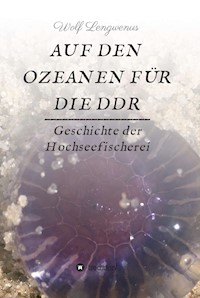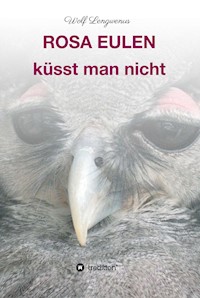
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Singende Affen, spielsüchtige Schweine, ein Kater, der Rache geschworen hat und schwule Elefanten im Liebesrausch. Das sind keine Fabelwesen sondern Tiere, denen der Biologe Wolf Lengwenus begegnet ist. Der Autor nimmt uns mit auf seine Reisen durch Wälder und Savannen, lädt uns ein in sein Gartenreich an der Elbe in Südmecklenburg und erzählt von den Abenteuern seiner Kindheit auf dem Land, als die Welt noch grenzenlos und die Natur unverletzlich schien. Humorvoll, informativ und immer mit einem Blick für das Skurrile schildert er Begegnungen mit schrägen Vögeln wie dem Brotrindenrabe, dem Rollschnabelkolibri und einer Dragqueen in New York. Ein autobiografisches Buch über die Liebe zur Natur zum schmökern, schmunzeln und staunen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
© 2021 Wolf Lengwenus
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Wolf Lengwenus
ROSA EULENKÜSST MAN NICHT
Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand.
Charles Darwin
Wolf Lengwenus
Diplom-Biologe, geboren 1956 in Kupfermühle bei Flensburg. Studium der Biologie mit Hauptfach Zoologie in Hamburg. Als TV-Autor realisierte er seit 1984 mehr als 300 Dokumentationen, Reportagen und Magazinbeiträge für den NDR und andere ARD-Anstalten. Er beschäftigte sich hauptsächlich mit naturwissenschaftlichen Themen und rezensierte von 1991 bis 1999 zahlreiche Publikationen für das Bücherjournal des NDR. Von1988 bis 2017 war er in verschiedenen Positionen für die ARD-Sendereihe „Expeditionen ins Tierreich“ tätig. 2001 bis 2017 zeichnete er außerdem als Redakteur für die NDR-Sendereihe „Länder Menschen Abenteuer“ verantwortlich. Heute ist er freier Autor.
Inhalt
In den Wäldern von Maine
Spielsüchtige Schweine
Bullerbü an der dänischen Grenze
Der fiese Brotrindenrabe
Mein Hamsterzirkus
Quallen für das DDR-Fernsehen
Die Hunde von La Palma
Rosa Eulen am Kilimandscharo
Verliebt in die Elbtalauen
Der Sensenmann
Abstand und Nähe
Der ungeliebte Hausgenosse
Mammutjäger in der Metro
Von Rollschnabelkolibris und Wadenstechern
Affenliebe in Appeldoorn
Die heimliche Weltmacht
Lothars Rache
Erdwölfe im Garten
Mordpläne im Paradies
Der hinterhältige Chiwawa
Mein Leben mit Löwen
Ehebruch im Dschungel
Zusatzinformationenzu Tieren und Pflanzen
In den Wäldern von Maine
Krisen gehören zum Leben. Auch wenn man erfolgreich ist und fast alles geschafft hat, was man sich in jungen Jahren vorgenommen hatte, kommt irgendwann der Tag, an dem man sich fragt, ob das schon alles gewesen ist. Man arbeitet vielleicht sogar in seinem Traumberuf, ist Arzt, Uniprofessor, Grafiker oder Journalist. Eigentlich ist alles in bester Ordnung, man hat eine Eigentumswohnung oder ein Haus, bekommt Anerkennung im Beruf, ist glücklich mit dem Partner. Aber irgendetwas stimmt nicht mehr. Der Grafiker hat das Gefühl sich nicht frei entfalten zu können, weil seine Auftraggeber zu konservativ sind. Der Anästhesist fühlt sich als Hilfsarbeiter und fragt sich, warum er nicht wie sein bester Freund Internist geworden ist und keine eigene Praxis aufgemacht hat. Der Uniprofessor hat soviel mit Lehre und Verwaltung zu tun, dass die Forschung viel zu kurz kommt. Und der Journalist spürt, dass er in einem Korsett eingeschnürt ist, weil Chefredakteur und Herausgeber immer nur auf die Auflage schielen und wichtige Themen nicht mehr richtig angepackt werden. Man traut sich mehr zu, doch weil man auch im kreativsten Beruf ein mehr oder minder großes Rädchen im Getriebe ist, hat sich im täglichen Ablauf Routine eingeschlichen. Man brennt noch, hat aber das Gefühl, dass man das Leben wieder mehr spüren, es neu ordnen muss. Aber wie?
Zur Ruhe kommen und über alles nachdenken, das ist der Wunsch vieler Vierzig- bis Fünfzigjähriger. Um das Leben wieder so richtig spüren zu können, muss man sein Leben entschleunigen und auf die innere Stimme hören.
Das ist schwerer als man denkt, denn sag einmal deinem Partner: „Schatz, ich muss einmal über alles in Ruhe nachdenken. Ich hab´ mir zwei Wochen Urlaub genommen und mir eine Hütte in den Alpen gemietet. Mein Handy nehm´ ich nicht mit, denn ich will in der ganzen Zeit nicht gestört werden.“ Nun, das Ende vom Lied wäre ein handfester Krach. Garantiert käme der Vorwurf, dass dies der Tiefpunkt der Beziehung sei. Es fließen Tränen, es wird mit Gegenständen geworfen, mit Trennung gedroht. Kurzum: Einmal richtig über alles nachzudenken ist verdammt schwierig, denn es braucht Zeit und man muss dafür möglichst allein sein.
Auch dem berühmten Zoologie-Professor und langjährigen Weltrekordhalter im 100 Kilometer-Lauf Bernd Heinrich erging es so. Bei seinen Studenten war er sehr beliebt, denn er hatte nicht nur ein unglaublich großes Wissen, man spürte bei seinen Vorträgen seine Begeisterung für die Natur. Selbst die kleinsten Details wusste er so gut zu präsentieren, dass es nie langweilig in den Vorlesungen wurde. Aber auch Bernd Heinrich geriet ins Getriebe. Da seine Vorlesungen und Seminare immer brechend voll waren, musste er Zusatzangebote machen. Dann trug ihm die University of Vermont als Anerkennung auch noch das Amt des Dekan an. Er war bald so sehr mit Verwaltungsarbeit eingedeckt, dass die Lehrveranstaltungen zum Selbstzweck wurden und er das Gefühl hatte, nur noch irgendetwas zu referieren. So kam es, dass er den Bezug zu dem, über das er redete, mehr und mehr verlor. Seine Vorträge kamen immer weniger aus seinem Herzen, wenn er über das Verhalten der Hummeln, den Vogelzug der nordamerikanischen Kolibris und die Wiederbewaldung Maines nach der Aufgabe Tausender von Farmen im 19. Jahrhundert sprach. Bernd Heinrich spürte bald, dass er sich immer mehr von dem entfernte, was er eigentlich wollte. Er wollte in der Natur sein, Feldforschung betreiben, Zusammenhänge begreifen, indem er jedes Detail in der Natur beobachtete und daraus seine Rückschlüsse zog. Er hatte alles erreicht, was er sich schon als Jugendlicher erträumt hatte. Doch Erfolg kann auch ein Fluch sein, denn es bedeutet, dass die Welt etwas von einem will, etwas, was man auf die Dauer vielleicht gar nicht zu geben bereit ist, weil es einen auslaugt und die Zeit zum Auftanken fehlt. „Ich hörte die Geräusche, aber die Musik hörte ich nicht mehr“, sagte Bernd Heinrich als er am Ende seiner mentalen Kräfte war.
Ich besuchte ihn zweimal in Maine. Er hatte sich mit seiner Frau tief im Wald eine einfache Blockhütte gebaut - ohne Strom- und Wasseranschluss. Das Grundstück, auf dem einst eine Farm stand, war schon vor hundert Jahren von seinen ehemaligen Besitzern verlassen worden. Es liegt im Westen von Maine am Rande des Mount Blue State Parks. Ganz in der Nähe war Bernd Heinrich aufgewachsen. Einen besseren Ort für einen abenteuerlustigen Jungen kann es nicht geben, denn dort sind die Wälder grenzenlos und es gibt keine Zäune, die Kinder einsperren. Bernd Heinrich spürte sofort ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit als er sich für zwei Forschungssemester mit seiner Frau in der Hütte einrichtete. Vielleicht hatten sich die beiden schon lange auseinandergelebt, es aber bislang nicht gemerkt. Sie funktionierten, aber durch den ewigen, anstrengenden Trott fehlte die Zeit für gemeinsame Erlebnisse und für notwendige Aussprachen. Beide spürten, dass ihre Liebe durch den Mühlstein des Alltäglichen zerrieben worden war. Sie hatten gehofft, in der Einsamkeit Maines wieder zusammenzufinden, längst verschüttete Gefühle neu zu beleben. Aber sie mussten feststellen, dass sie grundverschieden waren, so sehr sie sich auch viele Jahre geliebt hatten. Sie brauchte auch andere Gesellschaft als nur ihren Mann und fand keine Erfüllung darin, stundenlang das Verhalten der Tiere zu beobachten oder dem Gesang der Vögel zu lauschen. Auch an den romantischen Abenden am Lagerfeuer unter sternenklarem Himmel fand sie irgendwann keinen Gefallen mehr. Eines Tages stand ihr Entschluss fest, sie trennte sich von ihrem Mann und zog in die Zivilisation zurück. So sehr ihn die Trennung auch geschmerzt haben mag, Bernd Heinrich blühte wieder auf und spürte, dass seine verlorene Lebensfreude zurückkehrte. Er war grenzenlos neugierig auf die Welt, die ihn umgab. Stundenlang konnte er Hummeln, Käfer, Ameisen und andere Insekten beobachten, waren sie im Auge der meisten Betrachter auch noch so unscheinbar. Er führte Tagebuch und notierte selbst die kleinste Beobachtung in sein Notizblock. Abends in der Hütte zeichnete er dann detailgenau, was er am Tage gesehen hatte. Über seine Forschungsarbeiten schrieb Bernd Heinrich zahlreiche Bücher, manche erreichten in den USA so hohe Auflagen, dass sich auch ausländische Verlage für seine Werke interessierten. Die deutschen Rechte bekam der List-Verlag. Zwischen 1992 und 2003 erschienen dort sieben Bücher. Das erste hatte den Titel „Die Seele der Raben“, im Original „Ravens in Winter,“ das ich im Bücherjournal im ERSTEN Programm der ARD vorstellen durfte. Vier Jahre später besuchte ich den Autor noch einmal für einen Bericht über die deutsche Ausgabe von „A Year in the Maine Woods“ - „Ein Jahr in den Wäldern von Maine.“
Vor unserer Abreise rief mich Bernd Heinrich in Hamburg an: „Hi Wolf, läuft alles wie geplant, kommt ihr in zwei Wochen?“, fragte er. „Ja, klar“, erwiderte ich „Flüge und Mietwagen sind gebucht und es ist auch wieder Fritz dabei, alles wie vor vier Jahren.“ Wir hatten die ganze Zeit über lose Kontakt gehalten und einige Briefe gewechselt. Weil wir uns mochten, machte uns Bernd ein Angebot: „Ich hab´ den Weg zu meiner Hütte immer noch nicht befestigt, ihr müsst euer Equipment also einen ganzen Kilometer durch den Wald schleppen. Ich kenne euch Fernsehleute mittlerweile, ihr habt doch bestimmt wieder mehrere Zentner Gepäck dabei, die wollt ihr doch nicht wieder zweimal am Tag hin- und hertragen. Es wird vielleicht etwas eng, aber ihr könnt dieses Mal bei mir übernachten.“ Fritz, mein Freund und Kameramann, überschlug sich fast vor Freude als ich ihm von Bernd Heinrichs Vorschlag berichtete. Er liebte das Abenteuer und hatte zwei Jahre lang mit seiner Familie in einer Hütte in Ontario an der kanadischen Ostküste gelebt, einhundert Kilometer entfernt von der nächsten Einkaufsmöglichkeit in Fort Albany. „Ja, Wahnsinn!“, schrie er begeistert ins Telefon. „Endlich kommt mal wieder Leben in die Bude. Ich hab´ schon jahrelang keinen richtig klaren Sternenhimmel mehr gesehen. Selbst bei mir draußen in Stelle nicht, Hamburg mit seinen vielen Lichtern ist einfach zu nah. Ich freue mich wahnsinnig auf die Dreharbeiten.“ Ich informierte Bernd, dass wir sein Angebot annehmen und arbeitete sein Buch zur Vorbereitung noch einmal gründlich durch. An einem Kapitel biss ich mich fest. „WINTER-ÖKOLOGIE“:
Spielsüchtige Schweine
Wie weit zurück reicht eigentlich das Gedächtnis des Menschen? Große, emotionale Ereignisse bleiben lange im Gedächtnis: die Einschulung, der erste Kuss oder der erste Urlaub in der Fremde. An Erlebnisse aus der ganz frühen Kindheit erinnert sich fast niemand. Schon Säuglinge haben ein Kurzzeitgedächtnis. Sie erinnern sich zum Beispiel an das Gesicht ihrer Mutter. Aber ab wann ein Mensch in der Lage ist Erlebnisse langfristig abzuspeichern, darüber sind sich die Hirnforscher nicht ganz einig. Viele Neurowissenschaftler und Psychiater gehen davon aus, dass man sich frühestens bis zu einem Alter von zwei Jahren zurückerinnern kann. Eine wichtige Rolle für die langfristige Speicherung und den Abruf von Informationen aus dem Gedächtnis spielt der Hippocampus. Dieser Teil des Gehirns ist für die Weiterleitung von Erinnerungen aus dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis verantwortlich. Erst mit ungefähr zwei Jahren ist der Hippocampus ausgereift. Daher gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass sich Erwachsene an ihre ersten beiden Lebensjahre zurückerinnern können. Und es gibt noch zwei weitere Voraussetzungen, dass man sich erinnern kann: Der heranreifende Mensch braucht ein Verständnis für seine Identität. Erst dadurch kann das Kind Gedächtnisinhalte mit der eigenen Person verknüpfen. Auch die Sprache ist unverzichtbar für das autobiografische Gedächtnis. Das Kind lernt mit ihr zu abstrahieren und zu generalisieren und kann Sinneseindrücke zunehmend besser verarbeiten. Erlebnisse mit intensiven Sinneseindrücken prägen sich besonders gut ein.
Ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, als ich zweieinhalb Jahre alt gewesen bin. Meine Eltern waren mit mir nach Teichgut gefahren, in ein kleines Dorf in der Nähe von Gifhorn in Niedersachsen. Dort lebte die Cousine meines Vaters mit ihrer Familie auf einem Bauernhof. Die Erinnerung ist verschwommen, aber ich sehe eine sehr einfache Küche vor mir. Ein Mann nahm mich dort auf den Arm und ging mit mir auf eine Tür zu. Je näher wir ihr kamen, desto lauter wurden seltsam fremdartige Grunzgeräusche. Als wir das geheimnisvolle „Zimmer“ betraten, wurde das Grunzen und Quieken ohrenbetäubend, es roch unangenehm und in zahlreichen Boxen wuselten große, nackte Wesen herum. Ich hatte damals Todesangst, denn ich wusste nicht, was mich in dieser fremden Welt erwartete. Ich hielt mir die Ohren zu, schloss die Augen und wollte einfach nur zurück in die Geborgenheit. Erst sehr viel später habe ich begriffen, dass mein Großcousin mir nur seinen ganzen Stolz, seine Schweine, zeigen wollte. Für mich aber war der Ausflug eine schockierende Konfrontation mit dem Fremdartigen und dieses intensive Gefühl der Angst hat wohl dazu geführt, dass sich mein Erlebnis unvergesslich als Erinnerung in meinem Gehirn manifestierte. Im Alter von sechs Jahren hatte ich dann eine zweite, unangenehme Begegnung mit Schweinen. Mein Vater war mit mir auf einen Bauernhof nach Handewitt bei Flensburg gefahren. Dort wollten wir mit unserem R4 ein schon größeres Ferkel abholen.
Es sollte eine Weile bei uns leben und bis zur Schlachtreife mit Küchenabfällen gefüttert werden. Bauer Peter Petersen führte uns in seinen Schweinestall. In einer großen Bucht lagen mindestens zwanzig Ferkel, von den Sauen waren sie schon getrennt worden. „Na, dann such dir mal einen Spielkameraden aus“, forderte mich Herr Petersen auf und schwups setzte er mich in den Schweinekoben. Neugierig kamen die Ferkel eines nach dem anderen auf mich zu, bis ich von ihnen umringt war. „Greif zu!“, ermunterte mich mein Vater, doch ich traute mich nicht. Dann begannen die Ferkel mich zu schubsen und kniffen mich mit ihren Schnauzen in meine Gummistiefel. Herr Petersen wurde ungeduldig: „Du willst doch nicht zu denen gehören, die von den Schweinen gebissen werden, ran an den Feind!“, rief er. Endlich stieg mein Vater zu mir in die Bucht, schnappte sich entschlossen eines der Ferkel und sprach den kurzen, aber erlösenden Satz: „Komm Junge!“ Er war sauer, mir war nur nicht klar, ob auf mich oder auf seinen Freund Peter. Mein Vater setzte das kleine Schwein in unseren Kofferraum und ab ging es zurück nach Hause. Die Dunkelheit und das Geschaukel gefiel dem Ferkel gar nicht, es wollte heraus aus seinem Verlies und stieß immer wieder quiekend heftig gegen die Rückbank, die nicht richtig verankert war. Als „großer Junge“ war es meine Aufgabe, das Tier daran zu hindern zu uns ins Wageninnere vorzudringen. Ich atmete auf, als wir zuhause ankamen und ich von meinem schwierigen Job als Schweinehirt befreit war. Das Schwein lebte von nun an in unserem kleinen Stall und wurde unsere Bio-Mülltonne. Es bekam Kartoffelschalen, alles was beim Gemüse putzen übrig blieb, verschimmeltes Brot und die Abfälle aus unserem Garten. Als das Schwein größer wurde, reichten die Abfälle aus Haus und Garten nicht mehr, aber es gab meistens jemanden in der Umgebung, der organische Abfälle loswerden wollte: der Lebensmittelkaufmann, der Bäcker, der Restaurantbesitzer. Im Herbst war das Angebot an kostenlosem Schweinefutter besonders groß. Wenn unser Garten nicht genug hergab, fanden wir auf den Feldern Kartoffeln, die die Erntemaschinen nicht aufgenommen hatten und wir sammelten Kastanien und Eicheln. Ende des Jahres wog unser Schwein schon um die hundert Kilo.
Es schneite Riesenflocken als Schlachter Jepsen mit seinem Goliath-Kastenwagen über die gepflasterte Dorfstrasse zu uns geknattert kam. Meine Mutter schenkte ihm zur Begrüßung und zum Aufwärmen ein großes Glas Schnaps ein. Er trank es mit einem Schluck aus und sagte feierlich: „Des Schweines Ende ist der Wurst Anfang.“ Dann zog er sich in aller Seelenruhe seinen Kittel an und machte das Bolzenschussgerät klar. Alles sollte ohne Hektik geschehen, um das Schwein nicht unnötig zu stressen. Doch Schweine sind sensible Tiere und merken sofort, wenn etwas anders abläuft als gewöhnlich. Als mein Vater die Tür zum Schweinekoben öffnete, stürmte das Tier plötzlich grunzend aus dem Stall und lief am Schlachter vorbei direkt auf mich zu. Nur mit einem schnellen Sprung zur Seite konnte ich mich in Sicherheit bringen.
Es dauerte ein ganze Weile bis die Sau wieder eingefangen und der Schlachter endlich seine Arbeit verrichten konnte. Das Sterben unseres Schweines wollte ich mir nicht ansehen, deshalb verschwand ich in unser Haus. Dort hörte ich nur ein dumpfes Geräusch als das Bolzenschussgerät ausgelöst wurde. Ich ging erst wieder zum Schauplatz, als das Schwein mit heißem Wasser übergossen und die Borsten abgeschabt wurden. Dann kam der Fleischbeschauer und untersuchte die Lymphknoten und Innereien auf Trichinen. „Alles bestens“, verkündete er nach einer Weile. Damit war das Schwein zur Verarbeitung freigegeben. Zur Schlachtung unserer Sau waren auch die beiden Brüder meiner Mutter mit ihren Frauen angereist. Bis zum Abend hatte meine Familie gut zu tun bis das Schwein endlich portioniert, durch den Fleischwolf gedreht und in zahlreiche Würste gelangt war. Am nächsten Tag fand das Schlachtfest statt. Schon am Morgen hatte meine Großmutter einen großen Topf auf den Herd gestellt. Ich war neugierig, was sich darin befand. Als ich allein war, stellte ich mich an der Kochstelle auf einen Schemel, schnappte mir eine Suppenkelle und fischte in der roten Flüssigkeit herum. Mal angelte ich ein Ohr, dann eine Pfote, zuletzt die Schnauze unserer Sau, alles schwamm im Blut. Das also war Schwarzsauer, wie meine Oma die exotische Suppe nannte. Ich war entsetzt. Nein, das war ganz und gar nicht meine Sache, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich nicht zu dieser Familie passte. Sie kam mir zum ersten Mal in meinem Leben seltsam fremd vor.
Auf keinen Fall wollte ich es mir ansehen, wie meine Verwandten mit blutverschmierten Mündern auf Pfoten kauten und an Ohren knabberten. Ich lies die Suppenkelle fallen und lief zu meinem Freund Rolf, um mit ihm bis zum späten Nachmittag an unserem Baumhaus weiterzubauen. Zwar waren wir Dorfkinder an Hausschlachtungen gewöhnt, aber das Töten unseres eigenes Schweines, das ich schon als Ferkel kannte, war ein Wendepunkt in meinem Leben. Ich hatte zwar keine Beziehung zu dem Tier aufgebaut, weil ich ja von Anfang an wusste, wie die Sache enden würde. Aber ich fragte mich, ob es überhaupt notwendig ist Tiere zu essen. Als ich schreiben konnte, erstellte ich für meine Mutter eine Liste mit meinen fleischlosen Lieblingsgerichten: Kartoffeln mit Petersiliensoße, Kartoffelpfannkuchen und Spaghetti mit Tomatensauce zählten zu meinen Topfavoriten. Meine Großmutter mütterlicherseits war von meinen Rezeptvorschlägen gar nicht begeistert. „Der Mensch ist ein Allesfresser“, wollte sie mich aufklären. „Wenn man kein Eiweiß isst, wird man dumm und stirbt irgendwann. Und Eiweiß ist nun mal im Fleisch.“ Zugegeben, ein konsequenter Vegetarier wurde ich als Kind nicht. Vor allem mit Rinderrouladen und mildem, zartem Katenschinken konnte man mich bestechen. Und noch einen Effekt hatte unsere erste eigene Hausschlachtung: Ich war von meinem schlimmsten Albtraum befreit. Oft träumte ich, dass mich eine Rotte Schweine böse angrunzte und mich hin und her schubste. Ich versuchte wegzulaufen, aber es klappte nicht, so sehr ich mich auch bemühte.
Ein unsichtbares Gummiband hielt mich fest. Dieser böse Traum kehrte nie mehr wieder, vielleicht weil ich das Gefühl hatte, dass unserem Schwein Unrecht angetan wurde und ich ein Schuldgefühl ihm gegenüber hatte. Und so begann ich mich für Schweine zu interessieren.
Schweine zählen neben den Affen, den Hundeartigen und den Zahnwalen zu den intelligentesten Säugetieren. Man unterscheidet zwei Familien: Die Nabelschweine, die in Amerika leben, und die Altweltschweine, die über Europa, Afrika und Asien verbreitet sind. Zwanzig Arten gibt es. In Europa lebt nur eine Art, das Wildschwein. Von ihm stammen alle Rassen des Hausschweins ab. Obwohl wir schon 9000 Jahre lang mit diesem Nutztier leben, war über sein Verhalten lange Zeit nur sehr wenig bekannt. Vor allem Professor Dr. Stanley Curtis von der University of Illinois ist es zu verdanken, dass wir heute viel mehr über das Wesen der Schweine wissen. In der Fachwelt berühmt wurden Hamlet und Omelett, denen er Videospiele beibrachte. Natürlich musste der Computer erst einmal schweinegerecht umgebaut werden. Da die Tiere den Joystick mit der Schnauze bedienten, durfte er nicht aus leicht zerbeißbarem Material sein. Statt eines Plastikknaufs hatte der Stick einen Stahlknauf von der Gangschaltung eines Traktors, das erleichterte es den Tieren den Computer zu bedienen. „Als ich Hamlet und Omelett das erste Mal spielen sah, fiel mir fast die Kinnlade herunter“, erzählte Candace Croney, die Assistentin von Professor Curtis. Die Schweine benutzten den Joystick wie Teenager und erfüllten innerhalb kürzester Zeit ihre Aufgabe. Dafür belohnte Stanley Curtis sie mit Leckereien. Die Schweine mussten verschiedene Symbole erkennen und mit dem Joystick zueinander schieben. Löste ein Schwein die Aufgabe richtig, klingelte eine Glocke und teilte ihm so mit, dass es eine Belohnung bekommt. Dann fiel etwas Köstliches in den Trog des Spielers. Der Testaufbau ist übrigens ähnlich wie bei Intelligenzmessungen an Kindern. Hamlet und Omelett wurden mit der Zeit immer schneller, schnauften und grunzten vor Aufregung, wenn sie den Joystick bedienten. Stundenlang spielten sie ihre Videogames ohne zu ermüden. Mit dem Joystick im Maul manövrierten sie den Cursor äußerst geschickt durch sich verändernde Muster auf ihrem Computerbildschirm. Dabei schaufelten sie so viele Leckereien wie möglich in sich hinein. Nach einiger Zeit zeigten Hamlet und Omelett Entzugserscheinungen, wenn sie nicht spielen konnten. Sie lungerten dann am ausgeschalteten Computer herum, waren übellaunig und es gab nichts womit man sie hätte aufmuntern können. Die Geschwister Hamlet und Omelett haben die Verhaltensforschung revolutioniert und gezeigt, dass Schweine nicht dümmer sind als unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen. Jeder muss selbst entscheiden, ob solch hochentwickelte Lebewesen als Braten, Kotelett, Wurst oder Schinken auf den Teller gehören.
Bullerbü an der dänischen Grenze
Durch unser Dorf Kupfermühle floss die Krusau (dänisch Krusaa), die im Mühlenteich des gleichnamigen Ortes auf der dänischen Seite entsprang. In dem kleinen Fluss fing ich mit meinem besten Freund Rolf mit Begeisterung Dreistachelige Stichlinge7. Wenn es darum ging Tiere zu beobachten, war Rolf immer dabei. Bisher hatten wir die kleinen Fische nur in großen Gurkengläsern betrachtet. Nun wollten wir ein Aquarium so einrichten, dass wir die Balz des Männchens, die Eiablage des Weibchens und das Schlüpfen der Jungen beobachten konnten. Dazu brauchten wir aber dringend die entsprechende Literatur. Heute benötigt man oft nur wenige Minuten bis man die gesuchten Informationen über das Internet zusammengetragen hat. Damals, in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, dauerte es mehrere Wochen bis wir über den Bücherbus eine Broschüre über das Verhalten des Dreistacheligen Stichlings aufgetrieben hatten. Rolf wohnte mit seiner Familie in der Volksschule von Kupfermühle, sein Vater war der Rektor. Der etwa dreihundert Quadratmeter große Dachboden des 1908 gebauten Backsteinhauses war ein wichtiger Teil unseres riesigen Abenteuerspielplatzes. Er reichte vom Badestrand in Wassersleben an der Flensburger Förde bis über die dänische Grenze hinaus. Weite Schilfflächen, ein Fluss, Moore und Seen und zwei Wälder, das Klueser Gehölz und der Kollunder Wald in Dänemark, lagen in unserem Revier. Auf dem Dachboden bauten wir das Aquarium auf. Rolfs größerer Bruder Peter, der seit Jahren Guppys und Black Mollys züchtete, hatte es uns überlassen. Er riet uns davon ab, Leitungswasser zu nehmen und so schleppten wir das Flusswasser eimerweise aus der Krusau. Sechs Mal rannten wir hinunter zur Au und wuchteten die schweren Eimer auf den Dachboden, doch das Aquarium war danach immer noch nicht voll. Mir reichte es: „Schluss jetzt!“, den Rest nehmen wir aus der Leitung, das ist reinstes Quellwasser, so empfindlich werden die Stichlinge schon nicht sein.“ Rolf sah das genauso, er äußerte außerdem den Verdacht, dass sein größerer Bruder uns auf den Arm genommen hatte und Stichlinge gar nicht so wählerisch seien. Beweisen konnte er das nicht, denn in unserem Buch stand nichts über die Befüllung des Stichlingaquariums mit Wasser. Auch wenn Rolf recht hatte mit seiner Vermutung, konnten wir Peter nicht böse sein, denn er hatte unser Projekt sehr unterstützt und uns sogar Aquarienkies und genug Hornkraut und Wasserpest für die Bepflanzung bereitgestellt. Die Pflanzen setzen wir sehr dicht in den hinteren Raum des Beckens, wo die Fische sich verstecken konnten. Den Vordergrund des Aquariums hielten wir frei, damit wir das Verhalten der Tiere gut beobachten konnten. Einige Tage mussten sich nun die Schwebstoffe im Aquarium absetzen, dann begann der spannendste Teil unseres Projektes. Vier Tage später, gleich nach dem Frühstück, bewaffneten wir uns mit zwei Keschern, nahmen unsere beiden Eimer mit und zogen aufgeregt zum Fluss. Wir waren so im Jagdfieber, dass wir schon nach einer Stunde neunzehn Tiere gefangen hatten. Langsam dämmerte es uns, dass wir so viele Stichlinge in unserem 80 Liter-Becken gar nicht unterbringen konnten. Wir hatten nämlich gelesen, dass es unter den Männchen zu heftigen Raufereien und sogar zu Verletzungen bei den Kämpfen kommt, wenn sie auf zu engem Raum leben müssen. Wir betrachteten unsere Stichlinge genauer. Einige Fische hatten Verletzungen, die setzten wir gleich zurück in den Fluss. Es war nicht so einfach, das Geschlecht der Fische zu erkennen, denn das Balzkleid der Männchen hatte sich noch nicht voll ausgebildet. Schließlich glaubten wir drei männliche Fische identifiziert zu haben. Einer hatte ein hellblaues Auge, zwei andere zeigten schon eine leichte Rotfärbung ihrer Bäuche. Wir waren so in unsere Arbeit vertieft, dass wir gar nicht bemerkt hatten, dass wir beobachtet wurden. „Habe die Ehre Professor Grzimek, moin Dr. Dolittle, sagt mal findet ihr das nicht albern so kleine Fische zu fangen“, stichelte Jan. Wir erklärten unserem Schulkameraden, was wir geplant hatten. „Lächerlich“, sagte er, „das Beobachten von Fischen, die man nicht essen kann, ist reine Zeitverschwendung. Kommt doch mit zum Angeln“, lockte er uns. „Die Barsche beißen zur Zeit ganz gut, und ich hab´ gestern auch zwei Aale geangelt. Was wir fangen, werfen wir heute Abend auf den Grill, hab´ auch noch eine große Flasche Cola.“ Als Jan merkte, dass er uns nicht zum Angeln überreden konnte, versuchte er einen Keil zwischen mich und Rolf zu treiben: „Überlass die Spinnerei man August Kuhbrot, bei dem ist doch sowieso eine Schraube locker.“ „Der ist so doof, wie der lang ist“, flüsterte ich Rolf zu. Gegen meinen Spitznamen setzte ich mich schon lange nicht mehr zur Wehr, weil keiner der anderen Jungen den Namen für mich passend fand. Jan nannte mich aber seit einem Jahr beharrlich so, nachdem er mich dabei beobachtet hatte, wie ich am Dorfrand Kühe mit trockenem Brot füttern wollte, was die Rinder allerdings verschmähten. „Die mögen dein verschimmeltes Brot nicht, das sind keine Pferde. Setz mal deine Brille auf! Hast du schon mal Pferde mit Hörnern gesehen?“, raunzte mich Jan damals an. „Ja, hab´ ich“, konterte ich wütend. „Hast du etwa noch keine Einhörner gesehen. Das hier ist eine Mutation mit zwei Hörnern.“ Eine bessere Antwort fiel mir nicht ein. Ich wollte Jan auf keinen Fall die Wahrheit sagen, damit er mich nicht verpetzen konnte. Ich fütterte die Kühe nämlich nicht, weil ich sie besonders mochte, sondern weil ich das Brot verschwinden lassen wollte. Ich hatte es aus der großen Kumme meiner Großmutter gestohlen. In dem Steingutgefäß sammelte sie Brotreste, um daraus - wenn genug zusammen gekommen war - einen Brotkuchen zu backen. Ich hasste diese süße, glibberige, gelbgraue Masse und wollte den Kuchen nicht so oft auf meinem Teller sehen. Deshalb nahm ich ab und zu ein paar Brotreste aus der Kumme, immer nur so viel, dass meine Großmutter den Diebstahl nicht bemerkte. „Na, dann beobachtet man eure Zwergfische, vielleicht bringt ihr ihnen ja ein paar Kunststücke bei, dann könnt ihr im Zirkus auftreten“, verabschiedete sich Jan spöttisch. Wir ließen uns nicht beirren, trugen unseren Fang zum Aquarium und setzten Fisch für Fisch vorsichtig ins Wasser. Die Stichlinge versteckten sich blitzschnell in der dichten Bepflanzung.
„Wir waren schon lange nicht mehr auf unserer schwimmenden Insel, wir können dort auch gleich Futter für die Tiere fangen“, schlug Rolf vor. „Wollen wir mal nachsehen, ob alles in Ordnung ist?“ „Klasse Idee“, ich war begeistert. „Muss nur noch meine Gummistiefel holen, wir treffen uns am Konsum, sagen wir in einer Viertel Stunde. Ich nehm´ schon mal den Kescher mit, such´ du mal zwei kleine Gläser ´raus mit gut verschließbaren Deckeln, bis gleich.“ Der Konsum lag genau an der Grenze zu Altkupfermühle. In diesem Teil des Dorfes kannten wir uns nicht so gut aus, denn dort wohnten hauptsächlich die dänischen Familien. Die meisten Kinder kannten wir nur vom Sehen, Kontakt zu Ihnen hatten wir nur wenig, denn so klein das Dorf auch war, es gab zwei Schulen: eine deutsche Volksschule im Zentrum und eine dänische Grundschule am Ortsrand, die Kobbermölle Danske Skole. Die schwimmende Insel war ein mystischer Ort für uns Kinder. Keinem Erwachsenem hatten wir je von dieser anderen Welt erzählt. Es war nicht einfach dort hinzukommen, denn das geheimnisvolle Eiland am äußersten Ende unseres Dorfes wurde von bösen Wächtern beschützt. Mit klopfendem Herzen machten wir uns auf den Weg. Er führte an einem Graben entlang, der sehr viel Wasser führte und an dessen Rand neben Schwanenblumen8, Igelkolben9, Schwertlilien10 und Sumpfdotterblumen11 auch Rohrkolben12 wuchsen, die wir Pompesel oder Bambus nannten. Dessen Blütenstände rauchten wir im Herbst als Mutprobe wie Zigarren. Keiner von uns Jungs hat aber je mehr als drei Züge geschafft, weil der beißende Rauch die Nasen- und Mundschleimhäute verätzte und in den Augen einen stechenden Schmerz erzeugte. Plötzlich, keine drei Meter vor uns, explodierte es. Wir zuckten kurz zusammen, doch wir kannten das schon. Zwei Rebhühner13