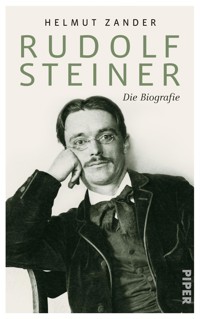
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Man kann Schüler auf der Waldorfschule sein, ohne an Reinkarnation zu glauben. Man kann Demeter-Erdbeeren aus biodynamischer Landwirtschaft schmackhaft finden, ohne auf der Zunge kosmische Kräfte zu spüren. Man kann die vielen Praxisfelder der Anthroposophie nutzen, aber man wird ihren Herzschlag nicht verstehen, wenn man nicht ihren Vater und Ideengeber kennt: Rudolf Steiner (1861–1925), das Kind aus einem Krähwinkel des Habsburgerreiches, der einer der großen Esoteriker des 20. Jahrhunderts wurde. Helmut Zander schreibt die kritische Biografie des kantigen Querdenkers, der seiner unangepassten Grundsätze wegen bis heute Gläubige fasziniert und Gegner provoziert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-95303-0
Dezember 2016
© Piper Verlag GmbH, München 2011
Umschlaggestaltung: Niko Dzoidos, München
Umschlagmotiv: © Ullstein Bild/Skibbe
Datenkonvertierung E-Book: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Anfänge
EINS
Kindheit. Kleinbürgerliche Kindheit mit großem Vater
Geist und Materie
Halbwahr scheint der Satz, mit dem Rudolf Steiner 1923 in seiner Autobiografie Mein Lebensgang von sich zu erzählen beginnt: »In Kraljevec bin ich am 27. Februar 1861 geboren.« Der Ort stimmt, Steiner hat das Licht der Welt im kroatischen, damals zu Ungarn gehörigen Örtchen Kraljevec erblickt, in einem Zimmer der Bahnstation. Aber noch in einer wohl wenige Jahre älteren Lebensskizze hatte Steiner festgehalten: »Meine Geburt fällt auf den 25. Februar 1861.«1 Einmal, nur dieses eine Mal, wie bei einem Freudschen Versprecher, verlegt Steiner seinen Geburtstag zwei Tage vor. Die Differenz ist minimal und könnte als Versehen durchgehen, ließe sich dahinter nicht ein Programm lesen. Die Lücke von zwei Tagen ist ein Schlüssel zu Steiners Autobiografie, ja zu seinem ganzen Leben. Denn der 27. Februar ist Steiners Tauftag. Das wahre Leben, so kann man Steiners Credo lesen, beginnt nicht mit der biologischen Geburt, sondern mit der Taufe, die den Menschen zu einem geistigen Wesen mache. Diese Differenz zwischen, wie er später sagen wird, exoterischer und esoterischer Existenz war die Grundspannung seines Lebens. Er hat dieses Drama, das unter dem Titel »Materialismus« versus »Idealismus« das 19. Jahrhundert in unversöhnliche Weltanschauungslager spalten konnte, in allen Höhen und Tiefen durchlitten. Allerdings war er als Anthroposoph felsenfest davon überzeugt, dass die geistige Welt die Wahrheit sei.
Daher ist seine Autobiografie auch nicht einfach die Chronologie seines »Lebensganges«, wie er sie nennt. Vielmehr hat er den Jahresringen eine große Erzählung unterlegt, das Narrativ vom Sieg des Geistes über die Materie, vom Sieg des frommen Theosophen Steiner, der er seit 1902 war, über den gottlosen Nietzscheaner gleichen Namens aus den letzten Jahren vor 1900. Steiners versehentliche Verlegung seines Geburtstags ist ein erster Hinweis auf dieses geheime Skript.
Bei einem genauen Blick auf die Quellen wird die Sache jedoch komplizierter.2 Vielleicht war er irritiert gewesen, dass die Taufe nicht, wie üblich, zwei Tage nach der Geburt stattgefunden haben sollte. Aber es war eine schwere Geburt gewesen, die sich vom 26. Februar an hingezogen hatte, und die Eltern hatten den kleinen Rudolf am 27. Februar notgetauft, weil sie um sein Leben fürchteten. Wie auch immer: Man muss Steiners Lebenstableau mit einer Schere im Kopf lesen und die historische von der erinnerten Wahrheit trennen. Insoweit hat Steiners Biografie – wie jeder Lebensrückblick – zwei »halbe« Wahrheiten, eine persönliche und eine faktische.
»Ganz« wird die Wahrheit nicht werden. Für weite Teile von Steiners Kindheit und Jugend sind nur seine Aussagen verfügbar. Was wir über diese Zeit nicht durch ihn selbst wissen, wissen wir, von wenigen Splittern abgesehen, überhaupt nicht. Wir besitzen nur die Fragmente, die Steiner uns zugebilligt hat, als er seinen »Lebensgang« zwischen 1923 und 1925 in der anthroposophischen Hauszeitschrift Goetheanum Woche für Woche ausbreitete. Er hatte später noch ein persönliches Journal schreiben wollen, aber da der Tod dem fiebergepeinigten Körper die Feder aus der Hand nahm, ist es bei einer Autobiografie geblieben, die für die öffentliche Wahrheit zuständig war. Aus dieser Abhängigkeit hat uns Steiner allerdings selbst ein wenig herausgeholfen. Denn er hat nach 1900 immer wieder biografische Bemerkungen in seine Vorträge eingestreut und Lebensskizzen verfasst.3 Sie ermöglichen es manchmal, den späten Steiner mit den Augen des frühen zu lesen.
Der Vater
Die Statistik ist unbestechlich: In den beiden ersten Kapiteln seiner Autobiografie, die Kindheit und Jugend behandeln, kommt Steiner achtmal auf seine Mutter zu sprechen, der Vater dagegen bringt es auf sechsunddreißig Nennungen. Zweifelsohne war Vater Johann die dominierende Gestalt in der familiären Hierarchie. Er kam aus dem niederösterreichischen Waldviertel, war in seiner Jugend Diener bei den Mönchen des niederösterreichischen Prämonstratenserstifts Geras und Jäger bei dem Grafen Hoyos gewesen und hatte, wie sein Vater, Förster werden wollen. Weil aber der Graf die Heirat Johann Steiners mit seiner geliebten Franziska Blie verbot, verließ Rudolfs Vater die agrarische Welt seiner Herkunft und ging als Telegrafist zur Südbahn – und hat es zu etwas gebracht. Hier war er weder ein abhängiger Landarbeiter noch der Proletarier eines Industriebetriebs. In Kraljevec war Johann Steiner stolzer Angestellter an der kleinen Bahnstation, gelegen an einer Linie der Südbahn-Aktiengesellschaft, die Budapest mit der adriatischen Hafenstadt Rijeka verband. Hier wachte er über den Zugang der Menschen zum Bahnsteig, er sorgte für die korrekte Weichenstellung, und als Telegrafist war er das lokale Kommunikationsrelais, denn neben den Schienen verliefen die Drähte, die die Morsezeichen durch die Welt schickten.
Dieser Migration verdankte Steiner seine Geburt in Kraljevec. Aber diesen Ort betrachtete er zeitlebens als fremde Erde. Er »stamme« vielmehr aus Horn in Niederösterreich. Aus dieser Gegend kommen jedoch nur seine Eltern, Steiner selbst hat nie in diesem »Stammgebiet« gelebt. Die häuslichen Verhältnisse werden, wenn nicht arm, so doch bescheiden gewesen sein. Rudolf war stolz, wenn er den Abendbrottisch, auf dem üblicherweise nur ein Butterbrot oder höchstens einmal ein Käsebrot lag, mit selbst gepflückten Beeren bereichern konnte. Der Preis dieses kleinen Wohlstands war für den Vater hoch gewesen: Seine Heimat hatte er verlassen, Eltern und Verwandte lebten in weiter Ferne, nur seine Frau hatte er aus dem Land seiner Kindheit mitgenommen. Zudem war der Stationsdienst kein Zuckerschlecken. Drei Tage und drei Nächte hintereinander schob er Dienst, gefolgt von einer Pause von vierundzwanzig Stunden. Aber diese Welt der Technik war das väterliche Reich, das den jungen Rudolf faszinierte und wichtige Strukturen seines Weltbilds bis zu seinem Tod prägte.
Die Mutter spielte Steiners Erinnerungen zufolge in dieser Welt nur eine Assistentenrolle, obwohl sie die Hauptlast der häuslichen Sorge trug. Sie schenkte nach »Rudl«, wie sie ihren Ältesten nannte4, noch zwei Geschwistern das Leben: der Schwester Leopoldine, die dreieinhalb Jahre jünger war, und dem Bruder Gustav, der sehr bald, acht Monate nach der Schwester, zur Welt kam und das Sorgenkind der Familie wurde, weil er taubstumm war. Die Nachrichten über die Mutter sind so karg, dass sie nicht über ein paar Druckzeilen hinausgehen: Sie führte den Haushalt, sie strickte und häkelte, sie kümmerte sich »liebevoll« um die Kinder – und das war es schon, was Steiner über sie in seiner Autobiografie preisgibt. Was nicht heißt, dass das Verhältnis zwischen beiden gespannt war. Als erwachsener Mann hat er die Rolle des Vaters, der 1910 starb, übernommen und sich fürsorglich um seine Mutter und seine Geschwister, insbesondere um seinen behinderten Bruder, gekümmert.
Der Vater also und sein Erstgeborener, das war die Konstellation, die die ersten achtzehn Lebensjahre Steiners prägte, bis er das elterliche Haus verließ, um in Wien zu studieren. Dieser Patriarch, der »leidenschaftlich aufbrausen« konnte, wenn er in Rage geriet, erzog seinen Filius liebevoll und autoritär. Als beispielsweise der sechsjährige Rudolf in der Schule zu Unrecht beschuldigt wurde, die Tintenfässer in den Schulbänken mit Kreisen aus Tintenklecksen dekoriert zu haben, »kündigte« der Vater dem Lehrerehepaar die »Freundschaft« und unterrichtete fortan seinen Sohn selbst. Zwei, drei Jahre lang war der Vater auch der Lehrer und Rudolf Schüler in seinem Dienstraum. Was dort geschah, hört sich im gestelzten Stil von Steiners später Lebensrückschau so an: »Ich konnte … bei ihm kein rechtes Interesse zu dem fassen, was durch den Unterricht an mich herankommen sollte.« Leuchtende Augen meint man hingegen noch im Gesicht des sechzigjährigen Steiner zu sehen, wenn er über die Bahntechnik schreibt, über die Schienen, die sich in den Bergen verlieren, und die Drähte, die die Bahn mit der Welt verkabelten. Ihn fesselten der Eisenbahndienst, die Technik, das Leben auf der Station, aber nicht der Schulstoff. Dabei hat Rudolf offenbar gut lesen, aber nur miserabel schreiben gelernt. Für die Bewältigung seiner Rechtschreibschwäche brauchte er Jahre.
Leiter einer Bahnstation zu sein bedeutete für Johann Steiner, immer wieder umzuziehen. In Kraljevec, der ersten Station, blieb man nur anderthalb Jahre, vielleicht weil der deutschnational orientierte Vater aus dem kroatischen Umfeld wegwollte. Dann zog man im Zickzack durch das Wiener Becken, für ein knappes Jahr nach Mödling, das heute am Südrand Wiens liegt, bis man Anfang 1863 nach Pottschach kam, wo der gerade zweijährige Steiner die Zeit bis zu seinem achten Lebensjahr verbrachte. Dann ging es im August 1869 nach Neudörfl auf der ungarischen Seite des Flüsschens Leitha. Von hier aus besuchte Steiner die Schule im deutschsprachigen Westen, in Wiener Neustadt. Die letzten Jahre im Elternhaus verlebte er ab 1879 in Inzersdorf, wieder vor den Toren Wiens, wohin sich der Vater hatte versetzen lassen, um dem Sohn das Studium, zu dem er ihn bestimmt hatte, von zu Hause aus zu ermöglichen. Johann Steiner blieb, bis er seinen Sohn in die Metropole Wien entließ, ein starker, ein autoritärer Vater. Fragt man sich, wo die Wurzeln von Rudolf Steiners autoritärem Anspruch auf Wissen und höchste Einsicht liegen, der sich wie ein Fluidum, manchmal unmerklich, manchmal atemraubend durch das Werk des späteren Anthroposophen zieht, kommt man an dem Übervater, welcher der Bahnwärter Johann Steiner auch war, nicht vorbei.
Technik
Aber was heißt hier Bahnwärter? Was in unseren Ohren nach Nachtwächter klingt, war am Ende des 19. Jahrhunderts die Schaltstelle einer Hightech-Welt. Die Eisenbahn war Motor der Industrialisierung, sie erschloss abgelegene Gebiete, und vor allem war sie für die Zeitgenossen ein Faszinosum. Die Semmeringbahn, an die sein Vater in Pottschach kam, wo Rudolf sechs Jahre seines Lebens verbrachte und der Vater zum Stationsvorsteher aufgestiegen war, gehörte zu den technischen Wundern des 19. Jahrhunderts. Der Ingenieur Carl Ritter von Ghega hatte diese erste Hochgebirgseisenbahn der Welt, die die Alpen querte und Wien mit dem Seehafen Triest verband, um die Abhängigkeit von Genua zu mindern, fertiggestellt. Die Technikbegeisterten sahen nie zuvor realisierte Brücken und Tunnel, hinter denen neue Dimensionen der mathematischen Berechnung von Streckenführungen standen, und staunten über Lokomotiven, die entgegen der damals herrschenden Lehre starke Neigungen ohne Seilebenen, selbst bei Eis und Schnee, bewältigten. Damit fuhr Wiens bessere Gesellschaft am Wochenende in die Projektion einer unberührten Natur, während sie sich an der technischen Unterwerfung der Natur durch atemberaubende Viadukte und Tunnel berauschte. Die »Hofratszüge« entließen die Wiener Hautevolee in die Zuckerbäckerwelt historisierender Villen mit gotisierenden Türmchen und griechischen Säulenportiken oder auf die den »Heimatstil« beschwörenden Holzbalkone des Semmeringer Kurhauses. 1999 verneigte sich die Welt vor dieser Kulturlandschaft, als sie die Semmering-Strecke als erste Eisenbahn in das Weltkulturerbe aufnahm.
An ihrer kleinen Station in Pottschach verfiel der junge Rudolf der Faszination der Technik. Er beobachtete, wie »der Schullehrer, der Pfarrer, der Rechnungsführer des Gutshofes, oft der Bürgermeister erschienen«, um die einfahrenden Züge zu bestaunen, und er saß stunden- und tagelang in der »Kanzlei« seines Vaters. In einer sehr persönlichen Impression hat der zweiundsechzigjährige Steiner diese Verzauberung seines Lebens durch Technik offengelegt:
»Ich glaube, daß es für mein Leben bedeutsam war, in einer solchen Umgebung die Kindheit verlebt zu haben. Denn meine Interessen wurden stark in das Mechanische dieses Daseins hineingezogen. Und ich weiß, wie diese Interessen den Herzensanteil in der kindlichen Seele immer wieder verdunkeln wollten, der nach der anmutigen und zugleich großzügigen Natur hin ging, in die hinein in der Ferne diese dem Mechanismus unterworfenen Eisenbahnzüge doch jedesmal verschwanden.«
Der Kampf zwischen Technik und Natur, von dem Steiner hier berichtet, dürfte in den Kinderjahren zugunsten der »Mechanik« ausgegangen sein. Aber im Worthaushalt des späteren Anthroposophen und in dieser Textpassage liegt »das Mechanische« nahe bei dem Geistlosen, und deshalb erscheint die Technik als »Verdunklung« der Seele.
Doch in Steiners Erinnerung erklingt auch die Hintergrundmusik einer anderen Welt. Er berichtet von der Natur, die unmittelbar neben den Schienen begann. Im Gemeindewald von Neudörfl sammelte er Holz, in den umliegenden Fluren wanderte er mit seinen Eltern oder allein zu einer Kapelle, die der heiligen Rosalie geweiht war, hier schöpfte er Quellwasser und sammelte Beeren. Als alter Herr beharrte er deshalb darauf, schon früh ein Kind zweier Welten gewesen zu sein.
Schule
1869, als Rudolf acht Jahre alt war und der Vater sich nach Neudörfl hatte versetzen lassen, kam Steiner auf die dortige Dorfschule. Hier wurde noch generationenübergreifend unterrichtet, wodurch, so beklagt sich Steiner im Rückblick, keine Altersklasse zu ihrem Recht komme und Langeweile herrsche. Als Gründer der Waldorfschule wird Steiner 1919 – auch deshalb? – eine strikt altersgetrennte Erziehung dogmatisieren. Er war allerdings ein so guter Schüler, dass er drei Jahre später völlig ohne Probleme die Aufnahmeprüfung in die »Bürgerschule« von Wiener Neustadt bestand. Daraufhin witterte der Vater die Chance, seinen Sohn eine Stufe im Bildungsaufstieg überspringen zu lassen, und schickte ihn zur Aufnahmeprüfung auf die Realschule – und Rudolf schaffte es. Er schlüpfte nicht so »glänzend« durch dieses Nadelöhr wie in die Bürgerschule, aber geschafft war geschafft. Der Vater sah den Sohn dem väterlichen Traumberuf – Eisenbahningenieur!? – ein Stück näher. Und Rudolf, das kluge Köpfchen, wurde ein sehr guter Schüler. Das Zentrum seiner Lernwelt blieben, schon durch die Ausrichtung der Realschule, die »exakten« Fächer. Steiner erzählt viel von Mathematik und Physik, aber kaum etwas vom Geschichts- oder Deutschunterricht. Und insbesondere wenn seine Tonlage emotional wird, spürt man, wo sein Herz schlug: »Ich weiß, dass ich an der Geometrie das Glück zuerst kennengelernt habe.«
Allerdings, so erinnerte sich Steiner 1913 – nun schon Anthroposoph –, habe er bereits als Dreizehn- oder Vierzehnjähriger nach Wegen aus dem stahlharten Gehäuse des technischen Wissens gesucht. Begonnen habe alles mit einem Blick in die Auslage einer Buchhandlung in Wiener Neustadt, wo er im Schaufenster Kants Kritik der reinen Vernunft in einer Reclam-Ausgabe erblickte. Steiner beschloss, sich auf die Schultern dieses Heroen zu setzen und, so die abgeklärte Diktion der 1920er-Jahre, »zu verstehen, was menschliche Vernunft für einen wirklichen Einblick in das Wesen der Dinge zu leisten vermag«. Der Pennäler ergriff damit die Chance, die die neue Medienwelt im ausgehenden 19. Jahrhundert bot. Denn Reclam revolutionierte eine Gesellschaft, in der immer mehr Menschen lesen konnten, durch seine »Universal-Bibliothek«, in der seit 1867 wohlfeile Heftchen mit Klassikern der Weltliteratur und Philosophiegeschichte einen Massenmarkt eroberten. Aber Steiner hatte nicht wirklich Zeit zum Lesen, denn drei Stunden am Tag stahl ihm der fünf Kilometer lange Schulweg von Neudörfl nach Wiener Neustadt und zurück, wo dann Berge von Hausaufgaben auf ihn warteten. Doch der clevere Junge fand einen Weg zu Kant, indem er die Schule überlistete. Dort herrschte, so Steiner im Rückblick, große Langeweile, weil der Geschichtslehrer das Vorlesen des Lernstoffs aus einem Buch mit Unterricht verwechselte. Daraufhin habe er seine Erziehung selbst in die Hand genommen: »Ich trennte nun die einzelnen Bogen des Kantbüchleins auseinander, heftete sie in das Geschichtsbuch ein, das ich in der Unterrichtsstunde vor mir liegen hatte, und las nun Kant, während vom Katheder herunter die Geschichte ›gelehrt‹ wurde. … In den Ferienzeiten wurde die Kantlektüre eifrig fortgesetzt. Ich las wohl manche Seite mehr als zwanzigmal hintereinander.«
Steiner hat diese Geschichte mehrfach erzählt, es besteht kein Grund, ihren wahren Kern in Abrede zu stellen. Was aber hat diese Lektüre mit dem jungen Steiner gemacht? Wir wissen nicht, wie viel er begriffen hat, aber naheliegend – so kann man aus seinen überlieferten Reaktionen schließen – ist die Vermutung, dass er gedacht hat: Wir erkennen von einem Gegenstand, von dem »Ding«, nur das, was unsere Sinnesorgane uns vermitteln. Und wir sehen das »Ding« nur auf diejenige Art und Weise, wie es unsere Augen möglich machen. Mithin ist der Gegenstand »an sich«, das »Ding an sich«, unzugänglich. So könnte Steiners Einsicht in den Fußstapfen Kants gelautet haben. Die Konsequenzen haben bei vielen Kant-Lesern des 19. Jahrhunderts ein erkenntnistheoretisches Erdbeben ausgelöst. Der Glaube der idealistischen Philosophie, man könne das »Wesen« der Dinge erkennen, brach vielerorts zusammen. Dabei war die Einsicht eigentlich nichts Neues, dass jeder Mensch nach den Bedingungen seiner Erkenntnismöglichkeiten begreife, sie findet sich schon in der mittelalterlichen Scholastik, etwa bei Thomas von Aquin. Und heute leben wir ganz unaufgeregt mit dem Wissen, dass es keine Erkenntnis jenseits von Biologie und Kultur gibt. Aber sowohl für die rationalistischen Erkenntnistheorien der Aufklärung, für die die Welt so erkennbar war wie für den Mechaniker ein Uhrwerk, als auch für deren idealistische Schwestertheorien des 19. Jahrhunderts, denen Ideen so sichtbar schienen wie die Wolken am Himmel, war Kants Reflexion auf die Grenzen des Erkennens – mit der er nur Platz für eine verlässliche Metaphysik hatte schaffen wollen – ein destruktiver Schock.
Das galt auch für Steiner. Sein Bericht über die Kant-Lektüre deutet darauf hin, dass auch er dessen Philosophie als eine Zerstörerin der Erkenntnis des »Wesens« der Dinge gelesen hat. Mitten in den Erzählungen über seinen Kampf mit Kant gesteht er, dass er sich bemühen musste, die religiösen Lehren mit der neuen Erkenntnistheorie in Deckung zu bringen, denn damit drohte jede Einsicht auf der Oberfläche zu enden oder gar Projektion zu sein.
Mit großen Augen liest man dann jedoch, dass die Kant-Lektüre, so Steiner 1924, keine Konsequenzen gehabt habe: »Die Ehrfurcht vor dem Geistigen … wurde mir durch dieses Verhältnis zur Erkenntnis nicht im geringsten genommen.« Gerade durch Kant habe er erkannt, »wie der menschliche Geist erkennend den Weg ins Übersinnliche finden kann«. Das jedoch kann so nicht stimmen. Schon der massive Gebrauch von Begriffen, die in seiner theosophischen Phase Karriere machten, wie »das Übersinnliche« oder »das Geistige«, lässt erkennen, dass der alte Steiner hier dem jungen die Wörter lieh. Noch mehr Misstrauen hinterlässt eine Bemerkung wenige Zeilen später: »Ich verhielt mich zu Kant damals ganz unkritisch«, was doch im Umkehrschluss heißt, dass er Kants Erkenntniskritik akzeptierte.
Bei all dem ist Steiner ein Erinnerungsfehler, vielleicht eine weitere Freudsche Fehlleistung unterlaufen, indem er seine Kant-Lektüre weiter zurück in seine Biografie verlegte, als es die Wirklichkeit hergab. Denn die Reclam-Ausgabe erschien erst 1877. Steiner war also schon sechzehn Jahre alt, als er auf Kant stieß, nicht dreizehn oder vierzehn, wie er in Mein Lebensgang nahelegt. Das härteste Argument jedoch für die Einsicht, dass der Sturm der Kantschen Kritik den Schüler zerzaust zurückließ, ist Steiners Leben in den nächsten fünfzig Jahren. Die lebenslange gereizte Auseinandersetzung mit Kant dokumentiert, dass dessen Philosophie den jungen Rudolf mächtig verunsichert hatte. Mit Dutzenden kritischer bis polemischer Äußerungen hat Steiner Kant verfolgt, weil sein Denken die Aussicht auf eine »objektive« Erkenntnis verbaut habe. Noch der Theosoph Steiner verdammte den Königsberger Philosophen dazu, als »Neger« und damit in einer für Steiner »degenerierten« Rasse zu reinkarnieren.5
Summa summarum: Es spricht alles dafür, dass die Kant-Lektüre viel Porzellan der unbedarften, naturfrommen Weltsicht des Sechzehnjährigen zerbrochen hat. Mit den eingehefteten Kant-Blättern begann eine philosophische Pubertät, der Abschied vom kindlichen Kosmos, in dem Gegenstand und Wahrnehmung noch siamesische Zwillinge gewesen waren. Man kann Steiners Biografie als einen lebenslangen Versuch lesen, die von Kant in die Wege geleitete Vertreibung aus dem Paradies eines unmittelbaren Zugangs zur Welt wieder rückgängig zu machen.
1878, Steiner war nun siebzehn Jahre alt, unternahm er eine neue Expedition ins Reich der Philosophie, indem er einen Untergrundkampf mit seinem Deutschlehrer, Josef Mayer, aufnahm. Steiner hatte, möglicherweise durch einen Aufsatz dieses Lehrers im Jahresbericht der Wien Neustädter Realschule, bemerkt, dass Mayer ein Anhänger der Philosophie Johann Friedrich Herbarts war, des großen, philosophisch ambitionierten Systematikers der Pädagogik im frühen 19. Jahrhundert. Deshalb spürte er seinem Lehrer nach und besorgte sich Literatur aus der Herbart-Schule: ein Lehrbuch der Psychologie und eine Einleitung in die Philosophie des Herbartianers Gustav Adolf Lindner. Nach der Lektüre inszenierte Steiner in Schulaufsätzen ein »Versteckspiel«, indem er Herbartsche Gedanken aufscheinen ließ. Der Lehrer reagierte offenbar verunsichert und maßregelte Steiner. Er solle das Lesen von philosophischer Literatur lassen, denn dies verwirre nur seine Gedanken.
Wir wissen nicht, was Steiner aus den Werken der Herbart-Schule herausgezogen hat. Möglicherweise verwendete er den Herbartianismus als Hilfsmittel gegen Kant, denn die Argumentation der Herbartschen Metaphysik lief darauf hinaus, die Gegenstände doch für einen Ausdruck ihres Wesens zu halten und so einen Weg zur Erkenntnis des Dings »an sich« zu bahnen.
In all den Schuljahren muss Steiner ein einsames Kind gewesen sein. Von Freunden ist in seiner Autobiografie keine Rede. Die Jahre in der Bahnstation von Pottschach unter den Fittichen seines Vaters, der lange Schulweg nach Wiener Neustadt, den er allein gehen musste, und die fehlende Chance, nachmittags mit Schulfreunden zu spielen, lassen vermuten, dass die Rede vom einsamen Rudolf keine bloße Selbststilisierung war. Dazu tritt der irritierende Befund, dass Steiner es in seinen Lebenserinnerungen liebte, Menschen anonym auftreten zu lassen. Keinen Lehrer, keinen Schüler nennt er mit Namen. Sie erscheinen wie Figuren, die eine Rolle spielten, aber keine Beziehung zu Steiner haben. Sein Mitschüler Albert Pliwa bestätigt, dass Steiner ein Einzelgänger war: Er war »für uns als Klassenkamerad eigentlich gestrichen. Tatsächlich wurde er bei allen losen Streichen, die wir anderen ausheckten und wofür wir bestraft wurden, stets selbstverständlich überhaupt nicht genannt.«6
Deutschtum
Steiners Heimat im Wiener Becken war auch der Rand des deutschsprachigen Siedlungsrayons im Habsburgerreich. Kaiser Franz Joseph, der seit 1848 Kaiser in Wien war und es bis zu seinem Tod 1916 bleiben sollte, gebot über ein Imperium, das von der Leitha in einen cisleithanischen, deutschsprachigen Bereich und in einen transleithanischen Osten geteilt wurde. Dieser Nebenfluss der Donau wurde für das Habsburgerreich zum Symbol eines kulturellen Grabens, und genau auf dieser Grenze wohnte Steiner. Jeden Tag, wenn er von Neudörfl nach Wiener Neustadt zur Schule ging, querte er die Leitha vom ungarischen Ufer, wo Neudörfl offiziell Leitha Szent Miklos (St. Nikolaus an der Leitha) hieß, zu den »Deutschen«, wie sich die Cisleithanen in Österreich-Ungarn nannten.
In Neudörfl, das als ungarische Halbinsel ins Wiener Becken ragte, erfuhr Steiner, was es hieß, zu einer sprachlichen und kulturellen Minderheit zu gehören. Hier begegnete er dem Ungarn Franz Maraz, seinem Pfarrherrn, der später zum Domkapitular in Sopron (Ödenburg) aufstieg und den Steiner als ungarischen Patrioten erinnerte. Hier in Neudörfl war in der Schule »alles auf ungarische Geschichte eingestellt«, denn seit den 1850er-Jahren verfolgten die Ungarn eine massive Magyarisierungspolitik, weshalb die erste Zeichnung, die von Steiner erhalten ist, den liberalen ungarischen Reformer Graf István Széchenyi zeigt.7 Hier geriet Steiner erstmals bewusst in die Nationalitätenkonflikte des Vielvölkerreichs. Denn zur habsburgischen Politik der Gleichberechtigung der verschiedenen Sprachnationen gehörte, dass Staatsdiener, eben auch Stationsvorsteher, dort, wo sie arbeiteten, die Sprache der Mehrheitsbevölkerung zu sprechen hatten. Dies traf auch Johann Steiner, der in Neudörfl eigentlich hätte Ungarisch sprechen müssen – was er nicht tat (wobei Steiner noch 1923 ohnehin der Meinung war, dass Neudörfl in einer »urdeutschen Gegend« liege). So drohte die Versetzung, die der Vater so lange hinausschieben konnte, bis Rudolf seine Schulzeit beendet hatte. In dieser Grenzlage sah sich der Vater Johann Steiner als Mitglied einer bedrängten Minorität, »mochte« er doch »die Ungarn nicht«. Aber er liebte es, wie Steiner im Gedächtnis behielt, über dieses Thema zu Hause zu »politisieren«. Die Nationalitätenkonflikte färbten Rudolf Steiners Seele ein, noch bevor er wusste, dass die Apotheose der Nation das tödliche Gift für die europäische Kultur des 20. Jahrhunderts werden würde.
Der Junge war dieser toxischen Dosis des Nationalismus hilflos ausgeliefert. Der genannte Schulfreund Albert Pliwa erinnert sich, dass sich Steiner einmal in Sauerbrunn, wo er aus dem Zug ausstieg, weigerte, seine Fahrkarte vorzuzeigen, »weil auf dem Gebäude nicht der deutsche Name Sauerbrunn stünde, das ›hunnische‹ Savanyûkût verstünde er nicht. Darauf holte der Stationschef zu einer gewaltigen Ohrfeige aus, worauf Rudolf Steiner ihn mit ›Hunne‹ traktierte und sah, dass er aus dem Faustbereich des Schlagfertigen kam.«8 Hier erleben wir einen kleinen, trotzig-strammen Deutschnationalen. Doch diese Geschichte hat Steiner seinen Lebenserinnerungen 1924 nicht anvertraut. Immerhin liest man, wie er sich von den kroatischen und ungarischen Wohnorten distanzierte und herausstrich, »aus einer urdeutschen Familie« zu stammen. Aber das sind, verglichen mit der Hunnenschelte, altersmilde Rückblicke, die jedoch die tief reichende nationalistische Imprägnierung seiner Kinderseele bestätigen.
Religion
Nur vorsichtig hat Steiner den Schleier über seiner religiösen Sozialisation gelüftet, obwohl wir gerade hierüber gern mehr wüssten, ist er doch zu einem der bedeutenden Religionsstifter und Weltanschauungsdenker des 20. Jahrhunderts aufgestiegen. Über vieles hat er geschwiegen, anderes zu verschiedenen Zeiten mit unterschiedlichen Interpretationen versehen.
Wenn man mit der Coda des Jahres 1923, den biografischen Äußerungen in Mein Lebensgang, beginnt, begegnet uns ein Steiner, der im volkskirchlichen Milieu des katholischen »Deutsch-Westungarn« (wie das heutige Burgenland damals hieß) aufwächst. In Neudörfl lebte er »in unmittelbarer Nähe der Kirche und des Friedhofs«, hier erhielt er zweimal pro Woche Religionsunterricht, hier hörte er Predigten des Pfarrers Maraz (wohl doch auf Deutsch), hier verrichtete er den »Ministranten- und Chordienst« »bei Messen, Totenfeiern und Leichenbegängnissen. Das Feierliche der lateinischen Sprache und des Kultus«, berichtet Steiner, »war ein Element, in dem meine Knabenseele gerne lebte. Ich war dadurch, daß ich an diesem Kirchendienste bis zu meinem zehnten Jahre intensiv teilnahm, oft in der Umgebung des von mir so geschätzten Pfarrers.« Und dann folgt ein Hinweis, der aufhorchen lässt: »In meinem Elternhause fand ich in dieser meiner Beziehung zur Kirche keine Anregung. Mein Vater nahm daran keinen Anteil. Er war damals ›Freigeist‹. Er ging nie in die Kirche.« »Herrendienst geht vor Gottesdienst«, habe der Vater stets gesagt.9 Steiner berichtet also von feindlichen Kraftfeldern in der religiösen Welt seiner Kindheit. Hier das Mysterium der katholischen Liturgie, in der der Knabe aufgehe, dort der freigeistige Vater. Das Bild vom katholischen Steiner hat von dem Messdiener aus seinen Weg in unsere Steiner-Vorstellung angetreten. Aber dieses Gemälde verdeckt unter den kräftigen Farben vom Ministranten die Grautöne einer dürftigen Kirchenbindung.
Schon im nächsten Kapitel von Mein Lebensgang, in dem Steiner über den Schulbesuch in Wiener Neustadt berichtet, kommen Religion und Kirche nicht mehr vor. Von noch mehr Distanz spricht eine Erklärung, die Steiner 1913 abgab, als die Trennung von der Theosophischen Gesellschaft gerade vollzogen war und Theosophen ihn mit dem »Vorwurf« konfrontierten, er sei Jesuit und vielleicht sogar Jude gewesen. Steiner musste in dieser Situation einen schmalen Grat wandern. Einerseits wollte er sich der Identifikation mit dem Judentum entledigen und zeigte deshalb seinen katholischen Taufschein vor. Aber weil er auch seine Eigenständigkeit als Hellseher herausstreichen wollte, der den Raum des Katholischen längst hinter sich gelassen habe, musste er seinen Katholizismus zugleich marginalisieren. Und so erfahren wir 1913, dass die Messdienerzeit ein kurzes Intermezzo gewesen sei: Nur »eine ganz kurze Zeit« habe er den Ministrantendienst geleistet.10 Denn als ihm wegen säumiger Pflichterfüllung Prügel drohten, habe ihm der Vater den Dienst untersagt: »Jetzt ist es aus mit der Kirchendienerei. Du gehst mir nimmer hin.«11 Und deshalb hatte Steiner nach dem Pflichtunterricht seit der fünften Schulklasse auch keinen Religionsunterricht mehr und wurde nie gefirmt.12 Das heißt: Steiner hat ein gebrochenes Verhältnis zur katholischen Frömmigkeit. Für eine tiefer gehende Sozialisation gibt es keine Indizien. Steiner wurde, davon muss man ausgehen, vom achten oder zehnten Lebensjahr an weitgehend areligiös groß. Lebenslang merkt man ihm an, dass er das katholische Frömmigkeitsgefühl nur sehr punktuell und das katholische Lehrgebäude nur schlecht kennt. Was sich einige Jahre später in seiner Wiener Zeit als religiöse Sozialisation ereignete, war weniger eine Entfaltung katholischer Wurzeln als vielmehr die Entdeckung eines neuen religiösen Feldes, das ein Gegenmodell zur katholischen Lebens- und Denkwelt bildete.
Der Sensitive
Aber Steiner hat seinen Kindheitserzählungen eine weitere religiöse Matrix unterlegt, nämlich die Geschichte eines kleinen Jungen, der mit übersinnlichen Erfahrungen aufwächst: Der Pfarrer Maraz habe »zwischen der sinnlichen und der übersinnlichen Welt« vermittelt, und »die Wirklichkeit der geistigen Welt war mir so gewiss wie die der sinnlichen«, lauten Spitzensätze seiner Spiritualität. Natürlich: Wir wissen nicht, was Steiner in seiner Jugend wirklich erlebt hat. Aber unübersehbar sind solche Stellen ein Teil der großen Spiritualitätserzählung seiner Autobiografie von 1923. Hier spricht der alte Steiner, der Anthroposoph, der Indikatoren einer frühen Sensitivität für die Welt des Übersinnlichen vorweisen wollte. Schon das Vokabular – »geistige Welt«, »das Übersinnliche« – weist die Deutungen als Gäste aus einer anderen Lebensphase aus. Er schreibt 1923 eine Geschichte religiöser Autonomie, in der im Kokon kindlicher Erfahrungen der spätere Anthroposoph verpuppt ist. In gewisser Weise ist dieser sensitive Steiner ein Gegenmodell zum Messdiener, der im Gehäuse katholischer Tradition die religiöse Welt erfährt.
Aber die große Geschichte einer okkulten Wahrnehmung erzählte Steiner 1913. Der kleine Rudolf sitzt als ungefähr Achtjähriger im Wartesaal des Pottschacher Bahnhofs, als er ein inneres Gesicht hat. Er sieht eine Frau eintreten, die ihn (wie in der katholischen Fürbittpraxis) auffordert, »so viel du kannst, für mich zu tun!«13, und dann im Ofen des Wartesaals verschwindet. Später erfährt er, dass eine Tante zu diesem Zeitpunkt den Freitod gesucht habe. Steiner als paranormal begabter Mensch, das war eine massive Statusanzeige im theosophischen Milieu. Doch wie sich kindliche Phantasie und die Erinnerung des gut fünfzigjährigen Steiner zueinander verhalten, bleibt undurchschaubar.
Steiner hat diese Erzählungen aus dem Jahr 1913 nicht in seine Autobiografie aufgenommen. Vielleicht hatte er sie für die noch geplante Biografie seines inneren Lebens zurückbehalten. Aber man kann diese Leerstelle in den Erinnerungen von 1923 auch als leise Distanzierung von seiner theosophischen Phase lesen, von dem Zwang, sich durch handfeste paranormale Phänomene legitimieren zu müssen. Denn eigentlich hatte der Theosoph Steiner die Parole ausgegeben, dass nicht mehr die dunklen Erfahrungen des Okkultismus gelten sollten, sondern die helle Rationalität reflektierter theosophischer Erkenntnis. Dann wäre das okkulte Erlebnis in Pottschach 1913 ein strategisches Argument gewesen, dem großen Hellseher eine Kindheit zu verschaffen, die in die Standardbiografie des schon immer sensitiven Religionsvirtuosen gehört. Aber vielleicht gab es auch Erinnerungssedimente aus Steiners Kindheit, die die Theosophie wieder ins Wachbewusstsein holte – vielleicht.
ZWEI
Studienzeit. Mündigkeit durch Philosophie
Der Student
Im August 1879 brach für Rudolf Steiner das Reich der Freiheit an. Von Inzersdorf aus, knapp zehn Kilometer vom Zentrum Wiens entfernt, einem kleinen Nest mit großen Industrieanlagen und einem Bahnhof, fuhr Steiner nun täglich in die Stadt des Kaisers und der Boulevards, der großen Bildungseinrichtungen und Theater, in die Hauptstadt eines Reiches, das von der Schweizer Grenze bis nach Russland, von Böhmen bis nach Transsylvanien reichte, in eine Stadt, die wie alle Metropolen des 19. Jahrhunderts aus den Nähten platzte. Die Bevölkerung hatte 1870 die Millionenmarke überschritten und verdoppelte sich bis 1910. Das Kind aus der Provinz betrat eine Weltstadt.
Steiner immatrikulierte sich an der Technischen Hochschule in Wien – ganz so, wie es der Vater für den Sohn vorgesehen hatte. Die Technische Hochschule war das Flaggschiff der Habsburger Ingenieursausbildung, das Reich der »exakten« Wissenschaften und der Ingenieure, die die Eroberung der Natur mit Tunneln und Brücken und Bahnen in Angriff nahmen. Als Student der »TH« betrat Steiner eine prosperierende Ausbildungsstätte, denn das »k. k. polytechnische Institut« war gut ein Jahrzehnt zuvor in eine Technische Hochschule umgewandelt worden. Ein Jahr vor Steiners Aufnahme hatte man die Staatsprüfungen eingeführt, aber erst 1901 erhielt die TH das Promotionsrecht. Deshalb war sie zu Steiners Lebzeiten doch noch die kleine Schwester der großen Universität, aber hier wirkten, wie man meinte, die Macher, während in der Universität die Denker in ihren Stuben hockten. Hier konnte und würde Rudolf die Ziele erreichen, die dem Vater verwehrt geblieben waren, so mochte Johann Steiner hoffen. Aber da hatte er den Unabhängigkeitsdrang seines Ältesten gewaltig unterschätzt.
Steiner begann zunächst unter anderem die Fächer Mathematik und Physik, Botanik, Zoologie und Chemie zu studieren, zudem bei dem Germanisten Julius Schröer, von dem noch viel zu erzählen sein wird, »Geschichte der Dichtkunst« und Übungen in Dichtung und im Vortrag.1 Vermutlich wollte er Realschullehrer werden. Die Basisfinanzierung sicherte ein von Carl Ritter von Ghega gestiftetes Stipendium2, das möglicherweise der Vater besorgt hatte. 300 Gulden erhielt er pro Jahr, das war ungefähr so viel, wie auch ein ungelernter Industriearbeiter im Jahr verdiente. Und so büffelte Steiner exakte Naturwissenschaften – mit durchaus respektablem Erfolg: Er war klug und fleißig, erhielt ausgezeichnete Noten und war auf dem besten Weg, die Vision des Vaters Wirklichkeit werden zu lassen. Bis zum Herbst 1883. Nach gut drei Jahren schmiss er das Studium und befreite sich von einer Fessel, mit der der Vater doch das Beste gewollt hatte.
Der Einstieg in den Ausstieg hatte sich schon in den ersten Studientagen angebahnt, wie man jedenfalls rückschauend, wo man natürlich immer schlauer ist, erkennt. Denn es gab Dinge, die Steiner weit mehr interessierten: wie etwa die Philosophie. Bei einem seiner ersten Besuche in Wien packte er seine Schulbücher unter den Arm, verscherbelte sie in einem Antiquariat und kaufte sich erst einmal philosophische Literatur.3 Von diesem Tag an war Steiner auf dem Weg von der Physik in die Philosophie, sofern er es nicht schon als philosophieinteressierter Schüler war. Er muss einen unbändigen Wissensdurst besessen haben, denn er las sich, soweit wir seiner Autobiografie glauben dürfen, quer durch die neuere Philosophie: die drei Könige des deutschen Idealismus, Fichte, Schelling und Hegel, die Dichter Jean Paul und Goethe, den materialistischen Philosophen Ludwig Büchner und den Theoretiker des Unbewussten, Eduard von Hartmann, dazu die »edlen Veteranen« Kuno Fischer, Moritz Carrière, Friedrich Theodor Vischer oder Karl Rosenkranz, die heute nur noch Spezialisten der Philosophiegeschichte bekannt sind. Aber was kann Steiner eigentlich in welcher Frist mit welcher Intensität gelesen haben? Nehmen wir Fichte, Schelling und Hegel: Andere Menschen vertiefen sich über Monate und Jahre in einen dieser Philosophen, während Steiner in Mein Lebensgang so nebenbei bemerkt, auch Hegel gelesen zu haben. Misstrauisch macht, dass Spuren einer dichten Hegel-Exegese in seinem Werk fehlen, die über das hinausgehen, was an frei flottierendem Bildungswissen in der Luft lag.
Hinsichtlich anderer Autoren lässt sich sogar belegen, dass Steiner deren Bedeutung erst nachträglich schuf. Ein prominenter Fall ist Robert Zimmermann, in dessen Vorlesungen über »Praktische Philosophie« er »eine starke Anregung« erhalten habe, so Steiner 1924. Zieht man allerdings seine Briefe aus dem Jahr 1881 zu Rate, stößt man auf eine gegenläufige Bewertung: Die »Freiheitsphilosophie«, die er, Steiner, gerade schreibe, werde keinesfalls »zimmermannisch aussehen«. Da fragt man sich, warum Steiner später eine derart flotte 180-Grad Pirouette drehte. Die Lösung findet sich leicht. Zimmermann hatte 1882 ein Buch mit dem Titel Anthroposophie publiziert und erhielt deshalb als semantischer Vorläufer von Steiners Anthroposophie 1924 die Ehre einer wohlwollenden Erwähnung. Aber dass man mit Steiners später Lebensbeschreibung schwankenden Boden betritt, ist ohnehin klar. Allerdings ist man für die Studienjahre nicht mehr ausschließlich auf diesen Text angewiesen. Es gibt nun zeitnahe Quellen, sodass wir diese kunstvoll arrangierte Partitur namens Mein Lebensgang nicht mehr so dringend benötigen.
Auf diesem Weg von der Welt der Technik in die Welt des Geistes stand Steiner ein Cicerone zur Seite, der schon erwähnte Germanist und Goethe-Verehrer Julius Schröer, den er 1880 kennenlernte und später seinen »väterlichen Freund« nannte. Diese warmherzige Tonlage lässt vermuten, dass Schröer bei Steiner Saiten zum Klingen gebracht hat, die bei seinem leiblichen Vater stumm geblieben waren. Steiner war von Schröers Lehrveranstaltungen »gefesselt« und durfte bald seinen Mentor »in seinem kleinen Bibliothekszimmer in der Wiener Salesianergasse« besuchen, wo er »stundenlang« an dessen Seite saß, während dieser erzählte: von Goethe, von deutschen Mundarten und von dem inneren Leben der Welt: den »Ideen«.
Schröer wurde Steiners Führer auf dem Weg in die idealistische Philosophie. »Ich hörte geistig mit der allergrößten Sympathie alles, was von Schröer kam«, erinnert sich noch der 62-jährige Steiner, der längst selbst zum spirituellen Lehrer avanciert war. Möglich war dies, weil die Technische Hochschule keine engstirnige Ingenieursschmiede sein sollte, sondern auch Lehrveranstaltungen wie Schröers Kurse über Dichtung anbot, die andere kulturelle Kompetenzen förderten.
Schröer, 1825 im damals ungarischen Pressburg (slowakisch: Bratislava) geboren, zählte 54 Jahre, als ihn der achtzehnjährige Steiner traf. Schaut man genauer hin, wird klar, dass Steiner an einen Außenseiter geraten war. An der Hochschule gehörte Schröer zu den Professoren zweiter Klasse. Er war zwar 1866 zum Dozenten und ein Jahr später zum außerordentlichen Professor berufen worden, aber dann ließ man ihn 25 Jahre lang hängen, ehe er 1891, schon 66 Jahre alt, in den Olymp der »ordentlichen« Professoren aufgenommen wurde. Eine hohe Wertschätzung unter Kollegen sieht anders aus. Wichtiger noch war die Tatsache, dass Schröer zu einer der vielen Minoritäten Wiens gehörte: Er war Protestant in einer tiefkatholischen Stadt und stand vermutlich antiklerikalen Positionen nahe.
Und schließlich: Schröer wusste, was es heißt, zu einer deutschsprachigen Minderheit zu gehören – wie auch Steiner. Er hatte im ungarischen Teil des Habsburgerreichs, insbesondere in Pest (heute ein Teil von Budapest), als Lehrer gearbeitet und sich dabei als Spezialist für Dialekte einen Namen gemacht. Er sammelte und publizierte Texte deutschsprachiger Minderheiten aus den östlichen Provinzen Österreich-Ungarns. Das war, wie wir heute wissen, im 19. Jahrhundert nicht nur die »objektive« Dokumentation einer Minoritätenkultur, sondern bedeutete, von einzelnen Informanten abhängig zu sein, Texte auszuwählen und sie für die Veröffentlichung zu bearbeiten. Mit anderen Worten: Mundartforscher sicherten weniger die »alte Volkskultur«, als dass sie eine Tradition produzierten, die sie mit dem Nimbus der Wissenschaft zur Wirklichkeit erklärten. Von Schröer lernte Steiner das Oberuferer Christgeburtsspiel, das Drei-Königs- und das Paradeisspiel kennen, die sich an Waldorfschulen bis heute einer hohen Beliebtheit erfreuen. Auch dem Begriff der »Volksseele« könnte er bei Schröer begegnet sein. Dass dieser sich politisch für die Rechte deutscher Minderheiten einsetzte, war nur konsequent. Nicht verwunderlich ist, dass man in solchen Milieus sehnsüchtig auf das protestantisch-preußische Deutschland blickte.
Aber Schröer wäre für Steiner trotz der deutschnationalen Gemeinsamkeiten wohl eine Episode geblieben, hätte er nicht auch ein philosophisches Sinnstiftungsangebot gemacht: Goethe. Schröer war ein führender Kopf des 1878 gegründeten »Wiener Goethe-Vereins«, Verfasser eines damals bedeutenden »Faust«-Kommentars und Mitinitiator der Aufführung des vollständigen »Faust« im Jahr 1883 in der Wiener Hofburg. Goethe war für Schröer nicht nur das literarische Genie, sondern auch so etwas wie der Stifter einer alternativen, protestantischen Religionskultur: weltfromm war diese, leicht pantheistisch, eine Literaturreligion mit heiliger Schrift und ohne Tempel. Goethe habe, so glaubte Schröer (wie später auch Steiner glauben wird), den Weg von der Anschauung zu den Ideen gebahnt, von der äußeren Wahrnehmung zu dem inneren »Wesen« der Dinge. Schröer war überzeugter, bekennender »Idealist« von Goethes Gnaden. Er fragte nach dem »idealen Gehalt« in der Natur, »der doch in jedem Organischen zu suchen ist«, und war überzeugt, es könne »nur Eine Goetheforschung geben, das ist die, die zunächst auf die Idee ausgeht«. Wie aber erkennt man diese Ideen? Für Schröer war der Königsweg ein quasi göttlicher Akt, ein kongeniales Verstehen, in dem Versuch, Goethe »nach[zu]fühlen, womöglich wie er selbst«4 gefühlt habe. In Steiners Worten: »Würde Goethe so empfunden oder gedacht haben?« Die Knochenarbeit am Goethe-Text, also die Erstellung verlässlicher Lesarten, die Datierung, die Ermittlungen kultureller Kontexte, all das respektierte Schröer zwar, aber sein Herz schlug für die romantische Einfühlung. Steiner sollte, trotz aller erkenntnistheoretischen Reflexionen, in diesem Punkt ein Sohn von Vater Schröer bleiben.
Der aber war nur ein Knoten in dem sozialen Netz, das Steiner um sich herum knüpfte. Erstmals begegnet uns Steiner nun im Kreis von Freunden, mit denen er alles, was an philosophischen Themen Rang und Namen hat, diskutiert. Davon wissen wir vor allem durch Steiners Briefwechsel, auch wenn der ein tückisches Quellenkorpus ist. Denn dort lesen wir zwar viel über philosophische und literarische Zirkel, aber fast nichts über das tägliche Leben, über den Ort, wo er wohnte und schlief, über die Menschen, mit denen er aß und trank. Dass er noch acht Jahre lang, bis zum Herbst 1887, bei den Eltern in Brunn am Gebirge wohnte, 15 Kilometer im Süden Wiens, erfahren wir nur durch die Absenderangaben auf seinen Briefen. Daneben besaß er allerdings bald so etwas wie ein zweites Zuhause, weil er bei der Familie Specht als Hauslehrer arbeitete – davon wird noch zu reden sein.
Über seinen leiblichen Vater verlor Steiner in den überlieferten Briefen seiner Studentenzeit kein Wort mehr. Über mögliche Konflikte mit dem Vater, der mitansehen muss, wie der Sohn an der Hand von Schröer die gewiesene Bahn verlässt, über Mutter und Schwester, über die vermutlich sehr beengten Wohnverhältnisse schwieg sich Steiner aus. Er lebte in einer neuen Welt. Erst nach dem Ende seiner Studienzeit tauchen die Eltern in den Briefen wieder auf, als Adressaten der Nachricht, dass die akademische Karriere so gut wie sicher sei (s. Kap. 6).
Bilder aus dieser Zeit zeigen einen Mann mit einem noch jungenhaften Gesicht, das füllige Haar zurückgekämmt, mit einem hochbürgerlichen Kleidungshabitus: Stehkragenhemd (der »Vatermörder«) mit Krawatte, und vielleicht schon die damals beliebte Lavallière (die »Bohèmeschleife«), einen schmalen Schal, den er zu einer großen Fliege band und lebenslang trug.5
Steiner kam in einen Kreis junger Männer, die in seiner Autobiografie als Funktionsstellen einer intellektuellen Auseinandersetzung erscheinen. Ihre Namen nennt er nicht ein einziges Mal. Aber man hat ihre Identitäten inzwischen detektivisch ermittelt. Da gab es Emil Schönaich aus Troppau in Schlesien, der mit Steiner in Wiener Neustadt zur Schule gegangen war. Er schwärmte für Richard Wagner, dessen Musik Steiner jedoch in seinen Lebenserinnerungen als »Barbarei« und als »das Grab eines wirklichen Musikverständnisses« abqualifizierte. Schönaich wurde Journalist, konnte damit aber »kaum sein Brot verdienen«, schreibt Steiner. Sodann gehörte Rudolf Ronsperger dazu, der sich zum Dichter berufen fühlte, aber offenbar mit Depressionen geschlagen war; er wählte schließlich den Freitod. Des Weiteren Moritz Zitter, ein Siebenbürger Sachse, der Arthur Schopenhauer gelesen hatte und als Pessimist durchs Leben ging. Bis zu seinem Tod im Jahr 1921 blieb die Beziehung zu Steiner erhalten, obwohl dieser Zitters Hoffnungen auf eine intensivere Freundschaft wohl abgewiesen hat. Und Josef Köck, ebenfalls ein Mitschüler Steiners aus Wiener Neustadt. Auch Köck wandelte mit dichterischen Ambitionen durch die Welt und hatte dabei seine Probleme mit dem Leben. Er war ein introvertierter Mensch, dessen Verhältnis zu Frauen vor allem aus Träumen bestanden haben soll und der 1890 Steiner die Frustration über sein Scheitern anvertraute: »Ich blieb zurück. Du stiegst aufwärts, aufwärts höher und höher. Und nun stehst Du schon im Licht. … Vielleicht schöpfen wir Mut, die wir hier zurückgeblieben im armen Dunkel.«6 Schließlich war da noch Rudolf Schober, ein jüngerer Schüler aus der Wien Neustädter Realschule, der als Materialist Steiners Idealismus widersprochen habe. Dieser Freundeskreis war ein Milieu kleinbürgerlicher Aufsteiger, die eine ähnliche Bildungsbiografie wie Steiner durchlaufen hatten. Sie waren Kinder aus dem Wiener Umland oder einer Provinz des Habsburgerreichs, die in der großen Hauptstadt zusammentrafen. Sie suchten dort nach weltanschaulicher Orientierung in Philosophie, Dichtung oder Musik und hatten alle Probleme, ihre Herkunft mit den neuen Perspektiven zu einer stabilen Biografie zu verbinden.
Steiner spielte in seinem Kreis, wo er der »Prior« hieß7 und seine »Gesichtsfarbe« von »meist studierstubenhafter Blässe« auffiel8, möglicherweise bald eine führende Rolle. Jedenfalls betrachtete er sich in seiner Autobiografie als »Beichtvater« und verhielt sich in seinen Briefen wie ein Oberlehrer. Als Köck sich mit Liebeskummer wegen einer Frau namens Cyane an seinen Freund Rudolf wendet, doziert dieser: »Betrachte es als Deine Pflicht, zu erforschen, ob Dein Liebesverhältnis ganz frei war von Selbstsucht.« Dass Steiner dabei noch bemerkt, dass der Freund ihm eigentlich völlig »unbegreiflich« sei, irritiert ihn in seinem philosophischen Beratungselan offenbar überhaupt nicht. Deshalb erfahren wir im Anschluss an diese Stelle auch, welche Rolle Steiner Frauen in dieser Lebensphase überhaupt zugestand: »Das ist echte Liebe, wo man mit dem Bilde zufrieden ist und das Fleisch nicht braucht, ja es unterdrückt. Da gibt’s kein Grämen, keinen Kummer.«
Es gibt jedenfalls keine Hinweise auf eine erotische Zuneigung zu einer Frau in den Jahren. Erst sieben Jahre später hören wir von einer missglückten Affäre. Im Sommer 1888 hatte sich Steiner in die zwanzigjährige Radegunde Fehr verliebt, in deren Elternhaus er mit Köck und Schober verkehrte, um über Literatur zu diskutieren. Steiner erinnerte sich an dieses Haus auch wegen einer kafkaesken Situation: Fehrs Vater war psychisch angeschlagen und lebte als unsichtbare Eminenz in einem Zimmer, welches kein Gast betreten durfte.9 Immerhin hat Steiner der Angebeteten, die für ihn »das Urbild eines deutschen Mädchens« war, eine Art Liebesbrief geschickt – wenn man ihn denn so nennen darf. Der Namenstagsgruß war ein vierseitiger Vortrag über Politik und Literatur. Und so endete die Geschichte, wie sich Steiner sehr offen erinnerte, platonisch und verklemmt: »Wir liebten einander und wußten beide das wohl ganz deutlich; aber konnten auch beide nicht die Scheu davor überwinden, uns zu sagen, daß wir uns liebten.«
Der junge Philosoph
Was Steiner wirklich in diesen Jahren faszinierte, was mehr Leidenschaften zu entfachen schien als jede junge Frau, war schon damals die Philosophie. Selbst wenn man bei der Autorendusche, mit der Steiner uns in seiner Autobiografie konfrontiert, nicht jeden Namen auf die Goldwaage großer biografischer Bedeutung legen darf, so bleiben in den 1880er-Jahren ausreichend viele belastbare Dokumente seiner Auseinandersetzung mit philosophischen Fragen. Man versteht Steiner nur, wenn man ihn mit seinen philosophischen Leidenschaften ernst nimmt.
Aber damit baute er hohe Hürden auf, die es erschweren, ihn nach weit mehr als hundert Jahren noch zu verstehen. Denn er nötigt uns, in die Philosophiegeschichte des späten 19. Jahrhunderts zu steigen, deren Fragen und Probleme heute im Nebel der Vergangenheit zu Schemen werden und deren Autoren heute kaum noch jemand liest, insbesondere wenn es um die Wiener Szene geht. Dies war eine komplexe Sonderwelt der deutschsprachigen Philosophie, die sich keiner schnellen Lektüre erschließt. Wen das nicht interessiert, der mag die zentrale Erkenntnis Steiners aus diesen Jahren mitnehmen und den Rest dieses Abschnitts überblättern: Es gibt, so Steiner, eine Welt der Ideen, eine Welt des Geistes. Wenn man sie erkennen könne, sei Kant widerlegt, demzufolge das »Ding an sich«, das »Wesen« der Gegenstände unerkennbar sei. Diese Erkenntnis erledige zugleich den Materialismus, der die Existenz einer geistigen Welt grundsätzlich leugne. Wen nun Steiners Weg in den Dschungel dieses Idealismus interessiert, mag hier weiterlesen – er wird mit einer Erleuchtungserfahrung Steiners belohnt.
Eine erste Expedition führte Steiner zu Johann Gottlieb Fichte, also zu einer neben Hegel und Schelling zentralen Figur des »deutschen Idealismus« um 1800. Fichte und seine Kollegen wollten nichts weniger, als die Philosophie in Reaktion auf Kants Kritiken auf ganz neue, sichere Füße zu stellen. Fichte suchte deshalb den Ausgangspunkt beim »Ich«: Es »setzt« sich selbst, kann sich seiner selbst sicher sein und ist somit »absolutes Subjekt«. Damit seien Kants Erkenntnisgrenzen, an denen sich Steiner rieb, überwunden. Fichtes Konstruktionen hatte Steiner offenbar unmittelbar nach seiner Ankunft in Wien kennengelernt, als er dessen Wissenschaftslehre von 1794 (eine von einem Dutzend Fassungen, die Fichte zeitweilig im Jahresrhythmus schrieb) erstand. Seine eigenen Überlegungen, vermutlich 1879 entstanden, also im Alter von 18 Jahren, sind in einem unvollendeten Manuskript erhalten. Zum ersten Mal blickt man Steiner bei seinen philosophischen Suchbewegungen unmittelbar über die Schulter.
Er steigt bei Fichtes Subjektbegriff ein: Das Ich sei nicht nur ein absolutes, sondern auch ein »psychologisches Ich«, eine »erkennende Person«.10 Aber Steiner kennt auch die Probleme einer solchen Subjektkonstruktion, denn Philosophiegeschichten hatte er schon gelesen: Wie entsteht das Ich, das doch erst zur Existenz kommt, indem es sich selbst setzt? Dieser bohrenden Frage hatte sich bereits Fichte ausgesetzt gesehen, und diese Aporie realisierte auch Steiner: Das Ich »entschlüpft« uns, wenn wir nach dem Ich vor der Selbstsetzung fragen, »immer und immer nach rückwärts«. Aber man konnte noch schärfer fragen. Setzt sich das Ich überhaupt selbst oder entsteht es nicht vielmehr durch Anstöße von außen? Steiner nimmt diese Ursprungsfrage aus den Debatten um Fichtes Philosophie auf und fragt, wie »etwas ganz fremdartiges in die Tätigkeit des Ich« eintreten könne.11 Hier wird es spannend, weil der Schritt von einer selbstbezogenen in eine soziale Konstitution des Subjekts anstand – genauer gesagt: angestanden hätte, aber bezeichnenderweise bricht das Manuskript hier ab. Steiner, der Einzelgänger aus Wiener Neustadt und der Oberlehrer seiner Wiener Studentenfreunde, hatte die sozialen Bedingungen menschlicher Existenz als philosophisches Problem vertagt. Zwei Jahre laborierte Steiner an der philosophischen Anthropologie. Dabei machte er eine philosophische Erfahrung, deren Kenntnis wir dem Briefverkehr mit seinem Freund Josef Köck verdanken. In dem ersten Brief, der uns überhaupt aus seiner Feder erhalten ist, finden wir ein aufschlussreiches und intimes Selbstzeugnis. Es ist der Bericht einer philosophischen Erleuchtung, der dokumentiert, mit welch existenzieller Verve Steiner philosophische Literatur las, wie ernst er auf der Suche nach dem Sinn jenseits der Welt technischer Machbarkeit war, in deren Begrenzungen er im Elternhaus aufgewachsen war. »Um 12 Uhr mitternachts« schreibt er am 13. Januar 1881 an Köck einen Brief, um von einer Erfahrung zu berichten, die sich drei Nächte zuvor zugetragen habe:
»Lieber, getreuer Freund!
Es war die Nacht vom 10. auf den 11. Januar, in der ich keinen Augenblick schlief. Ich hatte mich bis 1/2 1 Uhr mitternachts mit einzelnen philosophischen Problemen beschäftigt, und da warf ich mich endlich auf mein Lager; mein Bestreben war voriges Jahr, zu erforschen, ob es denn wahr wäre, was Schelling sagt: ›Uns wohnt ein geheimes, wunderbares Vermögen bei, uns aus dem Wechsel der Zeit in unser innerstes, von allem, was von außen hinzukam, entkleidetes Selbst zurückzuziehen und da unter der Form der Unwandelbarkeit das Ewige in uns anzuschauen.‹ Ich glaubte und glaube nun noch, jenes innerste Vermögen ganz klar an mir entdeckt zu haben – geahnt habe ich es ja schon längst –; die ganze idealistische Philosophie steht nun in einer wesentlich modifizierten Gestalt vor mir; was ist eine schlaflose Nacht gegen einen solchen Fund!«
Dieser Brief ist ein Wechselbalg. Er suggeriert unmittelbare Erfahrung und ist doch durch tagelanges Nachdenken stilisiert. Dabei tritt Steiner wieder in der Pose des Lehrers auf, der von seinem »Forschen« erzählt. Er gibt sich abgeklärt und souverän. Doch daneben stehen Formulierungen mit einem emotionalen Ausschlag, etwa die Rede von der »Entdeckung« inmitten der Schlaflosigkeit. Er sieht sich einen entscheidenden Schritt über Fichte hinaus, vom Denken zur Anschauung vorangeschritten. Hatte er bei Fichte noch beklagt, dass uns das »reine Ich« »entschlüpft«, so glaubte er mit Schelling, »das Ewige in uns anzuschauen«. Damit hielt er Kants Erkenntniskritik einmal mehr für erledigt, und dies legt auch der Kontext bei Schelling selbst nahe, der kurz nach der von Steiner zitierten »intellectuellen Anschauung« den Zustand bezeichnet, in dem »das anschauende Selbst mit dem angeschauten identisch ist«, das Selbst als Subjekt und als Objekt in eins fallen. Kants Grenzen, jegliche Grenzen der Erkenntnis wären damit aufgehoben.
Beim Kräutersammler und »Meister«
Am Ende dieses Jahres 1881 erfolgte eine weitere Begegnung, der Steiner eine hohe Bedeutung zuschrieb. Steiner nennt weder in seiner Autobiografie noch sonst in seinem Werk den Namen des Mannes, wir erfahren nur, dass er Heilkräuter gesammelt habe, um sie in Wiener Apotheken zu verkaufen.12 Steiner lernte ihn auf den Bahnfahrten nach Wien kennen und besuchte ihn sogar mindestens zweimal zu Hause, wie wir inzwischen wissen, in Trumau, nochmals 15 Kilometer südlich von Brunn. Man könnte mit diesem Hinweis die Chronistenpflicht für erledigt halten, stieße man nicht in der anthroposophischen Steiner-Literatur auf eine große Oper: Der Kräutersammler sei in Wahrheit ein »okkulter Lehrer«, Steiners »Meister« gewesen und habe ihm eine »okkulte Unterweisung« erteilt – so Christoph Lindenberg. Und der weiß dann auch noch, dass die »Initiation«, die »Orientierung in der geistigen Welt«, von »Sätzen Fichtes« ausgegangen sei und bereits die revolutionäre Kosmologie theosophischer Prägung beinhaltet habe.13 Man atmet tief durch und fragt sich: Woher weiß er das?
Natürlich hat Steiner die entscheidende Fährte gelegt. Seine große Erzählung über den Meister aus Trumau beginnt 1907, als er sich in der Theosophischen Gesellschaft als eigenständiger spiritueller Lehrer auszuweisen sucht und einem befreundeten Theosophen, dem elsässischen Schriftsteller Édouard Schuré, eine autobiografische Skizze zukommen lässt, weil Schuré nach Material für ein Vorwort von Schriften Steiners sucht, die er gerade ins Französische übersetzt. Hier erfährt man erstmals, dass Steiner vor seinem Hegel-Studium die Bekanntschaft mit dem »Gesandten« des Meisters gemacht habe, der in die »Geheimnisse« des Kosmos, des Menschen und der Geister »vollkommen eingeweiht« gewesen sei und ihn in Kontakt mit dem Meister gebracht habe.
1913, nach der Trennung von der Theosophischen Gesellschaft, stellt sich Steiner erneut als Eingeweihter dar und kommt wiederum auf diesen Dürrkräutler zu sprechen. Er habe »ungeheure okkulte Tiefen« besessen und sei der »Verkünder einer anderen Persönlichkeit« gewesen – den Begriff des »Meisters« meidet Steiner, denn im Gegensatz zu 1907 waren nun die Weichen auf Distanzierung von der Theosophie gestellt. Und anderthalb Jahrzehnte später, in seiner Autobiografie, spricht Steiner nochmals von dem Heilkräutersammler, aber wieder ist von Meistern keine Rede mehr. Wir hören nur noch ganz moderat von einem »geistigen Dialekt«, den er habe lernen müssen. Angesichts dieser immer wieder veränderten Aussagen liegt der strategische Einsatz der Informationen über den Kräutersammler offen zutage: Für den werdenden Theosophen war die Bedeutung hoch, für den arrivierten Anthroposophen hingegen überschaubar.
Ende der Fünfzigerjahre kam Licht in die Geschichte des »Kräutersammlers«. Steiners erstem Biografen, dem Anthroposophen Emil Bock, gelang ein kleiner Jahrhundertfund, er lüftete die von Steiner verborgene Identität des Dürrkräutlers: Felix Kogutzki aus Trumau, sodass heute in der maßgeblichen Edition des Jahres 1907 der Name genannt wird, den Steiner so sorgsam verschwieg: Felix Kogutzki eben, der aber nun »endgültig« der »Gesandte« des »Meisters« war.
Bei einem so gewaltigen Opernfinale hilft nur die Handwerksarbeit des Historikers, der dem »Vetorecht der Quellen« (Reinhard Koselleck) Geltung verschaffen kann. Dabei ist ein Brief Steiners vom 26. August 1881 an seinen Freund Ronsperger von zentraler Bedeutung. Denn aus inzwischen bekannten Aufzeichnungen Kogutzkis wissen wir, dass Steiner an diesem Tag zum zweiten Mal bei ihm gewesen war. Liest man Steiners Brief an Ronsperger von diesem Tag, in dem es seitenlang um sein damaliges Lieblingsthema geht, die Wahrheit des Idealismus gegenüber dem »verhassten Materialismus«, stößt man auch auf einige Zeilen, in denen er von einem Fußweg nach Trumau berichtet: »Ich lerne dabei das niederösterreichische Volk kennen und zugleich liebgewinnen. Diese Leute kommen einem mit einer erstaunlichen Aufmerksamkeit entgegen und werden bald recht zutraulich.« Schon im nächsten Satz geht es wieder um den Materialismus. Von Meistern, Agenten und Unterweisungen keine Rede. Vielmehr interessiert sich Steiner für einfache Leute, für das »Volk« – und Kogutzki ist nicht der einzige. Auf dem Weg nach Trumau war er zum Grab des Dorfschullehrers Johann Wurth gepilgert, dessen Gedichte er bewunderte. Nun kann man behaupten, Steiner habe Ronsperger von seinen »ethnologischen« Exkursionen berichten wollen, von seinem Initiationserlebnis aber eisern geschwiegen. Doch in der jovialen Rede vom »zutraulichen« »Volk«, die den Eindruck hinterlässt, Steiner habe sich wie im Zoo durch das Wiener Vorland bewegt, findet sich von auch nur vorsichtigem Respekt gegenüber einem »Meister« keine Spur. Angesichts des völligen Fehlens weiterer Hinweise auf eine Art »Initiations«-Erfahrung im Umfeld dieser Begegnung liegt ein anderer Schluss nahe: Felix Kogutzki war ein normaler Mensch, der etwas damals nicht mehr ganz Normales tat, nämlich mit Heilkräutern handeln. Vermutlich gehörte er zu den Laienheilern, die die empirische Universitätsmedizin am Ende des 19. Jahrhunderts aus der Krankenbehandlung verdrängte. In dieser Auseinandersetzung war die Pflanzenmedizin ein Rückzugsgebiet gegenüber der Schulmedizin, zu der häufig auch ein abgedrängtes, »okkultes« Denken gehörte. Dass Kogutzi irgendwie »naturmystisch« dachte, bestätigen sowohl Steiner als auch ein Sohn Kogutzkis.14 Dieser Dürrkräutler mag Steiner beeindruckt haben, selbst wenn es dafür keinerlei zeitnahen Belege gibt. Aber ein theosophischer »Meister« wird daraus nicht.
Der Philosoph
DREI
Intellektuelle Zuneigung. Goethe und andere Philosophen
Steiner wird Goethe-Forscher
Was sich da am 9. Oktober 1882 ereignet, klingt ein wenig nach der Karriere vom Tellerwäscher, der zum Millionär wird: Joseph Kürschner, Herausgeber der ersten Gesamtausgabe von Goethes Werken, überträgt Steiner die Edition naturwissenschaftlicher Werke Goethes. »Man bedenke«, bringt der Germanist Wolfgang Raub das Unerhörte auf den Punkt, »ein 21-jähriger Student, der weder irgendein Examen noch einen akademischen Grad hatte und noch durch keine Arbeit öffentlich hervorgetreten war«1, wird in den Olymp der Goethe-Edition geladen, wo neben ihm die Koryphäen der Forschung sitzen.
Goethe-Forschung war in diesen Jahren ein kulturelles Politikum, denn der Geheimrat stieg soeben zum literarischen Nationalhelden auf. Die gerade einmal zehn Jahre alte deutsche Nation, 1871 im Spiegelsaal von Versailles im Blut des Sieges über Frankreich aus der Taufe gehoben, brauchte noch Identifikationsfiguren. Goethe-Denkmäler überzogen Deutschland, protestantische Pastoren hielten Goethe-Predigten zu Losungen des Meisters aus Weimar, Goethe-Literatur stand in den Regalen der Arbeiterbibliotheken, Goethe-Vereinigungen verschrieben sich dem Andenken des Meisters. Und nachdem in den 1880er-Jahren der Nachlass Goethes der Öffentlichkeit zugänglich wurde, nahm die Germanistik die Produktion des literarischen Praeceptor germaniae in Angriff.
Steiner verdankte seinen Aufstieg in diese deutschnationale Deutungselite seinem Mentor Julius Schröer, der ihn im Juni Kürschner avisiert hatte:
»Ein Student in höhern Semestern, der Physik, Mathematik und Philosophie betreibt, bei mir auch seit Jahren Vorlesungen hört, befaßt sich eingehend mit Goethes naturwissenschaftlichen Schriften. … Aus Gesprächen aber ersehe ich, daß er den Stoff beherrscht und eine selbständige, mir richtig scheinende Anschauung gewonnen hat. Er heißt Steiner.«2
Aber dahinter stand nicht nur Schröers Zuneigung zu Steiner, sondern auch ein ideenpolitisches Kalkül. Denn Schröer wollte im gerade laufenden Deutungskampf Goethe idealistisch interpretiert wissen und glaubte diese Ausrichtung durch Steiner gewährleistet. Kürschner seinerseits entschied nun weder nur ideenpolitisch noch nach den Maßstäben hehrer Wissenschaft. Denn seine Goethe-Edition war nur ein kleiner Teil eines gigantischen Publikationsprojekts, der Deutschen National-Litteratur, mit der die deutsche Nation ihren Klassikerkanon erhalten sollte. 220 Bände sollte das monumentale Legitimationsprojekt am Ende umfassen, und das heißt, dass Kürschner beständig auf der Suche nach Bearbeitern einzelner Bände war. Aber Kürschner, der »Lexikograph«, wie ihn die Zeitgenossen nannten, hatte eminent praktische Probleme, denn er kümmerte sich längst nicht nur um die Deutsche National-Litteratur. Daneben lancierte er Dutzende weiterer Projekte, darunter Nachschlagewerke wie die Gekrönten Häupter, das Handbuch der Presse, Das ist des Deutschen Vaterland oder Deutschland und seine Kolonien, sodann einen Schwung von Lexika, einige vom Umfang des großen Brockhaus, darüber hinaus Zeitschriften, etwa die viel gelesene Illustrierte Vom Fels zum Meer oder die Kunstkorrespondenz, und auch eine über 300 Bändchen umfassende Kollektion von Erzählungen unter dem Titel Bücherschatz. Die Deutsche National-Litteratur war »nur« das Flaggschiff dieses Publikationsimperiums. Als Großunternehmer in Sachen Literatur konnte er gar nicht jeden Band betreuen und hatte daher auch im Fall Steiners versucht, die Verantwortung zu delegieren. Schröer war als »Protektor« eingebunden, womit sich Steiner einverstanden erklärt hatte.3
Steiner muss sich mit einem unglaublichen Elan in die Arbeit gestürzt haben. Auf der Grundlage der Edition Salomon Kalischers in der »Hempelschen« Goethe-Ausgabe hatte er die aufzunehmenden Texte auszuwählen, was in dieser Phase wahrscheinlich noch in Abstimmung mit Schröer geschah, editionstechnisch aufzuarbeiten und eine Einleitung zu schreiben. Bereits ein halbes Jahr nach der Absprache mit Kürschner lieferte er das Manuskript des ersten Bandes an Schröer, und ein Jahr später, im März 1884, war dieser gedruckt. In dieser Goethe-Welt sah Steiner seine Zukunft. Im Oktober 1883 beendete er seine Studentenlaufbahn, wo er unter »Geistesdressur« durch »Formelgeschnörksel« habe leiden müssen – ohne Abschluss.4 Daneben hatte ihn Kürschner auch schon für weitere Projekte beigezogen, 1884 erschienen naturkundliche Artikel Steiners in Kürschners Taschen-Konversationslexikon.
Goethe: Steiners erste intellektuelle Liebe
Doch Steiner begibt sich bald auf eigene Wege, immer im Reich der naturkundlichen Werke Goethes (nicht in den uns viel bekannteren Dramen und Gedichten Goethes). Noch ehe 1887 ein zweiter Band Steiners in der Deutschen National-Litteratur gedruckt wird, legt er seine eigene Goethe-Deutung vor, die Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Darin aber präsentiert er nicht einfach Goethe, sondern seinen Goethe – wie jeder Goethe-Interpret. Der Angelpunkt von Steiners Goethe ist der Schröersche Goethe, der Goethe des Idealismus, der für Steiner zugleich ein Theoretiker objektiver Erkenntnis ist. Um die Attraktivität dieses Ansatzes zu verstehen, muss man sich wieder Steiners philosophische Fragen ins Gedächtnis rufen. Da war in erster Linie noch immer Kant. Man erinnere sich: Mit der Erkenntnistheorie Kants sah sich Steiner vom Inneren der Dinge, von dem Ding an sich und damit von der Welt der Ideen abgeschnitten. Vielleicht hatte sich diese Furcht an der Technischen Hochschule noch verstärkt, denn die Naturwissenschaften galten als Propagandisten einer »reinen«, »äußeren« Faktizität und oft genug als antiidealistische Front.
Gegen diese Phalanx der erkenntnistheoretischen Diesseitigkeit und des positivistischen Naturalismus bietet Steiner in der Mitte der 1880er-Jahre seine Philosophie des Idealismus auf den Spuren Goethes auf. An einem Beispiel aus den Grundlinien kann man sich das Grundmuster seiner Konzeption vor Augen führen: Wie gewinnt man den Allgemeinbegriff »Dreieck«? Steiner geht davon aus, dass es Dreiecke gibt, ohne dass wir sie sehen, dass Dreiecke also unserer Wahrnehmung vorausliegen. Das Dreieck komme also »nicht durch die bloße Betrachtung aller einzelnen Dreiecke« zustande, sondern existiere bereits, eben als Idee. Abstrakter gesagt: Im Denken werde der Gegenstand (das Dreieck »an sich«) »unmittelbare Erfahrung« (das wahrgenommene Dreieck), und diese »Erfahrung in der höchsten Form, sie weist jeden Versuch zurück, etwas von außen in die Erfahrung hineinzutragen«. Im Denken also, meint Steiner, ergreifen wir, besitzen wir die Idee. Dies war für ihn, wie er 1887 klarstellte, die Achse seiner Philosophie:
»In der Idee erkennen wir dasjenige, woraus wir alles andere herleiten müssen: das Prinzip der Dinge. Was die Philosophen das Absolute, das ewige Sein, den Weltengrund, was die Religionen Gott nennen, das nennen wir, auf Grund unserer erkenntnistheoretischen Erörterungen: die Idee.«
Deshalb verlaufe der Prozess des Erkennens nicht vom Objekt zur Idee, sondern umgekehrt: Die Idee »bewirkt





























