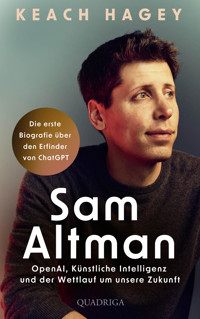
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Quadriga
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Wettrennen um eine Technologie, die unser aller Leben verändern wird.
Im November 2022 stellte OpenAI der Welt den Chatbot ChatGPT vor. Innerhalb von drei Monaten registrierten sich 100 Millionen Nutzer. OpenAI wurde vom kleinen Nonprofit zum Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen. An seiner Spitze: Sam Altman, damals gerade einmal 37 Jahre alt.
Wer ist dieser Mann, der die Welt der Künstlichen Intelligenz für immer verändert hat?
Die renommierte Journalistin Keach Hagey erzählt in ihrer Biografie erstmals Altmans Geschichte - von seiner Kindheit in St. Louis über seine Erfahrungen in der Startup-Szene bis zu seinem kometenhaften Aufstieg in der Tech-Welt.
Rivalitäten, Intrigen und Machtkämpfen
Ein hochspannender Blick hinter die Kulissen der KI-Revolution und eine akribisch recherchierte Betrachtung der Beweggründe und Ambitionen einer ihrer widersprüchlichsten Leitfiguren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungPrologTeil I: 1985–2005Kapitel 1: ChicagoKapitel 2: St. LouisKapitel 3: »Wo bist du?«Kapitel 4: Bei den »Obernerds«Teil II: 2005–2012Kapitel 5: »Studienpause«Kapitel 6: »Where You At?«Kapitel 7: Von »Schwach« zu »Cool«Kapitel 8: Das Trottel-AbzeichenTeil III: 2012–2019Kapitel 9: »In einer Rakete mitfliegen«Kapitel 10: »Sam Altman for President«Kapitel 11: »Ein Manhattan-Projekt für die KI«Kapitel 12: AltruistenKapitel 13: OpenAI wird erwachsenTeil IV: 2019–2024Kapitel 14: ProdukteKapitel 15: ChatGPTKapitel 16: Der BlipKapitel 17: Der entfesselte PrometheusEpilogDankAnhangQuellen und AnmerkungenRegisterÜber dieses Buch
Im November 2022 stellte OpenAI den Chatbot ChatGPT vor. Innerhalb von drei Monaten registrierten sich 100 Millionen Nutzer. OpenAI wurde vom kleinen Nonprofit zum Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen. An seiner Spitze: der damals 37-jährige Sam Altman.
In ihrer bahnbrechenden Biografie erzählt die renommierte Journalistin Keach Hagey erstmals Altmans Geschichte – von seiner Kindheit in St. Louis über seine Erfahrungen in der Startup-Szene bis zu seinem Aufstieg in der Tech-Welt, den Rivalitäten, Intrigen und Machtkämpfen. Ein hochspannender Blick hinter die Kulissen der KI-Revolution und eine akribisch recherchierte Betrachtung der Beweggründe und Ambitionen einer ihrer widersprüchlichsten Leitfiguren.
Über den Autor
Keach Hagey ist investigative Reporterin beim Wall Street Journal. Für ihre Recherchen hat sie mehrere Preise erhalten. Sie war die erste Journalistin, die Altman in einem ausführlichen Artikel porträtiert hat. Keach Hagey lebt in Irvington, New York.
K E A C H H A G E Y
Sam Altman
OpenAI, Künstliche Intelligenzund der Wettlauf um unsere Zukunft
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch vonChrista Prummer-Lehmair und Thomas Wollermann
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»The Optimist. Sam Altman, OpenAI, and the Race to Invent the Future«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2025 by Keach Hagey
Published by arrangement with W. W. NORTON & COMPANY, INC.,
of 500 Fifth Avenue, New York, NY 10110, USA
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 ~ 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Robert Schlepütz
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Einband-/Umschlagmotiv: © Joe Pugliese /AUGUST
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-8544-0
quadriga-verlag.de
luebbe.de
Für Wesley
Prolog
An einem milden Novemberabend im Jahr 2023 gab Peter Thiel, der bekannte Risikokapitalgeber, eine Geburtstagsparty für seinen Ehemann Matt Danzeisen im YESS. Das avantgardistische japanische Restaurant befindet sich in einem ehemaligen Bankgebäude aus den 1920er Jahren im Arts District von Los Angeles. Auch sein Freund Sam Altman saß in dem riesigen, tempelartigen Raum an seiner Seite.1 Thiel hatte sich vor mehr als einem Jahrzehnt an Altmans erstem Risikokapitalfonds Hydrazine beteiligt und dem jüngeren Kollegen, der als CEO von OpenAI das Gesicht der KI-Revolution geworden war, auch als Mentor zur Seite gestanden. Die Markteinführung von ChatGPT durch OpenAI im Jahr zuvor hatte die Tech-Aktien aus der Flaute zu einem der größten Höhenflüge seit Jahrzehnten geführt. Dennoch machte sich Thiel Sorgen.
Jahre bevor er Altman kennenlernte, hatte Thiel schon einmal ein KI-begeistertes Wunderkind unter seine Fittiche genommen, Eliezer Yudkowsky. Thiel finanzierte sein Institut, das sich zum Ziel gesetzt hatte, erst einmal zu erforschen, wie die Menschen eine ihnen wohlgesonnene KI gestalten könnten, bevor sie sich daranmachten, tatsächlich eine zu erschaffen, die ihnen an Intelligenz überlegen ist. Doch inzwischen war Thiel zu dem Schluss gekommen, Yudkowsky habe sich zu einem »extremen Pessimisten und Ludditen« mit finsteren Ansichten entwickelt, die er wie folgt zusammenfasste: »Man kann bloß noch zum Burning Man gehen, sich jede Menge Drogen reinschmeißen und darauf warten, dass die KI kommt und uns alle umbringt.« Im März hatte Yudkowsky einen Kommentar im Time Magazine geschrieben, der in der Prophezeiung gipfelte, dass »buchstäblich alle auf der Erde sterben werden«, wenn die Forschung an der generativen KI nicht gestoppt wird.2
»Dir ist nicht klar, dass Eliezer die Hälfte der Leute in deinem Unternehmen dazu gebracht hat, solches Zeug zu glauben«, warnte Thiel Altman. »Du musst das ernster nehmen.«
Altman, der in seinem vegetarischen Gericht herumstocherte, bemühte sich, nicht mit den Augen zu rollen. Dies war nicht das erste gemeinsame Essen, bei dem Thiel ihn vor einer Übernahme seines Unternehmens durch »die EAs« warnte, womit er die Anhänger der Philosophie des »effektiven Altruismus« meinte, dem auf statistischen Daten gestützten modernen Verwandten des klassischen Utilitarismus. Die EAs hatten sich in letzter Zeit von dem Versuch, weltweit das Armutsproblem zu lösen, auf Bemühungen verlegt, zu verhindern, dass eine aus dem Ruder laufende KI die Menschheit auslöscht. Thiel hatte schon wiederholt prophezeit, »die KI-Sicherheitsleute« würden OpenAI »zerstören«. Der Investor hatte das Unternehmen von Beginn an unterstützt, schon 2015 mit einer persönlichen Spende, als es noch ein kleines gemeinnütziges Forschungslabor war, und dann erneut Anfang 2023 über seinen Founders Fund. Da hatte OpenAI bereits eine gewinnorientierte Tochtergesellschaft gegründet, die Milliarden von Microsoft und anderen Investoren verschlang. Doch Thiel war auch ein bekannter Weltuntergangsprophet, der, wie man im Silicon Valley gerne witzelte, bereits siebzehn der letzten beiden Finanzkrisen korrekt vorhergesagt hatte.
»Tja, Elon war ganz ähnlich drauf, aber Elon sind wir losgeworden«, sagte Altman in Bezug auf die chaotische Trennung von seinem Mitgründer Elon Musk im Jahr 2018, der den Versuch, eine Künstliche Intelligenz zu schaffen, einmal als »Teufelsbeschwörung« bezeichnet hatte.3 »Und dann waren da noch die Anthropic-Leute«, fuhr Altman fort. Er meinte damit die mehr als ein Dutzend OpenAI-Mitarbeitenden, die Ende 2020 das Unternehmen verlassen hatten, um ihr eigenes konkurrierendes Forschungslabor zu gründen, weil sie das Vertrauen in Altman verloren hatten. »Aber die gehören nicht mehr zu uns.« Die mehr als siebenhundert verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten dem Unternehmen zu einem raketengleichen Aufstieg verholfen. Und nun durften sie angesichts des bevorstehenden Abschlusses eines Übernahmeangebots, bei dem OpenAI mit mehr als achtzig Milliarden Dollar bewertet wurde, bereits von Zweitwohnungen mit Blick aufs Meer träumen. Es gab keinen Grund zur Panik.
Optimismus war schon lange das Markenzeichen von Altman. Es gab aber auch Gründe genug für ihn, positiv in die Zukunft zu blicken. Der zart wirkende Achtunddreißigjährige beendete gerade das bislang beste Jahr seiner faszinierenden Karriere, ein Jahr, in dem sein Name in aller Munde gewesen war, Senatoren ihm aus der Hand gefressen hatten, er sich mit Präsidenten und Premierministern aus der ganzen Welt getroffen hatte und – was im Silicon Valley am meisten zählte – er eine neue Technologie mit weltveränderndem Potenzial hatte präsentieren können. OpenAI hatte im November 2022 mit der Vorstellung seines frappierend menschenähnlichen Chatbots ChatGPT (kurz für Generative Pre-trained Transformer, »generativer vortrainierter Transformer«) auf Anhieb einen Riesenerfolg gelandet. In nicht einmal drei Monaten meldeten sich hundert Millionen Nutzende an, was ChatGPT den Weltrekord der am schnellsten wachsenden App eintrug.4 Nur wenige Monate später stellte OpenAI einen noch beeindruckenderen Nachfolger vor, GPT-4. Diese Version konnte die US-Anwaltsprüfung bestehen und meisterte mit Bravour einen Standardtest in Biologie auf College-Niveau. Dieser unerwartet rasante Fortschritt ließ viele vermuten, dass das kühne Ziel des Unternehmens, tatsächlich die erste Künstliche allgemeine Intelligenz (Artificial General Intelligence, AGI) der Welt zu erschaffen, in greifbare Nähe gerückt sei. Selbst die härtesten KI-Skeptiker – darunter ein Informatikprofessor aus Stanford, der das ursprüngliche ChatGPT mir gegenüber als »Tanzbär« abgetan hatte – kamen nun ins Grübeln. Einige schwindelerregende Monate lang, in denen Unternehmen in ganz Amerika hektisch KI-Taskforces ins Leben riefen, um mögliche Produktivitätsgewinne durch KI abzuschätzen, schien es, als wären wir alle plötzlich zu Protagonistinnen und Protagonisten einer Science-Fiction-Geschichte geworden, deren Autor Sam Altman war.
Altman hatte das Programm nicht selbst geschrieben. Er war eher ein Visionär, Prediger und Dealmaker, kurzum das, was man einen »Promoter« nennt. Seine besondere Fähigkeit, die er im Laufe der Jahre als Berater und später als Leiter des renommierten Start-up Accelerators Y Combinator weiterentwickelt hatte, bestand darin, das nahezu Unmögliche ins Auge zu fassen, andere davon zu überzeugen, dass es tatsächlich möglich war, und dann das nötige Geld aufzutreiben, um es zu realisieren. »Er ist der einzige Mensch, dem ich in meinem Leben begegnet bin, der nur an Dingen arbeiten möchte, die das Potenzial haben, die Welt zu verändern, auch wenn es vielleicht lediglich eine einprozentige Chance für ihren Erfolg gibt«, sagte Ali Rowghani, der während Altmans Amtszeit als Präsident des Accelerators einen Fonds bei Y Combinator betreute.
Niemand verkörpert so sehr wie Altman die grundsätzliche Haltung des Silicon Valley, dass es nicht schaden kann, »immer noch eine Null dranzuhängen«. Diese Denkweise hatte er von seinem ursprünglichen Mentor, dem Hacker, Unternehmer und Essayist Paul Graham, übernommen, einem Mitgründer von Y Combinator. Grahams genereller Rat an seine Start-ups war, nicht zu klein zu denken, sondern die »Millionen« auf den Präsentationsfolien ihrer Umsatzprognosen gleich durch »Milliarden« zu ersetzen. Als Altman 2019 die Zügel bei OpenAI übernahm, bloggte er über seine persönliche Erfolgsphilosophie: »Es hilft, an das, was man als seine Erfolgsmarke definiert hat, noch eine Null dranzuhängen – ob das nun Geld, Status, Einfluss auf die Welt oder was sonst immer ist.«5 Thiel erklärte, an Altman habe ihn vor allem beeindruckt, dass er absolut »den Zeitgeist des Silicon Valley repräsentierte« – ein 1985 geborener Millennial, der im idealen Moment zwischen dem Platzen der Dotcom-Blase und der Finanzkrise die Bühne der Tech-Welt betrat, als der Start-up-Optimismus wieder an Fahrt aufnahm, die Tech-Branche aber noch nicht »verknöchert« war, wie Thiel später gerne spottete. Thiel, der sich an Altmans Investitionen Mitte der 2010er-Jahre beteiligte, als die Warnungen vor einem Platzen der Technologieblase immer lauter wurden, musste schließlich seine für ihn als Contrarian typische Einstellung, gegen den Strom zu schwimmen, überwinden, und das nicht zu seinem Nachteil. »Sam war extrem optimistisch, eine wichtige Einstellung, wenn man in diesem Bereich investieren wollte, denn dort war eigentlich alles sehr gut bewertet«, sagte er. Wie sich herausstellte, hatten die von Y Combinator geschaffenen sogenannten Einhörner, Start-ups wie Stripe und Airbnb mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar, deren Anteile nicht an der Börse gehandelt werden, noch viel Wachstumspotenzial. Mit Ausnahme der Nachbeben der Finanzkrise von 2008 und der globalen Pandemie, die im Jahr 2020 ausbrach, hat Altman praktisch nur steigende Tech-Märkte erlebt.
Aber dieses Mal lag Thiel mit seinem Pessimismus richtig. Während die beiden Investitionspartner unter dem offenen Dachgebälk des YESS feierten, einem der angesagtesten Restaurants in Los Angeles, konferierten vier Mitglieder des sechsköpfigen Vorstands von OpenAI – darunter zwei mit direkten Verbindungen zur Gemeinschaft der effektiven Altruisten – insgeheim per Video über die Entlassung von Altman. Yudkowsky persönlich hatte nichts damit zu tun, außer dass er mit seinem einflussreichen Blog LessWrong dazu beigetragen hatte, die Angst vor den existenziellen Risiken der KI in den Mittelpunkt der EA-Bewegung zu rücken.
Diese Furcht hatte schon bei der Gründung von OpenAI eine Rolle gespielt, war das erklärte Ziel doch, »die digitale Intelligenz auf eine Weise voranzubringen, die aller Voraussicht nach der gesamten Menschheit Nutzen bringt, ohne dabei durch die Notwendigkeit eingeschränkt zu sein, finanzielle Gewinne zu machen«. Sie zeigte sich noch deutlicher in der bemerkenswerten Charta von OpenAI aus dem Jahr 2018, in der es heißt: »Wir sind besorgt, dass die Entwicklung der AGI in ihrer Schlussphase zu einem Wettlauf geraten könnte, der keine Zeit für angemessene Sicherheitsvorkehrungen lässt.« Daher verpflichtete sich das Unternehmen, mit Projekten, denen der KI-Durchbruch früher gelingen sollte, »nicht mehr zu konkurrieren, sondern sie zu unterstützen«. Auch in der ungewöhnlichen Führungsstruktur des Unternehmens kam diese Befürchtung zum Ausdruck. Sie sah vor, eine gewinnorientierte Tochtergesellschaft unter die Aufsicht eines gemeinnützigen Vorstands zu stellen, der treuhänderisch keinem Investor, sondern vielmehr »der Menschheit« verpflichtet sein sollte.6 Die Anlegerinnen und Anleger wurden gewarnt, dass sie ihr Geld verlieren könnten, falls der Vorstand dies zur Erfüllung seiner Hauptaufgabe für unumgänglich halte.
Die Charta geht zum Teil auf die »KI-Prinzipien« zurück, die 2017 auf der Asilomar-Konferenz aufgestellt wurden. Veranstalter war das Future of Life Institute, das sich mit den existenziellen Risiken der KI beschäftigte und von Milliardären wie Musk und dem Skype-Gründer Jaan Tallinn finanziert wurde. Altman hatte an dieser Konferenz teilgenommen und die »Prinzipien« unterzeichnet. Bereits 2015, dem Gründungsjahr von OpenAI, bezeichnete Altman AGI als »die wahrscheinlich größte Bedrohung für den Fortbestand der Menschheit«. Er empfahl dazu die Lektüre des Buchs Superintelligenz – Szenarien einer kommenden Revolution von Nick Bostrom, einem Philosophen der Universität Oxford, damals schon seit einigen Jahren häufiger Gast bei den von Yudkowskys Machine Intelligence Institute organisierten Konferenzen.7 Bostrom machte die Befürchtungen vor den Folgen der KI in weiten Kreisen durch ein Gedankenexperiment bekannt, das auf Überlegungen von Eliezer Yudkowsky aufbaut. Es warnt davor, KI könne im Bemühen, Büroklammern herzustellen, die Menschheit auslöschen – und dies nicht aus Bosheit, sondern einfach deshalb, weil Menschen dem der KI einprogrammierten Ziel, sämtliche Materie im Universum in Büroklammern zu verwandeln, im Wege stehen könnten. Seine Warnungen trugen entscheidend dazu bei, dass es OpenAI gelang, die weltbesten KI-Forscher zu gewinnen, nicht zuletzt, weil Musk diese Sorgen teilte und Geld für diese Bemühungen zur Verfügung stellte. Und auch als Altman die Erfolge von ChatGPT noch feierte, versäumte er es nie, in seinen begeisterten Visionen der Zukunft eindringlich vor drohenden Katastrophen zu warnen. So forderte er bei einer Anhörung in Washington die Senatoren dazu auf, die KI zu regulieren. »Wenn mit dieser Technologie was schiefläuft, dann läuft es richtig schief«, so seine Begründung.8
Viele in der Branche sahen darin nicht mehr als geschicktes Marketing. Tatsächlich konzentrierte sich Altman im Jahr 2023 vor allem auf das, was er am besten konnte: Deals für mehr Investitionen abschließen, die Begeisterung der Presse anfachen und sich weltweit als Prophet einer blühenden Zukunft mit ungeahnten Möglichkeiten zu etablieren. Er mochte sich Sorgen darüber gemacht haben, wohin die Reise führen könnte, nahm aber deshalb nicht den Fuß vom Gaspedal.
Im Gegensatz zu Thiels düsteren Vorahnungen trafen sich die Vorstandsmitglieder von OpenAI an jenem Abend jedoch nicht, weil sie befürchteten, OpenAI mache zu schnelle Fortschritte in Richtung AGI. In Wahrheit hatten ihre Beweggründe für die Entlassung von Altman wenig mit effektivem Altruismus oder existenziellen Risiken zu tun, sondern mehr mit Thiels Lobpreisung von Altman als Verkörperung des »Zeitgeistes des Silicon Valley« schlechthin.
Gründer wie Altman hatten im ganzen Silicon Valley, so auch bei Y Combinator, nach der Jahrtausendwende den Status von Königen, Kaisern und Göttern. Die Risikokapitalgeber, die sie finanzieren, überschlugen sich darin, ihre »Gründerfreundlichkeit« unter Beweis zu stellen, was in der Praxis hieß, dass sie kaum jemals einen Gründer-CEO absetzten oder ihm anderweitig das Leben schwer machten. Dieser Logik entspricht es, dass Thiel sein Risikokapitalunternehmen Founders Fund nannte und erklärte, niemals einen Gründer entlassen zu wollen.9 Letztendlich heißt dies, dass der Erfolg eines Start-ups nicht so wichtig ist wie die Beziehung zwischen dem Risikokapitalgeber und dem Gründer. Erweist sich das Start-up als Fehlschlag, kann er es mit neuem Gründungskapital noch einmal versuchen und wird diesmal vielleicht sogar mit einer Milliarde bewertet.
Als Altman 2014 die Leitung von Y Combinator übernahm, hatten die Gründer bereits so viel Einfluss gewonnen, dass er sich in einem Blogbeitrag vorsichtig gegen den Trend wandte, ihnen Schecks auszustellen, ohne dass die Finanziers einen Sitz im Vorstand erhielten. Erfahrene Risikokapitalgeber, so sein Argument, könnten wertvolle Erfahrungen in die Unternehmen einbringen. Um aber die Y Combinator-Start-ups nicht zu verprellen, schloss er seinen Beitrag mit den Worten: »Es empfiehlt sich, genügend Kontrolle zu behalten, damit die Investorinnen und Investoren einen nicht feuern können.«10
OpenAI wollte es bewusst anders machen. Altman hielt nicht die Art von Mehrstimmrechtsaktien, die Leuten wie Mark Zuckerberg auf Lebenszeit entscheidenden Einfluss auf ihr Unternehmen sichern, er besaß fast überhaupt keine Anteile am Unternehmen. Das war ungewöhnlich, doch er hatte dies schon in der Gründungsphase von OpenAI entschieden – zunächst deshalb, weil es sich bei dem Unternehmen um eine gemeinnützige Gesellschaft handelte, später auch, weil er so im Vorstand bleiben konnte, ohne gegen die Charta zu verstoßen, die verlangte, dass die Mehrheit der Leitung unabhängig, also ohne Beteiligung am Unternehmen sein musste. Dass er keine Macht über das Unternehmen ausüben könne, so sein Argument, garantiere, dass er verantwortungsvoll handle.
Doch der Vorstand war der Meinung, Altmann übe de facto allein schon durch das Tempo, mit der er Entscheidungen in der undurchsichtigen Welt des Risikokapitals treffe, so große Macht aus, dass das Aufsichtsgremium seinem Job kaum nachkommen könne. Fünf Tage nach dem Essen mit Thiel in dem japanischen Restaurant wurde Altman von dem Unternehmen, das er mitgegründet hatte, gefeuert. Als Grund wurde genannt, er sei »in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht immer offen« gewesen.
Ich traf Sam Altman acht Monate zuvor während der ersten Welle des KI-Fiebers. Das Wall Street Journal hatte mich nach San Francisco geschickt, um ihn in der OpenAI-Zentrale zu interviewen. Sie befindet sich im Mission District, dem coolen Viertel, in dem ich während meines Studiums einen Sommer lang als Barista gejobbt hatte. Damals, während der ersten Dotcom-Blase, kursierten dort noch Flugblätter mit der Parole »Tod dem Yuppie-Abschaum« – die Punks und Freaks fühlten sich gestört. In der Zwischenzeit hatte der Tech-Boom den Mission District überrannt und aus ihm so etwas wie Brooklyn gemacht, nur mit besseren Burritos.
Über allem lag die Euphorie des Neuen. Es war Mitte März, in New York die graue Jahreszeit, in der man jeden Glauben an die Sonne verlieren kann. In San Francisco hingegen schien sie strahlend vom Himmel. Nach fünf Tagen Regen war die Luft frisch und rein. Sämtliche Werbetafeln entlang des Highway 101 priesen irgendein KI-Produkt an. Die Abendnachrichten brachten als erste Meldung, dass GPT-4 den Eignungstest für das Jurastudium bestehen konnte. Im Mission District stand alles in Blüte, überall gab es Kaffee mit Blaubeergeschmack und viele Obdachlose.
Das Büro von OpenAI ist in einer unscheinbaren ehemaligen Mayonnaise-Fabrik im ehemaligen Industriegürtel von Mission in der Nähe von Potrero Hill untergebracht. Kein Schild weist darauf hin, was sich im Inneren des Gebäudes befindet – damals mochte das seltsam erscheinen, erwies sich aber dann fast als weitsichtig, nachdem Yudkowsky kurz darauf gefordert hatte, notfalls auch Luftangriffe gegen Rechenzentren zu fliegen, um unkontrollierbar gewordene KI zu stoppen. Bei der Adresse angekommen, stieß ich dort auf einen verwirrten Investor mit einem Lanyard um den Hals, der wie ich zwischen der unbeschilderten Tür und dem unbeschilderten Lagertor um die Ecke hin und her lief und einfach nicht glauben konnte, dass hier der Eingang zu Silicon Valleys spannendstem und zugleich gefürchtetstem Unternehmen sein sollte. Auf unsere Frage, ob wir hier richtig seien, wollte uns der Wachmann vor dem Lagertor keine Auskunft geben.
Schließlich schafften wir es in die Empfangshalle, die wie eine Mischung aus einem Gewächshaus und einem Day Spa wirkte. Alles war bis zur Decke mit Sukkulenten und Farnen zugewuchert. Das Plätschern steinerner Brunnen mischte sich mit dem Gemurmel von Risikokapitalgebern, die zu einer Networking-Veranstaltung gekommen waren, um mehr über die Welt der KI-Investitionen zu erfahren.
Nach einer Weile betrat Altman, in weißen Sneakern und mit federnden Schritten, lächelnd den Raum. Mit seinen Grübchen wirkte er viel jünger als siebenunddreißig. Als Erstes fällt einem an Altman auf, wie zierlich er mit seiner Größe von knapp über einem Meter siebzig wirkt, eine Tatsache, die schon in vielen frühen Berichten über ihn hervorgehoben wurde. Die zweite Sache ist der intensive Blick seiner grünen Augen, den er stets so auf sein Gegenüber richtet, als würde er gerade mit der wichtigsten Person der Welt sprechen. Er entschuldigte sich dafür, dass sein Meeting, auf der Infotafel des Konferenzraums immer noch als »AI Manhattan Project« angeführt, etwas länger gedauert hatte.
Auf die Frage, was es mit diesem bedeutungsvollen Titel auf sich habe, erklärte Altman: »Es ging darum, was wir tun können, um das Alignment zu verbessern. Wie schaffen wir es angesichts der Fortschritte, uns stärker mit anderen Gruppen abzustimmen, insbesondere darüber, wie wir die Sicherheitsprobleme der AGI bewältigen können. Ich denke, wir haben dazu spannende Ideen.«
Das Gespräch fand zwei Tage nach der Veröffentlichung von GPT-4 statt. Altman leitete eine Organisation von anscheinend solch epochaler Bedeutung, dass er sich über so etwas Profanes wie Produkte oder Profite nicht einmal Gedanken machte. Er schien den Wirbel zu genießen.
»Ich hatte das große Glück, gleich zu Beginn meiner Karriere mehr Geld zu verdienen, als ich jemals benötigen werde«, sagte er. »Ich möchte an Dingen arbeiten, von denen ich überzeugt bin, die ich interessant, wichtig, nützlich und weltverändernd finde und die unbedingt richtig gemacht werden müssen, aber ich brauche nicht noch mehr Geld. Außerdem denke ich, dass wir hier einige Entscheidungen treffen werden, die« – er hielt kurz inne, um nach dem richtigen Ausdruck zu suchen – »irgendwann ein wenig seltsam erscheinen werden.«
Er entwarf eine Zukunft, in der die Weltbevölkerung über die weitere Entwicklung der KI abstimmen wird. »Es ist unser dringender Wunsch, dass diese Technologie unter der Aufsicht von allen steht und ihre Vorteile allen zugutekommen«, sagte er. »Wenn sich das nicht im staatlichen Rahmen realisieren lässt, und ich denke, es gibt viele Gründe, warum das weder eine gute noch eine praktikable Idee ist, bietet sich ein Non-Profit an.« Seine Definition von sicherer AGI war ziemlich weit gefasst. Auf die Frage, was Sicherheit für ihn bedeute, sprach er von einer Zukunft, in der »die überwiegende Mehrheit der Menschen auf der Welt viel besser dran wäre als in einer Welt, in der es keine AGI gibt«. Viele würden dann sicher auch den Beruf wechseln, denn, so sagte er, »ich denke, die meisten Menschen lieben ihre Arbeit nicht besonders«.
Nur ein Mal während unseres zweistündigen Gesprächs bekam die altruistische Maske einen Riss und ließ den knallharten Wettbewerber durchscheinen. Einen Monat zuvor hatten sowohl Google als auch Anthropic die Veröffentlichung eigener Chatbots mit generativer KI angekündigt. Alles deutete darauf hin, dass der Branche nun genau jenes KI-Wettrüsten bevorstand, vor dem die OpenAI-Charta so eindrücklich gewarnt hatte. Doch auf die Frage nach der Konkurrenz antwortete Altman nur: »Tja, sie waren wohl etwas voreilig mit ihren Pressemitteilungen«, und fügte hinzu: »Anscheinend sind sie nicht ganz hinterhergekommen.«
Dies war ein kurzer Moment, in dem Altman einmal Stärke demonstrierte, während er uns durch die OpenAI-Büros führte, in denen eine fast schon betont gutherzige Atmosphäre vorherrschte, wie an einer prestigeträchtigen Privatschule, die ihren Wertekodex zur Schau stellt. Es gab eine Cafeteria, einen Aufenthaltsraum im Stil der 1980er Jahre voller Brettspiele und die Nachbildung einer Unibibliothek, komplett mit Bücherleitern und sanft leuchtenden Schreibtischlampen, offensichtlich nach dem Vorbild des Bender Room der Green Library an der Stanford University. Am Ende der Regale türmte sich ein Stapel Schallplatten, obenauf lag an diesem Tag der Soundtrack zu Blade Runner.
Doch Altmans ganzer Stolz und Freude war ein bautechnisches Detail, das besonders schwierig zu realisieren gewesen war: die zentrale Podesttreppe, die er so entworfen hatte, dass alle der damals vierhundert Angestellten jeden Tag einander begegnen mussten. Als wir hinaufstiegen, geriet er richtig ins Schwärmen über diese Großtat der Ingenieurskunst. In diesem Moment wirkte er fast wie ein Priester in einem Tempel. Mir kam dabei etwas in den Sinn, das er mir während unseres Interviews gesagt hatte.
»Vor noch gar nicht so langer Zeit hat fast niemand an AGI geglaubt«, sagte er. »Und die meisten glauben vielleicht immer noch nicht daran. Aber ich denke, dass mittlerweile mehr Menschen bereit sind, wenigstens darüber nachzudenken. Und ich glaube, dass ein Großteil der Welt gerade einen Prozess durchläuft, den die meisten der hier Anwesenden in den vergangenen Jahren bereits durchgemacht haben, nämlich sich wirklich einmal intensiv damit auseinanderzusetzen. Und das ist schwierig. Aufregend. Führt zu Verunsicherung. Es ist ein Riesending. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Prozess in den nächsten Jahren weiter entfalten wird, und wir wollen versuchen, auf diesem Weg eine Stimme der Orientierung zu bieten.«
Altman war weniger darauf aus, eine Technologie zu verkaufen, sondern vielmehr einen Glauben. Und damit war er sehr erfolgreich. Als ich Thiel für meinen Artikel im Wall Street Journal, der ursprüngliche Grund meines Besuchs in den Büros von OpenAI, die Frage stellte, ob Altman ein Idealist sei, gab er zur Antwort: »Wir sollten ihn eher als eine Art Messias sehen.«
Gut ein Jahr später, im April 2024, betrat ich das Baccarat Hotel in Midtown Manhattan. Altman saß halb versunken in einem der Ledersessel der opulenten Lobby. Ich war früh dran, doch er hatte es noch früher geschafft, bereits diskret seine Personenschützer in einer Ecke postiert und die Rechnung schon im Voraus übernommen, wie ich später herausfand, als nichts mehr daran zu ändern war. Als er mich erblickte, sprang er auf und begrüßte mich mit einer Umarmung. So ist Sam Altman: warmherzig, charmant, fürsorglich, freundlich.
Er war in seiner typischen Aufmachung erschienen: Er trug ein kornblumenblaues langärmeliges T-Shirt, eine indigoblaue Hipster-Jeans und nagelneue graue Sneakers von New Balance. Ein paar graue Strähnchen hatten sich in seinen dunkelblonden Haarschopf geschlichen – es fehlten nur noch wenige Tage bis zu seinem neununddreißigsten Geburtstag. Er hatte sich einen Espresso bestellt – einen von den zweien, die er sich pro Tag gönnt, den ersten zum Frühstück – und schien bester Laune, beflügelt von seinem ausgedehnten Aufenthalt in New York.
Das kam überraschend. Während der monatelangen Verhandlungen hatte er seine ablehnende Haltung zu einem Buch über ihn deutlich gemacht. Der Artikel über Altman im Wall Street Journal, verfasst von meinem Kollegen Berber Jin und mir ein Jahr zuvor nach dem Interview in den Büros von OpenAI, hatte zu einem Buchvertrag geführt. Als wir Altman darüber informierten, meinte er nur, dafür sei es zu früh, außerdem sei das Projekt viel zu sehr auf ihn fixiert. Nach einigen Monaten Bedenkzeit teilte er mir mit, dass mit seiner Mitarbeit nicht zu rechnen sei. Schon bei meiner letzten Biografie war die Person, über die ich schrieb, komplett abgetaucht, deshalb ließ ich mich auch jetzt nicht davon entmutigen und rief ihn immer wieder an. Dann, ein paar Monate vor unserer Begegnung in New York, hatte Altman einen Sinneswandel. Er erklärte sich zu einer Zusammenarbeit in begrenztem Umfang bereit, unter der Bedingung, dass seine kritische Haltung zu diesem Projekt zum Ausdruck kam.
»Ich halte nichts von der Geschichtsverzerrung, die sich unweigerlich ergibt, wenn eine einzelne Person mit einem Unternehmen, einer Bewegung oder einer technischen Revolution identifiziert wird. Unsere Welt funktioniert einfach nicht so, das ist unfair gegenüber der außergewöhnlichen Leistung vieler anderer Menschen«, erklärte er fast ungehalten. »So etwas sollte man grundsätzlich nicht unterstützen.«
Das klang nobel, aber nicht mehr ganz so überzeugend, nachdem Altman nur fünf Tage nach seiner Entlassung bei OpenAI wieder auf den Chefsessel zurückgekehrt war. Nahezu alle siebenhundertsiebzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens hatten eine Petition unterzeichnet, in der sie damit drohten, zu Microsoft zu wechseln, sollte Altman nicht zurückkommen. Mitarbeitende und Investierende von OpenAI hielten ihn ganz offensichtlich gleichermaßen für unentbehrlich. Und in den vergangenen anderthalb Jahren war kaum ein Tag vergangen, an dem die Wirtschaftspresse nicht eine Geschichte über die KI-Revolution mit einem Foto von ihm gebracht hatte. Er mochte sich noch so sehr dagegen sträuben, sein Gesicht, nicht das OpenAI-Logo, war zum Symbol dessen geworden, was viele als den größten technologischen Durchbruch zu ihren Lebzeiten, wenn nicht gar der Menschheitsgeschichte betrachteten.
Sein anderer Einwand klang weniger bescheiden, aber plausibler und entsprach viel mehr seiner Persönlichkeit.
»Es ist nicht reiner Aberglaube, wenn man sagt, dass man nicht zu früh feiern soll, und ich glaube, es ist ein oder zwei Jahrzehnte zu früh«, wandte er ein. »OpenAI hat noch einen weiten Weg vor sich.«
Altman versteht es, andere davon zu überzeugen, dass er in die Zukunft blicken kann. Wenn er öffentlich über die Technologie von OpenAI spricht, schimpft er oft über die aktuellen Produkte – erst kürzlich erklärte er gegenüber einem prominenten Podcaster, GPT-4, das höchstentwickelte Produkt des Unternehmens, sei »irgendwie Murks«. Die Zuhörer sollten sich lieber darauf konzentrieren, was angesichts der Verbesserungsrate des Unternehmens zu erwarten sei.11 Das ist reinstes Investorendenken. In meinen ersten Jahren beim Wall StreetJournal, als ich oft früh in die Redaktion kam, um die Geschäftsberichte der Unternehmen auszuwerten, wunderte ich mich immer, dass deren Pressemitteilungen keinerlei Einfluss auf die Aktienkurse hatten; die Anlegerinnen und Anleger konzentrierten sich stattdessen ganz auf die »Prognosen«, die die Finanzchefs der Unternehmen in ihrem Kauderwelsch gegenüber den Analysten abgaben. In der von Risikokapital bestimmten Welt der privaten Start-ups, in der Altman Karriere machte, musste man schon fast ein Schamane sein, um eine Versammlung von Risikokapitalgebenden davon zu überzeugen, dass die Gewinnkurve eines Start-ups steil nach oben ging. Und niemand konnte das besser als Sam Altman.
In der Zukunftsvision Altmans wird die Künstliche allgemeine Intelligenz unweigerlich zu einer »Erweiterung unseres Willens« werden, ohne die »wir uns einfach nicht mehr wie wir selbst fühlen«. Studierende werden von kostenlosen oder sehr billigen KI-Tutoren unterrichtet werden, die sie »smarter und besser auf die Welt vorbereiten werden, als es heutzutage irgendjemandem möglich ist«. Die Preise für Waren und Dienstleistungen werden drastisch sinken, da die KI einen Großteil der Arbeit von Anwälten, Grafikdesignern und Programmierern übernehmen wird, sodass die Menschen mehr Zeit im »Flow-Zustand« einer kreativen Arbeit verbringen können, an der ihnen wirklich liegt. Löhne werden durch ein bedingungsloses Grundeinkommen (Universal Basic Income, UBI) ersetzt, abgezweigt aus einem Teil des Wohlstands, den all die neuen Roboter produzieren. Staaten werden gemeinsam mit der Privatwirtschaft in riesige Datenzentren investieren, betrieben mit billiger Kernenergie, die uns zur Verfügung steht, wenn wir die Geheimnisse der Kernfusion, die unsere Sonne antreibt, gelüftet haben. Die Künstliche Intelligenz (KI) wird wie Elektrizität fließen und es uns ermöglichen, den Krebs zu besiegen und die Rätsel der Physik zu lösen, die uns bislang an diesen Planeten gefesselt haben. Wir werden immer länger leben, da eine Krankheit nach der anderen besiegt wird. Die Menschheit wird in ein neues Zeitalter der Gesundheit und des Überflusses eintreten.
Altman hat viel mehr getan, als nur über diese Vision zu reden. Mit seinem Portfolio von mehr als vierhundert Start-up-Investitionen, die ihn zum vielfachen Milliardär gemacht haben, hat er bedeutende persönliche Wetten auf Unternehmen abgeschlossen, die etwas zu ihrer Verwirklichung beitragen können.12 So hat er mindestens 375 Millionen Dollar in Helion investiert, ein von Y Combinator gefördertes Start-up, das versucht, die Kernfusion zu einer Quelle sauberer, erneuerbarer Energie zu machen, und er hat das Start-up Oklo unterstützt und an die Börse gebracht, das Kleinreaktoren bauen will. Er ist Mitgründer des Unternehmens Worldcoin (heute World), eines gewinnorientierten Kryptowährungsprojekts, das mit dem sogenannten Orb, einem biometrischen Gerät von der Größe eines Fußballs, durch die Welt reist und die Iris der Menschen im Austausch gegen ein Wallet mit der Kryptowährung Worldcoin scannt. So soll ein weltweites Zahlungs- und Identitätsnetzwerk entstehen, das eines Tages auch zur Verteilung eines globalen Grundeinkommens verwendet werden könnte. Zusätzlich finanzierte er persönlich Langzeitstudien darüber, was ein bedingungsloses Grundeinkommen leisten kann.
Zu seinen weiteren Investitionen gehören besonders ambitionierte Projekte, sogenannte »Moonshots«, beispielsweise, die durchschnittliche Lebensspanne des Menschen um zehn Jahre zu verlängern, eine Behandlung der Parkinson-Krankheit mit Stammzellen zu entwickeln, den kommerziellen Überschallflug wiederzubeleben oder das menschliche Gehirn durch ein Implantat mit dem Computer zu verbinden. Man kann sich kaum vorstellen, dass er privat jemals in etwas so Banales wie Unternehmenssoftware investieren würde – auch wenn OpenAI in Partnerschaft mit Microsoft bisher hauptsächlich das gemacht hat. Paul Graham meinte einmal über Altmans prallvoll mit ehrgeizigen Projekten gefülltes Portfolio: »Mir scheint, sein Ziel ist es, die Zukunft zu gestalten, und zwar umfassend.«13
Altman selbst sagt, er habe es sich nie zum Ziel gesetzt, durch Investitionen in eine Reihe miteinander verzahnter Projekte sämtliche Facetten der menschlichen Existenz neu zu gestalten. Das habe sich einfach so ergeben. »Ich glaube schon lange, dass Energie und Intelligenz die wichtigsten Dinge auf der Welt sind«, sagte er. »Mir war aber nicht klar, wie eng sie zusammenhängen. Damit hatte ich wirklich Glück.«
In dieser Hinsicht unterscheidet sich Altman kaum von vielen anderen Tech-Unternehmern, wenn er auch ein besserer und ehrgeizigerer Investor ist als die meisten von ihnen. Was ihn jedoch von anderen unterscheidet, ist sein Interesse an Politik. Er will nicht bloß eine neue Technologie entwickeln und sie der Welt schenken. Sein Bestreben war es seit jeher, »in die Weltgeschichte einzugehen«, meinte Patrick Chung, der Investor, der ihn entdeckt hat. In den Jahren 2016 und 2017 sprach er mit Freundinnen und Freunden sowie Bekannten über eine mögliche Kandidatur für das Präsidentenamt und liebäugelte 2017 auch mit einer Kandidatur als Gouverneur von Kalifornien. Er entwarf sogar ein politisches Programm, unterstützte dann aber andere Kandidatinnen und Kandidaten, anstatt selbst für ein Amt zu kandidieren. Nachdem ChatGPT weltweit Furore zu machen begann, sprach Altman des Öfteren im Weißen Haus vor und tourte anschließend rund um den Globus, um mit führenden Politikern wie dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem indischen Premierminister Narendra Modi zu sprechen.
Altman beantwortete tapfer zweieinhalb Stunden lang meine Fragen. Ab und zu zog er ein spiralgebundenes Heftchen hervor und notierte sich den Namen einer Person, mit der ich bereits über ihn gesprochen hatte, um sie später zu kontaktieren. Das wirkte einerseits fürsorglich, denn offenbar wollte er mich unterstützen, andererseits aber auch bedenklich. In der Gefälligkeits-Ökonomie des Silicon Valley hält Altman eine einflussreiche Position, und ich konnte nur Vermutungen darüber anstellen, welche Auswirkungen das Buchprojekt auf seinen Ruf haben würde. Graham hatte einmal sehr treffend bemerkt: »Sam ist ein Meister der Macht.«
Doch seit er als CEO von OpenAI gefeuert und kurz darauf wieder eingesetzt wurde, ist seine Macht dort nicht nur gestiegen, sondern hat sich zugleich auch formell verfestigt. Altman wurde nun vorsichtiger, zurückhaltender. Er prahlte nicht länger mit der ungewöhnlichen Führungsstruktur des Unternehmens. Statt einem bedingungslosen Grundeinkommen will er der Menschheit nun eher kostenlosen (oder zumindest billigen) Zugang zu ChatGPT verschaffen. Sein Ruhm brachte es mit sich, dass er keine Zeit mehr für Hobbys hatte. Man hatte versucht, ihn abzuservieren, und er musste damit rechnen, dass sich das wiederholte. Eine Untersuchung nach seiner Entlassung hatte ergeben, dass der Vorstand ihm keinerlei Verfehlung nachweisen konnte, sondern lediglich das Vertrauen in ihn verloren und daraus die Konsequenzen gezogen hatte. So erfolgreich er bisher jede Bedrohung abwehren konnte, so etwas konnte jederzeit wieder geschehen. Hinter alldem stand die Frage, die erst nur hinter vorgehaltener Hand, dann schon im Flüsterton und schließlich ganz offen in Online-Debatten von Abtrünnigen des Unternehmens diskutiert wurde: Trauen wir dieser Person zu, dass sie uns der AGI näherbringt?
Seit seiner Rückkehr als CEO hat Altman versucht, OpenAI zu einem eher traditionellen, gewinnorientierten Unternehmen umzustrukturieren, an dem er inzwischen selbst einen Anteil von circa zehn Milliarden Dollar besitzt. Er ist weit mehr als das Gesicht der KI-Revolution – er ist ihr unumstrittener Anführer und Vordenker. Er hat sich mächtige Feinde gemacht, allen voran Musk, der Altman und OpenAI verklagt hat und ihm vorwirft, die ursprüngliche gemeinnützige Mission verraten zu haben. (OpenAI hält Musks Klage für unbegründet, und dessen Kritiker weisen darauf hin, dass er nach der Gründung seines eigenen KI-Unternehmens xAI ein Konkurrent ist.) Altmans alles überragende Stellung hat die Beantwortung der Frage, wer er wirklich ist, dringlicher denn je gemacht.
Für dieses Buch habe ich mehr als zweihundertfünfzig Interviews mit Sam Altmans Familienangehörigen, Freundinnen und Freunden, Lehrerinnen und Lehrern, Mentorinnen und Mentoren, Mitgründerinnen und Mitgründern, Kolleginnen und Kollegen, Investorinnen und Investoren sowie Portfoliounternehmerinnen und Portfoliounternehmern geführt, und natürlich auch viele Stunden mit Altman selbst gesprochen. Die Person, die dabei zum Vorschein kam, ist ein brillanter Dealmaker, der Tempo und Risiko liebt und mit fast religiöser Inbrunst an den technologischen Fortschritt glaubt – der aber doch manchmal für die Menschen in seinem Umfeld einfach zu schnell ist und dessen Scheu vor Konfrontationen gelegentlich dazu führt, dass sich größere Konflikte zusammenbrauen. Doch sooft Sam Altman zu Boden gegangen ist, so oft ist er stärker als zuvor aufgestanden. Wie Graham 2008 über ihn schrieb: »Würde man ihn mit dem Fallschirm über einer Kannibaleninsel absetzen und nach fünf Jahren vorbeischauen, wäre er dort sicher König geworden.«14
Will man Altman verstehen, so muss man zunächst einmal die Familie verstehen, aus der er kommt. Deshalb beginnt seine Geschichte mit der seines Vaters, Jerry Altman, der weit mehr war als ein »Immobilienmakler«, wie es oft von ihm heißt – sofern er überhaupt erwähnt wird. Jerry Altmans politisches Engagement und sein kreatives Dealmaking – zwei Dinge, die er an seinen Sohn weitergegeben hat – haben den politischen Kampf für bezahlbaren Wohnraum in den USA nachhaltig geprägt. Sams Mutter, Connie Gibstine, hat ihrem Sohn nicht nur den Forschergeist ihrer Familie vererbt, sondern auch ihren beispiellosen Arbeitseifer. Jerry und Connie sagten Sam und seinen Geschwistern jeden Tag, dass sie alles erreichen könnten, wenn sie es nur wollten. Das ist die Grundlage von Sam Altmans Selbstvertrauen und Optimismus. Gleichzeitig liegen in ihrer letztlich unglücklichen Ehe viele der Keime für die Ängste, unter denen Altman nach eigenem Eingeständnis leidet, sowie dem Bruch, der seine Schwester Annie dazu brachte, nach Jerrys Tod 2018 den Kontakt zum Rest ihrer Familie abzubrechen.
Als erstgeborener Sohn einer jüdischen Familie der oberen Mittelschicht in einem Vorort von St. Louis zeigte sich bei Altman schon früh, dass er etwas Besonderes war, und so wurde er auch behandelt. Seine Kindheit war entscheidend durch fortschrittliche Institutionen geprägt. Seine Familie gehörte der Central Reform Congregation an, für die soziale Gerechtigkeit eine wichtige Rolle spielt. Und auch die strenge John Burroughs School vermittelte ihm, es sei seine moralische Pflicht, die Welt zu verbessern. Computer wurden seine intellektuelle Berufung, und AIM-Chats halfen ihm, besser mit dem zurechtzukommen, womit ein homosexueller Teenager in den späten 1990er Jahren im Mittleren Westen der USA zu kämpfen hatte. Schon an seiner Schule hatte er sich gegen die Intoleranz gewandt, die er wegen seiner sexuellen Orientierung erleben musste, und dabei gelernt, dass es das ganze Leben verändern kann, wenn man große Risiken eingeht.
Als Student in Stanford lernte Altman die Mitgründer seines ersten Start-ups Loopt kennen. Es handelte sich um ein auf Standortdaten basierendes soziales Netzwerk in der Ära der Klapphandys. Loopt war das einzige Unternehmen, das Altman vor der Gründung von OpenAI leitete. Seine Geschichte enthält im Kleinen schon vieles von dem, was dann kommen sollte, angefangen von der relativ einfachen Geldbeschaffung bei renommierten Risikokapitalfirmen wie Sequoia Capital bis hin zu Meutereien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen Altman bereits als junger CEO dieses um seine Existenz kämpfenden Start-ups konfrontiert war.
Das wichtigste Ergebnis von Loopt war am Ende, dass die App Altman mit Paul Graham und seinem Start-up-Accelerator Y Combinator bekannt machte. Graham sah in Altman die Verkörperung all dessen, was für den Erfolg eines Start-ups erforderlich ist. Loopt wurde 2012 verkauft, aber Altman blieb Y Combinator treu und beriet dessen Start-ups, während er seinen eigenen Investmentfonds führte, an dem auch Thiel beteiligt war. Als Graham sich dann zurückzog, wählte er Altman zu seinem Nachfolger. Damit rückte Altman in eine Schlüsselposition im Silicon Valley auf. Unter seiner Führung schob Y Combinator nun nicht bloß Dutzende, sondern gleich Hunderte von Start-ups pro Jahr an, drang in den Bereich der bahnbrechenden Spitzentechnologie vor und schuf eine eigene Abteilung für Moonshots, aus der schließlich ein gemeinnütziges Forschungslabor namens OpenAI hervorging. Da Altman immer noch mit der Leitung von Y Combinator beschäftigt war, wurde die Aufgabe, Talente für das Labor zu finden, seinem Freund Greg Brockman übertragen, dem ehemaligen CTO des von Y Combinator finanzierten Zahlungsunternehmens Stripe.
Dieses Buch bietet nicht nur neue Einblicke in Altmans Herkunft, seine Jugend und seine frühe Karriere, sondern auch in seine bisherige Zeit bei OpenAI. Es erzählt die Geschichte, wie sich Altman und Musk wöchentlich zum Essen trafen und dabei die Gefahren und Verheißungen der KI-Technologie diskutierten, und wie Altman dann den Machtkampf gegen den älteren, reicheren Unternehmer dank seiner Allianz mit Brockman gewann. Es enthüllt, wie Altman, den der langjährige Chef von Sequoia Capital, Mike Moritz, einen »kaufmännischen Charakter« nennt, die Entwicklung des ersten kommerziellen Produkts leitete, das ein großes Sprachmodell verwendete. An so etwas war bislang nur an Universitäten geforscht worden. Und es zeigt, wie Altman mit der Einführung von ChatGPT und GPT-4 seine im Einsatz für Y Combinator geschulten Talente nutzte, um eine der größten Start-up-Geschichten aller Zeiten zu erzählen.
Freundinnen und Freunde von Altman, auch Thiel, sagen, er sympathisiere mit einer im Silicon Valley verbreiteten Vorstellung, dass die AGI bereits Realität sei und wir alle in einer von ihr geschaffenen Computersimulation lebten. Gegenüber Journalistinnen und Journalisten hält sich Altman in dieser Frage bedeckt. »Sam steht hier auf der Simulationsseite, ich auf der Nichtsimulationsseite«, erklärte Thiel gegenüber dem Wall Street Journal für unser Profil. »In gewisser Weise lässt sich die Frage stellen: Wie unterscheidet sich die KI von Gott?« Darauf angesprochen, erklärt Altman, dies seien »Diskussionen für Studentenbuden«. Ähnlich Descartes räumt er jedoch ein: »Man kann sich keiner anderen Sache als seines eigenen Bewusstseins sicher sein«, nicht einmal der eigenen Existenz. »Ganz ähnlich sehen es auch viele östliche Religionen: ›Wir existieren nur in unserem Bewusstsein‹«, erklärte er während unseres ersten Interviews.
Altman ist ein Suchender. Er glaubt nicht an Gott, meditiert aber regelmäßig und hat sich Elemente der hinduistischen Advaita-Vedanta-Philosophie zu eigen gemacht. Kurz nach der Veröffentlichung von ChatGPT twitterte er, dass er zu den wenigen Menschen gehöre, die an die »absolute Gleichwertigkeit von Brahman und Atman« glauben.15 Advaita, was in etwa Nondualität bedeutet, geht davon aus, dass es keinen Unterschied zwischen Brahman (dem ewigen Bewusstsein, das die Grundlage aller Realität ist) und Atman (der individuellen Seele oder dem Selbst) gibt und dass die Welt, die wir erleben, eine bloße Illusion und Manifestation von Brahman ist. »Ich bin durchaus bereit zu glauben, dass das Bewusstsein irgendwie das grundlegende Substrat ist und wir alle nur in einem Traum oder in einer Simulation oder wo auch immer existieren«, erklärte Altman in einem Podcast von Lex Fridman. »Ich finde es interessant, wie sehr sich die Silicon-Valley-Religion der Simulation dem Brahman angenähert hat und wie ähnlich sie sich sind.«16
Mit anderen Worten: Die ganze Welt ist ein Traum. Und im Traum ist alles möglich.
Teil I
1985–2005
Kapitel 1
Chicago
Eine frische Brise wehte vom Lake Michigan herüber, als sich am 29. April 1983 am Navy Pier alles einfand, was in Chicago Rang und Namen hatte, um der Amtseinführung des ersten Schwarzen Bürgermeisters der Stadt beizuwohnen. Eine Kapelle spielte, während Harold Washington in dunklem Anzug und silberner Krawatte, die mit seinem grauen Schnurrbart und seinem von hellen Fäden durchwirkten Haar harmonierte, an der Seite seiner Verlobten, die am Revers ihres Blazers ein Ansteckbouquet aus Fuchsien trug, durch die Menschenmenge schritt. »Wir wollen Harold! Wir wollen Harold!«, skandierte die Menge, als er das Podium erreichte. Es war ein Neuanfang für die Stadt, die etwas mehr als zwei Jahrzehnte lang fest im Griff von Bürgermeister Richard J. Daley und der Parteimaschine der Demokraten gewesen war.17
Zur Überraschung aller hatte Harold Washington in den Vorwahlen der Demokratischen Partei nicht nur die amtierende Bürgermeisterin, sondern auch den Sohn des verstorbenen Daley geschlagen und sich anschließend gegen den republikanischen Kandidaten durchgesetzt, der mit dem unterschwellig rassistischen Slogan »Wählt Epton zum Bürgermeister, bevor es zu spät ist« ins Rennen gegangen war. Bei einer seiner Wahlkampfveranstaltungen war sogar das N-Wort an eine katholische Kirche geschmiert worden.18 (»Die Politik ist kein Ponyhof«, erklärte Washington häufig.19 Und so sah es auch der junge Barack Obama, der sich als Community Organizer in der Sozialarbeit für die Stadt engagierte und für Washington arbeitete. Schließlich nutzte Obama die von Harold Washington aufgebaute Koalition als Sprungbrett für seine eigene Karriere.) Washington verdankte seinen Wahlsieg am Ende einem sprunghaften Anstieg der Zahl registrierter Schwarzer Wählerinnen und Wähler sowie einer Koalition der lateinamerikanischen Bevölkerung mit der weißen Elite, den sogenannten »Lakefront Liberals«.20 »Meine Wahl ist das Resultat einer Graswurzelbewegung, wie es sie in der Geschichte der Stadt Chicago noch nicht gegeben hat«, erklärte der neue Bürgermeister vom Podium.21
In der Menschenmenge stand auch Jerry Altman und verfolgte stolz das Geschehen. Der ruhige, konservativ gekleidete Mann Anfang dreißig hatte sich in dieser Graswurzelbewegung engagiert. Jerry hatte tiefschwarzes, seitlich gescheiteltes Haar, fröhlich zwinkernde Augen, und er lachte gerne. Ein ganzes Jahr war er tagsüber mit dem Wahlkampftross von Washington unterwegs gewesen und war abends als Berater für bezahlbaren Wohnraum tätig. Nun sollte er im Übergangsteam des Bürgermeisters für den Wohnungssektor zuständig sein. Washington holte ausdrücklich Altmans Expertise ein, um eine Taskforce ins Leben zu rufen, die sich mit der Abwanderung von Vermietern beschäftigen sollte, die ihren Wohnungsbestand in den ärmeren Vierteln der Stadt immer häufiger aufgaben.22
Eine Romanze, die in einer Enttäuschung endete, hatte Jerry nach Chicago geführt, und so war er schließlich in der Hochburg des Community Organizing, einer spezifischen Form von Gemeinwesenarbeit, hängengeblieben, die Aktivistinnen wie beispielsweise Gail Cincotta hervorgebracht hatte. Die Mutter von sechs Kindern wohnte in einem Viertel, aus dem sich die weiße Bevölkerung zurückzog. Aus Empörung über die schlecht finanzierten Schulen, auf die sie ihre Kinder schicken musste, organisierte sie eine landesweite Kampagne gegen die weitverbreitete Praxis des sogenannten »Redlining«, die Benachteiligung bei der Kreditvergabe aufgrund von ethnischen Merkmalen innerhalb eines Viertels. So kam es schließlich zum Community Reinvestment Act von 1977.23 Jerry tat sich mit Cincotta und ihrem Mitstreiter Shel Trapp zusammen, die gemeinsam auch schon mal eine Ratte an die Tür eines Stadtrats nagelten, um gegen die Tatenlosigkeit der Kommune in Sachen Schädlingsbekämpfung zu protestieren. Zudem arbeitete Jerry mit Leuten aus dem Umkreis von Saul Alinsky zusammen, dessen kämpferisches Engagement Chicago zum Vorbild für viele Aktivistinnen und Aktivisten machte – und ihn selbst auf alle Zeit zum Feindbild der Rechten.
Jerry war jedoch kein Community Organizer im eigentlichen Sinne, und ganz gewiss nagelte er niemandem Ratten an die Tür. Er war Finanzexperte mit einem besonderen Interesse für das Thema bezahlbarer Wohnraum und der festen Überzeugung, Geschäftsleute durch kreative Deals dazu bringen zu können, in ihrem eigenen Interesse auch Unterkünfte für die weniger Betuchten zu schaffen. Bereits nach wenigen Jahren hatte er mit seinen Ideen auch Erfolg. Unter geschickter Ausnutzung der Steuergesetzgebung leistete er Pionierarbeit bei der Finanzierung von erschwinglichem Wohnraum. Sein innovatives System wurde zum Vorbild für ein Bundesprogramm, das dies mit Steuergutschriften förderte. Dieser sogenannte Low-Income Housing Tax Credit ist bis heute das wichtigste Instrument für den Bau von bezahlbarem Wohnraum.
»Es war eine Bewegung«, sagte Leroy Kennedy, ein Mitarbeiter von Jerry in der hierfür von Bürgermeister Washington aufgestellten Taskforce. »Da war Enthusiasmus und Schwung dahinter, man spürte die Begeisterung, dass sich endlich mal jemand darum kümmerte, was in der Stadt los war.«
Jerry Altman war als jüngster Sohn eines Schuhfabrikanten in Clayton aufgewachsen, einem wohlhabenden Vorort von St. Louis. Die Geschichte der Altmans ist typisch für viele jüdische Einwanderer und Unternehmer. Jerrys Großvater, Sam Altmans Urgroßvater Harry Altman, kam in Płońsk zur Welt, einer vorwiegend von Juden bewohnten Stadt nordwestlich von Warschau. Das Königreich Polen unterstand zu jener Zeit als »Kongresspolen« dem Russischen Kaiserreich. Er hatte sich mit seiner Frau Birdie nach Westeuropa abgesetzt, um nicht im 1904 ausbrechenden Russisch-Japanischen Krieg kämpfen zu müssen. Harry ging zunächst allein in die Vereinigten Staaten. Nach einem Zwischenaufenthalt in New York begann er in der Kleinstadt Nicholls im Bundesstaat Georgia für die Familie Pizitz, die im Süden der USA eine Kaufhauskette besaß, als Straßenhändler zu arbeiten. Nach zwei Jahren hatte er genug Geld zusammengespart, um Birdie nachkommen zu lassen, die in dem Laden von Pizitz zu arbeiten begann, den die Altmans später kauften.24
Das Paar hatte fünf Kinder. Eine Tochter, Minnie, starb bereits im Kindesalter an der Spanischen Grippe. Die Überlebenden waren Sam, Jack, Sol und Reba. Die Altmans waren nicht besonders religiös, trotzdem gefiel es Birdie nicht, dass ihre Kinder in der kleinen Südstaatenstadt völlig von ihrem orthodoxen jüdischen Erbe abgeschnitten aufwachsen sollten. Deshalb arrangierte sie den Verkauf des Familienunternehmens in Nicholls und den Kauf eines Ladens in Atlanta. Der Deal ging schief, doch Birdie zog vor Gericht und gewann schließlich vor dem Obersten Gerichtshof von Georgia.25 »Meine Urgroßmutter hatte viel mehr Geschäftssinn als mein Urgroßvater«, erklärte später Sunny Altman, Enkelin von Sol.
Nachdem sich Birdies Plan, die Familie in Atlanta anzusiedeln, zerschlagen hatte, zogen die Altmans in die Hafenstadt Brunswick im Bundesstaat Georgia. Sie wagten einen Neuanfang, kauften in Konkurs gegangene Geschäfte auf, veräußerten den Warenbestand und anschließend die Immobilien. Darunter war auch ein Schuhgeschäft in North Carolina, das einem Brand zum Opfer gefallen war, dessen Inventar aber gerettet werden konnte. Ihr Sohn Jack, noch nicht ganz achtzehn Jahre alt, eröffnete mit der Ware Altman’s Shoes in der Newcastle Street, der Hauptstraße der Stadt.26
Das Geschäft florierte, und Birdie holte schon bald weitere Mitglieder der Familie aus Europa nach, die ebenfalls Geschäfte in Brunswick eröffneten. Der älteste Sohn der Altmans, Sam, machte gleich nach dem Schulabschluss in derselben Straße ein Geschäft für Damenbekleidung auf, Altman’s Feminine Apparel. Abgesehen vom jüngsten Sprössling Sol, der eine Karriere als Anwalt einschlug, suchte der Altman-Clan sein Glück im Bekleidungs- und Schuhgeschäft. Reba eröffnete mit ihrem Ehemann Phil Salkin in Brunswick einen weiteren Schuhladen namens Salkin’s. Jack besuchte zunächst die University of Georgia, kehrte aber nach Brunswick zurück und fertigte fortan Maßschuhe für wohlhabende Kunden an, die während der Weltwirtschaftskrise im Hotel The Cloister auf der nahe gelegenen Sea Island logierten.
Während des Zweiten Weltkriegs flog Jack mit dem Geschwader der »Aleutian Tigers« Einsätze im Pazifik. Als Verwundeter wurde er 1942 in einem Krankenhaus in St. Louis versorgt. Dort lernte er Sylvia Harris kennen, eine schöne, dunkelhaarige junge Frau, die dort als Freiwillige Dienst leistete. Sie entstammte einer angesehenen jüdischen Familie im nahe gelegenen University City, und ihr Vater war in führender Position beim Versicherungskonzern Metropolitan Life tätig. Die Trauungszeremonie fand im Temple Israel statt, einer der ältesten Synagogen des Reformjudentums.
St. Louis, zu jener Zeit das Zentrum der amerikanischen Schuhindustrie, war der ideale Ort für einen Schuhdesigner. Großbetriebe wie die International Shoe Company, Brown Shoe und Hamilton-Brown hatten dort während des Ersten Weltkriegs mehr als die Hälfte des Schuhwerks für das US-Militär produziert.27 »Führend in Spirituosen und Schuhen, Schlusslicht in der American League«, so scherzten die Einwohnerinnen und Einwohner von St. Louis gerne über ihre Stadt und ihr nicht sonderlich erfolgreiches Baseballteam, die St. Louis Browns. Jack begann mit einem Partner unter dem Namen Joy’s Shoemakers zusammenzuarbeiten. Seine Entwürfe erregten die Aufmerksamkeit eines Engländers namens Sam Wolfe, der eine Handvoll Schuhfirmen besaß. Zusammen gründeten sie die Deb Shoe Company, die modische Damenschuhe nach Entwürfen herstellte, die Jack auf Erkundungsreisen nach Vorbildern europäischer Modelle angefertigt hatte. Aus Italien brachte er für seine weiblichen Familienangehörigen Schuhe von berühmten Designern wie beispielsweise Ferragamo mit. Die Geschäfte liefen so erfolgreich, dass Deb expandierte und drei Schuhfabriken in Washington (im benachbarten Bundesstaat Missouri) eröffnete. Dort waren die Gewerkschaften nicht so einflussreich und die Produktionskosten niedriger.
Die Altmans ließen sich in Clayton nieder, einem wohlhabenden Vorort von St. Louis, und bekamen drei Kinder: Gail, Jack junior und Jerold, den alle nur Jerry nannten. Die Kinder besuchten die angesehenen öffentlichen Schulen von Clayton und verbrachten die Sommerferien bei ihren Cousins und Cousinen in Georgia. Im Januar 1958, als Jerry sieben Jahre alt war, erlitt seine Großmutter Birdie einen Schlaganfall. Seine Mutter reiste nach Brunswick, um sich um ihre Schwiegermutter zu kümmern. Beladen mit Einkäufen, rutschte Sylvia dort eines Tages vor einem Schuhgeschäft in der Newcastle Street auf dem nassen Pflaster aus und brach sich die Hüfte. Im Streckverband wurde sie nach St. Louis geflogen und sollte nie wieder das Bett verlassen. Nach einer sechsmonatigen Tortur starb sie im Alter von sechsunddreißig Jahren an einer Infektion.28
Sylvias Tod führte zu einer tiefen Kluft in der Familie. Zwei Jahre später heiratete Jack Altman, ein kräftiger, breitschultriger Mann mit beginnender Glatze und einem runden, etwas strengen Gesicht, seine Sekretärin Thelma Noerper, eine zierliche blonde Frau, die nicht viel größer als ein Meter fünfzig war. Noerper, bereits geschieden, brachte eine erwachsene Tochter namens Sally mit in die Familie. Im Unterschied zu seinen älteren Geschwistern, dem dreizehnjährigen Gail und dem zehnjährigen Jack junior, akzeptierte Jerry Thelma schnell als neue Mutter. »Jerry war noch ziemlich klein«, sagte sein Cousin Richard Altman. »Mit sieben oder acht Jahren ist das für ein Kind einfacher. Er entwickelte eine enge Beziehung zu Thelma, die anderen nie.«
Jerrys Vater, ein Arbeitstier, war ständig mit dem Vertriebsteam der Firma auf Achse. Und wenn er nach Hause kam, sollte alles so sein, wie er es sich vorstellte. »Jack war ein sehr fordernder, aber im Grunde unsicherer Mensch«, sagte Bob Nawrocki, Sallys Sohn. »Er hat seine Kinder stark kontrolliert. Ich denke, Jerry hat sich daher eher Thelma zugewandt.«
Jack junior schaute zu seinem Vater auf und arbeitete in den Ferien in der Schuhfabrik. Am Schabbat gingen sie in die Synagoge, nur sie beide. Als Jack die Familie 1965 für drei Wochen auf eine Geschäftsreise nach Europa mitnahm, verbrachte er mit seinem Sohn ganze Tage damit, heimlich mit einer Minikamera von Minolta Designerschuhe zu fotografieren. Es dauerte nicht lange, und ähnliche Modelle tauchten in den Schaufenstern des Mittleren Westens auf.
Jerry war ganz anders als sein Vater, es missfiel ihm, dass dessen Gedanken immer nur ums Geschäft kreisten. »Jerry ist einer der einfühlsamsten Menschen, denen ich je begegnet bin«, sagte Nawrocki. Er hörte nie ein schlechtes Wort von ihm über seinen Vater. Doch als Nawrocki einmal erwähnte, was für ein guter Großvater Jack für ihn gewesen sei, erwiderte Jerry nur: »Na, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht.«
Jack und Thelma schickten ihre Kinder in den ersten Jahren auf öffentliche Schulen, zweifelten aber bald daran, dass ihre Jungs dort richtig gefördert wurden. So kamen sie schließlich auf die St. Louis Country Day School für Jungen, die auch Jerry ab der fünften Klasse besuchte. Diese Schule im noblen Vorort Ladue stand bei den alteingesessenen Familien von St. Louis in hohem Ansehen. Jerry war bei seinen Mitschülern beliebt, obwohl er ein wenig eigenbrötlerisch war. »Jerry war ein eher stiller Typ, hatte aber viel Humor und spielte gerne Baseball«, erinnerte sich sein Klassenkamerad Ed Hall. »Er war ein herzensguter Mensch.« Das Lernen fiel ihm leicht, an Sport zeigte er weniger Interesse. Er lernte gerne Russisch und spielte bei einer Schultheateraufführung des russischen Märchens Iwan Zarewitsch, der Feuervogel und der Graue Wolf mit.29 Mit sechzehn fuhr Jerry einen sandfarbenen 1966 Pontiac Tempest. Er legte höchsten Wert darauf, dass das Fahrzeug innen wie außen stets tadellos gepflegt war. Etliche Jahre später sollte auch Sam Altman ein Faible für Autos entwickeln – allerdings viel, viel schnellere Exemplare.
1969, als Jerry die Schule abschloss, gab es in St. Louis große Spannungen zwischen der weißen Bevölkerung und People of Color, die sich insbesondere an der Wohnsituation aufluden. Wie in vielen amerikanischen Städten nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Familien aus der weißen Mittelschicht mit ihren Steuerzahlungen in die umliegenden Vorstädte abgewandert. In St. Louis, in einem früheren Sklavenhalterstaat gelegen, hielt sich die Rassentrennung besonders lange. Das wirkt immer noch nach – fährt man über den Delmar Boulevard, auch als »Delmar Divide« (Del-Mar-Trennlinie) bekannt, dann sieht man bis heute im Süden lauter schöne Häuser, in denen vorwiegend Weiße wohnen, während der von der Schwarzen Bevölkerung bewohnte Norden von Armut und Verfall geprägt ist. Die Kluft verstärkt sich noch, wenn man die Innenstadt von St. Louis mit den umliegenden Vororten im St. Louis County vergleicht.
Bis 1950 war für achtzig Prozent der Häuser im St. Louis County urkundlich festgelegt, dass dort nur Weiße wohnen durften.30 Das war in vielen Städten üblich, bis schließlich ein Prozess um einen Fall in St. Louis, Shelley v. Kraemer, der bis zum Obersten Gerichtshof durchgefochten wurde, für ein Verbot dieser Praxis sorgte. Unterdessen ließ die Stadtplanung im Zuge der Beseitigung von Slums systematisch die ärmeren, von der afroamerikanischen Bevölkerung bewohnten Viertel wie beispielsweise Mill Creek Valley abreißen. Die Menschen wurden in die dreiunddreißig elfstöckigen Gebäude der Siedlung Pruitt-Igoe gepfercht, deren Name Ende der 1960er Jahre zum Synonym für gescheiterte Wohnungspolitik wurde.31
Das 1954 fertiggestellte Wohnungsbauprojekt sollte ursprünglich zwei Komplexe auf dem dreiundzwanzig Hektar großen Gelände haben: einen für Schwarze, benannt nach Wendell O. Pruitt, einem afroamerikanischen Kampfpiloten im Zweiten Weltkrieg, und einen für Weiße, benannt nach dem US-Kongressabgeordneten William Igoe. Doch ein Gerichtsurteil von 1955 setzte der Praxis der Segregation im öffentlichen Wohnungsbau ein Ende, und schließlich zogen dort fast ausschließlich Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner ein. Pruitt-Igoe war ein Projekt der Bundesregierung gewesen, doch der Betrieb und Erhalt wurde der Stadt St. Louis überlassen, die sich dieser Aufgabe nicht gewachsen zeigte. Die Polizei nannte die Wohnsiedlung »Korea« oder »Fort Apache« und wagte sich meist nur in Begleitung von Hunden hinein.* Im Jahr 1969 entschied sich die klamme Wohnungsbehörde der Stadt, die Mieten in dem Wohnkomplex um das Sechsfache zu erhöhen. Mehr als tausend Bewohnerinnen und Bewohner von Pruitt-Igoe traten daraufhin in den Mietstreik. Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, protestierten sie in Clayton auch vor dem Haus des Behördenleiters und drohten damit, dort eine Zeltstadt zu errichten. In einer Pressemitteilung kündigte eine Aktivistengruppe an, »sämtliche von Zwangsräumung betroffenen Mieterinnen und Mieter von Sozialwohnungen, die sich dazu bereit erklären, nach Clayton zu bringen, um dort das menschliche Leid und die Armut sichtbar zu machen, die in den städtischen Konzentrationslagern des sozialen Wohnungsbaus herrscht«.32 Die Wohnungsbehörde gab den Forderungen der Demonstrierenden schließlich nach. Drei Jahre später wurde der Abriss von Pruitt-Igoe landesweit im Fernsehen übertragen.
Jerry kannte Pruitt-Igoe gut, er war dort einen Sommer lang mit einem Good-Humor-Eiscremewagen unterwegs gewesen. Verdient hatte er dort gut, wollte sich nach Einbruch der Dämmerung aber nicht in dem Viertel aufhalten. Von dem Mietstreik, der sich im Frühjahr seines letzten Schuljahres zuspitzte, bekam man an der Country Day nicht viel mit. »In dieser Schule waren wir weitgehend abgeschottet von der realen Welt«, berichtete Jerrys Klassenkamerad und Freund Walker Igleheart. Doch Jerry hatte eine empfänglichere soziale Antenne als andere. »Er war jemand, der etwas Positives in der Welt bewirken wollte«, erinnerte sich Joe Rechter, ebenfalls ein Mitschüler. Jerry wusste bloß noch nicht, wie.
Erste Ideen dazu entwickelte er während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften an der Wharton School der University of Pennsylvania. »Er interessierte sich sehr für Wohnungspolitik und machte sich Gedanken, wie man den Wohnungsmarkt gerechter gestalten könnte«, sagte Leah Bird, die sich dort mit ihm anfreundete. Sie diskutierten viel über Politik, insbesondere über Frank Rizzo, den umstrittenen Bürgermeister von Philadelphia. »Ihm war klar, dass man die Gesetze ändern musste«, sagte Bird. Altman mischte ein wenig in der Kommunalpolitik von Philadelphia mit. Er arbeitete dort auch in einem Schuhgeschäft, zeigte aber kein Interesse, in das Familienunternehmen einzusteigen.
Stattdessen entschied Jerry sich für eine Karriere in der Kommunalverwaltung und wurde Stadtplaner in Hartford im Bundesstaat Connecticut. Dort legte er dem Stadtrat abenteuerliche Pläne vor, wie beispielsweise 25.000 Dollar für eine Studie bereitzustellen, um »die Möglichkeit der Gründung eines kommunalen Unternehmens zur Herstellung von Solarenergieprodukten« zu untersuchen. Seine Strategie ähnelte schon sehr stark dem späteren »Altmanismus« seines Sohns Sam: Er setzte darauf, Bundeszuschüsse zu erhalten, umgab sich mit einer Aura von Autorität und versicherte, dass er keinerlei persönliche Gewinnabsichten verfolge. Jerry sprühte geradezu vor Begeisterung über seine neuen Ideen, gemeinnützige Unternehmen zu schaffen. »Ein kommunales Unternehmen, bei dem nicht die Gewinnerzielung im Mittelpunkt steht, könnte Beschäftigungs- und Ausbildungsprogramme auflegen, wie sie Privatunternehmen kaum je in den Sinn kommen«, argumentierte er gegenüber der Zeitung Hartford Courant.33
Schon bald hatte Jerry die Stelle eines stellvertretenden Stadtdirektors inne und ging mit Megan O’Neill aus, der Tochter eines Richters und Abgeordneten im Repräsentantenhaus von Connecticut. Megan studierte zu dieser Zeit Jura und arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hartford Institute of Criminal and Social Justice. »Die Menschen hatten damals Hartford in Scharen verlassen«, sagte Frank Hartmann, der das Institut leitete und sowohl Jerry als auch Megan kannte. »Die Frage war also: Wie kann man dafür sorgen, dass Hartford wieder eine lebenswerte Stadt wird?« Megan führte eine fünfjährige Studie über die Sicherheit in Wohngebieten durch. Im Ergebnis plädierte sie für die Art von Zusammenarbeit zwischen Polizei und Einwohnerschaft, die später als »Community Policing« bekannt werden sollte.34
»Sie war ziemlich tough«, meinte Hartmann, der sie sehr positiv in Erinnerung hatte. »Sehr klug. Nahm nie ein Blatt vor den Mund. Jemand, mit dem man rechnen musste.« Megan brachte es später zur stellvertretenden Justizministerin auf bundesstaatlicher Ebene. Auch Jerry ist Hartmann als »ausgesprochen intelligent« im Gedächtnis geblieben. »Hartford war eindeutig zu klein für ihn. Niemand erwartete, dass er dort hängenblieb.«
Jerry und Megan heirateten 1977 im Garten hinter dem malerischen Haus der O’Neills in West Hartford. In der Heiratsanzeige, die in der





























