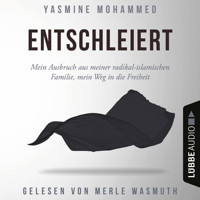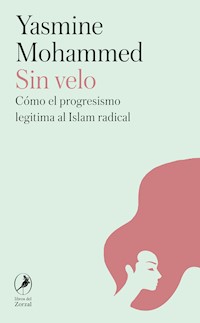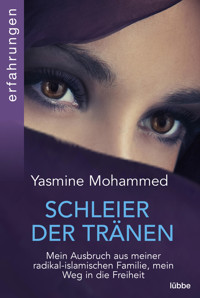
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Yasmines Stiefvater ist hochrangiger Al-Qaida-Stratege, er schlägt sie brutal, wenn sie ihre Suren nicht auswendig kann. Ihre Mutter schützt sie nicht, sondern beteiligt sich sogar an der Gewalt. Als Drittfrau von "Onkel Mounir" zieht sie mit ihren Kindern in eine elende Kellerwohnung, lässt zu, dass ihre Kinder beschimpft, schikaniert, bestraft, geschlagen und Yasmine sogar sexuell von ihm belästigt wird. Als Yasmine sich einem Lehrer anvertraut, nimmt ihr Leben eine dramatische Wendung... Aber "Schleier der Tränen" ist nicht nur eine Kindheitsgeschichte. Mit zwanzig wurde Yasmine in eine Ehe mit einem hochrangigen Al Quaida-Mitglied gedrängt, aus der sie sich erst lösen konnte, als ihrer Tochter die genitale Verstümmelung drohte. Yasmine Mohammeds Leben ist die Geschichte der Befreiung aus der Fremdbestimmung in die Freiheit, hin zu persönlichem Glück und Engagement für andere Opfer von Fundamentalismus.#Freeheartsfreeminds #NoHijabDay
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumZitateFür TiffersWidmungVorwortZitat von Roald DahlPROLOGGEWALT IGEBETUNTERWERFUNG IÄGYPTENEHREWICHTELNMISSBRAUCHJUDENUNTERWERFUNG IIHIDSCHABMUSLIMISCHE SCHULEVERRATMÜTTERDEPRESSION ITIFFERSVERLASSENDEPRESSION IIAUF EIGENEN FÜSSENDAHEIMUNTERWERFUNG IIIGEWALT IIMEIN BABYAL-KAIDAFLUCHTHAUSARRESTALLEINDER ELEFANTFREIHEITZWEIFELWIEDERAUFBAUWAYNEDOHALIEBESICH WEHRENHOFFNUNGDANKSAGUNGTafelteilÜber dieses Buch
Yasmines Leben ist stellvertretend für so viele andere Frauen in radikal-islamischen Familien: Sie lebt in Kanada, einer westlichen Gesellschaft, doch zu Hause erlebt die intelligente, selbstbewusste junge Frau Entrechtung, Gewalt und religiösen Terror, vor allem durch ihren Stiefvater, einen hochrangigen Al-Quaida-Funktionär. Als er noch dazu übergriffig wird, klagt Yasmine ihn an, doch das Unfassbare geschieht: die Richterin lehnt die Klage wegen »kultureller Unterschiede« ab. Was muss passieren, damit Frauen wie Yasmine beschützt werden?
Über die Autorin
Die kanadische Menschenrechtsaktivistin Yasmine Mohammed setzt sich für die Rechte von Frauen ein, die in mehrheitlich islamischen Ländern leben, sowie für diejenigen, die unter religiösem Fundamentalismus leiden. Yasmine ist auch die Gründerin von Free Hearts Free Minds, einer Organisation, die Ex-Muslimen aus mehrheitlich muslimischen Ländern – wo auf das Verlassen des Islam die Todesstrafe steht –, psychologische Unterstützung bietet. Heute lebt sie in Kanada mit ihren beiden Töchtern, die ihr wunderschönes Haar offen tragen, und mit ihrem liebevollen, unterstützenden Ehemann, der keine Ahnung hatte, was ihm bevorsteht, als er sie vor über einem Jahrzehnt heiratete. Schleier der Tränen ist ihr erstes Buch. Mehr über Yasmine unter www.YasmineMohammed.com
Y A S M I N E M O H A M M E D
SCHLEIER DER TRÄNEN
Mein Ausbruch aus meiner radikal-islamischen Familie, mein Weg in die Freieheit
Übersetzung aus dem Englischen vonMagdalena Breitenbach
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der kanadischen Originalausgabe:»Unveiled«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2019 by Yasmine Mohammed
Published by arrangement with the author
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Beate deSalve, Pulheim
Covergestaltung: Tanja Østlyngen unter Verwendung von Motiven von © conrado/shutterstock
Einband-/Umschlagmotiv: © 123rf.com/ Jakub Gojda
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1502-7
luebbe.de
lesejury.de
Wer sich dafür interessiert, wie Menschen schwierige Zeiten überstehen, sollte dieses Buch lesen. Yasmine ist einer der tapfersten Menschen unserer Zeit – und uns allen ein leuchtendes Vorbild.
Ayaan Hirsi Ali, Autorin von Mein Leben, meine Freiheit
Zu viele von uns erkennen nicht, dass die Hauptopfer der unfassbaren Grausamkeit, die durch ein fanatisches Befolgen des Islam verursacht wird (vom herrschsüchtigen, auch die winzigsten Alltagsdetails durchdringenden Kontrollwahn ganz zu schweigen), die Muslime selbst sind. Vor allem die Frauen. Yasmine Mohammeds herzzerreißendes, mutiges und wunderbar geschriebenes Buch führt uns das auf eine Weise vor Augen, die letztendlich auch die fehlgeleiteten unter den wohlmeinenden, liberalen Apologeten in unserer Mitte umstimmen sollte.
Richard Dawkins, Autor von Der Gotteswahn
Frauen und Freidenker schleppen in traditionellen muslimischen Gemeinschaften eine doppelte Bürde mit sich. Wenn sie in der modernen Welt leben wollen, haben Sie nicht nur die Theokraten in ihren Familien und Schulen gegen sich, sondern auch viele laizistische Liberale – deren Desinteresse, Scheinheiligkeit und »Rassismus«-Unterstellungen einen weiteren Schleier über ihre Leiden breiten. In Schleier der Tränen nimmt Yasmine Mohammed diese Herausforderung mit ungeheurer Courage an und straft so den gefährlichen Gedanken, dass jede Kritik an der islamischen Lehre eine Form von Bigotterie sein müsse, Lügen. Lassen Sie sich von Yasmines Weisheit und ihrem Mut inspirieren.
Sam Harris, Autor von Das Ende des Glaubens
Insiderberichte stellen eindrucksvolle Zeugnisse dar. Da bildet Yasmines zutiefst berührende, zuweilen bedrückende, jedoch auch Hoffnung schenkende Geschichte keine Ausnahme. Ehemalige Musliminnen sind wahrscheinlich die am meisten unterdrückte Minderheitengruppe der Welt. Nennen Sie mir eine andere persönliche Entscheidung, die in Ländern, die wir als unsere Verbündeten betrachten, zu ehrbezogener Gewalt bis hin zu Lynchmorden führt. Liberale sind zu nichts nutze, wenn sie solche Minderheiten innerhalb von Minderheiten vernachlässigen. Und Muslime in aller Welt müssen diese Willkür in unseren Reihen begreifen. Ich hoffe, dass Yasmines mutiger persönlicher Bericht dazu beitragen wird, das so dringend benötigte Bewusstsein dafür zu schärfen.
Maajid Nawaz, Autor von Radical
Yasmine Mohammed ist eine sehr mutige Frau und ein leuchtendes Vorbild für alle Frauen, die unter dem Deckmantel von Religion oder Kultur Missbrauch ausgesetzt sind. Yasmines Geschichte ist gleichzeitig tragisch und fesselnd. Sie hat etwas überstanden, was kein Mensch erdulden sollte. Ihre Geschichte ist eine des Muts und der Beharrlichkeit, denn: »Für Missbrauch gibt es keine Entschuldigung.«
Raheel Raza, Autorin von Their Jihad, Not My Jihad
Für Tiffers
WIDMUNG
Dieses Buch widme ich allen, die sich von dem enormen Druck und den entsetzlichen Drohungen des Islam erschlagen fühlen. Ich hoffe, meine Geschichte wird Ihnen helfen und Sie dazu inspirieren, sich zu befreien und Ihre herrlichen Flügel auszubreiten.
Doch ich widme es auch jenen, die meinen, alle Muslime dämonisieren zu müssen. Ich hoffe, Sie werden entdecken, dass wir alle nur Menschen sind und jeder von uns mit seinen eigenen Dämonen ringt.
Dieses Buch ist für alle, die es als ihre Pflicht betrachten, den Islam vor Kontrolle und Kritik in Schutz zu nehmen. Ich hoffe, Sie werden begreifen, dass Sie jedes Mal, wenn Sie von Kritik ablenken, auch das Licht daran hindern, auf Millionen von Menschen zu fallen, die im Dunkeln gefangen sind.
Und »last«, aber definitiv »not least« widme ich dieses Buch meinen MitstreiterInnen, allen anderen Ex-Muslimen und Freidenkern sowie all meinen Mit-Atheisten und Mit-Störenfrieden.
VORWORT
von Rick Fabbro
Am 17. Juli 2018 um 11 Uhr 26 klingelte mein Telefon. Da ich nie so recht weiß, welcher Klingelton zu welcher App gehört, scrollte ich mich durch E-Mails, Facebook, Twitter und die Buchstabenspiele, die ich mit Freunden spiele. Schließlich öffnete ich eine SMS.
»Hi Mr Fabbro. 1988/89 war ich in Ihrer Theatergruppe für die achten Klassen … Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern …«
Beim Lesen setzte mein Herzschlag für eine Sekunde aus. Tränen liefen mir über die Wangen.
»Ich erinnere mich nicht nur an dich, liebe Yasmine, ich habe in den letzten dreißig Jahren auch oft an dich gedacht!«
Ganz deutlich erinnerte ich mich an das mutige dreizehnjährige Mädchen, das mir im Büro gegenübersaß und mir Schrecken schilderte, die unsere Fassungskraft hinsichtlich dessen, was ein Mensch einem anderen an Grausamkeit antun kann – von einem so hilf- und harmlosen Wesen ganz zu schweigen –, übersteigt. Yasmine zeigte sich entschlossen, mit ihrer Geschichte zu den Behörden zu gehen, die sie aus ihren haarsträubenden häuslichen Verhältnissen retten würden.
Die Behörden wurden eingeschaltet, und ich sah sie nie wieder. Ich ging davon aus, dass man sie in einem sicheren Zuhause untergebracht hatte und alles gut war. Zum Jahresende wurde ich an eine andere Schule versetzt und fragte mich, wie es mit Yasmine wohl weitergegangen war.
»Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Es hat damals nicht geklappt, weil der Richter meinen Missbrauch durch die Familie als ›kulturelle Freiheit‹ betrachtete.«
Mir wurde mulmig. Ich dachte nicht nur daran, wie ihr Leben in den letzten dreißig Jahren wohl verlaufen war, sondern hatte brennende Fragen. Wir verabredeten ein Treffen. Wir umarmten uns. Wir redeten und weinten. Sie bat mich, einen Entwurf dieses Buches zu lesen.
Schleier der Tränen erzählt die ganze fesselnde Geschichte. Und es beantwortet die Fragen. Egal ob Familie, staatliche Behörden, religiöse oder kulturelle Mächte, sie alle versuchten, ihre Macht über Yasmine auszuüben. Das Buch erzählt, wie Yasmines Mut und Entschlossenheit, trotz der Augenblicke, in denen sie sich geschlagen fühlt, letztendlich den Sieg davontragen.
Dies ist ein wichtiges Buch, nicht nur wegen der packenden persönlichen Story, sondern auch, weil Yasmines Geschichte kein Einzelfall ist. Ihre Stimme sollten alle Menschen auf der Welt hören, die unterdrückt und ihrer Chance auf ein freies Leben beraubt werden.
Rick Fabbro
Über meine Probleme zu sprechen war mir unmöglich. Es war mir einfach zu peinlich, und ohnehin fehlte mir der Mut. Was immer ich einmal an Mut besessen hatte, wurde schon als Kind aus mir herausgeprügelt. Doch auf einmal verspürte ich den geradezu verzweifelten Wunsch, jemandem alles zu erzählen.
Roald Dahl, Matilda
PROLOG
Dass ich als Muslimin aufgewachsen bin, sollte im Grunde nicht mehr als eine ferne Erinnerung sein. Schon 2004 habe ich mit dieser Herkunft gebrochen. Aber die traumatische Welt, in die ich hineingeboren wurde, hat mich geprägt. Und sie steckt mir in den Knochen, liegt mir im Blut. Ich entkomme ihr nicht. Ich habe es einmal gedacht. Dachte, ich würde von vorn beginnen, mich neu erfinden, ein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen führen. Aber dann merkte ich, dass ich mir selbst nicht entkommen kann. Allein die Assoziationen in meinem Kopf, die instinktiven Reaktionen meines Körpers – nichts davon habe ich unter Kontrolle. Und ich kann auch kein völlig neuer Mensch werden. Manchmal denke ich, dass ich es vielleicht überstanden habe, vielleicht ein »normales« Leben führen kann. Aber kaum lässt die Wachsamkeit nach, erhebt eine schlummernde Erinnerung ihr hässliches Haupt.
Der Boden, auf dem ich aufwuchs, das Wasser, das mich nährte, alles war von Verrat, Angst und Lügen, von Heimtücke, Zorn und Traurigkeit und viel, viel Missbrauch getränkt. Von außen betrachtet mag ich wie ein gesunder Baum wirken, doch die Wahrheit verbirgt sich in den Wurzeln. Es gelingt mir, alle um mich herum zu täuschen. Freunde, die mich seit Jahren kennen, ahnen nichts. Sie sagen Dinge wie: »Aber du wirkst so normal!«, »Und wieso bist du nicht völlig bekloppt?«, oder: »Das hätte ich niemals gedacht!«
Nicht einmal mein Mann kann die Geschichten dieses Mädchens, dessen Leben so weit entfernt ist von seinem, mit der Frau zusammenbringen, in die er sich einst verliebt hat. Wir begegneten uns, nur wenige Jahre nachdem ich die Verbindung zu meiner Familie gekappt hatte. Zwar war ich damals keineswegs geheilt, doch ich hatte gelernt, meinen Schmerz hinunterzuschlucken. Es gab kein Ventil dafür, niemand hätte mich verstanden. Ich wusste, Gespräche über den Islam erfüllten die Leute mit Unbehagen, sodass ich das ganze Thema beiseiteschob.
Erst Jahre nach meiner Abwendung vom Islam stieß ich durch Zufall auf Bill Mahers Facebook-Seite, auf der sich Ex-Muslime zu Ben Afflecks Reaktion auf Sam Harris’ Islamkritik äußerten. Ben Afflecks Ausraster, Harris’ Kritik sei »übel und rassistisch«, ist mittlerweile legendär, ja fast zum Klischee geworden.
Den Ausdruck »Ex-Muslim« hatte ich vorher noch nie gehört, hatte keine Ahnung, dass es noch andere wie mich gab. Ich behielt meine schmutzigen Geheimnisse für mich, denn mein Leben ist nicht politisch korrekt, und ich passe nicht ins bevorzugte Narrativ. Meine Lebensgeschichte ist eine unbequeme Wahrheit, und die Menschen bevorzugen nun mal ihre bequemen Lügen. Doch diese Reaktionen auf Ben Afflecks Tirade erweckten in mir den Wunsch, mich einzumischen.
Sam Harris, Neurowissenschaftler und Autor des bahnbrechenden Werkes Das Ende des Glaubens, war im Oktober 2014 in Bill Mahers Sendung zu Gast und sprach auf die für ihn charakteristische souveräne und dennoch zurückhaltende Art über den Islam. Er näherte sich dem Thema mit derselben akademischen Strenge, mit der er auch seine Forschungen zu den Weltreligionen betreibt. Er sprach über den Islam nicht anders, als er über das Christen- und Judentum sowie viele andere Religionen und Ideologien gesprochen hatte – indem er Fakten präsentierte.
Zu Beginn des Gesprächs beklagte er gemeinsam mit Bill Maher, dass die Liberalen bedauerlicherweise nicht für ihre liberalen Werte einträten. Bill erzählte, dass sein Publikum Prinzipien wie Rede- und Religionsfreiheit oder die Gleichberechtigung von Frauen, Minderheiten und LGBT zwar stets mit lautem Beifall belohne, dieser Applaus jedoch abrupt verstumme, sobald irgendjemand erwähne, dass diese Prinzipien in der muslimischen Welt leider nicht gewährleistet seien. Gerne, fügte Sam hinzu, kritisierten Liberale weiße oder christliche Theokratien, versäumten es jedoch, die gleichen Übel in der muslimischen Welt zu benennen. Gleichzeitig stellte er klar, dass der Islam als Religion (beziehungsweise Ansammlung von Ideen) etwas völlig anderes sei als die Muslime, sprich die Menschen.
Quasi wie aufs Stichwort beschloss Ben Affleck, der im Film Dogma die Rolle eines gefallenen Engels gespielt hatte, sich als lebenden Beweis anzubieten und exakt jene Karikatur des von Sam beschriebenen verwirrten Liberalen zu verkörpern, indem er sowohl Bill als auch Sam Rassismus vorwarf. Er verglich sie mit Leuten, die Ausdrücke wie »Saujud« verwenden oder Dinge wie »Schwarze ballern sich halt gern gegenseitig ab« von sich geben. Er bestand darauf, dass Muslime »einfach nur in Ruhe gelassen werden wollten«, und demonstrierte damit genau jene Heuchelei, die Sam zuvor beschrieben hatte. War es für Ben Affleck – für den Mann, der einen Film gedreht hatte, in dem es vor allem um Kritik am und die Verhöhnung des Christentums ging – tatsächlich inakzeptabel, dass Sam Harris und Bill Maher ein sachliches Gespräch über den Islam führten?
Obgleich sowohl Bill als auch Sam Zahlen des Pew Research Center ins Feld führten – denen zufolge etwa neunzig Prozent der Ägypter glauben, dass Menschen, die sich von ihrer Religion abwenden, getötet werden sollten –, bestand Ben darauf, dass derart schlimme Vorstellungen nur von wenigen Muslimen geteilt würden.
Aus meiner Sicht war es unverzeihlich, dass Ben Affleck die Kritik an dieser Ideologie (die so viel Leid in die Welt gebracht hat) derart abschmetterte. Wenn muslimische Frauen in Iran oder Saudi-Arabien eingekerkert oder getötet werden, weil sie ihr Haar nicht bedecken, kümmert das in der Regel keinen im Westen. Niemanden scherte es, als Blogger in Bangladesch auf der Straße in Stücke gehackt wurden, weil sie es gewagt hatten, über Humanismus zu schreiben. Niemand störte sich daran, als Studenten in Pakistan zu Tode geprügelt wurden, weil sie den Islam infrage gestellt hatten. Doch nun unterhielten sich endlich Mainstream-Leute im Mainstream-TV über diese Themen, unter denen die muslimische Welt seit tausendvierhundert Jahren leidet – und dieser scheinbar wohlmeinende, mit »weißer« Schuld beladene Mann stellte sich dem in den Weg! Ich war stinksauer.
Ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, reden zu müssen. Ich wollte brüllen, wollte aufschreien, wollte mich Sam Harris in dieser Ideenschlacht anschließen. Aber ich hatte auch Angst. Mir war, als stünde ich auf einer Steilklippe, die über ein weites Meer hinausragt. Ich war sicher, befand mich auf dem Trockenen. Ich hatte mich aus den gefährlichen, unter mir tosenden Wassern herausgekämpft. Doch nun verspürte ich diesen überwältigenden Drang, wieder hineinzutauchen. Ich wollte andere kennenlernen, die dasselbe durchgemacht hatten wie ich, wollte meine Geschichten mit ihnen und allen teilen. Ich wünschte mir eine Gemeinschaft von Menschen, die meine latenten Ängste, Unsicherheiten und Obsessionen verstanden.
Es war ein gewaltiges Risiko. Kein Mensch in meinem Leben kannte meine Vorgeschichte. Nicht einer. Die einzige Person, die davon wusste, war ein paar Jahre zuvor verstorben. Ich hatte keine lebenden Zeugen. Ich konnte mich parallel zu diesen Vorgängen einfach entschließen, weiterzuleben wie immer, konnte mich gegen den Sprung von der Klippe entscheiden und für immer unauffindbar bleiben.
Oder ich konnte Mut beweisen, mich für den Sprung entscheiden, in Salzwasser und Tang eintauchen, ja sogar riskieren, darin zu ertrinken. Ich konnte mich entscheiden, die Perspektive zu wechseln und Freunde zu korrigieren, wenn sie erklärten, der Islam sei eine Religion des Friedens. Ich konnte mich entschließen, den Leuten mit meiner Geschichte Unbehagen einzuflößen, mich mit dem »Backlash« auseinanderzusetzen, den Freunden, die sich von mir distanzieren würden, und den Todesdrohungen.
Wäre ich vernünftiger gewesen, hätte ich einfach kehrtgemacht und eine möglichst große Entfernung zwischen mich und diesen Ozean gelegt. Ich kannte ihn ja, war schon mal dort gewesen. Es wäre so leicht gewesen, einfach umzudrehen, mein Leben auf dem sicheren, festen Land fortzusetzen, auf das ich mich einst unter Lebensgefahr gerettet hatte.
Doch ich entschied mich für den Sprung.
GEWALT I
»Nein, bitte! Bitte, es tut mir leid. Mama! Mama! Bitte!«
Ich liege auf meinem Bett, wie man es mir befohlen hat, und bettle verzweifelt, wie schon so oft. Ich fürchte den vertrauten Auftritt, obwohl er sich in diesem Augenblick direkt vor mir abspielt. Er packt mein Fußgelenk und zerrt mich ruckartig zum Fußende des Betts. Ich muss dem Drang, die Beine anzuziehen, widerstehen, denn dadurch wird es nur noch schlimmer. Ich weine so sehr, dass ich keine Luft mehr kriege, als er mein Springseil nimmt, um meine Füße ans Bett zu fesseln.
Er greift nach seinem orangefarbenen Lieblingsplastikstock, der den hölzernen, der immer wieder zerbrach, ersetzt hat. Erst war ich froh, weil ich mir von dem keinen Splitter einziehen konnte, doch mir war nicht klar gewesen, wie viel schmerzhafter dadurch die Schläge wurden. Die Farbe Orange werde ich für den Rest meines Lebens hassen.
Er peitscht mir damit die Fußsohlen. Die Fußsohlen sind die ideale Stelle, weil den Lehrern so die Narben verborgen bleiben. Ich bin sechs Jahre alt, und die Hiebe sind meine Strafe dafür, dass ich die Koransuren nicht richtig auswendig gelernt habe.
»Und, meinst du, dass du sie nächstes Mal richtig lernst?«
»Ja!«
Flehentlich sehe ich meine Mutter an. Warum sagst du nichts? Warum tust du nichts, um mich zu beschützen? Warum stehst du nur da?
Was hielt sie bloß zurück? Hatte sie Angst vor ihm? Sie hatte ihn doch gerufen! War es teilweise ihre Schuld?
In diesem Augenblick kann ich einfach nicht glauben, dass der einzige Elternteil, den ich kenne, mich einfach ausliefert, damit ich gefesselt und geschlagen werde. Er ist der Böse, nicht sie. So musste es sein.
Doch weshalb hat sie ihn dann angerufen und gebeten vorbeizukommen? Warum?
»Wenn ich das nächste Mal komme, will ich alle drei Suren hören, kapiert?«
»Ja …«
»Von welchen drei Suren spreche ich?«
Als ich nur für den Bruchteil einer Sekunde zögere, hebt er schon erneut die Hand. Ein Fünkchen Vorfreude glitzert in seinen Augen.
Wenn keine unverletzte Haut mehr vorhanden ist, auf der die Hiebe landen könnten, treffen sie auf meine schon wunden und zerrissenen Füße. Ich bin schweißgebadet. Mein Herz rast. Ich bekomme kaum Luft, doch ich weiß, es wird nicht aufhören, bis ich die Kraft finde, ihm zu antworten.
»Al-Fatiha, al-Kauthar und al-Ichlas.« Drei kurze Suren, die man für die fünf täglichen Gebete benötigt. Heiser, erstickt, kaum hörbar kommen mir die Worte über die Lippen.
»Wenn du einen Fehler machst – nur einen einzigen –, dann zeig ich dir, wie es wirklich wehtut.«
Schließlich löst er das Seil, wirft es zu Boden und geht hinaus.
Ich liege da und warte darauf, dass meine Mutter kommt und mich tröstet, doch sie kommt nicht. Nach jeder Züchtigung warte ich, aber sie kommt nie. Stets folgt sie ihm zur Tür, und ich höre ihre Stimmen, ihr Gelächter, während sie sich unterhalten. Atemlos warte ich darauf, dass die Wohnungstür ins Schloss fällt. Ich kann mich nicht entspannen, solange ich nicht weiß, dass er weg ist.
Nur langsam beruhigen sich meine Atemzüge, während ich dabei zusehe, wie die Scheinwerfer der unten vorbeifahrenden Autos über meine Zimmerdecke streichen. Wuuusch, wuuusch, wuuusch. Endlich rolle ich mich zusammen und stecke den Daumen in den Mund.
Trotz des Pochens in meinen Füßen und der unwillkürlichen Schluchzer, die mir schier die Brust zerreißen, falle ich in einen tiefen Schlaf. Es ist ein Schlaf, wie er nur auf Kämpfe folgt, die unsere Seele zu zerreißen drohen.
Völlig erschlagen wache ich mitten in der Nacht auf, mit dem schon gewohnten kalten, nassen Fleck unter mir. Aus Versehen berühre ich mit dem Fuß die Stelle, und das unerträgliche Stechen sorgt dafür, dass ich auf der Stelle hellwach bin. Ich weiß, ich muss ins Bad, aber bei dem Gedanken daran, wie weh es tun wird, wenn ich mit meinen kaputten Füßen auftrete, schießen mir gleich wieder die Tränen in die Augen.
Vorsichtig lasse ich meine Füße von der Bettseite baumeln. Sie sind geschwollen und mit Blutblasen bedeckt. Ich wappne mich, ehe ich sie auf den Boden setze. Ich weiß, dass die Blasen, wenn ich die Füße mit meinem gesamten Gewicht belaste, platzen können, doch ich muss mich auch beeilen, um das Pipi abzuwaschen, das in den offenen Wunden brennt.
Damit die wunden Stellen den Teppich nicht berühren, balanciere ich auf den Außenkanten meiner Füße. Langsam hoppele ich, suche bei jedem Schritt Halt – erst am Bett, dann an meiner Kommode, schließlich am Türknauf und an der Wand im Flur. Dieses Zerquetschen, wenn die Wunden dann unweigerlich aufreißen, ist etwas, woran ich mich auch nach fast vierzig Jahren noch lebhaft erinnere.
Doch all dieser Schmerz sei nichts – so versichert man mir –, verglichen mit dem Feuer der Hölle, das mich erwarte, sollte ich die Suren nicht memorieren. Aber bevor ich lerne, mir auf die Zunge zu beißen, melde ich erst mal Zweifel an.
»Wenn Allah mein Fleisch verbrennt und es danach wieder wachsen lässt, um es schließlich in alle Ewigkeit weiterschmoren zu lassen, werde ich mich dann nicht irgendwann dran gewöhnen?«
»Nein«, erwidert meine Mutter. »Allah sorgt dafür, dass es jedes einzelne Mal wieder genauso wehtut wie beim ersten Mal.«
Mir graute vor Allah, vor dem Tag des Gerichts, vor dem ewigen Höllenfeuer – nicht unbedingt Dinge, mit denen sich das Durchschnittskind gemeinhin herumschlägt. Na ja, das durchschnittliche nichtmuslimische Kind wenigstens nicht.
Das Internet ist voller YouTube-Videos von Kindern, die in Medresen brutal attackiert werden. Von Mädchen, die an den Haaren gezerrt und zu Boden gerissen werden, weil sie keinen Hidschab (Kopftuch) aufhaben, von Jungen, die ausgepeitscht werden und unter Fußtritten zu Boden stürzen. Verglichen mit einigen der Geschichten, die mir erzählt wurden, mutet mein eigener Missbrauch, so barbarisch er auch war, geradezu harmlos an. Ein Mädchen aus Somalia berichtete mir, wie ihre Mutter ihrem (ans Bett gefesselten) Bruder heißes Öl einflößte, während die Geschwister dabei zusehen mussten.
Jüngsten Berichten zufolge werden in Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung mehr als siebzig Prozent der Kinder zwischen zwei und vierzehn Jahren auf grausame Weise gezüchtigt. In einigen der Länder wie dem Jemen, Tunesien, Palästina und Ägypten berichten über neunzig Prozent der Kinder von schweren Misshandlungen.
Warum ist das so? Weshalb verzeichnen diese Länder eine so hohe Zahl an Gewalttaten gegen Kinder?
Der gemeinsame Nenner ist, dass man sich in all diesen Ländern zum selben Glauben bekennt. Zu einer Religion, die die Menschen lehrt, ihre Kinder zu schlagen. Gemäß dem Hadith, den Überlieferungen der Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed, sagte dieser:
»Lehrt eure Kinder beten, wenn sie sieben Jahre alt sind, und gebt ihnen einen Klaps, falls sie es im Alter von zehn Jahren immer noch nicht tun.«
(von Scheich al-Albani in Sahih al-Dschami, 5868, als sahih, richtig, klassifiziert).
Von ihm stammt auch:
»Häng deine Peitsche auf, wo die Mitglieder deines Haushalts (deine Kinder, Ehefrau und Sklaven) sie sehen können, denn dies wird sie disziplinieren.«
(gesagt von al-Albani in Sahih al-Dschami, 4022)
Sie sehen also, es liegt ganz in der Verantwortung der Eltern sicherzustellen, dass ihre Kinder den Koran memorieren, keines der täglichen Gebete versäumen und den schmalen, ihnen vorgeschriebenen Pfad beschreiten.
»Jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde. Der Herrscher ist Schäfer und für seine Herde verantwortlich. Jeder Mann ist Beschützer seiner Familie und verantwortlich für seine Herde. Eine Frau ist die Hirtin des Haushalts ihres Gatten und trägt Verantwortung für ihre Herde. Ein Diener ist der Hüter des Reichtums seines Herrn und ebenfalls verantwortlich für seine Herde. Jeder von euch ist Hirte und trägt als solcher Verantwortung für seine Herde.«
(erzählt von Al-Buchari, 583; Muslim, 1829)
Wenn Eltern also ihre Kinder schlagen, so tun sie dies sowohl aus religiöser Verpflichtung als auch aus Furcht; sie müssen dafür sorgen, dass ihre Kinder fromme Muslime werden. Werden die Kinder das nicht, haben die Eltern versagt und werden sich am Tag des Gerichts vor Allah zu verantworten haben. Denn sind die Kinder keine frommen Muslime, droht auch den Seelen der Eltern das ewige Höllenfeuer.
Studien zeigen, dass durchschnittlich sieben von zehn Kindern seelischer Gewalt ausgesetzt sind, mit dem höchsten Anteil im Jemen (neunzig Prozent). Etwa sechs von zehn Kindern erleben körperliche Züchtigung. Die höchsten Raten verzeichnen die Zentralafrikanische Republik, Ägypten und der Jemen (jeweils mehr als achtzig Prozent).
Meist bedienen sich die Haushalte einer Kombination aus mehreren disziplinarischen Praktiken. Die meisten Kinder in der Mehrzahl der Länder und Regionen sind sowohl psychologischen als auch körperlichen Formen der Bestrafung ausgesetzt. Das bestätigt, dass sich die beiden Ausprägungen der Gewalt häufig überschneiden und im disziplinarischen Kontext oft gemeinsam auftreten. Eine derartige Erfahrung multipler Gewaltformen kann den Schaden für ein Kind sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht noch verschlimmern.
Obwohl all die Misshandlungen und Androhungen von Misshandlungen mich buchstäblich erstarren ließen, kann ich mich an keinen Zeitpunkt in meinem Leben erinnern, an dem ich mich nicht zur Wehr gesetzt hätte.
So war es beispielsweise verboten, Musik zu hören. Musik war des Teufels. Dennoch drehte ich, wenn keiner zu Hause war, den Knopf unseres Radioweckers auf LG73 und hörte mir die Pop-Hits des Tages an. Der Prinz von Bel-Air hatte recht: Eltern checkten einfach nichts.
Doch ich fürchtete den Zorn Allahs. Wenn ich bei John Lennons »Imagine« mitsang, verstummte ich – zu verängstigt, um auch nur mitzusummen – stets vor der Zeile »Imagine no religion«, damit ich nicht aus Versehen vom Glauben abfiel. Denn ein Apostat, ein Abtrünniger, ein Kafir (Ungläubiger) zu sein ist im Islam die schlimmstmögliche Sünde. Sie kann mit dem Tod bestraft werden. Ich erinnere mich noch, dass ich mich fragte, wie es sein konnte, dass ich neunundneunzig Prozent dieses Songs so sehr liebte, doch diese eine Zeile so vollständig mied? So sehr, dass ich nicht einmal die entsprechenden Lippenbewegungen machte. Konnte es sein, dass Lennon, wenn er mit dem Rest dieses Songs richtiglag, auch mit dieser Zeile recht hatte?
Ich habe noch etliche ähnliche Erinnerungen an Zeiten, in denen das Licht momentweise durch die Ritzen des abbindenden »islamischen Zements« schimmerte, unter dem man mich meine ganze Kindheit über Schicht um Schicht begrub.
GEBET
Muslime sind verpflichtet, sich an die fünf Säulen des Islam zu halten: das Glaubensbekenntnis, die fünf täglichen Gebete, das Geben von Almosen, das Fasten während des Monats Ramadan und die Pilgerfahrt nach Mekka. Sowohl das Wiederholen der rhythmischen Muster als auch die einschläfernden, klagenden Laute der fremden Worte während der fünf täglichen Gebete sorgen dafür, dass wir nie aus der Reihe tanzen. Wenn immerfort das nächste Gebet bevorsteht, bleibt gar keine Zeit, vom rechten Weg abzukommen. Auch der Zement hat keine Zeit zu bröckeln, bevor die nächste Schicht aufgespachtelt wird.
Die Gebete sind von hirnzersetzender Monotonie, nicht die geringste Abweichung ist gestattet. Jede zeremonielle Bewegung, jedes Wort ist besonders, fügt sich ein in ein System und beraubt die Umma (die Gemeinschaft der Muslime) jeglicher Individualität. Reih dich ein. Folge der Herde. Keine Ablenkungen. Während der Hadsch, der heiligen Pilgerfahrt nach Mekka, legt man sogar seine individuelle Kleidung ab, und alle Hadschis hüllen sich in das gleiche schlichte, weiße Tuch.
Die Vorbereitung aufs Gebet war ein ebenso repetitiver Vorgang wie die Gebete selbst. Der erste Schritt bestand in einem Waschritual namens Wudu. Jeder Teil des Wudu musste dreimal wiederholt werden: dreimal Hände waschen, dreimal den Mund ausspülen und dreimal die Nase putzen, dann dreimal das Gesicht reinigen, dreimal die Arme vom Handgelenk bis zu den Ellbogen abspülen, dreimal die Ohren säubern und dreimal die Füße waschen.
Meine Beine waren noch zu kurz, um mit den Füßen das Spülbecken zu erreichen, sodass ich für diesen letzten Schritt auf die Arbeitsplatte stieg. Nach dem Wudu war man bereit zum Gebet. Sollte man nach der Waschung allerdings noch einmal pinkeln, kacken oder pupsen, musste das Ritual erneut durchgeführt werden.
Das Nächste waren die Gebete, die ihre eigenen rituellen Feinheiten mit sich brachten. Man musste in eine festgelegte Richtung gucken: nämlich zur Kaaba nach Mekka in Saudi-Arabien. Als Junge brauchte man nichts Besonderes anzuziehen, die Mädchen aber mussten jeden Zentimeter ihres Körpers, ausgenommen Gesicht und Hände, bedecken. Ich hasste Socken, doch Allah akzeptierte Gebete von Mädchen mit nackten Zehen nicht, nur die von Jungen.
Mein Bruder begann dann mit dem Adhan oder Gebetsruf, der ein wenig unnötig erschien angesichts dessen, dass wir sowieso schon alle im Wohnzimmer versammelt waren. Er wandte den Kopf nach links und nach rechts, um sicherzustellen, dass seine Stimme möglichst weit trug.
Dann stellten wir uns in Reihen auf – vorne die Jungs, dahinter die Mädchen. Die Moschee wurde von den Männern durch den Haupteingang betreten, während die Frauen durch einen Hintereingang direkt neben der Küche und in der Nähe der Mülltonnen eintraten.
Das Problem der Geschlechtertrennung in Moscheen wurde von muslimischen ReformerInnen wie Asra Nomani angesprochen. In der Washington Post schrieb sie, wie sie einmal mit ihrem Vater eine Moschee durch den Haupteingang betreten hatte, worauf man sowohl ihr als auch ihrem Vater so lange zusetzte, bis sie den Eingangsbereich verließ und sich zu den Frauen im Untergeschoss gesellte, wo sie hingehörte.
Frauen in Europa setzen sich mittlerweile zur Wehr, indem sie nicht nur Moscheen ohne Geschlechtertrennung, sondern sogar solche haben, die von weiblichen Imamen geleitet werden! Natürlich sind das keine dauerhaften Moscheen. Gewöhnlich verrichten diese Frauen ihre Gebete in Kirchen, deren zuvorkommende Geistliche am Freitag die Türen für sie öffnen, damit sie ohne Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen beten können. Es handelt sich dabei um eine kleine, rein weibliche Gruppe, doch sie widersetzt sich der Geschlechterapartheid, die im Islam weithin akzeptiert wird. Aus Angst vor Fundamentalisten, die ihnen wegen ihres Ungehorsams Drohungen schicken, wechseln die Frauen allwöchentlich den Veranstaltungsort.
Es gibt auch noch andere muslimische Gruppen, die den Fundamentalisten trotzen, indem sie sich etwa in Moscheen treffen, die auch LGBT-Gläubige und sogar LGBT-Imame zulassen! Ich unterstütze Muslime, die offen für Inklusion und gegen Diskriminierung sind, von ganzem Herzen.
In der Regel beten Männer für sich und Frauen ebenso. Müssen sie es im gleichen Raum tun, stehen die Männer vorne, die Frauen hinten, normalerweise mit einer Art Raumteiler dazwischen. In ihren jeweiligen Reihen rücken sie so eng wie möglich zusammen, sodass sich Schultern und Füße berühren, damit der Teufel sich nicht zwischen sie drängen kann.
Die Gebete folgen einer bestimmten Reihenfolge, einem festen Bewegungsablauf. Zunächst steht man mit vor der Brust gekreuzten Händen (rechte Hand auf der linken) da und rezitiert in dieser Haltung eine bestimmte Sure. Dann legt man die Hände auf die Knie und wiederholt dreimal eine andere Sure, richtet sich wieder auf, bringt das Gesicht zu Boden, murmelt dreimal die vorgeschriebenen Worte, um sich schließlich auf die Fersen zurückzusetzen und die für diese Position vorgesehenen Worte zu sprechen. Zum Schluss bring man erneut das Gesicht auf den Boden und erhebt sich wieder auf die Knie. Einen solchen Zyklus nennt man Rak’a.
Die Länge der Gebete variierte zwischen zwei und vier Rak’as. Nach jedem dieser Gebete gab es noch weitere, die angeblich freiwillig waren – wenn auch nicht für mich.
Dieses ganze Ritual hatte fünfmal täglich stattzufinden. Und bei jedem Gebet, jedem Rak’a, wurden die gleichen Worte wiederholt, heruntergeleiert, ins Gehirn gebrannt. Nie verstand ich den Sinn auch nur eines einzigen all der Worte, die ich mindestens zwanzigmal pro Tag wiederholte. Über die Bedeutung der Worte wurde nie gesprochen. Sie waren lediglich gedankenlos und bis zum Erbrechen zu wiederholen. Nachfragen hatten lediglich Ärger und Ermahnungen zur Folge.
Obwohl ich den Großteil des Tages mit Beten beschäftigt war, gelang es dem Zweifel doch, sich einzuschleichen. Ich wünschte, ich hätte mich einfach unterwerfen können – denn schließlich ist das die wahre Bedeutung des Wortes Islam. Gute Muslime kämpfen nicht mehr, sondern bleiben in dem trocknenden Mörtel, der sie an Ort und Stelle festzementiert.
Ich aber hörte nie auf zu kämpfen und war darum voller Selbsthass. Wie sollte ich denn je eine wahre Muslimin werden, wenn ich nicht loslassen, mich nicht unterwerfen konnte? Meine Schwester und mein Bruder schienen keinerlei Probleme damit zu haben, doch die sprachen ja sowieso nicht mit mir.
Von meiner Mutter kriegte ich dafür den Spitznamen »schwarzes Schaf« verpasst. Der Teufel, meinte sie, gebe mir solche Fragen ein.
Mit zunehmendem Alter wurde es immer schwerer, auf meine Fragen Antworten zu erhalten. Ich erinnere mich an ein aufschlussreiches Gespräch, das ich als Teenager mit meiner Mutter führte.
»Er war über fünfzig und hat ein sechsjähriges Mädchen geheiratet?«
»Und? Meinst du vielleicht, du weißt mehr als Allahs Prophet? Wer bist du denn, dass du seine Handlungen infrage stellst?«
»War er ein Pädophiler?«
»Nein! Natürlich nicht! Er hatte erst Sex mit ihr, als sie eine Frau geworden war. Als sie ihre Periode bekam. Vorher hat er nur andere Sachen mit ihr gemacht, um sie vorzubereiten. Damit sie sich wohl mit ihm fühlen würde, wenn es so weit war. Subhanallah, Allahs Gesandter war immer fürsorglich und rücksichtsvoll.«
»Oh, dann war sie also schon erwachsen …?«
»Ja, in den Augen Allahs war sie erwachsen. Wenn du deine Periode kriegst, wirst du eine Frau; ab da werden all deine Sünden gezählt. Vorher bist du noch ein Kind, und nichts, was du machst, wird aufgezeichnet.«
»Und wie alt war sie nun?«
»Sie war neun.«
»Neun? Aber mit neun ist man doch noch keine Frau!« Mittlerweile schrie ich fast.
Meine Mutter beantwortete meine beharrlichen Fragen mit einer Ohrfeige, gemeinen, gehässigen Worten und dem drohenden Hinweis, dass meine Fragerei des Teufels sei, der sich in meinem Kopf eingenistet habe und mir diese Dinge einflüstere.
Doch gegen Scheitan, den Teufel, kam ich eben nicht an. Ich versuchte, mir meine Fragen zu verkneifen, doch manchmal schaffte ich es einfach nicht. Und während der Kampf in mir weitertobte, wurde ich so verzagt, dass ich mich nicht einmal mehr traute, in Gedanken zu zweifeln, da Allah diese Gedanken lesen konnte und mich für meine Zweifel bestrafen würde. Alles Positive existierte dank Allah, und alles Negative war nur meiner Schwäche zuzuschreiben, weil ich unter dem Einfluss des Teufels stand. Nie hatte ich das Gefühl, selbst über mein Leben zu bestimmen.
Mit dem Teufel hatte das natürlich nichts zu tun. Es waren nur ganz normale Zweifel und kritisches Denken.
Und gerade das gehörte mit zum Schwierigsten, als ich den Islam hinter mir ließ: Entscheidungen zu treffen, mich auf meine innersten Überzeugungen, meine innere Stimme zu verlassen, die man in der Vergangenheit stets erstickt hatte. Nun musste ich sie aufs Neue beschwören und schauen, wie ich sie wieder wahrnehmen und mir vertrauen konnte. Denken hatte man mir nicht beigebracht, sondern mich eher entmutigt, und tja, eigentlich dafür bestraft. Man hatte mich gelehrt, das zu tun, was ich gesagt bekam. Jeder winzige Aspekt meines Lebens wurde mir vorgeschrieben. Keine Entscheidung durfte ich selbst treffen: vom Toilettengang bis zum Wassertrinken, vom Schneiden der Fingernägel bis zum Anziehen der Schuhe war alles aufs Genaueste geregelt. Ich war nichts weiter als ein Gefäß, geschaffen, um Allahs Wort zu verbreiten und, so die Hoffnung, dabei mein Leben hinzugeben – sprich: das perfekte Leben eines guten Muslims zu führen, nicht mehr und nicht weniger.
UNTERWERFUNG I
Ich war nie zufrieden mit dieser Rolle, die man mir da zugeteilt hatte. Ich erinnerte mich noch an eine Zeit, als ich nicht einzementiert gewesen war, bevor dieser grässliche Mann in unser Leben trat, und folglich kämpfte ich gegen jede neue Schicht, die man über mich kippte. Ich erinnerte mich an die Jahre, ehe meine Mutter ihn kennenlernte, sich zum fundamentalistischen Islam bekannte und begann, ihr Haar zu bedecken und alles als haram zu verteufeln. Ich erinnerte mich daran, dass ich Schwimmstunden gehabt und im Park gespielt hatte … und nicht schon vor dem Morgengrauen aufstehen und in den Teppich murmeln musste. Ich erinnerte mich noch daran, dass ich mit Barbies und den nichtmuslimischen Nachbarkindern hatte spielen dürfen. Ich erinnerte mich, dass ich meinen Geburtstag gefeiert hatte, geschwommen war, Oreos gegessen hatte. Das alles und noch viel mehr war inzwischen verboten.
Obwohl ich in Kanada lebte, war nicht mal meine Mutter in Ägypten so erzogen worden. Neidisch starrte ich auf die schwarz-weißen Hochzeitsfotos meiner Eltern. In ihrem knielangen Brautkleid sah meine Mutter wie ein Bondgirl aus. Sie hatte ihr Haar zu einem Beehive hochgesteckt, und die Augen mit den geschwungenen falschen Wimpern waren dramatisch geschminkt. Auf fast jedem Foto war eine wunderschöne und elegante Bauchtänzerin zu sehen. Immer wieder betrachtete ich diese Hochzeitsfotos und war baff angesichts dieser so völlig anderen Welt, aus der sie kam.
So vieles auf diesen Bildern im 10x15-Format war haram. Die Beine meiner Mutter waren nackt, ihr Kleid eng, die Ärmel reichten ihr nur bis zum Ellbogen, sie war geschminkt und ihr Haar unbedeckt. Sogar ihre Frisur war im Islam verboten. Es gab Alkohol, Musik und Tanz: All diese Dinge sind haram.
Das Wort »haram« war meiner Mom in ihrer Kindheit und Jugend wahrscheinlich nie zu Ohren gekommen. Sie war sehr behütet aufgewachsen. Der Onkel ihres Vaters war der erste Präsident Ägyptens gewesen, sodass sie stinkreich und mächtig waren. Mein Großvater war bereits verheiratet und hatte drei Kinder, als sein Onkel zum mächtigsten Mann des Landes aufstieg. Allerdings beschloss er, aus dieser neuen Berühmtheit Profit zu schlagen und sich eine hellhäutige Ehefrau zu gönnen. Er wünschte, dass die Trophäe von den Gesichtszügen und der Hautfarbe her europäisch wirkte, aber trotzdem die richtige Religion hatte, sodass er sich ein junges Mädchen aus der Türkei als Zweitfrau zulegte.
Als meine Großmutter nach Ägypten kam, konnte sie nicht einmal Arabisch, doch sie wurde für ihre Bemühungen reich belohnt. Sie zog in ein großes Herrenhaus mit vielen Bediensteten und machte sich daran, Kinder zu gebären – sieben, um genau zu sein.
Als Nasser das Ruder übernahm, wurde der Onkel meines Großvaters zur Persona non grata und stand unter Hausarrest. Das alles wurde ein wenig zu viel für meinen Großvater, und da er sich mit zehn Kindern und zwei Ehefrauen sowieso schon überfordert fühlte, zog er nach Saudi-Arabien. Zu diesem Umzug habe keinerlei Notwendigkeit bestanden, habe ich Verwandte mutmaßen hören, er sei wohl lediglich ein Vorwand gewesen, um sich allen familiären Verpflichtungen zu entziehen. Von dort schickte er Geld an seine beiden Familien. Selbstverständlich hatte er nicht vor, alleine zu bleiben, sondern heiratete ein drittes Mal.
Sein Umzug fand allerdings erst statt, als meine Mutter bereits die Universität besuchte. Meine Mutter war – unbestritten – seine Lieblingstochter. Als die beiden ersten von sieben Kindern waren sie und ihre Zwillingsschwester die einzigen, die tatsächlich von ihrem Vater erzogen wurden. Keines der anderen Kinder hatte dieses Glück genossen; einige erinnern sich kaum an ihren Vater.
Meine Mom hatte ihr Leben lang Kindermädchen gehabt und nie einen Finger rühren müssen. Der Witz dabei ist, dass sie, als sie meinen Vater heiratete, noch nicht einmal wusste, wie man Wasser kocht. (Das ist wirklich wahr.)
Sie besuchte teure katholische Privatschulen. Damals waren die Ägypter sehr viel säkularer, als sie es heute sind. Es war die Zeit vor dem Aufstieg der Muslimbruderschaft.
Inzwischen kommt es leider vor, dass ägyptische Christen beim Beten in ihren Kirchen zu Hunderten umgebracht werden. Und auch Muslime, etwa Sufis, die sunnitische Extremisten für nicht muslimisch genug halten, sterben in Ägypten während des Gebets in der Moschee. Der gesamte Nahe Osten und Nordafrika sind extremer geworden, und die Extremisten verbreiten sich auch nach Europa und Nordamerika. Andere muslimische Sekten werden nicht einmal toleriert. Ein ahmadischer Ladenbesitzer wurde in Großbritannien von einem sunnitischen Extremisten getötet, weil er seinen Vermietern »Frohe Ostern« gewünscht hatte.
Sunniten machen die Mehrheit (etwa neunzig Prozent) der Muslime aus, Schiiten bilden (mit fast zehn Prozent) die nächstgrößte Sekte, alle übrigen ergeben zusammen kaum ein Prozent. Wenn ich in diesem Buch von »Muslimen« spreche, meine ich in der Regel die Mehrheit der sunnitischen Muslime – da ich nur bei ihnen aus Erfahrung spreche.
In der Jugendzeit meiner Mutter identifizierten sich die Menschen eher lose mit dem Islam und nahmen die Religion nicht so ernst. Die Frauen trugen keinen Hidschab, man trank Alkohol, und der Islam war so zwanglos, wie es das Christentum für die meisten heutigen Christen ist. Doch inzwischen hat sich das beträchtlich verändert.
Es ärgerte mich, dass meine Mutter ein so glamouröses Leben hatte führen dürfen, während ich gezwungen war, Suren aus dem Koran zu memorieren, nicht Fahrrad fahren durfte, um nicht meine Jungfräulichkeit zu riskieren, und nicht schwimmen, weil der Badeanzug zu viel Haut zeigte. Weshalb gönnte sie mir nicht die gleichen Freiheiten, die sie selbst genossen hatte? Sie hatte christliche Freundinnen, aber ich durfte nicht mal mit meinen Freundinnen auf demselben Flur, Chelsea und Lindsay, spielen, weil sie Kuffar, Ungläubige, waren.
Tagein, tagaus klopften sie an unsere Tür.
»Können wir reinkommen und mit Yasmine spielen?«
»Nein, das geht gerade nicht«, erwiderte meine Mutter dann immer, während ich in der Diele stand, die Hände rang und hoffte, sie werde einlenken.
»Kann sie zu uns kommen?«
»Nein, sie ist beschäftigt.«
»Ich bin nicht beschäftigt!«, piepste ich dazwischen.
»Geh in dein Zimmer!«
Oft frage ich mich, wie ich mich wohl entwickelt hätte, wäre unser Leben nicht durch diese »Bombe« zerstört worden, die in unseren eigenen vier Wänden hochging.
Diese Bombe war der Mann, der meine Mutter zu seiner Zweitfrau erkoren hatte – »Onkel« Mounir. Sein Einzug in unser Leben hatte in der Tat etwas von einer Explosion. Da war kein Zittern, keine Vorwarnung, kein aufkommender Wind – plötzlich war er da, ein gewalttätiger Soziopath, der in unser Leben hineinraste. Mit seinem zerzausten Bart und den schwieligen Händen trat er in die Wohnung, als gehöre sie ihm.
Mit mir beschäftigte er sich nur selten, es sei denn, er fesselte gerade meine Füße ans Fußende des Betts. Ich hatte keine Ahnung, dass meine Mutter seine Zweitfrau war. Wir nannten ihn Onkel, denn schließlich hatte er selbst eine Frau und Kinder. Erst als ich aufs College ging, eröffnete mir meine Mutter die Wahrheit. Polygamie ist in der liberalen Demokratie Kanadas gesetzeswidrig, sodass sie uns Kindern die belastende Information vorenthielt. Sie ahnte ja nicht, dass unsere Regierung bei muslimischen Männern mit mehreren Ehefrauen routinemäßig ein Auge zudrückt. Steuergelder in Millionenhöhe werden darauf verschwendet, Männer zu unterstützen, die das Gesetz brechen. Kann ein Mann es sich nicht leisten, alle seine Frauen zu unterhalten, so lässt er sie einfach als Alleinerziehende Sozialhilfe beantragen. Voilà, Problem gelöst.
Meine Mutter war eine dieser Frauen. Weil sie nur islamisch, aber nicht standesamtlich mit ihm verheiratet war, konnte sie als Alleinerziehende Sozialhilfe beziehen, und der Staat ignorierte die Tatsache, dass sie mit diesem Mann verheiratet war, denn dies zu hinterfragen wäre rassistisch gewesen … oder was auch immer.
Obwohl er quasi eine Art Stiefvater für mich war, habe ich ihn nie so genannt, und eine Vater-Tochter-Beziehung hatten wir auch nie. Er war einfach nur der Mann, der uns verprügelte und (wie ich später erfuhr) gelegentlich mit unserer Mutter schlief.
Manchmal, wenn ich von der Schule kam, traf ich ihn bei uns zu Hause an.
»Was hab ich denn getan?« Soweit ich wusste, bestand der einzige Zweck seiner Besuche darin, einen von uns zu verprügeln.
»Nichts. Geh einfach in dein Zimmer spielen.« Meine Mutter scheuchte mich davon.
Einmal ging ich auf die Toilette und hörte die beiden in der Dusche, was mich nicht beunruhigte. Mein Bruder und ich badeten damals auch noch zusammen. Später erwähnte ich es zufällig – ich weiß nicht mehr weshalb – in Gegenwart seiner Frau.
»Was? Das ist nicht wahr!« Er und meine Mom bestritten es vehement.
»Doch. Ich habe euch da drinnen gehört.«
Unerklärlicherweise bestanden sie darauf, dass ich mich täuschte, und ich kapierte einfach nicht, weshalb.