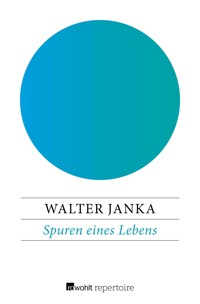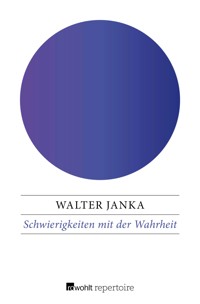
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«... Die anwesenden Schriftsteller, von Anna Seghers, Willi Bredel bis Bodo Uhse, hatten sich an der Schreierei nicht beteiligt. Sie blieben stumm. Ihre Gesichter wurden fahl. ... Auch Heli Weigel, die Witwe von Brecht, die Janka ihre Sympathie durch Zuwinken bekundet hatte, war blaß geworden. Betroffen sah sie vor sich hin. Daß sich keiner der hier vertretenen Freunde von Lukács dazu aufschwang, gegen die unwahren Behauptungen zu protestieren, war die schlimmste Enttäuschung für Janka während des ganzen Prozesses. Anna Seghers blieb stumm.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Walter Janka
Über Walter Janka
Über dieses Buch
«... Die anwesenden Schriftsteller, von Anna Seghers, Willi Bredel bis Bodo Uhse, hatten sich an der Schreierei nicht beteiligt.
Sie blieben stumm. Ihre Gesichter wurden fahl.
... Auch Heli Weigel, die Witwe von Brecht, die Janka ihre Sympathie durch Zuwinken bekundet hatte, war blaß geworden.
Inhaltsübersicht
Der Minister
«Zu allen Zeiten hat es Schriftsteller gegeben, die gegen staatliches Unrecht aufgetreten sind. Was sie größer machte. Um so mehr, wenn sie dafür Opfer bringen mußten. Für die Zeit des Hitlerfaschismus konnte das auch Becher in Anspruch nehmen. Freilich nur in seiner Haltung zum Faschismus. Den Terror Stalins hat er zu keiner Zeit öffentlich verurteilt.
Mit diesem Rückblick mache ich keinen Abstrich an Bechers poetischem Werk. Nicht einmal an seinem Wirken als Minister. So manches Gedicht von ihm lese ich noch immer mit Respekt. Und seine Nachfolger im Ministerium halten keinen Vergleich zu ihm aus. Aber sein Charakter als Mensch, seine Wahrheitsliebe als Politiker machen mir Schwierigkeiten.»
Walter Janka mit Georg Lukács in Berlin im Aufbau-Verlag.
Thomas Mann schrieb aus Anlaß des 60. Geburtstages von Johannes R. Becher: «… Mehr noch, oder fast mehr noch als den Poeten und Schriftsteller liebe und ehre ich in Johannes R. Becher den Menschen – dies drängend bewegte, von innigen Impulsen getriebene Herz, das ich mir bei so mancher Begegnung entgegenschlagen fühlte – eine persönliche Erfahrung, die eine fortdauernde Ergriffenheit von seiner Natur, seiner Existenz in mir zurückgelassen hat. Als sein Wesen empfand ich eine Selbstlosigkeit, rein wie die Flamme, und verzehrend wie sie; eine bis zum Leiden inbrünstige Dienstwilligkeit … sein Drang zum Dienst an der Gemeinschaft, dem Volke, ist – man lese nur seine Gedichte – zuerst und zuletzt der heiße Wunsch, seinem Volke, dem deutschen, zu dienen und ihm ein liebevoller, getreuer Berater nach bestem Wissen und Gewissen zu sein …»
Dieser Wertung lassen sich Essays und Reden von Georg Lukács, Paul Rilla, Heinrich Mann, Berthold Viertel, Bert Brecht, Günther Weisenborn und anderen hinzufügen. Auch Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht griffen zur Feder.
Pieck schrieb: «… Stalin, der große Führer des Lagers der friedliebenden Völker, nannte die Schriftsteller ‹Ingenieure der menschlichen Seele› … Johannes R. Becher ist in seinen Gedichten, Liedern und Reden ein ‹Ingenieur der menschlichen Seele› im Stalinschen Sinne …»
In dem von Ulbricht gezeichneten Beitrag heißt es: «… Johannes R. Becher ist ein glühender Verteidiger der Einheit eines demokratischen Deutschlands. Er ermahnt die deutschen Dichter, dessen eingedenk zu sein, daß ‹eine große deutsche Dichtung nur auf dem Boden eines freiheitlich geeinten Deutschlands gedeihen kann› … Geteiltes Deutschland ist friedloses Deutschland, und wie die Teilungen Polens Europa nicht den Frieden ließen, so würde erst recht nicht die Teilung Deutschlands zur Befriedung der Welt beitragen.»
Die drei Zitate machen Zeit und Wirkung von Becher ohne Umschweife deutlich. Auch das persönliche Verhalten. Und nur über letzteres wird in diesem Zusammenhang die Rede sein.
Als Nationaldichter verstanden, als Kulturminister geschätzt, hatte er dazu auch noch den Vorsitz der Akademie der Künste, des Kulturbundes, des PEN-Zentrums übernommen. Und natürlich war er Mitglied des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei und Abgeordneter der Volkskammer. Alles auf einmal.
«Mehr als den Poeten und Schriftsteller liebe und ehre ich den Menschen.» Die hervorgehobene Nähe zur Person, bei gleichzeitiger Distanz zum Werk, zeugen von Respekt und verhaltener Kritik.
Daß sich Becher im Stalinschen Sinne verstand, ist gewiß. Sein Werk, sein Tun, seine politische Gesinnung zeugen davon.
Thomas Mann mag man verzeihen, daß er das aus der geographischen Ferne nicht erkennen wollte. Wir aber, die wir in Bechers Nähe gearbeitet, zu Werkzeugen oder Opfern seiner Größe wurden, haben Gründe, kritischer zu sein. Als Dichter wäre Becher groß genug gewesen, um spätestens nach dem XX. Parteitag der KPdSU die Stimme gegen Unrecht zu erheben.
Zu allen Zeiten hat es Schriftsteller gegeben, die gegen staatliches Unrecht aufgetreten sind. Was sie größer machte. Um so mehr, wenn sie dafür Opfer bringen mußten. Für die Zeit des Hitlerfaschismus konnte das auch Becher in Anspruch nehmen. Freilich nur in seiner Haltung zum Faschismus. Den Terror Stalins hat er zu keiner Zeit öffentlich verurteilt. Auch wenn es um die Deportierung oder Erschießung von Intellektuellen ging, die Becher persönlich gut kannte, schwieg er.
In seinen Schriften war er schonungslos gegen jene zu Felde gezogen, die sich in der Nazizeit angepaßt, gegen Terror blind oder taub gestellt haben. Das war verdienstvoll. Nachdem er aber selbst Gelegenheit fand, seine Macht gegen Unrecht einzusetzen, widerfuhr ihm, trotz aller Unterschiede, Gleiches. Mehr noch. Er nahm Ungesetzlichkeiten auch nach dem XX. Parteitag widerstandslos hin. Wenn es einmal dazu kommen sollte, Einblick in die Staats- und Parteiarchive zu nehmen, werden es die Literaturwissenschaftler schwer haben, die Persönlichkeit eines so prominenten Literaten gerecht einzuordnen.
Seit dem XX. Parteitag wissen wir, daß jeder, der es wagte, gegen den Terror unter Stalin aufzutreten, gefährdet war. Dieser Umstand darf nicht vergessen werden. Trotzdem muß man fragen, wie sich Bechers Verhalten mit seinem Gewissen vereinbaren ließ. So kannte er den Prawda-Korrespondenten Michael Kolzow gut. Er war mit ihm befreundet, wußte, daß Kolzow niemals ein Agent gewesen sein konnte. Trotzdem schwieg er, als dieser Mann umgebracht wurde. Öffentlich hat Becher sogar die Prozesse gegen alte Genossen gerechtfertigt. Auch noch die Prozesse der Nachkriegszeit. Bis hin zum Prager Slansky-Prozeß 1952, in dem André Simone fälschlich als Trotzkist, Spion und Agent der Juden zum Tode verurteilt worden war. Wieder wäre Becher befähigt gewesen, Simones Unschuld nachzuweisen. Viele Jahre hatte er mit ihm zusammengearbeitet, hatte Einblick in dessen Tätigkeit gehabt; und hatte damals schon gewußt, was Franz Dahlen in den siebziger Jahren über Simone veröffentlichte.
Auch Anna Seghers stand Becher in ihrem Schweigen nicht nach. Der Fall Merker bestätigt das.
Als dieser Altkommunist 1951 aus dem Polit-Büro ausgeschlossen wurde, brach sie ihr Schweigen. Mit dubiosen Aussagen belastete sie Merker als Noel Field-Agent, sprich amerikanischen Agenten.
Nach zwanzigjähriger Zugehörigkeit zum ZK der KPD und nach dreijähriger Untersuchungshaft wurde Merker 1955, wenige Monate vor dem XX. Parteitag, vom Obersten Gericht der DDR als Agent des amerikanischen Geheimdienstes, Agent der Gestapo, Agent des französischen Geheimdienstes und Agent des Weltjudentums zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Schon 1956 mußte er rehabilitiert werden. Und da fiel Anna Seghers wieder ins Schweigen zurück.
Bechers Verhalten unterschied sich in dem Maße, in dem er als Mitglied des ZK der SED allen Beschlüssen gegen Merker seine Zustimmung gab. Wohl muß ihm dabei nicht gewesen sein. In mehreren Gesprächen mit mir in seinem Landhaus wollte er immer wieder meine Meinung über Merker hören. Als ich ihm unumwunden erklärte, daß ich alle Beschuldigungen gegen Merker für unwahr halte, widersprach er nicht. Sein Credo lief darauf hinaus, daß es in der Politik nicht ohne solche Vorgänge abgehe. Justiz sei immer ein Mittel der Politik gewesen.
Die Ereignisse in Polen und Ungarn beeinflußten auch das Denken der Schriftsteller. Besonders das Verhalten von Becher und Seghers zu Georg Lukács, der 1956–57 lebensgefährlichen Situationen ausgesetzt war.
Man kann sagen, daß unsere Schriftsteller nicht alles wissen können, nicht immer Einblick in die wirklichen Verhältnisse haben; und daß sie deshalb zu falschen Schlußfolgerungen kommen. Das trifft sicher auf einige zu. Aber auch auf Anna Seghers und Johannes R. Becher? Ich kann das nicht glauben. Wenn sie es wollten, waren sie gut informiert.
Ein Gespräch am Kaffeetisch von Anna Seghers machte mir das sehr deutlich. Noch vor dem Aufstand in Ungarn fragte ich, warum sie ihr letztes Buch Rákosi gewidmet habe. Nichts in diesem Buch hätte doch etwas mit Ungarn zu tun. Sie antwortete: «Ich war mit Rodi zu Gast bei Rákosi. Er hat uns mehrere Tage freundschaftlich bewirtet und viel über sein Land erzählt. Dafür wollte ich dankbar sein.»
Ein paar Wochen später, nachdem Rákosi in die SU geflohen war, erzählte sie mir die Fortsetzung ihrer Erfahrungen. Sprach mit seltener Erregung, bemüht, eine Erklärung für Rákosis Sturz zu finden. Zu meiner Überraschung ging es da aber nicht um Politik. Nein, es ging um ein Kind. Laut Bericht einer Freundin hätte unlängst ein Junge vor dem Zaun des herrlichen Parks, in dem Rákosi seinen Wohnsitz hatte, mit einem Ball gespielt. Irgendwann sei der Ball über den Zaun gefallen, und da wäre das naive Kind über die Umzäunung geklettert, um sich den Ball wiederzuholen. Zum Entsetzen der Anwohner hätten die Wachposten sofort geschossen. Ohne sich zu vergewissern, wer da über den Zaun kam. Und das Kind sei sofort tot gewesen.
Sie folgerte, daß wohl solche Vorkommnisse dazu beigetragen hätten, das Volk zu verbittern. Diese Einsicht war richtig. Aber aus den politischen Prozessen gegen zahllose Genossen, die unter Rákosi gehenkt wurden, zog sie noch immer keine Schlüsse. Und in ihren späteren Arbeiten findet sich nichts über das erschossene Kind. Wäre es nicht einer literarischen Aufarbeitung wert gewesen? Nur die Widmung ließ sie in den Nachauflagen streichen.
Die von den Volksmassen hinweggefegte Rákosi-Regierung hinterließ im Oktober 1956 ein Chaos. Niemand wußte, wie sich eine neue Regierung konstituieren soll. Bis Imre Nagy, ehemals Emigrant in der SU, einst selbst den Intrigen Rákosis ausgesetzt, eine neue Regierung bildete und auch Lukács zu einem seiner Minister ernannte.
In Berlin war man ratlos. Viele fürchteten, daß die Aufstände in Polen und Ungarn über die Grenzen ausufern würden. Der 17. Juni 1953 in der DDR war noch nicht vergessen. Und die westlichen Medien trommelten mit Informationen über das Morden in Ungarn. Auch über das Eingreifen sowjetischer Truppen, was schließlich mit der Niederschlagung des Aufstandes und der Verhaftung von Imre Nagy, samt allen Mitgliedern seiner Regierung, enden mußte.
Bevor es zu diesem Ende mit Schrecken kam, geschah in Berlin etwas, was wir vorher nicht erlebt hatten. Viele Schriftsteller und Intellektuelle waren verunsichert. Mehr als nach dem XX. Parteitag. Offenbar unterscheiden sich Volksbewegungen von unten, die in Ungarn und Polen die Ursache für den Zusammenbruch waren, von politischen Kehrtwendungen, die von oben gesteuert werden.
Aufstände, egal durch welche Umstände begünstigt, bewirken nicht nur innenpolitische Veränderungen. Fast immer werden andere Länder angesteckt. Und wenn die Sowjetarmee den Aufstand nicht niedergeschlagen hätte, wäre es mit Sicherheit, wie das 1968 die Dubček-Bewegung abermals bewies, dazu gekommen. Mindestens aber zwingen solche Erhebungen zum Nachdenken auch in anderen Ländern. Und manchmal wecken sie das Gewissen von Leuten, die sonst zufrieden sind oder hilflos den Ereignissen gegenüberstehen. Wenigstens so lange, wie der Ausgang von Revolten nicht entschieden ist.
Das von außen erzwungene Nachdenken der Intellektuellen war da keineswegs einheitlich. Die Gruppe um «Kuba», Kurt Barthel, sah die Rettung in noch mehr Unterdrückung aller, die an den festgefahrenen Dogmen zu rütteln wagten. Und so war die Verteufelung jener, die für das Aufbegehren der Arbeiter Verständnis zeigten, maßlos.
Nicht so übereilt reagierten Anna Seghers und Johannes R. Becher. Sie verhielten sich abwartend. Dann zeigten sie Bereitschaft, über Fehler in der Vergangenheit zu diskutieren. Nicht in den offiziellen Gremien der Partei oder des Verbandes, gar in der Presse. Nein, nur im engeren Kreis von Freunden. Aber das war schon etwas. Ob sie es zur eigenen Beruhigung taten oder die Notwendigkeit erkannten, endlich von ihrem Einfluß Gebrauch zu machen, läßt sich mit Bestimmtheit nicht sagen. Möglich ist, daß beides eine Rolle spielte.
Wir jedenfalls, die Mitarbeiter von Becher und Seghers, fühlten uns durch ihre Bereitschaft, über die Dinge zu reden, ermuntert und bestärkt. Wir sprachen aus, was uns bedrückte, was wir zum Nutzen der sozialistischen Entwicklung für unerläßlich hielten. Und sehr bald wurden die seit dem XX. Parteitag im Aufbau-Verlag geführten öffentlichen Diskussionen mit intellektuellen Mitarbeitern und Autoren zu einem Forum positiver Aussprachen. Auf viele Fragen mußten Antworten gefunden werden. Und selbstverständlich wurden Vorschläge in die Diskussion eingebracht, die nicht mit den Erklärungen der Parteiführung übereinstimmten. Nachbetereien gab es anderen Orts genug. Nur keinen Meinungsstreit! Aber der war bitter nötig. Und genau das war unser Anliegen. Dabei gelang es durchaus, die Diskussionen, an denen zahlreiche Parteilose beteiligt waren, in eine Richtung zu lenken, die wir für richtig hielten. Unsere Sache war, darüber gab es keinen Zweifel, die sozialistische Umgestaltung in der DDR.
Vereinfacht könnte gesagt werden, daß wir über die Formen sozialistischer Demokratie gestritten haben, um den zum Hindernis gewordenen Begriff «proletarische Diktatur» abzulösen. Dem müßte hinzugefügt werden, daß wir vor allem den unter diesem Deckmantel praktizierten Mißbrauch der Macht kritisierten. Alle späteren Behauptungen, wir hätten mit diesen Diskussionen die Konterrevolution vorbereitet, waren falsch. Sie dienten der Irreführung und Einschüchterung.
Und wem diente der Minister für Kultur, der unsere Diskussionsabende im Aufbau-Verlag als richtig und nützlich bezeichnet, der sich angeboten hatte, an diesen Gesprächen teilzunehmen, sie durch seine Persönlichkeit zu bereichern? Voll des Lobes und äußerst befriedigt hatte er seine Genugtuung über die konstruktive Art erklärt, mit der wir an die Kritik des Zeitgeschehens herangingen. Am Ende eines Auftrittes im Aufbau-Verlag hatte er in aller Form darum gebeten, ihn zu weiteren Gesprächen einzuladen. Später, nachdem die Ansätze zu freier Meinungsbildung zerschlagen waren, sollte er auf einer Kulturkonferenz der SED am 23. Oktober 1957 erklären. «So war bekannt, welche Stimmung im Aufbau-Verlag herrschte und daß bei einer Betriebsgewerkschaftswahl unsere Genossen in den Hintergrund abgedrängt wurden. Ich wurde zu einem Forum im Aufbau-Verlag eingeladen, und es war unschwer zu spüren, daß ich hier eine Gruppe von Genossen vor mir hatte, die gekommen waren, um mir eine Falle zu stellen. Jede Frage war gewissermaßen eine Fangfrage. In dem Augenblick, in dem ich zur Offensive überging, wichen sie zurück und wichen aus. Aber dessenungeachtet hätte diese Stimmung mir genügen müssen, um zu veranlassen, eine ideologische Bereinigung unter den Mitarbeitern des Aufbau-Verlages vorzunehmen. Ich bin dieser prinzipiellen Auseinandersetzung ausgewichen und habe dadurch zweifellos zur Aufweichung das Meine beigetragen.»
Bei den letzten Betriebsgewerkschaftswahlen waren die vorgeschlagenen Genossen ohne Eingriffe von der Verlagsleitung oder irgend jemand anderem und ohne Abstriche gewählt worden. Von einem «Abdrängen unserer Genossen» konnte nicht die Rede sein. Erst Becher hat diese Mär erfunden.
Ebenso unsinnig war die Behauptung von einer Gruppe Genossen, die dem Minister «Fangfragen stellen wollten». Ich erinnere mich, daß es Becher war, der sogenannte Fangfragen stellte. Und zwar deshalb, «weil er die gestellten Fragen zu harmlos fand», und, wie er mir ins Ohr flüsterte, «den Teilnehmern die Zungen lösen wollte, damit ein richtiges Gespräch in Gang komme».
Um den Zuhörern Mut zu machen, sagte er: «Ihr könnt ganz frei und offen sprechen. Ich versichere, daß hier kein Angehöriger der Staatssicherheit zugegen ist, der euch wegen heikler Fragen Schwierigkeiten bereiten könnte. Also sagt ungehemmt eure Meinung.» Und erst nach dieser Aufforderung lockerte sich das Gespräch auf. Als Becher nach Ende der Diskussion den Verlag verließ, dankte er mir für den erfolgreichen Abend und lobte mit seiner Frau, die an diesem Forum teilgenommen hatte, die «wohltuende Atmosphäre im Verlag». «Macht weiter so. Ihr seid auf dem richtigen Weg.»
Das waren seine Worte zum Abschied.
Als ich Becher zum erstenmal gegenüberstand, Anfang der 50er Jahre, im Ministerium für Kultur, hatte ich schon viel über ihn gehört. Wie jeder, der kulturpolitisch tätig war. Mein Verhältnis zu ihm wurde durch seine Persönlichkeit bestimmt. Er duzte mich. Ich sagte immer Sie. Obwohl er mich wiederholt aufforderte, das Sie zu unterlassen. Ich blieb trotzdem dabei. Warum ich Becher immer mit Sie angesprochen habe, kann ich nicht erklären. Mit Anna Seghers, Friedrich Wolf, Willi Bredel, Erich Weinert, Georg Lukács, Ernst Bloch, Leonhard Frank, Günther Weisenborn, und wie sie alle hießen, duzte ich mich. Nur mit Becher ging das nicht. Auch in seinem Haus am Scharmützelsee, wo ich wenigstens einen Tag in jedem Monat zubringen mußte, blieb es beim Sie. Auch dann noch, als er mir seine Pistolen und Kleinkalibergewehre zeigte, mit ihnen in die Luft schoß, amüsante Geschichten über die Wildschweinjagd erzählte und fragte: «Hast du Lust, einmal mit mir auf die Jagd zu gehen?» Ich antwortete: «Nein, keine Lust! Geschossen habe ich genug.»
Es wäre unrichtig, würde ich sagen, daß mir die Besuche bei ihm lästig waren. Von den Gesprächen mit Becher konnte ich manches profitieren. Viel durchsetzen, was für den Verlag von Nutzen war.