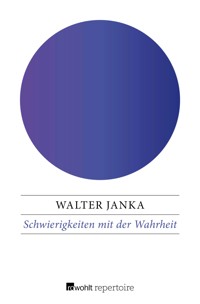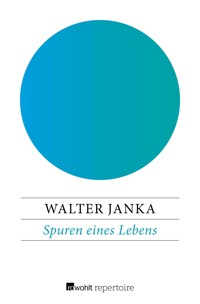
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als sich nach dem Ungarn-Aufstand 1956 auch in der DDR kritische Intellektuelle für Reformen einsetzen, wird Walter Janka der konterrevolutionären Verschwörung gegen die Regierung Ulbricht angeklagt und zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Zum zweitenmal in seinem Leben kommt er nach Bautzen. In der Kälte und Einsamkeit der Zelle, in der er Hunger und Krankheit, Zweifel und Demütigung ohne seine Frau und Freunde, die zu ihm hielten, nicht überlebt hätte, rechnet er ab mit den alten Dogmen, die er selbst mit Eifer vertreten hatte. 1960 wird er entlassen, 1989 erscheint sein Buch «Schwierigkeiten mit der Wahrheit». Das Buch macht Geschichte. In jenen Wochen, als das Volk der DDR das SED-Regime hinwegfegte, wurde das Schicksal Walter Jankas zum Beispiel – seine Unbeugsamkeit, sein Wille, sich nicht brechen zu lassen, zum Zeugnis gegen das Regime.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 668
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Walter Janka
Über Walter Janka
Über dieses Buch
Als sich nach dem Ungarn-Aufstand 1956 auch in der DDR kritische Intellektuelle für Reformen einsetzen, wird Walter Janka der konterrevolutionären Verschwörung gegen die Regierung Ulbricht angeklagt und zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Zum zweitenmal in seinem Leben kommt er nach Bautzen. In der Kälte und Einsamkeit der Zelle, in der er Hunger und Krankheit, Zweifel und Demütigung ohne seine Frau und Freunde, die zu ihm hielten, nicht überlebt hätte, rechnet er ab mit den alten Dogmen, die er selbst mit Eifer vertreten hatte.
Inhaltsübersicht
Für Charlotte
Neunzehnhundertneunundachtzig
Der Bericht über mein Leben wurde vor fünfzehn Jahren geschrieben. An eine Veröffentlichung war nicht gedacht. Denn zur Destabilisierung der DDR wollte ich nicht beitragen. Meine Absicht war die Veränderung der Verhältnisse: Die DDR habe ich trotz meiner Kritik an diesem Staat und der Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht hatte, als Alternative zur kapitalistischen Bundesrepublik für unverzichtbar gehalten. Ein DDR-Verlag hätte für ein solches Buch ohnehin keine Druckgenehmigung bekommen. Und wären meine Erinnerungen nur im Westen erschienen, hätte man mich als Dissidenten bezeichnet. Aber genau das wollte ich nicht sein. Zu keiner Zeit.
Ich mußte schließlich den Spuren meines Lebens nachgehen, um mich vor mir selbst zu rechtfertigen. Alle Versuche, eine öffentliche oder parteiinterne Rehabilitierung durchzusetzen, waren zurückgewiesen worden. Und schon deshalb wollte ich endlich aufschreiben, was vielleicht später zur Aufarbeitung unserer Geschichte einmal von Interesse sein könnte. Nach meinem Ableben sollte das Manuskript einem Archiv übergeben werden. Bei diesem Vorsatz wäre es geblieben, wenn nicht Vorkommnisse ein Umdenken erfordert hätten.
Ohne jede Rückfrage und ohne meine Zustimmung wurde mir nach dem 75. Geburtstag der «Vaterländische Verdienstorden in Gold» verliehen: «In Würdigung hervorragender Verdienste beim Aufbau und bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik.» Das rechtswidrige Urteil von fünf Jahren Zuchthaus, die Zerstörung meiner beruflichen Karriere und die fortdauernde Diskriminierung meiner Familie wurden weder erwähnt noch zurückgenommen. Offenbar glaubte die veränderungsunfähige Parteiführung, mich mit diesem Orden zum Stillhalten verpflichten zu können. Und das war mir dann doch zuviel. Ich brach mein Schweigen, um mich nicht noch selbst der Heuchelei schuldig zu machen.
Im Frühjahr 1989, lange vor der Wende, bat ich Günter Kunert, den viele Leser der DDR in guter und zugleich schmerzlicher Erinnerung haben, eine Lesung des Kapitels «Schwierigkeiten mit der Wahrheit» im westdeutschen Rundfunk zu vermitteln. Anders hätte ich die Hörer in der DDR nicht erreichen können. Kunert war es auch, der Freimut Duve und Ingke Brodersen zur Veröffentlichung meines Manuskripts im Rowohlt Verlag gewinnen konnte. Um mich den westdeutschen Lesern vorzustellen, fügte der Literaturwissenschaftler Michael Rohrwasser noch eine biographische Notiz hinzu. Ihnen ist es zu danken, daß es überhaupt ein Buch mit dem Titel «Schwierigkeiten mit der Wahrheit» gibt. Mit diesem Buch erscheinen jetzt die weiteren Kapitel meiner Erinnerungen, bei deren Bearbeitung mir Ingke Brodersen und Michael Rohrwasser mit hilfreicher Kritik zur Seite standen.
Daß schon im Herbst desselben Jahres die von Honecker, Stoph, Mittag, Hager, Axen bis Mielke auf Lebzeiten gepachtete Macht zusammenbrechen und mit ihnen auch der real existierende Sozialismus gleich mit untergehen würde, ahnte im Sommer 1989 noch niemand. Im Gegenteil. Die Bundesregierung, Frankreich, Spanien und Belgien hatten Honecker noch aufwendige Staatsempfänge bereitet, und der Parteivorstand der SPD gefiel sich in Versöhnungsgesprächen mit den Mitgliedern des SED-Politbüros.
Wer mag sich da wundern, daß die selbstherrlich regierenden Politbüromitglieder glaubten, das Gemetzel auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking gegen das eigene Volk ausbeuten zu können. Das von den DDR-Medien schamlos bejubelte chinesische Blutbad, die Bilder der zum Richtplatz geprügelten Studentenführer, der lächelnde Egon Krenz am Tisch der Pekinger Parteibonzen, die protzigen Honecker-Bankette zum 40. Jahrestag der DDR, die auf Demonstranten einschlagende Staatssicherheit, die Flüchtlingsströme aus der DDR über Prag und Budapest und die verlogenen Reden Hagers provozierten das eigene Volk, bis es im Oktober/November auf die Straßen ging und das SED-Regime hinwegfegte. Und wenn es dabei nicht zu Blutvergießen kam, war das wohl Gorbatschow zu danken, der die sowjetische Besatzungsmacht angewiesen hatte, jede gewaltsame Unterdrückung zu verhindern.
Am 28. Oktober las der Schauspieler Ulrich Mühe aus dem am 5. Oktober erschienenen Buch «Schwierigkeiten mit der Wahrheit» im Deutschen Theater zu Berlin. Der Dramatiker Heiner Müller und der Intendant des Theaters, Dieter Mann, hatten diese Veranstaltung initiiert. Zu Beginn wurde eine Erklärung von Christa Wolf verlesen. In ihr heißt es: «Heute abend findet in diesem Theater eine bedeutsame Premiere statt. Zum erstenmal wird öffentlich und so radikal wie möglich jenes Grundübel zur Sprache kommen, aus dem über Jahrzehnte hin fast alle anderen Übel des Staates DDR hervorgegangen sind: der Stalinismus. Vor mehr als dreißig Jahren wurde an Walter Janka ein Exempel statuiert, dessen Ziel es war, ihn zu brechen. Seine Unbeugsamkeit, sein Mut, seine Beharrlichkeit haben sein Schicksal zum Beispiel werden lassen. Es ist mehr als ein günstiger Zufall, daß wir seinen Bericht darüber in diesen Wochen, in denen alles davon abhängt, daß wir lernen, von Grund auf umzudenken, als Lehrbeispiel in den Händen haben … Er stellt uns vor einen bisher geleugneten, unterschlagenen, besonders düsteren Aspekt unserer Realität. Es gehört in das öffentliche Gespräch und ist, wie weniges sonst, geeignet, dieses Gespräch zu vertiefen und es von den Symptomen weg zu den Ursachen jener Deformationen zu führen, die jetzt auch ihre Verursacher und Nutznießer beklagen, unter denen auf einmal alle gelitten haben wollen, die aber keiner zu verantworten hat. So äußert sich die Fortdauer der Deformationen … Die Krise, die aufgebrochen ist, signalisiert auch einen geistig-moralischen Notstand unserer Gesellschaft, der nicht so schnell zu beseitigen sein wird wie ein Versorgungsnotstand oder ein Reisedefizit. Das Buch von Walter Janka kann uns helfen, ihn zunächst zu erkennen – überwinden können wir ihn nur in einem gemeinsamen langwierigen Lernprozeß. Wir müssen unsere eigenen ‹Schwierigkeiten mit der Wahrheit› untersuchen und werden finden, daß auch wir Anlaß haben zu Reue und Scham …»
Wegen des großen Ansturmes auf das Deutsche Theater wurde die Lesung am 5. November wiederholt und im Rundfunk und Fernsehen ausgestrahlt. Auch andere Theater der DDR veranstalteten Lesungen aus dem Rowohlt-Buch, das dann vom Aufbau-Verlag im Januar 1990 nachgedruckt und in kurzer Zeit vergriffen war. Viele Leser und Hörer fühlten sich verpflichtet, Erklärungen abzugeben, Briefe zu schreiben oder Besuche in Kleinmachnow abzustatten. Allen sei dafür aufrichtig gedankt.
Die auf den Straßen der DDR erzwungene Wende veranlaßte auch die Generalstaatsanwaltschaft der DDR zu handeln. Am 14. November 1989 beschloß sie, die Kassation des seit dem 26. Juli 1957 rechtskräftigen Urteils einzuleiten. In der Verhandlung des Obersten Gerichtes am 4. und 5. Januar 1990 erklärte Generalstaatsanwalt Dr. Harrland: «… Das Urteil vom 26. Juli 1957 beruht auf Verletzung des Gesetzes und ist daher aufzuheben …»
Rechtsanwalt Dr. Friedrich Wolff, der mich in dieser Kassationsverhandlung – wie schon 1957 – vertrat, sagte in seinem Plädoyer: «… Das heutige Urteil wird wieder ein Urteil in einem politischen Strafprozeß sein. Aber es muß ein rechtsstaatliches werden. Es wird das Ende einer Epoche deutscher Rechtsgeschichte markieren, deren Anfang noch zu suchen und zu finden ist, wenn wir gerecht urteilen wollen. Ich meine, diese Epoche beginnt nicht 1949 mit der Gründung der DDR, wohl auch nicht 1933. Politik geht in Deutschland schon immer vor Recht … Fallen wir dabei nicht in den Fehler der vergangenen Epoche zurück. Lassen wir den Richter Recht sprechen, unabhängig, objektiv, ohne Rücksicht auf der Parteien Gunst oder Haß. Möge Ihr Urteil dazu den Grundstein legen …»
Wenn sich diese Erwartungen erfüllen, wenn die im Herbst 1989 von den Intellektuellen im Zusammenwirken mit den Volksmassen erzwungene Wende unseren Menschen hilft, die Vereinigung der beiden deutschen Staaten der Demokratie und dem Frieden in der Welt dient, dann waren die Leiden und Opfer in den vier Jahrzehnten der Nachkriegsgeschichte nicht sinnlos. Ich jedenfalls darf in Anspruch nehmen, mein politisches Leben als Widerstand gegen Faschismus und Stalinismus genutzt zu haben. Und meine soziale Herkunft ist Verpflichtung, für die Interessen der Menschen einzustehen, die sich im täglichen Kampf von den Ideen sozialer Gerechtigkeit, Freiheit, Solidarität und Menschlichkeit bestimmen lassen.
Kleinmachnow im Dezember 1990
Den Spuren folgen
«Ich habe Marx aufmerksam gelesen. Und ich glaube, ihn richtig verstanden zu haben. Außer Zweifel steht, daß seine Theorien mein Leben beeinflußt und den Rhythmus meiner Gedanken und Handlungen bestimmt, mein Wesen geformt haben. Doch es war nicht allein das. Mein Leben war immer auch die Suche nach Selbstverwirklichung. Inwieweit das gelungen ist, werden diese Erinnerungen zeigen.»
«Sittliches Betragen»
«… das Leben ist eine Reise auf ein hohes Gebirge. Wir reisen in Gesellschaft dahin, und einem jeden ist eine gewisse Verrichtung aufgetragen. Einige sind bestimmt, eine gewisse Last hinanzutragen, anderen ist ein Vorrat übergeben worden, die Lastenträger zu erquicken …»
Christian Schubart
Festung Hohenasperg
Es gibt jene, die Lasten tragen, und andere, die die Lastenträger erquicken – so Christian Schubart, Zeitgenosse von Goethe und Schiller, während zehnjähriger Haft im Kerker seines Herzogs Carl Eugen.
Keine Gesellschaft, wie immer ihre Attribute lauten, kann diese Teilung aufheben. Einzelne, die von da nach dort wechseln, mit oder ohne Willen, setzen die Regel nicht außer Kraft. Jedenfalls habe ich den Sinn des Lebens so verstanden. Als junger Mann unbewußt, später bewußter. Ein «Vorrat» allerdings, um andere «zu erquicken», ist mir nicht mitgegeben worden.
Treffender ist, was Leonhard Frank, klein geboren, groß gestorben, mit schöner Bescheidenheit berichtet: «Er war das Sorgen vermehrende unerwünschte vierte Kind» einer Mutter, die Kinder liebte, aber keine wünschen konnte, weil sie mit jedem Kind von mehr Not geplagt wurde, dennoch aber ihren sechs Kindern alles gab, was menschliches Leben sinnvoll macht.
Und hier beginnen, um noch einmal mit den Worten eines anderen zu sprechen, der gleich groß geboren, in Größe sein Leben selbst und zu früh beendet hat, «die Geschichten … die Quellen unseres individuellen Lebens … die versunkenen Abenteuer und Leidenschaften, die unser Wesen geformt haben … ohne Frage, wir sind tiefer verwurzelt, als unser Bewußtsein es wahrhaben will. Niemand, nichts ist zusammenhanglos. Ein umfassender Rhythmus bestimmt unsere Gedanken und Handlungen …» (Klaus Mann)
Nach Marx gibt es eine dritte Kategorie von Menschen, nämlich jene, die Macht in Anspruch nehmen, sich nicht in die eine oder andere Gruppe einreihen lassen.
Ich habe Marx aufmerksam gelesen. Und ich glaube, ihn richtig verstanden zu haben. Selbstverständlich halte ich ihn für den Größten. Außer Zweifel steht auch, daß seine Theorien mein Leben beeinflußt und, wie Klaus Mann sagte, «den Rhythmus» meiner Gedanken und Handlungen bestimmt, mein «Wesen» geformt haben. Doch es war nicht allein das. Mein Leben war immer auch das Suchen nach Selbstverwirklichung. Inwieweit das gelungen ist, werden diese Erinnerungen zeigen.
Zu meinem Leidwesen kann ich weder singen noch schöne Geschichten erzählen. Noch weniger vermag ich, mich in Erbauliches zu flüchten. Ich kann nur Episoden aus dem «Mosaik» berichten, welches «Jahrhunderte hindurch dieselben Figuren prägt und variiert …».
Wie alle Kinder mußte ich den Spuren folgen, die von meinen Eltern vorgegeben waren. Und da könnte ich endlos über meine Kindheit berichten. Sie prägte, trotz millionenfacher Gleichheit mit Kindern anderer Lastenträger, ziemlich früh eine «Figur», die, im Verhältnis zu Gleichgestellten, «Variation» erkennen läßt.
Wo und wann das begonnen hat, kann ich nicht mehr bestimmen. Ich erinnere mich aber noch ganz genau an zwanzig Stockschläge, die ich als Sechsjähriger in der katholischen Schule zu Chemnitz, 1920, auf die rechte Hand bekam. Nicht, weil ich ein schlechter Schüler oder ein ungehorsames Kind war. Ich bekam die Stockschläge, weil ich mit zehn Mitschülern während der Pause auf dem Schulhof durch eine Regenpfütze lief. Der gestrenge, aber fromme Lehrer hatte das durch ein Fenster beobachtet und als groben Verstoß gegen die Schulordnung abgestraft. Zehn Schläge also auf jede Hand. Da ich aber ein paar Wochen vor Schulantritt an der linken Hand eine schwere Verletzung erlitten hatte, der Zeigefinger steif und nicht ganz geheilt war, sagte ich dem Lehrer nach den zehn Schlägen auf die Rechte: «Meine Mutter hat gesagt, auf die linke Hand darf ich keine Schläge bekommen. Ich war sechs Wochen im Krankenhaus, und mein Finger ist noch nicht geheilt.» Der übelgelaunte Lehrer sah sich eine Sekunde lang die Hand an und schrie: «Dann her mit der Rechten! Es bleibt bei zwanzig Stockschlägen.» Und das war dann wirklich sehr schmerzhaft.
Um das Maß der Strafe vollzumachen, ließ der fromme Lehrer, der jede Schulstunde mit einem Gebet begann, sogleich «Schönschrift» üben. Da es aber gänzlich unmöglich war, mit der angeschwollenen Hand, die vor Schmerzen zitterte, die gewünschte «deutsche Schönschrift» mit Haar- und Feststrichen zu Papier zu bringen, folgten am Ende der Schulstunde weitere zehn Stockschläge wegen Schmiererei.
Als meine Mutter beim Löffeln der Mittagssuppe das Zittern der angeschwollenen Hand bemerkte, fragte sie: «Was ist mit deiner Hand?» Ich erzählte, was geschehen war. Schon am nächsten Tag kam es zu einem gehörigen Krach mit der Schulleitung. Da auch der Direktor das Prügeln rechtfertigte, beschimpfte ihn meine Mutter. Wahrscheinlich nicht auf feine Art. Ab sofort durfte ich nicht mehr in die katholische Schule gehen.
Die Humboldt-Schule in Chemnitz nahm mich ohne Wenn und Aber auf. Sie war die erste weltliche Schule in Sachsen, in der Prügelstrafe und Religionsunterricht abgeschafft waren. Als Hitler an die Macht kam, 1933, wurde die Schule von ihrem weltlichen Charakter «befreit». Die Hälfte der Lehrer, zumeist Sozialdemokraten, durften keine Lehrer mehr sein. Ein Teil von ihnen kam auf Jahre in Konzentrationslager.
Nicht als Kind, erst später wurde mir klar, wie vernünftig dieses Experiment in der Weimarer Zeit gewesen war. Im allgemeinen wurde sie nicht als «weltliche», sondern als «Freie Schule» verstanden. Sie war im besten Sinne des Wortes eine Schule mit den größten Freiräumen. Wäre es anders gewesen, hätte ich nicht meine ganze Zeit dort verbracht. Zu dieser Bereitschaft haben die Lehrer das meiste beigetragen. Viel auch das System der freiwilligen Betätigung, der Zugang zur Weiterbildung, handwerklicher Beschäftigung und Unterhaltung.
Mit zehn Jahren fertigte ich Linolschnitte an, die in der Schulzeitung abgedruckt wurden. Mit zwölf Jahren bastelte ich aus Pappe, Silberpapier, Draht und Leim einen Zeppelin, der über einen Meter lang war. Alle Mitschüler bewunderten das zur Ausstellung gebrachte Werk. Anlaß war die aufgekommene Zeppelin-Euphorie in Deutschland.
Besessen war ich vom Mathematik- und Geometrieunterricht. Was an Lehrsätzen vermittelt wurde, setzte ich in Modelle um. Aufklappbare Würfel, Kegel, Pyramiden, Kugeln und vieles mehr in bunten Farben, die alle Formeln optisch anschaulich machten, ließen ein dickes Mathematikbuch entstehen.
Der 1927 aus Wien angereiste sozialdemokratische Oberbürgermeister, der neben anderen Einrichtungen auch die Humboldt-Schule besuchte, war darüber so erstaunt, daß er sich – neben anderen Leistungen guter Schüler – das mit solidem Einband versehene Mathematikbuch schenken ließ. Als Gegenleistung sprach er eine Einladung für zwanzig Schüler aus, natürlich auf Kosten der Stadt Wien. Ich zählte zu den Glücklichen, die über Nürnberg, Regensburg, Passau, Wien, den Semmering, Dachstein, Bad Ischl und Salzburg auf die Reise gehen durften. Nach der Rückkehr schrieb ich in drei Monaten einen hundert Seiten langen Aufsatz in schöner Druckschrift und ergänzte ihn mit Bildern, Fotos und Zeichnungen. Da ich auch das Buchbinden erlernt hatte, faßte ich meine Arbeit in einem Band zusammen. Als die Nazis an die Macht kamen und «Ordnung» schafften, wanderte dieses kindliche Buch mit anderen Büchern aus der Schulbibliothek auf den Scheiterhaufen, wo alles verbrannt wurde, was zum deutschen Ungeist erklärt worden war.
Die Reise durch Österreich hatte noch eine andere Arbeit zur Folge. Das alte Sensenwerk in Bad Ischl hinterließ einen so nachhaltigen Eindruck, daß ich den Versuch wagte, das Schmiedewerk in Sperrholz nachzubilden. Mit Hilfe eines Lehrers gelang das auch. Goß man Wasser über die Zuleitung auf das Mühlrad, begannen die durch eine Walze angetriebenen drei Hämmer den Takt zu schlagen. Das Hämmern im Modell begeisterte mich mehr als das Dröhnen der Riesenhämmer in Bad Ischl.
Großen Spaß machte die Besichtigung der Feuerwehrwache in Chemnitz. Der Brandmeister veranstaltete für die Humboldt-Schüler einen richtigen Alarm mit allem Drum und Dran. Zum Schluß fuhr ein Löschzug aus, um den vorbereiteten Brand zu löschen. Meine Mitschüler und ich durften zwischen den Feuerwehrleuten auf dem Löschzug sitzen und das Stadtzentrum durchfahren. Nie zuvor, auch niemals danach, hat es so etwas in meiner Vaterstadt gegeben.
Drei Monate nach dem Erlebnis mit der Feuerwehr lieferte ich wieder einen Aufsatz ab. Mit Fotos und Zeichnungen, Druckschrift und bunten Initialen. Der gute Brandmeister war so gerührt, daß er noch mehr Geheimnisse über die Feuerwehr erzählte. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einem besseren Erzähler gelauscht zu haben. Nach dem 30. Januar 1933 wurde der sechzigjährige Brandmeister wegen sozialdemokratischer Gesinnung aus dem Amt gejagt und zur «Umerziehung» in ein Konzentrationslager geschickt.
Als ich elf Jahre alt war, kam der Lehrer Voigtländer zu meiner Mutter und bat um die Erlaubnis, mich zu seinen Eltern mitnehmen zu dürfen. In Langhennersdorf besaß seine Familie einen Bauernhof. Da er mit seiner Frau, ebenfalls Lehrerin an der Humboldt-Schule und Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns in Leipzig, die Ferien im Riesengebirge verbrachte, stand mir für die Dauer der Ferien sein Zimmer im Elternhaus zur Verfügung. Die sechs Wochen waren so schön, wie ich mir den Aufenthalt im Paradies vorstellte. Der schon betagte Mittelbauer, stolz auf seinen gebildeten Sohn, besaß noch keine Enkelkinder. Vielleicht war das der Grund, warum er den fremden Jungen wie einen Enkel behandelte. Das erste, was er mir beibrachte, war, ein Pferd vor eine kleine Kutsche zu spannen. Natürlich teilte er mir auch Arbeiten zu. Nach dem Frühstück mußte ich die Hühner füttern, der Katze Milch und dem Hofhund das Futter geben. Das war so aufregend und neu für mich, daß ich zum glücklichsten Kind dieser Welt wurde. Freilich gab es auch Heimweh. Ich war ja nie zuvor in einer anderen Familie gewesen. Aber das verging schnell, spätestens als ich mit der Kutsche fahren durfte, um Kirschen zu pflücken, mit gefüllten Körben heimkam und dafür mit Lob und Dank bedacht wurde. Der Lehrer Voigtländer wurde 1933 aus dem Schuldienst verwiesen, obgleich er keiner Partei angehörte. Er weigerte sich nur, «Heil Hitler» zu sagen. Dennoch hat er die ersten Nazijahre gut durchgestanden. Der Leipziger Kaufmann nahm seinen Schwiegersohn ins Geschäft. Und so wurde aus dem begabten Lehrer ein erfolgreicher Kaufmann. Während des Zweiten Weltkrieges ist er gefallen.
Mit Beginn der achten Klasse begannen die Vorbereitungen auf die Jugendweihe. Mein letzter Lehrer, mit dem weitverbreiteten Namen Müller, unverheiratet, parteilos, unpolitisch, homosexuell – was uns Kindern verborgen blieb, weil wir nicht wußten, was das war –, war gegen die Jugendweihe. Sie würde die Kinder politisch beeinflussen. Womit er recht hatte.
Aber mein Elternhaus war ohnehin politisch. Seit Anfang der zwanziger Jahre waren mein Vater und meine Mutter Mitglieder der Kommunistischen Partei. Ich wurde zum Leiter der Gruppe ernannt, die sich auf die Jugendweihe vorbereiten sollte. Und das gefiel dem Lehrer überhaupt nicht. Er untersagte die Teilnahme. Von meinem ältesten Bruder Albert beeinflußt, der inzwischen Funktionär der KP war, wies ich ihn darauf hin, daß die Jugendweihe nicht in die Kompetenz der Lehrer falle. Da mir der Lehrer für meine schulischen Leistungen keine schlechten Zensuren im Abgangszeugnis geben konnte, rächte er sich für meinen Ungehorsam mit einer schlechten Zensur in «Sittlichem Verhalten». Heutzutage versteht man darunter «Betragen». Wer also nicht mindestens eine Eins bekam, galt als ganz und gar verdorben. Meine Eltern waren deshalb sehr böse auf den Lehrer. Trotzdem erhoben sie keinen Einspruch. Und ich machte mir nicht viel daraus. Die Schule, so glaubte ich, war damit abgeschlossen.
Aber ganz so einfach war das nicht. Zunächst fand ich keine Lehrstelle. 1928 zeigten sich die ersten Anzeichen der Weltwirtschaftskrise. Bis Anfang der dreißiger Jahre zählte man in Deutschland ein Arbeitslosenheer von sieben Millionen. Demzufolge wurde auch das Angebot von Lehrstellen auf ein Minimum reduziert. Wo ich mich mit meinem Zeugnis um eine Lehrstelle bewarb, wurde ich wegen der Zwei in «Sittlichem Verhalten» gleich abgewiesen. Da ich aber unbedingt einen Beruf erlernen sollte, wie alle meine Geschwister, kam meine Mutter auf die Idee, das Zeugnis zu Hause zu lassen und nur mit den schön gebundenen Aufsätzen über die «Reise nach Wien», die «Feuerwehr in Chemnitz» und einer weiteren Arbeit über die «Zündholzfabrik in Riesa» beim Besitzer der «Buch- und Steindruckerei Bruno Schönherr» vorzusprechen.
Der beleibte Mann, dem die Aktivitäten des Vaters und ältesten Bruders unbekannt waren, sah sich die in Druckschrift geschriebenen und reich illustrierten Aufsätze lange an und fragte schließlich: «Hast du diese Bücher allein geschrieben?»
«Ja, Herr Schönherr. Ich habe sie auch selbst gebunden.»
«Wie alt bist du eigentlich?»
«In fünf Wochen, am 29. April, werde ich vierzehn.»
Ohne nach den Schulzeugnissen zu fragen, sagte er: «Du kannst am 1. April die Lehre antreten. Sie dauert vier Jahre. Im ersten Jahr bekommst du fünf Mark Wochenlohn. Die Arbeitszeit beginnt um sieben und endet um siebzehn Uhr.» An meine Mutter gewandt: «Den Lehrvertrag schicke ich per Post zu.» Damit war die erste Hürde der «Sittenzensur» genommen. Mutter freute sich, und Vater war auch zufrieden. Er meinte nur: «Das hast du deiner Mutter zu verdanken. Sie ist tüchtiger als wir alle zusammen.»
Die zweite Hürde war in der Berufsschule zu nehmen. Der erste Tag: Ein Lehrling, der in der ersten Reihe stand, wurde beim Eintreten des Lehrers angeherrscht: «Zeugnisse einsammeln und auf das Pult legen!» Der Lehrer, der sich aufführte wie ein Feldwebel und eine Umgangssprache wie auf dem Kasernenhof pflegte, ging indessen vor dem Pult auf und ab. Nach ein paar Minuten des Stillstehens befahl er mit kaum geöffneten Lippen: «Setzen!» Nachdem die Zeugnisse auf dem Pult abgelegt waren, nahm der blaß aussehende, knochige, igelgestutzte, halb uniformierte Lehrer Platz und begann, die Zeugnise durchzusehen. Inzwischen warteten die stillsitzenden Berufsschüler gespannt auf das, was folgen würde.
Zunächst geschah nichts. Ohne Eile blätterte der «Igelkopf» – so wurde er fortan von den Lehrlingen genannt – in den Zeugnissen. Eines davon legte er beim Durchsehen auf die Seite. Als er damit fertig war, nahm er das auf die Seite gelegte Zeugnis wieder in die Hand und sagte, den Blick ins Unendliche gerichtet: «In diesem Raum befindet sich ein Sittenstrolch. Er mag vortreten.»
Keiner erhob sich, und niemand trat vor.
«Ich habe gesagt: Vortreten!»
Da sich noch immer niemand regte, schrie der aufgesprungene Igelkopf: «Ist der Lehrling Janka schwerhörig? Sofort vortreten!»
Als ich vor dem Pult stand, stieg der in Ledergamaschen stiefelnde Lehrer von seinem Podest herunter, umkreiste mich zweimal, betrachtete mich von oben bis unten, bis es wie ein Gewitter losprasselte: «Wie kannst du es wagen, mit einer solchen Zensur die Lehre als Schriftsetzer anzutreten? Willst du die geachtete Schule in Verruf bringen? Erkläre laut und deutlich, worin deine sittliche Verkommenheit besteht.»
Auf eine solche Attacke war ich nicht gefaßt. Aber was ich zu hören bekam, war zuviel. Nachdem ich noch einmal angeschrien worden war, antwortete ich: «Wenn Sie mich noch einmal als sittlich verkommen beschimpfen, werden meine Eltern eine Beschwerde einreichen.»
Zu den Lehrlingen gewandt, unterbrach mich der Lehrer mit höhnischem Gelächter: «Habt ihr gehört, was der sich herausnimmt?» Dann wieder mich anschreiend: «Du wirst dich noch wundern, Früchtchen!»
«Lassen Sie mich doch aussprechen», fiel jetzt ich dem Lehrer ins Wort. «Sie können dann daraus folgern, was Sie für richtig halten. Ich habe die Zwei bekommen, weil mein Lehrer die Teilnahme an der Jugendweihe untersagt hatte. Ich habe aber trotzdem teilgenommen. Und damit Sie gleich informiert sind, seit dem 1. April bin ich Mitglied des Buchdruckerverbandes und der Kommunistischen Jugend. Im übrigen bitte ich Sie, einen Blick auf die Zensuren für meine schulischen Leistungen zu werfen.»
Dem Gamaschen-Menschen verschlug es die Sprache. Er setzte sich wieder auf seinen Stuhl und sagte: «So ist das also, einen Kommunisten haben wir jetzt. Einen Kommunisten», wiederholte er verzweifelt, nicht wissend, was er hinzufügen könnte.
Ohne seine Erlaubnis, mich wieder setzen zu dürfen, abzuwarten, drehte ich mich um und ging zu meiner Bank. Bevor ich Platz nahm, sagte ich laut: «Nein, Herr Lehrer. Nur einen, der es werden will.»
«Schweigen Sie! Ich will nichts mehr hören.» Danach sprang der Igelkopf auf und verließ das Klassenzimmer. Bis er zurückkam – offenbar vom Direktor darauf aufmerksam gemacht, daß er sich mit dem «Kommunisten» abfinden müsse –, verging eine Weile.
Im zweiten Schuljahr organisierte ich, inzwischen Funktionär im Jugendverband, einen Schülerstreik. Er endete mit der Versetzung des «Igelkopfes». Auch die anderen Fachlehrer zeigten kein Verständnis für den Wüterich. Und der sozialdemokratische Direktor war nicht gewillt, dem Gamaschen-Helden Unterstützung zu geben. Im März 1933 kam der Davongejagte zurück an die Berufsschule. Nicht mehr als Lehrer, sondern als Direktor. Statt der billigen Gamaschen trug er Stiefel aus gutem Rindsleder und ein braunes Hemd. Die Lehrlinge mußten nach seiner Rückkehr den Unterricht mit «Heil Hitler» beginnen. Ich blieb davon verschont. Am 31. März 1932 hatte ich die Berufsschule und meine Lehre als Schriftsetzer abgeschlossen. Erwähnt sei noch, daß der vermeintliche «Sittenstrolch» Walter Janka die Berufsschule und Lehre mit guten Zeugnissen abschließen konnte. Die im «Handwerkerverein zu Chemnitz» organisierten Unternehmer mußten sogar den längst bekannten Jugendfunktionär, dessen Bruder inzwischen Reichstagsabgeordneter der Kommunistischen Partei war, nach den abgelegten Prüfungen auszeichnen. Er bekam eine zweibändige Ausgabe der Werke von Johann Wolfgang von Goethe.
Bei der Abgangsfeier sollte ein Lehrling nach den Ansprachen der Unternehmer und des Schuldirektors eine angemessene Rede halten. Sie sollte nicht länger als fünf Minuten dauern und mit Lob und Dank an die Unternehmer, Meister und Berufsschullehrer enden. Vorgesehen war der Sohn des größten Druckereibesitzers in Chemnitz. Der Junge, der in Lehre und Schule tüchtig war, hatte sich mit Hilfe des Klassenleiters lange auf die Rede vorbereitet. Nur hatten Vater und Lehrer nicht bedacht, daß der fleißige Sohn nie zuvor vor größerem Publikum gesprochen hatte. Schon im Unterricht gingen ihm die Worte, wenn auch immer mit richtigen Ergebnissen, schwer von der Zunge. Dennoch wurde er dafür auserkoren. Bei dieser Gelegenheit wollte man eben dem anwesenden Druckereibesitzer gefällig sein. Aber das ging schief. Einen Tag vor dem 13. März 1932 – der Termin konnte nicht mehr verschoben werden – bekam der brave Sohn Lampenfieber. Alles Zureden half nichts. Und so mußte in letzter Minute ein anderer für die Danksagung gefunden werden. Zwei weitere Kandidaten lehnten ab. Sie trauten sich nicht, vor Unternehmern, Lehrern, Meistern, Eltern und ehemaligen Mitschülern – zweihundert an der Zahl – zu sprechen. Der Lehrer, der sich um die Organisation der Veranstaltung kümmern und den Redner aussuchen mußte, sprach unter vier Augen mit mir. Er begann mit den Worten: «Deine Gesinnung ist uns bekannt. Ich weiß auch, daß du nicht gern vor Arbeitgebern sprechen möchtest. Aber vielleicht kannst du dir einmal Gewalt antun und ein paar Worte des Dankes sagen. Sprichst oft genug in öffentlichen Versammlungen und hast keine Hemmungen. Um es dir leichtzumachen, schreibe ich auf, was du vorlesen kannst.»
Ich antwortete: «Herr Busch, Sie haben unrecht. Ich würde gern einmal vor Unternehmern sprechen. Bis jetzt konnte ich das nur vor jugendlichen Arbeitern. Wenn Sie möchten, rede ich. Aber aufschreiben lasse ich mir nichts. Wenn ich reden soll, dann sage ich, was ich zu sagen haben. Aber keine Angst: Über den Kommunismus werde ich bei dieser Gelegenheit nicht sprechen.»
Kurz bevor ich vortreten mußte, bat der Lehrer noch einmal: «Bitte keine Propagandarede.» Dann schob er mich ans Rednerpult.
Meine Worte dauerten länger als fünf Minuten. Und sie fanden aufmerksame Zuhörer. Nach dem Dank an die Meister und Lehrer forderte ich die Arbeitgeber auf, denen zu danken, die in den letzten zwei Jahren der Ausbildung nicht schlechter und nicht weniger produktiv gewesen waren als die älteren Arbeitnehmer. Den Hauptteil der Rede aber füllte ich mit Hinweisen auf unser Schicksal. 99 Prozent der Junggesellen würden ohne Arbeit sein und das Heer der sieben Millionen Arbeitslosen vermehren. Mit dem Appell, daß sich keiner wundern möge, wenn die Arbeitslosen für das Recht auf Arbeit kämpften, schloß ich meine kurze Rede. Um die eingetretene Stille zu beenden, gab der Lehrer das Zeichen, mit Beethoven einzusetzen.
Am Ausgang des Saales löste sich die gemischte Gesellschaft rasch auf. Der Lehrer trat noch einmal heran und sagte: «Du hast dich nicht an unsere Abmachung gehalten. Aber trotzdem. Du warst besser, als ich erwartet habe. Ich wünsche dir alles Gute für dein weiteres Leben.» Danach kam der Sohn des Unternehmers, der die Rede hätte halten sollen, gab mir die Hand und sagte: «Du hast uns allen aus dem Herzen gesprochen. Wahrscheinlich bin ich der einzige, der in Lohn und Arbeit bleibt. Und das nur, weil mein Alter Herr dafür sorgt. Hier, die drei Nelken gehören dir.»
«Gib sie meiner Mutter, die da vorn auf mich wartet. Sie, nicht ich, hat die Blumen verdient. Es ist allein ihr Verdienst, daß ich Schriftsetzer werden konnte.»
Als wir nach Hause gehen wollten, traten andere heran, um sich zu verabschieden. Einer blieb zurück und fragte: «Kann ich dich ein Stück begleiten?»
«Ja, natürlich. Aber ich bin in Eile und werde von meinen Freunden erwartet. Worum geht es denn?»
«Ich möchte dich bitten, daß ihr mich in euren Jugendverband aufnehmt. Trage mich schon lange mit diesem Gedanken. Wollte aber warten, bis die Lehre beendet ist. Außerdem geht es mir wie dir. Ab 1. April bin ich arbeitslos.»
«Dann komm mit. Ich bin auf dem Weg in unser Büro. Da kannst du den Aufnahmeschein ausfüllen, und ab morgen bist du Mitglied.»
Am 31. März 1932 bekam ich die Papiere. Der beleibte Herr Schönherr händigte sie selbst mit den Worten aus: «Tut mir leid, daß ich dich nicht mehr beschäftigen kann. Aber du wirst ja bemerkt haben, wie schlecht es um unsere Aufträge steht. Der Betrieb ist seit Monaten nur zur Hälfte ausgelastet. Bald werde ich gezwungen sein, weitere Schnellpressen stillzulegen …»
Bleibt nachzutragen, was der Meister zum Abschied sagte, der mir schon mit 16 Jahren das Rauchen in den Pausen erlaubte, was anderen Lehrlingen untersagt war: «Alter Junge, dich hätte ich gern behalten. Nicht nur, weil du ein brauchbarer Schriftsetzer bist. Mehr als das werde ich die Streitgespräche missen, die dein sozialdemokratischer Meister mit dir geführt hat. Aber was soll’s? Du machst deinen Weg. Und wenn ich nicht irre, bist du am längsten Schriftsetzer gewesen. Wie dein Bruder Albert, der aufgehört hat, Schlosser zu sein …»
Nach dem 1. April 1932 habe ich nie wieder als Schriftsetzer gearbeitet. Über die Firma «Bruno Schönherr» ist zu berichten, daß sie nach 1933 noch einmal in Schwung gekommen war. Bei dem großen Bombenangriff im Februar 1945 ist sie bis auf die Grundmauern niedergebrannt und für immer zerstört worden.
Der Mord im Volkshaus von Reichenbach
Das Jahr 1932 machte mich zu einem rastlosen Arbeiter. Geld war dabei nicht zu verdienen. Was ich gern gewollt hätte, aber nicht konnte. Dennoch stand ich früh auf, nahm mit dem Vater, seit 1930 ohne Arbeit, der Mutter, die mit Wäsche- und Seifenhandel zur Arbeitslosenunterstützung des Vaters ein paar Mark dazuverdiente, der schulpflichtigen Schwester Gertrud und dem Bruder Hans, der gerade seine Malerlehre begonnen hatte, das bescheidene Frühstück ein. Danach verließ ich die elterliche Wohnung und kehrte nur auf ein paar Nachtstunden zurück.
Die ältere Schwester Hilde hatte einen Kellner geheiratet, der seine Arbeitslosigkeit mit Geschwätz verdrängte. Als die beiden am anderen Ende der Stadt eine Wohnung beziehen konnten, ihr erstes Kind erwarteten, war das für alle eine Erleichterung. Volle zwei Jahre hatten sie die «gute Stube» in Anspruch genommen. Als sie auszogen, wurde die Wohnung nicht größer, aber ruhiger.
Mit dem Bruder Albert lief alles anders. Für mich war er so etwas wie ein Vorbild, dem man nacheiferte, ohne es einzuholen. Die Hauptstationen seines kurzen Lebens waren: katholische Schule bis zum vierzehnten Lebensjahr. Die Schulleitung, der man keine Wohltaten für Arbeiterkinder nachsagen konnte, wollte ausnahmsweise den Abgang verhindern. Er sollte sein malerisches Talent ausbilden. Dazu wäre das Abitur und danach die Kunsthochschule in Dresden vonnöten gewesen. Da aber die Eltern arm waren, den Jungen nicht weitere acht Jahre durchfüttern, sich auch nicht vorstellen konnten, wie man mit der Malerei seinen Lebensunterhalt verdienen können sollte, mußte er einen «richtigen Beruf» erlernen. Und so trat er trotz des in Aussicht gestellten Stipendiums als Schlosser in die Lehre ein. Sie ging zu Ende, als die Hindenburgs und Hugenbergs ihren Kaiser nicht mehr retten, den Ersten Weltkrieg zwar anzetteln, aber nicht gewinnen konnten, das liebe Vaterland in ein Chaos stürzten und 1918 die Novemberrevolution – natürlich «wider Willen» – auslösten.
Alberts Begabung schlug in ein neues Talent um. Die Erfahrungen im größten Rüstungsbetrieb der Stadt Chemnitz, die unsagbare Not nach dem verlorenen Krieg, das revolutionäre Aufbegehren der Volksmassen schwemmten ihn an die Spitze der Arbeiterjugend. Zunächst in der Metallarbeiter-Gewerkschaft. Gleichzeitig im Kommunistischen Jugendverband. Da er so gut reden wie malen konnte, den mit Bravour verdauten Religionsunterricht vergaß, dafür mit Leichtigkeit das marxistische Gedankengut annahm, es besser auszulegen wußte als das Neue Testament, wurde er mit achtzehn Jahren Berufspolitiker. Oder, wie man damals sagte, Berufsrevolutionär. Und Gott muß die Hand im Spiel gehabt haben. Was er einmal las, hörte oder lernte, ging in sein Hirn und Gedächtnis ein. Nicht schlechter als ein Priester die Bibel zitierte er Marx, Engels oder Lenin.
Wenn ich sage, daß er reden konnte, ist nicht gemeint, daß er sich in Geschwätz erging. Seine Reden waren faszinierend. Ob in Sälen mit tausend Zuhörern oder auf Plätzen mit zwanzigtausend Menschen, er fand in freier Rede Gehör und Beifall. Niemals las er Reden ab, wie das heutzutage die Redner tun, weil sie sonst den Faden ihrer Rede verlieren oder nicht finden.
Gott hatte ihn zudem mit allem ausgestattet, was einen schönen Mann ausmacht. Groß, blaue Augen, blondes Haar, breite Schultern, feste Muskeln, schmale Hüften. Ich habe braune Augen, schwarzes Haar, stark wie mein Bruder war ich auch nicht.
Albert klagte nie. Auch dann nicht, wenn er von der Polizei oder von SS-Banden zusammengeschlagen wurde. Ich erinnere mich, wie er wiederholt die Familie überraschte, wenn er mit verbundenem Arm oder Bein, einmal sogar mit einem dicken Brustverband, still ins Bett gegangen war, ohne den Schlaf der Mutter zu stören, die jedes Geräusch wahrnahm. Wenn man ihn fragte, wann und wie das geschehen sei, antwortete er einsilbig. Selbst dann, wenn nicht zu übersehen war, daß er an starken Schmerzen litt, kam nie ein Stöhnen oder Klagen über seine Lippen. Oft wußten wir nicht, ob wir ihn bewundern oder fürchten sollten.
Ich bewunderte ihn grenzenlos. Er machte eine schnelle und steile Karriere. Nach mehreren Funktionen im Jugendverband, in der Partei, delegierte ihn das ZK der KPD auf die Lenin-Schule nach Moskau. Als er zurückkam, brachte er die in Moskau gedruckte vollständige Lenin-Ausgabe in deutscher Sprache mit. Sonst nichts. Für materielle Dinge interessierte er sich nicht. Alles zu wissen, das war seine Leidenschaft. Nach Moskau war er Berufsrevolutionär.
Mit dreiundzwanzig Jahren wurde Albert Erster Sekretär der KPD im Bezirk Erzgebirge-Vogtland. 1932 kandidierte er als Abgeordneter für den Reichstag und gewann sein Mandat. Er war der jüngste Abgeordnete in diesem hohen Haus. Kaum verwunderlich, daß er bei so vielen Erfolgen nicht nur Freunde, sondern auch Neider und Feinde hatte.
1933 wurde Albert zu einem der am meisten gefolterten Opfer der Naziverbrecher. Wenige Tage vor seinem 26. Geburtstag erschlugen ihn SS-Mörder. Berauscht von ihrer Tat, hängten sie ihn bei einem Saufgelage am Kronleuchter im ehemaligen Volkshaus von Reichenbach auf. Um ihre Schandtat zu verschleiern, ließen sie in der Presse verkünden, daß er Selbstmord verübt habe. Diese schamlose Lüge ist um so niederträchtiger, weil jeder wußte, daß Albert nie aufgab.
1932 wurde auch ich für die Lenin-Schule nominiert. Ich sah darin eine große Chance, mein Wissen zu erweitern und vielleicht, wie mein Bruder, ein qualifizierter Politiker zu werden. Da die Abreise auf Ende des Jahres festgelegt war, arbeitete ich noch mehr als zuvor. Es gab keinen Tag, an dem ich nicht in einer Mitgliederversammlung der vielen Ortsgruppen, oder in einer öffentlichen Kundgebung als Referent bzw. Diskussionsredner in Versammlungen der sozialdemokratischen, christlichen oder auch nazistischen Jugendorganisationen auftrat. Und selbstverständlich nahm ich an der Organisierung von Streiks, Demonstrationen, Herstellung und Verbreitung von Zeitungen oder Flugblättern teil. Ebenso an den meisten Sitzungen der Chemnitzer Parteileitung, der ich als Organisationssekretär des Jugendverbandes angehörte. Sie stand unter der Führung des populären Sekretärs der KPD Kurt Sindermann – Bruder von Horst Sindermann –, ebenfalls ein hervorragender Redner und Freund von Albert, der nach 1945 fälschlich als Verräter beschuldigt und im Zuchthaus Bautzen, wo er schon viele Jahre unter Hitler eingesessen hatte, hingerichtet wurde. Lange Zeit bewohnten sie gemeinsam eine Wohnung, und immer arbeiteten sie eng zusammen. Auch dann noch, als Albert Abgeordneter des Reichstags geworden war. Da Kurt und Albert zu den von den Nazibanden am meisten gehaßten Personen zählten, konnten sie keinen Schritt ohne Begleitschutz tun, was damals schwieriger war, als man sich das heute vorstellen kann. Waffen durften sie nicht besitzen. Hätten sie sich daran gehalten, würden beide schon das Jahr 1932 nicht überlebt haben.
Um wenigstens in ihrer Wohnung nicht überrascht zu werden, hielten sie sich einen scharf abgerichteten Schäferhund. Ein großartiges Tier. Wenn sich jemand an der Tür zu schaffen machte, knurrte er böse. Aber leider durften sie den braven Hund nicht lange behalten. Der Hausbesitzer erwirkte ein polizeiliches Verbot. Und obwohl sie das Verbot einige Zeit ignorierten, kam doch der Tag, an dem der Hund weggebracht werden mußte. Die Polizei hätte ihn sonst erschossen. Die Trennung fiel beiden schwer. Selbst wollten sie ihn nicht töten. Also verschenkten sie den Hund an einen Freund in Zwickau. Weit weg von Chemnitz, damit er nicht zurückkommt. Doch die Erwartung ging nicht auf. Drei oder vier Tage später jaulte der anhängliche Hund gegen Mitternacht auf der Straße, bettelte mit blutiggelaufenen Pfoten und völlig ausgehungert, daß man ihm die Tür zu seinem gewohnten Heim öffne. Die sonst so unsentimentalen «Herrchen» waren tief gerührt, holten ihn herein und päppelten ihn wieder hoch. Sie rätselten, wie der Hund, der im Auto nach Zwickau gebracht worden war, den weiten Weg zurückgefunden hatte. Ein paar Tage später – da es wieder Krach mit dem Hausbesitzer gab – haben sie ihn dann erschossen. Außerhalb der Stadt, im Zeisigwald, wo sie ihn auch begraben konnten.
Wer sich die Mühe macht, die Annalen von 1932 nachzuschlagen, wird entdecken, daß es in Chemnitz, wie in allen Industriestädten, ständig Morde und Erschießungen gab. Es läßt sich auch nachlesen, wie mächtig die Kundgebungen waren, wenn hingemordete Arbeiter zu Grabe getragen wurden. Die gemeinsamen Opfer von Kommunisten und Sozialdemokraten haben leider nicht dazu beigetragen, eine Verständigung der Linksparteien herbeizuführen. Eine damals noch denkbare Einheitsfront aller Hitlergegner hätte es vielleicht vermocht, dem Naziterror ein Ende zu bereiten und den Faschismus in Deutschland zu verhindern. Die Arbeiter jedenfalls waren dazu bereit. Im Wege standen die Parteiführer mit unversöhnlichen Theorien. Sie wurden selbst dann ihrer Verantwortung noch nicht gerecht, als schon ein Blinder erkennen mußte, daß es keinen anderen Weg gab, als dem Naziterror gemeinsam entgegenzutreten. Parteien und Gewerkschaften haben – ungewollt, aber nicht schuldlos – selbst zu ihrem Untergang beigetragen.
Nach einer Kundgebung im Sommer 1932, zu der ein führendes Mitglied des ZK aus Berlin angereist war, wurde ich zu einem Gespräch unter vier Augen gerufen. Es ging um die Reise nach Moskau.
Frohgemut schüttelte ich dem geschätzten Genossen aus Berlin die Hand und sagte: «Fritz, über meinen Nachfolger, der die Organisationsarbeit fortsetzen wird, haben wir uns schon entschieden. Der für Gewerkschaftsarbeit zuständige Max wird mich ablösen.»
Fritz nickte mit dem Kopf und stellte ein paar Fragen. Daß sie etwas mit der Reise zu tun hatten, ahnte ich nicht. Ich vermutete, daß sich der führende Mann informieren wollte. Also, was sollte es? Ich antwortete gefaßt und gewann den Eindruck, daß er zufrieden war. Es ging dabei um den Unterschied zwischen ökonomischen und politischen Massenstreiks. Da Fritz nicht mit «Richtig» oder «Falsch» reagierte, wieder nur nickte, ergänzte ich: «Weißt du, wir haben die Streiktheorien bis zur Endlosigkeit durchgekaut. Besondere Probleme gibt es bei uns nicht. Wichtiger ist, wie wir die Streikbewegung mit mehr Erfolg durchsetzen. Ob da ein Streik politische oder ökonomische Ursachen hat, ist unwichtig. Auch ein Streik gegen Lohnkürzungen gewinnt durch die Maßnahmen der Polizei sofort politischen Charakter. Im übrigen machen wir die Erfahrung, daß die Arbeiter mit abstrakten Theorien nichts im Sinn haben.» Jetzt nickte Fritz nicht mehr. Er sagte auch nicht, ob ich etwas Falsches gesagt hätte. Er unterbrach mich aber, als ich darüber klagte, daß die Losung: «Raus aus den Gewerkschaften!» die Verständigung mit den Arbeitern erschwerte: «Außer ein paar Kommunisten lassen sie sich nicht für die ‹Roten Gewerkschaften› gewinnen.»
«Das ist falsch», antwortete Fritz. «Die wichtigste Aufgabe ist, jetzt die Reformisten zu schlagen, die Massen dafür zu mobilisieren.»
Darauf hatte ich keine Antwort. Ich wußte auch nicht, ob Fritz recht hatte. Aber dann sagte ich doch: «Alle diese Versuche bleiben ohne Erfolg. Das müßt ihr da oben doch wissen.» Und ich fügte hinzu: «Der mit den Nazis propagierte Streik gegen die ‹Sozialfaschisten› hat dazu geführt, daß ein Zusammengehen mit den sozialdemokratischen Arbeitern unmöglich wurde.»
Fritz mißbilligte, daß ich keine Begeisterung für den Kampf gegen die «Sozialfaschisten» erkennen ließ. Und so stellte er gleich eine weitere Frage: «Wie ist deine Meinung zu Heinz Neumann?» (Damals Reichstagsabgeordneter, seit 1929 Mitglied des Politbüros der KPD, Chefredakteur der «Roten Fahne» und Mitglied der Komintern, der im April 1937 fälschlich als Trotzkist und imperialistischer Agent in Moskau beschuldigt, zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde.)
«Meinst du die Losung ‹Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft›?»
«Nicht nur die. Ich meine seine Polemik gegen das Thälmannsche Zentralkomitee.»
«Dazu kann ich nichts sagen. Wir erfahren über den Streit in der Parteiführung zuwenig. Was davon bis zu uns kommt, stiftet mehr Verwirrung als Klarheit. Wir verstehen auch nicht, warum wir heute so und morgen wieder anders orientiert werden. Die einen zitieren Lenin, der gesagt haben soll: Erst müssen wir mit den Sozialdemokraten abrechnen, bevor man die Kapitalisten schlagen kann. Daher wohl die Theorie über die ‹Sozialfaschisten›, die von den sozialdemokratischen Arbeitern als üble Beleidigung verstanden wird. Die anderen rufen auf, die Faschisten zu schlagen, wo wir sie treffen. Daß das die geeignete Politik ist, die zu den Nazis übergewechselten Arbeiter zurückzugewinnen, kann ich mir kaum vorstellen. Außerdem ist es zur Zeit so, daß wir die Prügel beziehen. Deshalb wäre es besser, solche Überspitzungen zu unterlassen. Wichtiger ist, die Demontage der Demokratie zu verhindern. Und das ist nur möglich mit den Sozialdemokraten. Egal ob uns die reformistischen Führer der SPD gefallen oder nicht.»
Das reichte. Fritz beendete die Aussprache mit den Worten: «Genosse Janka, du bist noch nicht erfahren genug, um auf die Schule nach Moskau zu gehen. Wir haben uns für Fritz Rudolf entschieden. Dafür wirst du seine Funktion als Politleiter im Bezirk Chemnitz übernehmen, um dich in der praktischen Arbeit weiter zu qualifizieren.»
Die unerwartete Wendung machte mich traurig. Ich wäre gern auf die Reise gegangen. Die Misere meines materiellen Seins wäre damit vorerst gelöst gewesen. Ich bekam wöchentlich neun Mark Unterstützung vom Arbeitsamt. Zuwenig, um mich damit von meiner Mutter ernähren zu lassen.
Warum ich aber doch nicht böse wurde, weiß ich nicht. Vielleicht war es nur das Gefühl, das Leben geht auch ohne Moskau weiter. Später sollte sich erweisen, daß es ein Glück war, nicht nach Moskau gegangen zu sein.
Wie die Monate bis zum 30. Januar 1933 dahingingen, lohnt nicht, rekapituliert zu werden. Andere haben den Aufstieg der Nazis und die Ohnmacht der Arbeiterbewegung aus allen Perspektiven beschrieben. Ich erlebte diese Zeit wie alle politisch engagierten Jugendlichen. Wenn sie sich unterschieden haben sollte, dann durch etwas mehr Aktivität. Im nachhinein gestehe ich, daß mir die damit verbundenen Gefahren kaum bewußt wurden. Oder erst, als es zu spät war.
Immerhin, wir bereiteten uns in den Wochen vor Hitlers Machtantritt auf die Illegalität vor. Abziehapparate, Papier, Druckerschwärze und manches mehr wurden an geheime Orte geschafft. Die Arbeit sollte weitergehen können, wenn die legalen Einrichtungen verwüstet werden.
Auch Quartiere mußten beschafft werden. Das war besonders schwer. Niemand, ich schon gar nicht, verfügte über Geld. Das illegale Leben war nur möglich, wenn sich Freunde fanden, die ihre Wohnungen zur Verfügung stellten, das knappe Brot mit den Verfolgten teilten und das Risiko eingingen, selbst verfolgt zu werden, wenn sie Widerstandskämpfern Unterschlupf gewährten.
Arge Schwierigkeiten machte auch die Reorganisation der Ortsgruppen und Betriebszellen. Praktisch hörten sie nach dem 30. Januar 1933 auf zu existieren. Nur verläßliche Mitglieder wurden noch in kleinen Gruppen erfaßt. Aber auch diese funktionierten nicht richtig. Es gab zu viele Denunzianten und Spitzel. Und so mancher wechselte die Front, um sich zu retten. Hinzu kam, daß alle auf ein Wunder warteten. Nur konnte keiner sagen, woher ein Wunder kommen sollte.
Am 30. Januar versammelte ich noch einmal die Leitung des Chemnitzer Jugendverbandes im Parteihaus «Kämpfer». Wie sich herausstellen sollte, zum letztenmal. Die sonst mit Leben erfüllten Büros waren schon leer und still.
Nach einigem Hin und Her, ob die Sitzung abgebrochen werden sollte, wurde das Wichtigste besprochen. Bald nach Beginn der Aussprache ging die Tür auf, und die Landtagsabgeordnete Grete Groh, Mitglied des ZK der Kommunistischen Jugend, stürzte herein. Erregt schrie sie: «Die Polizei ist mir auf den Fersen. Vor dem ‹Kämpfer› fahren Lastautos mit SA und Polizei vor. Wir sind in der Falle!»
Meine erste Reaktion war: «Raus! Sie dürfen uns nicht in einem Raum erwischen. Verkrümelt euch!»
Als das Getrampel von Polizei und SA-Leuten auf der Treppe hörbar wurde und alle bis auf Grete aus dem Raum gestürzt waren, aber gleich auf der Treppe gefaßt wurden, zog Grete aus ihrer Handtasche eine Pistole und drückte sie mir in die Hand.
«Du mußt mir helfen. Mich dürfen sie nicht mit der Pistole erwischen.»
«Mich etwa?» Rasch drehte ich den Schlüssel im Türschloß herum, um Zeit zu gewinnen. Was sollte ich mit der verdammten Pistole anfangen? Ein Versteck gab es nicht. Und bevor mir noch etwas einfallen konnte, trommelte es an der Tür.
«Aufmachen! Aufmachen, sonst schießen wir!»
Wütend warf ich das Schießeisen aus dem Fenster. Der Hof lag im Schnee. Sagte dabei: «Du bist das größte Rindvieh. Zeig ihnen deinen Landtagsausweis. Vielleicht lassen sie dich laufen.» Und da krachte die Tür schon aus den Fugen. Die ins Büro stürzenden Polizisten waren verblüfft. Einer brüllte: «Raus mit euch!» Ich bekam einen Tritt ins Hinterteil und fiel den SA-Leuten vor die Stiefel. Mit weiteren Fußtritten wurde ich dann die Treppe hinunterbefördert.
In der ersten Etage standen schon die anderen mit erhobenen Händen. Das Gesicht zur Wand. Grete hatte Glück. Ein älterer Polizist betrachtete den Ausweis und sagte: «Die hat Immunität. Laßt sie gehen.» Und so konnte sie sich wirklich aus dem Staube machen. Ohne Behinderung, ohne Schläge. Um so reichlicher wurden wir damit bedacht. Als mein Nebenmann plötzlich «Scheiße» sagte, einfach so, weil es ihm in den Sinn kam, bekamen wir noch ein paar zusätzliche Fußtritte.
Ich war überzeugt, daß es aus sei mit uns. Der nächste Weg mußte in die Hartmannstraße führen, wo sich das Polizeigefängnis befand. Oder in die Strafanstalt auf den Kaßberg. Dort hatte ich schon vor neun Monaten fünf Wochen wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt verbracht.
Aber es kam anders. Die Polizei vernahm jeden einzeln. Nach Ausfertigung kurzer Protokolle jagten sie uns auf die Straße. «Laßt euch hier nie wieder blicken, ihr Kommunistenschweine», schrie einer der SA-Männer.
Alles in allem ging dieser Tag also noch glimpflich ab. Nur der «Kämpfer» wurde für alle Zeiten geschlossen.
Was nun? Auf dem Weg nach Hause überlegte ich, ob ich sofort ein illegales Quartier aufsuchen oder noch warten sollte.
Die Entscheidung wurde mir auf der Straße vor der elterlichen Wohnung abgenommen. Eine Schießerei war im Gange. «Stehenbleiben, oder wir schießen!» Dabei schossen sie schon wie verrückt. Die SA war gerade dabei, meinen Bruder Otto abzuholen. In der Hoffnung, noch flüchten zu können, hatte er sich davonmachen wollen. Was mißlingen mußte. Mit erhobenen Händen ergab er sich den auf ihn einschlagenden SA-Leuten.
Ich beobachtete mit anderen Passanten das Schauspiel. Dann kehrte ich um. In der Wohnung einer Freundin, die verständnisvolle Eltern hatte, wurde ich für die nächsten Tage aufgenommen.
Um die überall wachsam gewordenen Nachbarn nicht auf meinen Aufenthalt aufmerksam zu machen, wechselte ich häufig das Quartier. Und natürlich setzte ich die Herausgabe von Flugblättern, nächtliche Wandmalereien, heimliche Versammlungen und Treffs fort. Wenn ich von meinen Quartiergebern nichts zu essen bekam – weil sie selbst nichts hatten –, blieb ich tagelang ohne Nahrung. Wäre nicht die Freundin gewesen, die immer ein paar Brote mitbrachte, hätte ich verhungern können. Auf das Arbeitsamt konnte ich nicht mehr gehen, um die geringe Unterstützung abzuholen. Auf den Straßen mußte ich auf der Hut sein, um nicht erkannt zu werden. Angenehm war das Herumvagabundieren nicht. Daß es anderen ähnlich oder schlechter ging, war kein Trost. Auch der sich breitmachende Pessimismus unter den Freunden trug nicht dazu bei, die Stimmung zu verbessern. Zumal am politischen Horizont kein Silberstreifen erkennbar war. Es ging nur noch bergab. Ohne Hoffnung auf einen Ausweg. Es sei denn, sich der Polizei zu stellen, hinzunehmen, was jenen widerfuhr, die schon im Gefängnis oder Konzentrationslager waren. Aber genau das wollte ich freiwillig nicht tun.
Entsetzlich war die Meldung, Albert habe sich im Konzentrationslager Reichenbach erhängt. Noch in der Nacht vom 14. zum 15. April 1933 traf ich mich mit Kurt Sindermann, der seines Lebens sowenig sicher war wie Albert. Die Begegnung war niederschmetternd. Kurt war überzeugt, daß Albert ermordet worden war. Wir trennten uns mit der Vereinbarung, Flugblätter zu verbreiten, die den Mord an die Öffentlichkeit bringen sollten.
In der Nacht schrieb ich den Text für ein Flugblatt. Am nächsten Tag wurde es in der Wohnung einer älteren Genossin vervielfältigt. Ihre Tochter und andere beteiligten sich an der Verbreitung. Da es zu gefährlich war, die Flugblätter auf der Straße zu verteilen, wurden sie des Nachts an Wände geklebt oder in Briefkästen gesteckt. Der Erfolg war bemerkenswert.
In der zweiten Nacht nach dem Mord traf ich mich mit meinem Vater am Stadtrand von Chemnitz. Er war völlig demoralisiert. Nach seinen Worten ging es der Mutter noch schlimmer. Albert war der Sohn, auf den sie die größten Hoffnungen gesetzt hatten. Und jetzt war er tot. Ein größeres Unglück war nicht denkbar.
Bevor wir auseinandergingen, fragte mein Vater: «Was soll jetzt werden? Wir können Albert nicht sang- und klanglos verscharren. Außer uns traut sich niemand, an der Beerdigung teilzunehmen. Freidenker, die Grabreden halten, gibt es nicht mehr. Ich kann auch keine Rede halten. Mir würden die Worte im Halse steckenbleiben. Du bist der einzige von uns, der das könnte. Aber was wird passieren, wenn du am Grabe erscheinst? Es fällt mir schwer, dich darum zu bitten.»
«Ich werde ein paar Worte sagen. Komme, was wolle. Irgendwann passiert das Unvermeidliche sowieso. Tröste Mutter, so gut du kannst. Sag ihr, daß noch viele das Schicksal von Albert erleiden werden. Sag ihr auch, daß der Tag kommen wird, an dem die Mörder bezahlen werden. Und solange es möglich ist, werde ich alles dafür tun. Alles, das versprech ich dir, Vater.»
Die Beisetzung fand im Krematorium Reichenbach statt. Die Nacht zuvor verbrachten wir in der Wohnung von Alberts Frau in Plauen. Da außer den Ehebetten keine Schlafgelegenheiten vorhanden waren, schliefen wir auf dem Boden – soweit überhaupt von Schlaf die Rede sein konnte. Die Eltern teilten sich die Ehebetten mit der Schwiegertochter. Die Nacht war für alle miserabel. Am schlimmsten natürlich für die Eltern und die dreiundzwanzigjährige Witwe.
Sehr früh machte ich mich mit dem Vater auf den Weg nach Reichenbach. Wir wollten den erschlagenen Sohn und Bruder noch einmal sehen. Erfahren, was er hatte erleiden müssen. Der Friedhofsverwalter war ein alter Bekannter. Er würde uns schon hereinlassen. Da zu so früher Stunde noch niemand zu sehen war, ließ er uns die Leichenhalle betreten, meinte aber, daß wir uns beeilen müßten. Es sei damit zu rechnen, daß Polizei oder SS erscheinen würden.
«Danke, Hermann», sagte mein Vater. «Wir brauchen nur ein paar Minuten. Falls jemand kommt, sagst du, daß wir ohne Erlaubnis die Halle betreten haben.»
Der Frühling hatte schon Einzug gehalten. Außer unseren Schritten auf den Kieswegen war nur der Morgengesang der Vögel zu hören. Nachdem der Verwalter, ein alter Sozialdemokrat, die Tür zugezogen hatte, verharrten wir eine Minute am offenen Sarg. Dann nahm mein Vater den erstarrten Sohn, in dessen Antlitz die erkennbaren Verletzungen überpudert waren, in die Arme, zog das Leichenhemd zurück und legte ihn auf die Seite. Rund um den Hals waren Striemen erkennbar, die das Totenhemd verdeckt hatte. Das rückwärts offene, wie eine Schürze um den Körper gelegte Hemd fiel auseinander. Der Rücken war vom Nacken bis an die Oberschenkel zerschlagen, verkrustet, als hätte man die Haut abgezogen. Tiefe, eingebrannte Wunden. Ganze Stücke aus dem muskulösen Körper herausgerissen.
Die Hände meines Vaters wurden kraftlos. Tränen liefen über seine Wangen. Fast ohnmächtig hielt er den ermordeten Sohn in seinen Armen. Den Atem anhaltend, legte er ihn schließlich zurück und bettete ihn wieder sorgsam, so als fürchte er, dem Toten neue Schmerzen zuzufügen. Ich berührte ihn am Arm und flüsterte: «Laß uns gehen.»
Vor der Halle stand der Verwalter. Er wußte, in welchem Zustand der Tote eingeliefert worden war. Als er meinem Vater stumm die Hand drückte, weil er kein Wort hervorbringen konnte, sagte Vater: «Danke, Hermann. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe. Vielleicht heute. Und eins wissen wir jetzt endgültig. Wir haben es nicht mit politischen Gegnern zu tun. Nur mit Mördern.»
Der Alte nickte mit dem Kopf. Dann machte er eine Geste mit der Hand. Drei oder vier Schritte gingen wir gemeinsam. Bevor wir uns trennten, sagte er doch etwas. Es hörte sich wie eine Entschuldigung an: «Ich kann nichts dafür, daß sie mir solche Leichen einliefern.»
Der Vater erwiderte: «Das weiß ich. Ich bitte dich, laß den Sarg schließen. Meine Frau darf Albert nicht mehr sehen.»
Der Alte nickte und ging. Dann warteten wir schweigend vor dem Friedhof auf den Rest der Familie.
Es mag ein Zufall gewesen sein, vielleicht auch nicht. Als die Leichenträger den Sarg in die Halle trugen, zeigte sich noch immer niemand.
Dem Sarg folgten Mutter und Vater, die junge Frau des Toten, meine ältere Schwester, die ihre Schwägerin stützen mußte, weil sie nicht allein gehen konnte, meine zwei jüngeren Geschwister und ich.
Am Eingang zur Halle schlossen sich zwei Arbeiter an. Sie waren unbemerkt durch den hinteren Eingang gekommen. Wie sich herausstellte, waren es zwei Kampfgefährten von Albert, die es sich nicht nehmen lassen wollten, Abschied zu nehmen.
Nachdem der Sarg auf dem versenkbaren Podest abgesetzt, der vom Vater getragene Kranz mit roter Schleife niedergelegt worden war, nahm die kleine Gemeinde in der ersten Reihe Platz.
Von der Empore, im Rücken der Trauernden, schwang ein Satz aus der Johannespassion herab. Als die Orgel abbrach, erhob ich mich und trat ans Rednerpult. Nach einem Blick auf die in Tränen vor mir sitzenden Eltern und Geschwister erkannte ich – noch immer nach dem ersten Satz meiner Rede suchend – auf der Empore rosarote Gesichter unter schwarzen Schirmmützen. Wie lauernde Ratten schauten sie herab. Sie waren gekommen, um zu sehen, wie der von ihnen ermordete Arbeiterführer ohne Arbeiter auf seinem letzten Gang begleitet wurde.
Das Grinsen in ihren Gesichtern rief Übelkeit in meinem Magen hervor. Und Zorn in meinem Hirn. Eine Sekunde dachte ich daran, daß es kein Entkommen gäbe. Sie würden mich beim Verlassen der Halle verhaften. Dann faßte ich mich. Meine Stimme, herb und bitter, gewann Klang. Auf andere Art als die wundervolle Musik der Bachschen Passion, die in meinem Kopf mitschwang.
Meinen Eltern konnte ich keinen Trost zusprechen. Ich wollte es auch nicht. Die kurze Rede, einfach, schlicht vorgetragen, kann ich nicht mehr nachzeichnen. In Erinnerung ist nur geblieben, daß ich mit Mühe nach Worten suchte, die nicht mehr Tränen in den Augen der Mutter bewirkten. Zumal ich selbst die Tränen unterdrücken mußte. Aber das weiß ich noch genau: Ich endete mit dem Versprechen, daß der am meisten geliebte Sohn unvergessen bleiben und sein Tod die Hoffnung auf eine bessere Zeit nicht brechen werde. Daß der verlorene Sohn in Ewigkeit Mahnung für die Lebenden bliebe. Den Blick noch einmal nach oben gerichtet, den Rattengesichtern nicht mehr ausweichend, waren die letzten Worte: «Und nicht nur Mahnung, Albert. Das schwöre ich an deinem Sarg.»
Dann setzte die Orgel wieder ein. Als sich die Öffnung über dem niedergehenden Sarg schloß, wandte ich mich der Tür zu, die sich hinter dem Pult befand. Hermann hatte sie leise geöffnet und mit der Hand ein Zeichen gegeben. Es war also nicht Gott, sondern dem alten Verwalter zu danken, daß mir die Flucht noch einmal gelang.
Acht Tage später wurde meine Schwester Hilde ins Konzentrationslager Hohenstein eingeliefert. Wenige Tage danach holten sie meinen Vater. Wegen «Vorbereitung zum Hochverrat» wurde er auf Jahre ins Zuchthaus Bautzen geschickt. Auch der jüngere Bruder Hans, vierzehn Jahre alt, kam ins Polizeigefängnis Chemnitz. Er wurde mißhandelt, kahlgeschoren, blutig geschlagen, weil er nicht sagen konnte, wo sich sein Bruder Walter befände. Selbst wenn er es gewollt hätte, hätte er es nicht gekonnt. Niemand wußte, wo ich untergetaucht war.
Die Zeit ist um
Nach der Beisetzung in Reichenbach fuhr ich nach Prag, um mit den verantwortlichen Genossen über mein weiteres Wirken zu sprechen. Ohne Paß, weil ich keinen besaß. Aber ich kannte mich bei Oberwiesenthal gut aus. Schon vor 1933 war ich dort wiederholt über die Grenze gegangen.
Die verantwortlichen Genossen schickten mich nach Chemnitz zurück. Ich müsse, so meinten sie, meine Arbeit fortsetzen. Der Widerstand dürfe nicht unterbrochen werden. Dieser Meinung war ich auch. Zweifel hatte ich allerdings an ihrer Auffassung, daß es keinen Grund gäbe, in die Emigration zu gehen. Einer von ihnen, wegen seiner überdimensionalen Nase nur «Nasenhermann» genannt, tat sich besonders hervor. Er meinte: «Wo kommen wir hin, wenn alle in die Emigration gehen.» Für sich ließ er das nicht gelten. Er war gleich zu Anfang ins Exil gegangen und kehrte erst nach Deutschland zurück, als alles vorbei war.
Wie dem auch war, ich kehrte mit Ratschlägen dahin zurück, wo ich nicht lange warten mußte, bis mich die Gestapo verhaftete.
Am frühen Morgen holten sie mich aus meinem Quartier. Sehr zum Leidwesen der alten Dame, die mir Nachtlager und Essen ohne Bezahlung gewährte. Tapfer hielt sie sich an die Vereinbarung: Sie wisse nichts davon, daß der Untermieter von der Polizei gesucht werde. Sonst hätte sie ihn niemals aufgenommen. Auch ich sagte bei den Vernehmungen nicht die Wahrheit über die Verabredung mit der Frau. Sonst hätte sie trotz ihres Alters mit Verhaftung rechnen müssen.
Auf der Fahrt ins Polizeigefängnis, von zwei Polizisten in Zivil in die Mitte genommen, dachte ich darüber nach, wer mich verraten haben könnte. Daß es der Jugendfreund war, der mir das Zimmer vermittelt hatte, mochte ich nicht glauben. Und die alte Dame war viel zu anständig, um so etwas zu tun. Sonst aber gab es niemanden, der mein Versteck kannte.
Auf dem Hof in der Hartmannstraße stießen mich die Gestapoleute aus dem Auto. Ohne Umstände schubsten sie mich bis in das Zimmer des «Kriminalrates», der mich für die nächsten Tage in die Mangel nahm. Täglich von früh bis in die Abendstunden. Und zu seinem größten Ärger legte der «verdammte Kommunistenbengel» kein Geständnis ab. Bei der auf dem Schreibtisch liegenden Beweislast, so meinte jedenfalls der Herr Kriminalrat, sei das eine unverschämte Frechheit.
Es dauerte nicht lange, bis der erfahrene Kriminalist die Ruhe verlor, um den Schreibtisch herum kam, mir die Flugblätter um die Ohren schlug und mit voller Lautstärke schrie: «Ich habe Zeugen, die ausgesagt haben. Wir wissen, wer die Hetzschriften verfaßt und vervielfältigt hat. Dein Leugnen hilft nichts. Raus mit der Sprache. Wenn du nicht auspackst, übergebe ich dich der SA im Hansa-Haus. Dort bringen sie dich bestimmt zum Reden. Also, was ist?»