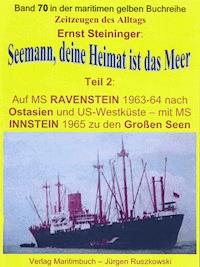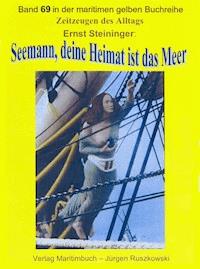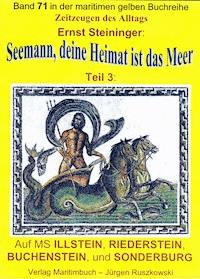
Seemann, deine Heimat ist das Meer - Teil 3 - Reisen auf ILLSTEIN, RIEDERSTEIN, BUCHENSTEIN, SONDERBURG E-Book
Ernst Steininger
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ernst Steininger, gebürtiger Österreicher, hatte von frühester Jugend an Fernweh zum Wasser und den Wunsch, zur See zu fahren. 1957 begann er in Bremen mit einem Lehrgang auf dem "SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND" seine Seemannslaufbahn und fuhr danach auf verschiedenen Schiffen und Fahrtgebieten an Deck. Auf einem seiner Schiffe, dem MS "VEGESACK", begegnete er auch dem durch die Veröffentlichung mehrerer Bücher vielen Seeleuten bekannten Maschinisten Hein Bruns, der ihn für seine weiteren Fahrzeiten wesentlich prägte. Ernst Steininger reflektiert in drei Bänden über das erste Jahrzehnt seiner Seefahrtzeit. Dieses Buch erlaubt nicht nur einen guten Einblick in das Leben auf See und in fremden Häfen, wie der Autor es erlebte. Er gibt auch Einblicke in die Geschichte der Seefahrt und die Entdeckungsreisen früherer Seefahrergenerationen. Rezension zur maritimen gelben Reihe: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit und vermitteln einem das Gefühl, mitten in den Besatzungen der Schiffe zu sein. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights der Seefahrts-Literatur. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechselungsreiche Themen aus verschiedenen Zeitepochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlich hat. Alle Achtung!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche, ein Hotel für Fahrensleute mit zeitweilig bis zu 140 Betten. In dieser Arbeit lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 kam mir der Gedanke, meine Erlebnisse bei der Begegnung mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen, dem ersten Band meiner maritimen gelben Reihe „Zeitzeugen des Alltags“: Seemannsschicksale.
Insgesamt brachte ich bisher über 3.800 Exemplare davon an maritim interessierte Leser und erhielt etliche Zuschriften als Reaktionen zu meinem Buch.
Reaktionen auf den ersten Band und die Nachfrage nach dem Buch ermutigten mich, in weiteren Bänden noch mehr Menschen vorzustellen, die einige Wochen, Jahre oder ihr ganzes Leben der Seefahrt verschrieben haben. Inzwischen erhielt ich unzählige positive Kommentare und Rezensionen, etwa: Ich bin immer wieder begeistert von der „Gelben Buchreihe“. Die Bände reißen einen einfach mit und vermitteln einem das Gefühl, mitten in den Besatzungen der Schiffe zu sein. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights der Seefahrts-Literatur. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechselungsreiche Themen aus verschiedenen Zeitepochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlich hat. Alle Achtung!
In den Bänden 69, 70 und 71können Sie wieder den Bericht eines ehemaligen Seemanns lesen. Da das Gesamtvolumen der Texte für ein Buch mit Leimbindung zu umfangreich war, wurde es zu einer Trilogie aufgeteilt. Ernst Steininger, gebürtiger Österreicher, hatte von frühester Jugend an Fernweh zum Wasser und den Wunsch, zur See zu fahren. 1957 begann er in Bremen mit einem Lehrgang auf dem „SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND“ seine Seemannslaufbahn und fuhr danach auf verschiedenen Schiffen und Fahrtgebieten an Deck. Auf einem seiner Schiffe, dem MS „VEGESACK“, begegnete er auch dem durch die Veröffentlichung mehrerer Bücher vielen Seeleuten bekannten Maschinisten HeinBruns, der ihn für seine weiteren Fahrzeiten wesentlich prägte. Ernst Steininger reflektiert in diesen drei Bänden über das erste Jahrzehnt seiner Seefahrtzeit. Diese Berichte erlauben nicht nur einen guten Einblick in das Leben auf See und in fremden Häfen, wie der Autor es erlebte. Ernst Steininger gibt auch recht ausgiebig und detailliert Informationen über die Geschichte der Seefahrt, der angelaufenen Häfen und Fahrtgebiete und die Entdeckungsreisen früherer Seefahrergenerationen.
Ohne bürgerlich-moralische Verklemmungen oder Tabus schildert Ernst Steininger sehr offen auch die Bewältigung der jugendlichen Libido der Seeleute.
In diesem Zusammenhang wurde ich bei der Lektüre des Manuskripts wieder einmal an den bekannten Theologieprofessor und langjährigen Prediger auf der Kanzel des Hamburger Michels, Helmut Thielicke, erinnert, der 1958 eine Seereise nach Japan auf einem Frachtschiff der Hapag unternahm und seine Erlebnisse an Bord in dem Buch „Vom Schiff aus gesehen“ zusammenfasste. Seine hautnahen Begegnungen auf dieser wochenlangen Reise mit Seeleuten brachten ihn zu dem Bekenntnis, dass ihm eine ganz neue, bisher unbekannte Welt erschlossen worden sei und er nun eigentlich sein kurz zuvor veröffentlichtes Ethikwerk umschreiben müsse: „Ich bemühte mich nach Kräften, offen zum Hören zu bleiben und – so schwer es mir fällt – selbst meine stabilsten Meinungen in diesem thematischen Umkreis als mögliche Vorurteile zu unterstellen, die vielleicht einer Korrektur bedürfen. Ich frage mich ernstlich, was an diesen meinen stabilen Meinungen christlich und was bürgerlich ist… Ich merke, wie schwer es ist, sich im Hinblick auf alles Doktrinäre zu entschlacken und einfach hinzuhören – immer nur hören zu können und alles zu einer Anfrage werden zu lassen... Bei meiner Bibellektüre achte ich darauf, wie nachsichtig Jesus Christus mit den Sünden der Sinne ist und wie hart und unerbittlich er den Geiz, den Hochmut und die Lieblosigkeit richtet. Bei seinen Christen ist das meist umgekehrt.“
Hamburg, 2013 /2015 Jürgen Ruszkowski
Da das Gesamtvolumen der Texte des Ernst Steininger für ein Buch mit Leimbindung zu umfangreich war, wurde es zu einer Trilogie aufgeteilt.
Der Band 69 beinhaltet den Bericht über die Kindheit und den Beginn der Seefahrtszeit des Autors auf SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND in Bremen, Küstenmotorschiff STADERSAND, Motorschiff LINZERTOR, Motorschiff VEGESACK, Turbinenschiff HUGO STINNES, Motorschiff HORNBALTIC, Motorschiff BREMER BOERSE, Turbinenschiff WERRASTEIN, Turbinenschiff MOSELSTEIN.
Im Band 70 lasen Sie über die Fahrzeiten des Autors auf Motorschiff RAVENSTEIN nach Fernost und US-Westküste und auf MS INNSTEIN zu den Großen Seen.
Hier nun die Fortsetzung.
Widmung – Der Autor
Dieses Buch ist dem Andenken meiner Mutter gewidmet
Der Autor Ernst Steininger heute
Der Autor Ernst Steininger heute
Der Autor Ernst Steininger heute
Motorschiff ILLSTEIN
13. Kapitel
Motorschiff ILLSTEIN
Auszug aus dem Seefahrtbuch Nr. 0266, Seite 34/35
Inhaber ist angemustert als Matrose auf MS „ILLSTEIN“
Reeder: Norddeutscher Lloyd
Unterscheidungssignal: DDSG
Br.- Raumgehalt: cbm 4952
Heimathafen: Bremen
Geführt von Kapitän Dietze
Reise: Große Fahrt
Zeit: unbestimmt
1. Einsatz:
Der Dienstantritt erfolgte 21.10.1965
Das Seemannsamt Bremen, den 05. Nov. 1965
Der Inhaber hat
In der Zeit vom 21.10.1965 bis zum 01.07.1966
8 Monate und 12 Tage als Matrose gedient
2. Einsatz:
Der Dienstantritt erfolgte 29.11.1966
Das Seemannsamt Bremen, den 01. Dez. 1966
Der Inhaber hat in der Zeit vom 29.11.1966 bis zum 27.02.1967
3 Monate und 7 Tage als Matrose gedient
Zusätzliche Daten
Entnommen: Seefahrt – Norddeutscher Lloyd – Naxos
MS ILLSTEIN, Bj. 1959; BRT.: 4952;
Zugehörigkeit: bis 1972; ab 1970 Hapag-Lloyd;
1972 verkauft nach Mogadischu. Neuer Name: „MINSHAN“;
1978 verkauft nach China. Neuer Name: „LONSHAN”;
1992 in Lloyds Register noch so verzeichnet.
MS SIEGSTEIN – Schwesterschiff der ILLSTEIN
Nach dem „Eunuchentrip“ – den INNSTEIN-Reisen zu den Großen Seen – sollte mich mein nächstes Schiff unbedingt wieder einmal an liebesfreundlichere Gestade bringen. Demzufolge absolvierte ich vorerst mehrere vierzehntägige Urlaubsvertretungen auf verschiedenen mir nicht genehmen Lloyd-Schiffen, bis mir endlich die ILLSTEIN fürbass kam. Die ILLSTEIN war einer jener kleineren Neubauten, mit denen der Lloyd die zentralamerikanischen Staaten einschließlich Mexiko und den Nordosten Brasiliens bediente. In der Regel konnte es sich ein einfacher Matrose nicht aussuchen, mit welchem Lloyddampfer er auf die Reise gehen würde, denn das bestimmte Herr Pauli, der norddeutsch kühle, unbestechliche Chef des lloydeigenen Heuerbüros. Dass es mir dennoch gelang, Schiffe mit ungeliebten Reisezielen wie die US-Ostküste, US-Golf, die Westküste-Nord oder gar Australien zu vermeiden – das hatte ganz bestimmt nicht mit dem typisch österreichischen „Schmäh“ zu tun – weil ich nun einmal absolut kein Schmähtandler bin, eher ein gerader „Michel“…
Urlaubsvertretung – das war für die, die zu vertreten waren, natürlich eine gute Sache. Meist waren es Fahrensleute, die es nicht allzu weit nach Hause hatten, also von der „Waterkant“ stammten. Aber auch für mich, der ich doch meist völlig abgebrannt aus meinem „verlängerten“ Urlaub an die Küste zurückkehrte, war es eine gute Einrichtung, denn sie brachte mich stets umgehend in Brot und Lohn. Andererseits war mir das Pendeln zwischen Antwerpen, Rotterdam, Bremen und Hamburg ein Graus. Die Hektik in diesen Häfen, die kurzen Seereisen, die langen Revierfahrten und die Animositäten innerhalb solcher „Fremdbesatzungen“ waren nicht dazu angetan, das Seemannsherz zu erfreuen. Außerdem war der Urlaubsvertreter schließlich nur Gast und hatte sich mit der ihm zugewiesenen Unterkunft einfach abzufinden. Das tat er natürlich auch, schließlich saß er sowieso, bildlich gesprochen, die ganze Vertreterzeit auf seinem Seesack. Das besonders Unangenehme aber war, dass man keinen eigentlichen privaten Rückzugsort zur Verfügung hatte, um seine „Batterie“ wieder aufzufüllen. So ist es halt auch nicht verwunderlich, dass so ein quasi „heimatloser“ Janmaat in den genannten Häfen seine karge Freizeit lieber an Land als an Bord verbrachte.
Bei einer solchen Gelegenheit lernte ich auch Hamburg etwas besser kennen. Hamburg!? Na, damit ist natürlich die Gegend um St Pauli gemeint, die „Große Freiheit“ und die sündige Meile der Stadt, die Reeperbahn. Nun ist es aber nicht so, dass diese Ecke Hamburgs für mich gestandenen Seemann Neuland gewesen wäre, nein, ganz bestimmt nicht. War ich doch bereits im Jahre 1956, als eben flügge gewordener Grünschnabel, per Autostopp bis nach Hamburg gelangt. Damals nahm mich ein Polizist, dessen Absichten ich da noch nicht ahnen konnte, unter seine Fittiche. Das kam so: Ich trieb mich in der Speicherstadt herum und beobachtete von einer Brücke aus – offensichtlich sehr interessiert – einen Helmtaucher und seine Gehilfen bei ihrer Arbeit. Der Polizist hingegen, ein Mann um die Vierzig, musste mich anscheinend schon eine Weile im Visier gehabt haben. Jedenfalls war ich nicht wenig überrascht, als ich plötzlich energisch angefasst und vom Geländer der Brücke weg gezerrt wurde. Der gute Mann war der absurden Meinung, dass ich mich in den Kanal stürzen wollte. Sicherlich, ich hatte gerade noch ganze zehn Mark in meiner Hosentasche, und die Jugendherberge, in der ich zu übernachten gedachte, hatte mich kurz vorher wegen Überbelegung abgewiesen. Aber mich deswegen ersäufen? Im Gegenteil: ich war guter Dinge, voller Zuversicht, in Aufbruchstimmung: Was kostet die Welt?!
Der Polizist aber, der mich nötigte, ihm mein Dasein zu erklären, war vorerst misstrauisch und ließ mich nicht einfach laufen, obwohl meine Papiere in Ordnung waren. Doch schleppte er mich auch nicht auf die nächstgelegene Wache, sondern bot mir freundlichst seine Begleitung an. Eigentlich, auch wenn er noch in Uniform sei, habe er bereits dienstfrei, und wenn ich nur möchte, würde er mir ein Stück Hamburg, sein Revier, zeigen. Ich war nicht abgeneigt, zumal er mir versicherte, dass er mir dann auch noch eine Schlafstelle besorgen wolle. Überdies versprach er, mir bei der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit nach Hause behilflich zu sein.
Also überließ ich mich vertrauensselig dem freundlichen Ordnungshüter und hatte es schließlich auch nicht zu bereuen. Der gute Mann lotste mich vorerst am Baumwall entlang, Richtung Landungsbrücken. Er zeigte mir den Einlass zum Elbtunnel, die U-Bahn-Haltestelle, das gewichtige Bismarck-Monument und schließlich und endlich auch noch die Reeperbahn. Er erklärte mir, dass die knapp einen Kilometer lange Straße ihren Namen von den Reepschlägern, den vormaligen Schiffstaudrehern, erhalten hatte. In früheren Tagen, lange bevor aus ihr die „Sündige Meile“ wurde, war die Reeperbahn nichts weiter als ein sich in die Länge ziehender, zugiger Arbeitsplatz. Genau betrachtet ist sie das ja auch noch heutzutage, Schiffstaue aber werden hier nicht mehr produziert. Allerdings – frei von Fallstricken ist die Reeperbahn bis heute nicht. Ich jedoch hatte nichts zu befürchten, darauf achtete schon mein Freund und Helfer, der Polizist. Kraft seiner Begleitung sah ich sogar das eine oder andere Animierlokal kurz von innen. Auch in die wie ein öffentliches Pissoir mit Sichtblenden abgesicherte Herbertstraße ließ er mich hineinlugen. Was ich da so erspähte, die halbnackten Damen, die prallen Schenkel, Pos und Brüste, vorm Anfassen nur geschützt durch eine Schaufensterscheibe, das bewegte meine Fantasie noch lange danach…
Mein Freund bediente nicht nur meine Neugierde. In einer der vielen Eintopf-Buden verpflegte er mich auch noch mit Erbsensuppe und Wiener Würstchen. Die Zeche bezahlte er nicht etwa mit Geld, sondern mit Marken, die er von einem handlichen Papierblock abtrennte. Das fand ich genial. Weniger angetan war ich aber dann von der Art und Weise, wie er mich anschnauzte, weil ich den Senf auf dem Papierteller beim Verzehr der Würstchen etwas unorthodox verteilte. Das gab mir zu denken. Überhaupt irritierte mich sein ganzes Verhalten nicht wenig. Mal gab er sich väterlich jovial, dann wieder herrisch und gereizt. Auch machte es mich stutzig, dass er mir die Davidswache, das wohl bekannteste Polizei-Revier der Welt – und von dem ich annahm, dass es seine Dienststelle sei – mit einer vagen Ausrede vorenthielt. Dennoch ging ich auf seinen Vorschlag ein, ihn nach Hause zu begleiten. Seine Wohnung läge in der Nähe des Bahnhofs Hamburg-Altona, da würde sich auch eine Schlafgelegenheit für mich finden. Allerdings, wie sich dann herausstellte, war die angepeilte Schlafstelle ein Bett in seiner Wohnung. Dies, so erklärte er mir, sei möglich, weil seine Lebensgefährtin gerade verreist sei.
Eigentlich ja ganz plausibel. Der Verdacht, dass mit dem Mann vielleicht doch nicht alles in Ordnung und er eventuell „andersherum“ sein könnte, kam mir erst, als er mich bei Kaffee und Kuchen mit erotischem Gelaber belöffelte. Dieser Versuch aber, mich auf Kommendes vorzubereiten, verpuffte bei mir völlig wirkungslos. Ich brauchte mich gar nicht dumm zu stellen, ich war es einfach. Zwar hatte ich sicher schon von Schwulen und Lesben gehört, aber das war für mich eine Welt, an der ich nicht das geringste Interesse hatte. Kerle wie Hans Albers, in jedem Arm eine „seute Deern“, waren die Vorbilder meiner pubertierenden Seele. Und dann dies: Ich als angehender Seemann, Aspirant eines Berufstandes, der für mich der Inbegriff aufrechten, kernigen Mannsvolks war, sollte mit einem Polizisten ins Bett gehen? Ha, deswegen war ich nicht aus der heimatlichen Enge ausgebrochen, um mich dann in der Fremde so einfach vernaschen zu lassen…
Schließlich wurde die Situation auch meinem Polizisten zu dumm. Jedenfalls begriff er, dass er in mir keinen willigen Lustknaben gefunden hatte. Und er war anständig genug, von mir abzulassen. Zu guter Letzt brachte er mich genau in der Jugendherberge unter, die mich an diesem Tag schon einmal abgewiesen hatte. Vorher noch zeigte er mir innerhalb eines Hafengeländes, in der Nähe des Fischmarktes einen Getreideumschlagplatz, der von Fernlastern aus ganz Deutschland belagert wurde. Ja, zum Abschied beschenkte er mich noch mit ein paar Essenmarken aus seinem praktischen Abreißblock. Es gelang mir am nächsten Tag auch tatsächlich, an dem von ihm bezeichneten Ort einen Fernlaster zu ergattern, der mich bis Passau brachte. Diesen Wohltaten ist es sicher zu verdanken, dass mir der gute Mann bis heute im Gedächtnis geblieben ist.
Soviel zu meinen Hamburg-Erlebnissen aus dem Jahre 1956.
Werftanlage Blom und Voss, Hamburg 1957
Zehn Jahre später hatte sich die Gegend zwischen der Reeperbahn und dem Johannisbollwerk wohl weniger verändert als ich mich selbst. Der Blick des „Eisernen Kanzlers“, der imposanten Bismarckstatue unweit der Landungsbrücken, konnte noch immer ungehindert die andere Seite der Norderelbe kontrollieren. Da mochte sich sein „teutsches“ Gemüt an der beeindruckenden Kabelkrananlage der Stülcken-Werft erfreuen. Da sollten die wie ein deutsches Wahrzeichen in den blauen „Wirtschaftswunderhimmel“ aufragenden Kräne von Blom + Voss, einer der großen Rüstungsschmieden des Reiches, sein „eisernes“ Herz erquicken. Auferstanden aus Ruinen – oder sollte man besser sagen: Auferstanden kraft blutbesudelten Runen-Kapitals...
Hamburg 1960er Jahre
Der Bismarck, St. Michaelis, das „Graue Haus am Meer“ (gemeint ist das für den Seefahrer so unangenehm weithin sichtbare Hafenkrankenhaus), der Kuppelbau über dem Fracht-Lift des Elbtunnels standen also wie eh und je unverändert an ihren angestammten Plätzen.
Ich hingegen hatte mich verändert. Meine Unschuld war perdu! Was nicht heißen soll, dass ich inzwischen schwul geworden wäre, das nicht. Aber ansonsten genoss ich, sofern ich es mir leisten konnte, die sexuelle Freizügigkeit der Hafenstädte schon. Nicht, dass ich für andere Dinge überhaupt kein Interesse mehr gehabt hätte. Aber wie das so ist in einer reinen Männergemeinschaft, der Gruppenzwang und die daraus resultierende Dynamik bestimmten letztlich meistens, wo es lang ging. Oft zog es uns – selbstverständlich nur im „feinen Zwirn“, der damals noch durchaus zur Ausrüstung eines selbstbewussten Matrosen gehörte – ins vornehme Reeperbahn-Tanzlokal „Cafe Keese“. Dieses Etablissement war bekannt für seinen „Ball der einsamen Herzen“. Sozusagen ein heißer Tipp. Die Chancen, im „Keese“ ein einsames lusthungriges Frauenherz zu erobern, waren durchaus reell. Trotzdem gelang es einem der Unsrigen aber nur sehr selten von einer der meist nicht mehr ganz taufrischen Damen abgeschleppt zu werden. Weshalb? Na, Seeleute haben es halt nicht nötig, langatmig zu parlieren. Hinzu kommt noch der schnelle Griff zum Glas. Ein kleines Übermaß an Bier mit Sekt und dann womöglich auch noch Wein ließen die selbsternannten Lords den ursprünglichen Grund ihres Kommens schnell vergessen. Vergessen? Na, eher war es wohl so, dass uns die Damen mehr oder weniger deutlich machten, wir sollten sie vergessen. Besonders Vergessliche unter uns, die oft nicht mehr wussten, wo sie waren, wurden dann wenig sanft von routinierten Rausschmeißern daran erinnert…
So endete der Ausflug ins „Café Keese“ nicht selten in einem ungeordneten, individuellen Rückzug. Der war dann auch vielfach so verschlungen wie die Gangart des jeweiligen Individuums. Den einen zog es in den eher biederen „Silbersack“, den anderen vielleicht in die hinterfotzige „Ritze“. Der Rest versackte ganz schlicht in einer der unzähligen Kaschemmen auf der Großen Freiheit. Für diejenigen, die es noch schafften, war dann die „Washington-Bar“ der Abschluss oder – je nachdem – der Höhepunkt des Landgangs. Diese Bar war so etwas wie die externe Heimat aller gestandenen Lloyd-Fahrer. Hier hausten sie, all die erfahrenen Dirnen, die genau wussten, was ein Seemannsherz im desolaten Zustand am meisten benötigt…
Und das ist nicht nur Sex. Eine in Ehren erblondete Beischläferin könnte doch glatt nach all dem seelischen Ballast, den die „Jungens“ auf ihren mütterlichen Busen abgeladen hatten, ihr Examen als Psycho-Expertin machen. Hanna, die mit dem Holzbein, hatte sich zwar nicht direkt als Psychologin, dafür aber wegen ihres schlagfertigen Mund- und Beinwerks einen Namen gemacht. Sie und ihr Holzbein – das sie notfalls wie einen Baseball-Schläger zu handhaben wusste – waren in Seefahrerkreisen so bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. So mancher Lümmel, der sich nicht zu benehmen wusste, wusste hinterher ein Lied über Hannas Bein „welch Pein, welch Pein“, zu singen…
In diesem trauten „Milljö“ machte ich Hans Ballermanns; (Name geändert), Bekanntschaft. Hans war einer der hässlichsten Kerle, die mir je über den Weg gelaufen waren. Nichts, aber auch gar nichts passte in seiner für sein Gegenüber geradezu beleidigenden Visage zusammen. Besonders abstoßend waren seine oberen Schneidezähne, die sich wie bei einem Biber gelb und mächtig unter der bockwurstförmigen Oberlippe hervor schoben. Darüber steckte eine verknorpelte Nase im breitflächigen Gesicht. Die untere Kieferpartie gemahnte an die Funktion eines Nussknackers, was ihm dann später, an Bord der ILLSTEIN, auch folgerichtig den Spitznamen „Nussknackerface“ einbrachte. Vermutlich war ihm dieser Rufname sogar angenehmer als sein Familienname. Seine flachsfarbenen Haare standen wirr und stachelig in alle Himmelsrichtungen. Kurz gesagt, er hatte die Physiognomie einer Vogelscheuche, ein Alptraum – wenn da, ja wenn da nicht die großen, weit auseinander stehenden, samtbraunen, so wundersam sanft blickenden Augen gewesen wären. Dieser sanfte, warme Blick und die Art seines Sprechens, eine fast singende, sich unmerklich einschmeichelnde Redeweise versöhnten mich immer wieder schnell mit seinem fürs erste so erschreckenden Anblick. Die Gestik, mit der er seine Rede unterstrich, war wohl eindringlich, dabei aber völlig unaufgeregt. Seine Sprache war das akkurateste Hochdeutsch, das ich unter uns gemeinem Volk je vernommen habe. Niemals geschah es, dass sich aus seinem Mund ein unbedachtes, ein zu lautes oder gar unfeines Wort löste. Hans, der Penner, der er war, hatte die Seele eines Heiligen, selbst wenn er sturzbesoffen war, wurde er in keiner Weise ausfällig…
Na, möglicherweise übertreibe ich jetzt ein bisschen. Dass er aber der friedfertigste Mensch war, der mir bislang in meinem schon ziemlich langen Leben begegnet ist, davon nehme ich kein Jota! Wie und warum Hans, der Sohn eines höheren Landesbeamten, zum Penner wurde, darüber ließ es sich trefflich spekulieren. Ich meine halt, dass es sein entstelltes Gesicht war, welches ihn zum Außenseiter stempelte. Derselbe Grund war aber vielleicht auch die Ursache seiner gepflegten Umgangsmanieren. Allein dadurch gelang es ihm, sein abstoßendes Erscheinungsbild erheblich abzumildern.
Hans kannte den Kiez wie seine Westentasche. Das mit der Weste ist natürlich nur bildlich zu verstehen, seine Bekleidung entsprach eher der eines Lumpensammlers. Sein Revier, auf das er mich neugierig gemacht hatte, lag rund um St. Michaelis. In dieser abseits der Reeperbahn gelegenen Ecke gelangte ich dank seiner Begleitung in Spelunken, die ich in Deutschland nicht, nicht einmal in Hamburg, für möglich gehalten hätte. Dunkel erinnere ich mich an spärlich beleuchtete Kellergewölbe, an schemenhafte Gestalten, die sich dicht an dicht stehend oder hockend an einem anscheinend endlosen Tresen festhielten. Anderes, genauso wenig Vertrauen einflößendes Volk belagerte die mit Gläsern und Flaschen voll beladenen Stehtische am Rande des Gewölbes. In den wenigen Sitzgelegenheiten hingen schwer gezeichnete Zecher – wie angeschlagene Boxer in den Seilen. Einige zur Gänze abgestürzte Alkoholleichen krümmten sich auf dem vorsorglich mit Sägespänen bestreuten Stein- oder Ziegelboden…
Instinktiv versuchte ich zu kneifen. Das war mir nun doch eine Nummer zu surreal. Ich sah mich in einen Film zurück versetzt, in dem sich biedere Bürger nach Einbruch der Dunkelheit in Ratten verwandelten, allerdings, ohne dabei ihre menschliche Gestalt einzubüßen. Und, im Gegenteil zu Ballermanns Kellerratten, waren es sehr elegant gekleidete Männlein und Weiblein. Das Anstößige daran war, dass den blütenweißen Stehkragen der schwarzbefrackten Herren menschlich aussehende Rattenköpfe aufgesetzt waren. Ebensolche, jedoch weitaus putzigere Köpfchen, zierten die mit glitzernden, gleißenden Colliers behängten, aber sonst nackten Hälse der Damen. Überhaupt zeigten die Damen – außer anschmiegsamen Fuchs- und Marderpelzen – sehr viel glatte Haut. Auch kamen sie mit dem obligaten Rattenschwanz, den sie vorwiegend wie eine Stola um die blanke Schulter trugen, viel besser zurecht als ihre männlichen Partner…
Ratte, ratte, rette sich wer kann – mein lieber Mann, das ist leichter gesagt als getan!Eine, nein, keine Ratte – eine mausgraue Alte, schwere, trübe Hornbrille auf der ausgetrockneten, verknautschten Nase, hält mir kommentarlos die Bild-Zeitung unter meine lange, feuchte Nase: „Vorlesen!“ Ich lese vor, lese und trinke und versinke, versinke unaufhaltsam in Hans Buhmanns Welt…
Zu Hansens Ehre sei gesagt, er war kein Bettler. Vollmatrose, der er war, verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Gelegenheitsarbeiter im Hafen oder wenn es sich ergab, eben als Urlaubsvertreter auf Hapag- und Lloydschiffen. Er kannte sich und seine Unzuverlässigkeit und mied daher „feste Anstellungen“. Die Vorstellung, eine längere „Durststrecke“, also eine mehrmonatige Seereise auf sich zu nehmen, entsprach nicht seiner Lebensphilosophie. Trotzdem ergab es sich, dass wir zusammen – für „fest“ – auf der ILLSTEIN anheuerten.
Ende Oktober 1965, Auslaufen Hamburg. An dieser Stelle würde ich gern meine ureigensten Originalberichte, die ich gelegentlich so zwischendurch verfasste, mit einfließen lassen. Soll ich? All right – ich wage es…
Zwei Uhr morgens, Auslaufen Hamburg. Die Janmaaten stehen schon klar bei „Leinen los!“ Der letzte Schauermann jumpt noch eben über die Verschanzung. Die Gangway haben wir dem etwas zu säumigen Agentenlehrling bereits unter den Füßen weggezogen. Die Schlepptrossen straffen sich; ab geht die Post. Wer über die Abschiedsgepflogenheiten in der ordinären Frachtschifffahrt im Unklaren sein sollte, dem sei kurz gesagt: Es gibt keine. Kein Ehrensalut, keine Deutschmeisterkapelle oder vielleicht gar einen Shanty-Chor, auch keine Kusshändchen hauchenden Dockschwalben. Selbst die höchst anständigen Ehegattinnen, die des Kapitäns, der Offiziere und Ingenieure, des Funkers und des Chefstewards, haben ihre Männer schon vor Stunden verlassen. Wer lässt sich schon gerne um zwei Uhr morgens an die kühle Nachtluft setzen.
Langsam zieht der Vorderschlepper das Schiff durch den Kaiser-Wilhelm-Hafen. Vorbei an der langen Reihe der Lagerschuppen: Schuppen Nr. 74, Nr. 73, Nr. 72, Nr. 71; hier liegen sie, die Lloyd- und HAPAG-Liner, Bug an Heck, aufgereiht wie die Perlen an einer Gebetsschnur. Mich fröstelt es, meine Laune ist am Tiefpunkt. Die Vorstellung, dass allmächtige Konzernherren die Schiffe samt Fracht und Menschen wie die Perlen einer Gebetsschnur durch ihre gepflegten Hände gleiten lassen, macht mich auch nicht fröhlicher. Im grellen Licht zahlloser Hochkerzen rotieren auf engstem Radius unentwegt schlanke Kräne neuester Bauart. Sie erinnern mich an Geier, deren Schnäbel Hiev um Hiev in den geöffneten Bäuchen der Frachter verschwinden, um ihnen entweder ihre fremdartigen Schätze zu entreißen oder sie mit profanen Kisten, sperrigen Konstruktionen oder Fahrzeugen vollzustopfen.
An Backbord gleißt, zu einem sprühenden Lichtbündel verschmolzen, die bläuliche Flammenglut vieler Schweißaggregate. Pausenloses Gedröhne, Geratter, Gezische: Die Werft – für jeden rechtschaffenen Seemann ein Ort der Verwünschung. Wehe dem Schiff, das notgedrungen in die Hände der Werftarbeiter fällt. Da bleibt kein Auge trocken. Alles, was dem Seemann heilig ist, ist diesen Barbaren völlig wurscht. Überall dort, und nicht nur dort, wo sie zu tun haben, hinterlassen sie „verbrannte Erde“. Die Motormänner stehen tränenden Auges vor ihren einstmals blitzblanken Handrädern und Ventilen, die Reiniger sehen fassungslos auf ihre verölten, verdreckten Flurplatten… Wir Decksbauern schaufeln uns durch Unmengen von Schlacke, abgeblätterten Rost, verkohlte Farbe, durch Berge von Elektroden- und Verpackungsresten… Das Küchenpersonal vermisst den Schlüssel für die Provianträume, dem Steward sind Teller und Tassen abhanden gekommen, und dem Messeboy fehlen Kehrblech, Handfeger und die letzten Rollen Toilettenpapier. Dreck, Lärm, Rauch und Gestank dringen durch alle Ritzen. Eine Werftzeit kann man eigentlich nur im Suff aussitzen. Und wenn die Werft, wie in diesem Fall, Howaldt heißt, dann ist man im „Levermann“, der nächstgelegenen Kneipe, bestens aufgehoben.
Wir, die Achtergang, stehen noch immer wegen des Einholens der Schlepptrosse klar. Im Moment ist sie gespannt wie eine Gitarrenseite, der Schlepper zieht das Heck, natürlich samt Schiff, um das an Steuerbord liegende Kaiser-Wilhelm-Höft herum. „Achterschlepper los!“ schallt es plötzlich aus dem Lautsprecher der Wechselsprechanlage. Im selben Augenblick klatscht auch schon die vom Schlepperkapitän per Slip-Haken gelöste Leine ins Wasser. Mit geübten Griffen werfen wir sofort das in Achterschlingen um einen Doppelpoller liegende schwere Drahtseil los, nachdem wir es mit ein paar Törns ums Spill vor dem Ausrauschen gesichert haben.
Kaum ist die Schleppleine im Wasser, will der Alte – von Statur ein kleiner Mann, dafür aber ein ganz großes Nervenbündel – auch schon wissen: „Ist die Schraube klar?“ – „Nein, Schraube ist noch nicht klar!“ antwortet der Zweite dem Lautsprecher. „Ist die Schraube klar?“ – „Nein, Schraube ist noch nicht klar!“ brüllt der Zweite gereizt in den Lautsprecher hinein. Aber aus diesem schallt es unentwegt, zuerst forsch fordernd, dann zunehmend anklagend und schließlich geradezu winselnd zurück: „Schraube klar, Schraube klar, ist die Schraube klar…“
Inzwischen ziehen wir – in „Gänsemarschaufstellung“, Hand über Hand – das nasse, dreckverschmierte, frisch gelabsalbte Stahlseilende mit Muskelkraft durch den Hafengrund an Deck. So eine Schlepperleine kann ganz schön lang und ganz schön schwer sein; dementsprechend kann es schon einige Minuten länger dauern, bis endlich das Auge unterm Schiffsarsch sichtbar wird.
„Ist die Schraube klar, Schraube klar?“ Das unentwegte Gequake und Gewinsel des Alten raubt dem Zweiten seine sonst mit so viel Nachdruck zur Schau gestellte Gelassenheit. Seiner tadellosen Uniform und seiner feinen Lederhandschuhe nicht achtend, reißt er wie ein wild gewordener Matrose nun ebenfalls an der nicht endenden wollenden Stahltrosse. Zwar könnten wir zum Einholen der Leine auch das eigens dafür gedachte Spill verwenden. Aber unser Bootsmann, ein von der Hunte stammender, schollenflüchtiger Kleinbauer, hat wohl eine angeborene Aversion gegen technische Geräte. Also nutzt er jede Gelegenheit, dem „nümodschen Kram“ eins auszuwischen. Und weil ihm die Übersetzung des Verholspills zu langsam ist, heißt es dann: Nix wie ran, und mit „man tau“ und „noch een“ wird wieder einmal mehr „aleman winscha“ geübt…
Endlich klatscht das mit Mudd behängte Auge an Deck. Der Zweite macht einen Satz in Richtung Lautsprecher, schreit lauthals die befreiende Meldung: „Schleppleine ein, Schraube klar!“ in den Trichter. Aus dem ist noch kurz ein letztes Schniefen des Alten und dann die Stimme des Ersten zu vernehmen: „Genug achtern!“ Damit wären wir eigentlich entlassen, aber wie ich unseren Bootsmann einschätze…
Vielleicht sollte ich noch kurz erklären, warum das möglichst schnelle Einholen der achteren Schleppleine von so großer Wichtigkeit ist. Ohne Umdrehungen der Schraube ist das Schiff praktisch manövrierunfähig. Erst der durch die Umdrehungen erzeugte Druck auf das Ruderblatt macht dieses als Steuerelement wirksam. Aber solange sich besagte Stahltrosse in diesem sensiblen Bereich befindet, ist an eine Benutzung des Eigenantriebs nicht zu denken. Zu groß ist die Gefahr, Ruder wie Schraube, die Achillesferse eines Schiffes, zu beschädigen. Von daher ist die Nervosität so mancher Kapitäne während dieser bangen Momente schon verständlich, weil im stark frequentierten Fahrwasser, im versetzenden Strom und womöglich noch bei schlechter Sicht das Schiff quasi gelähmt ist. Weniger verständlich aber bleibt die sinnlose Antreiberei. Aber unser kleiner Kapitän, dessen unüberhörbares „Sächseln“ hinter seinem Rücken immer wieder zur allgemeinen Heiterkeit beiträgt, hat halt nicht mehr die besten Nerven.
Der Bootsmann entlässt uns natürlich noch nicht – wie richtig ich ihn doch eingeschätzt habe! Erst wenn die Leinen „weggeschossen“ sind, dürften wir die Station verlassen. Purer Unsinn! Die Leinen seefest zu verstauen, hätte bei der langen Revierfahrt die Elbe hinunter auch noch bis morgen Zeit. Aber unser Bäuerlein will halt wieder einmal glänzen. „Gut so“, sagt der Zweite und verzieht sich auf die Brücke, um dem Alten sein Sprüchlein aufzusagen: „Achtern alles klar, Herr Kapitän. Der Bootsmann schießt noch eben die Leinen auf.“ Noch eben! Noch eben mal dies, noch eben mal das – dieser biedere Ausdruck noch biederer Bootsmänner hat selbst schon die friedfertigsten Janmaaten zur Weißglut gebracht. Bedeutet er im Klartext doch nichts anderes, als dass eine aufschiebbare Arbeit unnötiger Weise sofort zu erledigen ist, während eine unumgängliche Schwerarbeit gern zur Nebensache verniedlicht wird.
Inzwischen ist es halb vier geworden. Dem Urteilsvermögen des Ersten, na, wahrscheinlich eher dessen Laune, habe ich es zu verdanken, dass ich wieder einmal mehr Vier-Acht-Wächter bin. Während sich meine Kollegen in ihr Logis verdrücken, um bis zum Arbeitsbeginn noch schnell eine Mütze voll Schlaf zu nehmen, versuche ich noch schnell meine Unterarme mit einer Handvoll Twist von der eklig klebenden, übel riechenden Labsalbe zu befreien. Die Labsalbe, was für ein hübsches Wort, ist ein im „Eigenbau“ vom Bootsmann oder von dessen rechter Hand, dem Kabelgatts-Ede, nach uralten Segelschiffs-Rezepten hergestelltes Drahtseil-Konservierungsmittel. Und je nach Dummheit oder Gehässigkeit dieser „Experten“ ist halt dann die Schmiere auch mit mehr oder weniger Tran und Braunteer vermischt.
Wir passieren Toller Ort. Der Vorderschlepper wird entlassen, der Hafenlotse geht von Bord, die Maschine beginnt zu wummern, das Schiff nimmt Fahrt auf. Während ich mich über die Außentreppen auf den Weg nach oben mache, schweift mein Blick noch einmal kurz zurück. Ein Blick zurück, im Zorn? St. Pauli, der Michel, die Landungsbrücken: Im diffusen Lichte der Stadtbeleuchtung, der aufdringlichen Reklamelichter, erscheint mir auf einmal alles irgendwie abgestanden, säuerlich… Hamburg: Tor zur Welt, Stadt der mächtigen Reeder, Stadt der Wirtschafts- und sonstiger Kapitäne, Stadt der Nutten und Lottls, Verteilungslager bajuwarischer, österreichischer, spanischer, türkischer Seefahrer. Hamburg, du alte … – ach scheiß drauf, Scheiß Hamburg…
Leidlich gesäubert melde ich mich auf der Brücke, um sogleich den Rudergänger abzulösen.Mit der üblichen Redewendung „Ich geh dann mal eben nach unten“ – was soviel heißt wie: Ich tauche bis zum Lotsenwechsel in Brunsbüttelkoog erst einmal ab – macht sich der Alte davon. Der an Bord gebliebene Revierlotse ist sichtlich erleichtert, die „Tratschtante“ los zu sein. Er kann sich nun völlig auf seine Arbeit konzentrieren. Sachlich, im ruhigen Ton, gibt er seine Anweisungen an den Rudergänger und an den am Maschinentelegrafen stehenden Offizier. Sie sind schon eine Klasse für sich, diese Revierlotsen. Immerzu mit heiklen Situationen konfrontiert, wirken die meisten von ihnen doch ruhig und gelassen. Ob auf der Elbe, der Weser oder der Schelde, ob auf der Themse, der Seine oder dem Mississippi – ganz egal, auf welchen Revieren auch immer – ihr Beruf verlangt ihnen diese spezifischen Eigenschaften einfach ab: Übersicht, Durchsetzungsvermögen, Entschlossenheit und nicht zuletzt Gelassenheit. Dennoch kann auch der beste Lotse dem Kapitän die Verantwortung nicht abnehmen. Und deshalb wird unser hochgradig nervöser Käpt`n Dietze beim leisesten Furz der Maschine oder nach einer nur etwas zu heftig durchgeführten Kursänderung sofort wieder, wie weiland Rumpelstilzchen, auf der Brücke herumspringen.
Das mache ich jetzt auch. Ich springe zurück in die Gegenwart, um mich aber sogleich wieder von den Erinnerungen an Kapitän Dietze, Hans Ballermann, Rosaria und Paule gefangen nehmen zu lassen. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte: Das Reiseziel war die Westküste Zentralamerikas. Die Überfahrt bis zum Panama-Kanal verlief für die Jahreszeit – Oktober / November – ganz normal. Das heißt, bis weit über die Azoren hinaus hatten wir das übliche nordatlantische Schweinewetter.
nordatlantische Schweinewetter
Ein Foto, das ich von der Nock aus „geschossen“ habe; lässt erahnen, mit welcher Wucht und Gewalt die See auf ein Schiff einschlagen kann. Offensichtlich konnte ich mich im letzten Moment noch in die Brücke hinein retten, weil es sonst zumindest dieses Foto nicht gäbe. Bei längerem Betrachten des Bildes bekomme ich nachträglich noch weiche Knie! Dass das Schiff diesen „Kaventsmann“ überstand, das war wohl mehr Glück als Seemanns-Verstand…
Zu Hans Ballermann (Name geändert), von dessen Anwesenheit ich mir geistige Anregung versprach, hatte ich während der ganzen Reise kaum Kontakt. Gerade, dass wir uns bei der Wachablöse – er war Null-Vier-Wächter – begegneten. Das änderte sich auch dann nicht, als das Wetter besser wurde und das Arbeiten an Deck wieder zuließ. Denn nun ging es ums Geldverdienen, sprich: Überstundenkloppen! Und das nicht nur im übertragenen Sinn. Herr Schwertfisch, (Name geändert), erster Offizier und ein Mann mit der Statur eines Hufschmiedes, war der damals noch durchaus gängigen Meinung, dass die Masten und Schotten der ILLSTEIN von ihrem dicken Farbanstrich befreit werden sollten. Teure Farbe, oft genug überflüssigerweise, dafür aber Reise für Reise, also wenigstens vierteljährlich, übers ganze Schiff verteilte, fachmännisch verarbeitete Farbe sollte also partiell entfernt – und dann wieder neu aufgetragen werden. Immerhin gelang es auf diese Weise, das stetige Anwachsen der „Farbenringe“ zu unterbrechen. Nach meinem Verständnis schlicht ein Schildbürgerstreich, den ich aber schlecht unserem sächsischen Kapitän anlasten konnte. Diese Art der Ressourcenverschleuderung war in der „Nachkriegs-Blütezeit“ der deutschen Seefahrt allgemein üblich. Beim Lloyd wurzelte es sozusagen im System: Kein Kapitän, kein Erster konnte es sich leisten, mit einem ungepflegten Schiff in das Visier eines Lloyd-Inspektors zu geraten. Schließlich hing von dem sein Weiterkommen ab. Aber selbst wenn sie sich das nur eingebildet haben sollten, es lag nun einmal in der Natur der Sache, dass der eine Kapitänsanwärter dem anderen vorgezogen werden wollte. Und so waren unisono alle ersten Offiziere bemüht, dass ihr jeweiliges Schiff bei der Ankunft in Bremen wie ein frisch gewienertes Osterei glänzte.
Schwertfisch war nicht mehr der Jüngste. Möglicherweise war er bei der einen oder anderen Beförderungswelle schon mal übersehen worden. Wie dem auch sei und was auch immer der wahre Grund dafür sein mochte: Er ließ „Farbe kloppen“. Das bedeutete, dass fast die gesamte Deckscrew, mit handlichen Kugelhämmern ausgestattet, von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends auf die ausgesuchten Objekte losgelassen wurde. Das waren in der Regel zumeist der Schornstein, die Masten, Lüfter etc. Um die Farbe abplatzen zu lassen, bedurfte es schon ziemlich kräftiger Schläge, die mitunter etwas zu kräftig ausfielen – z. B. auf die nicht ganz so dickwandigen Schutzbleche der Lüfterköpfe. Das wiederum war nicht in des Schwertfisches Sinne und zog für denjenigen, der so seine Unwilligkeit am wehrlosen Metall demonstrierte, eine kurze Aussprache mit dem Ersten nach sich. Die fand dann an einer nicht einsehbaren Stelle des Kapitänsdecks statt. Obwohl sich die Delinquenten nur sehr vage über die Art der Aussprache ausließen, wurde es doch ruchbar: Der Mann wurde handgreiflich. Eigenartigerweise schadete das dem Ansehen des an sich wortkargen Mannes nicht, im Gegenteil! Auch Hans Ballermann, der wiederholt zu einer dieser wortkargen Aussprachen zitiert wurde – allerdings nicht wegen mutwilliger Sachbeschädigung – beschwerte sich hinterher nicht nur nicht, sonder meinte nur lapidar, dass diese Art der Aussprache allemal besser sei als eine Tagebucheintragung…
Na, und so vergingen die Tage bis zur Panamakanal-Passage in kurzweiliger Eintönigkeit. Halb vier: „Reise, reise, raus aus der Scheiße“, Seewache bis acht Uhr. Halb neun: Werkzeugsausgabe durch den Kabelgatts-Ede und hurtig, mit neu gestieltem Kugelhammer, frisch geschliffenem Winkelroststecher und verknautschter Plastik-Schutzbrille, hinauf auf den mir zugeteilten Pfahlmast. Nach der einstündigen Mittagspause, in der die Mahlzeit möglichst schnell hinuntergewürgt wird, damit noch Zeit für ein Nickerchen im Freien bleibt, wiederholt sich dieselbe Prozedur bis zum „Koffiteim“. Nach der Kaffeepause (15:00 h bis 15:20 h) vertausche ich erst einmal den Hammer gegen Pinsel und Rostschutzfarbe, um den allgegenwärtigen, lüstern lauernden Rostbazillen mit bleihaltiger Mennige den Appetit zu verderben. Für diese wichtige Arbeit bleibt mir bis 17:30 h Zeit. Dann aber ist es schon wieder höchste Zeit, notdürftig gesäubert das Abendbrot hinunter zu schlingen und pünktlich um 18:00 h auf der Brücke zum Wachtörn zu sein. Zwanzig Uhr: Endlich Feierabend! Summa summarum war dann unsereins, abgesehen von dem kurzen Mittagsnickerchen, sechzehn Stunden auf den Beinen. Bei einem achtstündigen Arbeitstag ergab das dann aber keineswegs auch acht Überstunden. Oh nein, nach Abzug der Essenspausen waren es – nach Adam Ries und dem Manteltarif – nur noch deren sechs hart erworbene Überstunden. Aber immerhin, die Vier/Acht-Wächter scheffelten so – im Vergleich zu den anderen Wachen – die meisten Überstunden. Na und? Was heißt da, na und! Schließlich waren es die Überstunden, die den Kohl, sprich: die im Grunde jämmerliche Heuer, etwas fetter machten. So viel nur zum Farbe- und Überstundenkloppen…
Themenwechsel: Die Westküste Zentralamerikas erstreckt sich vom Golf von Darién (Panama) bis zum Isthmus von Tehuantepec (Mexiko). Insgesamt drei ILLSTEIN-Reisen führten mich an diesen Küstenabschnitt. Und sicherlich haben wir auch alle wichtigen Häfen der anliegenden Bananenstaaten der Reihe nach angelaufen. Leider will es mir in diesem Fall nicht mehr so recht gelingen, die sich daran knüpfenden Erinnerungen auf die Reihe zu kriegen.
An der Pazifikküste Panamas hatten wir anscheinend gar nichts verloren, oder aber es gab dort nichts zu holen. Jedenfalls ist mir da nicht ein einziger prägnanter Hafenname in Erinnerung geblieben. Auch der zur Hilfe genommene Atlas bringt mich da nicht weiter. Oder doch? Bei dem Wort Golfito, einem Hafen im Golfo Dulce – mein Gott, gleich schmelze ich hin! – blitzt in meinem Langzeitgedächtnis ein schwacher Funke auf; mehr aber nicht, leider…
Golfito ist der südlichste Pazifik-Hafen Costa Ricas. Costa Rica y Castillo de Oro, reiche Küste und goldene Burg, taufte 1502 der vom Goldwahn benebelte Columbus die karibische Landseite. Die ihm nachfolgenden Konquistadoren mussten aber schon sehr früh feststellen, dass der Entdecker Westindiens einmal mehr gewaltig geflunkert hatte. Die goldenen Burgen erwiesen sich als schroffe Berge, und das davor ausgebreitete Tiefland gab nichts her – außer wild wachsenden Bananen und außer einfältigen, zu ihrem Verderben viel zu leichtgläubigen Eingeborenen. Deshalb aber Costa Rica als einen Bananenstaat zu bezeichnen, ist schlicht gesagt eine dümmliche Frechheit. Seit das Land 1821 das spanische Joch abgeschüttelt hatte, gab es nur noch zwei kurze Perioden der Gewalt, die die Demokratisierung des Landes beeinträchtigten. (Wikipedia)
Schließlich wird dieses Land wohl nicht umsonst die Schweiz Mittelamerikas geheißen. Die Schweiz? Das könnte natürlich auch ein dezenter Hinweis auf unauffällige Geldwäsche sein. Aber nein, sicher sind damit unter anderem die hohen Berge gemeint. Zum Beispiel überragt der 3.820 m hohe Chirripo Grande zwar nicht das Matterhorn, dafür aber um ganze 22 Meter Österreichs stolzen Großglockner. Auch das angenehme Hochland-Klima im Inneren des Landes und die fast ausschließlich „weiße“ Bevölkerung müssen für diesen Vergleich herhalten. Vor allem aber ist damit die aktive, unbewaffnete Neutralität Costa Ricas gemeint. Am 8. Mai 1949 schaffte Präsident José Figueres Ferrer per Verfassungsbeschluss die Armee ab. Pikanterweise war besagter Präsident erst durch einen zwei Monate währenden Bürgerkrieg an die Macht gekommen, an dem er selbst nicht ganz unschuldig war. Spätestens an dieser Stelle, der Abschaffung der Armee, wird doch ein erheblicher Unterschied zur Schweiz deutlich. Übrigens, die dadurch frei gewordenen Gelder kommen seitdem dem Bildungs- und Gesundheitswesen zugute. In keinem Land Lateinamerikas außer Kuba gibt es weniger Analphabeten…
Bei der Erinnerung an den Namen Puntarenas, damals der wichtigste Kaffee-Verladehafen Costa Ricas, blitzen die Neuronen in meinem Langzeitgedächtnis schon etwas häufiger, aber noch immer nicht häufig genug. Also flüchte ich noch einmal ins Allgemeinwissen und stelle fest: Die Kaffeebohne ist längst nicht mehr die Nummer Eins des costaricanischen Exports, sondern – die Banane. Und weil die am besten im östlichen Tiefland gedeiht, ist nur folgerichtig, dass das an der Karibikküste liegende Puerto Lemon inzwischen der wichtigste Hafen des Landes ist. Über diesen Hafen wüsste ich schon einiges mehr zu berichten. Jedoch gehören diese Erlebnisse zu einem anderen Schiff und in eine andere Zeit…
Auf der Rückreise waren die Kaffeebohnen, das „grüne Gold“, immer der mit Abstand größte Posten an Ladung. Angeliefert und verladen wurden sie in ganz gewöhnlichen Jutesäcken, die aber immerhin ein ganz schönes Gewicht hatten. Außerdem waren diese Säcke nur schwer zu fassen, denn selbstverständlich verbot es sich von selbst, sie mittels eines handlichen Stauhakens im Laderaum zu stauen. Zwar ist das „Stauen“ nicht unbedingt Matrosenarbeit, aber verschont blieben wir davon dennoch nicht. Immer wieder einmal gefiel es einem der obergescheiten „Supercargos“ – das sind bestellte Ladungsexperten – das Schiff vom Volldecker zum Schelterdecker zu deklarieren. Das ist lediglich ein Vermessungstrick und dient dazu, den Raumgehalt des Schiffes abgabengünstig zu verändern. Warum das den Experten immer erst einfiel, wenn das Schiff bereits so gut wie abgeladen war, das entzieht sich dem Sachverstand eines simplen Matrosen. Dafür aber durften wir die Zugänge zu den Ablaufventilen im Zwischendeck, die ja schon eingestaut waren, Sack um Sack wieder frei räumen. Solch schweißtreibende Arbeiten, mit einem quakenden, quiekenden Kapitän und einem „Schwertfisch“ im Rücken, solche Höhepunkte unnötiger Schinderei vergisst man auch nach Jahrzehnten nicht. Übrigens: Hans Ballermann war da schon nicht mehr mit von der Partie – er war irgendwo ganz schlicht abhanden gekommen. Tatsache ist, dass es nicht die Kaffeesäcke waren, sondern eher die „leichten Mädchen“, die nicht immer nur sanften, aber sonst ach so hingebungsvollen Latinas, die mich an diese Küste zogen. Na, da sollte mir dazu doch auch etwas einfallen. Da war doch noch was…
Da war… Nein, es war, es war wahrscheinlich ein Sonn- oder Feiertag. Die Sonne stand schon wieder sehr hoch, als wir uns, Hans und ich und ein paar andere Janmaaten noch immer im Innenhof der ach so gastlichen „Ranch“ aufhielten, die uns die vergangene Nacht über beherbergte. Möglicherweise hatten wir ja wirklich einen korrekt beglaubigten „freien Tag“. Wahrscheinlicher aber ist, dass wir uns den „freien Tag“, der uns nach der so gut wie schlaflosen Nacht zur Erholung nötig schien, einfach selbst verordnet hatten. Die Ranch war natürlich kein nobler Pferdehof, aber irgendwie hatte sie doch etwas von einem „Gestüt“. Die in sich geschlossene Anlage bot dem Seemann alles, was sein Herz begehrte. Das war im Grunde nicht viel: Wein, Weib, Gesang… Na ja, Gesang musste nicht unbedingt sein…
Was unbedingt sein musste, war eine Bar mit einem mehr oder weniger langen Tresen, hinter dem sich wie auf einem Laufsteg die kulleräugigen Schönheiten darboten. Und so nach und nach kam ein jeder unter Dach und Fach. Das „Dach“ war eine mit ein paar schnellen Schritten über den Innenhof erreichbare Kemenate. Das „Fach“ eine verhältnismäßig breite „Werkbank“, wie Hein Seemann das Lotterbett zu bezeichnen pflegte. Und, und das ist wirklich betonenswert, die Putas waren in der Regel lieb und treu, ja oft genug treuer, als so manch einem von uns lieb sein mochte. Während der kurzweiligen Nacht, davon darf man ausgehen, gab es wohl reichlich von all dem, was das Seemannsherz halt so erfreut. Und weil es so schön und so lustig und ganz sicher auch noch jede Menge Alkohol im Blut war, blieben Hans und ich vernünftigerweise eben da. Auf der Veranda gemütlich in Rohrstühlen sitzend, vor drohendem Sonnenstich sicher durch ein dichtes Palmenblätterdach geschützt, ließen wir träge Beine und Seele baumeln. Aufmerksame, eifrige Bedienerinnen sorgten dafür, dass auch stets frisches Eis im stets nachgefüllten Glas zischte. Eine vielleicht etwas Übereifrige überraschte uns mit einer ganz besonderen Art von Bedienung: Kurz entschlossen entblößte sie eine ihrer prallen Brüste, nahm sie, die Brust, zwischen ihre Hände und drückte und spritzte einen Strahl Milch zielgerecht in meinen Drink. Fröhlich lachend taufte sie diese mir noch neue Kreation Cuba libre con leche! Um es gleich zu sagen, in diesem pikanten Fall erwies ich mich, ich, der doch allem Neuen gegenüber stets aufgeschlossen war, als stockkonservativer Trinker und verlangte, trotz hübschester An- und Aussicht, nach dem traditionellen Cuba libre con lemon…
Ein anderes Erlebnis: Allerdings kann ich weder von dem eben geschilderten noch von dem zu schildernden mit Sicherheit behaupten, ob es sich im costaricanischen Puntarenas oder im nicaraguanischen Corinto abgespielt hat. Eigentlich ist es ja e wurscht. Nun ist es aber so, dass die doch sehr unterschiedliche Qualität der zugrunde liegenden Ereignisse Rückschlüsse auf die Verhältnisse der angesprochenen Städte zulässt, und das ist dann vielleicht doch wieder nicht ganz so wurscht. Ich denke, der Film, den ich gerade in meinem Kopf ankurble, scheint sich eher in Corinto abzuspielen.
Vor meinem inneren Auge entsteht eine düstere, nur spärlich mit künstlichem Licht ausgeleuchtete, gespenstisch anmutende Welt. Im Vordergrund, bis an die Hafenmole reichend, breitet sich ein Rangierbahnhof aus, auf dem zusammengekoppelte Güterwaggons in langen Reihen wie kopf- und schwanzlose Blechschlangen herumstehen. Im Hintergrund, vor nur noch schwach erkennbarer Bergsilhouette, unter nur noch schwach fluoreszierenden Federwolken, liegt vermutlich das „Zentrum“. Genau da will ich hin. Ich bin spät dran und solo – und jetzt sehe ich mich auch noch massiv daran gehindert, mein Vorhaben zügig auszuführen: Eine dieser Blechschlangen versperrt mir den Weg. Weil ich mir nicht sicher bin, ob die Schlange nicht etwa doch einen fauchenden, rußenden Kopf hat, wage ich es vorerst nicht, die Blockade einfach zu unterkriechen. Die üppig mit Disteln und Dornen ausgestattete Vegetation links und rechts des Teerstranges, der den Namen Straße nur seiner Konkurrenzlosigkeit verdankt, zwingt mich zum Handeln: Entweder – oder…
Immer wiederkehrende Rangier-Blockaden verleiden mir den Weg ins „Zentrum“, von dem ich eh schon gar nicht mehr glaube, dass es ein solches überhaupt gibt. Inzwischen scheint mir das weitere Vordringen sowieso nicht mehr nötig zu sein. Beidseitig der Zufahrtsstraße, aber auch direkt im Bahngelände, neben den Gleissträngen, stehen vereinzelt oder sich gegenseitig stützend hölzerne oder aus Ziegelresten zusammengeflickte Bruchbuden. Mit bunten Lämpchen und lärmender Musik-Box werben sie um die in dieser trostlosen Einöde umherirrenden Nachtschwärmer. Im Licht einer Straßenlaterne glaube ich ein mir wohlbekanntes Gesicht zu sehen. Ja doch, es ist der Moses! Spuckend, rotzend, wie ein Rohrspatz schimpfend kommt er auf mich zu. Er ist so mit sich beschäftigt, dass er mich kaum wahrnimmt. Ich stelle ihn zur Rede und frage teilnahmsvoll: „Na, Moses, was ist los mit dir? Hast du etwa was Falsches in den Hals gekriegt?“ Der Bursche, vielleicht gerade sechzehn Jahre alt, sieht mich anstelle einer Antwort trotzig, ja fast zornig an. Dann bricht es aus ihm heraus: „Pfui Teufel, so eine Scheiße! Diese alten Lügner! So ein verlogener Mist, das nun soll das Tollste sein, das man einer Frau antun kann?“ Dabei rubbelt er intensiv mit dem Zeigefinger über seine Lippen und die zum Spucken vorgestreckte Zunge, so als wolle er sie von irgendwas befreien. Ah, nun kapiere ich: Irgendjemand hatte ihn dazu gebracht, das zu tun, was unter Janmaaten „In den Keller steigen“ genannt wird. Und weil das „In den Keller steigen“ oft genug in geselliger Saufrunde als das „Non plus Ultra“ sexuellen Abenteuers geschildert wurde, musste man es auch mindestens einmal gemacht haben, um mitreden zu können …
Ich versuche ihn zu besänftigen: „So was bringt einen Seemann doch nicht um!“ Und wenn ihm schon einige Härchen im Rachen hängen geblieben sein sollten, dann sollte er nicht wie ein Lama in der Gegend herumspucken, sondern sich lieber schnell noch ein Bier in den Hals kippen. Mitfühlend klopfe ich ihm auf die Schulter und ermuntere ihn, mich in die nächstgelegene Pinte zu begleiten. Aber sein momentaner Widerwille gegen die ganze Matrosen-Zunft, mich eingeschlossen, ist offensichtlich stärker; immer noch zutiefst beleidigt, trollt er sich spuckend von dannen…
Ob ich in dieser Nacht noch bis ins Zentrum der Lustbarkeiten gelangte, das weiß nur mein Schutzengel, und der ist nicht sehr redselig (wahrscheinlich weil er genau weiß, dass es wenig Sinn hat, mir ins Gewissen zu reden). Jedenfalls war ich am Morgen zum Arbeitsbeginn wieder an Bord, wenn auch in leicht lädiertem Zustand. Hans Ballermann aber fehlte – als einziger. Er fehlte auch noch, als wir am späten Nachmittag damit begannen, das Schiff wieder seeklar zu machen. Ich machte mir Sorgen um ihn. Der Hafen lag im Herrschaftsbereich des berüchtigten Somoza-Regimes. Es hieß, dessen „Fänger“ gingen mit achteraus gesegelten, mittellosen Seeleuten nicht besonders fürsorglich um. Also ging ich zum Ersten und machte mich erbötig, noch eben mal nach Hans Ballermann sehen zu dürfen. Schwertfisch sah mich an, als ob er mich gleich im Ganzen verschlingen wollte: „Sie, Sie ganz bestimmt nicht!“ zischte er – und beorderte die doofe „Oase“, den allgemein als Arschkriecher betitelten Offiziersanwärter, mit der Suche nach Hans. Hans zu finden, war dann auch nicht allzu schwer, angeblich lag er vor der erstbesten Kneipe im Staub. Und danach sah er auch aus, als er völlig abgerissen im Schlepptau des OA die Gangway herauf torkelte. Ein Bild des Jammers! Ich schämte mich für ihn, schämte mich meiner Freundschaft zu ihm und wandte mich feige ab. Später dann, auf See, nahm sich Schwertfisch in seiner bewährten Art den inzwischen ausgenüchterten Ballermann zur Brust. Darauf angesprochen, erklärte uns Hans, dass er die Abreibung ja verdient habe und dass ihm so eine unbürokratische Abmahnung lieber sei als Tagebucheintragungen und Geldstrafen. Außerdem vertraute er mir noch an, dass es nicht die Faustschläge des Ersten waren, die sein Ego verletzten, sondern, dass er ausgerechnet von der dämlichen Oase aufgespürt und abgeführt wurde…
Nikaragua: Der Name dieses „Bananenstaates“ geht wohl auf den toltekischen Kaziken Nicarao zurück. Dieser Kazike, so erfahre ich durch Wikipedia, versuchte vorerst mit dem europäischen Räuberpack, das Columbus nachfolgte, im Guten auszukommen. Der Goldgier und der christlich verbrämten Menschenverachtung der königlich-spanischen Mord-AG hielt aber auch diese Strategie nicht lange stand. Die indigenen Völker Nicaraguas wurden alsbald versklavt und als Arbeitstiere in die Silberminen Perus verschleppt. Der Mönch Bartolomé de las Casas, sozusagen das unfreiwillige historische Gewissen der Konquistadoren, schrieb 1552: „Im gesamten Nicaragua dürften heute 4.000 bis 5.000 Einwohner leben, früher war es eine der am dichtesten bevölkerten Provinzen der (spanischen?) Welt“.
Das Wappen Nicaraguas zieren fünf wie Reihenhäuser aneinander gefügte Vulkane. Über diesen gleichförmigen Zuckerhüten schwebt, gleichsam wie der „Heilige Geist“, eine rote Jakobinermütze. Ob diese Mütze, die der französischen „Briefmarken-Marianne“ so hübsch steht, stilisierter Ausdruck einer permanenten Revolution sein soll? Eher nicht. Eher war sie das Freiheits-Symbol des Generalkapitanats Guatemala, zu dem auch Nicaragua gehörte und das sich am 15. September 1821 von Spanien lossagte. Die daraus entstehende Konföderation „Vereinigte Provinzen von Zentralamerika“ hielt nicht lange vor, und seitdem wurschtelt jede dieser ehemaligen Provinzen als Kleinstaat vor sich hin. Innerhalb der einzelnen Staaten kämpften (und kämpfen) dann jeweils die Eliten aus konservativen und liberalen Kreisen um die Macht.
In Nicaragua rissen 1909 – mit tätiger Hilfe der USA – die Konservativen mit einem Putsch die Macht an sich. Der Preis für die nicht ganz uneigennützige Hilfe der Nordamerikaner war der Ausverkauf des Landes. Fortan kontrollierten US-Gesellschaften den Bergbau, die Eisenbahn, die Banken und das Zollwesen. 1926 nahm der legendäre Freiheitskämpfer Sandino mit vorerst nur dreißig Mann den Kampf gegen die US-Besatzungsmacht auf. Mit Erfolg: Sandinos stetig anwachsende Guerilla setzten den Yankies so zu, dass sie 1933 entnervt das Land verließen. Daraufhin legten die Sandinos ihre Waffen nieder – ein folgenschwerer Fehler! Denn das war die Stunde Anastasio Somozas, der natürlich gar nicht daran dachte, seine von den Amerikanern bezahlte und geschulte Nationalgarde vertragsgemäß ebenfalls zu entwaffnen. 1934, nach der programmgemäßen Ermordung Sandinos, war der Weg frei für die vierzig Jahre währende Diktatur des Somoza-Clans. Aber so wie sich die Somoza-Diktatur wie Mehltau über das Land ausbreitete, so gärte Sandinos Vermächtnis, wie der Geist in der Flasche, im mundtot gemachten Volk. Aber ich will nicht vorgreifen… So viel noch, ich zitiere: Am 17. Juli 1979 verließ Somoza unter Mitnahme der Staatskasse und der Särge seines Vaters und Bruders das Land und setzte sich nach Miami ab. Nicaragua war befreit. Der Befreiungskampf hatte mehr als 50.000 Nicagaruaner das Leben gekostet und hinterließ ein weitgehend zerstörtes Land.
(http.//www.globales-lernen.de/Nicaragua/nicaragua/geschichte.htm)
Dass sich die US-Politik so sehr für Nicaragua interessierte, lag nicht zuletzt an der natürlichen Wasserstraße zwischen der Karibik und dem Nicaragua-See, da sie sich als mögliche Alternative zum Panama-Kanal geradezu anbot. Sogar die Spanier liebäugelten bereits mit dieser Möglichkeit. Ich zitiere: Bereits 1539 entdeckte Diego Machuca den Rio San Juan als Wasserstraße zwischen der Karibik und dem Nicaragua-See. 1551 äußerte sich bereits der spanische Chronist Francisco López de Gómara: „Man fasse nur den festen Entschluss, die Durchfahrt auszuführen, und sie kann ausgeführt werden. Sobald es am Willen nicht fehlt, wird es auch nicht an Mitteln fehlen.“ Doch der spanische König Felipe II. sah in der Landbrücke zwischen den beiden Meeren Gottes Schöpfung, und an der wollte er nicht rütteln… (http://de.wikipedia.Org/wiki Nicaragua)
Ach, hätten die spanischen Könige nicht auch im Menschen Gottes Schöpfung erkennen können? Aber auf diesem Auge waren sie wohl blind oder – und das erscheint mir eigentlich noch glaubhafter – ein Gott, der in seiner unermesslichen Gnade Spitzbuben, Mörder und Henker als Potentaten auf seine Erbthrone hievt, der muss wohl ganz und gar mit Blindheit geschlagen sein…
Bei der Recherche zu diesem Bericht stieß ich – wiederum dank Wikipedia – auch auf ein pikantes Detail der Kanonenbootpolitik des längst verflossenen deutschen Kaiserreiches.
Zitat: Bei der Eisenstuck-Affäre 1876 – 1878 handelte es sich um eine diplomatisch–militärische Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Reich und der Republik Nicaragua. Sie war verbunden mit der größten Operation, die die Kaiserliche Marine im ausgehenden 19. Jahrhundert in Mittelamerika durchgeführt hat. Sie fand sowohl an der Pazifik- als auch an der Atlantikküste statt.
Worum es dabei ging? Um nichts Geringeres als um die Ehre des Herrn Honorarkonsuls Eisenstuck. Die Stieftochter dieses honorigen Herrn lag in jenen Jahren in Scheidung von ihrem nicaraguanischen Ehegespons und hatte sich wohl wieder in die väterliche Obhut zurück geflüchtet. Der verlassene Ehemann, offensichtlich ein Heißsporn, nahm ihr das übel. Da er aber der Dame seines Herzens – bzw. seines Hasses – nicht so ohne weiteres wieder habhaft wurde, wurde er tätlich. Zuerst schoss er – nicht auf die Dame, sondern auf den Konsul, den er aber verfehlte. Der eifersüchtige oder vielleicht auch nur in seinem Stolz gekränkte, aber sicher sehr einflussreiche Patron ließ jedoch nicht locker. Beim zweiten Anschlag bediente er sich gedungener Polizeisoldaten, die den bedauernswerten Vertreter deutscher Interessen zuerst auf offener Straße böse verprügelten und hinterher auch noch verhafteten. Das Gericht hob die Verhaftung zwar sofort wieder auf, vertrat aber sonst die Meinung, dass es sich bei dem Vorfall lediglich um eine Familienfehde handle. Es empfahl dem Herrn Eisenstuck, den Weg der Privatklage einzuschlagen.
Diese lapidare öffentliche Reaktion Nicaraguas war aber ganz und gar nicht im Sinne einer beleidigten Nation, zumal die sich gerade anschickte, als junge Großmacht auf internationalem Parkett mitzumischen. Das Deutsche Reich verlangte Satisfaktion: Bestrafung der Täter, 30.000 $ Schmerzensgeld und ein Flaggensalut der nicaraguanischen Soldaten. Diese Forderungen stießen in Managua allerdings auf taube Ohren; sie wurden einfach ignoriert…
Das wiederum wollte und konnte sich Berlin nicht bieten lassen. Also, was tun in so einem Fall, wenn die Diplomatie versagt? Man – man ist immerhin deutscher Kaiser, wenn auch von Bismarcks Gnaden – greift zum Schwert und lässt die „Kanonenboote“ von der Leine. Gleich vier Schiffe der kaiserlichen Admiralität, die sich in jenen Tagen „Flagge zeigend“ auf den Weltmeeren herumtrieben, wurden vor die Küsten Nicaraguas detachiert. Aus den Weiten des Pazifiks herbeieilend, trafen sich die Korvetten SMS „LEIPZIG“, SMS „ARIADNE“ und SMS „ELISABETH“ vor der Westküste Nicaraguas, um das kleine unscheinbare Hafenstädtchen Corinto, „Breitseite zeigend“, zu bedrohen. Das in Westindien herumschippernde Kadettenschulschiff SMS „MEDUSA“ traf zwischen dem 17. und 18. März 1877 vor der Ostküste Nicaraguas ein. Die Republik Nicaragua sah sich also plötzlich von beiden Seeseiten bedroht und – lachte sich ins Fäustchen, als sie gewahr wurde, dass die kaiserlichen Kriegsschiffe für Landungsoperationen gar nicht ausgerüstet waren. Dennoch beugte sie sich dann doch klugerweise der Kanonenbootspolitik des aufstrebenden Deutschen Reiches und erfüllte die gestellten Bedingungen. Das war sicherlich auch ganz im Sinne des Herrn Konsul Eisenstuck – aber dass seine Stieftochter, derer Ehestreitigkeiten die ganze Kanonenboot-Affäre ja erst ausgelöst hatte, nach all der Aufregung, so als ob gar nichts gewesen wäre, wieder zurück in die Arme ihres Gatten eilte, ob das auch in seinem Sinne war – das darf bezweifelt werden…