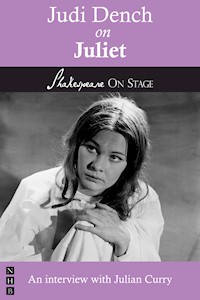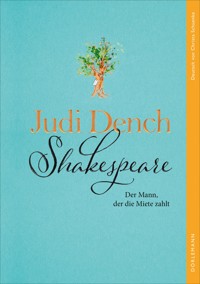
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wohl keine Schauspielerin kennt Shakespeares Dramen so gut wie Judi Dench, die seit sieben Jahrzehnten auf der Theaterbühne steht und Teil der Royal Shakespeare Company war. Mit einem Augenzwinkern, aber auch viel Liebe zur Literatur erzählt sie ihrem Gesprächspartner Brendan O'Hea von ihren Erfahrungen auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Sie führt uns aber auch ein in den Zauber der shakespeareschen Welten, in die Geheimnisse der Theaterszene und nicht zuletzt die praktischen Seiten des Bühnenlebens. Ein wunderbares, ebenso lehrreiches wie amüsantes Buch, das seine Leserschaft zugleich ganz nah an eine der faszinierendsten Schauspielerinnen unserer Zeit heranlässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Judi Dench | Brendan O’Hea
Shakespeare - Der Mann, der die Miete zahlt
Dame Judi im Gespräch mit Brendan O’Hea
Aus dem Englischen von Christa Schuenke
Mit Illustrationen von Judi Dench
Dörlemann
Inhalt
Widmung
EINFÜHRUNG
MACBETH
STRATFORD-UPON-AVON
EIN SOMMERNACHTSTRAUM
SPIELEN
WAS IHR WOLLT
DER KAUFMANN VON VENEDIG
ENSEMBLE
HAMLET
CORIOLAN
WAS EINEM ABENDS AM KAMIN SO DURCH DEN SINN GEHT
WIE ES EUCH GEFÄLLT
MASS FÜR MASS
ROSE THEATRE
VIEL LÄRM UM NICHTS
KÖNIG LEAR
FEHLER
DIE KOMÖDIE DER IRRUNGEN
PROBEN
RICHARD II.
ANTONIUS UND KLEOPATRA
CYMBELINE
KRITIKER
ENDE GUT, ALLES GUT
SHAKESPEARES SPRACHE
HEINRICH V.
DIE LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR
PUBLIKUM
RICHARD III.
DIE ZEITEN ÄNDERN SICH
DAS WINTERMÄRCHEN
SHAKESPEARES ZUKUNFT
ROMEO UND JULIA
RATSCHLAG
EPILOG
DANKSAGUNG
SCHLUSSBEMERKUNG UND DANKSAGUNG DER ÜBERSETZERIN
ÜBER JUDI DENCH
ÜBER BRENDAN O’HEA
ÜBER CHRISTA SCHUENKE
Für Michael, Finty und Sammie
EINFÜHRUNG
Wir hatten nie die Absicht, aus diesem Interview ein Buch zu machen. Mein Plan war aufzunehmen, was Judi Dench über die vielen Shakespeare-Figuren erzählt, die sie gespielt hat, und diese Aufzeichnungen dann mit ihrem Segen dem Archiv des Londoner Globe Theatre zu übergeben. Doch dann war zufällig einmal ein Freund ihres Enkels bei einem unserer vielen Gespräche, die wir in ihrem Haus in Surrey führten, anwesend, und der war neugierig geworden und wollte wissen, worüber wir die ganze Zeit lachten, in Begeisterung ausbrachen oder uns stritten, und da habe ich mich gefragt, ob diese Interviews vielleicht auch für einen größeren Kreis interessant sein könnten.
Der Mann, der die Miete zahlt, so hieß Shakespeare bei Judi und ihrem Mann Michael Williams, als sie beide fast die ganzen Siebzigerjahre hindurch zusammen an der RSC, der Royal Shakespeare Company, engagiert waren. Michael ist leider 2001 verstorben, aber in diesem Buch hat er einige Auftritte, und es war mir eine große Freude, ihn durch Judis Erzählungen besser kennenzulernen.
Zeitweilig habe ich mit dem Gedanken gespielt, das Buch Flöhe hüten zu nennen, denn es ist beinah unmöglich, Judi auf irgendwas festzunageln – besonders, wenn es um ihre Person und ihre Sicht auf die Schauspielerei geht. Überdies lässt sie kaum eine Gelegenheit aus, irgendwas Albernes zu machen: Sie kann keine Orange essen, ohne sich aus der Schale ein lustiges Gebiss zu schnitzen; kommt ein Paket an, muss sie sich aus der Verpackung gleich erst mal einen Hut machen; und ich weiß nicht, wie oft ich ihr dabei zusehen durfte, wenn sie mitten im Gespräch probieren musste, wie viel Popcorn sie auf einmal in den Mund kriegt.
Und es gab noch ein anderes Hindernis. Judi bekennt sich dazu, dass sie bei der Arbeit ausschließlich ihrem Instinkt folgt, sie hatte Angst, wir könnten uns verzetteln und die Stücke akademisch zerpflücken. Eine unnötige Sorge, denn wie man im Folgenden sehen wird, sind wir beide keine Akademiker.
Wir sind seit Jahren befreundet (kennengelernt haben wir uns 1995, als wir zusammen in A Little Night Music am National Theatre spielten), und doch habe ich bei diesem Interview so viel Neues über sie erfahren. Dass sie freundlich, großzügig, schelmisch und witzig ist, wusste ich schon immer, aber mir war beispielsweise nie aufgefallen, dass sie ein phänomenales Gedächtnis hat. Sie kann nicht nur ganze Shakespeare-Szenen auswendig rezitieren, sondern sie erinnert sich auch mikroskopisch genau an Ereignisse aus ihrer Kindheit und weiß noch die Namen von Schauspielern, Ankleiderinnen und Bühnepförtnern aus ihren allerersten Berufsjahren, und außerdem hat sie ein fotografisches Gedächtnis für nahezu jedes ihrer Kostüme.
Viele der Regisseure, mit denen Judi gearbeitet hat, gehören zur Avantgarde des britischen Theaters, und es war ein besonderes Vergnügen, sich von ihr auf deren Probebühnen mitnehmen zu lassen. Ihr Shakespeare-Verständnis ist prägnant und von erfrischender Einfachheit. (Vor allem aber war es ein ungeheures Privileg, von einer Schauspielerin, die seit fast sieben Jahrzehnten an der Spitze ihrer Zunft steht, an die Hand genommen und mit Shakespeares vielen außergewöhnlichen Frauenfiguren bekanntgemacht zu werden.)
Unser Interview ging über vier Jahre. Angefangen haben wir mit einer allgemeinen Unterhaltung über das jeweilige Stück. Dann habe ich jede Szene vorgelesen und dabei Fragen gestellt, während Judi die ganze Zeit ihre Kommentare abgab (und mich dabei auf meine falsche Aussprache und meinen walisischen Akzent aufmerksam machte). Bei Heinrich V., Richard III. und der Komödie der Irrungen, den Stücken, in denen sie auf der Leinwand zu sehen war, haben wir uns die Filme gemeinsam angeschaut, was für mich sehr lehrreich war, für sie aber eine Qual.
Judi hat schon immer gern gemalt und gezeichnet, die Seitenränder ihrer Textbücher sind von oben bis unten vollgekritzelt. Ihre Sehkraft hat im Lauf der Jahre abgenommen, inzwischen kann sie sehr schlecht sehen. Dass wir ein paar ihrer neueren Zeichnungen in diesem Band als Illustrationen verwenden, hat sie erst zugelassen, nachdem ein Freund sie darauf aufmerksam gemacht hatte, dass andere sehbehinderte Menschen dadurch inspiriert werden könnten, selbst mit dem Malen anzufangen.
In den ungekürzten Transkripten unserer Interviews beginnt Judi fast jeden Satz mit Wörtern wie »mag sein«, »vielleicht«, und »möglicherweise« (ganz zu schweigen von den Kraftausdrücken, die sie immer mal mit einflicht). Weil diese Partikeln beim Lesen ein wenig stören können, habe ich sie größtenteils gestrichen. Allerdings verraten sie – also die Adverbien, nicht die Kraftausdrücke – Judis Abneigung gegen jeglichen Dogmatismus. Ganz sicher ist sie sich nur darin, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, Shakespeare zu spielen.
Ich habe irgendwo gelesen, wenn man versuchen wolle, Shakespeares Persönlichkeit zu ergründen, das sei, als würde man in der National Portrait Gallery vor einem sehr dunklen, stark gefirnissten Bild stehen. Zuerst sieht man gar nichts, dann erkennt man ein paar Gesichtszüge, und schließlich wird einem klar, dass es die eigenen sind.
Ich denke, das gilt auch für Shakespeares Figuren. Sie spiegeln uns unser eigenes Ich zurück. Wie Judi einmal zu mir gesagt hat: »Es gibt so viele Shakespeare-Interpretationen, wie es Menschen gab, gibt und geben wird.« Was folgt, sind also nur die Überlegungen einer einzelnen Person …
Brendan O’Hea
MACBETH
Lady Macbeth
Macbeth war der Grund, weshalb ich zum Theater gegangen bin. Ich war in einer Schulaufführung, bei der mein Bruder Peter den König Duncan spielte. Er musste sagen: ›What bloody man is that?‹, und ich hab ›bloody hell‹ verstanden und dachte: Hey, die fluchen ja! Also wenn das Shakespeare ist, dann ist das genau mein Ding.
Die Lady Macbeth hast Du zweimal gespielt?
Ja, das erste Mal 1963 in Nottingham, und dann bei unserer Tournee durch Ghana, Sierra Leone und Nigeria. Peter Brook hat immer behauptet, seine Truppe war die erste, die in Westafrika gastiert hat, aber Fakt ist nun mal, dass wir das waren.
Das Publikum war wundervoll – sehr lautstark. In der Schlafwandel-Szene schrie eine Frau: »O Gott, die wäscht sich die Hände und hat gar keine Schüssel.« Und den Reim, den haben sie geliebt, die haben sich schief gelacht über die Reime. ›Der Than von Fife, der hatte ’n Weibs.‹ Das war der Hammer! Die Leute haben gejohlt: »Sag das noch mal!«, haben sie gerufen.
Es war ganz schön strapaziös, bei der Hitze im Freien zu spielen. Ich weiß noch, wie ich in den Bäumen Geier sitzen sah und zu den anderen Schauspielern gesagt hab: »Hey Leute, ihr müsst ein bisschen zucken, wenn ihr tot seid. Die warten schon, die wolln uns fressen.«
Und dann Polly Adams, die spielte eine von den Hexen – also, die hatte plötzlich wahnsinnige Zahnschmerzen und konnte nicht weitermachen. Eine Frau vom British Council erbot sich einzuspringen, sie hat gemeint, sie kennt den Text. Aber als die Zaubersprüche am Kessel dran waren, ›Aug des Molches, Zeh vom Kauz / Fledermaushaar, Hundeschnauz‹, da wusste sie den Text auf einmal doch nicht mehr und sagte: »Aug des Molches, Schnauz vom Hund / Fledermauskotelett zwei Pfund.«
An der Royal Shakespeare Company hast du Lady Macbeth auch gespielt?
1976 unter Trevor Nunn am Courtyard Theatre in Stratford.
Trevor wollte sich erst gar nicht darauf einlassen, weil er es ja gerade erst am Großen Haus gemacht hatte, aber Ian [McKellen] und ich haben erklärt, wenn er’s nicht macht, sind wir raus. Es gab kein Geld. Die Inszenierung war sehr frugal. Ein Kreidekreis auf dem Boden und zum Sitzen Apfelsinenkisten aus rohem Holz. Wir waren alle in gedecktem Schwarz und Grau, außer König Duncan, der war ganz in Weiß. Ich hatte ein schwarzes Kleid und schwarze Stiefel, und ich hatte die Idee, dass ich auch noch ein schwarzes Kopftuch tragen müsste.
Hattest du irgendwann einmal Angst vor dem Stück?
Angst?
Um Macbeth gibt es ja eine ganze Menge Aberglauben. Hat sich Roger Rees nicht mal das Bein gebrochen?
Ja, stimmt – er musste den Malcolm im Rollstuhl spielen. Nein, ich bin, glaube ich, nicht abergläubisch. In der Garderobe pfeifen muss nicht sein, aber meistens pfeife ich ja selbst, und klar, wenn ich in ein Theater komme, sag ich immer The Scottish Play. Es gab einen Pfarrer, der saß hin und wieder mit einem Kruzifix in der ersten Reihe. Und ich weiß noch, wie ich einmal mit Trevor aus dem Courtyard Theatre kam, die Proben liefen nicht so gut – ich glaub, das lag auch an dem kargen Bühnenbild, man war so ungeschützt –, und ich hab zu ihm gesagt: »Das wird nicht aufgehen, oder?«. Gott, war das peinlich.
Am Ende war es ein sehr befreiendes Gefühl, dass wir alles so weit zurückgestutzt hatten. Und es war irgendwie komisch und furchtbar aufregend, weil das Publikum so nah dran war. Sehr intensiv war das.
Zuerst sehen wir Lady Macbeth, die einen Brief von ihrem Gemahl liest.
Ja. Wenn du mich fragst, dann hat sie diesen Brief schon viele Male gelesen, hat ihn regelrecht studiert und bestimmte Stellen auswendig gelernt. Kann sein, ich hab sogar ein paar Zeilen vor mich hingemurmelt.
Wichtig ist, dass du in dieser Szene erst mal die Leidenschaft, die die beiden verbindet, etablieren musst. Ein Schlüsselsatz ist der, wo Macbeth seine Gemahlin als ›liebste Gefährtin meiner Größe‹ bezeichnet. Zu einer Zeit, wo Frauen vielleicht nicht als ganz so gleich angesehen wurden – ›liebste Gefährtin meiner Größe‹ – das ist der eigentliche Schlüssel zur Beziehung dieser beiden.
In dem Brief verrät Macbeth, dass er diesen drei sehr eigenartigen Gestalten begegnet ist, die ihn mit ›Heil dem, der König wird dereinst‹ gegrüßt haben. In Lady Macbeths Kopf fängt es gleich an zu rattern. ›Heil dem, der König wird dereinst.‹ Aber Macbeth will nichts für seinen Aufstieg tun, er ist nicht ehrgeizig, nicht rücksichtslos genug, er ist ›zu voll der Milch der Menschlichkeit‹. Sie kennt ihn verdammt gut.
Und natürlich gibt sie auch etwas von sich selbst preis. Aber ich glaube nicht, dass man sie als eine Frau sehen sollte, die total vom Ehrgeiz zerfressen ist. Oder als unglaublich böses Weib. Wenn sie wirklich böse wäre, hätte sie doch keinen Grund, die Geister anzurufen. Man darf nicht so geradeaus denken: Sieh an, hier gibt es ein Problem. Man sollte zeigen, wie sich das aufbaut.
Stellt sie die Prophezeiung der Hexen eigentlich nie infrage?
Ich glaube nicht. Und er auch nicht. Aber du darfst nicht vergessen, zu dieser Zeit waren Hexen total …
Gott, ich hab da was ganz Schreckliches gehört. Kennst du dich gut aus in Edinburgh? Ganz unten im Schloss waren die Kloaken. Und wenn jemand der Hexerei angeklagt wurde, dann haben sie ihn da raufgeschleppt und dort hineingeworfen. Und wer in der Kloake und in dem ganzen Dreck nicht gleich ertrunken ist, den hat man rausgezogen und verbrannt. Das hat sich mir so lebhaft eingeprägt. Da möcht man nicht so gern als Hexe gelten, oder?
Zumindest nicht in Edinburgh.
Zumindest nicht in Edinburgh, genau. Bradford wär OK. [Lacht.]
Ein Bote kommt und sagt: ›Der König kommt zur Nacht.‹ Also Duncan.
Welch eine Koinzidenz. Wo sie gerade diesen Brief gelesen hat. Wenn das kein Zufall ist! Das kommt den beiden wie gerufen. Sie müssen doch enorm nervös sein, oder nicht?
BOTE
Der König kommt zur Nacht.
LADY MACBETH
Du redest wirr.
Und das ist ein klassischer Anschlussvers – ein voller jambischer Pentameter, der geteilt wird. Wenn er an so einer Position auf der Seite steht wie hier, dann sagt dir Shakespeare: Aufgepasst, ich bin dein Stichwortgeber.
Wenn der Bote gegangen ist, sagst du: ›Kommt, Geister, die ihr Mordgedanken hegt, entweibt mich hier.‹
Ach das – ja – ich hab immer gewartet und gehorcht und mich umgeschaut, ob irgendjemand in der Nähe ist, und dann bin ich runter auf die Knie und hab die Geister angerufen. Und mitten im Text – ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle – hab ich viel zu tief Luft geholt, und mir ist schwindlig geworden und ich bin schnell wieder aufgesprungen.
Sie weiß, sie hat die Grenze zum Profanen überschritten – hat sich zu weit mit der Hexerei eingelassen. Das ist, wie wenn du mitten in einer Séance etwas ganz unvorstellbar Fürchterliches entdeckst. Aber sie muss die Geister um Hilfe anrufen – ›füllt mich vom Schädel bis zur Zeh randvoll/ mit wilder Grausamkeit‹. Sie muss ihre Weiblichkeit verlieren -›entweibt mich hier‹. Macbeth braucht einen Schubs, und den verpasst ihm seine Frau mithilfe der Geister. Sie ist der Stachel, der ihn anspornt.
Stimmt es, dass Trevor auf die Frage, ob die Macbeths die Nixons sind, gesagt hat …
Er sagte: »Nein, sie sind die Kennedys.« Sie sind das Vorzeigepaar. Sie bewundern einander. Und sie würde alles für ihn tun. Wenn er König werden will, dann wird er es. Du bist Glamis, du bist Cawdor, und wir kennen beide die nächste Prophezeiung. Verdammt noch mal, mein Schatz, du wirst der König.
Und du die Königin.
Das interessiert sie nicht. Ich glaube nicht, dass sie dabei auch nur einmal an sich gedacht hat. Sie tut es für ihn. Sie wird ihn weiter vorantreiben, bis er erreicht hat, was ihm nach ihrer Überzeugung zusteht.
Du hast also seinen Brief gelesen, man sagt dir, dass der König heute Abend kommt, und dann erscheint Macbeth.
MACBETH
Teuerste Liebste,
Duncan kommt heut Nacht.
LADY MACBETH
Und geht wann wieder fort?
MACBETH
Am Morgen, so sein Plan.
LADY MACBETH
Oh! nie
Soll Sonne dieses Morgen sehn!
Euer Gesicht, mein Than, ist wie ein Buch, in dem
Man Sonderbares liest.
Das ist doch die reinste Orchesterpartitur, oder? Shakespeare sagt einem genau, wie man das spielen soll. Lady Macbeth vollendet den geteilten Vers, woran man erkennt, wie ihre Gedanken rasen. Und nach ›Soll Sonne dieses Morgen sehn‹ ist eine Pause, weil das kein voller jambischer Pentameter ist, das heißt, man hat ein wenig Spielraum, um darauf zu reagieren. Das hab ich von Peter [Hall] gelernt, und es hat mir eine Tür geöffnet – ganz weit.
Ich glaube, in dieser Pause überlegt sie, was Macbeth wohl gerade denkt. Sie sieht, dass seine Gedanken in genau die gleiche Richtung gehen wie ihre. Sie erkennt in seinem Gesicht den nackten Ehrgeiz, und von dem ist er bis ins Mark erschüttert. Gott, wie schön das aufgebaut ist.
Wenn sie sagt: ›Der da kommt‹ – mit ›er‹ meint sie König Duncan – ›Muss gut versorgt sein‹, ist da irgendein Hintersinn in dem Wort ›versorgt‹?
O ja, davon geh ich aus. Sie reden verschlüsselt. Man kriegt richtig Gänsehaut.
LADY MACBETH
Der da kommt
Muss gut versorgt sein; dieser Nacht
Großes Geschäft leg nur in meine Hand,
Dass fortan unsern Nächten, unsern Tagen,
Alleinherrschaft und Macht sei übertragen.
Sie beendet die Replik mit einem Reim. Heißt das, sie möchte das Thema damit abschließen?
Könnte sein. Oder vielleicht verleiht der Reim ihren Worten auch noch mehr Nachdruck, macht es noch wahrscheinlicher, dass das passieren wird. Und sie hat nicht zufällig das Wort Alleinherrschaft benutzt.
Lady Macbeth begrüßt König Duncan. Aber sie ist allein. Kein Macbeth da.
Tja, der hockt vermutlich in seinem Kämmerchen und hat Fracksausen. Aber es ist auch gar nicht so ungewöhnlich, dass sie Duncan allein begrüßt. Duncan ist doch ihr Cousin. Später sagt sie: ›Hätt er / nicht meinem Vater so geähnelt, als / Er schlief, ich hätt’s getan.‹
Umso abscheulicher, dass sie überhaupt nur in Erwägung ziehen kann, ihn zu töten.
Das kannst du laut sagen!
Glamis macht ja eigentlich einen ganz netten Eindruck. Nichts deutet auf das Grauen hin, das sich da anbahnt.
Darf es ja auch nicht. Wie in jedem guten Thriller muss es Licht und Schatten geben. Sie sagen so viel Nettes über das Schloss und seine Lage. All die Vögel, Sommer, milde Luft – ›des Himmels Luft / verlockend duftet hier.‹ Sie empfängt Duncan so herzlich – die Gastfreundschaft in Person.
Kein Kasperletheaterschurke weit und breit.
Überhaupt nicht. Sonst würden ja Duncan und die anderen wie Idioten aussehen. Und außerdem würde irgendjemand einen entsprechenden Kommentar abgeben.
Später ist Macbeth allein und bekommt kalte Füße bezüglich des Mordes. Lady Macbeth erscheint.
Ja, und sie haben eine Menge geteilte Verse, woran man nicht nur sieht, was für ein Tempo in dieser Szene herrscht, sondern es zeigt auch, wie gut sie aufeinander eingespielt sind.
Also, er hat Bauchschmerzen und sagt ihr, dass er doch lieber keinen Mord will. Da rastet sie aus: ›War denn die Hoffnung trunken, / In die du dich gehüllt hast?‹ Sie überlegt: Wenn du jetzt schwankst und es dir anders überlegst, denk nicht, dass ich nach deiner Pfeife tanze. Wenn du in dieser Sache wackelst, wer sagt mir, dass du es dir nicht im Hinblick uns zwei auch noch mal anders überlegst? Sie benutzt ihre Beziehung als Faustpfand. Sie denkt, er ist feige, nicht Manns genug. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund.
Und natürlich kommt auch noch der Druck hinzu, dass Duncan und die anderen unten warten. Macbeths Abwesenheit kann jeden Moment bemerkt werden. Ich meine, ihre Nerven müssen doch zum Zerreißen gespannt sein – Duncan ist hier, hier im Schloss – so ein Glücksfall – und sie haben nur die eine Nacht, um ihm das Licht auszupusten.
Im weiteren Verlauf der Szene erfahren wir, dass sie einmal Kinder hatten, die gestorben sind.
LADY MACBETH
Ich hab gesäugt und weiß, /
Wie’s wärmt, das Kind zu lieben, das mich melkt;
Ich hätte, lächelt’s mir auch ins Gesicht,
Gezerrt die Zitze ihm vom weichen Gaumen,
Und ihm das Hirn zermalmt, hätt ich’s geschworen
So wie du dieses hier.
Sie sagt, sie würde nicht davor zurückschrecken, etwas Grausames zu tun – sie würde sogar ihr eigenes Kind umbringen. Und darum musste sie die Geister anrufen. Weil, was sie da sagt, keine rationale, menschliche, humane, liebevolle Antwort ist. ›Entweib mich hier‹ und so weiter.
Also sind da die Geister am Werk?
Das ist jedenfalls meine Deutung von dem, was hier abläuft.
Sie will ihn anstacheln loszulegen. Aber er zaudert immer noch: ›Und wenn wir scheitern?‹ Und sie darauf: ›Scheitern? / Schraub deinen Mut nur bis zum Anschlag hoch, / Dann gibt’s kein Scheitern.‹ Für sie ist der Ablauf sonnenklar: Duncan töten, die betrunkenen Diener mit seinem Blut beschmieren, ihnen die Dolche in die Hände legen, und dann einen Heidenlärm machen, das ganze Haus zusammenschreien, die Treppen rauf und runter rennen.
Keine Frage, die zwei verbindet eine große Leidenschaft.
Nun ja, sie reden ja die ganze Zeit davon. ›Kückchen mein‹ nennt er sie. Und selbst die anderen reden darüber. König Duncan spricht von ihr als Macbeths ›großer Liebe‹. Jeder weiß, dass es eine fantastische Ehe ist. Wär nicht die Leidenschaft, was könnte sie sonst antreiben?
Sie schafft es also, Macbeth wieder zur Vernunft zu bringen, und dann ist die Nacht des Mordes.
Ja, wir kommen auf die Probe, und Trevor hat alles verdunkeln lassen, nicht der allerkleinste Lichtspalt. Es war ein heißer Sommertag, wir kamen also im Courtyard Theatre an – das Ding ist eine Blechbüchse – und alles stockfinster. Auf der Bühne gab es eine Treppe. Trevor sagte: »Ian, du gehst die Treppe hoch, und du entscheidest selber, wie lange du brauchst, bis du nach dem Mord wieder runterkommst.« Das war richtig gruselig. Denn in diesen ersten Worten von ihr – ›Horch. Still … Jetzt geht er dran‹ – da geht es nur ums Hören. Ich konnte Macbeth hören, aber ich konnte ihn nicht sehen. Stell dir doch nur mal vor, dieses riesige Schloss – ich hab auf jedes Knarren gehorcht, auf jeden Laut und jeden Atemzug. Aber dann hör ich ihn ganz leise die Treppe runterkommen und diese Schritte … also, das war absolut elektrisierend.
Diese Spannung – das Publikum muss …
Total. Schieres Entsetzen. Immer noch alles stockfinster. Es war jedes Mal totenstill.
Macbeth ist in Panik nach dem Mord. Die Reue packt ihn, Zweifel plagen ihn.
Er hat eine unglaubliche Angst. Er dachte, er schleicht sich einfach die Treppe rauf, haut dem König das Messer zwischen die Rippen, kommt schnell wieder runtergerannt, und fertig ist der Lack. Aber dann sind da Leute, sie wachen halb auf und murmeln im Schlaf Gebete. Einmal hat Lady Macbeth ihn ›Wer da?‹ rufen hören. O Gott. Und jetzt ist er runtergekommen, schlotternd vor Angst, und kann sich gar nicht wieder beruhigen.
Und sie ist wütend, weil er drauf und dran ist, alles kaputt zu machen. Was, wenn irgendjemand reinkommt und sieht ihn bibbern wie ein kleines Kind. Und außerdem ist er voller Blut und hat immer noch die Dolche in der Hand. Sie muss schnell nach oben rennen und die Dinger den Dienern in die Hände drücken. Als sie zurückkommt, fährt sie ihn an: ›Blutrote Hände hab ich, so wie du, / doch wär mein Herz wie deins so weiß, ich schämte mich.‹
Sie hat aber enorm viel Schneid.
Ja – na ja, sie hat die Geister ja schließlich nicht umsonst beschworen, sie anzutreiben. Und sie hat etwas zu erledigen – er ist ja so was von entkräftet, so voller Reue. Er muss sich zusammenreißen, weil, sie müssen ja jetzt gleich total überrascht tun.
Und die nächste Szene ist doch dann die mit dem Pförtner, oder? Shakespeare wusste genau, wo was Komödiantisches hinmuss. Dass die Zuschauer mal durchatmen können, dass sie lachen können, und dann wird die Spannung noch weiter hochgeschraubt.
Man findet Duncan ermordet, und es gibt Chaos. Alle kommen angerannt. Ich empfinde ihr Schweigen in dieser Szene wie einen Bann.
Sie muss höllisch aufpassen, was Macbeth macht.
Und wenn sie dann in Ohnmacht fällt, ist das echt oder gespielt?
Vielleicht ist es echt, vielleicht ist ihr das jetzt doch alles zu viel: Die Realität der Tat, die sie begangen haben, die Angst, dass Macbeth die Katze aus dem Sack lässt. Aber ich hab es, glaube ich, als falsche Ohnmacht gespielt. Sozusagen als Ablenkungsmanöver, damit er nicht mehr so im Fokus ist. Sie muss die Aufmerksamkeit auf sich ziehen – Macbeth hält einfach nicht die Klappe, und sie hat Angst, dass er ihre Tarnung auffliegen lässt.
Duncan ist tot, und als nächstes sehen wir euch beide als König und Königin. Kein großer Kostümwechsel?
Überhaupt keiner. Nur eine kleine goldene Krone.
Sie ist recht still in dieser Szene. Sie begegnet Banquo sehr höflich.
Na ja, Banquo war bei Macbeth, als die Hexen ihre Weissagung gemacht haben. Er weiß Bescheid, er steckt mit drin, also behält sie ihn im Auge.
Außerdem erfahren wir, dass Duncans Söhne nach Irland geflüchtet sind – das ist der Shakespearesche Zeitraffer. Und die Söhne verbreiten Gerüchte, nicht wahr, und sie erzählen Lügengeschichten, nicht wahr?
Ich weiß nicht so genau, ob das wirklich Lügengeschichten sind; sie äußern ihren Verdacht im Hinblick auf den Tod ihres Vaters, einen Verdacht, der sich ja auch als richtig erweist.
OK, OK, wie du meinst.
In der nächsten Szene ist Lady Macbeth allein mit einem Diener.
Und Macbeth lässt sich nicht blicken. Sie muss ihren Gatten holen lassen: ›Geh, sag dem König, ich lass ihn ersuchen / Auf ein paar Worte.‹ Reine Verzweiflung, nicht wahr? Er ist nicht da.
LADY MACBETH
Nichts ist gewonnen, alles hin
Wenn, zwar am Ziel, ich nicht zufrieden bin:
Sichrer ist’s, das zu sein, was wir zerstört,
Als wenn Zerstörung zweifelhaftes Glück gewährt.
Das ist der Moment, wo sie erkennt, dass sich zwischen ihnen ein Riss auftut, weil Macbeth sich immer wieder in seiner Kammer verkriecht und die Tür zumacht. Weißt du, König und Königin zu sein, ist ja ganz schön, aber wo ist die Leidenschaft geblieben, die sie einst verbunden hat?
Hat sich Trevor Nunn eigentlich mal zum Rhythmus und zur Versstruktur geäußert?
Eigentlich nicht. John [Barton] und Peter [Hall] schon. Peter unentwegt. Er hat immer am Pult gestanden und das Metrum geklopft, wenn wir die Verse gesprochen haben.
War das störend?
Manchmal vielleicht schon, aber er hat einem ja das Gerüst gegeben. Für ihn war der Vers ein Stück Musik. Das kam vielleicht durch seine Opernarbeit. Er hat immer gesagt, dass das Versende wie der Taktstrich in der Musik ist – und wie ein Jazzmusiker da drüber hinweggehen würde. Gott, Peter war wirklich einmalig.
Und John war auch toll. Sie sind beide mit einer solchen Gründlichkeit und Leidenschaft an die Stücke herangegangen. Sie hatten genau die gleiche Auffassung, nur bei der Umsetzung gab es ein paar Unterschiede.
Peter hat immer bloß auf den Text geguckt, bis man den Vers rhythmisch so hatte, wie er ihn haben wollte, erst dann hat er aufgeblickt und zugeschaut. John hat immer Kaugummi gekaut – oder Rasierklingen (eins seiner Kabinettstückchen) – hatte immer dieselbe grüne Strickjacke an und hat Unmengen Milch getrunken. Und er hat ständig mit seinem Stuhl gekippelt, ich hab mal gesehen, wie er mit dem Stuhlbein voll in seiner Milchtasse gelandet ist.
Und Trevor Nunn?
Trevor war ständig auf den Beinen: hat hingeguckt, beobachtet. Der Rhythmus war ihm ziemlich egal. Aber den hatte ich ja bei Peter und bei John gelernt, den hatte ich bereits verinnerlicht. All drei haben sehr auf die Sprechkultur geachtet, die war doch bei der Royal Shakespeare Company das A und O.
Aber Trevor war im Grunde mehr wie ein Schauspieler. Ihn interessierte das Psychologische, die Beziehungen, das Menschliche – nicht, dass das die anderen nicht auch interessiert hätte, aber er ist da noch weiter gegangen. Und Trevor lacht viel, er hat immer einen Witz auf Lager.
Aber gleichzeitig dringt er unglaublich tief in das Stück ein und … er beharrt nicht auf seinem Willen – er ist kein bisschen didaktisch – seine Methode ist, etwas vorzuschlagen und es dann dir zu überlassen, was du daraus machst.
Nach Lady Macbeths kurzem Moment mit dem Diener erscheint Macbeth.
Und was ist das Erste, was sie zu ihrem Mann sagt? ›Was hältst du dich allein?‹ Sie schlafen nicht mehr miteinander. Er ist in seinem eigenen Zimmer, schließt sie aus. [Depressiv.] Das ist der Grund, weshalb sie wahnsinnig wird … weshalb sie … ja, der Grund, weshalb sie stirbt …
Im Geiste bist du wieder dort, nicht wahr? Ich seh’s dir an.
Ja, weil sie so verdammt einsam ist. Macbeth ist nur noch mit sich selbst beschäftigt. Und sie denkt: Meine Güte, ›getan ist getan‹. Lass uns doch wieder so sein, wie wir früher waren. Es macht uns doch kaputt, wenn wir das alles wieder und wieder durchkauen. Aber sie dringt nicht zu ihm durch. Ich glaube, es gab einen Moment, da hat sie ihn richtig geschüttelt.
Und du darfst nicht vergessen, es ist der Abend des Banketts, also noch etwas, das sie enorm unter Druck setzt: ›Sei hell und heiter, wenn die Gäste kommen‹, sagt sie zu ihm. Und da eröffnet ihr Macbeth – o Gott – was er mit Banquo und Fleance vorhat. Das ist der Punkt, wo sich zwischen ihm und Lady Macbeth ein gewaltiger Abgrund auftut, weil er zum ersten Mal in ihrer Ehe Vorkehrungen trifft, die nichts mit ihr zu tun haben. Etwas, was ihrer Beziehung vollkommen fremd ist: Sie war bei allem immer mit dabei, und jetzt ist sie auf einmal ausgeschlossen.
Ich meine, sie haben erreicht, was sie wollten – dafür haben sie gekämpft: Er ist König, sie ist Königin. Aber irgendwie wird die Kluft zwischen ihnen immer größer. Wo einmal Leidenschaft, Komplizenschaft und Nähe war – schwupp! – alles weg. Sie sieht jemanden vor sich, den sie nicht mehr kennt. Er ist weg – meilenweit weg. O Gott.
Gegen Ende dieser Szene scheinen Lady Macbeth die Worte zu fehlen. Macbeth sagt: ›Du staunst ob meiner Worte.‹
Na ja, sie ist entsetzt, sie ist sprachlos. Ian [McKellen] hat mich buchstäblich an sich gerissen und mit rausgeschleppt.
Und ich glaube, das war gegen Ende dieser Szene, wo Ian sagen musste: ›Das Licht nimmt ab, die Krähe / Fliegt hin zum Rabenwald.‹ Einmal bei einer Vorstellung hat er ›zum Wabenrald‹ gesagt. [Lacht.] Das war so ein ulkiger Versprecher. Ich vor ihm auf Knien … ich hab gedacht – ich meine, ich war total … Ich musste dermaßen lachen, ich hatte einen richtigen Lachkrampf. Und da hab ich halt so getan, als ob ich einen schrecklichen hysterischen Anfall habe. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, und das Publikum war gerade mal einen halben Meter weit weg. Ich war heilfroh, dass ich das hingekriegt hab – mit einem Taschenspielertrick.
Lady Macbeth ist keine große Rolle, oder?
Ganz und gar nicht. Aber wichtig. Und es ist ein kurzes Stück. Wenn man es ohne Pause spielt, was wir getan haben, dann bleibt die Spannung erhalten.
Und dann sind wir also beim Bankett, und Lady Macbeth hat keine Ahnung, dass Banquo ermordet wurde?
Nein, aber sie ist ja nicht dumm. Banquo hätte da sein sollen. Und Fleance. Sie weiß, irgendwas stimmt nicht. Meine Güte, ist das alles spannend, oder?
Merkst du, dass Macbeth mit den Mördern spricht?
Kommt auf die Regie an, aber nein, in unserer Inszenierung hab ich das nicht mitgekriegt. Darum bittet Macbeth doch Lady Macbeth, die Gäste zu begrüßen: Er ist abgelenkt, steht in der Tür und redet mit den Mördern, und sie muss die Party am Laufen halten.
Außerdem, einer der Mörder hat Blut im Gesicht. Wenn Lady Macbeth die Kerle bemerkt hätte, hätte sie doch gesagt: Was ist da los, zum Teufel, was hat der da?
Banquos Geist erscheint Macbeth, der daraufhin durchdreht, und sie muss sein irrationales Verhalten entschuldigen.
Ja. Sie sagt: Kümmert euch bitte nicht um ihn. Der hat mitunter Muffensausen. Er kommt gleich wieder zu sich.
Und das alles, während sie aufpassen muss, dass ihnen das Bankett nicht um die Ohren fliegt. Wir denken gerade, na ist doch alles mehr oder weniger okay – keine Gespenster mehr –, als Macbeth plötzlich Banquo vor sich sieht und prompt seinen Drink verschüttet und Lady M den Gästen sagen muss:
LADY MACBETH
Ihr guten Herrn, das ist
Bloß wieder mal sein kleiner Tick, nichts weiter;
Nur uns verdirbt’s die angenehmen Stunden.
Da kannst du aber Gift drauf nehmen. Das ist doch ein wahres Höllenbankett, oder? Aber allerletzter Güte.
Sie muss doch wie auf glühenden Kohlen sitzen. Macbeth ist kurz davor, alles zu versauen, es fehlt nicht viel, und er plaudert alles aus –
O ja, er ist verdammt nah dran. Und beim Bankett stellt jeder Fragen. Sie muss die Gäste samt und sonders loswerden.
Und ich weiß noch, wie alle andern abgingen und Ian und ich alleine zurückblieben, und wir haben einfach bloß dagesessen … total geschafft … Lady Macbeth ist fix und fertig, emotional ausgezehrt. Macbeth ist erschöpft, aber er muss weitermachen – er ist in einer Tretmühle und ist entschlossen, seine Spuren zu verwischen: Nichts wird ihm im Wege stehen. ›Wir fangen grad erst an‹, sagt er. Und sie sagt gar nichts. Sie kann nicht. Weil sie weiß, wie tief die Kluft ist zwischen ihnen und dass nichts mehr drin ist. Für sie als Paar.
Oder für sie selbst. Sie hat Macbeth dazu gebracht, Duncan zu ermorden, weil sie dachte, das sei alles, mehr brauche es nichts. Aber ihm hat das nicht gereicht, und jetzt kann sie nicht mehr weiter mitmachen. Also macht er alleine weiter, weiter, immer weiter, wird immer gieriger und immer ehrgeiziger, und sie bleibt zurück – alleine. Alles hin.
Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb sie stirbt. Von ihrer Ehe ist nichts mehr übrig, darum muss man auch auch so deutlich zeigen, wie wunderschön diese Ehe am Anfang ist.
Manche Leute finden ja, dass Lady Macbeth zwischen dieser Stelle hier und der Schlafwandelei noch eine Szene haben müsste.
Ja, das hab ich auch schon gehört – ich glaube, es war Dame Edith Evans, die das gesagt hat. Aber ich hab es nie so empfunden, weil hier der Anfang ihres Untergangs signalisiert wird, am Ende der Bankett-Szene, und das ebnet den Weg für die Schlafwandelei.
So – wir sind in Dunsinane. Ein Arzt tritt auf mit einer Kammerzofe.
Ach du dickes Ei, die Zofe, die Kammerfrau – hält schön den Mund. Sie muss doch schreckliche Dinge mitangehört haben. ›Der Than von Fife, der hatte ’n Weibs, wo ist sie jetzt?‹ Die Kammerfrau muss doch denken: Was soll denn das heißen? Sie hat diese Worte Nacht für Nacht gehört. Lady Macbeth schläft nackig.
Sie schläft nackt?
Mmmm. Steht auf, zieht sich ein Nachthemd über, schreibt einen Brief, versiegelt ihn, zieht ihr Nachthemd aus und legt sich wieder ins Bett. [Lacht.]
Das einzige Licht, das wir hatten, war eine Kerze, die ich in der Hand hielt. Lady M. hat jetzt Angst vor der Dunkelheit. Und nicht zu fest einwickeln. Bei der allerersten Vorstellung am Courtyard Theatre gab’s ein Gewitter, weil, ich werde nie vergessen, wie der Wind unter der Tür durchpfiff und die Kerze tropfte, und diese langen flackernden Schatten, die an der Wand hochkrochen. Und wie das Blechdach klapperte. Später in der Garderobe haben wir gesagt »Special Effects: der Herrgott.«
Sehr gute Szene, gut platziert. Sie spielt ihre größten Hits, nicht wahr? ›Jetzt Schluss damit, mein Lord, jetzt Schluss damit; mit deinen Zuckungen verdirbst du alles‹ – das ist das Bankett. ›Doch wer hätt denn gedacht, dass in dem alten Mann noch so viel Blut drin ist‹ – das ist nach dem Mord. Sie kommt gar nicht darauf, dass sie sich verdächtig macht.
Lady Macbeth sagt: ›Hier riecht es noch nach Blut. Arabiens Wohlgerüche allesamt können nicht duftend machen diese kleine Hand. Oh! oh! oh!‹
Ich hab aus den drei Oh einen langen Schrei gemacht. Später wird Macbeth die Mitteilung erhalten: ›Die Königin, Mylord, ist tot.‹ Und für das Publikum darf das nicht überraschend kommen. Deshalb kannst du bei dieser Szene auch nicht einfach auftreten, ziemlich unvermittelt so ein bisschen schlafwandeln, dann abgehen und auf einmal sterben. Am Ende dieser Szene darf das Publikum absolut keinen Zweifel haben, dass Lady Macbeth wirklich den Löffel abgegeben hat. Darum hab ich die drei ›Oh‹ zusammengezogen. Um zu zeigen, dass da nichts mehr ist. Weg. Komplett. Ein großer, langer Schrei der Leere. Es ist das Geräusch eines Herzens, das bricht.
Aber wie bist du auf diese Idee gekommen? Weil, der Arzt sagt doch: ›Was war das für ein Seufzen?‹
Ich hab dem Kollegen, der den Arzt spielt, überlassen, was er daraus macht. [Lacht.] Also ich meine Seufzen, Schreien, seinen letzten Schnaufer tun. Weil, es ist doch nicht geschrieben wie ein Seufzen. Da steht ›Oh! oh! oh! – Das ist doch kein Seufzen.
Das ist doch fantastisch, wie er das geschrieben hat, findest du nicht auch? Der reinste Thriller. Ihre letzten Worte sind: ›Zu Bett, zu Bett, zu Bett, zu Bett, zu Bett, zu Bett.‹ Ich hab das immer wieder wiederholt, während ich abging. Sie sehnt sich nach Schlaf.
Und nachdem es am Courtyard Theatre durch war?
Haben wir’s am großen Haus gemacht, und das war eine Katastrophe. Die haben direkt um den hinteren Teil der Bühne herum Sitze eingebaut, wollten es dadurch intimer machen, aber das Theater war zu groß, da ist uns alles zerfasert.
Und dann haben wir es am Young Vic gespielt. Und da kam John Woodvine angerannt und hat gerufen: ›Wir wolln uns treffen und / erforschen dieses blutige Werk‹. Ich glaub, das war’s, was er gesagt hat. Also jedenfalls war’s ein Vers, der nach dem Mord kommen soll, und der Mord war ja noch gar nicht passiert. [Lacht.] Ian und ich – o Gott, es hat nicht viel gefehlt – das kommt durch diese irrsinnige Intensität; wenn du erst mal anfängst zu lachen, kannst du einpacken – [lacht] – dann kannst du echt einpacken. Aber irgendwie haben wir’s hingekriegt.
Findest du die Komödien eigentlich schwieriger zu spielen als die Tragödien?
Ich finde, das ist alles verdammt schwer. Ja, die Komödien sind schwer, weil, du kriegst einen Lacher, und in der nächsten Vorstellung kommt dieser Lacher nicht, und du denkst: Was hab ich falsch gemacht? Die Leute sollen doch lachen, und wenn sie’s nicht tun, dann ist es keine richtige Komödie, oder?
Wenn du in einer Komödie mitspielst, sitzt du normalerweise in der Garderobe und heulst dir die Augen aus, und bei einer Tragödie kannst du dich oft scheckiglachen, reißt Witze und gackerst die ganze Zeit – wie damals, als wir Macbeth am Courtyard gespielt haben. Wir waren zusammen in einem Kabuff, wir vier Mädels (ich und die drei Hexen), und machten uns fertig, aber es ging zu wie bei einer Horde pubertierender Schulmädchen. Ich weiß noch, wie wir die Hosen hochgeworfen haben und sie an der Decke kleben blieben. Wir haben uns allesamt entsetzlich schlecht benommen. Aber wenn dann die Vorstellung losging und wir uns in diesem Kreidekreis auf unsere orangenen Apfelsinenkisten gesetzt hatten – weißt du, da war der Schaum weg vom Bier, und sofort war die Konzentration da.
Stimmt’s, dieses Stück hat es dir angetan?
Ich liebe es. So schön gebaut, Wahnsinnsplot, tolle Rolle, gute Erinnerungen – ich hab noch so viel davon im Gedächtnis. Kurz, keine Pause, und dann ab ins Pub – ins Dirty Duck in Stratford: himmlisch.
STRATFORD-UPON-AVON
Mit Stratford-upon-Avon verbindet dich eine lange Geschichte. Wann warst du das erste Mal dort?
1953 mit meinen Eltern, ich war gerade achtzehn, wir wollten Michael Redgrave als König Lear sehen, und da hatte ich so ein Erweckungserlebnis. Bis dahin hatte ich immer davon geträumt, Bühnenbildnerin zu werden, aber als ich Robert Colquhouns Bühnenbild für Lear sah, war mir klar, dass ich etwas so Fantastisches niemals zustandebringen würde.
Es war so sparsam und so vollkommen – es sah aus wie ein großes dickes Papadam mit einem hohen Felsen, und wenn es gedreht wurde, konnte es den Thron darstellen oder ein Bett oder eine Höhle. Nichts war in Reserve für einen Szenenwechsel – alles war da und direkt vor dir, wie ein Zauberkasten, der darauf wartet, geöffnet zu werden.
Wir blieben über Nacht in Stratford, und am nächsten Nachmittag saß ich mit meinen Eltern am gegenüberliegenden Flussufer, vis-à-vis vom Theater. Es war Sommer, im Theater standen alle Türen und Fenster sperrangelweit offen, und wir konnten über die Lautsprecheranlage die Nachmittagsvorstellung hören und sahen die Schauspieler treppauf, treppab zu ihren Garderoben rennen. Wie hätte ich damals ahnen sollen, dass ich zehn Jahre später selbst diese Bühne betreten würde, um Titania zu spielen.
Unter Schauspielern gibt es so einen Spruch, wer nach Stratford geht, um dort zu arbeiten, der beendet entweder eine Beziehung, oder er fängt eine an. Stimmt das?
Ja, das kann ich bezeugen – das Städtchen ist sehr romantisch und hat sein eigenes Ökosystem. Und früher, als es noch keine guten Verkehrsverbindungen gab, kam man sich dort schon sehr abgeschnitten vor. Und die Schauspieler sind alle weg von zu Hause, sie ackern wie die Wilden und spielen wie die Wilden.
Wo hast du eigentlich gewohnt, als du dort warst?
Scholar’s Lane, Chapel Lane, mal hier, mal dort. Und dann hab ich Mikey [Michael Williams] kennengelernt, und wir haben geheiratet, und nach ein paar Jahren haben wir beschlossen, uns in Charlecote, das ist gleich nebenan von Stratford, ein Haus zu bauen. Wir haben meiner Mutter (die da schon verwitwet war) und Mickeys Eltern angeboten, bei uns zu wohnen, und sie haben sich nicht lange bitten lassen. Es war immer schon mein Traum gewesen, in einer Gemeinschaft zu leben, das ist natürlich so ein altes Quäkerprinzip – und es hat sehr gut funktioniert.
Ich weiß noch, wie Mikey und ich einmal nachts aus dem Theater kamen und die Hampton Lucy Lane langfuhren; plötzlich sahen wir ein junges Reh, das dort spazieren ging und offenbar die Orientierung verloren hatte, wir hielten an, und irgendwie schafften wir es, das Tier wieder zurückzulocken in den Charlecote Park. Aber am nächsten Morgen stand plötzlich die Polizei bei uns vor der Tür, weil uns anscheinend jemand beobachtet hatte, der dachte, wir wollten es stehlen. (Ich glaube, es war genau dieselbe Stelle, wo man Shakespeare einmal beim Wildern erwischt hat.) Wir haben erklärt, dass wir das Kerlchen nicht rausholen wollten, sondern es wieder reingebracht haben, und da haben sie uns glücklicherweise vom Haken gelassen.
Nach Charlecote fahr ich immer noch sehr gern, wann immer sich eine Gelegenheit bietet. Wir haben zehn Jahre dort gewohnt. Fint [Judis Tochter Finty Williams] ist dort aufgewachsen. Und auf dem kleinen Kirchhof dort ist Michaels Grab.
Was sind deine schönsten Erinnerungen an deine Zeit in Stratford?
Ach, so viele: die Stücke und die Ensembles; die Touristen und die Schwäne; die durchgemachten Nächte im Dirty Duck; der Morgennebel auf dem Avon. Ich bin immer so gern am Ufer entlanggegangen, wegen der Weiden, die so tief hinunterhingen, dass ich mich bücken musste, um darunter durchzulaufen. Trevor Nunn hat sich sehr amüsiert, als ich ihm einmal erzählt habe, dass dieser kleine Pfad der einzige Ort auf der Welt ist, wo ich mir groß vorkomme, weil ich den Kopf einziehen muss. Du weißt doch, welche Stelle ich meine, oder? In den Bancroft Gardens. Dort gibt es auch eine Hängebirke, die zu Ehren von Vivien Leigh gepflanzt worden war, und am Fuß des Baumes ist ein Stein, auf dem steht ›A lass unparalleled‹, und ja, sie hatte in der Tat nicht ihresgleichen, diese Maid.
Und dann die Mop Fair, der Jahrmarkt, der einmal im Jahr in Stratford ist. Als Fint noch ganz klein war, sind Mikey und ich mit ihr auf dem Octopus gefahren, und als wir ausgestiegen sind, hat Finty geheult, und ihr war ganz doll schlecht. Und ich musste von da aus gleich zum Courtyard rüber rennen und Lady Macbeth spielen; ich weiß nur noch, dass ich am Ufer langgetorkelt bin und mich an allem festhalten musste, was da rumstand; in meinem Kopf hat sich alles gedreht. Die Vorstellung dürfte eine sehr wacklige Angelegenheit gewesen zu sein.
Wie war noch die Geschichte mit dem Mann, der bei euch daheim in London ein Paket abgeben wollte?
Ach, der war so süß. Ich hab die Tür aufgemacht, und er schien ganz erfreut, mich zu sehen. »Ich kenne Sie«, sagte er, »Ich hab Sie in Stratford-upon-Avon gesehen in – ähm …« Und ich: »Macbeth?« »Nein, nein, nicht Macbeth.« »Viel Lärm um nichts?« »Nein, nicht Viel Lärm.« »Cymbeline?« »Nein, auch nicht in Cymbeline: im Mayflower Restaurant.« [Lacht.]
Warst du mal in der Trinity Church, wo Shakespeare begraben ist?
Andauernd. Und in der Guild Chapel: In die Kathedrale bin ich vor jeder Pressevorstellung gegangen – einfach nur still dasitzen, meine Nerven beruhigen. Sie ist ja unmittelbar neben der Schule, auf der Shakespeare war, und direkt vis-à-vis von New Place, wo er gewohnt hat – zur damaligen Zeit muss sie genau in der Mitte der Stadt gewesen sein. Ich liebe diese Kathedrale. Sie war früher weiß getüncht mit einfachen Holzbänken, aber seit man sie restauriert hat, ist sie viel schicker.
2022 bist du mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt Stratford ausgezeichnet worden. Dieser Preis ist seit der ersten Verleihung an den Schauspieler David Garrick im Jahre 1768 erst sechs Mal vergeben worden.
Das war so eine große Ehre. Wir haben ihn beide bekommen, Ken [Kenneth Branagh] und ich. Das heißt, wir dürfen jetzt straflos unsere Schafe durch die Stadt treiben. Nach der Zeremonie im Rathaus mussten wir uns draußen fotografieren lassen. Die Organisatoren hatten dafür gesorgt, dass ein paar Schafe da waren. Ich wurde dann nach oben auf einen Balkon geleitet, wo ich eine Rede halten sollte, und ich hab gedacht, dass ich ein paar nette Lacher ernten kann, aber die hat alle mein vierbeiniger Freund abgegriffen, weil er geblökt hat.
[Lacht.]
Du liebst Stratford, stimmt’s?
In all meinen Erinnerungen ist Stratford der Ort, wo mein Herz ist. Dort fühle ich mich geerdet. Bei so vielem, worüber Shakespeare in seinen Stücken spricht, kann man Bezüge zu der Landschaft rund um Stratford sehen. Man sieht den Wald von Arden, den er in seiner Fantasie gesehen hat, man weiß, er war auf dieser Schule, hat an diesem Fluss gespielt, ging Anne Hathaway in Shottery besuchen und aus dem Haus in der Henley Street ist er abgehauen. Als ich 1962 nach Stratford kam, um Titania zu spielen, hab ich sofort gewusst, hier will ich sein.
EIN SOMMERNACHTSTRAUM
Titania
Im Sommernachtstraum hast du die 1. Elfe gespielt und Hermia – und natürlich Titania.
Tits, oh ja – Tits andauernd. Tits in der Schule – also in York, auf der Mount[1] – mit vierzehn, und ich trug ein abgelegtes Abendkleid von irgendjemandem, wo vorn was draufgenäht war. Die Regisseurin war die selige Mrs Mac [Kathleen Macdonald], die mit Gielgud am Old Vic gewesen war. Eine überaus inspirierende Lehrerin.
Ich hab die Titania aber auch dreimal professionell gespielt, immer in der Regie von Peter Hall. Mit dem Sommernachtstraum hat unsere Arbeitsbeziehung angefangen, und sie ging auch damit zu Ende, das Stück war meine erste Zusammenarbeit mit ihm und auch die letzte.
Das erste Mal spielte ich Titania 1962 an der Royal Shakespeare Company in einer älteren Inszenierung von Peter, die ich in den Fünfzigerjahren mit Mary Ure als Titania gesehen hatte (Mary war auf der Mount ein paar Klassen über mir gewesen, daher kannte ich sie). Das Bühnenbild von Lila de Nobili war absolut fantastisch. Die Eröffnungsszene spielt in einem großen Saal mit zwei geschwungenen Treppen, die rechts und links eines in der Mitte befindlichen Portals nach oben führen. Als dann die Verwandlung zum Wald kam, senkte sich vorn über die ganze Breite der Bühne ein beleuchteter Gazeprospekt herab, hinter dem der Wald erschien, und Ian Holm kam als Puck zwischen den Bäumen hindurch auf uns zugerannt. Ein absolut magisches Bild.
Mein Kostüm war elisabethanisch, mit so einem Wagenrad von Kragen. Und meine Perücke war in Paris aus Yakhaar angefertigt worden. Das Mieder hatte Fischbeinstäbchen – die Farbe dunkelbraun – und der weite Rock war hauchdünn und an den Knien abgewetzt und mit Mottenlöchern. Unsere Füße waren dreckig und nackt, wodurch wir uns ätherisch und zugleich als Erdenwesen fühlten, und man konnte gut rumrennen (damals hatte ich noch nicht die Neigung, ständig hinzufallen). Und bei jedem Auftritt schnupperten wir immer erst mal in die Luft – wir waren ja Waldwesen.
Sechs Jahre später haben wir die Inszenierung verfilmt, im Compton Verney House, das damals eine Ruine war. Peter wollte die Bühnenkostüme nicht benutzen, weil sie ihm vor der Realität der Landschaft zu theatral wirkten, also waren die Elfen alle grün geschminkt und trugen weiter nichts als einen G-String, und hier und da hatten sie ein paar Blätter angeklebt. Mein Kostüm wurde jeden Morgen frisch gepflückt.
Weißt du, wie ich mich vor Würmern ekle? Also an einer Stelle wollte Peter, dass ich mich vor ›Weckt mich ein Engel hier vom Blumenbett?‹ auf den Boden lege. »Judi«, hat er gesagt, »du bleibst mal kurz schön still hier liegen, bis wir alles vorbereitet haben.« Die haben eine Ewigkeit gebraucht, bis sie die Blumen und die ganzen Blätter auf mir verteilt hatten – eine Ewigkeit – und dann mach ich die Augen auf und gucke an mir runter und sehe einen Wurm an meinem Fuß. Da bin ich aufgesprungen und hab alles ruiniert. Danach durfte Titania Gummistiefel tragen.
Wie war noch mal diese Geschichte mit dem Feuerwehrmann in Compton Verney?
Während des Drehs hat es fast jeden Tag geregnet. Aber an dem einzigen Tag, an dem Peter Regen brauchte, kam die Sonne raus, und wir mussten die Feuerwehr rufen, damit sie uns mit Wasser bespritzt. Wir haben die ganze Sequenz im Regenmantel geprobt, und wenn Peter »Action« rief, haben wir die Dinger schnell auf den Boden fallen lassen, und dieser junge Feuerwehrmann, wie der uns da fast splitternackt sieht … da ist dem der Schlauch aus der Hand gerutscht. Alles voll Wasser.
In Compton Verney gab es keine Duschen, also musste ich jeden Abend in voller Maske heimfahren in mein Cottage in Ettington. Ich hatte meine eigenen Sachen an – Hosen und ein Polohemd – aber Hände und Gesicht waren immer noch grün. Einmal ist ein Mann vor Schreck von der Leiter gefallen, als er mich den Weg lang kommen sah.
2010 hast du Titania noch mal am Rose Theatre in Kingston upon Thames gespielt. Das war eine ziemlich konzeptuelle Inszenierung.
Peter hatte diese Idee, dass ich sie als Elisabeth I. spielen sollte. Er rief an und sagte: »Ich hab da so eine Idee – eine Titania, die in deinem Alter ist« – ich war damals fünfundsiebzig. »Eine Schauspielertruppe erscheint an ihrem Hof, sie verguckt sich in den jungen Mann, der den Oberon gibt, und beschließt ganz dreist, dass sie die Titania spielt.«
Ich verstehe den Gedanken hinter diesem Konzept. Ältere Frau, jüngerer Mann, das assoziiert Elisabeth und Essex, und es gibt im Stück ja auch Anspielungen auf Elisabeth, die ›Vestalin, die im Westen thront‹ etc. Und Edmund Spenser hatte natürlich auch Elisabeth vor Augen, als er seine ›Feenkönigin‹ schrieb. Und war es schwierig, Titania durch das Prisma von Elisabeth I. zu spielen?
Ich hab das einfach so gespielt, wie ich mir dachte, dass sie es spielen würde. Keine Ahnung, ob das aufgegangen ist, das müssen andere entscheiden, aber wenn Peter gesagt hätte, er möchte, dass ich sie als großen blauen Plüschhasen spiele, hätte ich’s wahrscheinlich auch probiert. [Lacht.] Es gibt nicht die eine richtige Art, Shakespeare zu spielen. Darum werden die Stücke ja immer wieder gemacht. Peter hat sich für eine bestimmte Interpretation entschieden, und wenn es den Leuten gefällt – wunderbar. Und wenn es ihnen nicht gefällt, auch gut – sie müssen ja hinterher nicht mehr weiter drüber nachdenken.
Und wie spielt man die Elfenkönigin?
Gar nicht. Man spielt die Situation. Man hofft, dass man richtig aussieht, und den Rest erledigt dann der Text.
Titania sieht sich selbst ja nicht als Elfenkönigin – außer wenn es ihr nützt. Titania und Oberon sind ein zerstrittenes Paar, das zufällig Königin und König im Reich der Feen ist. Deine Aufgabe als Schauspielerin ist es, das Menschliche darin zu finden: etwas, womit das Publikum sich identifizieren kann. In diesem Fall sind das zwei Menschen, bei denen buchstäblich die Hütte brennt.
Und wie spielt man Status –
Der Status wird durch die Haltung gesetzt, mit der die anderen einem begegnen. Titania hat ja ein Gefolge, es sind die Leute um sie herum, die ihr den Status geben. Das ist wie – ich glaube, es war Tyrone Guthrie, der zu Ian Holm gesagt hat, als dieser Heinrich V. spielte: »Achte immer darauf, dass dir niemand näher kommt als einen Meter zwanzig.« Es geht nur darum, wie die anderen dir gegenüber agieren, das ist alles. Das gibt dir die Macht.
Shakespeares Globe hat hinten auf der Bühne drei Zugänge – zwei Seitentüren und ein viel größeres Mittelportal. Das Mittelportal war Leuten von Macht und Ansehen vorbehalten – Königen und Königinnen, Gräfinnen und Prinzen. Und Shakespeares Narren traten auch durch die Mitte auf, weil sie den Mächtigen die Wahrheit sagten.
Das mit den Narren hab ich nicht gewusst – interessant. Ich weiß, dass Titania und Oberon von der Seite auftreten, weil das in der First Folio als Regieanweisung steht: Auftritt der König der Elfen mit seinem Gefolge von einer Seite, und von der anderen die Königin mit ihrem Gefolge. Das zeigt, dass sie entzweit sind, im Streit liegen. Und wie nicht anders zu erwarten, gehen sie am Ende, wo man sie wieder harmonisch vereint sieht, zusammen durch die Mitte ab.
Ganz genau. Wir treffen sie also zum ersten Mal, als sie sich im Wald begegnen?
Ja. Sie will da draußen ein bisschen umherflattern, und plötzlich steht Oberon vor ihr.
OBERON
Schlecht trifft’s im Mondschein sich, stolze Titania.
TITANIA
Wohl eifersüchtig, Oberon? Elfen, wir gehen.
Hab seinem Bett und Umgang abgeschworen.
In meiner Schulaufführung auf der Mount durften wir nicht das Wort ›Bett‹ sagen. Zu schlüpfrig. Da hieß es dann bloß noch ›Ich habe seinem Umgang abgeschworen.‹ Die Sache mit der ›verliebten Phillida‹ mussten wir auch weglassen, glaube ich. In dem Stück geht es ständig um Sex, an einer Quäkerschule musste da so einiges gestrichen werden. Titania und Oberon sind richtig scharf aufeinander. Rattenscharf. Da geht’s die ganze Zeit nur um das eine. Das kommt in keiner Inszenierung raus, nicht wahr? Eigentlich müssten die Elfen in einer Tour poppen. [Lacht.]
Titania und Oberon werfen sich gegenseitig Untreue vor, und dann hat sie diesen wundervollen Monolog.
›Das reimt sich deine Eifersucht zusammen.‹ Sie ist außer sich vor Wut. Weil sie ihm nicht entkommen kann. Egal, wo sie hingeht, auf einen Berg, an einen Strand, auf eine Wiese – er taucht überall auf und sucht Streit. Und was ist die Folge ihres Krachs? Dass die ganze Welt auf dem Kopf steht. Er ist kataklystisch. Es gibt giftige Nebel und Krankheiten, Fluten im Sommer, Hitzewellen im Winter, die Tiere sterben, die Ernten verrotten auf den Feldern, und an allem sind die beiden schuld. Sie machen, dass die Welt zugrunde geht. An ihren Differenzen. Das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung dessen, was wir gerade im Hinblick auf unseren Planeten erleben. Schmelzende Polkappen, Überflutungen und Klimawandel.
Ich hab mal gehört, dass man so einen langen Monolog in drei Abschnitte unterteilen kann: These (das Argument wird behauptet), Antithese (das Argument wird hinterfragt) und Synthese (es gibt etwas wie eine Lösung, wobei diese auch eine weitere Frage sein kann).
So hab ich mir das noch nie überlegt, aber es ist bestimmt richtig. Wichtig ist, dass man auf keinen Fall eine Leuchtkugel hochschießen sollte, die ankündigt: Achtung, jetzt kommt ein großer Monolog. Das ist fatal, weil, dann schalten die Zuschauer gleich ab. Man muss sie überraschen. Und das tun man, indem man die Geschichte erzählt und das Argument spielt, indem man jeden Gedanken Zeile für Zeile aufdeckt, als ob er einem gerade eben eingefallen ist.
Findest du die Geschichte mit dem indischen Knaben eigentlich verwirrend? Manchmal fehlt er in einer Aufführung, und dabei ist er doch der Grund, weshalb Titania und Oberon sich überworfen haben.
Also ich würde ja sagen, der Grund für ihr Zerwürfnis ist die Eifersucht. Oberon will den kleinen indischen Knaben in seinem Gefolge haben. Und Titania sagt nein: ›War seine Mutter doch aus meinem Orden … / Um ihretwillen geb ich ihn nicht her.‹ Und das ist für Oberon der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Er ist eifersüchtig, weil sie dem Kind so viel Aufmerksamkeit schenkt.
Aber er ist auch eifersüchtig auf ihre Beziehung zu Theseus. Und das ist sexuelle Eifersucht. Andererseits hatten sie ja beide ihre Seitensprünge – er ist mit Hippolyta fremdgegangen und sie mit Theseus. Titania ist wie ein Sukkubus – einer dieser weiblichen Dämonen, die die Männer in ihren Träumen verführen.
Oberon willigt ein, sich mit Titania zu versöhnen, wenn sie ihm den indischen Knaben überlässt.
Titania sagt, er kann ihr mal im Mondschein begegnen. Die Mutter des Knaben stand ihr sehr nah, und als sie starb, nahm sich Titania seiner an. Er ist wie ein Sohn für sie, um nichts auf der Welt würde sie ihn hergeben.
Oberon, vergrätzt, weil sie ihn hat abblitzen lassen, fragt sie: ›Wie lange bleibst du hier im Walde noch?‹ Und sie entgegnet: ›Bis Theseus Hochzeit feiert, denk ich doch.‹ Böses Mädchen. Er hat ihr bereits unterstellt, dass sie mit Theseus schläft, und sie deutet an, dass sie, eh er heiratet, noch ein letztes Schäferstündchen mit ihm haben könnte. Sie provoziert Oberon.
Titania hat eine Menge Text in dieser ersten Szene. Wie verhindert man, dass das wie ein einziges langes Gezeter rüberkommt?
Man vertraut dem Regisseur, dass er einem schon sagen wird, wann man aufhören soll zu zetern. Außerdem, sich streiten heißt doch nicht unbedingt, sich die ganze Zeit gegenseitig Schmähreden an den Kopf zu werfen. Vielleicht möchte man ja auch mit seinem Gegenüber verhandeln oder den anderen necken oder ihn besänftigen. Ein langer Monolog besteht aus so vielen unterschiedlichen Schattierungen. Zum Beispiel kann man mitten im wildesten Streit unglaublich ruhig werden. [Wird ruhig.] ›Jetzt hör mir doch mal zu … das Problem ist … du hörst … einfach nicht zu.‹ So könnte man das sprechen. Und so einen Ton könnte Titania anschlagen, wenn sie erklärt, warum sie das Kind nicht hergibt.
Mein alter Schauspiellehrer hat immer gesagt, ein Monolog ist ein Dialog, bei dem die andere Person einfach nichts sagt.
Das gefällt mir sehr gut. Weil, wenn man will, dass einem jemand zuhört, muss man beobachten, was er tut, und sein Verhalten bringt einen dann dazu, sich selbst zu ändern. Die meisten Menschen denken, Zuhören ist das, was man tut, wenn man nichts zu sagen hat, dabei hört man oft zu, während man selber spricht und beobachtet den anderen – um seine Reaktionen einzuschätzen und zu sehen, ob man noch weiter auf ihn einreden muss.
Man reagiert also auf das, was einem angeboten wird?
Ja. Wenn ich dich zum Beispiel ärgern wollte – was ich bestimmt irgendwann mal getan habe –
Allerdings hast du das.
Was! Wann hab ich dich geärgert?
Als du diese Kerze ausgepustet hast, da hast du mir das ganze Jackett mit Wachs bekleckert. Und dann wolltest du das Wachs mit Löschpapier und einem heißen Bügeleisen wegmachen, und dabei hast du die Revers versengt.
[Lacht.] Ach ja, das hatte ich ganz vergessen.
Also stell dir vor, du bist aus dem Zimmer gerannt, ich hätte dir hinterherrennen können und sagen [streng]: ›Herrgott noch mal, Brendan, hör gefälligst zu, wenn ich mit dir rede.‹ Oder ich hätte sagen können [in sanftem Ton]: ›Hast du gehört, Brendan? Das war ein Versehen. Ich bezahl dir das Jackett.‹
Das sind unterschiedliche Taktiken. Es ist eine andere Haltung. Vielleicht nicht so durchdacht wie eine Taktik – es ist einfach eine andere Art, etwas auszudrücken, zu versuchen, die eigene Sicht rüberzubringen und bei dem anderen eine Veränderung zu bewirken.
Gut. Wollen wir jetzt mal weitergehen? Ich glaub, wir haben diese Szene ausreichend besprochen.
Ausreichend? Ich würde sagen, wie haben sie erschöpfend behandelt. Ich bin fix und fertig.
Du bist fix und fertig, weil du immer, wenn ich eine Zeile sage, gleich den ganzen Monolog runterratterst. Und danach machst du weiter, bis zum Ende der Szene, und dabei spielst du alle Rollen. Du bist wie Zettel.
[Lacht.] Das ist, weil ich das Stück so oft gespielt hab und den ganzen Text auswendig kann. Und wenn ich einmal angefangen habe, kann ich nicht wieder aufhören.
Also was kommt jetzt? Titanias Laube und ›Kommt, einen Reigen und ein Feenlied‹, wo sie ihre Elfen bittet, sie in den Schlaf zu singen?
TITANIA
Dann fort mit euch aufs Drittel der Minute:
Ihr killt die Würmchen in den Moschusrosen,
Und ihr ringt mit den Fledermäusen um
Die Flügel für die Elfenledermäntel …
Auf einmal sind wir tief im Elfenwald, wo alles klitzeklein ist. Und Shakespeare gibt uns ein Mikroskop und zeigt uns, wie winzig dort alle sind, im Verhältnis zur Natur. ›Nun husch, an eure Dienste, lasst mich ruhn.‹ Schlafenszeit für die Elfen. Die Mount School war ja ein Internat, da haben sie uns nach dem Frühstück immer verschiedene Aufgaben gegeben, die wir überall im Haus erledigen mussten – Aufräumen, Staubwischen, Waschbecken schrubben, Bettenmachen, so was alles – und das hieß damals auch Dienste. Das fällt mir immer ein bei diesem Vers.
Titania macht also ein Nickerchen. Der Zweite Elf sagt:
ZWEITER ELF
Los jetzt alle, alles gut.
Einer Wache stehen tut.
(Ich hab immer noch im Ohr, wie Maggie [Margaret] Drabble, die Romanschriftstellerin, das gesagt hat. Sie hat das auf der Mount gespielt und dann noch mal 1962 an der Royal Shakespeare Company.) Und dann wird der Erste Elf entführt – so haben wir das jedenfalls in unserer RSC-Inszenierung gemacht – entführt von Ian Richardson und Ian Holm, den beiden bösen Buben mit den spitzen Ohren. Die Elfen hatten alle solche kessen spitzen Ohren.
Und dann träufelt Oberon Titania den Liebessaft auf die Augenlider.
Dieser blöde Liebessaft – sehr stark – Liebessaft vom Elfenschwarzmarkt.
Etwas später schlummert Titania in ihrer Laube selig und süß vor sich hin und hört Zettel singen, den Weber, der in einen Esel verwandelt ist. Seine Freunde sind alle ausgerissen, er ist ganz allein im Wald. Es ist dunkel, und er fürchtet sich, darum singt er vor sich hin und marschiert trotzig auf und ab [singt]: ›Die Amsel trägt die schwarze Tracht‹. Titania wacht auf und ist durch den Liebesaft augenblicklich in ihn verknallt. Sie meint, er sei das Schönste, was sie je gesehen hat.
In mehreren Kritiken zu der Inszenierung 2010 am Rose Theatre wurde der Ernst hervorgehoben, mit dem du diese Szene gespielt hast.
Natürlich, das ist doch auch ernst. Er