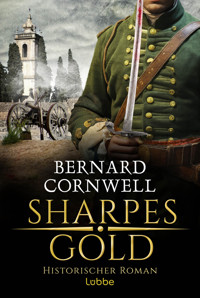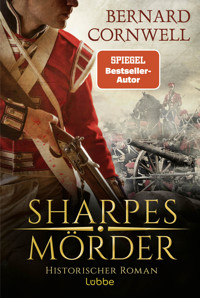
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Endlich: der erste neue SHARPE seit mehr als 15 Jahren!
1815. Der Staub der Schlacht von Waterloo hat sich noch nicht gelegt, noch sind nicht alle Opfer begraben. Lieutenant-Colonel Sharpe und seinen tapferen Riflemen ist dennoch keine Ruhepause vergönnt. Der Duke of Wellington hat erfahren, dass nach dem Untergang Napoleons und seiner Armee bereits ein anderer Feind im Verborgenen lauert - eine geheime Bruderschaft fanatischer Revolutionäre, die wild entschlossen sind, Rache zu nehmen. Er schickt Sharpe auf ein neues Schlachtfeld, ins Labyrinth der Straßen von Paris, wo die Linien zwischen Freund und Feind verwischen. Dort soll er einen gefährlichen Attentäter ausfindig machen und ihn vernichten - oder bei dem Versuch sterben ...
Wenn ein Mann das Unmögliche erreichen kann, dann Sharpe!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungTeil eins: Die ZitadelleKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4Teil zwei: Die StadtKAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10Teil drei: Der KampfKAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13EPILOGHISTORISCHE ANMERKUNGÜber dieses Buch
Endlich: der erste neue SHARPE seit mehr als 15 Jahren! 1815. Der Staub der Schlacht von Waterloo hat sich noch nicht gelegt, noch sind nicht alle Opfer begraben. Lieutenant-Colonel Sharpe und seinen tapferen Riflemen ist dennoch keine Ruhepause vergönnt. Der Duke of Wellington hat erfahren, dass nach dem Untergang Napoleons und seiner Armee bereits ein anderer Feind im Verborgenen lauert – eine geheime Bruderschaft fanatischer Revolutionäre, die wild entschlossen sind, Rache zu nehmen. Er schickt Sharpe auf ein neues Schlachtfeld, ins Labyrinth der Straßen von Paris, wo die Linien zwischen Freund und Feind verwischen. Dort soll er einen gefährlichen Attentäter ausfindig machen und ihn vernichten – oder bei dem Versuch sterben … Wenn ein Mann das Unmögliche erreichen kann, dann Sharpe!
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Reihe, die er in den 80er Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Historischer Roman
Aus dem Englischen vonRainer Schumacher
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2021 by Bernard Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Assassin«
Originalverlag: HarperCollingsPublishers
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2022/2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Rainer Delfs, Scheeßel
Titelillustration: © Collaboration JS/Arcangel | © Jordi Bru/Arcangel
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-2856-0
luebbe.de
lesejury.de
Sharpes Mörderist WHISKEY gewidmet,meinem wundervollen Hund,der mir bei elf BüchernGesellschaft geleistet hat und der,kurz nachdem ich dieses hier fertiggestellt habe,gestorben ist.
Teil eins
Die Zitadelle
KAPITEL 1
Da waren drei Männer auf dem Hügelkamm. Zwei lebten noch.
Einer der beiden, ein großer, schlanker Mann mit von der Sonne gebräuntem Gesicht, trieb eine Spitzhacke in die sture Erde. Die ersten zwölf Zoll waren leicht gewesen, doch der heftige Regen der vergangenen zwei Tage hatte die dicke Lehmschicht darunter nicht gelockert. Die Spitzhacke traf zwar hart, drang aber nicht tief ein. »Das wird den ganzen gottverdammten Tag dauern«, knurrte der Mann.
»Lassen Sie mich mal«, sagte der andere. Er war sogar noch größer, ein stämmiger, muskulöser Mann mit starkem irischen Akzent. »Nehmen Sie die Schaufel.«
»Nein, lass mich«, widersprach der erste Mann mürrisch und schlug wieder zu. Er hatte den Oberkörper frei gemacht und trug nur einen einfachen Strohhut, wadenhohe Stiefel und eine französische Kavalleriehose. Sein Hemd und seine grüne Riflejacke hingen an einem Baum in der Nähe zusammen mit dem schweren Kavalleriesäbel, einer ausgefransten roten Offiziersschärpe und einem Gewehr.
»Ich habe Ihnen doch gesagt, wir sollten das Loch im Tal graben«, sagte der größere Mann. »Da ist der Boden weicher.«
»Nein. Es muss hier oben sein, Pat. Dan hat schon immer die Höhe geliebt.«
»Ich werde Dan vermissen«, seufzte Patrick Harper wehmütig.
»Diese verdammten Froschfresser.« Die Spitzhacke sauste wieder herab. »Gib mir mal die Schaufel.«
»Ich schaufele«, sagte Harper. »Machen Sie Platz.« Er sprang in das flache Grab und begann, die lose Erde rauszuwerfen.
Der Offizier ging zum Baum und nahm sein Gewehr herunter. »Ich werde das mit ihm begraben«, erklärte er.
»Warum nicht sein eigenes Gewehr?«
»Weil seins besser ist als meins. Dan hätte sicher nichts dagegen.«
»Ja, er hat sich immer gut um sein Gewehr gekümmert. So viel steht fest.«
Dan Hagmans Leiche lag auf dem Gras. In dem Kampf, der am Tag zuvor auf dem Hügelkamm getobt hatte, war er von einem französischen Voltigeur erschossen worden. Die meisten Toten des Bataillons wurden in einem flachen Grab weiter unten bestattet, nahe dem Château de Hougoumont, wo noch immer der Rauch des Feuers emporstieg, das das Haupthaus zerstört hatte. Unweit des Châteaus brannte jedoch noch ein weiteres, größeres Feuer, und sein Gestank waberte den Hügel hinauf.
Der Offizier hockte sich neben Hagmans Leiche und berührte sanft das Gesicht des Toten. »Du warst ein guter Mann, Dan«, sagte er.
»Ja, das war er.«
Der Offizier mit Namen Richard Sharpe schnippte ein Stück Dreck von Dan Hagmans grüner Jacke. Ansonsten war sie sauber, und die Marketenderinnen des Bataillons hatten sie geflickt. Sharpe hatte derweil Hagmans Gesicht gewaschen, doch egal, wie sehr er auch geschrubbt hatte, die eingebrannten Pulverflecken auf Hagmans rechter Wange wollten einfach nicht verschwinden. »Wir sollten ein Gebet sprechen«, sagte Sharpe.
»Ja, wenn wir denn endlich tief genug gegraben haben«, knurrte Harper.
»Sprich du es. Du bist doch katholisch, oder?«
»Himmel, ich war schon seit zehn Jahren nicht mehr in der Kirche«, erwiderte Harper. »Ich bezweifle, dass Gott mir noch zuhört.«
»Bei mir weiß er noch nicht einmal, dass es mich gibt. Hat Dan eigentlich gebetet?«
»In jedem Fall hat er schön Kirchenlieder gesungen«, antwortete Harper. Er griff nach der Spitzhacke und trieb sie tief in die Erde. »Wir sind bald fertig«, sagte er und brach die Erde auf.
»Ich will nicht, dass die Füchse ihn wieder ausgraben.«
»Wir werden Steine auf ihn legen.«
Sharpe hatte ein Holzkreuz aus Brettern gebastelt, die er aus einem Munitionswagen herausgebrochen hatte. Mit einem rot glühenden Bajonett hatte er Dans Namen in den Querbalken gebrannt und schließlich »Rifleman« daruntergeschrieben. Jetzt bog er den Rücken durch, um die Schmerzen aus den Muskeln zu vertreiben, und starrte über das flache Tal hinweg zu den Orten, wo die Schlacht getobt hatte. Überall lagen Leichen, Männer und Pferde, und das Korn war entweder platt getrampelt oder vom Feuer der Artillerie verbrannt. »Gott, das stinkt«, knurrte Sharpe und nickte den Hang hinunter zu der Stelle, wo hinter Hougoumont ein weit größeres Feuer geschürt wurde. Männer trugen französische Leichen zu den Flammen und warfen sie hinein. Die englischen Toten wurden begraben, doch der Feind ging durch das Feuer in die Ewigkeit ein. Sharpe ließ das Holzkreuz fallen und schnappte sich die Schaufel.
»Da kommt ein Offizier«, warnte Harper.
Sharpe drehte sich um und sah einen Kavallerieoffizier auf sie zukommen. »Das ist keiner von uns«, bemerkte er und wandte sich wieder dem Erdreich zu, das Harper mit der Spitzhacke aufgebrochen hatte. Der näher kommende Offizier trug eine himmelblaue Hose und eine dunkelblaue Uniformjacke mit einer goldenen Schärpe. Auf Sharpe wirkte die Uniform unnatürlich sauber. Die Männer, die auf dem Hügelkamm gekämpft hatten, waren hingegen völlig verdreckt, ihre Uniformen voller Schlamm, dunkel von Blut und von Schwarzpulver verbrannt. Im Gegensatz dazu wirkte der junge Kavallerieoffizier elegant und glattpoliert.
»Der Mistkerl spricht mit Sergeant Huckfield«, sagte Harper. Misstrauisch beäugte er den Reiter, der neben einer Gruppe Rotröcke angehalten hatte, die gerade Musketen putzten, die sie auf dem Schlachtfeld eingesammelt hatten. Einer der Rotröcke deutete zu Sharpe. Sharpe fluchte, und Harper lachte. »Egal, wo Sie auch hingehen, Sie ziehen den Ärger magisch an, Sir«, bemerkte der große Ire.
Der elegant uniformierte Offizier wendete sein Pferd und ritt zu Sharpe und Harper. Als er sah, was sie da taten, verzog er das Gesicht. »Man hat mir gesagt, ihr wisst, wo ich Lieutenant Colonel Sharpe finden kann«, begann er. Er hatte eine klare Stimme, was zusammen mit seinem gestriegelten Pferd und der teuren Uniform von Geld zeugte.
»Sie haben ihn gefunden, Euer Ehren«, erwiderte Harper und betonte seinen irischen Akzent über Gebühr.
»Du – äh – Sie?« Der Offizier starrte Harper ungläubig an.
»Ich bin Colonel Sharpe«, meldete sich nun auch Sharpe zu Wort.
Wenn der Kavallerieoffizier es schon als unglaublich empfunden hatte, dass Harper ein Colonel sein könnte, so kam ihm die Vorstellung, dass Sharpe der Gesuchte war, geradezu absurd vor. Vermutlich lag das unter anderem daran, dass Sharpe ihm den Rücken zugekehrt hatte, sodass die Peitschennarben auf seinem Rücken deutlich zu sehen waren.
Sharpe schob seinen Strohhut in den Nacken und drehte sich zu dem Neuankömmling um. »Und Sie sind?«
»Captain Burrell, Sir. Ich gehöre zum Stab des Herzogs.«
»Lord Burrell?« Die Verachtung in Sharpes Stimme war nicht zu überhören.
»Einer seiner jüngeren Söhne, Sir.«
»Was kann ich für Sie tun, Burrell?«
»Der Herzog wünscht, Sie zu sehen, Sir.«
»Er ist noch immer in Waterloo?«
»In Brüssel, Sir. Wir sind heute Morgen dorthin geritten.«
»Ich muss das hier noch zu Ende bringen«, erklärte Sharpe und stieß die Schaufel wieder in die Erde. »Und ich muss mich rasieren.« Er hatte sich seit vier Tagen nicht mehr rasiert, und inzwischen waren die Stoppeln deutlich zu sehen.
»Der Herzog hat gesagt, es sei wichtig«, erwiderte Burrell nervös. »Er besteht darauf, dass Sie sich beeilen, Sir.«
Sharpe richtete sich auf. »Sehen Sie den Toten da, Captain?«
»Selbstverständlich, Sir.«
»Das war ein verdammt tapferer Soldat und ein guter Freund. Dieser Mann ist mit mir von Portugal bis nach Frankreich marschiert, und als er dann hier ankam, hat so ein Bastard von Voltigeur ihn einfach abgeknallt. Ich schulde ihm ein Grab, und ich zahle meine Schulden. Wenn Sie es wirklich so eilig haben, wie wäre es dann, wenn Sie von Ihrem hohen Ross steigen und uns helfen würden?«
»Ich werde warten, Sir«, sagte Burrell verunsichert.
Es dauerte noch eine weitere Stunde, bis das Grab ausreichend tief war, doch dann wurde Dan Hagman in die Erde hinabgelassen, und Sharpe legte sein eigenes Gewehr neben die Leiche und steckte die Finger des Toten durch den Abzugsbügel. Schließlich berührte er Hagmans von Pulver verbrannte Wange. »Dan, solltest du am falschen Ort landen, dann jag dem Teufel eine Kugel in den Leib. Sag ihm, die ist von mir.«
Sharpe stieg aus dem Grab und half Harper, Erde und Steine auf den Toten zu schütten. »Sprichst du ein Gebet, Pat?«
»Nein. Ich nicht, Sir. Wir brauchen jemanden, der Gottes Ohr hat. Statt zu beten, könnte ich genauso gut furzen.«
Sharpe grunzte. »Dann such jemanden, der ein Gebet sprechen kann, Pat, aber nicht Huckfield oder einen anderen verdammten Methodisten.« Er schaute zu Burrell hinauf, der auf dem Hügelkamm hin und her ritt. Er war sichtlich ungeduldig. »Was will der Herzog von mir?«, rief Sharpe ihm zu.
»Das sagt er Ihnen am besten selbst, Sir. Und er hat Eile angemahnt.« Burrell zögerte. »Sie mögen keine Methodisten, Sir?«
»Ich hasse die Bastarde«, antwortete Sharpe. »Die predigen mir ständig. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Das müssen sie mir nicht sagen. Nein, ich will einfach ein gutes Gebet für einen guten Mann.« Er schaufelte weiter Erde auf das Grab. Dann rammte er das schlichte Holzkreuz hinein. Just in dem Augenblick kam Harper zurück. Er hatte einen blassen, dünnen Jüngling im Schlepptau. »Wer zum Teufel bist du denn?«, fragte Sharpe den Jungen.
»Private Bee, Sir«, antwortete der Kleine nervös. Er sah keinen Tag älter als siebzehn aus, dürr wie ein Ladestock und mit langem schwarzem Haar. Auf seinem roten Rock waren weder Schlamm noch Pulverflecken zu sehen.
»Wir haben heute Morgen Ersatz bekommen«, erklärte Harper. »Sechsunddreißig Mann. Der kleine Bee hier ist einer davon.«
»Dann hast du die Schlacht also verpasst, ja?«, fragte Sharpe den Jungen.
»Ja, das haben wir, Sir.«
»Und da habt ihr Glück gehabt«, seufzte Sharpe. »Und du kennst ein Gebet, Bee?«
»Jawohl, Sir.«
»Dann sprich es, Junge. Das hier war ein guter Mann. Er hat hart gekämpft, und ich will, dass er in den Himmel kommt.«
»Jawohl, Sir.« Bee klang zunehmend nervös, als er an den Rand des Grabes trat und die Hände faltete. »Dormi fili, dormi«, begann er unsicher, doch dann fand er seine Stimme: »Mater cantat unigenito. Dormi, puer, dormi. Pater nato clamat parvulo.« Seine Stimme verhallte.
»Amen«, sagte Burrell in feierlichem Ernst.
»Amen«, sagte auch Sharpe. »Das klang gut, Bee.«
»Ich bin noch nicht fertig, Sir.«
»Ich bin sicher, das reicht. Für mich klang das wie ein Gebet.«
»Das hat mir meine Mutter beigebracht«, erklärte Bee. Er sah so zerbrechlich aus, dass Sharpe sich wunderte, dass er überhaupt eine Muskete halten konnte.
»Das hast du gut gemacht, Junge«, lobte ihn Harper. Er holte eine Flasche aus seinem Tornister und goss die Hälfte des Inhalts aufs Grab. »Ein paar Tropfen Brandy für deinen Weg in den Himmel, Dan.«
»Verdammt«, knurrte Sharpe wütend und wischte sich die Tränen aus den Augen. »Er war wirklich ein guter Mann.«
»Der Beste.« Harper nickte.
»Hol mein Pferd, Pat«, befahl Sharpe.
Private Bee schaute verwirrt drein.
»Ihr Pferd, Sir?«, fragte der Junge.
»Heißt du etwa auch Pat?«
»Er heißt Patrick, Sir.«
»Pat Bee«, sagte Sharpe amüsiert. »Sergeant Pat Harper kann das Pferd holen.« Harper war bereits unterwegs, und Sharpe schaute zu Burrell hinauf. »Ich bin in einer Minute bei Ihnen, Captain.« Er zog zuerst sein Hemd an und dann seine zerschlissene grüne Riflejacke. Sie war voller Blut- und Pulverflecken. Schließlich band er sich die ausgefranste rote Schärpe um den Bauch, schnallte den Säbel um und warf sich Hagmans Gewehr über die Schulter. Dann tauschte er den Strohhut gegen einen verbeulten Tschako, in dessen Mitte ein großes Loch zu sehen war, wo eine französische Musketenkugel ihn durchschlagen hatte.
Sharpe legte die Hände um den Mund und rief: »Captain Price!«
Harry Price erschien auf dem Hügelkamm. Dahinter lag ein Feld, und dort lagerte das Bataillon. »Sir?«
»Sie haben das Kommando. Ich muss nach Brüssel, und ich habe keine Ahnung, wann ich wieder zurück sein werde. Stellen Sie heute Nacht Wachen auf.«
»Glauben Sie, die Franzosen kommen zurück, Sir?«
»Nein. Die Hosenscheißer laufen noch immer, Harry, aber so sind die Regeln. Wachen.« Er schaute zu Bee. »Zu welcher Kompanie gehörst du, Bee?«
»Das hat man mir noch nicht gesagt, Sir.«
»Nehmen Sie ihn mit, Harry. Seine Statur schreit geradezu nach Leichter Infanterie.«
»Ja, leichter geht’s nicht, Sir«, erwiderte Price und musterte Bee von Kopf bis Fuß.
Sharpe gab Bee zwei Schilling für das gut klingende Gebet. Dann schwang er sich in den Sattel. Das Pferd hatte er einem französischen Dragoner abgenommen, und auf der grünen Schabracke war deutlich ein »N« in einem Lorbeerkranz zu sehen. »Kümmere dich um Nosey«, sagte Sharpe zu Harper.
»Nosey bekommt heute Abend frisches Pferdefleisch, Sir«, erwiderte Harper. »Und Charlie Weller kann sich um ihn kümmern. Ich komme mit Ihnen.«
»Das ist nicht nötig, Pat.«
»Ich komme mit«, erklärte Harper stur. Er lief los, um sein eigenes Pferd zu holen, dann ritt er Sharpe hinterher, der mit dem eleganten Kavallerieoffizier nach Westen trottete.
»Nosey?«, fragte Burrell amüsiert.
»Mein Hund.«
»Dem Herzog könnte dieser Name missfallen, Sir.«
»Der Herzog muss es ja nicht erfahren. Außerdem hat er mir schon ein Leben lang Befehle erteilt, da steht es mir wohl zu, es ihm mit Nosey ein wenig heimzuzahlen. So – was will der Herzog von mir?«
»Er besteht darauf, es Ihnen selbst zu sagen, Sir.«
Die drei Pferde trabten auf der Straße, die über den ganzen Kamm führte. Sie kamen an einer Gruppe von erbeuteten französischen Kanonen vorbei. Die Mündungen waren rußgeschwärzt, und als Sharpe nach rechts schaute, sah er, wo die Kaiserliche Garde den Hang hinauf angegriffen hatte. Dort war noch alles von Leichen bedeckt, die meisten dank der Bauern nackt, die des Nachts auf das Schlachtfeld strömten, um die Toten zu plündern.
»Waren Sie hier?«, fragte Sharpe den Captain.
»Ja, das war ich, Sir. Ich habe gesehen, wie Sie Ihr Bataillon den Hang hinuntergeführt haben. Das war gut gemacht.«
Sharpe grunzte. Seine Erinnerung an die Schlacht war eher verschwommen. Hauptsächlich sah er Bilder von dichtem Rauch, in dem die blau uniformierten Franzosen nur drohende Schatten gewesen waren. Aber er erinnerte sich noch genau an das Ende der Schlacht, als er sein Bataillon aus der Linie und in die Flanke der Kaiserlichen Garde geführt hatte, um sie mit mörderischen Salven einzudecken. »Das war pure Verzweiflung, Captain.«
»Und der Herzog hat Sie zum befehlshabenden Offizier ernannt.« Burrell nickte anerkennend.
»Vielleicht will er mir das Bataillon jetzt ja wieder abnehmen«, sagte Sharpe mürrisch.
»Das glaube ich nicht, Colonel«, erwiderte Burrell, auch wenn er alles andere als sicher klang. »Jedenfalls hörte es sich nicht so an. Was ist eigentlich mit Colonel Ford passiert?«
»Er hat den Verstand verloren«, antwortete Sharpe. »Der arme Mann.«
»Ja, der arme Mann.« Burrell lenkte sein Tier um die Kadaver von einem Dutzend französischen Pferden herum, die von Kartätschen mitten aus dem Herzen des französischen Kavallerieangriffs gerissen worden waren und nun in einem blutigen Haufen beieinanderlagen.
»Wie heißt der Ort hier eigentlich?«, fragte Sharpe.
»Nun, die Farm hier heißt Mont-Saint-Jean, aber der Herzog will die Schlacht nach der nächstgelegenen Stadt benennen: Waterloo.«
»Die Schlacht von Waterloo«, sinnierte Sharpe. Der Name klang irgendwie komisch für ihn. »Lassen Sie uns einfach hoffen, dass das die letzte Schlacht war, in der wir haben kämpfen müssen.«
»Amen, Sir, Amen«, erwiderte Burrell. »Aber wer weiß, was noch alles passieren wird, bevor wir Paris erreichen.«
»Paris?«
»Wir marschieren morgen los.« Burrell klang fast so, als täte ihm das leid.
»Nach Paris?«
»In der Tat, Sir.«
Als der Feldweg, der über den Hügelkamm führte, auf die Hauptstraße nach Brüssel traf, bogen sie nach links ab und trotteten an der Farm von Mont-Saint-Jean vorbei, vor der zwei Rotröcke immer wieder streunende Hunde von einem Berg von amputierten Armen und Beinen vertrieben, denn in der Farm arbeiteten die Feldschere. »Die meisten Verwundeten sind wieder in Brüssel«, erklärte Burrell und zuckte angesichts der blutigen Körperteile unwillkürlich zusammen. »Die armen Kerle.«
»Viele liegen noch draußen auf dem Feld«, bemerkte Sharpe. Bei Sonnenaufgang hatte er vier Kompanien losgeschickt, um Verwundete im Tal zu sammeln. Die anderen Kompanien hatten Gräber ausgehoben.
»Es war wirklich schlimm«, seufzte Burrell.
»Ja. Das Schlimmste, was ich je gesehen habe.«
»Und der Herzog hat mir gesagt, Sie hätten schon viel gesehen, Sir?« Der junge Kavallerieoffizier ließ das wie eine Frage klingen.
»Das hat der Herzog gesagt?«
»Und er hat auch gesagt, Sie seien ein bemerkenswerter Mann, Sir.«
Sharpe verbarg seine Überraschung. »Das war sehr nett von ihm«, brummte er.
»Und Sie waren mal ein einfacher Soldat, nicht wahr, Sir?«, fragte Burrell vorsichtig.
»Sie haben meinen Rücken doch gesehen, Captain. Haben Sie je auch nur davon gehört, dass man einen Offizier ausgepeitscht hätte?«
»Nein, Sir.«
»Ich habe mich 93 zu den Havercakes gemeldet«, erzählte Sharpe. »99 bin ich dann Sergeant geworden, und vier Jahre später habe ich mein Patent bekommen.«
»Und Sie haben einen Adler erbeutet«, fügte der Captain bewundernd hinzu, »in Talavera?«
»Aye«, bestätigte Sharpe.
»Wie haben Sie das gemacht?«, wollte Burrell wissen.
Sharpe schaute ihn an. Ein Jüngling, dachte er, mit frischem Gesicht und blauen Augen. Sharpe hatte den Eindruck, als sei Burrell erst zwei, drei Jahre aus der Schule. Aber er war ein kleiner Lord und deshalb schon Captain, und der Herzog förderte ihn. »Das waren Patrick und ich«, erklärte Sharpe und deutete zu Harper. »Wir haben uns mitten durch eine französische Kolonne gehackt. Gestern hätten wir das fast wieder gemacht, aber da waren einfach zu viele von den Scheißern.«
»Und jetzt befehligen Sie ein Bataillon.« Burrell nickte anerkennend.
Sharpe war sich da nicht so sicher. Man hatte ihn nur zum Lieutenant Colonel befördert, damit er als Adjutant von Wilhelm von Oranien einen angemessenen Rang hatte, einem jungen, verblödeten Prinzlein, das der Herzog als Preis für die niederländischen Truppen hatte akzeptieren müssen, die ihm geholfen hatten, den Kaiser auf dem Hügelkamm zu schlagen. Der Prinz, der den Alliierten mehr geschadet als genutzt hatte, hatte Sharpe mitten in der Schlacht entlassen, und Sharpe hatte sich daraufhin dem Bataillon angeschlossen. Und nachdem Ford, der Colonel, panisch die Flucht ergriffen hatte, hatte er das Kommando übernommen. Als der Herzog gesehen hatte, wie Sharpe die Prince of Wales Own Volunteers gegen die Kaiserliche Garde geführt hatte, da hatte er laut erklärt, das Bataillon gehöre Sharpe, doch ob das auch so bleiben würde, das wusste Sharpe nicht. Er wollte das Kommando zwar, aber er befürchtete und erwartete, dass der Herzog ihn jetzt wieder degradieren und durch einen anderen ersetzen würde.
Die Straße führte in den Wald von Soignes, wo Hunderte Männer unter den Bäumen biwakierten. Rauch stieg von ihren Lagerfeuern zu den Blättern empor. Jenseits des Waldes lag die kleine Stadt Waterloo, und von dort führte die Straße durch friedliche Felder zum von Rauch gekrönten Brüssel. »Ich nehme an, der Krieg ist jetzt wirklich vorbei«, sagte Burrell angesichts des grauen Schleiers aus den Schornsteinen der Stadt.
»Aye. Sie können jetzt wieder nach Hause gehen, Captain.«
»Nein, zuerst geht’s nach Paris«, widersprach Burrell leidenschaftlich.
»Es ist durchaus möglich, dass wir da wieder kämpfen müssen«, warnte ihn Sharpe.
»Glauben Sie, Sir?«
»Ach, was weiß ich schon? Ich hoffe nicht, aber wir werden tun, was auch immer wir tun müssen. Und je schneller es vorbei ist, desto besser. Dann können wir alle heim.«
»Und wo ist Ihr Heim, Sir?«
»In der Normandie.«
Burrell schaute ihn erstaunt an. »In der Normandie, Sir?«
»Ich habe eine französische Frau«, erklärte Sharpe, »und die hat eine Farm in der Normandie.« Er lächelte, als er Burrells Gesichtsausdruck sah. »Ich habe auch nicht damit gerechnet, Captain. Mein ganzes Leben lang habe ich gegen die Froschfresser gekämpft, und dann habe ich plötzlich mit ihnen gelebt. Das Leben verläuft nie so, wie man es erwartet.«
»Ich habe auch ein paar gute Neuigkeiten«, wechselte Burrell das Thema.
»Ach ja?«
»Der Prinz von Oranien erholt sich gut, Sir. Ich dachte, das würden Sie gerne wissen.«
Sharpe grunzte. Der Prinz hatte eine Kugel in die Schulter bekommen, doch Sharpe hätte sich gefreut, wenn sie ihn ein wenig tiefer getroffen hätte, am besten mitten ins Herz, denn in nur drei Tagen hatte der Prinz mit seiner Dummheit vier, fünf Bataillone in den Untergang geführt. »Die Ärzte haben die Kugel entfernt«, berichtete Burrell, »und die Wunde ist sauber.«
»Gut«, sagte Sharpe wenig überzeugend.
»Aber der Herzog hat gesagt, dass es keine französische, sondern eine von unseren Kugeln war!«
»Eine von unseren?«
»Da waren Lederfetzen dran, Sir. Wickeln unsere Riflemen ihre Kugeln nicht in Lederflicken?«
»Ja, das tun wir«, bestätigte Sharpe. »Das sorgt für besseren Halt im Lauf.«
»Der Herzog schließt daraus, dass einer Ihrer Männer auf den Prinzen geschossen hat«, sagte Burrell.
»Warum sollte er das tun?«, erwiderte Sharpe, und er fragte sich, ob der Herzog ihn deshalb zu sich bestellt hatte. Als Sharpe auf den Prinzen geschossen hatte, war er nur knapp hundert Schritte unter dem Hügelkamm gewesen, von dem aus der Herzog die Schlacht verfolgt hatte. Verdammt, dachte er, denn die Kugel hätte den Prinzen mitten in die Brust treffen und sein Herz zerreißen sollen, doch stattdessen war sie zu hoch eingeschlagen. Hatte der Herzog gesehen, wie er geschossen hatte? In dem Fall, so glaubte Sharpe, würde er mit Sicherheit kein Bataillon mehr befehligen. Tatsächlich könnte er froh sein, wenn ein Kriegsgericht ihn nur zu unehrenhafter Entlassung verurteilen würde. Was war eigentlich die Strafe dafür, auf einen Prinzen von königlichem Blut zu schießen? Der Galgen? Oder ein Erschießungskommando? »Die Froschfresser benutzen manchmal unsere Gewehre, wenn sie sie in die Finger bekommen«, erklärte Sharpe, doch das klang alles andere als glaubhaft.
Burrell schwieg. Er führte Sharpe einfach in die Stadt, und dann war es an der Zeit, den wartenden Ordonnanzen die Pferde zu übergeben und die Stufen zum Hauptquartier des Herzogs hinaufzugehen.
Captain Burrell zeigte Patrick Harper die Tür zur Küche und versicherte dem großen Iren, dass es dort gutes Essen und Trinken gab. Dann führte er Sharpe durch das Labyrinth der Gänge. »Der Herzog ist in der Bibliothek«, sagte er zu Sharpe und klopfte an eine große Tür. Eine strenge Stimme antwortete ihm, und Burrell begleitete Sharpe in die Bibliothek. Licht fiel durch die großen, nach Norden ausgerichteten Fenster. An den Wänden standen hohe Regale mit in Leder gebundenen Büchern, und der Herzog saß an einem großen runden Tisch, der über und über mit Papieren bedeckt war. Besonders besorgniserregend war jedoch, dass Rebecque neben ihm saß.
Baron Rebecque war ein guter Mann, der dem Prinzen von Oranien als oberster Adjutant und Ratgeber gedient hatte. Er lächelte, als Sharpe den Raum betrat, und nickte zum Gruß. Doch der Herzog schaute Sharpe nur kalt an und grunzte seinen Namen.
»Mylord«, erwiderte Sharpe unbeholfen. Er wünschte, er hätte sich die Zeit genommen, sich vor dem Aufbruch noch einmal zu rasieren.
»Rebecque hat mir berichtet, dass der Prinz von Oranien überleben wird.«
»Das sind gute Neuigkeiten, Mylord.«
»Die Wunde ist sauber, Sharpe«, ergänzte Rebecque. »Allerdings hat Seine Hoheit noch immer starke Schmerzen. Aber die Ärzte sind sicher, dass er sich wieder erholen wird.«
»Das freut mich zu hören«, sagte Sharpe.
»Wirklich, Sharpe?«, verlangte der Herzog zu wissen.
»Natürlich, Mylord.«
»Die Kugel war eine der unseren«, sagte der Herzog. »Gewehrkaliber. Die Franzosen benutzen so was nicht.«
»Sie verwenden durchaus Beutemunition, Mylord«, widersprach Sharpe. »Und eine Gewehrkugel passt fast genau in ihre Musketen.«
»Wie erklären Sie sich dann die Lederreste, die an der Kugel gefunden worden sind? Die Franzosen umwickeln keine Kugeln!«
»Das stimmt, Mylord, aber wenn ich mich recht entsinne, hat der Prinz ein Lederband über der Schulter getragen. Vermutlich stammen die Fetzen davon.« Tatsächlich war Sharpe sich sogar sicher, dass das so war, denn vor lauter Eile hatte er die Kugel nicht in Leder gewickelt. Wahrscheinlich war das auch der Grund dafür, dass sie zu hoch eingeschlagen war. »Und unsere Flicken verbrennen, Mylord.« Er wusste, dass er den Herzog eigentlich mit »Euer Gnaden« ansprechen sollte, doch das war ihm irgendwie peinlich.
»Colonel«, sagte Rebecque in sanftem Ton, »wir fragen Sie das, weil man Sie auf dem Hang unterhalb der Position des Prinzen gesehen hat, und zwar kurz bevor er getroffen worden ist.«
»Ja, ich war dort, Sir. Ich wollte Major Dunnetts Riflemen helfen.«
»Die gegen die Franzosen gekämpft haben«, ergänzte der Herzog betont.
»Natürlich, Mylord.«
»Natürlich«, sagte der Herzog und starrte Sharpe ein paar Sekunden lang stumm an. »Sie wissen also nicht, wer die Kugel abgefeuert hat, die Seine Königliche Hoheit fast das Leben gekostet hätte, korrekt?«
»Da waren Dutzende von Voltigeuren, Mylord. Das hätte jeder von ihnen sein können.«
»In der Tat«, sagte der Herzog. »Ich denke, wir sind hier fertig, Rebecque. Ihre Männer werden morgen Vormittag losmarschieren.«
»Natürlich, Euer Gnaden.« Rebecque stand auf und sammelte ein paar Papiere ein, vermutlich Marschbefehle. »Es war schön, Sie zu sehen«, sagte Rebecque zu Sharpe und verließ die Bibliothek.
»Eine Kugel in der Schulter«, sagte der Herzog, »die den jungen Narren vom Schlachtfeld entfernt und weitere Dummheiten verhindert, ihn aber nicht tötet. Das nenne ich einen guten Schuss.«
»Für den Prinzen war es wohl eher ein großes Pech, Mylord. Jede Menge Voltigeure haben den Hang hinaufgeschossen.«
»Wie ich gesagt habe: ein guter Schuss.« War da ein Hauch von Lächeln im Gesicht des Herzogs zu sehen? Falls ja, dann verschwand es rasch wieder. »Wie geht es Ihrem Bataillon?«
»So gut, wie man es unter den Umständen erwarten kann, Mylord.«
»Verluste?«
»Zu viele, Mylord. Wir haben einhundertsechsundachtzig Männer begraben.«
Der Herzog zuckte ob dieser Zahl unwillkürlich zusammen. »Und Offiziere?«
»Fünf Tote, Mylord. Acht befinden sich noch in der Obhut der Ärzte.«
Der Herzog grunzte. »Sie haben bei Quatre Bras einen Major verloren.«
»Ja. Major Micklewhite, Mylord.«
»Und das aufgrund des Unvermögens dieses jungen Narren«, seufzte der Herzog verbittert. Er sprach natürlich von Prinz Wilhelm von Oranien. »Wer ist Ihr anderer Major?«
»Wir haben noch keinen, Mylord. Major Vine ist gestern gestorben.«
»Haben Sie angemessene Verstärkung bekommen?«
»Nein, Mylord. Peter d’Alembord ist unser bester Mann, aber er ist verwundet.« Sharpe brauchte einen guten Major als Stellvertreter, doch die beiden Majore des Bataillons waren tot, und er bezweifelte, dass die überlebenden Kompanieführer für eine Beförderung geeignet waren. Er hatte Captain Jefferson von der Leichten Kompanie in der Hoffnung das Kommando über die Grenadiere übertragen, dass ihn das erfahrener machen würde, und Harry Price hatte den Befehl über die Leichte Infanterie bekommen, doch Sharpe glaubte nicht, dass auch nur einer der beiden wusste, wie man ein Bataillon als Einheit in den Kampf führt. »Peter d’Alembord ist mein bester Captain, Mylord.«
»Haben Sie nicht gerade gesagt, er sei verwundet? Ist er nicht kampfunfähig? Schade. Dann muss ich Ihnen wohl einen suchen«, sagte der Herzog. »Aber vermutlich habe ich morgen noch keinen gefunden, und Sie marschieren in aller Früh los, bei Sonnenaufgang. Ihr Bataillon wird die Marschkolonne anführen.«
»Es ist mir eine Ehre, Mylord.«
Erneut grunzte der Herzog. »Verlassen Sie sich nicht darauf, Sharpe. Werfen Sie mal einen Blick auf diese Karte.« Er entfaltete eine riesige Landkarte, die schließlich den ganzen Tisch bedeckte. Dann drehte er sich halb zu Sharpe um, der neben ihn getreten war.
»Die Preußen marschieren ebenfalls nach Süden«, erklärte der Herzog verstimmt. »Sie werden die östliche Route nehmen und wir die westliche. Hier.« Er legte den Finger auf eine Stadt mit Namen Mons. »Knapp südlich von Mons werden wir die Grenze überqueren. Die nächste Stadt ist dann Valenciennes. Dort gibt es eine Garnison, aber wenn die uns keinen Ärger macht, werden wir sie auch in Ruhe lassen. Dann kommt Péronne, eine weitere Festung. Und achten Sie auf diese Straße, Sharpe.« Der Finger bewegte sich südöstlich von Péronne. »Sie führt zu einer Stadt mit Namen Ham.«
»Ham, Sir?«
»Ja, wie in Ham & Eggs. Da werden Sie mit Ihrem Bataillon hinmarschieren.«
»Jawohl, Mylord«, sagte Sharpe. Was anderes fiel ihm nicht ein.
»In Ham gibt es eine Zitadelle, Sharpe, und die werden Sie einnehmen.« Der Herzog schwieg.
»Und was wissen wir über diese Zitadelle, Mylord?«
»Viel und doch auch wieder nichts«, antwortete der Herzog. »Sie ist uralt – das weiß ich –, und mit ziemlicher Sicherheit hat sie auch eine Garnison. Bonaparte hat sie als Gefängnis benutzt. Deshalb sollen Sie auch dorthin. Um die Gefangenen zu befreien.«
Sharpe schaute auf die Karte und sah, dass die Hauptstraße von Péronne nach Paris ein gutes Stück westlich von Ham verlief. »Mylord, gehe ich recht in der Annahme, dass der Rest der Armee nicht nach Ham marschiert?«
»In der Tat. Von Péronne werden wir direkt auf Paris vorrücken. Doch in Ham könnten Sie die Preußen finden. Die Stadt liegt nicht weit von ihrer Angriffsroute. Aber die Gefangenen kommen zu mir, Sharpe. Verstanden?«
»Natürlich, Mylord.« Sharpe zögerte. »Und diese Gefangenen – wissen wir, wer die sind?«
»Das sind Leute, die Bonaparte genug verärgert haben, dass er sie weggesperrt hat«, antwortete der Herzog wenig hilfreich. »Aber wir wissen von mindestens einem Engländer, den sie dort gefangen halten, und vor allem den sollen Sie zurückbringen.«
»Jawohl, Mylord.«
»Ich werde Ihnen einen Offizier mitgeben, Sharpe: Major Vincent. Er spricht Deutsch und Französisch, und er kennt den Gefangenen, den wir haben wollen. Hören Sie auf ihn. Er ist äußerst fähig. Er ist einer meiner besten Fernspäher. Wissen Sie, was das ist?«
»Jawohl, Mylord«, antwortete Sharpe. Fernspäher waren Männer auf schnellen, gut ausgebildeten Pferden, die weit hinter die feindlichen Linien vordrangen, um die Stellungen und die Stärke des Gegners auszukundschaften.
»Vincent war schon mal in Ham«, fuhr der Herzog fort. »Also wird er von großem Wert für Sie sein. Aber er wird sich nicht in Ihre Gefechtsführung einmischen, und sehen Sie zu, dass Sie die Schlacht schnell entscheiden! Haben Sie verstanden, Sharpe? Schnell! Die Franzosen sind absolut dazu fähig, ihre Gefangenen zu exekutieren. Deshalb müssen Sie schneller in der Zitadelle sein, als sie die Gefangenen an die Wand stellen können.«
»Das werde ich, Mylord«, erklärte Sharpe, obwohl er nicht die geringste Ahnung hatte, wie er eine Festung einnehmen sollte. Er hatte keine Kanonen, also konnte er sie nicht zusammenschießen, und nach allem, was der Herzog gerade gesagt hatte, hatte er auch nicht genug Zeit, um die Mauern mit Leitern zu stürmen.
»Wo und wann soll Major Vincent morgen zu Ihnen stoßen?«, verlangte der Herzog zu wissen.
»Um halb fünf Uhr morgens«, antwortete Sharpe, »im Hotel Vlezenbeek.«
»Sie bleiben über Nacht in der Stadt?« Die Frage war ein Tadel, suggerierte sie doch, dass Sharpe Bequemlichkeit über Pflichterfüllung stellte.
»Ja, Mylord, aber das Bataillon wird pünktlich bereit sein.«
»Sorgen Sie dafür. Informieren Sie Major Vincent?« Letzteres war an Captain Burrell gerichtet, der das Gespräch stumm verfolgt hatte.
»Natürlich, Euer Gnaden.«
»Marschieren Sie schnell, und kämpfen Sie hart, Sharpe. Enttäuschen Sie mich nicht.«
»Natürlich nicht, Mylord.«
»Bitte, begleiten Sie Colonel Sharpe hinaus, Burrell.«
Der Captain eskortierte Sharpe zur Haustür, wo Harper schon auf ihn wartete. Burrell streckte die Hand aus. »Ich wünschte, ich könnte mit Ihnen gehen, Colonel.«
»Diese Aktion ist vergebliche Liebesmüh«, erwiderte Sharpe, doch er schüttelte Burrell die Hand. »Hotel Vlezenbeek, halb fünf.«
»Ich werde Major Vincent Bescheid geben, Sir.«
Burrell schaute zu, wie sich der Rifleman wieder auf sein Beutepferd schwang. Dann kehrte er in die Bibliothek zurück, wo der Herzog am Straßenfenster stand. Offenbar schaute auch er Sharpe hinterher.
»Wahrlich eine bemerkenswerte Erscheinung. Denken Sie nicht, Burrell?«
»Um Sie zu zitieren, Euer Gnaden: Ich weiß nicht, was er mit dem Feind macht, aber bei Gott, mir macht er Angst.«
»Ha!«, rief der Herzog, doch ohne auch nur den Hauch von Belustigung in der Stimme. »Hat er noch etwas gesagt?«
»Er hat gesagt, die Aktion sei vergebliche Liebesmüh, Euer Gnaden.«
»Und das ist sie auch, Burrell. Das ist sie. Aber Sharpe ist kein Narr. Er ist ein gottverdammter Gauner, aber er ist auch mein Gauner. Außerdem hat er geradezu teuflisches Glück, und er pflegt seine Kämpfe zu gewinnen. Und ich bete, dass er auch diesen gewinnen wird. Sonst …« Der Herzog ließ den Satz unvollendet, denn die Alternative war undenkbar.
Captain Burrell zögerte, dann wagte er es, dem Herzog einen Rat zu geben: »Könnten Sie nicht ein anderes Bataillon schicken, Euer Gnaden?«
»Sie meinen, ich sollte einen Gentleman statt eines Gauners schicken?«
»Vielleicht einen erfahreneren Offizier, Euer Gnaden.«
»Ha!« Der Herzog schnaubte verächtlich. »Sharpe ist zwar kein Gentleman, aber er hat mehr Kampferfahrung als all meine anderen Colonels zusammengenommen. Nein, für diese Aufgabe brauchen wir keinen Gentleman, sondern einen rücksichtslosen Bastard. Und beten Sie, dass er gewinnt, Burrell. Beten Sie, dass er gewinnt.«
Sharpe schickte Harper wieder nach Süden, um den Prince of Wales Own Volunteers den Befehl zu übermitteln, dass sie bei Sonnenaufgang zum Abmarsch bereit sein sollten. »Und ich meine bereit, Pat. Sobald ich morgen früh ankomme, marschieren wir los.«
»Ich sorge dafür.«
»Und wir werden nicht auf den Rest der Armee warten«, ergänzte Sharpe. »Wir müssen pünktlich bei Sonnenaufgang los, und wir werden allein marschieren.«
»Nur wir gegen Frankreich?«
»Die Verwundeten müssen zurückbleiben. Die Musiker bleiben bei ihnen. Und sollte irgendwer glauben, mit dir diskutieren zu müssen, dann sag ihm, der Befehl komme direkt vom Herzog.«
Pat Harper hatte nicht wirklich Befehlsgewalt, doch aufgrund seiner Körpergröße und seines Rufs besaß er dennoch eine gewisse Autorität. Nach den Siegen in Südfrankreich hatte er die Armee verlassen und war in sein geliebtes Dublin zurückgekehrt. Aber die Flucht des Kaisers von Elba hatte Harper wieder an Sharpes Seite geführt. Wenigstens erkannten die Offiziere der Prince of Wales Own Volunteers seinen Wert an. Harper war der Sergeant Major des Regiments gewesen, und obwohl er jetzt offiziell Zivilist war, trug er seine Uniformjacke, und alle im Bataillon wussten, dass er für Sharpe sprach.
Sharpe ging zu dem billigen Hotel, wo er mehrere Zimmer für Lucille gemietet hatte. Halb erwartete er, dass sie bei ihrer Freundin war, die sie hier in Brüssel kennengelernt hatte, der verwitweten Gräfin von Mauberges, einer älteren Französin und leidenschaftlichen Anhängerin Napoleons. Dennoch hatte die Gräfin Lucille unter ihre großzügigen Fittiche genommen.
»Madame ist hier.« Jeanette, die Zofe, öffnete die Tür und machte einen Knicks vor Sharpe.
»Wie geht es euch, Jeanette?«
»Uns geht es allen gut, Monsieur.«
»Das Baby?«
»Er isst, schläft und verlangt wieder nach Essen.«
»Du siehst müde aus«, bemerkte Sharpe auf Französisch.
»Sie auch, Monsieur.«
Sharpe lächelte. »Wir Engländer haben ein Sprichwort, Jeanette: Keine Rast den Sündern.«
»Damit kennen die Engländer sich sicher gut aus, Monsieur.«
Sharpe lachte und ging ins Schlafzimmer, das direkt an dem schmalen Flur lag. Lucille setzte sich im Bett auf. Sie sah erfreut aus, legte aber den Finger auf die Lippen. »Patrick schläft.«
Patrick war ihr Sohn, und genau wie Sharpe war er unehelich geboren. Sharpe beugte sich über die schlichte Wiege und streichelte dem Baby sanft die Wange. Dann setzte er sich aufs Bett und gab Lucille einen Kuss.
»Das ist ja eine Überraschung. Was machst du hier?«, fragte sie.
»Der Herzog wollte mich sehen.«
»Und die Schlacht?« Lucille packte ihn fest am Arm. »War es sehr schlimm?«
»Es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Glaub mir: Mehr willst du nicht wissen.«
»Und der Kaiser ist weg?«
»Ja, er ist weg«, antwortete Sharpe. Er küsste seine Frau erneut und staunte wie immer über ihre elegante Schönheit und sein eigenes unglaubliches Glück, sie gefunden zu haben. »Boney hat die Beine unter die Arme genommen und ist nach Süden gerannt.«
»Dann können wir jetzt also nach Hause gehen, ja?«
»Zuerst nach Paris, dann nach Hause. Und dann spiele ich auch nicht mehr Soldat.«
»Was hat der Herzog gewollt?« Lucille klang misstrauisch.
»Marschbefehle, Liebling. Wir brechen morgen auf.«
»Du gehst nach Paris?«
Sharpe nickte.
»Dann kommen wir mit«, erklärte Lucille. »Die Gräfin will auch nach Hause.«
»Ihr könnt nicht mit uns kommen«, sagte Sharpe. »Wir marschieren vor der Armee. Aber im Tross gibt es genug Wagen. Da werdet ihr sicher sein.«
»Und heute Nacht?«
»Heute Nacht wirst du nicht sicher sein.« Sharpe grinste. »Ich komme ins Bett.«
»Sag mir, dass es keine weiteren Kämpfe mehr geben wird«, flüsterte Lucille einige Zeit später.
»Es wird keine Kämpfe mehr geben«, erklärte Sharpe.
»Wirklich nicht?«
»Keine Kämpfe mehr«, wiederholte Sharpe und hoffte, dass er recht hatte. »Wir haben den Bastard besiegt. Jetzt müssen wir noch die Trümmer zusammenkehren.«
Einschließlich der Trümmer, die in Ham warteten, in einer Zitadelle, die Sharpe erobern sollte. Und er hatte nicht die geringste Ahnung, wie er das bewerkstelligen sollte.
KAPITEL 2
Major Vincent wartete am nächsten Morgen vor dem Hotel. Er war ein großer, hagerer Mann, und er saß auf einem kräftigen schwarzen Hengst. »Er heißt Satan!«, erklärte Vincent Sharpe glücklich. »Er kommt aus dem County Meath. Er fliegt förmlich über die Hecken und ist schneller als jede Franzosenmähre.«
»Lassen Sie uns hoffen, dass er das nicht unter Beweis stellen muss.« Sharpe schwang sich in den Sattel und bot Vincent einen halben Brotlaib an, der ausgehöhlt und mit Schinken gefüllt war. »Frühstück. Wenn Sie wollen, heißt das.«
»Sie sind wirklich ein guter Kerl. Brot und Schinken?«
»Mit Butter«, ergänzte Sharpe, »und das ist der letzte Schinken, den wir hatten. Von nun an gibt es nur Pökelfleisch. Sollen wir?«
»Je schneller, desto besser.« Vincent trug die dunkelblaue zweireihige Jacke der Royal Artillery. Trotzdem nahm Sharpe an, dass der Major in den letzten Jahren noch nicht einmal in der Nähe einer Kanone gewesen war. »Der Herzog hat Sie einen Gauner genannt«, bemerkte Vincent fröhlich, als sie sich auf den Weg gen Süden machten.
»Aye. Da hat er vermutlich recht.«
»Erzählen Sie mir von sich.«
»Da gibt es nicht viel zu erzählen.«
»Ach, kommen Sie schon, Sharpe. Nicht so bescheiden. Sie haben bei Talavera doch einen Adler erobert, nicht wahr?«
»Ich und ein Sergeant. Ja.«
»Und ohne Zweifel werden Sie jetzt behaupten, das sei alles nur Glück gewesen, korrekt?«
»Nein, das war ein verdammt harter Kampf. Aber ich war wütend. Ein Bastard mit Namen Henry Simmerson hatte ein paar Wochen zuvor unsere King’s Colour verloren, den Union Jack. Ich wollte nur Gleiches mit Gleichem vergelten.«
»Ja, ich habe Sir Henry kennengelernt. Er ist völlig nutzlos.«
»Schlimmer. Er ist boshaft.«
»Er arbeitet jetzt für das Schatzamt. Er ist Steuereintreiber!«
»Gott schütze England.«
»Sie werden eher derjenige sein, der England hilft, Sharpe, und zwar, indem Sie die Zitadelle von Ham einnehmen.«
»Die Sie schon gesehen haben, Sir?«
»In der Tat, das habe ich. Vor noch nicht einmal drei Wochen.«
Sharpe schaute zu dem schlanken Offizier. »Sind Sie tief nach Frankreich vorgedrungen? Ich habe gehört, dass Fernspäher die Grenze eigentlich nicht überqueren dürfen.«
»Und das haben wir auch nicht, denn offiziell waren wir ja nicht im Krieg mit Frankreich, sondern mit seinem Kaiser. Deshalb hat man uns befohlen, ihn nicht zu provozieren. Aber manche Befehle sind schlicht dafür da, gebrochen zu werden. Der Herzog hat erwähnt, das sei auch eine Ihrer Spezialitäten.« Vincent klang amüsiert.
»Und wenn man Sie gefasst hätte?«
»Dann wäre ich jetzt vermutlich tot. Aber mit so einem Pferd wie dem hier wäre mir das nie passiert. Ein paar Ulanen haben mich zum Rennen aufgefordert, und Satan hat sie alle abgehängt. Braver Junge.« Er klopfte seinem Hengst den Hals. Der Major sah aus, als wäre er ein, zwei Jahre älter als Sharpe, der glaubte, achtunddreißig zu sein. Wie viele Kinder, die in einem Armenhaus groß geworden waren, so wusste auch er nicht wirklich, wie alt er war, ganz zu schweigen davon, dass er seinen Geburtstag gekannt hätte. Aber mit seiner Schätzung lag er wohl nahe an der Wahrheit, und schon vor langer Zeit hatte er sich für den 1. August als Geburtstag entschieden, denn dieses Datum ließ sich leicht merken. Major Vincent, so dachte Sharpe, hatte mit Sicherheit solche Probleme nicht. Sein Pferd war offensichtlich teuer, seine Uniform war elegant geschnitten, und seine Kavallerie-Pelisse war mit echtem Pelz verziert. Sharpe lächelte. »Wann haben Sie zum letzten Mal ein Geschütz abgefeuert, Major?«
Vincent verstand sofort, was Sharpe wirklich mit dieser Frage meinte, und er erwiderte das Lächeln. »Gott sei Dank war ich nie auch nur in der Nähe einer Kanone, Sharpe. Das sind üble Dinger. Und sie machen viel zu viel Lärm.«
Vincent war einer von Wellingtons Fernspähern, und so ergab das Sinn. Sharpe hatte schon früher mit ihnen zusammengearbeitet und sie als subtile, clevere Männer kennengelernt, deren Hauptaufgabe es war, die Pläne des Feindes aufzudecken. Sie ritten auf guten Pferden weit hinter die feindlichen Linien, und sie trugen stets Uniform, sodass man sie nicht als Spione verurteilen und hinrichten konnte, sollten sie gefasst werden. »So – was können Sie mir über Ham erzählen?«, fragte Sharpe.
»Ham ist eine nette kleine Stadt an der Somme, Sharpe. Ihre Zitadelle liegt an einer Flussbiegung, eine verdammt große Steinfestung. Große Ecktürme, hohe Mauern. Haben Sie schon einmal den Tower von London gesehen?«
»Oft.«
»Dann stellen Sie sich den White Tower vor, nur zweimal so groß.«
»Himmel!«, rief Sharpe. »Und hat sie eine große Besatzung?«
»Oh ja, aber für gewöhnlich sind Garnisonstruppen nicht gerade die besten Kämpfer.«
»Sie könnten Verstärkung bekommen haben«, wandte Sharpe ein.
»Verstärkung?«
»Männer, die aus der Schlacht geflohen sind.«
»Ich nehme an, ein paar könnten es bis dorthin geschafft haben, aber die meisten Franzosen werden sich weiter nach Osten zurückgezogen haben. Außerdem sind ihnen die Preußen auf den Fersen.«
»Der Herzog hat angedeutet, dass die Preußen Ham als Erste erreichen könnten.«
»Oh Gott! Das wollen wir doch nicht hoffen! Wenn das passiert, werden sich die Gefangenen in halb Frankreich zerstreuen. Nein, Sharpe, wir werden als Erste dort ankommen. Wir werden sie freilassen, und wir werden unseren Mann zum Herzog zurückbringen.«
»Unseren Mann, Major?«
»Einen ziemlich wichtigen Mann. Es ist wahrlich eine Schande, dass sie ihn erwischt haben.«
»Und um wen handelt es sich?«
»Das müssen Sie erst wissen, wenn Sie vor ihm stehen.«
Sharpe zuckte ob der knappen Antwort unwillkürlich zusammen, aber er schwieg. »Die Garnison wird schon bald vom Ausgang der Schlacht erfahren«, sagte er stattdessen. »Also, warum sollten sie die Gefangenen dann nicht einfach nach Süden bringen, weg von uns?«
»Vergessen Sie das«, erwiderte Vincent, »und zwar schnell. Ja, das sollten sie tun, aber hat der Kommandant der Garnison auch die Eier, ohne Befehl zu handeln? Ich gehe einfach mal davon aus, wenn wir uns beeilen, dann kommen wir auch rechtzeitig an.«
»Der Herzog hätte Kavallerie schicken sollen«, knurrte Sharpe.
»Und wie soll Kavallerie eine Festung einnehmen? Die armen Kerle wüssten ja noch nicht einmal, wie.«
»Und ich weiß das?«
»Der Herzog glaubt an Sie, Sharpe«, erklärte Vincent ernst. »Werden Ihre Männer marschbereit sein?«
»Das sollten sie, wenn sie keinen Ärger bekommen wollen«, zischte Sharpe, und die Prince of Wales Own Volunteers waren in der Tat marschbereit. In Reih und Glied standen sie auf der Straße, die über den Hügelkamm führte, wo die Schlacht stattgefunden hatte. Die Feuer im Tal qualmten noch immer, und ihr Gestank wehte bis zur Straße hinauf. Die Verletzten des Bataillons waren wie geplant im Lager geblieben, wo die Musiker sich um sie kümmerten. Nur sechs Trommler begleiteten Sharpes Männer.
»Was ist mit den Frauen, Sir?«, verlangte Harry Price von Sharpe zu wissen.
»Was soll mit ihnen sein, Harry?«
»Können sie mitkommen?«
»Natürlich nicht!«, mischte Vincent sich brüsk ein.
Sharpe beugte sich nach unten. »Hör zu, Harry: Wir werden sehr, sehr schnell marschieren. Die Frauen müssen da mithalten. Wenn sie das nicht schaffen, lassen wir sie zurück. Sag ihnen das.«
»Natürlich, Sir.«
»Ist das wirklich klug, Sharpe?«, fragte Vincent.
Sharpe drehte sich zu ihm um. »Sie wollen diese Männer doch sicher hart kämpfen sehen. Wenn ihre Frauen aber beim Rest der Armee bleiben müssen, werden sie nicht gerade glücklich sein. Und glückliche Männer kämpfen verdammt noch mal besser als ein elender Haufen. Außerdem werden die Frauen selbst entscheiden. Ein paar werden mitkommen, andere bei den Verwundeten bleiben, und einige werden auch denken, dass ihre Kinder das Marschtempo nicht werden mithalten können.«
»Kinder auch?« Vincent klang besorgt.
»Kinder entstehen nun mal, wenn man Frauen und Männer zusammensteckt«, erwiderte Sharpe und ritt ins Zentrum der Marschkolonne.
Harper begleitete ihn. »Bataillon!«, bellte der Ire. »Stillgestanden!«
»Rührt euch!«, rief Sharpe. »Und jetzt hört mir gut zu, ihr Schurken! Der Herzog hat uns eine besondere Aufgabe gegeben, und zwar, weil auch wir etwas Besonderes sind! Er betrachtet uns als eines seiner besten Bataillone! Deshalb werden wir jetzt auch nach Frankreich marschieren, und wir marschieren allein!« Er ließ den Männern ein wenig Zeit, das zu verarbeiten. Ein Raunen ging durch die Reihen. »Ruhe!«, rief Sharpe schließlich. »Wir marschieren allein, und wir marschieren schnell! Wenn jemand nicht mithalten kann, dann wird er zurückgelassen, aber der Herzog vertraut darauf, dass ihr das schafft!« Das war zwar keine tolle Rede, aber Sharpe wollte seine Männer auch nur davor warnen, was ihnen bevorstand. »Okay, Pat. Setz sie in Bewegung.«
»Und in welche Richtung?«, fragte Harper amüsiert.
»Zur Mitte des Hügelkamms und dann nach rechts. Und stell die Kompanien um.«
Das Bataillon hatte sich nach Norden ausgerichtet. Deshalb war die Grenadierkompanie links von Sharpe, in Marschrichtung. Die Grenadiere waren zwar gut, aber die Leichte Kompanie zu Sharpes Rechter würde ein höheres Marschtempo vorgeben, und genau das wollte Sharpe. Natürlich würde das den Grenadieren nicht gefallen, denn sie gingen davon aus, dass sie das Bataillon immer anführten, aber die Leichte Kompanie würde so schnell laufen, dass die Grenadiere keine Luft mehr haben würden, um sich zu beschweren. »Trommler!«, bellte Sharpe. »Ich will euch hören!«
Begleitet von Harper und Vincent ritt er an die Spitze der Kolonne. Sie marschierten über den Hügelkamm, vorbei an den Kadavern der französischen Pferde, die so kühn angegriffen hatten, bis sie vom britischen Schrapnell und dem Volleyfeuer der Karrees niedergemäht worden waren. Ein Stück weiter kam Sharpe an der Stelle vorbei, wo seine Gewehrkugel den Prinzen von Oranien in die Schulter getroffen hatte, und sein Puls stieg bei der Erinnerung daran, zusammen mit dem Wunsch, dass die Kugel ihr Ziel nur eine Handbreit tiefer getroffen hätte. Dann erreichten sie die Kreuzung, wo die Land- auf die Hauptstraße traf, und Sharpe bog nach rechts ab und führte sein Bataillon an der ummauerten Farm mit Namen La Haye Sainte vorbei, wo die King’s German Legion gekämpft hatte und gestorben war. Tote Pferde lagen neben der Straße, und auch tote Männer waren noch zu sehen, die darauf warteten, begraben oder verbrannt zu werden. Unter ihnen waren auch viel zu viele Riflemen in ihren grünen Jacken. »Gott«, sagte Sharpe zu Harper, »was war das für ein Gemetzel.«
»Das Schlimmste, das ich je erlebt habe.« Der große Ire nickte.
»Badajoz war schlimmer.«
»Aye, das war auch ein böser Kampf.«
»Sie waren in Badajoz?«, fragte Vincent und schaute auf den Eichenlaubkranz, der auf Sharpes Ärmel gestickt war. »Ist das …?«, begann er und verstummte dann.
»Das ist Badajoz.« Sharpe hatte den Blick des Majors bemerkt. »Wir waren beide da.« Der Eichenlaubkranz war das Zeichen für einen Mann, der in einem »Verlorenen Haufen« gekämpft und überlebt hatte, mit jenen Männern, die den ersten, selbstmörderischen Angriff in eine feindliche Bresche hinein geführt hatten. Sharpe und Harper waren die Santa-Maria-Bresche hinaufgestiegen. Sie hatten sich in die blutgetränkten Trümmer gekrallt und durch das Abwehrfeuer der Verteidiger gekämpft, während sich der Graben hinter ihnen mehr und mehr mit Leichen gefüllt hatte. Noch immer wachte Sharpe des Nachts manchmal schweißgebadet auf und fragte sich, wie er und Harper das hatten überleben können, und bis heute wusste er nicht, warum er noch am Leben war, geschweige denn, warum er auch noch gewonnen hatte. »Und ich hoffe«, fuhr er an Vincent gewandt fort, »dass wir nie wieder werden kämpfen müssen.«
»Amen«, sagte Harper.
»Noch haben die verdammten Froschfresser nicht kapituliert«, gab Vincent zu bedenken.
»Aber sie sind geschlagen.«
»Vielleicht.« Vincent schien daran zu zweifeln. »Marschall Grouchy hat sein Korps nach Süden geführt, und Davout hat mindestens hunderttausend Mann in und um Paris. Und der Kaiser gibt nicht so einfach auf! Er wird bis zum bitteren Ende kämpfen.«
»Dann werden wir ihn eben noch mal schlagen müssen«, sagte Sharpe.
Sie hatten den Talboden erreicht. Hier lagen schon weniger Leichen, doch der Ekel erregende Gestank der Feuer hing noch immer in der Luft. Eine Frau, die sich ein Baby auf den Rücken gebunden hatte, war gerade damit beschäftigt, einer französischen Leiche die Zähne auszubrechen. Sie stieß ein gequältes Geräusch aus, als die Zange einen weiteren herausriss. Dann grinste sie Sharpe an. »Neue Zähne?« Sie steckte den gerade gezogenen Zahn in einen Beutel und setzte ihre Arbeit fort.
»Zähne?« Vincent schauderte.
»Sie wird gutes Geld dafür bekommen«, erklärte Sharpe. »Viele Leute brauchen ein neues Gebiss.«
»Nach Salamanca haben wir einen ganzen Sack davon gesammelt«, erzählte Harper fröhlich. »Und wir haben sie auch gut verkauft.«
Sharpe nickte einem Dutzend Artilleristen zum Gruß zu, die eine Gruppe erbeuteter französischer Kanonen bewachten. Dann ritten sie auf den Hügelkamm zu, wo Napoleon seine Truppen aufgestellt hatte. Dort hatten die französischen Attacken begonnen, die schließlich am Musketenfeuer der Briten gescheitert waren. Oben auf dem Hang gab es eine Taverne, und nicht weit davon entfernt stand ein wackeliger Turm aus dünnen Baumstämmen, die eine Plattform hielten, welche über eine Leiter zu erreichen war. »Boney hat einen großen Teil der Schlacht auf dem Ding verbracht«, erzählte Vincent, »und uns durchs Fernglas beobachtet.«
»Und wo waren Sie?«, fragte Sharpe.
»Ich war den größten Teil des Tages da draußen«, antwortete Vincent und deutete nach Osten, »und habe nach den Preußen Ausschau gehalten.«
Sharpe ritt an die Spitze der Kolonne. Dabei fielen ihm zwei, drei Soldaten mit neuen leuchtend roten Röcken auf. Das hieß, dass sie zur Verstärkung gehören mussten. Private Bee war einer von ihnen, und Sharpe winkte den Jungen zu sich. »Kannst du reiten, Bee?«
»Ich habe noch nie auf einem Pferd gesessen, Sir.«
»Dann ist es wohl an der Zeit, dass du es lernst, Pat Bee.« Sharpe gab dem Jungen die Zügel. »Er ist recht gutmütig. Treib ihn nur nicht zu sehr an, und versuch, nah bei mir zu bleiben.« Er glitt aus dem Sattel und half dem Jungen hinauf. »Wie alt bist du, Bee?«
»Siebzehn, Sir.« Der Junge klang unsicher. Er war kaum größer als seine Muskete, die viel zu schwer für ihn zu sein schien.
»Und wo kommst du her, Bee?«
»Ich bin in Balham geboren, Sir, aber jetzt lebe ich in Shoreditch.«
»Aus dem Teil der Welt stamme ich auch«, sagte Sharpe. »Und weshalb hast du dich gemeldet?«
»Wegen eines Richters, Sir.«
Sharpe lachte. »Genau wie bei mir. Was hast du angestellt?«
»Taschendiebstahl, Sir.« Bee klang beschämt.
»Du warst ein Clouter!«, rief Sharpe und benutzte das Londoner Wort für einen Langfinger.
»Aber kein guter, Sir.«
»Dann sei jetzt ein guter Soldat, Bee«, sagte Sharpe und ging weiter nach vorn. Jetzt würde er das Tempo vorgeben, und zwar ein schnelles. Inzwischen waren sie südlich des Schlachtfelds. Hier waren die Felder voller Musketen und Rucksäcke, die die Franzosen auf ihrer Flucht einfach weggeworfen hatten.
Harry Price schloss zu Sharpe auf. »Wollen Sie den Männern zeigen, dass Sie genauso gut marschieren können wie sie, Sir?«, fragte Price amüsiert.
»Ja, genau, Harry.«
»Und? Was genau machen wir, Sir?«
»Wir befolgen die Befehle des Herzogs, Harry.«
»Und die lauten, Sir?«
»Wir sollen rein nach Frankreich, eine Festung erobern, ein paar Gefangene befreien und wieder zur Armee zurück.«
Price ging ein paar Schritte schweigend neben Sharpe her. »Ich wusste doch, dass Sie mir nicht wirklich etwas sagen würden.«
»Dann hätten Sie nicht fragen sollen, Harry. Oh – wenn wir wieder bei der Armee sind, dann möchte ich, dass Sie ein halbes Dutzend Männer abstellen, um die Vicomtesse zu begleiten.« Lucille war die Vicomtesse de Seleglise, ein Titel, den sie zu Sharpes Erstaunen nur selten verwendete. »Und zwar vertrauenswürdige Männer.«
»Kein Problem, Sir. Aber eine Festung erobern? Hahaha!«
Die aufgehende Sonne war hinter den Wolken verborgen, und als das Bataillon schließlich die Kreuzung mit Namen Quatre Bras erreichte, hatte ein leichter Regen eingesetzt. Auf der Kreuzung bog Sharpe nach rechts ab und führte sein Bataillon wieder zwischen unbestatteten Leichen von Männern und Pferden hindurch, die zwei Tage zuvor im Kampf bei Mont-Saint-Jean gefallen waren. Die menschlichen Leichen waren fast alle nackt. Die Dörfler hatten sie ausgeplündert.
Sharpe schaute nach links, wo die schwere Kavallerie der Franzosen drei gute Infanteriebataillone niedergetrampelt hatte, nachdem der Prinz von Oranien darauf bestanden hatte, dass sie in Linie antreten sollten und das trotz Sharpes Warnung, dass feindliche Reiter in den Roggenfeldern lauerten.
Jenseits des Schlachtfeldes rasteten sie für ein paar Minuten, und die Männer füllten ihre Feldflaschen in einem kleinen Bach. Major Vincent entfaltete eine Landkarte und versuchte vergeblich, sie mit seiner Uniformjacke vor dem Regen zu schützen. »Das ist ein guter Anfang, Sharpe«, bemerkte er glücklich. »Und jetzt auf nach Mons!«
»Wie weit ist das von hier?«
Vincent fuhr den Weg mit seinem Finger entlang. »Oh – ungefähr dreißig Meilen.«
»Das schaffen wir heute nicht mehr«, sagte Sharpe.
»Dann sollten wir uns besser ranhalten!«
Am nächsten Morgen marschierten sie durch die Festungsstadt Mons, und von überall strömten die Menschen herbei. Alle wollten Neuigkeiten von der Schlacht hören. Sharpe kaufte Brot und gepökeltes Schweinefleisch in der Stadt und ignorierte das Bier, das sich seine Männer gönnten. Nach dem harten Marsch hatten sie sich das verdient.
Am Nachmittag überquerten sie dann die Grenze zu Frankreich. Die Straße, Schotter auf Stein, verschlechterte sich von einem Augenblick auf den anderen. »Boney hat sie aufpflügen lassen«, erklärte Vincent. »Er wollte es Invasoren nicht so leicht machen.« Jede Invasion Frankreichs musste über die Hauptstraßen erfolgen. Zwar konnten Infanterie und Kavallerie sich auch langsam durch die Felder bewegen, doch die schweren Geschütze und die Nachschubwagen mussten auf der Straße bleiben, und die war jetzt auf ganzer Länge aufgerissen.