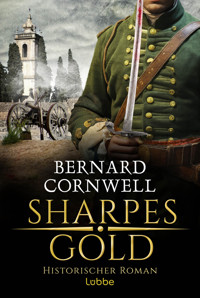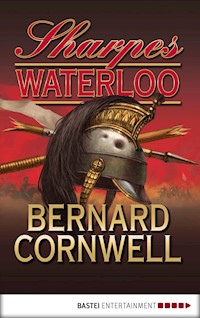
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Brüssel, Juni 1815. Richard Sharpe dient im persönlichen Stab des Prinzen von Oranien. Dieser weigert sich jedoch beharrlich, Sharpes Warnung ernst zu nehmen, dass Napoleon sich an der Spitze einer gewaltigen Armee auf sie zubewegt. So kommt es zur Schlacht bei Waterloo, und eine militärische Katastrophe bahnt sich an. Doch gerade, als der Sieg der Alliierten unmöglich erscheint, übernimmt Sharpe das Kommando - und die blutigste Schlacht seiner Karriere wird zu seinem größten Triumph.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
DER ERSTE TAG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
DER ZWEITE TAG
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
DER DRITTE TAG
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
DER VIERTE TAG
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
EPILOG
Historische Anmerkung
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
Bernard Cornwell
SHARPESWATERLOO
Richard Sharpe undder Waterloo-Feldzugvom 15. Juni bis 18. Juni 1815
Aus dem Englischen vonJoachim Honnef
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Überarbeitete Fassung des 1991 bei Bastei Lübbe erschienenenRomans »Sharps Waterloo«
Für die Originalausgabe:Copyright © 1990 by Bernard CornwellTitel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Waterloo«Published by arrangement withMarco Vigevani&Associati Agenzia Letteraria,on behalf of Toby Eady Associates Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Rainer DelfsTitelillustration: © Bao PhamUmschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4984-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Sharpes Waterloo widme ich Judy
DER ERSTE TAG
DONNERSTAG, 15. JUNI 1815
KAPITEL 1
Der Morgen dämmerte an der nördlichen Grenze Frankreichs. Die Grenze wurde nur durch einen seichten Fluss markiert, der zwischen verkümmerten Stämmen gekappter Weiden floss. Eine gepflasterte Landstraße endete an der Furt und erstreckte sich am anderen Ufer weiter nordwärts. Die Straße führte aus Frankreich in die holländische Provinz Belgien, aber es gab weder einen Wachtposten noch ein Tor, um anzuzeigen, wo die Straße das französische Kaiserreich verließ und in die Königlichen Niederlande führte. Da war nur der im Sommer seichte Fluss, über dem Nebel wallte und sich in Schleiern über die Weizen-, Roggen- und Gerstenfelder legte.
Die aufgehende Sonne wirkte wie ein roter Ball, der tief im feinen Nebel hing. Der Himmel im Westen war noch dunkel. Eine Eule flog über die Furt, drehte ab in einen Buchenwald und schrie noch einmal hohl. Der Schrei ging unter im lauten Chor der Morgendämmerung, der einen strahlenden, heißen Sommertag in dieser fruchtbaren und beschaulichen Landschaft anzukündigen schien. Der Himmel war wolkenlos. Es versprach ein Tag zum Heumachen zu werden, oder ein Tag, an dem Liebende durch den Wald schlendern und am grünen Flussufer rasten konnten. Es war eine schöne Morgendämmerung im Sommer an Frankreichs nördlicher Grenze, und für einen Augenblick, für einen herzbewegenden Moment, war Frieden auf der Welt.
Dann trommelten Hunderte Pferdehufe durch die Furt, und Wasser spritzte in den Nebel. Uniformierte Männer mit Degen in den Händen ritten aus Frankreich nach Norden. Die Männer waren Dragoner. Ihre metallenen Helme waren mit Stoff bedeckt, damit das Material nicht den Schein der aufgehenden Sonne reflektierte, was ihre Position verraten hätte. Die Reiter hatten kurzläufige Karabiner, die in Sattelfutteralen steckten.
Die Dragoner waren die Vorhut einer Armee. Hundertfünfundzwanzigtausend Männer marschierten nordwärts auf jener Straße, die zu der Furt bei Charleroi führte. Dies war eine Invasion. Eine Armee zog mit Wagen, Kutschen, Ambulanzen, dreihundertvierundvierzig Geschützen, dreißigtausend Pferden, mit tragbaren Schmieden, Pontonbrücken, Huren und Frauen und Fahnen, Lanzen, Musketen, Säbeln und Degen und allen Hoffnungen Frankreichs über eine unbewachte Grenze. Dies war die Nordarmee Kaiser Napoleons, und sie marschierte auf die wartenden holländischen, britischen und preußischen Streitkräfte zu.
Die französischen Dragoner überquerten die Grenze mit gezogenen Degen, doch die Waffen dienten nur dem Zweck, den großen Augenblick dramatisch zu würdigen, denn es gab keinen einzigen holländischen Zöllner, der sich der Invasion widersetzte. Da waren nur der Nebel und die leeren Straßen und das ferne Krähen von Hähnen in der Morgendämmerung. Ein paar Hunde bellten, als die Kavalleristen die ersten holländischen Dörfer einnahmen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die Dragoner hämmerten mit den Degen gegen Türen und Fensterläden und fragten, ob irgendwelche britischen oder preußischen Soldaten in den Häusern einquartiert wären.
»Die sind alle im Norden! Die lassen sich hier kaum blicken!« Die Dorfbewohner sprachen Französisch. Sie betrachteten sich als französische Bürger und hießen die Dragoner folglich mit Wein und Essen willkommen. Für diese widerwilligen Holländer war die Invasion eine Befreiung, und sogar das Wetter passte zu ihrer Freude. Die Sonne stieg höher am wolkenlosen Himmel, und der Nebel, der immer noch in den grünen Tälern wallte, löste sich bald auf. Auf der Hauptstraße, die nach Charleroi und Brüssel führte, kamen die Dragoner in zügigem Tempo voran. Sie ritten fast, als wären sie auf einer Übung in der Provence, anstatt im Krieg. Ein Lieutenant der Dragoner fühlte sich so sicher und ungefährdet, dass er seinem Sergent erzählte, wie man in der neuen Wissenschaft Phrenologie durch Messungen des menschlichen Schädels auf die Begabung der Person schließen konnte. Der Lieutenant meinte, wenn diese Wissenschaft richtig verstanden wurde, dann würden bald alle Beförderungen in der Armee auf sorgfältigen Schädelmessungen basieren. »Wir werden in der Lage sein, Mut und Entschlusskraft, gesunden Menschenverstand und Ehrbarkeit zu messen, und das alles mit einem Zirkel und einem Maßband!«
Der Sergent sagte nichts dazu. Er und sein Offizier ritten vor ihrer Schwadron und somit an der Spitze der vorrückenden französischen Armee. Der Sergent hörte nur mit halbem Ohr die begeisterten Worte des Lieutenants. In Gedanken beschäftigte er sich teils mit der Vorfreude auf die belgischen Mädchen, und teils sorgte er sich, dass dieser überstürzte Vormarsch auf feindliche Feldposten stoßen würde. Die Briten und Preußen waren doch bestimmt nicht geflüchtet, oder?
Der Lieutenant war ein wenig pikiert über das mangelnde Interesse seines Sergents an Phrenologie, doch die niedrige Stirn des Mannes verriet, dass er unfähig war, neue Ideen zu akzeptieren. Der Lieutenant versuchte dennoch, den altgedienten Soldaten aufzuklären. »Man hat Studien in den Polizeischulen in Paris gemacht, Sergent, und einen bemerkenswerten Zusammenhang entdeckt zwischen …«
Der bemerkenswerte Zusammenhang blieb ein Geheimnis, denn etwa dreißig Meter vor den beiden Reitern krachte hinter einer Hecke Musketenfeuer, und das Pferd des Lieutenants brach von einer Kugel getroffen zusammen. Das Pferd wieherte schrill. Blut schoss aus seinem Maul, als es stürzte und wild auskeilte. Der Lieutenant, der abgeworfen worden war, wurde von einem auskeilenden Huf in den Unterleib getroffen. Er schrie seinen Schmerz hinaus, während er mit seinem Pferd die Straße blockierte. Die bestürzten Dragoner hörten, dass der Feind die Ladestöcke in die Musketenläufe rammte. Der Sergent schaute zurück zu den Dragonern. »Einer gibt dem Pferd den Gnadenschuss!«
Weitere Schüsse krachten von der Hecke her. Die Männer im Hinterhalt waren gut. Sie hatten die französischen Kavalleristen sehr nahe herankommen lassen, bevor sie das Feuer eröffnet hatten. Die Dragoner schoben ihre Degen in die Scheiden und zogen die Karabiner, doch vom Pferderücken aus konnten sie nicht so gut zielen, und der kurzläufige Karabiner war bekannt für seine Ungenauigkeit. Das Pferd des Lieutenants lag immer noch in seinem Blut auf der Straße und keilte aus. Der Sergent befahl seinen Männern, vorzurücken. Ein Trompetensignal ertönte und befahl einen anderen Trupp in Linie nach rechts durch ein Weizenfeld. Ein Dragoner neigte sich aus dem Sattel und erschoss das Pferd des Lieutenants. Ein weiteres Pferd stürzte, von einer Musketenkugel getroffen. Ein Dragoner lag im Straßengraben, und sein Helm fiel zwischen Brennnesseln. Reiter preschten an dem verwundeten Lieutenant vorbei, und die Pferdehufe schleuderten Dreck und Schotter empor. Der Degen des Sergents glänzte silbern.
Wieder krachte es, doch diesmal wölkte der weiße Pulverrauch vereinzelter Schüsse hinter der Hecke auf. »Sie ziehen sich zurück!«, rief der Sergent einem Offizier weit hinter sich zu. Dann wartete er nicht auf Befehle, sondern gab seinem Pferd die Sporen und rief: »Attacke!«
Die französischen Dragoner preschten auf die Hecke zu. Sie sahen keinen Feind mehr, doch sie wussten, dass die Männer, die aus dem Hinterhalt geschossen hatten, in der Nähe sein mussten. Der Sergent nahm an, dass sich die feindliche Infanterie in dem Weizenfeld verbarg. Er schwenkte bei der Hecke ab, trieb sein Pferd durch einen Graben und ritt in den Weizen. Er sah eine Bewegung am fernen Ende des Feldes. Männer rannten auf ein Waldstück zu. Sie trugen dunkelblaue Uniformröcke und schwarze Helme mit silbernem Rand. Preußische Infanterie.
»Da sind sie!« Der Sergent wies mit dem Degen auf den Feind.
»Hinterher!«
Dreißig Dragoner folgten dem Sergent. Sie stießen die Karabiner in die Sattelfutterale und zogen die Degen. Preußische Musketen krachten am Waldrand, doch die Distanz war zu groß, und nur ein Pferd wurde getroffen und stürzte in den Weizen. Die übrigen Dragoner preschten weiter. Die preußischen Posten, die aus dem Hinterhalt die französische Vorhut angegriffen hatten, eilten in den Schutz des Waldes, aber einige hatten sich zu spät zurückgezogen, und die Dragoner holten sie ein. Der Sergent galoppierte an einem Mann vorbei und schlug rückwärts mit dem Degen zu.
Der preußische Infanterist presste die Hände auf das getroffene Gesicht und versuchte, seine Augen in die Höhlen zurückzudrücken. Ein anderer Mann, der von zwei Dragonern niedergeritten worden war, erstickte an seinem Blut. »Attacke!« Der Sergent ritt in den Wald. Er sah preußische Infanteristen davonrennen und empfand das wilde Hochgefühl eines Kavalleristen, der einen hilflosen Feind niedermachen konnte, aber er sah weder die Batterie Geschütze, die im tiefen Schatten am Waldrand versteckt war, noch den preußischen Artillerieoffizier, der jetzt befahl: »Feuer!«
Gerade noch trieb der Sergent seine Männer zum Angriff, und im nächsten Augenblick wurden er und sein Pferd von Kartätschenfeuer niedergemäht. Reiter und Pferd waren auf der Stelle tot. Hinter dem Sergent schwenkten die Dragoner nach links und drehten ab, doch vier weitere Männer starben und drei andere Pferde brachen getroffen zusammen. Zwei der Gefallenen waren Franzosen, und zwei waren preußische Infanteristen, die sich zu spät zurückgezogen hatten.
Der preußische Artillerieoffizier sah einen anderen Trupp Dragoner, der seine Stellung zu umgehen drohte. Er spähte zurück zur Straße, wo weitere französische Kavallerie aufgetaucht war, und er wusste, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis die erste französische Achtpfünderkanone eintreffen würde. »Aufprotzen!«
Die preußischen Geschütze wurden von Pferden nordwärts gezogen. Schwarzuniformierte Husaren, die auf ihren Helmen ein Abzeichen hatten, das einen Totenkopf und darunter gekreuzte Knochen zeigte, sicherten den Rückzug.
Die französischen Dragoner folgten nicht gleich. Stattdessen galoppierten sie in den verlassenen Wald, in dem noch die preußischen Biwakfeuer brannten. Neben einem Feuer lag ein umgekippter Teller, von dem Würste auf den Boden gefallen waren. Ein Dragoner probierte eine Wurst und spuckte den Happen angewidert ins Feuer. »Schmeckt wie deutsche Scheiße.«
Ein verletztes Pferd lief lahmend in das Weizenfeld und versuchte, die anderen Kavalleriepferde einzuholen. Im Wald wurden zwei preußischen Gefangenen die Waffen, Proviant, Bargeld und Feldflaschen abgenommen. Die Franzosen rückten zum Nordrand des eingenommenen Waldes vor und beobachteten den Rückzug des Feindes. Der letzte Nebel hatte sich aufgelöst. Die Räder der preußischen Geschütze hatten Schneisen in die Gerste auf den Feldern im Norden geschnitten.
Etwa sechzehn Kilometer südlich und noch in Frankreich wartete die schwere Kutsche Napoleons am Straßenrand. Stabsoffiziere informierten Seine Majestät den Kaiser, dass die holländische Grenze erfolgreich überquert worden war. Sie berichteten von sehr geringem Widerstand, der schnell gebrochen worden war.
Der Kaiser nahm die Meldung mit einem Grunzlaut zur Kenntnis und ließ den Ledervorhang fallen, woraufhin das Innere der Kutsche dunkel wurde. Es war genau hundertsieben Tage her, seit Napoleon, der mit nur tausend Mann sein Exil auf Elba verlassen hatte, an einem leeren Strand in Südfrankreich gelandet war. Vor achtundachtzig Tagen hatte er seine Hauptstadt Paris zurückerobert, und in diesen wenigen Tagen hatte er der Welt gezeigt, wie ein Kaiser Armeen aufstellt. Zweihunderttausend Veteranen waren wieder zu den Adlerstandarten gerufen worden, die entlassenen Offiziere waren wieder zu ihren Bataillonen befohlen, und die Arsenale Frankreichs waren aufgefüllt worden. Jetzt marschierte diese Armee gegen den Abschaum Britanniens und die Söldner Preußens. Es war ein Morgen im Mittsommer, und Napoleon griff an.
Der Kutscher ließ seine Peitsche knallen, die Kutsche des Kaisers fuhr an, und die Schlacht um Europa hatte begonnen.
KAPITEL 2
Eine Stunde nachdem der französische Dragoner-Sergent im Kartätschenfeuer gefallen war, ritt ein anderer Kavallerist durch den strahlenden Sonnenschein.
Dieser Mann befand sich in Brüssel, vierzig Meilen nördlich der Stelle, an der Napoleon in Belgien einmarschierte. Er war ein großer, gut aussehender Offizier in der rotblauen Uniform der britischen Gardetruppen. Er ritt einen großen Rappen, der hervorragend gestriegelt und offenkundig von edlem Geblüt war. Der Reiter trug einen vergoldeten Helm, der oben mit schwarzer und roter Wolle besetzt war und einen weißen Federbusch hatte. Seine lederne Reithose war noch feucht, denn weil sie hauteng sitzen sollte, zog er sie nass an, damit sich das Leder zusammenzog. Sein schwerer Kavalleriedegen hing in einer vergoldeten Scheide neben der königsblauen Satteldecke, die mit dem Monogramm des Königs bestickt war. Die schwarzen Stiefel des Offiziers reichten bis zu den Knien, seine Sporen waren vergoldet, die Patronentasche war mit Pailletten und goldener Stickerei verziert, der kurze Uniformrock mit einer goldenen Schärpe besetzt. Sein Sattel war mit Lammfell bezogen, und die Gebisskette seines Pferdes bestand aus reinem Silber, doch bei all diesem Pomp war es das Gesicht des britischen Offiziers, das die Aufmerksamkeit weckte.
Er war ein äußerst gut aussehender junger Mann, und an diesem frühen Morgen wirkte er sogar noch attraktiver durch seine glückliche Miene. Für jedes Milchmädchen und jeden Straßenkehrer in der Rue Royale war klar, dass sich dieser britische Offizier des Lebens erfreute, entzückt war, in Belgien zu sein, und dass er erwartete, jeder in Brüssel teile seine Lebensfreude, Gesundheit und sein Glück.
Er erwiderte den Gruß des Wachtpostens, der vor dem Eingangsportal stand, und ritt dann in langsamem Galopp durch Brüssels vornehme Straßen bis zu einem großen Haus in der Rue de la Blanchisserie. Es war noch früh, doch auf dem Hof des Hauses herrschte reger Betrieb. Händler lieferten mit Karren Stühle, Musikständer, Lebensmittel und Wein. Ein Stallbursche übernahm das Pferd des Kavallerieoffiziers, während ein livrierter Lakai Helm und Degen von ihm entgegennahm. Der Kavallerieoffizier fuhr sich mit der Hand durch sein langes goldblondes Haar, als er die Treppe zum Haus hinaufeilte.
Er wartete nicht darauf, dass die Diener die Tür öffneten, sondern stieß sie auf, durchquerte die Eingangshalle und ging in den großen Ballsaal, wo ein Dutzend Anstreicher und Polsterer die Arbeit einer langen Nacht beendeten, mit der sie den Ballsaal in eine seidenverhangene Pracht verwandelt hatten. Glänzende goldene, scharlachrote und schwarze Bahnen Seide waren von der Decke drapiert worden, und die Wände waren frisch tapeziert, damit die Tapete mit Rosenmuster die feuchten Flecke auf dem Putz verbarg. Die riesigen Kronleuchter waren auf den Boden herabgelassen worden, wo Arbeiter Hunderte weißer Kerzen in die frisch geputzten Halter aus Silber und Kristall steckten. Andere Arbeiter drehten Efeuranken um Säulen, die orangefarben angestrichen worden waren, während eine ältere Frau den Boden mit Kalk puderte, damit die Tänzer auf dem polierten Parkett nicht ausrutschten.
Der Kavallerieoffizier war sichtlich erfreut über all die Vorbereitungen. Er schritt durch den Saal. »Bristow! Bristow!« Seine Stiefel hinterließen Abdrücke im frisch gestreuten Kalk. »Bristow! Alter Halunke! Wo sind Sie?«
Ein weißhaariger Mann in schwarzem Rock und mit der abgeschlafften Miene eines Funktionärs, der die Verantwortung für die Vorbereitung des Balls trug, trat aus dem Speiseraum. Seine missmutige Miene hellte sich sofort zu einem erfreuten Lächeln auf, als er den jungen Kavallerieoffizier erkannte. Er verneigte sich tief. »Mylord!«
»Guten Tag, Bristow. Es ist eine Freude, Sie zu sehen.«
»Es ist eine Freude, Eure Lordschaft wiederzusehen. Ich hatte nicht gehört, dass Eure Lordschaft in Brüssel ist.«
»Ich traf gestern ein. Spät in der Nacht.« Der Kavallerist, Lord John Rossendale, schaute auf die üppigen Dekorationen im Speisesaal, wo die langen Tische mit weißen Tischdecken und mit Silber und feinem Porzellan gedeckt waren. »Ich konnte nicht schlafen«, erklärte er sein frühes Auftauchen. »Wie viele Personen kommen heute Abend?«
»Wir haben vierhundertvierzig Einladungskarten verteilt, Mylord.«
»Vierhundertzweiundvierzig kommen also.« Lord John Rossendale grinste Bristow an, brachte wie ein Zauberer einen Brief zum Vorschein und hielt ihn dem älteren Mann unter die Nase. »Zwei Einladungskarten, wenn Sie so freundlich sind.«
Bristow nahm den Brief, entfaltete ihn und las. Der Brief war vom Privatsekretär der Herzogin, und die Hoheit stimmte freudig zu, dass Lord John Rossendale eine Einladung zum Ball erhalten sollte. Eine Einladungskarte, hieß es, und Bristow wies höflich darauf hin. »Da steht nur etwas von einer Einladung, Mylord.«
»Zwei, Bristow, zwei, zwei, zwei. Tun Sie, als ob Sie nicht lesen können. Ich bestehe auf zwei. Es müssen zwei sein! Oder wollen Sie, dass ich auf den Speisetischen ein Tohuwabohu anrichte?«
Bristow lächelte. »Ich bin sicher, wir können zwei beschaffen, Mylord.« Bristow war der Butler des Herzogs von Richmond, dessen Gattin den Ball in diesem großen gemieteten Haus gab. Jeder wollte diesen Ball besuchen. Viele Leute der Londoner Gesellschaft waren in diesem Sommer nach Brüssel gereist. Es gab Armeeoffiziere, denen es äußerst peinlich sein würde, wenn sie nicht eingeladen wurden, und auch der einheimische Adel musste berücksichtigt werden. Die Antwort der Herzogin auf den Wunsch so vieler, den Ball zu besuchen, hatte darin bestanden, Einladungskarten drucken zu lassen. Dennoch rechnete Bristow mit mindestens so vielen Eindringlingen wie Karteninhabern. Vor zwei Tagen hatte die Herzogin Anweisung gegeben, dass keine Einladungskarten mehr ausgegeben wurden, aber es war unwahrscheinlich, dass dieses Verbot Lord John Rossendale einschloss, dessen Mutter eine enge Freundin der Herzogin von Richmond war.
»Ihre Hoheit frühstückt bereits. Möchten Sie ihr Gesellschaft leisten?«, fragte Bristow.
Lord John folgte dem Butler in die privaten Räume, wo in einem kleinen, von Sonnenschein erhellten Salon die Herzogin beim Frühstück saß. »Ich schlafe nie vor einem Ball«, begrüßte sie Lord John, und dann blinzelte sie ihn erstaunt an. »Was machen Sie denn hier?«
Lord John küsste der Herzogin die Hand. Die Herzogin trug eine Robe aus chinesischer Seide und hatte ihr Haar unter einer Morgenhaube zusammengesteckt. Sie war eine lebhafte Frau mit bemerkenswert gutem Aussehen.
»Ich bin natürlich gekommen, um die Einladungskarten für den Ball abzuholen«, sagte Lord John leichthin. »Ich nehme an, Sie geben den Ball zur Feier meiner Ankunft in Brüssel.«
»Was treiben Sie in Brüssel?« Die Herzogin ging über Lord Johns spöttische Bemerkung hinweg.
»Ich bin hierher abkommandiert worden«, erklärte Lord John. »Ich traf gestern Nacht ein. Wenn eines unserer Kutschpferde kein Hufeisen verloren hätte, wäre ich eher eingetroffen. Es dauerte vier Stunden, bis wir einen Schmied fanden. Ich konnte ebenfalls nicht schlafen. Das ist einfach die Aufregung.« Er lächelte glücklich und erwartete, dass die Herzogin seine Freude teilte.
»Sie sind mit der Armee hier?«
»Selbstverständlich.« Lord John zupfte an seinem Uniformrock, als wäre es seine Referenz. »Henry Paget ersuchte um mich, ich bat um Prinnys Erlaubnis, und der Prinz gab schließlich nach.« Lord John war zwar Kavallerieoffizier, hatte jedoch nie bei der Armee dienen dürfen. Er war Adjutant des Prinzregenten, der nicht auf seine Dienste hatte verzichten wollen, aber Henry Paget, der Graf von Uxbridge, der ein anderer Günstling des Prinzen war und Britanniens Kavallerie befehligte, hatte den Prinzen überredet, Lord John seine Chance zu geben. Lord John lächelte, während er zu einem Beistelltisch ging und sich mit Toast, Schinken und Kaffee bediente. »Prinny ist verdammt neidisch. Er findet, er sollte hier sein, um gegen Napoleon zu kämpfen. Apropos Napoleon – gibt es irgendwelche Neuigkeiten?«
»Arthur erwartet keinen Unsinn von ihm bis Juli. Wir nehmen an, dass er Paris vielleicht verlassen hat, aber keiner ist sich dessen wirklich sicher.« Arthur war der Herzog von Wellington. »Ich fragte Arthur, ob wir heute Abend bei unserem Ball sicher sind, und er versicherte mir, dass mit keiner Gefahr zu rechnen ist. Er gibt selbst einen Ball in der nächsten Woche.«
»Ich muss sagen, der Krieg ist ein Martyrium.« Lord John lächelte die Herzogin an.
Die Herzogin ignorierte die flapsige Bemerkung und musterte den eleganten jungen Mann misstrauisch. »Sind Sie allein gekommen?«
Lord John lächelte sie gewinnend an und nahm am Tisch Platz. »Bristow ist so freundlich und treibt zwei Einladungskarten für mich auf.«
»Ich nehme an, es ist diese Frau?«
Lord John zögerte und nickte dann. »Ja, es ist Jane.«
»Verdammt, Johnny.«
Die Herzogin sagte es in sehr mildem Tonfall, doch Lord John ärgerte sich über die Zurechtweisung. Er mochte die Herzogin jedoch zu sehr, um ernsthaft zu protestieren.
Die Herzogin sagte sich, dass sie Lord Johns Mutter schreiben und bekennen musste, dass der dumme Junge seine Geliebte nach Brüssel mitgebracht hatte. Sie gab dem Beispiel von Henry Paget die Schuld, der mit der Frau von Wellingtons jüngerem Bruder durchgebrannt war. Solch ein offener Ehebruch war plötzlich der Modesport unter Kavalleristen, aber er konnte leicht zu einem tödlichen Sport werden, und die Herzogin fürchtete um Lord Johns Leben. Sie nahm auch Anstoß daran, dass ein so charmanter und begehrter junger Mann wie Lord John seine Dummheit öffentlich zur Schau stellte. »Wenn es London wäre, Johnny, würde ich es Ihnen nicht im Traum erlauben, die Frau zu meinem Ball mitzubringen, aber ich nehme an, in Brüssel ist das etwas anderes. Da kann man kaum sagen, wer die Hälfte der Gäste sind. Aber stell mir das Mädchen nur ja nicht vor, denn ich werde es nicht empfangen. Ist das klar?«
»Jane ist sehr reizend …«, begann John seine Geliebte zu verteidigen.
»Es ist mir gleichgültig, ob sie reizend und schön wie Titania und so charmant wie Cordelia ist. Sie ist und bleibt die Frau eines anderen Mannes. Haben Sie gar keine Sorge wegen ihres Mannes?«
»Die hätte ich, wenn er hier wäre, aber das ist er nicht. Am Ende des Krieges fand er irgendeine Französin und zog zu ihr, und soweit ich weiß, ist er immer noch in Frankreich.« Lord John lachte leise. »Der arme Narr ist vielleicht von Napoleon gefangen genommen worden.«
»Sie glauben, er ist in Frankreich?«, fragte die Herzogin entgeistert.
»Gewiss nicht mit der Armee, dafür habe ich gesorgt.«
»Oh, mein lieber Johnny.« Die Herzogin stellte ihre Kaffeetasse ab und betrachtete Lord John mitfühlend. »Sind Sie nicht auf die Idee gekommen, die Mannschaftslisten der Holländer zu überprüfen?«
Lord John Rossendale sagte nichts. Er starrte die Herzogin nur an.
Sie schnitt eine Grimasse. »Lieutenant Colonel Sharpe ist im Stab des Dünnen Wilhelm, Johnny.«
Rossendale erbleichte. Sekundenlang war er sprachlos, doch dann fand er die Stimme wieder. »Er ist beim Prinzen von Oranien? Hier?«
»Nicht in Brüssel, aber sehr nahe. Der Dünne Wilhelm wollte einige britische Stabsoffiziere, weil er britische Truppen befehligt.«
Rossendale schluckte. »Und er bekam Sharpe?«
»So ist es.«
»Oh, mein Gott!« Rossendale war totenblass. »Kommt Sharpe heute Abend?«, fragte er in plötzlicher Panik.
»Ich habe ihn nicht eingeladen, aber ich gab Wilhelm zwanzig Einladungskarten, und wer weiß schon, wen er mitbringt.« Die Herzogin sah ihm die Angst an. »Vielleicht sollten Sie besser daheimbleiben, Johnny.«
»Das kann ich nicht.« Wenn Lord John fortlief, würde man das als schändliche Feigheit betrachten, aber es entsetzte ihn, zu bleiben. Er hatte Richard Sharpe nicht nur Hörner aufgesetzt, sondern ihm im Laufe des Verhältnisses mit dessen Frau sein Vermögen gestohlen, und nun musste er feststellen, dass sein Feind nicht in Frankreich verloren war, sondern lebte und sich nahe bei Brüssel aufhielt.
»Armer Johnny«, sagte die Herzogin spöttisch. »Dann kommen Sie und tanzen Sie heute Abend. Lieutenant Colonel Sharpe wird es nicht wagen, Sie in meinem Ballsaal zu töten, und ich werde es nicht zulassen. Aber an Ihrer Stelle würde ich ihm seine Frau zurückgeben und mir etwas Passenderes suchen. Wie wäre es mit dem Huntley-Mädchen? Sie hat ein anständiges Vermögen und ist nicht die Hässlichste.« Die Herzogin zählte ein halbes Dutzend andere Mädchen auf, die alle zu haben und aus adligem Hause waren, aber Lord John hörte nicht hin. Er dachte an einen dunkelhaarigen Soldaten mit einer Narbe auf der Wange, dem er Hörner aufgesetzt und den er um sein Geld betrogen hatte, an einen Soldaten, der geschworen hatte, ihn aus Rache zu töten …
Etwa vierzig Meilen südlich verblutete in diesem Moment der Lieutenant der Dragoner, der von seinem sterbenden Pferd getreten worden war. Er starb, bevor ein Sanitäter oder Arzt ihn erreichte. Der Bursche des Lieutenants durchwühlte die Habe des Toten. Er behielt die Geldmünzen des Offiziers, steckte das Medaillon ein, das er an einer Kette am Hals getragen hatte, und nahm sich die Stiefel. Das Buch über Phrenologie warf er weg. Die erste französische Infanterie schlachtete das Pferd des toten Lieutenants mit Bajonetten und marschierte mit blutigen Fleischstücken am Koppel nach Belgien. Eine Stunde später passierte die Kutsche des Kaisers die Leiche und störte die Fliegen, die über das Gesicht des toten Lieutenants krochen und ihre Eier in seinen blutgefüllten Mund und die Nasenlöcher legten.
Der Feldzug war vier Stunden alt.
Die preußischen Geschütze wurden bis nördlich von Charleroi zurückgezogen. Der Artillerieoffizier fragte sich, warum niemand auf den Gedanken gekommen war, die Brücke über die Sambre im Zentrum der Stadt in die Luft zu jagen. Er nahm an, es musste Furten bei Charleroi geben, was eine Zerstörung der schönen Steinbrücke sinnlos gemacht hätte. Als die Geschütze fort waren, wartete die schwarzuniformierte preußische Kavallerie in der Stadt nördlich des Flusses und verstärkte die Infanteriebrigade, die aus den Häusern nahe der Brücke die Möbel plünderte und daraus halbherzig eine Barrikade am Nordende der Brücke errichtete. Die Bürger der Stadt blieben vernünftigerweise in den Häusern und schlossen die Fensterläden. Viele von ihnen holten die sorgfältig aufbewahrten Trikoloren aus ihren Verstecken. Bis vor einem Jahr war Belgien ein Teil Frankreichs gewesen, und viele Leute in diesem Teil der Provinz ärgerten sich darüber, zu einem Teil der Niederlande gemacht worden zu sein.
Die Franzosen näherten sich Charleroi auf allen Straßen von Süden. Die Dragoner mit den grünen Uniformröcken trafen als Erste in der Stadt ein, gefolgt von Kürassieren und Lanzenreitern. Keiner der Reiter versuchte, eine Passage über die verbarrikadierte Brücke zu erzwingen. Stattdessen trabten die Lanzenreiter, zu denen viele Belgier zählten, ostwärts und suchten eine Furt. Auf dem Nordufer beobachtete ein Trupp schwarzuniformierter preußischer Husaren die Lanzenreiter, und als diese Husaren eine Biegung des Sambre-Tals umrundeten, entdeckten sie einen Trupp französischer Pioniere, die eine Pontonbrücke vom Südufer aus zu Wasser brachten. Sechs Pioniere waren zum nördlichen Ufer geschwommen, wo sie ein Tau an einer großen Ulme befestigten. Die Husaren zogen ihre Säbel und trieben die unbewaffneten Pioniere in den Fluss zurück, aber französische Artillerie war bereits ans Südufer gelangt, und als die Husaren ihre Pferde zum Trab antrieben, flogen die ersten Kanonenkugeln übers Wasser. Sie prallten ein paar Schritte vor den Husaren am Ufer auf und donnerten dann in ein Waldstück, wo sie eine Schneise durch das Unterholz fetzten.
Der Hauptmann der Husaren befahl seine Männer zurück. Er sah rote Uniformen flussaufwärts am Ufer, ein Beweis, dass die Lanzenreiter eine Furt gefunden hatten. Er führte seine Männer zurück nach Charleroi, wo ein halbherziger Musketenkampf über den Fluss hinweg geführt wurde. Die französischen Dragoner waren in den südlichen Häusern in Stellung gegangen, während die preußische Infanterie mit den dunkelblauen Uniformröcken und schwarzen Helmen eine Linie hinter der Barrikade bildete. Der Husaren-Hauptmann meldete einem preußischen Brigadekommandeur, dass der Feind bereits im Begriff war, die Stadt zu umzingeln, woraufhin der größte Teil der preußischen Infanterie schnell nordwärts geschickt wurde. Eine letzte französische Salve fetzte Splitter aus der Barrikade aus Möbeln, dann herrschte Stille in der Stadt. Die preußischen Husaren, die mit einem Bataillon Infanterie zurückgeblieben waren, um die nördliche Hälfte von Charleroi mit einer Garnison zu belegen, warteten, während französische Infanterie in die Stadt gelangte und die Häuser am Südufer des Flusses einnahm. Glas klirrte auf Pflastersteinen, als Soldaten Fensterscheiben herausschlugen, um primitive Schießscharten für ihre Musketen zu schaffen.
Einen knappe halbe Meile südlich der Brücke durchsuchten die ersten französischen Stabsoffiziere die Post in Charlerois Postamt nach Briefen, die von Offizieren der Alliierten aufgegeben worden waren und vielleicht Hinweise auf britische oder preußische Pläne gaben. Solche Hinweise kamen zu der Vielzahl von Nachrichten hinzu, die in letzter Zeit in Napoleons Hauptquartier eingetroffen waren und von Belgiern stammten, die lieber wieder zu Frankreich gehören wollten. Die Trikoloren, die aus den oberen Etagen der befreiten Häuser von Charleroi hingen, waren der Beweis für diese Sehnsucht.
Ein französischer Général der Dragoner fand einen bebrillten Colonel der Infanterie in einer Schenke nahe beim Fluss und fragte ihn ärgerlich, warum die verbarrikadierte Brücke nicht eingenommen worden war. Der Colonel erklärte, dass er noch auf Befehle warte, und der Général fluchte wie der gemeine Soldat, der er einst gewesen war, und sagte, ein französischer Offizier brauche keine Befehle, wenn der Feind deutlich zu sehen sei. »Greifen Sie jetzt an, Sie verdammter Narr, es sei denn, Sie wollen aus den Diensten des Kaisers ausscheiden.«
Der Colonel, geübt in richtiger Kriegsführung, führte die Angriffslust des Générals auf Aufregung zurück und versuchte höflich, den alten Mann zu beruhigen, indem er erklärte, dass es vernünftiger war, zu warten, bis die Artillerie in der Stadt eintraf. Erst dann hatte es seiner Meinung nach Sinn, die Infanterie anzugreifen, die die verbarrikadierte Brücke verteidigte. »Zwei Salven Kanonenfeuer werden sie wegfegen«, erklärte der Colonel, »und dann ist es nicht nötig, dass wir Verluste riskieren. Ich halte das für das einzig Vernünftige, Sie nicht?« Der Colonel schenkte dem Général ein gönnerhaftes Lächeln. »Vielleicht möchte der Général eine Tasse Kaffee?«
»Zur Hölle mit Ihrem Kaffee! Und zur Hölle mit Ihnen!« Der Général packte den Colonel am Uniformrock und riss den Mann so nahe an sich heran, dass er die Knoblauch- und Cognacfahne des Générals riechen konnte. »Ich greife die Brücke jetzt an«, sagte der Général, »und wenn ich sie eingenommen habe, komme ich hierhin zurück, reiße Ihnen die Eier ab und übergebe Ihr Regiment einem richtigen Mann.«
Er ließ den Colonel los und verließ die Schenke. Eine preußische Musketenkugel knallte in eine Hauswand, die mit Plakaten beklebt war, die einen Jahrmarkt am Feiertag Peter und Paul ankündigten. Jemand hatte mit Kreide in großen Buchstaben quer über die Plakate geschrieben: »Vive l’Empereur!« – Es lebe der Kaiser!
»Sie da!« Der Général rief einen Infanterie-Lieutenant an, der sich vor dem sporadischen preußischen Feuer in eine Gasse duckte. »Bringen Sie Ihre Männer! Folgen Sie mir! Hornist! Zum Sammeln blasen!« Der Général winkte seinem Burschen, sein Pferd zu bringen. Er ignorierte das preußische Musketenfeuer, schwang sich in den Sattel und zog seinen Säbel. »Franzosen!«, rief er, um so viele Männer zu sammeln, wie in Hörweite waren. »Bajonette! Säbel!«
Der Général wusste, dass die Stadt eingenommen und damit der Schwung des Vormarschs an diesem Tag erhalten werden musste, und so führte er einen bunt zusammengewürfelten Haufen zum Angriff gegen die preußischen Infanteristen, die hinter der Barrikade aufgereiht standen. Er glaubte, einen niedrigeren Teil am Ende der aufgestapelten Möbelreihe zu sehen, über die ein Pferd hinwegspringen konnte. Der Général trieb sein Pferd zum Trab, und die Hufeisen schlugen Funken auf dem Kopfsteinpflaster.
Der Général war sich darüber im Klaren, dass er vielleicht fallen würde, denn die Infanterie machte sich ein Vergnügen daraus, Kavalleristen zu töten, und er würde beim Angriff auf die Brücke der Reiter an der Spitze sein, aber der Général war Soldat durch und durch und hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass der wahre Feind des Soldaten die Furcht vor dem Tod ist. Diese Furcht galt es zu besiegen, dann war der Sieg sicher, und der Sieg brachte Ruhm und Ehre und Medaillen und Geld, und das Beste von allem, das Glorreichste und Wundervollste von allem, der Sieg schenkte einem das leicht spöttische Grinsen eines kleinen schwarzhaarigen Kaisers, der dem Général der Dragoner einen freundlichen Klaps geben würde, als wäre er ein treuer Hund. Bei dem Gedanken an diese Gunst des Kaisers ritt der Général schneller und zog seinen Säbel. »Attacke!«
Hinter ihm, angetrieben durch sein Beispiel, stürmte eine Masse unberittener Dragoner und schwitzender Infanteristen auf die Brücke zu. Der Général, dessen weißer Schnurrbart Flecken von Tabaksaft aufwies, preschte auf die Brücke zu.
Die preußische Infanterie legte ihre Musketen auf der Barrikade auf.
Der Général sah das Glänzen von Musketen, die den Sonnenschein reflektierten. »Tötet die Bastarde! Tötet die Bastarde!«, schrie er, um sich einzureden, dass er keine Angst hatte, und plötzlich war die Barrikade in Rauch gehüllt, durch den Mündungsfeuer stachen wie Lichtspeere, und im Donnern der Salve wurde der lange weiße Schnurrbart des Générals von einer Kugel gepeitscht, die ihm das linke Ohrläppchen abriss. Das war jedoch die einzige Verletzung, denn er hatte stets Glück gehabt, und dann setzte das Pferd über die aufgestapelten Möbel am Ende der Barrikade hinweg. Das Pferd sprang durch den stinkenden Rauch. Der Général sah, dass ein Bajonett auf das Tier zustach, und er drosch mit dem Säbel hinab, schlug das Bajonett zur Seite, und das Pferd setzte sicher jenseits der Barrikade auf und galoppierte aus dem Rauch. Die preußischen Husaren, die fünfzig Schritte von der Brücke entfernt gewartet hatten, um Platz für einen Angriff auf jeden zu haben, der die Reihen der Infanterie durchbrach, trieben ihre Pferde an, aber der Général ignorierte sie. Er parierte sein Pferd, zog es um die Hand und ritt zurück zur Barrikade und zu den entsetzten Infanteristen.
»Bastarde! Bastarde!« Der Général tötete einen preußischen Soldaten mit einem Säbelhieb. Die anderen Infanteristen flüchteten. Es waren nicht viele Preußen an der Brücke, denn sie hatten nur dazu gedient, den französischen Vormarsch zu verzögern. Mündungsfeuer stachen von der französischen Seite her über die Barrikade, und der Général schrie seine Männer an, das Feuer einzustellen und stattdessen die Barrikade niederzureißen.
Die preußische Infanterie rannte nordwärts. Die Kavallerie, die sah, dass die Franzosen die Brücke mit unverschämter Leichtigkeit eingenommen hatten, machte kehrt und folgte den Fußsoldaten. Der französische Général wusste, dass er sich den freundlichen Klaps von Napoleon verdient hatte. »Ihr feigen Hunde!«, schrie er dem Feind nach. »Ihr Memmen! Ihr Schoßhündchen! Bleibt und kämpft, ihr Abschaum!« Er spuckte aus. Blut von seinem verletzten Ohr tropfte auf seine linke Epaulette mit dem vergoldeten Adler.
Französische Infanterie beseitigte die Barrikade. Ein einziger toter preußischer Infanterist, der bereits gefleddert worden war, lag vor der Brücke. Ein Sergent der Dragoner zog die Leiche zur Seite, als weitere Kavalleristen auf die Brücke ritten. Eine Frau lief aus einem Haus am Nordufer und wurde fast von einem Trupp Dragoner niedergeritten. Die Frau hielt einen Strauß getrockneter Veilchen, deren Blätter fast fliederfarben verblasst waren. Sie lief zu dem französischen Général und hielt ihm den Veilchenstrauß hin. »Kommt er?«, fragte sie und schaute zu dem grimmig dreinblickenden Offizier auf dem Pferd empor.
Sie brauchte nicht zu erklären, wer mit »er« gemeint war. Der Général lächelte. »Er kommt, ma poule.«
»Die sind für Sie.« Die Frau hielt die getrockneten Veilchen hoch. Während Napoleons Zeit im Exil war das Veilchen das Symbol der Bonapartisten gewesen, denn das Veilchen war die Blume, die wie der gestürzte Kaiser im Frühjahr zurückkehren würde.
Der Général griff hinab und nahm den kleinen Veilchenstrauß entgegen. Er steckte die getrockneten Blumen in ein Knopfloch seines Uniformrocks, neigte sich hinab und küsste die Frau. Wie sie hatte der Général gebetet und auf die Rückkehr des Veilchens gehofft, und jetzt war es so weit, und es würde prächtiger denn je erblühen. Frankreich war auf dem Vormarsch. Charleroi war gefallen, und es gab keine Flüsse mehr zwischen dem Kaiser und Brüssel. Der Général witterte den Sieg. Er zog sein Pferd herum und machte sich auf die Suche nach dem Infanterie-Colonel, der sich geweigert hatte, die Brücke anzugreifen, und dessen militärische Karriere deshalb zu Ende war. Frankreich brauchte keine Zauderer, sondern Kühnheit und Siege und den kleinen schwarzhaarigen Mann, der wusste, wie man Siege errang, die so strahlend wie die Sonne und schön wie das Veilchen waren. Vive l’Empereur.
KAPITEL 3
Ein einzelner Reiter näherte sich Charleroi von Westen her. Er ritt am Nordufer der Sambre, angelockt vom Musketenfeuer, das vor einer Stunde noch laut gewesen, jetzt jedoch verstummt war.
Der Mann ritt ein großes fügsames Pferd. Er mochte das Reiten nicht sonderlich und ritt schlecht.
Es war ein großer Mann mit von Wind und Wetter gegerbtem Gesicht, das von einer großen Narbe an der linken Wange verunziert wurde. Die Narbe verlieh ihm einen spöttischen, sardonischen Ausdruck, der erst verschwand, wenn er lächelte. Sein Haar war schwarz, hatte jedoch ein paar weiße Strähnen. Hinter dem Reiter folgte gehorsam ein Hund. Der Hund gefiel dem Mann, denn das Tier war groß, wild und ungepflegt.
Der Mann trug französische Kavalleriestiefel, die oft geflickt worden waren, aber noch weich und fest saßen. Zu den verschrammten Stiefeln trug er eine französische Kavalleriehose, die im Schritt und am Gesäß mit Leder verstärkt war. Die roten Streifen an der Außennaht der Hose waren längst zu einem hellen Rosa verblasst. Zu der Kavalleriehose trug er einen verblichenen grünen Uniformrock mit verwaschener schwarzer Paspelierung. Es war ein Uniformrock der 95th Rifles Britanniens, jetzt jedoch so fadenscheinig geflickt, dass es der Rock eines Landstreichers hätte sein können. Der braune Dreispitz des Mannes stammte weder von der französischen noch von der britischen Armee, sondern war auf dem Markt der Stadt Caen in der Normandie gekauft worden. Auf dem Dreispitz thronte die scharlachrote, goldene und schwarze Kokarde der Niederlande.
Im Sattelfutteral des Mannes steckte ein in Britannien hergestelltes Baker-Gewehr. Hinter den Gürtel hatte der Mann eine langläufige deutsche Pistole geschoben, und an seiner linken Hüfte hing eine verschrammte Scheide mit einem schweren britischen Kavalleriesäbel. Der Mann wirkte wie die Karikatur eines Soldaten in einer zerlumpten, zusammengewürfelten Uniform, und er saß so graziös auf dem Pferd wie ein Sack Mehl.
Sein Name war Richard Sharpe, und er war britischer Soldat. Er kam aus der Gosse, war das Kind einer Hure und nur dem Galgen entkommen, weil er sich für einen Shilling des Königs beim 33rd Regiment gemeldet hatte. Er wurde zum Sergeant, und später, nach einem Akt selbstmörderischer Tapferkeit, wurde er als einer der wenigen Männer aus den Mannschaften zum Offizier befördert. Er war zum Schützenregiment der 95th Rifles gegangen und hatte später die Rotröcke der »Eigenen Freiwilligen des Prinzen von Wales« befehligt. Er hatte in Flandern gekämpft, in Indien, Portugal, Spanien und Frankreich. Er war fast sein ganzes Leben Soldat gewesen, doch bis vor Kurzem hatte er als Landwirt in der Normandie gelebt, zurückgeblieben im Land seiner Feinde wegen einer Frau, die er durch Zufall im Chaos des Friedens kennengelernt hat. Jetzt, im Chaos des Krieges, und weil Napoleon aus dem Exil nach Frankreich zurückgekehrt war und eine neue Schlacht um Europa erzwingen wollte, war Sharpe Lieutenant Colonel beim Fünften Belgischen Leichten Dragoner-Regiment. Er hatte das Regiment nie kennengelernt, wünschte auch nicht, es kennenzulernen, und hätte es nicht erkannt, wenn es sich in Linie formiert und ihn angegriffen hätte. Die Beförderung diente nur dazu, Richard Sharpe einen Status für den Stab des Prinzen von Oranien zu geben, doch Sharpe betrachtete sich selbst nach wie vor als Rifleman.
Die aufgehende Sonne, die ins Sambre-Tal schien, blendete Sharpe. Er schob den Dreispitz tief über die Augen. Die Landschaft, durch die er ritt, war sumpfig, und er war gezwungen, auf einem Zickzackkurs den gefährlichen Stellen auszuweichen. Sharpe blickte immer wieder nach Norden, um sich zu vergewissern, dass keine feindlichen Truppen auftauchten und ihn beim Fluss festnagelten. Er glaubte nicht, dass die Schüsse, die er gehört hatte, von Franzosen abgegeben worden waren. Mit einem Vormarsch der Franzosen war erst im Juli zu rechnen, und gewiss nicht in diesem Teil Belgiens, und so nahm Sharpe an, dass das Musketenfeuer von preußischen Truppen abgegeben worden war, die Schießübungen veranstaltet hatten. Dennoch wollte er feststellen, was es mit den Schüssen auf sich hatte, denn er hatte im Krieg schon viele Überraschungen erlebt.
Sein Pferd scheuchte Wasservögel auf, und einmal stoben ein paar Kaninchen in einem Feld davon. Sharpes Hund witterte ein Frühstück und machte sich an die Verfolgung. »Nosey, du Hundesohn! Bei Fuß!« Der Hund war Nosey genannt worden, weil der Herzog von Wellington diesen Spitznamen bei seinen Männern hatte. Wellington hatte Sharpe zwanzig Jahre lang Befehle gegeben, und als Sharpe im Frieden den Hund gefunden hatte, war er entschlossen gewesen, das Kompliment zurückzugeben.
Nosey kehrte widerwillig zu Sharpe zurück. Dann sah der Hund etwas jenseits des Flusses und bellte warnend. Sharpe bemerkte Reiter. Im ersten Augenblick nahm er an, es wären Preußen, doch dann erkannte er die Form der stoffbedeckten Helme. Dragoner. Franzosen. Sein Puls beschleunigte sich. Nach der Schlacht von Toulouse hatte er gedacht, dass die Zeit des Kämpfens für ihn vorüber war, dass Frieden in Europa herrschte, weil sich Napoleon auf Elba im Exil befand, doch nun, vierzehn Monate später, war der alte Feind wieder in Sicht.
Sharpe trieb das Pferd zum Handgalopp. Die Franzosen waren also in Belgien. Vielleicht war es nur ein Kavallerieangriff. Die feindlichen Dragoner hatten Sharpe gesehen und ritten zum Flussufer, doch keiner versuchte, den hier tiefen Fluss zu durchqueren. Zwei Reiter mit den grünen Uniformröcken zogen ihre Karabiner aus den Sattelfutteralen und zielten auf Sharpe, aber ihr Offizier gab den Befehl, nicht zu schießen. Sharpe war zu weit entfernt für die Gewehre mit den kurzen, glatten Läufen.
Sharpe ritt vom Fluss fort und lenkte das Pferd neben ein Roggenfeld. Die Halme waren fast mannshoch. Der Feldweg führte hügelan. Dann ging es eine Böschung hinab zu einer zerfurchten Straße, die von Bäumen gesäumt war und Sharpe vor den Dragonern verbarg. Sharpe nahm eine Landkarte aus seiner Satteltasche. Er entfaltete die Karte und trug mit einem Bleistiftstummel darauf ein, wo er die feindliche Kavallerie gesehen hatte. Das Kreuz, das er malte, war nur eine geschätzte Angabe, denn er wusste nicht genau, wie weit er von Charleroi entfernt war.
Sharpe steckte die Karte weg, öffnete seine Feldflasche und trank kalten Tee. Dann nahm er den Hut ab, dessen Krempe sein ungewaschenes Haar niedergedrückt hatte. Er rieb sich übers Gesicht, gähnte und setzte den Hut wieder auf. Er schnalzte und lenkte das Pferd zu einem Einschnitt, von dem aus er einen Blick durch die niedrigen Hügel nördlich von Charleroi werfen konnte. Dort stieg Staub von einer Straße auf, aber selbst durch das verschrammte alte Fernrohr konnte Sharpe nicht erkennen, was den Staub aufwirbelte und in welche Richtung er zog.
Es konnte eine ganz einfache Erklärung für die Staubwolke geben: Sie konnte von einer Rinderherde verursacht werden, die zum Markt getrieben wurde, von einem preußischen Regiment im Manöver oder von einem Arbeitstrupp, der die Straße pflasterte. Sharpe hatte jedoch vor einiger Zeit Musketenfeuer gehört, und die Anwesenheit von feindlichen Dragonern auf dem südlichen Ufer der Sambre ließ wie die Schüsse auf eine bedrohliche Ursache schließen.
Eine Invasion? Seit Tagen hatte es keine Nachrichten mehr aus Frankreich gegeben, ein Beweis dafür, dass Napoleon allen Verkehr über die Grenze verboten hatte, doch dieses Schweigen musste nicht zwangsläufig auf eine bevorstehende Invasion hinweisen, sondern eher auf eine Verheimlichung, wo genau sich die französischen Streitkräfte konzentrierten. Die besten Geheimdienstler der Alliierten waren der festen Überzeugung, dass die Franzosen nicht vor dem Juli bereit waren und dass sie auf ihrem Angriff durch Mons vorrücken würden, nicht durch Charleroi. Die Straße nach Mons bot die beste Route nach Brüssel, und wenn Brüssel fiel, konnte Napoleon die Briten zur Nordsee zurücktreiben und die Preußen wieder über den Rhein. Die Einnahme Brüssels bedeutete für die Franzosen den Sieg.
Sharpe trieb sein Pferd über die zerfurchte Straße, die in ein Tal hinabführte, bevor sie zwischen zwei Weiden wieder anstieg. Er hielt sich auf dem Gras neben der Straße, um keinen Staub aufzuwirbeln, der seine Anwesenheit verriet. Die Stute atmete schwer, als sie in das Weideland hinauftrabte. Sie war an Bewegung gewöhnt, denn in den vergangenen zwei Wochen hatte Sharpe sie jeden Morgen um drei Uhr gesattelt und war nach Süden geritten, um den Tagesanbruch über dem Sambre-Tal zu beobachten, doch heute Morgen hatte er das Musketenfeuer im Osten gehört und war mit der Stute viel weiter geritten als sonst. Der Tag drohte auch der heißeste des Sommers zu werden, aber Sharpe war besorgt wegen des mysteriösen Auftauchens des Feindes, und so zwang er das Tier vorwärts.
Wenn dies die französische Invasion war, dann musste die Nachricht schnell das Hauptquartier der Alliierten erreichen. Die britischen, holländischen und preußischen Armeen bewachten ungefähr achtzig Meilen der anfälligen holländischen Grenze – die Preußen im Osten und die Briten und Holländer im Westen. Die vereinigten Streitkräfte waren wie ein Netz verteilt, um Napoleon in die Enge zu treiben, und wenn der Kaiser das Netz berührte, sollte es sich zusammenziehen, sodass er sich darin verfing. Das war die Kriegslist, doch Napoleon wusste über die Hoffnungen der Alliierten Bescheid wie jeder britische oder preußische Offizier, und er würde planen, das Netz in zwei Stücke zu zerfetzen und sie getrennt auseinanderzureißen. Es war Sharpes Pflicht, herauszufinden, ob dies Napoleons Schlag zum Zerfetzen des Netzes war oder nur ein Kavallerieüberfall tief in der belgischen Provinz.
Von der nächsten Hügelkuppe aus sah er weitere französische Dragoner. Sie waren etwa eine halbe Meile entfernt, jedoch auf derselben Flussseite wie Sharpe, und sie blockierten ihm den Weg nach Charleroi. Sie sahen ihn und trieben ihre Pferde an. Sharpe lenkte seine erschöpfte Stute nordwärts und gab ihr die Sporen. Er galoppierte über die Straße hinweg, überquerte Weideland und gelangte in ein kleines Tal, dessen Hänge zu beiden Seiten eines Baches mit Dornengestrüpp bewachsen waren. Sharpe zwang sein Pferd durch die Büsche und schwenkte nach Osten ein. Weit voraus sah er einen Wald. Wenn er in den Schutz der Bäume gelangte, gab es vielleicht eine Chance, die Landstraße von der anderen Seite des Waldes aus zu beobachten.
Die französischen Dragoner gaben sich damit zufrieden, dass sie den einsamen Reiter verjagt hatten, und sie verfolgten ihn nicht. Sharpe klopfte seiner Stute den schweißnassen Hals. »Weiter, Mädchen! Weiter!« Sie war ein sechsjähriges Jagdpferd, ausdauernd, kräftig und gefügig, eines der Pferde, die Sharpes Freund Patrick Harper aus Irland geholt hatte.
Im Wald zwischen den riesigen alten Bäumen war es kühler und sehr still. Der Hund Nosey trottete dicht hinter der Stute her. Sharpe ritt langsam zwischen den alten Bäumen und an vor langer Zeit gefällten moosbewachsenen Stämmen vorbei. Lange bevor er den anderen Waldrand erreichte, wusste er, dass die Aktion der Franzosen nicht nur ein Kavallerieüberfall war. Er wusste es, weil er die unverkennbaren Geräusche von Artillerie auf dem Marsch hörte.
Sharpe zügelte das Pferd, saß ab und band die Zügel an den tiefen Ast einer Eiche. Er nahm einen Strick aus seiner Satteltasche, knüpfte eine Schlinge, legte sie Nosey als improvisiertes Halsband an und zog sein Gewehr aus dem Sattelfutteral. Er spannte das Gewehr und machte sich leise auf den Weg. Das Hundehalsband hielt er mit der linken Hand, das Gewehr in der rechten.
Der Wald endete vor einem Weizenfeld, das zur Straße hinabfiel, über der eine Staubwolke in der heißen Luft hing. Sharpe spähte durch sein Fernrohr hinab auf den alten, vertrauten Feind.
Französische Infanterie mit den blauen Uniformröcken marschierte durch den niedergetrampelten Weizen zu beiden Seiten der Straße und überließ die Straße der Artillerie. Die Kanonen waren Zwölfpfünder. Alle paar Minuten hielten die Geschütze an, wenn irgendein Hindernis den Weg für die lange Kolonne blockierte. Stabsoffiziere galoppierten auf prächtigen Pferden an den Straßenrändern entlang. Auf dem fernen Hang des Tals ritt ein Trupp Lanzenreiter im Handgalopp durch ein Feld und hinterließ eine Schneise von zertrampeltem Weizen.
Sharpe hatte keine Uhr. Er schätzte, dass er zwei Stunden am Waldrand geblieben war und in dieser Zeit zweiundzwanzig Geschütze und achtundvierzig Versorgungswagen gezählt hatte. Er sah auch zwei Kutschen, in denen vielleicht ranghohe Offiziere fuhren, und er spielte mit dem Gedanken, dass in einer der Kutschen vielleicht Napoleon persönlich saß. Sharpe hatte über zwanzig Jahre gegen die Franzosen gekämpft, aber er hatte noch nie den Kaiser gesehen, und plötzlich und ungewollt stieg vor seinem geistigen Auge das kindische Bild eines Teufels auf und weckte in Sharpe Ängste, die noch verstärkt wurden durch den Ruf des Kaisers als genialen Soldaten, dessen Anwesenheit auf einem Schlachtfeld ein ganzes Korps Männer wert war.
Die Franzosen marschierten immer noch nordwärts. Sharpe zählte achtzehn Infanteriebataillone und vier Schwadronen Kavallerie, von denen eine, die aus Dragonern bestand, sehr nahe an seinem Versteck am Waldrand vorbeiritt. Keiner der Dragoner blickte jedoch in den Schatten am Waldrand, wo Sharpe und der Hund reglos verharrten. Die Franzosen ritten so nahe an Sharpe vorbei, dass er ihre Cadenettes sehen konnte, die Zöpfe, die sie auszeichneten. Ihre Ausrüstung sah gut und neu aus, und ihre Pferde waren gut genährt. In Spanien hatten die Franzosen ihre Pferde vernachlässigt und zuschanden geritten, doch diese Dragoner ritten kräftige und gesunde Tiere.
Neu berittene Kavallerie, achtzehn Bataillone Infanterie und zweiundzwanzig Kanonen bildeten noch keine Armee, waren jedoch zweifellos eine Bedrohung. Sharpe wusste, dass er viel mehr sah als einen Kavallerieüberfall, doch er war sich nicht sicher, ob dies wirklich die Invasion war. Es war möglich, dass diese Männer nur als Täuschungsmanöver dienten, um die Alliierten nach Charleroi zu locken, während der wahre französische Vorstoß, angeführt von Napoleon, westlich bei Mons stattfand.
Sharpe zog sich vom Waldrand zurück, ging zu seinem Pferd und schwang sich müde in den Sattel. Es war jetzt seine Aufgabe, dem alliierten Hauptquartier zu melden, was er gesehen hatte.
Die Franzosen hatten die Grenze überquert, und folglich hatte der Feldzug begonnen. Sharpe erinnerte sich, dass Lucille, die Frankreich verlassen hatte, um an seiner Seite zu bleiben, zu irgendeinem vornehmen Ball eingeladen war, der heute Abend in Brüssel stattfinden sollte. Alle Vorbereitungen und Ausgaben waren jetzt für die Katz gewesen, denn Kaiser Napoleon hatte soeben den gesellschaftlichen Kalender neu geschrieben. Sharpe, der das Tanzen hasste, lächelte bei dem Gedanken …
Zwei Meilen entfernt, in Charleroi, saß Napoleon vor dem Gasthaus Belle-Vue. Seine Kutsche war außer Sicht geparkt, und sein weißes Reitpferd war an einem Pfosten am Straßenrand angebunden, damit die vorbeimarschierenden Soldaten dachten, ihr Kaiser reite in den Krieg, anstatt sich in gepolstertem Komfort fahren zu lassen. Die Männer ließen ihren Kaiser hochleben, als sie vorbeimarschierten. »Vive l’Empereur! Vive l’Empereur!« Die Trommler, die den Marschrhythmus trommelten, schlugen Trommelwirbel, als sie erkannten, dass ihr Kaiser so nahe war. Die Soldaten konnten nicht an ihr Idol heran, denn Napoleon wurde von Wachen beschützt, doch einige Männer traten aus dem Glied und küssten den Schimmel des Kaisers.
Napoleon zeigte keine Reaktion auf die Speichelleckerei. Er saß reglos da, trug trotz der drückenden Hitze einen Mantel, und sein Gesicht war fast verborgen unter der Hutspitze, die er nach vorn gezogen hatte, um seine Augen zu beschatten. Er saß mit gesenktem Kopf auf einem niedrigen Stuhl und wirkte für alle Welt wie ein tief in Gedanken versunkenes Genie, doch in Wirklichkeit schlief er tief und fest.
Jenseits der eingenommenen Brücke stieß ein französischer Artillerieoffizier die Leiche des preußischen Infanteristen in die Sambre. Einen Augenblick lang verfing sich der Leichnam an einem halb versunkenen Baumstamm, dann löste ein Wasserstrudel den Toten, und die Strömung trug ihn westwärts.
Der Feldzug war sechs Stunden alt.
Sharpe ritt aus dem Wald und lenkte die Stute nach Nordwesten. Das müde Pferd hatte einen Weg von über zwanzig Meilen durch unwegsames Terrain vor sich, und so ließ Sharpe das Tier gemächlich traben. Die Sonne brannte vom Himmel wie in jenen Tagen der langen Feldzüge in Spanien. Der Hund, der scheinbar unermüdlich war, streifte ungeduldig voraus.
Es dauerte gut fünf Minuten, bis Sharpe die französischen Dragoner bemerkte, die ihn verfolgten. Die feindlichen Reiter zeichneten sich als Silhouetten vor dem südlichen Horizont ab, und Sharpe nahm an, dass sie ihm gefolgt waren, seit er den Wald verlassen hatte. Er verfluchte seine Sorglosigkeit und trieb die erschöpfte Stute mit den Hacken zum Galopp. Er hoffte, die Franzosen würden sich damit zufriedengeben, ihn von der Landstraße zu verjagen, anstatt ihn weiter zu verfolgen und gefangen zu nehmen, doch als er schneller ritt, gaben auch die Franzosen ihren Pferden die Sporen.
Sharpe schwenkte westwärts ab, fort von der Straße nach Brüssel, die offenbar von den Dragonern bewacht wurde. Eine halbe Stunde lang trieb er das Pferd hart an, immer in der Hoffnung, seine Flucht würde die Dragoner veranlassen, ihre Verfolgung aufzugeben. Aber die Franzosen waren stur, oder die Jagd war eine willkommene Unterbrechung ihrer Langeweile. Ihre Pferde waren frischer, und sie holten auf. Sharpe versuchte, die größten Hügel zu umreiten, um die Stute zu schonen, doch schließlich steckte er in einem langen Tal in der Falle und war gezwungen, die Stute einen steilen, mit Gras bewachsenen Hang hinaufzutreiben, der zu der kahlen Hügelkuppe hinaufführte.
Die Stute kämpfte sich tapfer den Hügelhang hinauf, aber selbst die lange Rast im kühlen, schattigen Wald hatte ihr nicht die volle Kraft wiedergegeben. Sharpe trieb das Pferd zum Galopp, die Scheide mit dem schweren Säbel an seiner Seite hüpfte auf und ab, und der Griff schlug schmerzhaft gegen seinen linken Oberschenkel. Die Dragoner bildeten einen Pulk wie Reiter bei einem Jagdrennen, als sie den Fuß des Hangs erreichten. Ein Franzose hatte seinen Karabiner aus dem Sattelfutteral gezogen und feuerte jetzt aus großer Distanz auf Sharpe, doch die Kugel flog harmlos über ihn hinweg.
Die Stute atmete rasselnd, als sie die Hügelkuppe erreichte. Sie wollte stehen bleiben. Sharpe trieb sie durch eine Lücke in einer Hecke und ritt über eine gewellte Weide, die vor vielen Jahren gepflügt worden war und deren alte Furchen immer noch Wellen bildeten. Sharpe ritt über die grasbewachsenen Wellen, und die Stute rüttelte ihn mit jedem Schritt über den harten, unebenen Boden durch. Nosey lief voraus, schlug einen Bogen und kehrte zurück, bellte glücklich und lief neben dem erschöpften Pferd her.
Sharpe blickte zurück und sah, dass die ersten Dragoner auf der Hügelkuppe waren. Sie hatten sich verteilt und galoppierten, um ihn gefangen zu nehmen. Das Weideland fiel vor Sharpe ab zu einem Eichenwald, aus dem ein Feldweg nordwärts zu einem großen Bauernhaus führte, das mit seinen Steinwänden wie eine Miniaturfestung wirkte. Sharpe schaute wieder zurück und sah, dass die nächsten Dragoner nur noch fünfzig Schritte entfernt waren. Sie hatten die langen Degen gezogen. Sharpe wollte seinen Säbel ebenfalls ziehen, doch als er mit der Rechten die Zügel losließ, stürzte er fast aus dem Sattel, weil die Stute sofort stehen bleiben wollte. »Weiter!«, schrie er und gab dem Pferd die Sporen. »Weiter!«
Er blickte nach rechts und sah ein weiteres halbes Dutzend Dragoner heranjagen, die ihm den Weg zu dem Feldweg abschneiden wollten. Er fluchte und lenkte die Stute wieder mehr westwärts. Das gab den Verfolgern nur einen besseren Winkel zum Aufholen. Der Wald war nur noch hundert Yards entfernt, doch die Stute war am Ende ihrer Kraft und wurde immer langsamer. Selbst wenn er es in den Wald schaffte, würden ihn die Dragoner bald einholen. Sharpe fluchte erbittert. Wenn er überlebte, würde er den Krieg als Gefangener verbringen.
Plötzlich blies eine ferne Trompete zur Attacke. Sharpe wandte den Kopf und sah zu seinem Erstaunen schwarzuniformierte Reiter in wilder Jagd von dem festungsähnlichen Bauernhaus und den Nebengebäuden herangaloppieren. Es mussten mindestens zwanzig Kavalleristen sein, die über den Feldweg preschten. Sharpe erkannte die Kavalleristen als Preußen. Staub wirbelte unter den Pferdehufen empor, und die gezogenen Säbel der Preußen blitzten im Sonnenschein.
Die französischen Dragoner, die am nächsten bei den Preußen waren, machten sofort kehrt und galoppierten auf den Hügel zurück, auf ihre Kameraden zu. Sharpe trieb die Stute ein letztes Mal verzweifelt mit den Hacken an, und dann zog er den Kopf ein, als das Tier am Waldrand durch Farn stampfte und in den kühlen Wald eintauchte. Die Stute würde nicht weitergehen. Sie schleppte sich gerade noch zwischen die Bäume und blieb zitternd und schnaufend mit schweißnassem Fell stehen. Sharpe zog seinen Säbel.
Zwei Dragoner folgten Sharpe in den Wald. Sie galoppierten heran, und der Mann an der Spitze griff Sharpe von links an, der andere hielt sich rechts. Sharpe verharrte mit dem Rücken zu den Angreifern, weil die Stute zu erschöpft war, um kehrtzumachen. Er drehte sich im Sattel, um den Angriff des Mannes zu seiner Linken zu parieren. Die Klinge des Franzosen klirrte hell gegen Sharpes Säbel und schrammte dann über den Stahl, bis sie von dem schweren Griff gestoppt wurde. Sharpe schlug die Klinge des Dragoners weg und fuhr verzweifelt mit dem Säbel herum, um den Angriff des zweiten Mannes abzuwehren. Der Schwung war so heftig, dass Sharpe aus dem Gleichgewicht geriet, doch er erschreckte auch den zweiten Dragoner, der aus der Reichweite von Sharpes Säbel zurückzuckte und abschwenkte. Sharpe klammerte sich an der Mähne der Stute fest und richtete sich auf. Beide Dragoner waren an ihm vorbeigaloppiert und zogen jetzt ihre Pferde um die Hand, um zum zweiten Mal anzugreifen.
Auf dem Weideland hinter Sharpe formierten sich die Preußen zu einer Linie. Die verbliebenen Dragoner, die in der Unterzahl waren, hatten sich vorsichtig zum Hügel hin zurückgezogen. Diese Konfrontation ging Sharpe nichts an. Er hatte es mit den beiden Dragonern zu tun, die ihn im Wald angriffen. Sie spähten an Sharpe vorbei und schätzten ab, wie sie am besten zu ihren Kameraden stoßen konnten, aber es war klar, dass sie zuerst Sharpe töten wollten.
Einer der beiden zog seinen Karabiner aus dem Sattelfutteral. »Fass ihn, Nosey!«, rief Sharpe, und zugleich stieß er der Stute so heftig die Sporen in die Flanken, dass das erschöpfte und erschreckte Pferd einen Satz machte und Sharpe fast abwarf. Er schrie die beiden Dragoner an, versuchte sie zu erschrecken. Der Hund sprang den Mann an, der mit seinem Karabiner beschäftigt war und deshalb nicht mit dem Säbel auf den Hund hinabschlagen konnte. Dann prallte Sharpes Stute gegen das Pferd des Franzosen, und Sharpe schlug mit dem schweren Kavalleriesäbel zu. Die Klinge traf den mit Stoff bedeckten Helm an der Spitze, und in den Ohren des Mannes dröhnte und klingelte es. Der Franzose rief verzweifelt seinen Kameraden zu Hilfe, der versuchte, hinter Sharpe zu gelangen, um ihm die Klinge in den Rücken zu stoßen.
Sharpe schlug von Neuem mit dem Säbel zu, und diesmal traf er den Helm an der Hinterseite. Die Klinge fetzte den Stoff vom Helm, und verschrammtes Metall kam zu Vorschein. Der Dragoner ließ den Karabiner fallen und fuchtelte mit seinem Säbel herum. Der Mann war ungeschickt. Sharpe stieß seinen Säbel vor, doch Nosey erschreckte das Pferd des Franzosen, das scheute und seinen Reiter aus Sharpes Reichweite trug.
Schweiß brannte in Sharpes Augen. Alles wirkte verschwommen. Er trieb die Stute vorwärts und hob den Säbel. Dann hörte er hinter sich einen Ruf und ruckte herum. Er sah, dass zwei deutsche Soldaten den zweiten Franzosen angriffen. Klingen klirrten gegeneinander, ein Schrei ertönte und verstummte unvermittelt. Sharpe schaute wieder zu seinem eigenen Feind, doch der Dragoner hatte genug und ergab sich.
»Nosey! Bei Fuß! Lass ihn!«
Der andere Dragoner war tot. Ein Husar hatte ihm mit dem Säbel die Kehle durchgeschnitten. Der Mann, der das getan hatte, grinste Sharpe an und säuberte seine Klinge an der Mähne seines Pferdes. Der Sergeant trug einen silbernen Totenkopf und darunter gekreuzte Knochen auf seinem schwarzen Helm, ein Anblick, der Sharpes Gefangenen noch nervöser machte.
Die anderen Dragoner zogen sich über den Hügel zurück. Sie wollten nicht gegen die Überzahl der schwarz uniformierten Husaren kämpfen. Der Husarenoffizier an der Spitze seiner Männer forderte den französischen Offizier höhnisch zum Duell heraus, doch der Franzose war zu klug, um sein Leben für eine solch sinnlose Heldentat zu riskieren.
Sharpe ergriff die Zügel des Pferdes, auf dem der Dragoner saß. »Steig runter«, sagte er zu dem Mann auf Französisch.
»Der Hund, Monsieur!«
»Runter vom Pferd! Beeilung!«
Der Gefangene saß ab und stolperte auf Sharpe zu. Als er seinen verbeulten Helm absetzte, kam hellblondes Borstenhaar zum Vorschein. Das stupsnasige Gesicht des Dragoners erinnerte Sharpe an Jules, den Sohn des Müllers von Seleglise, der Sharpe bei Lucilles Schafherde half und der so aufgeregt gewesen war, als Napoleon nach Frankreich zurückgekehrt war. Der gefangen genommene Dragoner begann zu zittern, als er von deutscher Kavallerie umzingelt wurde.
Der preußische Hauptmann sprach ärgerlich auf Deutsch mit Sharpe. Sharpe schüttelte den Kopf. »Sprechen Sie Englisch?«
»Nein. Können wir uns vielleicht auf Französisch verständigen?«
Sie sprachen Französisch. Der Husaren-Hauptmann war wütend, weil sich der französische Offizier geweigert hatte, mit ihm zu kämpfen. »Keiner darf heute kämpfen! Wir wurden aus Charleroi wegbefohlen. Warum sind wir überhaupt in die Niederlande gekommen? Warum geben wir Napoleon nicht einfach die Schlüssel von Berlin, und damit hat sich’s? Wer sind Sie, Monsieur?«
»Mein Name ist Sharpe.«
»Brite, wie? Ich heiße Ziegler. Wissen Sie, was, zum Teufel, los ist?«
Ziegler und seine Männer waren von einem ganzen Regiment Lanzenreiter westwärts getrieben worden. Wie die Dragoner auf dem Weideland hatte sich Ziegler angesichts der ungleichen Chancen zurückgezogen. Er und seine Männer hatten auf dem Bauernhof gerastet und Sharpes schmachvolle Flucht beobachtet. »Immerhin haben wir einen der Bastarde getötet.«