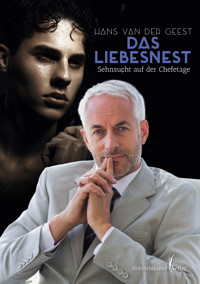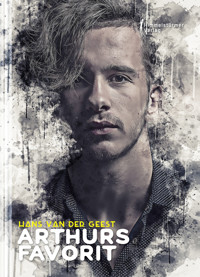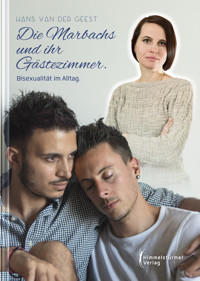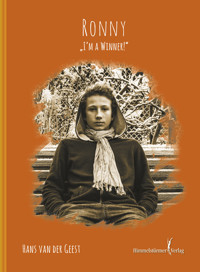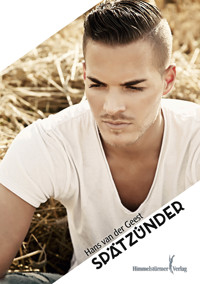
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1944 – Hungerwinter in Holland, im letzten Jahr des zweiten Weltkrieges. Die deutsche Besatzung befiehlt die Männer zwischen 17 und 40 Jahren zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Viele Männer tauchen unter und verstecken sich in einem Strohvorrat, auch Jan und Ted. Verdrängte Sehnsucht blüht zwischen ihnen auf. Der Friede im Frühling bringt nicht nur Erleichterung. Ted ist todkrank, aber ihre gegenseitige Liebe bleibt stark. Im letzten Winter des Zweiten Weltkrieges bleibt das westliche Holland unter deutscher Besatzung. Durch den Bahnstreik kommen die Nahrungstransporte in die Städte fast zum Erliegen. Es entstehen Hungersnöte. Außerdem brauchen die Deutschen Ersatz für die fehlenden Arbeiter in ihren Fabriken. Dazu befehlen sie die Männer zwischen 17 und 40 Jahren zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Viele Holländer verstecken sich aber. In Den Haag verkriecht sich ein Dutzend Männer auf einem Stapelplatz für Stroh. Jan und der Friseur Ted sind auch dabei. Durch den engen Kontakt und in der gespannten Atmosphäre kommen sich die zwei schnell näher. Die letzte Nacht im Stroh wird ihre Liebesnacht. Die weiteren Kriegsmonate sind von unvorstellbarem Elend gekennzeichnet. Jan und Ted überleben, auch ihre Familien. Im Freudentaumel, der am Kriegsende ausbricht, wird leider klar, dass Ted an unheilbarer Tuberkulose leidet. Obwohl er neben seiner Frau und seinen Kindern auch Jan sehr liebt, plagt ihn sein Gewissen über die Freundschaftsbeziehung. Jan ist ihm mit Hilfe und Liebe bis zum Ende treu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans van der Geest
Spätzünder
Von Hans van der Geest im Himmelstürmer Verlag bisher erschienen:
Wilde Treue - Frühjahr 2015, ISBN print 978-3-86361-548-2
Plötzlich Pflegeväter - Herbst 2016, ISBN print 978-3-86361-570-3
Das Kuckuckkind - Frühjahr 2017, ISBN 978-3-86361-629-8
Alle Bücher auch als E-book
Himmelstürmer Verlag, part of Production House, Hamburg
www.himmelstuermer.de
E-Mail: [email protected]
Originalausgabe, August 2017
© Production House GmbH
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
Zuwiderhandeln wird strafrechtlich verfolgt
Rechtschreibung nach Duden, 24. Auflage
Coverfoto: ©panthermedia.net
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, Grafik-Designer AGD, Hamburg. www.olafwelling.de
E-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH
ISBN print 978-3-86361-659-5
ISBN e-pub 978-3-86361-660-1
ISBN pdf 978-3-86361-661-8
Alle hier beschriebenen Personen und alle Begebenheiten sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist nicht beabsichtigt.
Mit Dank an Peter Schär für die sprachlichen Korrekturen.
Historische Einführung
Nachdem der zweite Weltkrieg am ersten September 1939 mit dem Überfall der deutschen Truppen auf Polen angefangen hatte und in kurzer Zeit die polnischen Gebiete von der deutschen Wehrmacht und von der Sowjetunion erobert worden waren, trat eine lange Periode ohne solche aufsehenerregenden Kampfhandlungen ein. Im Rückblick spricht man von „The Phoney War“, weil sich fast nichts Kriegerisches ereignete. Im April 1940 endete diese Zeit abrupt mit dem deutschen Einfall in Norwegen. Kurz darauf, am 10. Mai 1940, brachen dann gewaltige Kämpfe aus, indem die Deutschen Frankreich, Belgien und die neutralen Niederlande angriffen.
Der Krieg dauerte für die Niederlande genau fünf Tage, aber im Grunde genau fünf Jahre, bis zum 8. Mai 1945, als die Deutschen über die ganze Linie kapitulierten.
Der Anfang dieser Kriegszeit war blutig. Mit ihrer Übermacht auf dem Land und in der Luft, mit einer Schlacht am Grebbeberg und einer Terrorbombardierung auf Rotterdam zwang die Wehrmacht das kleine Land zur raschen Kapitulation. Die Königin und die Regierung konnten gerade noch rechtzeitig nach London entkommen.
Zuerst versuchten die Besatzer – anders als in Polen – das Wohlwollen der Niederländer zu gewinnen. Sie gaben sich als die kultivierten Herrscher eines neuen Europas. Bis auf die Juden betrachteten sie das eroberte Volk als Mitglied in der Familie der Edelgermanen.
Die Judenverfolgung, welche bald eintrat, bedeutete das definitive Ende der niederländischen Geduld. Es entstanden im ganzen Land Widerstandsgruppen, die den Besatzern so stark wie möglich zu schaden versuchten.
Mit dem Schwinden ihrer Siegeschancen, besonders nach der verheerenden Niederlage in Stalingrad im Jahre 1943, traten die Deutschen immer brutaler auf. Sie raubten Materialien und Rohstoffe für ihre Kriegsführung. Kirchenglocken, Lastwagen und Straßenbahnwagen wurden abtransportiert, und kräftige Männer wurden in deutschen Städten und Fabriken zur Arbeit gezwungen.
Die niederländische Bevölkerung war, bis auf wenige Mitglieder einer national-sozialistischen Partei, den Deutschen entschieden feindlich gesinnt. Trotz erbarmungsloser Bekämpfung illegaler Gruppen stieg die Zahl junger Männer, die sich den Widerstandskämpfern anschlossen.
Nach der Landung in der Normandie im Juni 1944 wuchs die Hoffnung, dass die Alliierten die Niederlande bald befreien würden. Kräftiger deutscher Widerstand führte jedoch dazu, dass der nördliche Teil des Landes mit den Großstädten bis Kriegsende in den Händen der Deutschen blieb. Eine Landung der Engländer bei Arnheim misslang.
Die Niederländer taten, was sie konnten, um den Alliierten zu helfen. Viel konnte das nicht sein. Sie streikten bei der Bahn. Der ganze Schienenverkehr kam definitiv zum Stillstand. Das war jedoch nicht nur für die Besatzung ein Problem, auch die Bewohner der besetzten Gebiete waren betroffen. In den Großstädten begannen Nahrung und Kohlen zu fehlen. Im Herbst 1944 fiel der Schulbetrieb aus, weil die Lokalitäten zu kalt waren.
Der Hungerwinter hatte begonnen. Die Monate November bis Kriegsende im Mai 1945 waren die allerschwersten des Krieges. Kälte und Hunger rafften Tausende dahin. Auch Terror und Bombardierungen forderten ihren Zoll.
Zu allem Übel kamen die V2-Raketen zum Einsatz. Sie wurden von den westlichen Gebieten des Landes abgefeuert, damit sie in London ihre zerstörerische Wirkung ausüben konnten. Zahlreiche dieser Raketen kamen jedoch nach dem Abschuss nicht in die richtige Position, sodass sie abstürzten. Oft fielen sie auf Wohngebiete und verursachten dutzendfach Tote.
Im November befahlen die Besatzer in Rotterdam und Den Haag allen Männern zwischen 17 und 40 Jahren, sich für Arbeitseinsätze in Deutschland zu melden. Viele traten an, viele tauchten unter. Wehrmachtsoldaten durchsuchten die Wohnungen nach Verstecken. Auf der Straße sah man wochenlang keine jungen Männer mehr. Ihrer Arbeit konnten die Untergetauchten nicht mehr nachgehen.
Müll wurde nicht mehr eingesammelt. Überall in den Straßen türmten sich Abfallberge. Alles Brennbare wurde mitgenommen: Holzschwellen von den Straßenbahnschienen, Bäume, Teile aus leerstehenden Wohnungen – alles musste her, damit man die Wohnungen ein wenig erwärmen konnte.
Der Schwarzhandel grassierte in großem Ausmaß. Wer raffiniert genug war, beteiligte sich und verdiente auf diese Weise das Geld, um Brot und Kartoffeln zu kaufen. Wer nur vom Wenigen, das legal zur Verfügung stand, überleben wollte, stand auf verlorenem Posten. Diese Armen starben an Hungerödem oder anderen Krankheiten. Holz für Särge war nicht mehr vorhanden, man begrub die Toten in Kartonhüllen.
Inzwischen verblieben in der Region nur noch kleine Teile der Wehrmacht, die kaum noch kampffähig waren. Sie ließen zu, dass Schweden im Februar den hungernden Holländern Brot lieferte. Ende April durften britische Flugzeuge sogar ganze Nahrungspakete „droppen[1]“.
Als die Deutschen kapitulierten, brach ein ungekannter Jubel los. Die Schulen öffneten ihre Tore wieder. Zu essen gab es immer noch wenig, aber doch genügend. Wohlstand lag noch in weiter Ferne. Aber die Niederländer waren wieder frei. Das allein schon reichte für eine wochenlange Ekstase der Freude.
Abgesehen von der frei erfundenen Geschichte von Jan und Ted sind die Begebenheiten in „Spätzünder“ genauso wirklich geschehen, wie sie erzählt werden. Mein Vater war einer der im Stroh untergetauchten Männer.
Jan
Es war noch angenehm sommerlich kühl, obwohl der Herbst begonnen hatte. Ja kühl, denn warm ist es ja nie in der Nacht, und ich musste bereits um sechs Uhr morgens in der Bäckerei sein. Natürlich war es noch völlig dunkel, wenn ich von zuhause wegging. Wenn wir dann um halb sieben mit den Brotwagen in unsere Quartiere zogen, fing es erst an, hell zu werden.
Es war heikel, in der Finsternis durch die Straßen zu gehen, denn nirgends brannte Licht. Ziemlich rasch, nachdem die Deutschen 1940 unser Land überfallen und besetzt hatten, war totales Dunkel befohlen worden. Die Umrisse der Häuser waren zu sehen, jedoch an vielen Stellen musste man erraten, wo die Bordsteinkanten waren, vor allem wenn es regnete. Allerdings kannte ich meine Route, ich hätte sie fast mit geschlossenen Augen ablaufen können.
Als ich an jenem Morgen auf meinem Weg zur Arbeit über den Hobbemaplatz ging - den breiten Platz neben dem Markt – kam mir ein Motorrad mit zwei Soldaten entgegen. Der Lärm zerriss die Stille der Nacht.
„Stehen bleiben!“, rief der eine Moff zu einem Passanten auf der anderen Straßenseite. Das Motorrad hielt an. Es war plötzlich wieder still. Der Fahrer bemühte sich aber laut um den Passanten. Dann stieg der Beifahrer aus, kam in meine Richtung und rief auch mir zu: „Stehen bleiben!“
Ich hatte das noch nie erlebt und reagierte nicht sofort. Da schrie er nochmals: „Stehen bleiben!“
Ich blieb stehen, zu Tode erschrocken. Der Soldat kam auf mich zu. Er hinkte ein wenig.
„Was machen Sie hier? Sie wissen doch, dass Sperrstunde ist?“
Zum Glück verstehe ich ein wenig Deutsch. Ich bin an der Grenze aufgewachsen und in meinen jungen Jahren habe ich manchmal in Deutschland zu tun gehabt.
„Ich arbeite in der Bäckerei“, rechtfertigte ich mich. Ich zitterte und stotterte, bin eben kein Held.
„Ausweis!“
Ich suchte das Papier. Nervös griff ich zuerst in die falschen Taschen, schließlich fand ich es.
Der Ausweis war die Erlaubnis, an Wochentagen nach fünf Uhr morgens in Den Haag auf der Straße zu sein. Der Soldat sah ihn sich an. Die Beine gespreizt, stand er vor mir, als ob er mich mit seiner Breite am Weitergehen hindern wollte. Obwohl es dunkel war, konnte ich ihn gut sehen. Ich stellte sofort fest, dass er ein schöner Mann war.
Das sehe ich immer schnell …
Auf einmal änderten sich seine Haltung und sein Ton. Er stellte die Beine wieder zusammen und wurde ein schlanker Mann. „Ach so, sind Sie Bäcker?’
„Nein, ich bin Ausläufer, ich bringe das Brot zu den Leuten.“
Darauf lächelte er mich sogar an. Er reichte mir meinen Ausweis herüber. „Mein Vater war auch Bäcker!“, sagte er und sah mich an.
Ich war im Zwiespalt. Ich hatte mir geschworen, nie im Leben mehr mit einem Deutschen zu reden. Weil sie unser Land überfallen, Rotterdam bombardiert hatten und die Juden malträtierten.
Der freundliche Ton dieses mächtig schönen Hünen erweichte mich jedoch sekundenschnell. Ich wollte ihn merken lassen, dass ich trotz allem nicht ungern mit ihm zu tun hatte.
„Ist er jetzt nicht mehr Bäcker?“, fragte ich ihn.
„Er ist gefallen, in Polen, vor fünf Jahren.“
Gut so, dachte ich. Ein Moff[2] weniger!
„Ach“, sagte ich. Zu meinem Rachegedanken gesellte sich sofort die spannende Feststellung, dass der Deutsche mir etwas Persönliches, Zartes preisgab. Das war nicht nur aus der Mitteilung selbst, sondern auch aus dem Klang seiner Stimme zu hören.
„Ja, ja”, fuhr er fort, „es wird Zeit, dass dieser Scheißkrieg endlich aufhört.“
Das war ein Seufzer. Was vertraute er mir da an!
Er zog sich einen seiner Handschuhe aus und schaute hinauf in den nächtlichen Himmel.
Ich war verblüfft, wie sich seine anfängliche Schroffheit auf einmal verwandelt hatte. Er schien Nähe zu suchen. Meine Abneigung gegen ihn als Vertreter seiner Sorte und meine Sympathie für ihn als Person konnte ich schwer auf einen Nenner bringen. Deshalb schwieg ich.
Und schön war er! Ein germanisches Bleichgesicht mit einem warmen Blick. Es war noch Nacht, aber ich sah es! Und es geht mir immer so: Ich kann meinen Blick von schönen Männern fast nicht losreißen. Doch ich wusste wirklich nicht, was ich noch sagen konnte in meinem holprigen Deutsch.
„Noch einen guten Tag gewünscht!“, sagte er mir.
„Danke“, reagierte ich und ging meines Wegs.
Er trat nicht sofort weg. Als ich mich umschaute, sah ich, dass er noch etwas in ein Büchlein schrieb.
Dann geschah etwas Unerwartetes in mir. Ich hatte plötzlich Lust, ihm etwas Nettes zu sagen. Weil er ein attraktiver Mann war, nur deshalb.
Ich ging nochmals auf ihn zu. Er blickte auf.
„Danke, was Sie da sagten. Ich möchte auch, dass bald nicht mehr Krieg ist. Ich wünsche Ihnen alles Gute!“
Einen Moment lang war er sichtlich überrascht. Dann lachte er.
„An mir wird es nicht liegen! Ich kann sowieso nicht mehr viel machen, mit dem Hinkefuß da!”
„Sind Sie denn verwundet?”, wagte ich zu fragen.
„Andenken an Russland. So geht das im Krieg. Fürs Vaterland.” Das tönte bitter.
Dann wandte er sich seinem Kollegen zu und stieg wieder auf das Motorrad.
Ich war über mich selbst verdutzt, obwohl ich mich ein wenig kenne. Prinzipien schmelzen bei mir schnell weg, wenn ich berührt bin. Und das war ich.
Der Dreckmoff. Und so schön!
Am Abend erzählte ich es meiner Frau. Cor wollte es zuerst nicht glauben. „Und du hast immer gesagt, du würdest nie mehr ein Wort mit einem Moff reden?“
„Ja, ich weiß. Darum erzähle ich es ja! Bei mir ist einfach eine Schraube locker. Ich sollte mich schämen, nicht wahr?“
„Ach komm, nein! Nimm’s nicht so schwer. Er war ja nett, sagtest du?“
„Nein, mehr als nett! Er war ein schöner Mensch, ich hätte ihn umarmen können!“
„Huh! Hahaha! Ihn umarmen können! Einen Moff umarmen!“
„Ja, lach nur!“
„Na ja, es sind schließlich auch Menschen. Der kann nichts dafür, dass er mitmachen muss. Er sagte ja Scheißkrieg. Der wird kein großer Freund von Hitler sein!“
Sie schenkte mir Tee ein, nach unserer Mahlzeit.
„Weißt du, Jan: Der hat dich vielleicht genauso nett gefunden! Dass er so persönlich geworden ist!“
„Nein, es war nur wegen dem Bäcker. Sein Vater war ja Bäcker gewesen.“
„Das weißt du doch nicht! Vielleicht hat er dich sympathisch gefunden.“
„Ja, warum nicht?“, reagierte ich lachend. „Ich bin hübsch genug, oder was meinst du?”
„Bald vierzig bist du, aber immer noch hübsch. Für mich jedenfalls!”
„Wenn Friede wäre und wenn er kein Moff wäre, wer weiß, könnten wir gute Freunde sein!”
„Das wollte ich eben sagen!”
Mit Cor kann ich offen reden. Sie weiß, dass ich nicht nur Frauen, sondern auch Männer manchmal schön finde. Ich sage ihr immer, sie selbst sei für mich die Schönste von allen. Ich weiß, dass das nur ein Spruch ist, aber ich habe meine Frau wirklich gern. Und das will ich damit ausdrücken.
Wir sind bald zehn Jahre verheiratet, ich war neunundzwanzig damals, sie sechsundzwanzig. Wir kannten uns von Kind an, wohnten wir doch im selben Dorf. Cor war oft ein wenig schwer von Begriff, wirklich nur ein wenig, fast unmerklich. Sie sei nicht ganz wie die anderen, sagte man von ihr. Cor grinste dann, wenn sie das hörte. Es schien sie nicht zu stören.
Sie war hübsch! Und jetzt ist sie immer noch eine attraktive Frau, nur ein bisschen dick. Ich sage ihr immer, sie solle entweder ein Korsett tragen oder nicht so viel essen. Sie hat ja ein Korsett, aber trägt es nicht. Sie fühlt sich unwohl in dem Gitter. Und zum Thema Essen: In letzter Zeit haben wir sowieso nicht viel zu essen. Für sie ist das nicht nur schlecht. Wie für all die Magenkranken. Als wir im Überfluss zu essen hatten, klagten sie immer über Schmerzen. Seit Knappheit herrscht, sind sie geheilt. Wozu ein Krieg gut sein kann!
Cor ist nicht nur hübsch, sie ist auch freundlich in einem Maß, wie man das selten antrifft. Sie schaut offen und mit einem Lächeln in die Welt hinaus. Jedermann hat sie gern. Die Kinder in unserer Straße rennen immer auf sie zu, wenn sie sie sehen. „Tante Cor! Tante Cor!”, rufen sie.
Leider haben wir selber keine Kinder. Das geht eben nicht. Es ist eine traurige Geschichte.
Cor suchte als Kind und als junges Mädchen Schutz bei mir. Manchmal wurde sie gehänselt und ausgelacht, da sie etwas unbeholfen war. Dann suchte sie bei mir Zuflucht. Ich habe sie oft verteidigt und ihre Quäler in die Flucht getrieben.
Meine Eltern warnten mich mit der Zeit. Ich solle mich nicht zu fest an Cor binden, denn sie sei als Hausfrau nicht geeignet. Sie sei eben nicht wie die anderen.
Ich konnte indessen kein Mädchen finden. Meine Kameraden schmusten mit ihren Freundinnen schon ewig lange herum, und ich fand keinen Anschluss. Darunter habe ich gelitten. Ich wollte alles tun, damit ich endlich eine richtige Freundin bekam. Aber sobald ich mit einer Kandidatin unterwegs war, fehlte mir die Lust, sie näher kennenzulernen.
Ich träumte von Jungen. Wenn ich mit mir spielte, kamen mir immer Männer in den Sinn, nie Frauen. Das sagte ich natürlich niemandem. Ich weiß, dass es nicht richtig ist, was ich mit mir selbst tat und was für Vorstellungen ich in mir zuließ. Ich weiß nicht, warum ich solche schlechten Gedanken bekomme. So bin ich nun einmal.
Dann habe ich es mit Cor versucht. Sie widerte mich nicht an, wie fast alle anderen Frauen, im Gegenteil. Ich musste nie Angst vor ihr haben. Und sie war überglücklich, als ich mit ihr gehen wollte. Sie war eben immer anhänglich gewesen. Sie forderte nichts von mir, sie war mit allem zufrieden.
Als ich ihr zum ersten Mal einen Kuss gab, fing sie an zu weinen. Nicht weil sie traurig war, nein: Sie war glücklich. Es waren Freudentränen.
Als Hausfrau war sie nicht schlecht. Meine Eltern sahen das schließlich ein. Sie waren froh, dass ich endlich ein Mädchen hatte.
Wir haben geheiratet. Adolphine Cornelie heißt sie offiziell, das habe ich bei diesem Anlass erfahren.
Mit dem Sex war es schwierig. Ich hatte Lust. Ich fand zudem, dass es nötig sei, wenn man verheiratet ist. Aber sie hatte Angst. „Tu mir nicht weh!”, sagte sie. Sie schmuste gern mit mir, bis zu einer gewissen Grenze.
Es vergingen einige Monate, bis wir richtig Sex hatten. Glaubte ich! Sie fand es jedoch nicht schön. Ich habe sie dann zum Arzt geschickt. Der hat ihr erklärt, dass sie noch Jungfrau sei! Er hat das Problem gelöst, klinisch natürlich. Er versprach ihr, dass der Verkehr nicht mehr wehtun und sie sich mit der Zeit daran gewöhnen werde. Zu mir sagte er, ich solle sie nicht überfordern.
Nach zwei Jahren wurde sie schwanger. Das hat sie in Panik versetzt. Ich sagte ihr, dass es allen Frauen so gehe. Ihre Mutter redete ihr ebenfalls zu. Es half alles nichts.
Dann wurde sie krank und verlor die Frucht. Der Arzt sagte uns, dass die Chance auf ein Kind gering sei.
Nachher wollte es mit dem Sex nicht mehr klappen. Ich fragte sie hundertmal, ob sie denn keine Kinder wolle. Sie sei doch gern mit Kleinen zusammen.
Sie wollte nie richtig darauf eingehen.
Wenn ich ehrlich bin – das würde ich nie jemandem sagen! – muss ich gestehen, dass ich nicht unglücklich war deswegen. Ich wäre gern Vater geworden. Aber ich hatte nicht gern Sex mit Cor. Mir war es recht, einfach lieb und gut mit ihr umzugehen und die Sexgeschichte auf sich beruhen zu lassen.
Ohne es offen auszusprechen, verstehen Cor und ich uns in dieser Sache. Wir machen uns keine Vorwürfe. Und seit ich nicht mehr zu Sex dränge, haben wir ein völlig harmonisches Zusammenleben, wie man es wahrscheinlich selten antrifft.
Mir ist bewusst, dass wir beide komische Menschenwesen sind. Jeder Mann würde mich wohl auslachen, falls er um das alles wüsste. Aber ich bin zufrieden und Cor auch. Und es gibt ja viele Paare ohne Kinder. Wenn man uns deswegen bedauert, klagen wir immer brav mit. „Ja, schade, was will man machen? Wenn Gott uns keine Kinder schenkt, was soll man da lamentieren?”
Erstaunlicherweise gibt es wenige, die so kinderfreundlich sind wie Cor. Wo wir auch immer wohnen, in kürzester Zeit hat sie einen Kreis von Kindern um sich herum, wenn sie auf die Straße geht oder an der Haustür steht. Sie tröstet sie, wenn sie traurig sind, sie verbindet ihre Wunden, wenn sie gefallen sind, sie spielt Hinkebein und Seilspringen mit ihnen, und sie kann endlos zuhören, wenn die Eltern ihr über ihre Sprösslinge berichten.
Sie ist der Liebling der Nachbarschaft.
Mein Problem liegt auf einer anderen Ebene. Ich möchte ab und zu einen schönen Mann anfassen. Das tue ich natürlich nicht! Also fantasiere ich nur darüber. Darin bin ich ziemlich virtuos geworden. Ich kann mir ganze Geschichten ausdenken, in denen ich Männern nahekomme. Ich kann sie küssen und berühren, wo ich will.
Alles in der Fantasie! Ich begreife, dass das nie Wirklichkeit werden darf. Und ich bin vernünftig genug, um keine Dummheiten zu machen. Gott sei Dank bin ich darin stark. Denn wenn ich einen schönen Mann sehe, bin ich innerlich sofort in Flammen. Wie mit dem Moff! Dann könnte ich augenblicklich den Krieg und meine Grundsätze vergessen, nur um ihm nahe zu kommen. Doch keine Angst, ich bewahre einen kühlen Kopf! Es ist ja nichts passiert. Für meine Fantasien habe ich dann wieder neues Material, darum geht’s! Denn ich denke weiter, auch über den Soldaten. Zum Beispiel, dass er auf mich zukommen, mich anschauen und sagen würde: „Ach, Jan, ich sehe dich so gern! Ich möchte dich einmal küssen, Jan, komm, komm mit, wo niemand uns sieht.” Und dann stehen wir in einem Hauseingang und küssen uns. Er lässt seine Zunge über meine Lippen gehen und sagt immer wunderschöne Worte zu mir. „Ich liebe dich, Jan!”, sagt er, und „Ich will immer bei dir sein!”
Was wäre ich ohne Fantasie!
Ted
Heute wieder Überstunden! Ich musste rennen, um vor Beginn der Ausgangssperre zuhause zu sein. Dafür darf ich morgen später anfangen. Kunden zum Rasieren haben wir nicht mehr viele, und nur wenige kommen früh.
Lustig finde ich es nicht. Wenn ich erst gegen acht nach Hause komme, sind die Kinder im Bett. Nur Tini ist manchmal noch wach, dann kann ich ihr noch einen Gutenachtkuss geben. Rita schläft immer schon.
Janni, meine Frau, meint, ich solle dem Chef gegenüber nicht so gefügig sein. Sie hat recht. Ich finde es aber schwierig. Ich bin froh um meine Stelle. Wenn der Chef will, kann er schnell einen anderen anstellen. Und wenn ich arbeitslos werde, muss ich mich bei den Moffen melden, und die schicken mich in die „Heimat“, wo sie ja zu wenig Arbeiter haben.
Endlich zuhause erwarteten mich neue Probleme. Janni hatte vernommen, dass wir bald nur noch zwei Kilo Kartoffeln bekommen. Die Rationen werden immer kleiner. Ich kaufe zwar zusätzlich auf dem Schwarzmarkt. Das kostet viel Geld, immer mehr. Die Kinder müssen doch genug zu essen haben! Und wir – ja, wir auch.
Sie hatte noch eine andere Hiobsbotschaft. Ihr Bruder Robi hat sie gewarnt, dass die Deutschen bald alle Männer zwischen siebzehn und vierzig nach Deutschland schicken. Was soll ich denn dann machen, in Gottes Namen? Ich bin noch nicht dreißig, ich kann mich unmöglich für einen 41jährigen ausgeben. Sonst kennte ich einen, der die Identitätsausweise fälscht. Aber bei mir ...?!
Robi meint, ich sollte einen Ort finden, wo ich mich verstecken kann, wenn es so weit ist. Das ist leichter gesagt als getan. Und wenn sie mich finden, werde ich erschossen!
Vielleicht hilft Robi mir. Er macht bei einer illegalen Gruppe mit. Sie haben ein Radio und hören jeden Tag die Nachrichten aus London, deshalb weiß er immer viel. Was in der Zeitung steht, wird von den Deutschen kontrolliert, das ist alles nichts wert.
Was Robi sagt, stimmt übrigens nicht immer. Er hat schon oft Razzien und Überfälle angekündigt, die nachher nie stattgefunden haben.
Wo finde ich einen Ort, um mich zu verstecken?
Janni hatte aufgeschnappt, dass irgendeiner in der Delagoastraße eine Paste für aufs Brot anbietet. Sie ist da heute vorbeigegangen und hat eine Schale voll gekauft. Es schmeckt salzig und ist klebrig. Und gut!
Janni ist schlauer als ich. Ich vernehme auch manchmal bei der Arbeit, wo etwas zu ergattern ist, aber bis ich auf die Idee komme, dort schauen zu gehen, ist alles ausverkauft. Ich bin zu langsam. Janni ist praktisch und gewandt.
Bei mir werde sie ruhig und friedlich, sagt sie immer. „Findest du mich nicht schlaff und träge?”, frage ich sie manchmal. Das findet sie zwar, aber ich habe eine geheimnisvolle Stille in mir, meint sie. So ergänzten wir uns.
Wir haben uns in einem Kurs für Erste Hilfe kennengelernt. Sie musste mir den Arm verbinden, und ich dasselbe bei ihr. Daraus ist dann mit der Zeit mehr geworden. Zum Glück war sie katholisch. Meine Eltern hätten mir nie erlaubt, eine zu heiraten, die nicht katholisch ist.
Mein Vater geht jeden Tag, bevor er zur Arbeit geht, in die Kirche. Wir nicht, wir gehen nur am Sonntag. Und beichten gehen wir nicht so oft wie mein Vater.