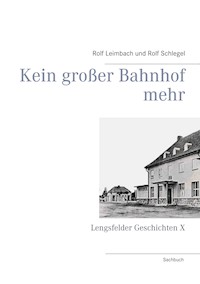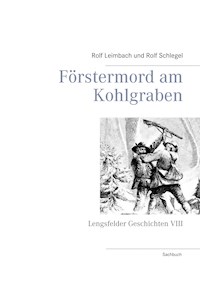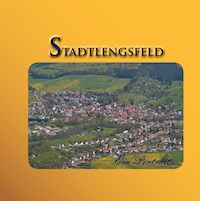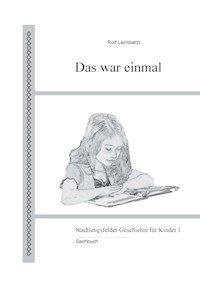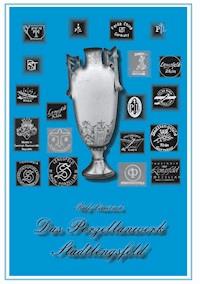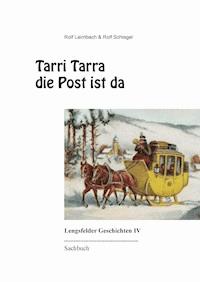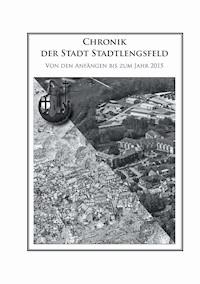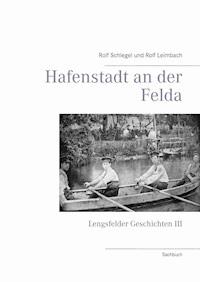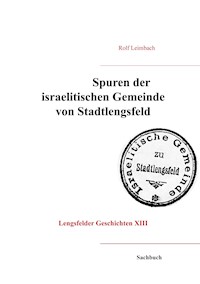
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Dieser Band macht den Versuch, die vierhunderttjährige Geschichte der jüdischen Gemeinde von Stadtlengsfeld von ihren Anfängen bis zu ihrem Erlöschen darzustellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wirklich tot sind nur jene,
an die sich niemand mehr erinnert.
Jüdisches Sprichwort
Claire Heilbronn, geborene Clara Huhn
Tocher des Stadtlengsfelder Kaufmanns Louis Huhn und seiner Frau Babette. Geboren am 18.07.1895 in Stadtlengsfeld, ermordet im Vernichtungslager Birkenau. Quelle: Yad Vashem 2021
Autor
Studienrat i. R. Rolf Leimbach war 47 Jahre Lehrer. Als Mitglied des Wissenschaftlichen Rates für Unterstufenforschung an der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR war er beteiligt an der Weiterentwicklung der Lehrpläne und Lehrmaterialien für das Fach Heimatkunde. Publikationen in der Fachzeitschrift „Die Unterstufe“ befassten sich mit der Methodik des Experiments im Heimatkundeunterricht und der Erziehung zu einer aktiven Fragehaltung. Rolf Leimbach veröffentlichte zahlreiche methodische Handreichungen für den Heimatkundeunterricht. In Lehrbuchverlagen ist er Autor vieler Lehrbücher, Schülerarbeitsheften und Unterrichtshilfen für den Heimatkunde- und Sachunterricht in allen neuen Bundesländern.
Besonders nach dem Ausscheiden aus dem Schuldienst intensivierte Rolf Leimbach seine Forschungen zur Geschichte seines Heimatortes Stadtlengsfeld. Er veröffentlichte im Eigenverlag eine umfangreiche Chronik seiner Heimatstadt, die Geschichte des Porzellanwerkes, des Schulwesens, des Kaliwerkes Menzengraben, des Kirchengebäudes und seiner schriftlichen Hinterlassenschaften im Turmknauf. Weitere Publikationen befassen sich mit den Hexenprozessen im 17. Jahrhundert, den Ereignissen des Jahres 1848 in der Stadt Lengsfeld, der Brandkatastrophe 1878 und dem Jahr 1945. Ein ganz besonderer Schwerpunkt ist die Erforschung der einstigen israelitischen Gemeinde, die mit etwa 800 Mitgliedern um 1800 zu den größten in Thüringen zählte.
Als ehemaligen Lehrer ist Rolf Leimbach besonders daran gelegen, die facettenreiche Geschichte seiner Heimatstadt vielen Einwohnern und Gästen nahezubringen. Deshalb engagiert er sich im Kultur- und Geschichtsverein mit Vorträgen, Führungen und Ausstellungen.
Inhalt
Anfänge
Judenordnungen
Untertanen
Sitz eines Landrabbinates
Berühmte Namen
Schulen
Abgewandert
Handel, Geschäfte und Firmen
Hetze, Boykott, Vertreibung
Anhang
Vorwort
Einzelne Episoden aus der über 400jährigen Geschichte der jüdischen Gemeinde Stadtlengsfeld wurden in den bisherigen Bänden „Lengsfelder Geschichte“ dargestellt.
Rolf Schlegel und Rolf Leimbach, Lengsfelder Geschichten I, „Werwölfe und Hexen“, BoD Verlag, ISBN 9783732286751
Moritz Goldschmidt und die Lengsfelder Schule
Vom Viehhändler zur Industriellen-Dynastie
Rolf Schlegel und Rolf Leimbach, Lengsfelder Geschichten III, „Hafenstadt an der Felda“, BoD Verlag, ISBN 9783738637564
Pianist, Dirigent und Musikpädagoge Theodor Fuchs
Rolf Leimbach und Rolf Schlegel, Lengsfelder Geschichten IV, „Tarri Tarra die Post ist da“, BoD Verlag, ISBN 9783844810356
Von Amsterdam in den Tod
Rolf Schlegel und Rolf Leimbach, Lengsfelder Geschichten V, „Segelflieger über Stadtlengsfeld“, BoD Verlag, ISBN 9783743166356
Präsident von General Electric - Sohn Stadtlengsfelder Eltern Spendable Lengsfelder - Spiro‘sche Stiftung
Rolf Leimbach und Rolf Schlegel, Lengsfelder Geschichten VI, „Großmütter und Hebammen“, BoD Verlag, ISBN 9783746030890
Shanghai Tower nicht ohne Lengsfelder Dankmar Adler
Der gute Ort - Jüdischer Friedhof zu Stadtlengsfeld
Rolf Leimbach und Rolf Schlegel, Lengsfelder Geschichten VIII, „Förstermord am Kohlgraben“, BoD Verlag, ISBN 9783749496907
Uri Rosenan in Israel
Eine chronologische Darstellung dieser Geschichte von den Anfängen bis zu ihrem Ende 1938 fehlte bisher. Diese Lücke will Band 13 schließen. Es galt, Spuren zu finden und sie einzuordnen. Dabei taten sich Lücken auf, die wohl nicht mehr zu schließen sind. Denn beim Stadtbrand von 1878 gingen Akten verloren. Die Nationalsozialisten taten das Übrige. Schon 1933 wurden alle Gemeinden angewiesen, sämtliches Schriftgut des „Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ zu beschlagnahmen. Zudem verwüsteten in der Pogromnacht Faschisten die Synagoge und zerstörten alles Inventar.
Spuren zu den Anfängen
Erste Juden kamen wohl zu Beginn des 16. Jahrhunderts in die Stadt Lengsfeld. Darauf weist ein Schreiben des letzten Kultusvorsitzenden der jüdischen Gemeinde Stadtlengsfelds, Aron Freudenberg, an den Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden im Jahr 1937 hin. Freudenberg erbat eine finanzielle Unterstützung zur Fertigstellung der Friedhofsmauer. In dem Schreiben heißt es: „… Unser Friedhof, der über 400 Jahre alt ist,.“ (siehe Anlage, Abb. 121 und 122)
Vor 1500 bestanden südwestlich des Thüringer Waldes bis in die Höhen der Thüringer Rhön keine nennenswerten Ansiedlungen jüdischer Menschen. Die Mehrzahl jüdischer Siedlungsorte lag damals in der Nähe wichtiger Handelsstraßen. Diese aber fehlten im südwestlichsten Thüringer Raum. Eine Ausnahme bildeten Geisa und Vacha ob ihrer Lage an der alten Fernhandelsstraße von Frankfurt/Main nach Leipzig. Handelsstraßen waren besonders für Juden wichtig in Bezug für ihre Handelstätigkeit und wirtschaftliche Beweglichkeit.
Um 1500 kam es zu einer Reihe von Umständen und Ereignissen, die eine Bewegung und Ansiedlung jüdischer Menschen auch südwestlich des Thüringer Waldes zur Folge hatten. So wurden aus ernestinischen Territorien in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Juden ausgewiesen.1 Bei der Suche nach neuen Niederlassungen bevorzugten Juden Orte mit Stadtbefestigungen. Die Mauern, Tore, Türme, sowie die Verpflichtung der Bürger, ihre Stadt mit der Waffe zu verteidigen, boten ihnen ein höheres Maß an Sicherheit. Zudem eröffnete die größere Anzahl von Einwohnern, die Bürger waren, den Juden weitere Geschäftsmöglichkeiten. Solche Voraussetzungen boten neben der Stadt Lengsfeld auch die Städte Geisa und Vacha.
Weiter bevorzugten Juden bei ihrer Siedlungssuche Orte unter reichsritterschaftlicher Herrschaft. Die Grafen, Freiherren und Herren von Boineburg waren Reichsritter und als solches Mitglied des reichsritterschaftlicher Kantons Rhön und Werra.2 Reichsritterschaftliche Besitzungen waren von ihrer Größe und Einwohnerzahl meist bescheiden. Sie mussten sich oft gegen ihre übermächtigen Nachbarn behaupten. So ist bekannt, dass das Bistum Fulda mit den Herren von Lengsfeld im Dauerstreit lag. Der artete um 1700 sogar zum legendären „Lengsfelder Knüppelkrieg“ aus. Ständige Fehden kosteten Geld. Hinzuziehende Juden waren deshalb willkommen, weil sie Geld in die Kassen der Herrschenden brachten. Willi Katz, der letzte jüdische Lehrer an der Bürgerschule von Stadtlengsfeld, schrieb in einem Aufsatz 1929: „Die jüdische Gemeinde zu Stadtlengsfeld ist, wie alle jüdischen Landgemeinden in den ehemaligen reichsritterschaftlichen Orten, auf Grund der Reichspolizeiverordnung von 1548 entstanden, in der der deutsche Kaiser der gesamten Reichsritterschaft und allen einzelnen Mitgliedern derselben wie den übrigen Reichsständen das Recht zusicherte, Juden auf ihrem Gebiet zu ‚halten‘ und von ihnen das Schutz- und Schirmgeld zu erheben.“3
Stadtlengsfelder Juden waren Untertanen der Freiherren von Boineburg und von Müller in deren Patrimonialamt Lengsfeld. Wie ihr Gemeindeleben organisiert war, bestimmten die Grundherren durch Judenordnungen. Als Patrimonialherren übten sie die niedere Gerichtsbarkeit aus.
Der reichsritterschaftlicher Besitz derer von Boineburg entwickelte sich zu einer Ganerbenschaft. Das waren mehrere Familien, die alle Anteile am Gesamtbesitz besaßen und diese auch selbst bewirtschafteten und verwalteten. Über den Gesamtbesitz verfügten sie gemeinsam. Eine einzelne Familie konnte ihren Besitz also nicht an andere veräußern, ohne dass diese der Ganerbenschaft nicht beitrat.4 Die Einheit nach außen blieb zwar gewahrt, nach innen lockerten sich jedoch im Laufe der Zeit die engen Bindungen. Für Juden war eine Ansiedlung in solche geteilten Besitzungen vorteilhaft, weil die dortige Rechtsgrundlage nicht immer eindeutig war. So kam es, dass sich Juden in der Stadt Lengsfeld und in Gehaus ansiedelten konnten, in Weilar aber dagegen nicht.
Verschiedentlich ist zu lesen, dass der Zuzug von Juden im Boineburg’schen Besitz auf acht Familien begrenzt war. Auch Willi Katz vertritt in dem oben genannten Artikel eine solche Ansicht. Diese Anordnung nach der Reichspolizeiordnung von 1548 hatte keinen langen Bestand. Schon 1731 werden 61 jüdische Personen in der Stadt Lengsfeld gezählt (vgl. Tabelle 1).5 Davon sind mindestens 26 Personen Familienoberhäupter. Zudem wurden Kinder unter 13 Jahren gar nicht erfasst. Wenn, wie Freudenberg in seinem Schreiben von 1937 bemerkt, der Friedhof über 400 Jahre alt ist, also schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstand, dann hatten sich schon sehr früh feste Strukturen einer größeren jüdischen Gemeinde gebildet, zu der auch eine eigene Begräbnisstätte, eine Synagoge bzw. ein Gebetsraum, eine Schule und eine Mikwe gehörten. Der Chronist fand Hinweise auf solche Strukturen in Dokumenten, wo er sie nicht vermutete. In den Gerichtsprotokollen des Amtes Lengsfeld 1659 ist am zweiten Juli zu lesen: „Den Juden angedeutet, keinen Unflat in den Frawbrunnen zu schutten auch sich nicht drinnen zu baden, oder Wänste drinn zu spulen, bey unableßlicher ernster straffe.“ Das ist ein eindeutiger Hinweis, dass die jüdische Gemeinde eine Mikwe besaß. Nicht anders kann der „Frawbrunnen“ (Frauenbrunnen) gedeutet werden. Meist wurde sie im Keller einer Synagoge angelegt. Nicht so in Stadtlengsfeld. Den Zustand dieser Mikwe beschrieb Professor Kukowka, ein Bürger jüdischen Glaubens und Leiter des Greizer Krankenhauses 1961 auf Anfrage der Stadtverwaltung: “… Hier befand sich auch ein solches Tauchbad, allerdings befand sich dieses Tauchbad in einem sehr primitiven Zustand. Es bestand nur aus einem kleinen Häuschen, das als Umkleideraum diente und aus einem weiteren Häuschen, in dem drei Stufen hinab das Bad angelegt war. Dasselbe war mit Blech ausgeschlagen, ohne Boden, damit das Grundwasser einlaufen konnte. Dem Grundwasser wurde warmes Wasser zum Baden beigegossen.“
Erste Namen jüdischer Einwohner in der Stadt Lengsfeld finden sich in den Boineburg’schen Gerichtsprotokollen aus dem Jahr 1659. Sie wurden dort nur mit einem Vornamen und dem Zusatz „Jude“ bezeichnet: „Mosche, der lange Jude“, „Samuel Juden“, Joseph Juden“, „Mosch Jude“, „Jacob, der kleine Jude“, „Judemann Juden“, „David Juden“, Mänlein Jude“. Nach den Protokollinhalten handelte es sich meist um Streitigkeiten, die beim Viehhandel entstanden und durch einen Amtsspruch beendet wurden.
Abbildung 1: Gerichtsprotokoll 05.02.1659, Quelle: Staatsarchiv Marburg„Den 2 May Ist Judeman Juden auf befehl Jr: Wolf Danielß von Boynebg. anbefohlen ihm zwischen hier und Sonabent 1 Rthl Siegellgebühr abzustatten, dann eine Flachßbreche einzuschaffen, die ihm 2 kloben flachß brachte, und 2 Faßnachtshuner entweder zu bezahlen oder selbe in natur zu liefern.“
Über die Stärke der jüdischen Gemeinde im 16. und 17. Jahrhundert in der Stadt Lengsfeld gibt es keine genauen Angaben. Die können lediglich aus Schutzgeldlisten oder Vermögensschätzungen derer von Boineburg ungefähr ermittelt werden. Kinder unter 13 Jahren wurden überhaupt nicht erfasst.
In dem Freyherrl. Boyneburg. Gerechte Stadt Lengsfeld befinden sich dermalen (1731) an Judenschaft
Männer
Weiber
Söhne so das 13te Lebensjahr erreicht
Weiber dto.
1
David Levi
hat Vermögen kein
2
Jacob
hat nichts
3
Liebmann Ruben
hat etwas Vermögen
weib
2 einer in der Fremde
4
Sander Itzig
hat nichts
weib
1
2 beide in der Fremde
5
Marcus Itzig
hat nichts
weib
6
Moses Itzig
hat nichts
weib
1
7
Löw cus Mar-
hat nichts
weib
8
Itzig ham Abra-
hat nichts
weib
9
Mendel Itzig
hat nichts
weib
10
Salomon Mängen
hat nichts
weib
11
Löser Mendel
hat nichts
weib
12
Aron Ba- charach
hat wenig ein Ver- mögen
weib
13
Moses Salomon
hat etwas Vermögen
weib
14
Meyer Jacob
hat gar wenig
weib
15
Itzig del Men-
hat nichts
16
Kappel Marcus
hat ein wenig Ver- mögen
weib
17
Israel Sa- lomon
hat wenig ein Ver- mögen
weib
18
Moses Marcus
hat nicht viel
weib
19
Selig Itzig
hat nichts
weib
20
Philipp Aron
hat gar wenig
weib
21
Michel
hat ges weni-
weib
22
Moses Aron
hat wenig
weib
23
Daniel Abraham
hat wenig
weib
24
Meyer Aron zu Gehauß
hat nichts
weib
2, so auswärts dienen
25
hat wenig
Sara Mosis rx. (relicta Witwe)
1
26
hat nichts
Sara rx. Löw
27
hat nichts
Jütgen Mendels rx.
1, dient in der Fremde
28
hat nichts
Sprintz Seligmans rx.
2, dienen in der Fremde
29
hat nichts
Rahel Amsels
Stadt Lengsfeld den 5. Januarij 1731 Johann Christoph Schell, Freyherl. Boyneburg. Ges. Amtmann daselbst m. m.
Tabelle 1: Mitglieder der jüdischen Gemeinde in der Stadt Lengsfeld 1731, Quelle: Privat R. Leimbach, 2021
Die dritte Spalte dieser Liste ist bemerkenswert. In vielen anderen Herrschaftsbereichen gab es die Vorbedingung, dass der um das Niederlassungsrecht nachsuchende Jude ein Eigenkapital zwischen mindestens 300 und 500 Talern oder Gulden nachweisen musste. So nicht bei den Boineburgs. Der boineburgische Amtmann schätzte 24 Familien bzw. Personen als mittellos ein. Nur fünf Familienoberhäupter hatten „… ein wenig Vermögen.“ Das jährliche „Schutzgeld“ aber lag bei jedem Juden, mittellos oder etwas vermögend, zwischen sechs und neun Talern bzw. Gulden. Dazu kamen noch die Sondersteuern wie das Zucker- oder Neujahrsgeld. Jeder Jude hatte zudem die Kultussteuer zu entrichten.
Dennoch hatten diese Bedingungen einen fast ungehemmten Zuzug jüdischer Menschen zur Folge. Das führte zu einer Belästigung der christlichen Einwohner durch die hausierenden und bettelnden Juden. Die Herren von Boineburg schien das aber über Jahrzehnte nicht zu kümmern. Erst nach geharnischten Protesten der Gemeindevorsteher boten sie dem ungehemmten Zuzug durch einen Erlass Einhalt: „… daß der verbriefte Schutz künftig nur noch für den Hauserben väterlicherseits Gültigkeit haben soll, … mögen sich die übrigen Kinder um anderen Schutz und Schutzherren umsehen.“6
Den Judenschutz bekamen 1744 folgende jüdische Einwohner:7
1744
Einnahmen-Geld an Judenschutz
fl
8
gl
9
hl
10
Betrag
Zahlbar am
Betrag
Zahlbar am
Hirschel Jonas
2 1/2 Thl
11
Martini
12
1744
2 1/2 Thl.
Petri
13
1744
7
Jacob Lippmann
3 Thl.
Michel.
14
1744
3 Thl.
Petri 1745
9
Jonas Hirschel
2 1/2 Thl.
Joh.
15
1744
2 1/2 Thl.
Mart. 1744
7
10
6
Israel Salomon
3 Thl.
Mich. 1744
3 Rhl.
Petri 1749
9
Liebmann Ruben
3 Thl.
Mich. 1744
3 Thl.
Petri 1745
9
Hoym Gözschlich
2 1/2 Thl.
Joh. 1744
2 1/2 Thl.
Christtag 1744
7
10
6
Moyses Salomon
3 Thl.
Mich. 1744
3 Thl.
Petri 1745
9
Sander Isaac
2 1/2 Thl.
Mich. 1744
2 1/2 Thl.
Petri 1745
7
10
6
Salomon Meyer
2 1/2 Thl.
Mich.1744
2 1/2 Thl.
Petri 1745
7
10
6
Salomon Menck und Meyer Jacob
5 Thl.
Mich. 1744
5 Thl.
Petri 1745
15
Hoym Solomon
2 1/2 Thl.
Mich. 1744
2 1/2 Thl.
Petri 1745
7
10
6
Coppel Marx
3 Thl.
Mich. 1744
3 Thl.
Petri 1745
9
Moyses Itzig
6 fl. incl. Hausmieth
Mich 1744
7 fl. 10 gl. 6 hl.
Petri 1745
Jacob Seligmann
Von Mar- tini 1743 bis Martini 1744, incl. Hausmieth
12
Meyer Abraham
2 1/2 Thl.
Neujahr 1744
2 1/2 Thl.
Joh. 1744 bey Johann Schuler
7
10
6
Latus
(Zwischensumme)
148
10
6
Choyum Levi
Von Petri bis Monats Aug. 1744 bey Joh. Heflfelde
2
13
Moyses Aaron
5 fl.
Mich. 1744
5 fl.
Petri 1745, incl. Hausmieth
10
Itzig Abraham
Neujahr bey dem Cammerschmidt
3
Chlom Seligmann
2 Thl.
den 15. April 1744
2 Thl.
den 15. Oct. 1745 bey Jacobus Waldt
6
Itzig Sander
2 Thl.
Martini 1744
2 Thl.
Petri 1745 bey dem Sattler
6
Aaron Meyer
2 1/2 Thl.
Mart. 1744
2 1/2 Thl.
Petri 1745 bey Joh. Meurer
7
10
6
Leib Heilbronn
4 Thl.
Oster 17845 1/2 Jahr
6
Summa Chent fl.
189
13
Tabelle 2: Judenschutz - Steuerverzeichnis 1744; Quelle: Privat R. Leimbach
Die gleichen Personen in der Tabelle 2 wurden auch mit einer Zuckersteuer (Abb. 2) belegt.
Der Grund, warum Juden eine Zuckersteuer bezahlen mussten, erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Es war verbreitet, dass im Mittelalter und noch lange danach soziale Randgruppen mit besonderen Steuern belastet wurden. Solche Steuern waren in den einzelnen Gebieten unterschiedlich und auch ungewöhnlich. Bekannt ist das sogenannte Judenporzellan in Preußen unter Friedrich den Großen. 1769 wurde diese Sonderabgabe angeordnet. Danach mussten die Juden beim Erwerb oder der Vererbung ihrer Schutzbriefe sowie beim Kauf von Grundstücken für 300 Taler Porzellan aus der Königlichen Porzellanmanufaktur kaufen und im Ausland weiterverkaufen. Diese Sonderabgabe war für viele Juden existenzbedrohend. Die minderbemittelten wanderten aus Preußen ab, was durchaus beabsichtigt war. Zugleich wirkte diese Sondersteuer beruhigend auf die Proteste der christlichen Bevölkerung, denen die Zuwanderung der Juden zumindest unerwünscht war. Für sie waren die Juden zunächst Konkurrenten. Solchen Widerstand und Protest gab es auch unter den christlichen Einwohnern und in Zünften der Stadt Lengsfeld. Der Judenzucker war also eine Sonderabgabe, die nur die Juden zu entrichten hatten. Jetzt wird auch klar, warum die Höhe des Judenzuckers für alle Juden gleich bemessen war. Sie sollte alle Juden treffen, ob sie nun Vermögen besaßen oder nicht.
Abbildung 2: Judenzucker, Quelle: Privat R. Leimbach 2021
Nr.
Familienoberhaupt
Familienmitglieder
Vermögensangaben
1
Aaron Barachach
hat nichts
2
Moses Salomon
mit dem Knecht
3000 fl.
3
Michael Jacob
hat nichts
4
Israel Salomon
hat nichts
5
Salomon Joseph
hat nichts
6
Abraham Salomon
detto
7
Itzig Abraham
detto
8
Herz Baruch
detto
9
Jacob Liebmann
einen Sohn
2500 fl.
10
Hirsch Jonas
250 fl.
11
Löw Heß
detto
12
Jacob Meyer
50 fl.
13
Loiv Cappel
einen Sohn so nicht handelt, einen so handelt
75 fl.
14
Isaac Mendel
einen Sohn
100 fl.
15
Juda Mendel
detto
16
Abraham Gerson
50 fl.
17
Rubel Moses
600 fl.
18
Itzig Marz
50 fl.
19
Moses Cappel
detto
20
Herla Israel
detto
21
Hertz Israel
600 fl.
22
Löw Moses
200 fl.
23
Jacob Mendel
250 fl.
24
Isaac Jacob
50 fl.
25
Wolf Moses
1100 fl.
26
Hirsch Mendel
100 fl.
27
Feibel Nathan
nebst einem Knecht
400 fl.
______
9375 fl.
28
Itzig Meyer
350 fl.
29
Abraham Isaac
detto
30
Isaac Lewi
100 fl.
31
Isaac Schmul
detto
32
Israel Boehm
200 fl.
33
Seelig Moses
detto
34
Schmuhl ...
50 fl.
35
Mary Moses
detto
36
Amsel Lewi Rabbi
detto
37
Wolf Itzig
100 fl.
38
Gottschalik ...
nebst einem Bruder
50 fl.
39
Süßkind Lewi