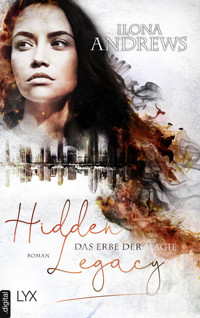11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kate-Daniels-Reihe
- Sprache: Deutsch
Kate Daniels verdient ihr Geld damit, übersinnliche Phänomene zu bekämpfen. Bewaffnet mit ihrem Schwert "Slayer" und ihren magischen Fähigkeiten macht sie auf den Straßen Atlantas Jagd auf Vampire und andere finstere Kreaturen. Ihr Leben nimmt jedoch eine unerwartete Wendung, als ihr Freund Greg ermordet wird. Bei der Suche nach dem Täter stößt Kate auf Ungereimtheiten: Neben Gregs Leiche wird ein geköpfter Vampir gefunden, und alles deutet darauf hin, dass bei der Tat nekromantische Magie im Spiel war. Hat womöglich der geheimnisvolle Curran, der Anführer der Gestaltwandler, etwas mit dem Ganzen zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Ilona Andrews
DIE NACHT DER MAGIE
Roman
Ins Deutsche übertragenvon Jochen Schwarzer
Für meine Töchter,
Anastasia und Helen
Kapitel 1
Ich saß in meiner schattigen Küche, eine Flasche Boone’s Farm Hard Lemonade vor mir auf dem Tisch, als es zu einer Magieschwankung kam. Meine Wehre erloschen und ließen mein Haus schutzlos zurück. Der Fernseher sprang plötzlich an und lärmte in die Stille hinein.
Ich hob eine Augenbraue und wettete mit der Flasche, dass es wieder eine Eilmeldung gab.
Die Flasche verlor.
»Eilmeldung!«, verkündete Margaret Chang. »Das Justizministerium warnt die Bevölkerung: Mit versuchten Beschwörungen oder anderen Aktivitäten, die zum Erscheinen übernatürlicher Wesen führen könnten, gefährden Sie sich und Ihre Mitbürger.«
»Was du nicht sagst«, wandte ich mich an die Flasche.
»Die Polizei ist angewiesen, derartige Umtriebe unter Einsatz aller erforderlichen Mittel zu unterbinden.«
Margaret Chang redete weiter ihren Schmus, und ich biss derweil von meinem Sandwich ab. Wem wollten die was vormachen? Keine Polizei der Welt konnte hoffen, jede einzelne Beschwörung zu unterbinden. Es brauchte einen gut ausgebildeten Magier, um eine Beschwörung überhaupt zu bemerken. Andererseits brauchte es nur irgendeinen Schwachkopf mit einem Fünkchen Macht und einer sehr vagen Vorstellung, wie er sie einsetzen sollte, um so etwas zu versuchen. Und ehe man sich versah, verwüstete ein dreiköpfiger Slawengott die Innenstadt von Atlanta, oder es regneten geflügelte Schlangen vom Himmel herab, während den Spezialeinheiten der Polizei ganz schnell die Munition ausging. Wir lebten in gefährlichen Zeiten. Doch wären sie weniger gefährlich gewesen, hätte ich mir einen neuen Job suchen müssen. In der sicheren Technikwelt von ehedem wäre eine der Magie kundige Söldnerin wie ich nicht sonderlich gefragt gewesen.
Wenn man Probleme magischer Art hatte, Probleme, bei denen die Polizei nicht helfen konnte oder wollte, rief man bei der Söldnergilde an. Und wenn die Sache mein Revier betraf, rief die Gilde anschließend bei mir an. Ich rieb mir die Hüfte und verzog das Gesicht. Ich hatte immer noch Schmerzen vom letzten Einsatz, auch wenn die Wunde besser verheilt war, als ich erwartet hatte. Das war das erste und letzte Mal gewesen, dass ich mich darauf eingelassen hatte, ohne irgendeinen Schutz gegen den Impala-Wurm vorzugehen. Beim nächsten Mal würde ich auf einen Schutzanzug der Kategorie vier bestehen.
Plötzlich packten mich Angst und Abscheu. Mein Magen krampfte sich zusammen. Es lief mir eiskalt über den Rücken, und meine Nackenhaare stellten sich auf.
Etwas Böses war in mein Haus eingedrungen.
Ich legte das Sandwich weg und stellte den Fernseher stumm. Auf der Mattscheibe gesellte sich ein Mann mit versteinerter Miene zu Margaret Chang. Er hatte kurz geschorenes Haar und schiefergraue Augen. Ein Polizist. Wahrscheinlich von der Paranormal Activity Division. Ich ergriff den Dolch, der auf meinem Schoß lag, und blieb reglos sitzen.
Ich lauschte. Wartete.
Kein Laut durchbrach die Stille. Ein Wassertropfen perlte an der feuchten Flasche hinab.
Etwas Großes schlich über die Decke der Diele in die Küche. Ich tat, als würde ich es nicht bemerken. Es hielt links hinter mir inne, daher musste ich mir keine allzu große Mühe geben.
Der Eindringling zögerte, wandte sich um und ging dann in der Ecke vor Anker. Dort hing er nun mit mächtigen gelben Klauen an der Täfelung, stumm und reglos wie ein Wasserspeier, und das am helllichten Tag. Ich trank einen Schluck aus der Flasche und stellte sie so ab, dass ich darauf das Spiegelbild des Wesens sehen konnte. Es war nackt und unbehaart und schien kein einziges Gramm Fett am Leib zu haben. Die Haut war über den Muskelsträngen zum Reißen straff gespannt, wie eine dünne Wachsschicht auf einem Anatomiemodell.
Der nette Herr Spiderman von nebenan.
Der Vampir hob die linke Hand. Die messerscharfen Klauen durchschnitten die Luft. Er drehte den Kopf hin und her wie ein Hund und betrachtete mich mit Augen, in denen eine ganz besondere Art von Wahnsinn leuchtete, geboren aus bestialischer Blutgier und von keinerlei Rücksicht gehemmt.
Mit einer einzigen fließenden Bewegung wirbelte ich herum und schleuderte den Dolch. Die schwarze Klinge traf das Wesen in den Hals.
Der Vampir erstarrte. Seine gelben Klauen regten sich nicht mehr.
Dickes, dunkles Blut rann von der Klinge über Hals und Brust des Vampirs und tropfte von dort zu Boden. Seine Gesichtszüge zuckten, versuchten sich zu verwandeln. Er öffnete das Maul und entblößte zwei Fangzähne, die wie kleine, elfenbeinerne Sicheln geformt waren.
»Das war sehr unbedacht, Kate«, sprach Ghasteks Stimme aus der Kehle des Vampirs. »Jetzt muss ich ihn füttern.«
»Das ist ein Reflex, da kann ich nichts machen. Du hörst ein Glöckchen, und du kriegst Futter. Du siehst einen Untoten, und du wirfst ein Messer. Es ist echt genau dasselbe.«
Das Gesicht des Vampirs zuckte, als versuchte der Herr der Toten, der ihn lenkte, einen Blick auf etwas zu werfen.
»Was trinkst du da?«, fragte Ghastek.
»Boone’s Farm.«
»Du kannst dir doch was Besseres leisten.«
»Ich will aber nichts Besseres. Ich mag Boone’s Farm. Und geschäftliche Dinge bespreche ich lieber am Telefon. Und mit dir am liebsten gar nicht.«
»Ich will dich nicht engagieren, Kate. Das hier ist lediglich ein privater Besuch.«
Ich sah den Vampir an und wünschte, ich könnte Ghastek selbst ein Messer in die Kehle rammen. Es wäre ein sehr schönes Gefühl. Doch leider saß er meilenweit entfernt in einem gesicherten Raum.
»Es macht dir Spaß, mir auf die Nerven zu gehen, nicht wahr, Ghastek?«
»Oh ja.«
Die große Frage war, was dahintersteckte. »Was willst du? Mach schnell, mein Boone’s Farm wird warm.« Mir war längst nicht so unbesorgt zumute, wie ich tat.
»Ich habe mich bloß gefragt«, sagte Ghastek mit einer trockenen Neutralität, die eines seiner Markenzeichen war, »wann du deinen ehemaligen Vormund das letzte Mal gesehen hast.«
Die Unbekümmertheit seines Tons jagte mir einen Schauder über den Rücken. »Wieso?«
»Nur so. Es war mir wie immer ein Vergnügen.«
Der Vampir löste sich von der Wand, flog zum offen stehenden Fenster hinaus und nahm meinen Dolch mit sich.
Ich griff zum Telefon und fluchte dabei leise vor mich hin. Ich wählte die Nummer des Ordens der Ritter der mildtätigen Hilfe. Kein Vampir konnte meine Wehre durchbrechen, wenn die Magie in vollem Schwange war. Ghastek konnte nicht wissen, wann die Magie abebben würde, und daher musste er mein Haus schon eine ganze Weile ausgespäht haben, darauf lauernd, dass sich in meinem Abwehrzauber eine Lücke auftat. Ich trank einen Schluck aus der Flasche. Das bedeutete, dass sich, als ich am Vorabend nach Hause kam, ganz in der Nähe ein Vampir versteckt und ich ihn weder gesehen noch gespürt hatte. Wie überaus beruhigend.
Es läutete einmal, zweimal, dreimal. Weshalb hatte er mich nach Greg gefragt?
Am anderen Ende meldete sich eine strenge Frauenstimme: »Der Orden, Sektion Atlanta. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich würde gern mit Greg Feldman sprechen.«
»Wie ist Ihr Name?«
Die Stimme klang ein wenig angespannt.
»Ich muss Ihnen meinen Namen nicht nennen«, sagte ich. »Ich möchte den Wahrsager des Ordens sprechen.«
Nach kurzer Pause meldete sich eine Männerstimme. »Nennen Sie uns bitte Ihren Namen.«
Sie wollten Zeit schinden. Wahrscheinlich versuchten sie den Anruf zurückzuverfolgen. Was, zum Teufel, war hier los?
»Nein, das werde ich nicht«, sagte ich mit Entschiedenheit. »Seite sieben Ihrer Satzung, dritter Absatz von oben: ›Jede Bürgerin und jeder Bürger hat das Recht, sich von einem Wahrsager des Ordens beraten zu lassen. Diese Beratung erfolgt auf Wunsch anonym.‹ Und als Bürgerin verlange ich, dass Sie mich jetzt sofort mit dem Wahrsager des Ordens verbinden oder mir mitteilen, wann ich ihn erreichen kann.«
»Der Wahrsager ist tot«, sagte die Stimme.
Die Welt blieb mit einem Ruck stehen. Ich rutschte noch ein Stück weiter, verängstigt und aus dem Gleichgewicht. Die Kehle tat mir weh. Ich hörte mein Herz pochen.
»Wie das?« Meine Stimme klang ganz ruhig.
»Er wurde bei einem Einsatz getötet.«
»Wer war es?«
»Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Schauen Sie, wenn Sie mir einfach Ihren Namen nennen würden …«
Ich legte auf. Dann blickte ich zu dem Stuhl auf der anderen Seite des Tischs hinüber. Zwei Wochen zuvor hatte Greg auf diesem Stuhl gesessen und in seinem Kaffee gerührt. Sein Löffel hatte sich in exakt kreisförmigen Bahnen bewegt, ohne je den Becher zu berühren. Und die Erinnerung sorgte dafür, dass ich ihn einen Moment lang tatsächlich dort sitzen sah.
Greg sah mich aus seinen dunkelbraunen Augen an. Mit ihrem traurigen Blick glichen sie den Augen einer Ikone. »Bitte, Kate. Vergiss deine Abneigung gegen mich mal für einen Moment und hör dir an, was ich dir zu sagen habe. Es ist durchaus vernünftig.«
»Ich habe keine Abneigung gegen dich. Das wäre eine grobe Vereinfachung.«
Er nickte, mit jenem überaus geduldigen Gesichtsausdruck, mit dem er Frauen um den Verstand brachte. »Natürlich. Ich wollte mich keinesfalls kränkend oder vereinfachend über deine Gefühle äußern. Ich möchte nur, dass wir uns auf den Kern dessen konzentrieren, was ich zu sagen habe. Könntest du mir bitte zuhören?«
Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme. »Ich höre.«
Er griff in seine Lederjacke, zog eine Schriftrolle hervor, legte sie auf den Tisch und entrollte sie langsam.
»Das ist die Einladung des Ordens.«
Ich hob die Hände. »Das war’s. Ich bin dann mal weg.«
»Lass mich bitte ausreden«, erwiderte er. Er wirkte nicht ärgerlich. Er sagte mir nicht, dass ich mich wie ein kleines Kind aufführte, obwohl mir klar war, dass ich genau das tat. Das machte mich nur noch wütender.
»Also gut«, sagte ich.
»In ein paar Wochen wirst du fünfundzwanzig. Das will für sich genommen nichts besagen, ist aber, was die Wiederaufnahme in den Orden angeht, durchaus bedeutsam. Es ist sehr viel schwieriger, dort aufgenommen zu werden, wenn man erst mal fünfundzwanzig ist. Nicht unmöglich. Nur schwieriger.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Sie haben mir Broschüren geschickt.«
Er ließ die Schriftrolle los, lehnte sich zurück und schlang die langen Finger ineinander. Das Schriftstück regte sich nicht, obwohl es sich sämtlichen physikalischen Gesetzen zufolge hätte wieder zusammenrollen müssen. Greg nahm es mit den physikalischen Gesetzen manchmal nicht so genau.
»Dann bist du dir also auch der Altersbußen bewusst.«
Es war keine Frage, aber ich antwortete dennoch darauf. »Ja.«
Er seufzte. Es war eine winzige Regung, die nur bemerkte, wer ihn gut kannte. An der Art, wie er dort saß, ganz reglos, und den Hals ein wenig reckte, erkannte ich, dass er schon wusste, wie ich mich entschieden hatte.
»Ich wünschte, du würdest es dir noch einmal überlegen«, sagte er.
»Nein, daraus wird nichts.« Einen Moment lang sah ich die Frustration in seinem Blick. Wir wussten beide, was hier unausgesprochen blieb: Der Orden bot Schutz, und Schutz war bei jemandem von meiner Herkunft von größter Wichtigkeit.
»Darf ich fragen, wieso?«
»Das ist nichts für mich, Greg. Ich kann diese Hierarchien nicht ertragen.«
Für ihn war der Orden ein Ort der Zuflucht und der Sicherheit, eine Stätte der Macht. Die Mitglieder orientierten sich ganz und gar an den Werten des Ordens und dienten ihm mit solcher Hingabe, dass der Orden nicht mehr als Zusammenschluss einzelner Personen erschien, sondern als eigenständiges Gebilde, das überaus mächtig war. Greg hatte sich dem angeschlossen, und es ernährte ihn. Ich hatte mich dagegen gesträubt und beinahe alles verloren.
»Jeden Augenblick, den ich dort verbracht habe«, sagte ich, »hatte ich das Gefühl, als würde ich zusammenschrumpfen, dahinschwinden. Ich musste da raus, und ich werde nicht dorthin zurückkehren.«
Greg sah mich mit einem sehr traurigen Blick aus seinen dunklen Augen an. Im schummrigen Licht meiner kleinen Küche war seine Schönheit geradezu betörend. Auf verquere Art war ich froh, dass meine Sturheit ihn dazu gebracht hatte, mich zu besuchen, und er mir nun direkt gegenübersaß, wie ein altersloser Elfenprinz, elegant und traurig. Ach Gott, wie ich mich für diese Kleinmädchenfantasie hasste.
»Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest«, sagte ich.
Er blinzelte, verblüfft ob meiner Förmlichkeit, und erhob sich mit einer geschmeidigen Bewegung. »Selbstverständlich. Vielen Dank für den Kaffee.«
Ich brachte ihn noch zur Tür. Es war schon dunkel, und der Mond tauchte meinen Vorgartenrasen in seinen silbernen Schein. An der Veranda leuchteten die weißen Hibiskusblüten wie ein Sternhaufen vor dem dunklen Gesträuch.
Ich sah zu, wie Greg die drei Stufen der Eingangstreppe hinabging.
»Greg?«
»Ja?« Er wandte sich um. Seine Magie wallte um ihn wie ein Umhang.
»Nichts.« Ich schloss die Tür.
Das ist meine letzte Erinnerung an ihn: vor dem mondbeschienenen Rasen und in seine Magie gehüllt.
Oh Gott.
Ich schlang die Arme um mich, wollte weinen. Doch die Tränen kamen nicht. Mein Mund war wie ausgetrocknet. Die letzte Verbindung zu meiner Familie war gekappt. Jetzt war niemand mehr übrig. Ich hatte keine Mutter und keinen Vater und jetzt auch keinen Greg mehr. Ich biss die Zähne zusammen und ging packen.
Kapitel 2
Die Magie war wiedergekehrt, während ich das Allernötigste zusammenpackte, und statt meines normalen Wagens musste ich Karmelion nehmen. Karmelion war ein verbeulter, rostiger, gallegrüner Pick-up, dem der linke Scheinwerfer fehlte und der nur einen einzigen Vorteil hatte: Er ließ sich auch mit Wasser betreiben, dem ein wenig Magie zugesetzt war, und daher konnte man auch während einer Magie-Flut damit fahren. Anders als normale Autos rumpelte oder schnurrte der Wagen nicht und machte auch sonst keine Geräusche, die man von einem Motor erwarten würde. Stattdessen heulte er und knurrte und gab mit deprimierender Regelmäßigkeit ohrenbetäubende Donnerschläge von sich. Wer ihn auf den Namen Karmelion getauft hatte und warum, wusste ich nicht. Ich hatte ihn auf einem Schrottplatz gekauft, und der Name hatte in krakeliger Schrift auf der Windschutzscheibe gestanden.
An normalen Tagen musste Karmelion zum Glück nur die dreißig Meilen nach Savannah zurücklegen. Heute jedoch zwang ich den Wagen auf die Erdstrahlenader, was ihm erst einmal nicht schadete, da ihn die Ader fast bis nach Atlanta zog, doch die anschließende Fahrt quer durch die Stadt tat dem Wagen nicht gut. Jetzt kühlte er dort auf einem Parkplatz ab. Wasser tropfte heraus, und er schwitzte Magie. Ich würde eine gute Viertelstunde dafür brauchen, die Lichtmaschine wieder auf Betriebstemperatur zu bringen, aber das war okay. Ich hatte vor, eine Weile hierzubleiben.
Ich hasste Atlanta. Ich hasste alle Städte. Ende der Debatte.
Ich stand auf dem Gehsteig und betrachtete das kleine Bürogebäude, das angeblich die hiesige Sektion des Ordens der Ritter der mildtätigen Hilfe beherbergte. Der Orden gab sich Mühe, seine wahre Größe und Macht zu verbergen, doch in diesem Fall hatten sie es damit übertrieben. Das Gebäude, ein dreigeschossiger Betonkasten, hob sich dank seiner Schäbigkeit deutlich von den stattlichen Backsteinbauten links und rechts ab. Die Mauern waren von Roststreifen überzogen, die das Regenwasser aus der lecken Dachrinne hinterließ. Schwere Gitter sicherten die kleinen Fenster, und Jalousien hinter staubigen Scheiben versperrten den Blick hinein.
Es musste in der Stadt noch eine andere Einrichtung des Ordens geben, in der die Arbeit im Hintergrund geleistet wurde, während man hier der Öffentlichkeit eine nette, bescheidene Fassade bot. Dort gab es dann sicherlich ein großes, hochmodernes Waffenarsenal und dazu ein Computernetzwerk und eine Datenbank, die alles über die Mächtigen enthielt – die magischen wie die weltlichen. Irgendwo im hintersten Winkel dieser Datenbank stand auch mein Name – der Name einer Verstoßenen, einer Undisziplinierten und Wertlosen. Und genauso gefiel es mir.
Ich versuchte, die Gebäudemauer zu berühren. Einige Millimeter vor dem Beton stieß mein Finger auf einen elastischen Widerstand, so als hätte ich versucht, einen Tennisball zusammenzudrücken. Ein schwaches silbernes Schimmern flimmerte über meine Haut, und ich zog die Hand zurück. Das Gebäude war mit einer massiven Abwehr gegen feindliche Magie ausgestattet. Wenn jemand einen Feuerball darauf geschleudert hätte, wäre er wahrscheinlich abgeprallt, ohne auf den grauen Mauern auch nur eine Brandspur zu hinterlassen.
Ich öffnete die stählerne Haustür und ging hinein. Rechts führte ein schmaler Korridor zu einer Tür. Auf einem großen Schild daran stand mit roten Lettern auf weißem Grund: ZUTRITTNURFÜRBEFUGTE. Meine zweite Option war eine Treppe, die aufwärtsführte.
Ich entschied mich für die Treppe, und mir fiel auf, dass sie erstaunlich sauber war. Niemand versuchte mich aufzuhalten. Niemand fragte mich, was ich hier wollte. Schaut her. Wir sind hilfsbereit und ganz und gar nicht bedrohlich. Unser einziges Ziel ist es, der Gemeinschaft zu dienen, und wir lassen sogar jedermann einfach so in unsere Geschäftsräume hereinspazieren.
Das Bedürfnis nach einem bescheiden wirkenden Gebäude konnte ich noch nachvollziehen, aber den öffentlich zugänglichen Angaben zufolge bestand die gesamte Sektion aus neun Rittern: einem Protektor, einem Wahrsager, einem Ermittler, drei Verteidigern und drei Wächtern. Neun Leute kümmerten sich um eine Stadt von der Größe Atlantas. Aber klar doch.
Am oberen Treppenabsatz kam ich an eine mattgrün lackierte Stahltür. Ein kleiner Dolch schimmerte darauf, knapp über Augenhöhe. Anzuklopfen erschien mir keine gute Idee, daher öffnete ich die Tür und trat ein.
Vor mir erstreckte sich ein langer Korridor, der meinen müden Augen eine große farbliche Vielfalt bot: grau, grau und noch mal grau. Die Auslegeware war in schlichtem Grau gehalten, und die Wände waren in zwei verschiedenen Grautönen gestrichen – oben hell- und unten dunkelgrau. Die elektrischen Deckenleuchten wirkten ebenfalls grau. Hier hatte der Innenarchitekt, zweifellos aus ästhetischen Erwägungen, zu einem besonders rauchigen Rauchglas gegriffen.
Der Korridor wirkte makellos sauber. Links und rechts gingen etliche Türen ab, die wahrscheinlich zu den einzelnen Büros führten. Ganz am Ende des Flurs hing an einer großen Holztür ein schwarz lackiertes Drachenschild. In der Mitte des Schildes prangte ein auf Hochglanz polierter stählerner Löwe. Der Protektor. Genau der Typ, den ich sprechen wollte.
Ich marschierte den Korridor hinunter, auf das Schild zu, und warf dabei im Vorbeigehen einen Blick in die offen stehenden Räume. Links sah ich eine Waffenkammer. Ein kleiner, muskulöser Mann saß auf einer Holzbank und polierte ein Dha. Die breite Klinge des vietnamesischen Schwerts schimmerte, und er fuhr mit einem in Öl getunkten Lappen über das bläuliche Metall. Rechts sah ich ein zwar kleines, aber mit allem Pipapo ausgestattetes Büro. Ein großer Schwarzer, der einen teuren Anzug trug, saß an einem Schreibtisch und telefonierte. Er sah mich, lächelte höflich und sprach weiter.
An seiner Stelle hätte ich mich auch keines zweiten Blicks gewürdigt. Ich trug meine übliche Arbeitskluft: eine Jeans, die weit genug geschnitten war, dass ich einem Mann, der größer war als ich, einen Tritt gegen die Kehle verpassen konnte, ein grünes Hemd und bequeme Laufschuhe. Slayer ruhte in seiner Scheide auf meinem Rücken, größtenteils unter meiner Jacke verborgen. Das Heft des Schwerts ragte an meiner rechten Schulter empor, unter meinem Haar verborgen, das zu einem dicken Zopf gebunden war. Dieser Zopf war hinderlich. Er schlug mir beim Laufen auf den Rücken und bot meinen Gegnern im Kampf einen erstklassigen Griff. Wenn ich nicht so eitel gewesen wäre, hätte ich ihn längst abgeschnitten, aber ich hatte der Zweckmäßigkeit schon feminine Kleidung, Make-up und schöne Unterwäsche geopfert. Und es fiel mir nicht im Traum ein, alledem nun auch noch mein Haar hinterherzuschicken.
Als ich vor der Tür des Protektors stand, hob ich die Hand, um anzuklopfen.
»Einen Moment mal«, sagte die strenge Frauenstimme, die ich am Tag zuvor am Telefon gehört hatte.
Ich sah in ihre Richtung und erblickte ein kleines Büro voller Aktenschränke. Mitten im Raum stand ein großer Schreibtisch, und auf diesem Schreibtisch stand eine Frau mittleren Alters. Die Frau war groß und sehr schlank und hatte kurzes, lockiges, platingrau gefärbtes Haar. Sie trug einen eleganten blauen Hosenanzug. Ein passendes Paar Schuhe lag neben dem Stuhl, den sie offenbar dazu genutzt hatte, auf den Tisch zu steigen.
»Es ist gerade jemand bei ihm«, sagte die Frau. Sie hob eine Hand und fuhr damit fort, den Leuchtkörper einer Feenlampe zu wechseln, die neben einer elektrischen Lampe an der Decke angebracht war. »Sie haben doch keinen Termin, oder?«
»Nein, Ma’am.«
»Aber Sie haben Glück. Er hat heute Morgen Zeit. Nennen Sie mir doch Ihren Namen und den Grund Ihres Besuchs, dann schauen wir mal, was ich für Sie tun kann.«
Ich wartete, bis sie mit der Feenlampe fertig war, sagte ihr dann, dass ich wegen Greg Feldman hier sei, und gab ihr meine Karte. Sie schrieb es auf, zeigte keinerlei Regung dabei und wies schließlich hinter mich. »Da drüben ist das Wartezimmer.«
Ich ging hinüber in das Wartezimmer, das sich als ganz normales Büro entpuppte, das mit einem schwarzen Ledersofa und zwei Sesseln möbliert war. An der Wand neben der Tür stand außerdem ein Tisch mit einer Kaffeekanne darauf, flankiert von zwei Stapeln Steinguttassen. Neben den Tassen stand eine Schale Zuckerwürfel und neben dieser Schale zwei Schachteln Duncan’s Donuts. Meine Hand griff unwillkürlich nach einem Donut, doch ich hielt mich zurück. Wer einmal das Vergnügen hatte, einen dieser Donuts zu probieren, weiß, dass man davon unmöglich nur einen essen kann, und wenn ich das Büro des Protektors mit von Hand geschlagener Schokosahne verschmiertem Mund betreten hätte, wäre der erste Eindruck sicher nicht der allerbeste gewesen.
Ich stellte mich in sicherer Entfernung von den Donuts ans Fenster und schaute zwischen den Gitterstäben hindurch nach draußen, in den bedeckten, von Dächern gerahmten Himmel. Der Orden der Ritter der mildtätigen Hilfe bot genau das, was der Name versprach: Hilfe für jeden, der darum bat. Wenn man dafür bezahlen konnte, stellten sie einem eine Rechnung, wenn nicht, killten sie kostenlos. Offiziell lautete ihr Motto, die Menschheit mittels Magie oder Waffengewalt vor allem Übel zu bewahren. Das Problem war bloß, dass sie die Definition des Begriffs »Übel« recht flexibel handhabten, und daher konnte die mildtätige Hilfe durchaus auch darin bestehen, dass sie dem, der sie rief, den Kopf abschlugen.
Der Orden konnte sich eine ganze Menge erlauben. Seine Mitglieder waren zu mächtig, um ignoriert zu werden, und die Versuchung, ihn zu Hilfe zu rufen, war einfach zu groß. Die Regierung verließ sich auf ihn als dritte Säule des polizeilichen Triumvirats. Die Polizei mit ihrer Paranormal Activity Division, das Militär mit seinen Supernatural Defense Units und der Orden der Ritter der mildtätigen Hilfe sollten sich untereinander vertragen und gemeinsam den Schutz der Bevölkerung gewährleisten. Doch die Wirklichkeit sah ein wenig anders aus. Die Ritter des Ordens waren hilfsbereit, fähig, tödlich. Im Gegensatz zu den Söldnern der Gilde waren sie nicht von Geldgier getrieben und hielten, was sie versprachen. Doch anders als die Söldner fällten sie Urteile und glaubten, stets alles besser zu wissen.
Ein groß gewachsener Mann betrat das Wartezimmer. Ich roch ihn fast, ehe ich ihn erblickte – den widerlich süßlichen Gestank von verrottendem Abfall. Der Mann trug einen braunen Trenchcoat voller Tinten- und Fettflecke. Dieser Trenchcoat stand offen und gab so den Blick frei auf eine Scheußlichkeit von einem Hemd: in blau und rot, mit grünem Schottenkaro. Die schmutzige Khakihose wurde von orangefarbenen Hosenträgern gehalten. Der Mann trug alte Springerstiefel mit Stahlkappen und Lederhandschuhe, die über dem ersten Fingerglied abgeschnitten waren. Auf dem Kopf hatte er einen Filzhut, einen altmodischen, völlig verdreckten Fedora. Dichtes, mausgraues Haar ragte in steifen Strähnen unter dem Hut hervor.
Als er mich sah, griff er sich an den Hut, nahm dabei die Krempe zwischen Zeige- und Mittelfinger, so wie manche Leute Zigaretten halten, und da erhaschte ich einen Blick auf sein Gesicht: strenge Falten, Dreitagebart und helle, kalt blickende Augen. Die Art, wie er mich ansah, hatte eigentlich nichts Bedrohliches, doch irgendetwas hinter diesen Augen weckte in mir den Wunsch, schützend die Hände zu heben und langsam zurückzuweichen, bis es sicher war, mich umzuwenden und um mein Leben zu laufen.
»Ma’am«, sagte er gedehnt.
Er machte mir eine Heidenangst. Ich lächelte ihn an. »Guten Morgen.« Dieser Gruß klang, als wollte ich einen bissigen Hund beschwichtigen. Um zur Tür zu gelangen, hätte ich mich an ihm vorbeizwängen müssen.
Die Vorzimmerdame kam mir zu Hilfe. »Sie können jetzt hineingehen!«, rief sie mir zu.
Der Mann trat beiseite und deutete eine Verbeugung an, und ich ging an ihm vorbei. Meine Jacke strich an seinem Trenchcoat entlang und bekam dabei wahrscheinlich genug Bakterien ab, um eine kleine Armee außer Gefecht zu setzen, aber ich wich nicht zurück.
»Sehr erfreut«, murmelte er.
»Gleichfalls«, gab ich zurück und floh in das Büro des Protektors.
Ich fand mich in einem großen Raum wieder, der mindestens doppelt so groß war wie die Büros, die ich bisher hier gesehen hatte. Die schweren, burgunderroten Vorhänge vor den Fenstern ließen gerade genug Licht herein, um eine behaglich-schummrige Atmosphäre zu erzeugen. Ein imposanter Schreibtisch aus poliertem Kirschholz beherrschte den Raum, darauf ein Pappkarton, ein großer Briefbeschwerer aus Mesquiteholz mit der Dienstmarke eines Texas Rangers obendrauf und ein paar braune Cowboystiefel. Die Füße und Beine in diesen Stiefeln gehörten einem breitschultrigen Mann, der sich in einem großen schwarzen Ledersessel zurücklehnte und dem lauschte, was aus dem Telefonhörer an seinem Ohr drang. Der Protektor.
Er musste früher einmal sehr kräftig gewesen sein, doch nun waren seine Muskeln gewissermaßen durchwachsen. Er war immer noch ein großer und starker Mann und konnte sich wahrscheinlich, wenn nötig, immer noch schnell bewegen, trotz seines unansehnlichen Bauchansatzes. Er trug Bluejeans und ein marineblaues Hemd mit Fransen. Ich hatte gar nicht gewusst, dass so etwas noch hergestellt wurde. Diese Klamotten, in denen einst der Westen gewonnen worden war – oder besungen, bis er sich ergeben hatte –, waren eigentlich für gertenschlanke Kerle bestimmt. Der Protektor sah darin aus wie Gene Autry, nachdem er sich allzu lange ausschließlich von Twinkie-Törtchen ernährt hatte.
Der oberste Ritter sah mich an. Er hatte ein breites Gesicht, ein kantiges Kinn und eindringlich blickende blaue Augen unter buschigen Brauen. Seine Nase war, nachdem sie zu oft gebrochen worden war, ein wenig unförmig. Der Hut auf seinem Kopf verbarg sein Haupthaar, oder wahrscheinlich eher den Mangel daran, aber ich hätte darauf gewettet, dass das, was von seinem Haupthaar noch übrig war, grau und kurz geschoren war.
Der Protektor lud mich mit einem Wink ein, in einem der kleineren roten Sessel vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen. Ich setzte mich und erhaschte dabei einen Blick in den Karton auf dem Tisch. Er enthielt einen halb verspeisten, mit Marmelade gefüllten Donut.
Der Protektor lauschte weiter in den Hörer, also sah ich mich ein wenig in seinem Büro um. Ein großer Bücherschrank, ebenfalls aus dunklem Kirschholz, an der Wand gegenüber. Darüber eine hölzerne Landkarte von Texas, die mit Stacheldrahtstücken dekoriert war. Eine goldene Inschrift unter jedem einzelnen Stück vermerkte Hersteller und Baujahr.
Der Protektor beendete das Telefonat, indem er auflegte, ohne ein Wort gesprochen zu haben. »Wenn Sie mir irgendwelche Papiere zu zeigen haben, wäre jetzt der richtige Moment dafür.«
Ich überreichte ihm meinen Söldnerausweis und ein halbes Dutzend Empfehlungsschreiben. Er sah sich alles an.
»Wasser und Abwasser, hm?«
»Ja.«
»Man muss entweder knallhart oder strohdumm sein, wenn man heutzutage noch in die Kanalisation hinabsteigt. Also, was von beidem sind Sie?«
»Strohdumm bin ich nicht, aber wenn ich Ihnen nun sage, ich sei knallhart, halten Sie mich ja doch bloß für ein Großmaul, und deshalb lächle ich lieber geheimnisvoll.« Ich schenkte ihm mein schönstes geheimnisvolles Lächeln. Er fiel nicht vor mir auf die Knie, küsste mir nicht die Schuhe und legte mir auch nicht die Welt zu Füßen. Ich muss wohl ein bisschen aus der Übung sein.
Der Protektor warf einen Blick auf die Unterschrift. »Mike Tellez. Mit dem hatte ich schon zu tun. Arbeiten Sie regelmäßig für ihn?«
»Mehr oder weniger.«
»Worum ging es diesmal?«
»Er hatte ein Problem, große Ausrüstungsgegenstände wurden fortgeschleppt. Jemand hatte ihm gesagt, er hätte es da mit einem jungen Marakihan zu tun.«
»Das sind Meereslebewesen«, entgegnete er. »Die würden in Süßwasser nicht überleben.«
Ein Fettsack, der mit Puderzucker bestäubte Marmeladen-Donuts futterte, ein Fransenhemd trug und andererseits ein seltenes magisches Wesen identifizieren konnte, ohne auch nur darüber nachdenken zu müssen. Der Protektor. Ein Mann, der wirklich was von Tarnung verstand.
»Und Sie sind Mikes Problem auf den Grund gegangen?«, fragte er.
»Ja. Er hatte den Impala-Wurm«, antwortete ich.
Wenn er beeindruckt war, ließ er es sich nicht anmerken. »Haben Sie ihn zur Strecke gebracht?«
Sehr witzig. »Nein, ich habe ihn nur vergrault.«
Die Erinnerung daran kam wieder hoch, und einen Augenblick lang bewegte ich mich erneut durch einen schummrig erleuchteten Tunnel, der bis in Hüfthöhe mit flüssigen Exkrementen geflutet war. Mein linkes Bein brannte vor Schmerz, und ich kämpfte mich humpelnd weiter voran, während hinter mir der riesenhafte, bleiche Leib des Wurms in den schmutzigen Schlamm blutete. Das seidig glänzende grüne Blut wirbelte auf der Schlammoberfläche herum, jede einzelne Blutzelle ein winziger Organismus, der von einem einzigen Ziel besessen war: sich wieder zu vereinen. Ganz egal, wie oft und wie weit voneinander entfernt dieses Wesen auftauchte, es war immer derselbe Impala-Wurm. Es gab nur diesen einen, und er hörte nie auf, sich neu zu bilden.
Der Protektor legte meine Papiere auf den Schreibtisch. »Also, was wollen Sie?«
»Ich ermittle im Fall Greg Feldman.«
»In wessen Auftrag?«
»In meinem eigenen.«
»Soso.« Er lehnte sich zurück. »Und weshalb?«
»Aus persönlichen Gründen.«
»Kannten Sie ihn denn persönlich?« Er stellte die Frage in einem gänzlich ausdruckslosen Ton, aber es war offenkundig, was er damit andeuten wollte. Ich war froh, dass ich ihn enttäuschen konnte.
»Ja. Er war ein Freund meines Vaters.«
»Soso«, sagte er erneut. »Ihr Vater könnte das nicht zufällig bestätigen?«
»Nein, er ist tot.«
»Das tut mir leid.«
»Das muss es nicht«, erwiderte ich. »Sie kannten ihn ja gar nicht.«
»Haben Sie irgendetwas, das Ihr Verhältnis zu Greg Feldman bestätigen könnte?«
Es wäre mir ein Leichtes gewesen, ihm eine derartige Bestätigung zu liefern. Wenn er in seinen Daten nachgesehen hätte, hätte er festgestellt, dass Greg damals, als ich mich beim Orden beworben hatte, mein Bürge gewesen war, aber auf dieses Thema wollte ich lieber nicht zu sprechen kommen.
»Greg Feldman war neununddreißig Jahre alt. Er war sehr auf seine Privatsphäre bedacht und konnte es nicht ausstehen, fotografiert zu werden.« Ich überreichte ihm einen kleinen Ausschnitt des Fotos. »Das ist ein Bild von ihm und mir, entstanden am Tag meiner Highschool-Abschlussfeier. In seiner Wohnung befindet sich ebenfalls ein Abzug dieses Fotos. Es steht in seiner Bibliothek, auf dem dritten Brett von oben des mittleren Regals.«
»Das habe ich gesehen«, sagte der Protektor.
Wie reizend. »Dürfte ich das bitte wiederhaben?«
Er gab mir das Foto zurück. »Sind Sie sich bewusst, dass Sie in Greg Feldmans Testament als Erbin aufgeführt sind?«
»Nein.« Ich hätte gern einen Moment Zeit gehabt, um mit meinen Schuldgefühlen und meiner Dankbarkeit klarzukommen, aber der Protektor fuhr bereits fort.
»Er hat sein Vermögen dem Orden und der Akademie vermacht.« Er beobachtete mich, wie ich reagieren würde. Glaubte er im Ernst, ich wäre scharf auf Gregs Geld? »Alles Übrige – die Bibliothek, die Waffen, die magischen Objekte – gehört nun Ihnen.«
Ich schwieg.
»Ich habe mich bei der Gilde nach Ihnen erkundigt«, sagte er und sah mich unverwandt an. »Man sagte mir, Sie seien fähig, bräuchten aber dringend Geld. Der Orden ist bereit, Ihnen für die Gegenstände, über die wir gerade sprachen, ein großzügiges Angebot zu unterbreiten. Sie werden sehen, die Summe ist mehr als angemessen.«
Das war eine Beleidigung, und das wussten wir beide. Ich war drauf und dran, ihm zu sagen, dass die Texaner ihre Entstehung doch wohl einzig und allein dem Zusammentreffen von Cowboys aus Oklahoma und Nutten aus Mexiko zu verdanken hätten, aber das wäre kontraproduktiv gewesen. Man bezeichnete einen Protektor nicht in seinem eigenen Büro als Hurensohn.
»Nein, danke«, sagte ich mit freundlichem Lächeln.
»Sind Sie sicher?« Sein Blick taxierte mich. »Sie sehen aus, als könnten Sie Geld gebrauchen. Der Orden zahlt Ihnen mehr, als wenn Sie das Zeug versteigern lassen würden. Ich rate Ihnen, nehmen Sie das Geld. Und kaufen Sie sich mal ein Paar anständige Schuhe.«
Ich sah auf meine ramponierten Laufschuhe hinunter. Ich mochte meine Schuhe. Man konnte sie bleichen. Damit kriegte man sogar das Blut raus.
»Soll ich mir auch solche wie Sie zulegen?«, fragte ich mit Blick auf seine Stiefel. »Wer weiß, vielleicht kriege ich ja auch noch gratis ein Fransenhemd dazu. Und so einen Cowboygürtel.«
Es regte sich etwas in seinen Augen. »Sie haben eine ganz schön große Klappe.«
»Wer? Ich?«
»Reden kostet nichts. Was haben Sie denn wirklich auf der Pfanne?«
Vorsicht, dünnes Eis.
Ich lehnte mich zurück. »Was ich auf der Pfanne habe, Sir? Nun, ich werde den Protektor in seinem eigenen Büro weder bedrohen noch gegen mich aufbringen, ganz egal, wie sehr er mich auch beleidigen mag. Das wäre töricht und schlecht für meine Gesundheit. Ich bin auf der Suche nach Informationen. Ich will nur wissen, woran Greg Feldman gearbeitet hat, bevor er starb.«
Einen Moment lang saßen wir nur da und sahen einander an.
Dann atmete der Protektor tief durch die Nase ein und fragte: »Und Sie verstehen etwas von solchen Ermittlungen?«
»Klar. Man geht den Beteiligten so lange auf den Zeiger, bis der Schuldige renitent wird und versucht, einen vor die Tür zu setzen.«
Er verzog das Gesicht zu einem Grinsen. »Sie wissen, dass auch der Orden in dieser Sache ermittelt?«
Mit anderen Worten: Geh nach Hause, kleines Mädchen, und überlass das hier den Erwachsenen. »Greg Feldman war mein einziger Angehöriger«, sagte ich. »Ich werde herausfinden, wer oder was ihn umgebracht hat.«
»Und dann?«
»Das kläre ich, wenn es so weit ist.«
Er verschränkte die Finger so ineinander, dass er mit beiden Händen eine Faust bildete. »Wer fähig ist, einen Wahrsager des Ordens zu töten, hat einiges an Macht zu bieten.«
»Aber nicht mehr lange.«
Er ließ sich das durch den Kopf gehen. »Wie es sich trifft, könnte ich Sie gut gebrauchen«, sagte er.
Das kam unerwartet. »Wieso das?«
Er schenkte mir das, was er wohl für sein geheimnisvolles Lächeln hielt. Der Anblick erinnerte an einen Grizzlybären, den man gerade aus dem Winterschlaf gerissen hatte. »Ich habe meine Gründe. Folgendes könnte ich für Sie tun. Sie würden ein Amtshilfeabzeichen in den Ausweis bekommen, was Ihnen einige Türen öffnen würde. Sie könnten Gregs Büro nutzen. Sie dürften Einblick in die offene Akte und die Polizeiberichte nehmen.«
Offene Akte bedeutete, dass ich den Fall bekommen würde, wie Greg ihn bekommen hatte: das Faktengerippe und kaum weitere Erkenntnisse. Ich würde Gregs Schritte nachvollziehen müssen. Es war viel mehr, als ich erwartet hatte.
»Danke«, sagte ich.
»Die Akte bleibt hier im Gebäude«, sagte er. »Keine Kopien, keine Zitate. Sie berichten mir, und nur mir.«
»Aber ich bin der Gilde Rechenschaft schuldig«, erwiderte ich.
Das wischte er mit einer Handbewegung beiseite. »Das wird geregelt.«
Seit wann denn das? Dieser Protektor stellte tatsächlich alles Mögliche auf die Beine, um einer nichtsnutzigen Söldnerin zu helfen. Wieso tat er das?
Leute, die mir einen Gefallen taten, machten mich nervös. Doch andererseits schaute man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul. Nicht mal, wenn man das Pferdchen von einem Fettsack im Fransenhemd geschenkt bekam.
»Sie haben hier keinen offiziellen Status«, sagte er. »Wenn Sie Mist bauen, sind Sie bei mir sofort unten durch.«
»Verstanden.«
»Das wär’s dann«, sagte er.
Draußen winkte mich die Vorzimmerdame zu sich und ließ sich meinen Ausweis geben. Ich sah zu, wie sie ein kleines metallisches Amtshilfeabzeichen hinzufügte, eine offizielle Bestätigung, dass der Orden an meinem bescheidenen Wirken interessiert war. Das würde mir manche Türen öffnen. Andere würde man mir deshalb vor der Nase zuschlagen.
»Nehmen Sie es Ted nicht übel«, sagte die Sekretärin und gab mir meinen Ausweis wieder. »Er ist halt manchmal etwas schroff. Ich heiße übrigens Maxine.«
»Ich bin Kate. Könnten Sie mir zeigen, wo das Büro des verstorbenen Wahrsagers ist?«
»Aber gern. Hinten rechts die letzte Tür.«
»Danke.«
Sie lächelte und widmete sich wieder ihrer Arbeit.
Bei Gregs Büro angelangt, blieb ich in der Tür stehen. Irgendetwas stimmte hier nicht.
Durch ein rechteckiges Fenster schien Tageslicht auf den Fußboden, einen schmalen Schreibtisch und zwei alte Stühle. Links nahm ein tiefes Bücherregal die gesamte Wandfläche ein und drohte unter der Last der säuberlich geordneten Bände zusammenzubrechen. Vier mannshohe metallene Aktenschränke nahmen die Wand gegenüber ein. Aktenstapel und Papiere häuften sich in den Ecken, auf den Stühlen und auf dem Tisch.
Jemand hatte Gregs Papiere durchsucht. Man hatte dabei Vorsicht walten lassen. Das Büro war nicht durchwühlt worden, sondern jemand hatte sich jede einzelne Akte angesehen und sie dann nicht an ihren Standort zurückbefördert, sondern auf der erstbesten Fläche abgelegt. Aus irgendeinem Grund ging es mir mächtig gegen den Strich, dass jemand Gregs Sachen nach seinem Tod angerührt und durchgesehen und seine Aufzeichnungen gelesen hatte.
Ich trat über die Türschwelle und spürte einen schützenden Zauberbann sich hinter mir schließen. Arkane Symbole, die schwach orangefarben leuchteten, bildeten auf dem grauen Teppichboden komplexe Muster. Lange, verschlungene Linien verbanden die einzelnen Symbole, und wo sie im Raum aufeinandertrafen, leuchteten rote Punkte. Greg hatte das Zimmer mit seinem eigenen Blut versiegelt und hatte dieses Siegel darüber hinaus auf mich abgestimmt, sonst wäre ich nicht in der Lage gewesen, den Bann zu sehen. Jetzt würde alle Magie, die ich in diesem Raum wirkte, darin verbleiben und jenseits der Tür keinen Nachhall auslösen. Einen derart komplexen Bann zu erschaffen musste Wochen gedauert haben. Weshalb hatte Greg das getan?
Ich ging zwischen den Akten hindurch zu dem Bücherregal. Darin standen eine alte Ausgabe des Almanachs der Zauberwesen, eine sogar noch ältere Ausgabe des Arkanen Wörterbuchs, eine Bibel, eine schöne, in Leder gebundene und mit Goldschrift verzierte Koran-Ausgabe, etliche weitere religiöse Werke und eine schlanke Ausgabe von Edmund Spensers Faerie Queene.
Dann ging ich zu den Aktenschränken. Wie nicht anders zu erwarten, waren sie leer. Die Abteilungen waren in Gregs persönlichem Kode beschriftet, den ich nicht entziffern konnte. Aber das spielte nun auch keine Rolle. Ich nahm den Aktenstapel, der mir am nächsten lag, und hängte vorsichtig die erste Akte in das Register.
Zwei Stunden später hatte ich die Akten, die auf dem Fußboden und auf den Stühlen verstreut lagen, wieder einsortiert und wollte eben mit den Aktenstapeln auf dem Schreibtisch fortfahren, als mich ein großer brauner Umschlag innehalten ließ. Er lag auf einem Stapel in der Mitte, daher konnte ich meinen Namen erkennen, der mit schwarzem Filzstift in Gregs Handschrift daraufstand.
Ich stapelte die Akten auf dem Fußboden, zog mir einen Stuhl heran und verteilte den Inhalt des Umschlags auf der nun frei geräumten Schreibtischplatte. Es waren zwei Fotos und ein Brief. Auf dem ersten Foto standen zwei Paare beieinander. Ich erkannte meinen Vater, einen hünenhaften rothaarigen Mann, der einen Arm um die Schultern einer Frau legte, bei der es sich um meine Mutter handeln musste. Manche Kinder bewahren Erinnerungen an ihre verstorbenen Eltern, den Nachhall einer Stimme, einen Duft, ein Bild. Ich aber erinnerte mich überhaupt nicht an meine Mutter, so als hätte es sie nie gegeben. Mein Vater hatte keine Fotos von ihr aufbewahrt – es wäre wohl zu schmerzlich für ihn gewesen –, und ich wusste von ihr nur, was er mir erzählt hatte. Sie sei hübsch gewesen, hatte er gesagt, und habe langes blondes Haar gehabt. Ich sah mir die Frau auf dem Bild genau an. Sie war klein und zierlich. Ihre Gesichtszüge entsprachen ihrem Körperbau: Sie waren wohlgeformt und zart, ohne zerbrechlich zu wirken. Wie sie dort stand, machte sie einen selbstsicheren Eindruck und war sich ganz offenkundig ihrer Macht bewusst. Sie war eine schöne Frau.
Greg und mein Vater hatten behauptet, dass ich ihr ähnelte, aber so aufmerksam ich ihr Bild auch betrachtete, konnte ich da keine Ähnlichkeit entdecken. Meine Gesichtszüge waren gröber. Mein Mund war größer und ließ sich nicht einmal mit viel Fantasie als »Schmollmund« bezeichnen. Ich hatte zwar ihre Augenfarbe geerbt, ein dunkles Braun, aber meine Augen waren eher mandelförmig. Außerdem war mein Teint eine Spur dunkler.
Doch da war noch mehr: Das Gesicht meiner Mutter hatte eine feminine Schönheit, meines gar nicht, zumindest nicht im direkten Vergleich mit ihrem. Wenn wir nebeneinander in einem Raum voller Menschen gestanden hätten, hätte mich gewiss niemand beachtet. Und wenn mich doch mal ein Mann angesprochen hätte, hätte sie ihn mir mit einem Lächeln abspenstig machen können.
Von wegen hübsch. Nette Untertreibung, Daddy.
Andererseits, wenn die gleichen Leute eine von uns beiden dazu hätten auserwählen sollen, einem Fiesling einen kräftigen Tritt gegen die Kniescheibe zu verpassen, hätten sie sich auf jeden Fall für mich entschieden.
Neben meinen Eltern stand Greg mit einer gut aussehenden Asiatin. Anna. Seine erste Frau. Im Gegensatz zu meinen Eltern standen die beiden ein wenig auseinander, hielten kaum merklich Abstand zueinander. Und Gregs Augen blickten traurig.
Ich drehte das Foto um und legte es auf den Schreibtisch.
Auf dem anderen Foto war ich zu sehen. Ich war neun oder zehn Jahre alt und sprang von den Ästen einer großen Pappel in einen See. Ich hatte nicht gewusst, dass er dieses Foto besaß, hatte nicht einmal gewusst, dass es geknipst worden war.
Dann las ich den Brief, ein paar Zeilen auf weißem Papier, Verse von Edmund Spenser:
»Den liebsten Namen schrieb ich in den Sand,
Da schwand er mit der Ebbe in der See.
Und wieder einmal schrieb ich ihn, da schwand
Er mit der Flut zu meinem tiefen Weh.«
Darunter waren mit Gregs Blut vier Worte geschrieben:
Amehe
Tervan
Senehe
Ud
Die Worte loderten rot. Mich packte ein Krampf. Meine Lunge wurde zusammengepresst, der Raum verschwamm vor meinen Augen, und das Pochen meines Herzens klang in meinen Ohren laut wie Glockengeläut. Kräfte wirbelten um mich herum, hüllten mich in ein Gewirr aus Strömungen. Ich griff danach, und sie trugen mich fort, tief hinein in ein Gemisch aus Licht und Laut. Das Licht durchdrang mich und erstrahlte in meinem Geist, jagte Myriaden Funken über meine Haut. Das Blut in meinen Adern glomm wie geschmolzenes Metall.
Verloren. Verloren in diesem Wirbel aus Licht.
Mein Mund öffnete sich, rang darum, ein Wort von sich zu geben. Doch es wollte nicht, und ich dachte schon, ich würde sterben, und dann sagte ich es doch, steckte all meine Macht in den einen schwachen Laut.
»Hesaad.« Mein.
Die Welt hörte auf sich zu drehen, und ich fand meinen Platz darin wieder. Die vier Worte ragten vor mir auf. Ich musste sie aussprechen. Ich ballte meine Macht und sprach die Worte, unterwarf sie mir, zwang sie, mein zu werden.
»Amehe. Tervan. Senehe. Ud.«
Der Strom der Macht verebbte. Ich starrte auf das weiße Blatt Papier. Die Worte waren verschwunden, und an ihrer Stelle breitete sich nun ein tiefroter Fleck auf dem Blatt aus. Ich berührte ihn und spürte das Prickeln der Magie. Es war mein Blut. Meine Nase blutete.
Ich zog einen Verband aus der Tasche (ich hatte immer Verbandszeug dabei), drückte ihn mir unter die Nase und legte den Kopf in den Nacken. Diesen Verband würde ich später verbrennen. Meine Armbanduhr zeigte 12.17 Uhr. Irgendwie waren in diesen wenigen Augenblicken fast anderthalb Stunden vergangen.
Die vier Wörter der Macht: Gehorche, Töte, Beschütze und Stirb. Wörter, die so ursprünglich, so gefährlich, so mächtig waren, dass sie der Magie selbst geboten. Niemand wusste, wie viele dieser Wörter es gab, woher sie kamen und warum sie so einen gewaltigen Einfluss auf die Magie hatten. Selbst Menschen, die nie selbst die Magie gebraucht hatten, erkannten ihre Bedeutung und unterlagen ihrer Macht, so als gehörten diese Wörter einem uralten Menschheitsgedächtnis an, das wir alle in uns trugen.
Doch es genügte nicht, sie nur zu kennen; man musste sie auch besitzen. Und wenn es darum ging, diese Wörter zu erwerben, gab es keine zweiten Chancen. Man errang sie entweder oder kam bei dem Versuch ums Leben – was auch erklärte, warum so wenige Magie-Wirkende sie zu führen wussten. Hatte man sie aber erst einmal erworben, so gehörten sie einem für immer. Sie mussten mit äußerster Präzision eingesetzt werden; und ihr Gebrauch erforderte einen solchen Machtaufwand, dass man anschließend fast völlig erschöpft zurückblieb. Sowohl Greg als auch mein Vater hatten mich gewarnt, dass den Wörtern der Macht Widerstand entgegengesetzt werden konnte, doch bisher hatte ich keine Gelegenheit gehabt, sie gegen einen Widersacher einzusetzen, der das tat. Sie waren das letzte Mittel, wenn alles andere versagt hatte.
Nun besaß ich sechs dieser Wörter. Vier hatte ich von Greg, und zwei weitere hatte mir mein Vater vor langer Zeit beigebracht: Mein und Gib frei. Ich war damals zwölf Jahre alt gewesen, und es hatte mich fast umgebracht, sie mir anzueignen. Diesmal war es viel zu einfach gewesen.
Vielleicht wuchs die Macht des Blutes mit den Jahren. Ich wünschte, Greg wäre noch am Leben gewesen und hätte mir das alles erklären können.
Ich sah zu Boden. Die orangefarbenen Linien von Gregs Wehr leuchteten so schwach, dass ich sie kaum noch erkennen konnte. Sie hatten alles absorbiert, was sie absorbieren konnten.
Die Wörter hallten in meinem Kopf wider. Gregs letztes Geschenk. Wertvoller als alles, was er mir hätte hinterlassen können.
Da wurde ich mir bewusst, dass ich beobachtet wurde. Ich blickte hoch und sah einen schlanken schwarzen Mann in der Tür stehen. Er hatte mir zugelächelt, als ich drei Stunden zuvor an seinem Büro vorbeigegangen war.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte er.
»Ich bin über ein remanentes Wehr gestolpert«, murmelte ich, das Verbandstuch immer noch unter der Nase. »So was kommt schon mal vor. Alles okay.«
Er beäugte mich. »Sicher?«
»Ja.« Ja, ich gebe es zu, ich bin eine unfähige Vollidiotin. Und jetzt verpfeif dich.
»Ich habe Ihnen Gregs Akte mitgebracht.« Er machte keine Anstalten, den Raum zu betreten. Nicht dumm. Wenn ich in eine Falle getappt war, konnte es ihm ebenso ergehen. »Tut mir leid, dass es ein bisschen gedauert hat. Einer unserer Ritter hatte sie.«
Ich ging hinüber und nahm die Akte entgegen. »Danke.«
»Gern.« Er besah mich noch einen Moment lang und ging dann wieder fort.
Ich suchte in Gregs Schreibtischschubladen nach einem Spiegel. Jeder Magier, der etwas auf sich hielt, hatte stets einen Spiegel zur Hand. Gregs Spiegel war rechteckig und in einen schlichten Holzrahmen gefasst. Als ich mein Spiegelbild erblickte, hätte ich beinahe den Verbandslappen fallen lassen. Mein Haar glühte. Ein burgunderrotes Leuchten ging davon aus, das sich veränderte, wenn ich mit der Hand hindurchfuhr. Ich schüttelte den Kopf, doch das Leuchten ließ nicht nach. Es anzuknurren half auch nicht, und ich hatte keine Ahnung, wie ich es wieder loswerden konnte.
Ich verzog mich in die hinterste Ecke des Zimmers, die von der Tür aus nicht einzusehen war, und schlug die Akte auf. Wenn ich es nicht vertreiben konnte, würde ich eben warten, bis es von selbst verschwand.
Als ich mir das letzte Mal Wörter der Macht angeeignet hatte, war ich hinterher vollkommen erschöpft gewesen. Nun aber war ich in Hochstimmung, geradezu besoffen von Magie. Die Energie erfüllte mich, und ich konnte kaum an mich halten. Am liebsten wäre ich herumgesprungen, hätte irgendetwas unternommen. Doch stattdessen musste ich mich in einer Ecke verstecken und mich auf diese Akte konzentrieren.
Die Akte enthielt einen rechtsmedizinischen Bericht, die Zusammenfassung eines Polizeiberichts, einige eilig hingeworfene Notizen und etliche Tatortfotos. Ein Foto zeigte zwei auf dem Asphalt ausgestreckte Leichen, die eine bleich und splitternackt, die andere zerfleischt und blutüberströmt. Dann kam ich zu einer Nahaufnahme des zerfleischten Leichnams. Er lag mit ausgebreiteten Armen auf einem blutgetränkten Tuch. Etwas hatte ihm mit einem Schlag das Brustbein gebrochen und ihm dann mit unglaublicher Kraft den Brustkorb aufgerissen. Die Brusthöhle klaffte, die feucht schimmernde Masse des zermalmten Herzens dunkel vor den schwammartigen Überresten der Lunge und dem gelblichen Weiß der gebrochenen Rippen. Der linke Arm hing, aus dem Schultergelenk gerissen, nur noch an einem blutigen Fetzen.
Das nächste Bild war eine Nahaufnahme des Kopfes. Traurig blickende Augen, die ich nur allzu gut kannte, sahen direkt in die Kamera und so auch mich direkt an. Oh Gott. Ich las die Bildbeschriftung. Dieser zerfetzte Fleischklumpen war alles, was von Greg übrig geblieben war.
Meine Kehle war wie zugeschnürt, und ich kämpfte dagegen an. Das war nicht Greg. Das war nur sein Leichnam.
Das nächste Foto lieferte mir einen genaueren Blick auf die zweite Leiche. Sie schien unversehrt, bis auf den Kopf. Der fehlte. Der Ansatz des Rückgrats ragte aus dem Halsstumpf, umgeben von Gewebefetzen. Doch es war kaum Blut zu sehen. Da hätte literweise Blut sein müssen. Der Leichnam lag schräg, Halsschlagader wie Drosselvene waren säuberlich durchtrennt. Also, wo war das ganze Blut geblieben?
Ich stieß auf vier weitere Fotos der Leiche und legte sie nebeneinander auf dem Fußboden aus. Die glatte, marmorweiße Haut war über der Muskulatur straff gespannt, so als hätte der Körper keinerlei Fett, nur Muskelgewebe. Kein einziges Haar war zu sehen. Das Skrotum sah schrumpelig und ungewöhnlich klein aus. Ich brauchte eine Nahaufnahme der Hände, aber die gab es nicht. Da hatte jemand gepatzt. Aber das spielte nun auch keine große Rolle mehr, denn die übrigen verräterischen Anzeichen waren allesamt vorhanden. Auch ohne dass ich die Fingernägel betrachtet hatte, war die Sache klar: Was ich da vor mir hatte, war ein toter Vampir.
Vampire sind definitionsgemäß tot, doch dieser hier hatte nun auch sein Dasein als Untoter hinter sich. Nicht einmal Ghastek mit all den nekromantischen Kräften, über die er gebot, vermochte einen Vampir wiederzubeleben, der keinen Kopf mehr hatte. Die Frage war nun, wem dieser Vampir gehörte. Die meisten Leute versahen ihre Vampire mit einem Brandzeichen. Wenn dieser hier ein Brandzeichen besaß, so sah man es zumindest auf keinem der Bilder, die der vollkommen unfähige Fotograf geschossen hatte.
Was war in der Lage, einen Vampir und einen Wahrsager des Ordens gemeinsam auszulöschen?
Der Vampir, unglaublich schnell und in der Lage, mit bloßen Händen ein ganzes Sondereinsatzkommando der Polizei niederzumachen, wäre alleine schon keine leichte Beute gewesen. Doch den Vampir und Greg zur Strecke zu bringen war so gut wie unmöglich. Und doch, da lagen sie – beide tot.
Ich lehnte mich an die Wand und dachte nach. Der Täter musste über große Macht verfügen. Er musste schneller sein als ein Vampir, stark genug, um jemandem den Kopf abzureißen, und fähig, Gregs Magie abzuwehren. Die Liste der möglichen Täter, die mir auf Anhieb einfielen, war ziemlich kurz.
Erstens: Das Volk konnte versucht haben, Greg zu töten, und hatte dabei einen seiner Vampire als Köder eingesetzt. Ein bejahrter Vampir war in den Händen eines erfahrenen und fähigen Herrn der Toten eine Waffe, die sich mit keiner anderen vergleichen ließ. Wenn mehr als einer beteiligt war, hatten sie womöglich Greg und ihren Blutsauger umgebracht. Das war kostspielig und unwahrscheinlich, da Greg gerade im Kampf gegen Vampire sehr gut war, aber unmöglich war es nicht.