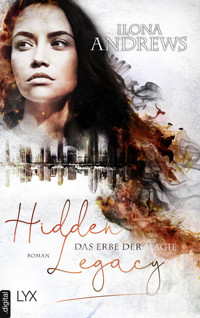11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Kate-Daniels-Reihe
- Sprache: Deutsch
Seit die ehemalige Söldnerin Kate Daniels und ihr Gefährte, der Gestaltwandler Curran Lennart, ihr Rudel verlassen haben, verläuft ihr Leben in ruhigeren Bahnen. Doch dann erfahren sie, dass ihr Freund Eduardo verschwunden ist. Eduardo war ein Mitglied der Söldnergilde, und als Kate und Curran seiner Spur folgen, decken sie eine geheime Verschwörung innerhalb der Gilde auf. Ein alter Feind will die Stadt Atlanta ins Chaos stürzen - und Kate und Curran sind die Einzigen, die ihm noch Einhalt gebieten können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchDanksagungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19 Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22EpilogDie AutorinDie Romane von Ilona Andrews bei LYXLeseprobeImpressumILONA ANDREWS
Stadt der Finsternis
EIN NEUER MORGEN
Roman
Ins Deutsche übertragen vonBernhard Kempen
Zu diesem Buch
Kate Daniels und Curran Lennart hatten es nie besonders leicht, erst recht nicht, seit sie sich entschieden haben, das anstrengende Leben im Rudel hinter sich zu lassen. Während sie noch versuchen, sich an ihr neues, unabhängiges Leben zu gewöhnen und eine eigene Söldner-Firma zu gründen, wird ein uralter Feind entfesselt und droht, Atlanta in Schutt und Asche zu legen. Seit Kate die Stadt ihrem gottähnlichen Vater im Kampf abgerungen hat, ist es ihre – und Currans – Aufgabe, Atlanta zu beschützen. So bleibt den beiden nichts anderes übrig, als gegen eine Horde Ghoule, schreckliche Killer-Insekten und gewaltige Riesen anzutreten. Doch ihre Feinde sind so zahlreich und mächtig, dass der Sieg diesmal alles andere als sicher ist. Um zu gewinnen, muss Kate etwas tun, das ihr zutiefst widerstrebt: jemandem vertrauen, dem sie eigentlich nicht trauen kann …
DANKSAGUNG
Es wäre nicht möglich gewesen, diese Geschichte ohne den Einsatz der Herausgeberin Anne Sowards zu erzählen. Vielen Dank für den Rat und die Freundschaft! Wir möchten auch unserer Agentin Nancy Yost für ihre unendliche Geduld und Bereitschaft danken, mit einem anscheinend nie endenden Strom von Anrufen, E-Mails und Krisen fertigzuwerden.
Wie immer sind wir all denen dankbar, die daran mitgearbeitet haben, aus dem Manuskript ein Buch zu machen. Der Herstellerin Michelle Kasper und ihrer Assistentin Julia Quinlan. Der Grafikerin Judith Lagerman, der Künstlerin Juliana Kolesova, die für das Titelbild verantwortlich ist, und dem Coverdesigner Jason Gill.
Wir möchten auch unseren Beta-Lesern danken, die selbstlos die Qualen ertragen, ein unfertiges Manuskript Korrektur zu lesen. Das sind in willkürlicher Reihenfolge: Ying Dallimore, Laura Hobbs, María Isabel Amoretti de Pagano, Nur-El-Hudaa Jaffar, Kelly Brooke, Beatrix Kaser, Olivia Toune, Nicole Joury, Christian und ganz besonders Shannon Daigle. Danke an Vibha Patel, Lisa Rigdon, JeNoelle Flom, Liz Semkiu, Olga Zmijewska-Kaczor und Bambi Parfan für ihre Hilfe bei medizinischen Fragen. Alle Fehler sind von uns und nur von uns allein.
Schließlich danken wir Ihnen allen, dass Sie bis jetzt bei uns geblieben sind. Wir hoffen, Sie genießen das Buch.
KAPITEL 1
Ich ritt auf einer Mammut-Eselin durch die in Nacht getränkten Straßen von Atlanta. Der Name der Eselin war Knuddel. Sie war einschließlich der Ohren drei Meter hoch, und ihr schwarz-weißes Fell ließ vermuten, sie könnte in einer dunklen Gasse eine Holstein-Kuh überfallen haben und nun ihre Kleider tragen. Mein eigenes blutbespritztes Outfit ließ darauf schließen, dass ich eine interessante Nacht hinter mir hatte. Die meisten Reittiere hätte es nervös gemacht, eine so blutige Frau aufsitzen zu lassen, aber Knuddel schien es nichts auszumachen. Entweder machte es ihr nichts aus, oder sie war eine Pragmatikerin, die wusste, woher ihre Karotten kamen.
Die Stadt lag vor mir, ausgestorben, ruhig und in Magie getaucht, und breitete ihre Straßen bis zum Sternenlicht wie eine vom Mond beschienene Blume aus. Heute Nacht war die Magie in Atlanta tief wie die Strömung eines Phantom-Flusses, der in die schattigen Orte schlüpfte und hungrige Wesen mit nadelspitzen Zähnen und glühenden Augen aufweckte. Jeder mit auch nur einem Fünkchen Vernunft versteckte sich hinter bewehrten Türen und verbarrikadierte die Fenster, wenn es dunkel wurde. Zu meinem Pech war Vernunft noch nie eine meiner Tugenden gewesen. Während Knuddel gelassen mit unnatürlich lautem Hufschlag die Straßen entlangklapperte, beobachteten uns die Schatten der Nacht, und ich beobachtete sie meinerseits. Lasst uns »Wer ist der bessere Killer?« spielen. Mein Schwert und ich lieben dieses Spiel.
Keins der Monster ließ sich ködern. Es mochte an mir liegen, aber höchstwahrscheinlich lag es daran, dass sich eins davon parallel zu meiner Route bewegte. Sie rochen es und versteckten sich in der Hoffnung, es würde an ihnen vorbeigehen.
Es war schon fast Mitternacht. Es war ein langer Tag gewesen. Mir schmerzte der Rücken, meine Kleidung stank übel nach Blut, und eine heiße Dusche klang verheißungsvoll. Ich hatte letzte Nacht zwei Apfelkuchen gebacken und war mir ziemlich sicher, dass sie mir mindestens ein Stück übrig gelassen hatten. Ich würde es heute Abend zum Tee essen, bevor ich zu Bett ging …
Ein unangenehmer magischer Funke entzündete sich in meinen Gedanken. Ein Vampir. Na toll!
Der Funke »sirrte« in meinem Gehirn wie ein verärgerter Moskito und kam näher. Der für Vampirismus verantwortliche Immortuus-Erreger löschte den Geist seiner Opfer aus und ließ eine leere Hülle zurück, die von einer alles aufzehrenden Mordlust gesteuert wurde. Sich selbst überlassen, würde ein Vampir so lange jagen und schlachten, bis nichts mehr zu töten übrig war, um dann zu verhungern. Dieser besondere Blutsauger konnte nicht frei herumtoben, denn sein leerer Verstand wurde von einem Nekromanten telepathisch gesteuert. Der Nekromant oder Navigator, wie sie genannt wurden, saß irgendwo weit entfernt in einem Raum und lenkte den Vampir mit seiner Willenskraft wie ein ferngesteuertes Auto. Der Navigator hörte, was der Vampir hörte, sah, was der Vampir sah, und wenn der Vampir den Mund öffnete, kamen die Worte des Navigators heraus.
So weit im Süden einen Blutsauger anzutreffen bedeutete, dass er zum Volk gehörte, einer merkwürdigen Mischform aus Konzern und Forschungsinstitut, deren Personal sich der Erforschung der Untoten widmete und nebenbei Geld verdiente. Das Volk mied mich wie die Pest. Vor zwei Monaten hatten sie herausgefunden, dass der Mann hinter ihrer Organisation, der nahezu unsterbliche Hexenmeister mit gottähnlicher Macht und sagenumwobener Magie, zufällig mein Vater war. Diese Entwicklung hatte einige Probleme mit sich gebracht. Also hatte es der Vampir nicht auf mich abgesehen.
Aber ich kannte die meisten Patrouillenrouten des Volkes, und dieser Untote war ganz eindeutig vom Kurs abgekommen. Wo wollte er nur hin?
Nein. Das war nicht mein Zirkus, das waren nicht meine untoten Affen.
Ich spürte, dass der Vampir eine Neunzig-Grad-Drehung machte und nun direkt auf mich zukam.
Nach Hause, Dusche, Apfelkuchen. Wenn ich es wie ein Mantra aufsagte, würde es vielleicht wirken.
Die Entfernung zwischen uns wurde geringer. Nach Hause, Dusche …
Ein Untoter sprang vom Dach des nächstgelegenen zweistöckigen Hauses und landete neben mir auf der Straße. Er war ausgemergelt, jeder einzelne dürftige Muskel war unter der dicken Haut zu sehen, als hätte jemand ein menschliches Anatomiemodell aus Stahldraht gefertigt und eine papierdünne Schicht Gummi darüber gegossen.
Verdammt.
Der Untote klappte den Mund auf, und Ghasteks Stimme kam heraus. »Du bist nicht leicht zu finden, Kate.«
Sieh an, sieh an. Der neue Chef der Ortsgruppe von Atlanta suchte mich persönlich auf. Ich hätte einen Knicks gemacht, wäre ich nicht zu müde gewesen, von meiner Eselin abzusteigen, und wäre mir das Schwert auf dem Rücken nicht in die Quere gekommen. »Ich wohne am Stadtrand und komme fast jeden Abend nach Hause. Meine Geschäftsnummer steht im Telefonbuch.«
Der Vampir neigte den Kopf und imitierte Ghasteks Bewegungen. »Reitest du immer noch dieses Ungeheuer?«
»Darfst ihn gern zertrampeln«, sagte ich zu Knuddel. »Meine Rückendeckung hast du.«
Knuddel ignorierte mich und den Vampir und trappelte trotzig an ihm vorbei. Der Blutsauger drehte sich elegant um und lief im Gleichschritt neben mir her. »Wo ist deine … bessere Hälfte?«
»In der Nähe.« Er war nie zu weit weg. »Warum? Machst du dir Sorgen wegen unseres romantischen Rendezvous?«
Der Vampir erstarrte. »Was?«
»Du triffst dich mit mir heimlich auf einer einsamen Straße mitten in der Nacht …«
Ghasteks Stimme war scharf. Wäre sie ein Messer gewesen, hätte sie mich zerfetzt. »Ich finde deine Versuche, humorvoll zu sein, höchst peinlich.«
Hä-hä.
»Ich versichere dir, es ist rein dienstlich.«
»Na klar, du süßer Po.«
Der Vampir machte große Augen. In einem gepanzerten Raum irgendwo in den Tiefen des Casinos bekam Ghastek vor Entrüstung vermutlich einen Herzanfall.
»Was treibst du hier draußen in meiner Gegend?«
»Eigentlich gehört die ganze Stadt zu deiner Gegend«, sagte Ghastek.
»Stimmt.«
Vor zwei Monaten hatte mein Vater beschlossen, Atlanta auf dramatische Weise als sein eigenes Territorium zu beanspruchen. Ich versuchte ihn auf ebenso dramatische Art zu stoppen. Er wusste, was er tat, ich nicht, und schließlich erhob ich versehentlich an seiner Stelle Anspruch auf die Stadt. Mir war immer noch nicht ganz klar, was es mit dieser Inanspruchnahme auf sich hatte, aber es bedeutete wohl, dass ich die Schutzherrschaft über die Stadt übernommen hatte und nun für die Sicherheit von Atlanta zuständig war. Theoretisch hätte mich die Magie der Stadt ernähren und mir meine Arbeit erleichtern sollen, aber ich hatte keine Ahnung, wie genau das funktionierte. Bisher kam ich mir kein bisschen anders vor.
»Dennoch bist du befördert worden, wie ich gehört habe. Hast du keine Lakaien, die deinen Befehlen Folge leisten?«
Der Vampir verzerrte das Gesicht zu einem heimtückischen Grinsen. Ghastek hatte wohl eine Grimasse gezogen.
»Ich dachte, du würdest dich freuen«, sagte ich. »Du wolltest doch der Boss sein.«
»Ja, aber jetzt muss ich mit dir verhandeln. Er hat es mir persönlich aufgetragen.«
Er sagte »er« mit einer solchen Ehrfurcht, dass nur Roland, mein Vater, gemeint sein konnte.
»Er glaubt, du könntest aufgrund unserer gemeinsamen Erlebnisse zögern, mich umzubringen«, sagte Ghastek weiter. »Was mich eindeutig dazu qualifiziert, das Volk in deinem Territorium anzuführen.«
Wenn ich mir anmerken ließ, wie erschrocken ich war, ein Territorium zu haben, würde das meine Glaubwürdigkeit als Schutzherrin der Stadt trüben.
»Ich soll mit dir zusammenarbeiten. Deshalb informiere ich dich, dass unsere Patrouillen eine große Gruppe von Ghulen gesichtet haben, die sich auf die Stadt zubewegt.«
Ghule waren keine gute Nachricht. Sie folgten dem gleichen Grundmuster von Infektion, Inkubationszeit und Transformation wie Vampire und Gestaltwandler, doch bisher hatte noch niemand herausgefunden, was sie eigentlich zu Ghulen machte. Sie waren klug, übernatürlich schnell und brutal, und sie ernährten sich von menschlichem Aas. Im Gegensatz zu Vampiren, denen sie ein Stück weit ähnelten, behielten Ghule einen Teil ihrer früheren Persönlichkeit und ihres logischen Denkvermögens, und sie kamen schnell darauf, dass sie am ehesten an menschliches Aas gelangten, wenn sie ein paar Leute schlachteten und die Leichen so lange verwesen ließen, bis sie gefressen werden konnten. Sie reisten in Rudeln von drei bis fünf Mitgliedern umher und griffen abgelegene kleine Siedlungen an.
»Wie groß ist die Gruppe?«
»Mehr als dreißig«, sagte Ghastek.
Das war keine Gruppe. Das war eine verdammte Horde. Ich hatte noch nie von einem so großen Ghulrudel gehört.
»Auf welchem Weg kommen sie?«
»Über den alten Lawrenceville Highway. Du hast ungefähr eine halbe Stunde, bis sie in Northlake eintreffen. Viel Glück!«
Der Vampir zog sich in die Nacht zurück.
Vor ein paar Jahrzehnten wäre Northlake nur ein paar Minuten entfernt gewesen. Jetzt lag zwischen mir und jenem Stadtteil ein Labyrinth aus Ruinen. Unsere Welt hat durch die Magiephasen viel erlitten. Es begann vor ein paar Jahrzehnten ohne Vorwarnung mit einer durch Magie ausgelösten Apokalypse, der sogenannten Wende. Wenn die Magie unsere Welt überflutete, machte sie vor nichts Halt. Sie erstickte die Elektrizität, ließ Flugzeuge vom Himmel fallen und brachte Hochhäuser zum Einsturz. Sie beschädigte den Asphalt auf den Straßen und gebar Monstren. Dann verschwand die Magie plötzlich, und all unsere Geräte und Schusswaffen funktionierten wieder.
Die Stadt war in der Nachwendezeit geschrumpft, nachdem die erste Magiewoge katastrophale Zerstörungen hinterlassen hatte. Die Menschen hatten sich massenhaft in Sicherheit gebracht, und die meisten Vororte entlang des alten Lawrenceville Highway waren inzwischen verwaist. Es gab einige isolierte Gemeinden in Tucker, aber wer sich dort niederließ, wusste, was er von der magieverseuchten Wildnis zu erwarten hatte, und ein Ghulrudel würde dort auf viel Widerstand stoßen. Wozu die Mühe, wenn Northlake nicht mal fünf Meilen weiter auf der Straße den Außenrand der Stadt markierte? Es war eine dicht bevölkerte Gegend voller Vorstadthäuser, die von ein paar Wachtürmen an einem drei Meter hohen Zaun mit Stacheldraht abgegrenzt wurde. Die Wachen konnten es mit ein paar Ghulen aufnehmen, aber wenn dreißig von ihnen schnell hereinbrachen, würden sie überrannt werden. Die Ghule würden in wenigen Sekunden über den Zaun klettern, die Turmwächter niedermetzeln und dann in der Siedlung ein Blutbad anrichten.
Von den Behörden würde es keine Unterstützung geben. Bis ich ein funktionierendes Telefon gefunden und die Paranormal Activity Division davon überzeugt hätte, dass sich ein sechsmal größeres Ghulrudel als üblich auf Atlanta zubewegte, wäre Northlake längst zu einem Flatrate-Buffet für Ghule geworden.
Über mir sauste eine riesige dunkle Gestalt an den Dächern entlang und übersprang den Zwischenraum zweier Häuser. Im Licht der Sterne leuchtete sie eine Schrecksekunde lang auf: ein muskulöser Oberkörper, vier kräftige Beine und eine dunkelgraue Mähne. Mir standen die Rückenhaare zu Berge. Es war, als hätte die Nacht ihren Rachen geöffnet und ein prähistorisches Wesen ausgespuckt, das aus menschlicher Angst geboren worden war, während hungriges Tierknurren im Dunkeln widerhallte. Ich sah es nur ganz kurz, aber das Bild prägte sich meinen Gedanken wie in Stein gemeißelt ein. Mein Körper erkannte es sofort als Raubtier, während ich die Beute war. Ich kannte es nun schon seit drei Jahren und reagierte jedes Mal instinktiv darauf.
Die Bestie landete, wandte sich nach Norden und verschwand in der Nacht in Richtung Northlake.
Statt so schnell wie möglich wegzulaufen, wie es jeder mit gesundem Menschenverstand getan hätte, trieb ich Knuddel an, bis sie in einen Galopp verfiel. Es gehört sich nicht, den Verlobten allein gegen eine Horde Ghule kämpfen zu lassen. So etwas kam einfach nicht infrage.
*
Die leere Fläche des Lawrenceville Highway breitete sich vor mir aus. Die Straße schnitt hier durch einen flachen Hügel, und steinerne Mauern hielten zu beiden Seiten den Abhang zurück. Ich parkte am Fuß des Hügels, wo er in ein weites, völlig flaches Feld überging. Die Stelle eignete sich so gut wie jede andere, um Widerstand zu leisten.
Ich reckte den Hals langsam in die eine, dann in die andere Richtung. Ich hatte Knuddel eine halbe Meile zurück an einen Baum gebunden. Normalerweise wären Ghule nicht an ihr interessiert, aber sie roch wie ich, und einer von ihnen könnte aus purer Boshaftigkeit versuchen, ihr den Hals aufzureißen.
Der Mond rollte aus den Wolken und beleuchtete die Felder. Der Nachthimmel wirkte unglaublich hoch, die Sterne sahen in der eisigen Tiefe wie Diamanten aus. Eine kalte Brise kam, zerrte an meinen Kleidern und meinem Zopf. Es war Anfang März, der Frühling begann plötzlich und warm, nur in der Nacht zeigte der Winter immer noch seine Klauen.
Als ich mich das letzte Mal so weit von der Stadt entfernt hatte, war ich noch die Gemahlin des Rudels gewesen, der größten Gestaltwandlerorganisation im Süden. Das hatte ich nun hinter mir. Dreißig Ghulen wäre ohne Unterstützung schwer beizukommen. Zum Glück hatte ich die beste Unterstützung der Stadt.
Als ich Anspruch auf Atlanta erhoben hatte, wurde dadurch eine Grenze errichtet. Ich spürte sie nun fünfzehn Meter vor mir, diese unsichtbare Grenzlinie. Ich hätte sie mir längst mal ansehen sollen, aber ich war zu sehr damit beschäftigt gewesen, mich vom Rudel zu trennen, das neue Haus einzurichten und mir den Arsch abzuarbeiten, denn unsere Ersparnisse würden bald aufgebraucht sein. Aber ich tat mir keinen Gefallen, wenn ich vorgab, die Inanspruchnahme hätte nicht stattgefunden.
In der Ferne bewegte sich etwas. Ich konzentrierte mich darauf. Es bewegte sich weiter, der Horizont kräuselte sich leicht. Wenige Atemzüge später schälten sich aus dem Kräuseln einzelne Umrisse heraus, die in einer merkwürdigen, galoppähnlichen Gangart rannten und sich wie Gorillas auf die Arme stützten, jedoch nie nur auf vier Beinen gingen.
Das waren wirklich viele Ghule!
Showtime! Ich griff nach dem Schwert auf meinem Rücken und zog Sarrat aus der Scheide. Die matte, fast weiße Klinge leuchtete im fahlen Mondschein. Die einschneidige scharfe Waffe war eine Mischung aus einem glatten Schwert und einem traditionellen Säbel mit leichter Krümmung, was ideal zum Schlitzen und Stechen war. Sarrat war schnell, leicht und flexibel und sollte in Kürze gebührend zum Einsatz kommen.
Die verzerrten Gestalten kamen näher. Von dreißig Ghulen zu wissen war eine Sache. Sie herangaloppieren zu sehen war etwas ganz anderes. Instinktiv bekam ich es mit der Angst, was meine Sinne schärfte und mich die Welt in ruhiger Achtsamkeit wahrnehmen ließ.
Als Antwort stiegen von Sarrats Oberfläche dünne Dampffähnchen auf. Ich drehte den Säbel, um mein Handgelenk aufzuwärmen.
Die Ghulhorde kam näher. Warum musste ich mich wieder in so eine Lage bringen?
Ich ging mit gezücktem Schwert in der Hand, die Spitze nach unten, auf sie zu. Ich hatte nur wenige soziale Kompetenzen im Repertoire, aber im Einschüchtern war ich gut.
Die Ghule sahen mich. Die vorderen Reihen wurden langsamer, während die hinteren immer noch in vollem Tempo rannten. Die Masse der Ghule verdichtete sich wie eine Welle, die gegen einen Felsen schlug, und kam mit kreischenden Bremsen kurz vor der Grenze zum Stehen. Wir hielten an, sie auf der einen Seite der magischen Trennwand, ich auf der anderen.
Sie waren schlank und muskulös mit unverhältnismäßig kräftigen Armen und langen, spatenförmigen Händen, und jeder Finger war mit einer kurzen, geschwungenen Kralle bestückt. Wie kleine knorrige Hörner traten Knochen an vielen Stellen auf dem Rücken und an den Schultern hervor. Die Hörner waren ein Schutzmechanismus. Wenn jemand versuchen sollte, einen Ghul aus seinem Erdloch zu zerren, würden sich die Hörner im Dreck verkeilen. Ein mit übermenschlichen Kräften ausgestatteter Werwolf müsste sich ganz schön anstrengen, um einen Ghul aus dem Boden zu holen. Ich hatte zehn Zentimeter lange Hörner gesehen, aber bei dieser Gruppe ragten die meisten kaum mehr als einen Zentimeter hervor. Die Haut war an Brust, Hals und Gesicht dunkelgrau. Die Art von Grau, wie sie für urbane Militärtarnanzüge typisch war. Der Rücken und die Schultern waren mit kleinen schlammbraunen Klecksen besprenkelt. Wäre nicht das wässrig gelbe Glühen ihrer Iris gewesen, hätten sie sich kaum von der Straße abgehoben.
Keiner von ihnen wirkte lahm, verhungert oder schwach. Die Chancen standen nicht gut für mich. Ich musste mir eine Strategie überlegen, und zwar schnell.
Die Ghule beäugten mich mit merkwürdig schrägen Augen, bei denen der innere Winkel viel tiefer lag als der äußere.
Ich wartete ab. Sobald man zu reden anfing, wirkte man weniger furchterregend, und ich hatte nicht vor, einen ungefährlichen Eindruck zu machen. Die Ghule hatten ein eigenes Bewusstsein, was bedeutete, dass sie Angst spüren konnten, und ich brauchte jeden möglichen Vorteil, den ich mir verschaffen konnte.
Ein riesiger Ghul schob sich an die Spitze des Rudels. Mit dem wohlgenährten, kräftigen Körper hockte er sich vor mich hin. Aufrecht stehend würde er über zwei Meter messen. Mit mindestens zweihundert Pfund bestand er nur aus harten Muskeln und scharfen Krallen. Die braune Musterung war am Rücken kaum vorhanden. Stattdessen zierten Streifen aus hellerem und dunklerem Grau seine Flanken.
Der Ghul beugte sich vor. Mit dem Gesicht berührte er die Grenze, zuckte zurück und starrte mich an. Er war sich nicht sicher, was er spürte, aber ihm war klar, dass die Grenze und ich irgendwie miteinander verbunden waren.
Manche Ghule waren Aasfresser. Sie waren harmlos und bekamen deswegen manchmal sogar einen Job. Wir lebten in einer unsicheren Welt. Viel zu oft konnten Leichen nicht geborgen werden, weil sie unter Trümmern lagen oder der Tatort für die Angehörigen zu entsetzlich war, um die Überreste zu identifizieren. Wenn man Leichen in ein Massengrab legte, war eine Katastrophe vorprogrammiert. Der menschliche Körper strahlte auch nach dem Tod noch Magie aus, und es war nicht auszudenken, was die nächste Woge der Magie in einem Massengrab anstellen könnte. Meistens wurden die Überreste kremiert, doch gelegentlich zogen die Behörden Ghule hinzu, um den Tatort zu reinigen, weil es billiger und schneller war.
Ich würde meinen Arm darauf verwetten, dass diese Ghule keine offiziellen Aasbeseitigungsarbeiter waren, aber ich musste auf Nummer sicher gehen.
Der Ghul starrte mich an. Ich lächelte wie eine Irre.
Der Ghul blinzelte mit seinen gelblichen Augen, spannte sich wie ein Hund vor dem Angriff an und öffnete das Maul, um die Lippen langsam zu einem aufgesetzten Grinsen zu verziehen. Genau, zeig mir deine großen Zähne, mein Hübscher.
Sein Vorderkiefer war mit einer Reihe dicker, scharfer Zähne geschmückt. Nach hinten wurden die Zähne dünner, sahen mehr wie Klingen mit gezackten Kanten aus. Ich habe verstanden.
Der Ghul klappte den Kiefer auf. Eine raue Reibeisenstimme ertönte. »Wer bist du?«
»Kehrt jetzt um, dann bleibt ihr am Leben.«
Er klappte das Maul wieder zu. Das war offensichtlich nicht die Antwort, die er erwartet hatte. Kate Daniels, Meisterin der Überraschungen. Keine Sorge, das war erst der Anfang.
»Wir sind ein offizielles Reinigungsteam«, sagte der Anführer der Ghule.
»Nein.«
Eine halbe Meile hinter den Ghulen bewegte sich ein dunkler Schatten so still durchs Feld, dass ich schon einen Moment lang dachte, ich würde es mir nur einbilden. Mein Verstand weigerte sich anzuerkennen, dass ein so riesiges Wesen so ruhig sein konnte. Hallo, Liebling.
Die Ghule bemerkten ihn nicht. Sie waren auf menschliches Fleisch konditioniert, und ich stand direkt vor ihnen und lieferte ein sehr bequemes Angriffsziel.
Der Anführer der Ghule drehte sich um und zeigte auf eine Tätowierung an seiner linken Schulter.
Columbia, SC
014
Ort und Nummer seiner Lizenz. Er hielt mich wohl für dumm.
»Wir sind eine friedliche Gruppe«, fuhr der Ghul fort.
»Klar. Ihr lauft nur in die Stadt, um euch eine Tasse Zucker zu borgen und Leute in eure Kirche einzuladen.«
»Du störst eine offizielle Mission der Stadt. Das ist diskriminierend.«
Der dunkle Schatten tauchte auf der Straße auf und kam auf uns zu. Ich musste etwas Zeit für ihn gewinnen, bis er nahe genug war, um angreifen zu können.
Ich sah den Ghul an. »Weißt du, was das Besondere an Ghulen ist? Ihr seid unglaublich anpassungsfähig. Euer Körper passt sich schneller an die Umgebung an als neunundneunzig Prozent von allem, was ich in der Natur gesehen habe.«
Mein Lieblingsmonster kroch auf riesigen Tatzen näher heran.
Ich hob meinen Säbel und legte die matte Klinge auf meiner Schulter ab. Schwache Dampffähnchen stiegen von Sarrats Oberfläche auf. Das Schwert spürte, dass es Ärger geben würde, und konnte es kaum erwarten.
»Ich sage dir mal, was ich sehe. Deine Farbe hat sich von Braun zu Grau gewandelt, weil du dich nicht mehr an den Dreck anpassen musst. Deine Streifen zeigen mir, dass du viel im Wald unterwegs bist. Deine Hörner sind kurz, weil du dich nicht mehr in Erdlöchern versteckst.«
Die Ghule kamen näher. Ihre Augen leuchteten heller. Ihnen gefiel nicht, wie sich die Sache entwickelte.
»Deine Krallen sind nicht lang und gerade, damit du gut graben kannst. Sie sind gebogen und scharf, um Fleisch zu zerreißen.«
Die Ghule fletschten die Zähne. Sie standen kurz davor, brutal zu werden. Ich musste weiterreden.
»Auch deine hübschen Zähne haben sich verändert. Sie sind nicht mehr schmal und gezackt. Sie sind dick, stark und scharf. Die Art von Zähnen, die man braucht, um sich wehrende Beute im Maul zu behalten. Und dein schickes Tattoo ist seit zwei Jahren abgelaufen. Bei allen Ghul-Lizenzen in Columbia ist inzwischen unter der Lizenznummer das Jahr eintätowiert.«
Die Ghule waren verstummt, ihre Augen wie Dutzende kleiner Monde auf mich gerichtet. Nur noch ein paar Sekunden …
»Töte sie«, warf ein anderer Ghul ein. »Wir haben es eilig.«
»Töte sie. Er wartet«, klinkte sich eine dritte Stimme ein.
»Töte sie. Töte sie.«
Sie wirkten schrecklich verzweifelt. Hier war etwas Merkwürdiges im Gange.
»Wer wartet?«, fragte ich.
»Halt’s Maul!«, knurrte der Anführer der Ghule.
Ich beugte mich vor und sah den Anführer streng an. »Du bist dick. Ihr wart auf Raubzug außerhalb der Stadt und seid fett geworden, weil ihr euch mit den Menschen vollgestopft habt, die ihr ermordet habt. Ich habe euch die Gelegenheit gegeben zu verschwinden. Jetzt ist es zu spät. Macht euch diesen Moment bewusst. Blickt zu den Sternen. Atmet die kalte Luft ein. Dies ist eure letzte Nacht. Dies sind eure letzten Atemzüge. Ich werde jeden Einzelnen von euch umbringen.«
Der Anführer der Ghule knurrte und legte die Maske ab. »Du und welche Armee?«
Ich zog die Magie zu mir. Es würde wehtun. Es tat immer weh. »Das Tolle an Werlöwen ist, dass man keine Armee braucht. Man braucht nur einen.«
Der Ghul verzerrte das Gesicht. »Du bist kein Werlöwe, du Fleisch.«
»Ich nicht.« Ich deutete mit einem Nicken hinter die Gruppe. »Er schon.«
Der Anführer der Ghule fuhr herum.
Aus der Dunkelheit starrten ihn zwei goldene Augen an. Die riesige löwenähnliche Bestie öffnete das Maul und brüllte. Bis ich ihm begegnet war, hatte ich nie einen echten Löwen brüllen gehört. Es klang wie Donnern. Ein betäubendes, unbändiges, herzzerreißendes Donnern, das tief im Gehirn die lebenswichtige Verbindung zwischen der Logik und der Kontrolle über den eigenen Körper durchtrennte. Es war ein so mächtiger Schallausstoß, dass ich schon Hunderte von Gestaltwandlern erlebt hatte, die dabei zusammengezuckt waren. Das Heulen eines Wolfes mitten in der Nacht ließ einem die Haare zu Berge stehen, aber das Gebrüll eines Löwen drang durch alles Antrainierte und die Vernunft hindurch an den geheimen Ort tief im Innersten, der einen anschrie, sofort zu erstarren.
Die Ghule blieben regungslos stehen.
Ich öffnete den Mund und spuckte ein Machtwort aus: »Osanda.« Auf die Knie!
Machtworte stammten aus einem längst vergessenen Zeitalter, das so weit entfernt war, dass sich damit pure Magie beschwören ließ. Nur wenige Personen kannten sie, und noch viel weniger konnten sie anwenden, denn um ein Zauberwort zu erlernen, musste man es beherrschen. Man machte es sich entweder untertan, oder es brachte einen um. Ich kannte eine Handvoll Machtwörter, viel mehr als alle anderen, denen ich begegnet war, aber der Preis war hoch, auch nur eins davon zu benutzen. Für meinen Vater waren Machtwörter eine Sprache, die er fließend und ohne Nebenwirkungen beherrschte. Sie taten ihm nicht weh, aber ich zahlte jedes Mal einen Preis.
Die Magie schoss aus mir heraus. Ich verspannte mich vor dem zu erwartenden Schmerz. Der Rückstoß traf mich, fraß sich durch mein Inneres, aber diesmal offenbar mit stumpfen Zähnen, denn es schmerzte nicht annähernd so heftig wie in meiner Erinnerung.
Die Magie krachte gegen die versteinerten Ghule. Ihre Knie und Ellbogen knirschten im Gleichklang, und sie stürzten auf den Asphalt. Damit würde ich mindestens zehn Sekunden gewinnen. Wäre die Magiewoge stärker gewesen, hätte ich ihnen die Knochen gebrochen.
Ich schwang mein Schwert. Sarrat traf den knochigen Hals eines Ghuls, glitt mühelos durch Knorpel und dicke Haut. Bevor der tote Körper zu Boden sackte, bohrte ich meine Klinge einem zweiten Ghul in die Brust und spürte, wie Sarrats Spitze durch das feste Herz stach.
Der Körper des Löwen bebte und richtete sich auf. Knochen schoben sich nach oben. Mächtige Muskeln legten sich wie Spiralen um das neue Skelett. Einen Wimpernschlag später preschte ein neues Monster vor, eine albtraumhafte Mischung aus Mensch und Löwe, zwei Meter dreißig groß mit stahlharten Muskeln unter grauem Pelz und schrecklichen, gebogenen Krallen. Ein Ghul sprang ihn an. Er packte das Wesen an der Gurgel, wrang es wie ein nasses Handtuch aus. Ein ekelhaftes Knacken hallte durch die Nacht, und der Ghul erschlaffte.
Ich schnitt den dritten Ghul in zwei Stücke und schlitzte dem vierten die Kehle auf.
Die Ghule wachten auf. Sie umschwärmten uns. Die Löwenbestie schwang ihre Krallen und weidete einen Ghul mit einem präzisen Prankenhieb aus. Die Innereien regneten auf den Boden. Der üble und bittere Geruch von Ghulblut und der unverwechselbare saure Gestank einer Darmwunde versengten meine Nasenlöcher.
Krallen rissen durch meine Kleidung, zogen qualvolle, glühend heiße Linien quer über meinen Rücken. Ihrwollt spielen? Schön. Ich benötigte ohnehin eine Trainingseinheit.
Mein Säbel wurde zu einer rasiermesserscharfen Wand. Er schnitzte, schnitt und stach zu, zerriss Fleisch und zischte, als das Ghulblut, das ihn benetzte, von seiner Magie kochte. Ich bewegte mich schnell, wich Krallen aus und blockte Zähne ab. Noch eine feurige Scharte klaffte in meinem Rücken. Ein Ghul klammerte sich an meinen Stiefel, ich befreite mein Bein und trat seinen Schädel ins Straßenpflaster. Willkommene Wärme durchflutete mich, machte meine Muskeln biegsam und geschmeidig. Die Welt wurde kristallklar. Die Zeit dehnte sich und unterstützte mich. Die Ghule stürzten sich auf mich, aber ich war schneller. Sie beharkten mich mit ihren Krallen, aber meine Klinge fand sie schneller. Ich kostete jede Sekunde des Kampfes aus, jeden Tropfen Blut, der an mir vorbeiflog, jeden Moment des Widerstands, wenn Sarrat meinen Gegner mit ihrer Klinge erwischte.
Dafür war ich aufgezogen und ausgebildet worden. Ich war auf Gedeih und Verderb eine Killerin. Das war meine Berufung, und dafür wollte ich mich nicht entschuldigen.
Ein Ghul ragte vor mir auf. Ich metzelte ihn mit einem klassischen Überhandstoß nieder. Er stürzte. Niemand nahm seinen Platz ein. Ich drehte mich, für einen Kampf bereit, auf den Zehenspitzen. Links von mir warf der Werlöwe einen gebrochenen Körper auf den Boden und wandte sich mir zu. Ein einzelner Ghul lag zwischen uns gefangen am Boden.
»Er lebt«, fauchte der Werlöwe.
Ich bin dir weit voraus. Lass uns herausfinden, wer der mysteriöse »Er« ist. Ich ging mit dem Schwert in der Hand auf den Ghul zu.
Er zitterte, sah nach rechts, dann nach links, blickte zu dem Werlöwen, dann zu mir. Ganz recht, du sitzt in der Falle, und es gibt keinen Ausweg. Sollte er weglaufen, würden wir ihn zur Strecke bringen.
Der Ghul wich zurück, legte die Krallenhände an den eigenen Hals und schlitzte ihn auf. Er röchelte und brach zusammen. Das Licht in seinen Augen erlosch.
Was für ein Teufelskerl!
Das Löwenmonster öffnete das Maul, und eine menschliche Stimme sagte in perfekter Aussprache: »Hallo, Baby.«
»Hallo, Schatz.« Ich zog ein Stück Stoff aus meiner Tasche und wischte damit vorsichtig Sarrats Klinge ab.
Curran trat zu mir herüber, legte mir den Arm um die Schultern und zog mich an sich. Ich lehnte mich gegen ihn, spürte die harten Oberkörpermuskeln an meiner Seite. Wir blickten über die Straße, die mit zerbrochenen Körpern übersät war.
Das Adrenalin ebbte langsam ab. Die Farben wurden weniger lebhaft. Die Schnitte und klaffenden Wunden machten sich allmählich bemerkbar: Mein Rücken brannte, meine linke Hüfte schmerzte ebenso wie meine linke Schulter. Wahrscheinlich würde ich morgen mit einem spektakulären Bluterguss aufwachen.
Wir hatten wieder einmal überlebt. Wir würden nach Hause gehen und unser Leben fortsetzen.
»Was zum Teufel hatte das zu bedeuten?«, wollte Curran von mir wissen.
»Keine Ahnung. Normalerweise bilden sie keine größeren Rudel. Das größte Rudel von Plünderern, das je gesichtet wurde, bestand aus sieben Ghulen, und das wurde als Einzelfall betrachtet. Sie sind territoriale Einzelgänger. Sie verbinden sich nur zu Gruppen, um sich zu schützen, aber offensichtlich hatte sie jemand erwartet. Glaubst du, Ghastek hat etwas damit zu tun?«
Curran zog eine Grimasse. »Das sieht ihm nicht ähnlich. Ghastek rührt sich nur, wenn es ihm etwas nützt. Wenn wir Ghule umbringen, hat er nichts davon. Er weiß, wozu wir imstande sind. Ihm wäre klar gewesen, dass wir sie niedermetzeln werden.«
Curran hatte recht. Ghastek musste wissen, dass wir die Ghule niedermachen würden. Er hätte uns auch nicht dazu benutzt, ihm die schmutzige Arbeit abzunehmen. Trotz all seiner Fehler war er ein erstklassiger Navigator, ein Herr der Toten, und er liebte seine Arbeit. Hätte er die Ghule töten wollen, hätte er diese Gruppe mit ein paar Vampiren massakriert, oder er hätte diese Gelegenheit als Übung für seine Gesellen genutzt.
»Das alles ergibt keinen Sinn«, sagte ich, während ich die Spuren meines Blutes zu mir zog. Es glitt und rollte in winzigen Tröpfchen, bildete auf dem Straßenpflaster eine kleine Pfütze. Ich schob es zur Seite, verfestigte es und stampfte darauf. Es zerbröselte unter meinem Fuß zu inaktivem Pulver. Blut bewahrte seine Magie auch vom Körper getrennt. Solange ich mich erinnern konnte, musste ich auf mein Blut aufpassen, denn sobald jemand es untersuchte, würde es wie ein Pfeil auf meinen Vater weisen. Es gab eine Zeit, als ich jede Spur von meinem Blut verbrennen musste, aber jetzt gehorchte es mir. Ich war mir nicht sicher, ob es mich zu einer besseren Kämpferin oder zu einem noch abscheulicheren Wesen machte. »Sie wirkten verzweifelt, getrieben, als hätten sie ein ganz bestimmtes Ziel.«
»Wir werden es herausfinden«, sagte Curran. »Es ist fast Mitternacht. Ich schlage vor, wir gehen nach Hause, machen uns sauber und steigen ins Bett.«
»Klingt nach einem guten Plan.«
»He, ist noch was von dem Apfelkuchen übrig?«, fragte Curran.
»Ich glaube schon.«
»Gut, dann lass uns nach Hause gehen, Baby.«
Unser Zuhause. Es war immer noch völlig ungewohnt, obwohl wir schon seit Monaten zusammen waren. Er war für mich da, wartete auf mich. Was immer mich angreifen wollte, brachte er um. Wenn ich Hilfe brauchte, würde er mir helfen. Er liebte mich, und ich liebte ihn. Ich war nicht mehr allein.
Auf dem Weg zu meiner Eselin sagte er plötzlich: »Süßer Po?«
»Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ghastek ist so steif, als hätte er einen Besenstiel im Arsch. Hast du den Gesichtsausdruck des Vampirs gesehen? Er sah aus, als hätte er Verstopfung.«
Curran lachte. Wir fanden Knuddel und gingen nach Hause.
KAPITEL 2
Unser Haus lag an einer kurzen Straße in einer der neueren Trabantenstädte. In einem früheren Leben gehörte dieser Teil zu den Victoria Estates, einer Wohngegend der oberen Mittelschicht, einem ruhigen Ort mit engen Straßen und alten, hochgewachsenen Bäumen. Man lebte so nah wie möglich am Wald, aber dennoch in der Vorstadt. Dann kam die Magie, und die Bäume vom Hahn Forest bis in den Süden und zum W. D. Thomson Park rebellierten. Die Bäume wurden von derselben merkwürdigen Magie gespeist, die an Wolkenkratzern nagte und sie zu kleinen Klümpchen zerbröckeln ließ. Nun wuchsen sie unnatürlich schnell, drangen in benachbarte Gebiete ein und schluckten sie. Victoria Estates fiel den Übergriffen des Waldes ohne Gegenwehr zum Opfer. Die meisten Leute zogen weg.
Vor etwa vier Jahren beschloss ein geschäftstüchtiger Bauunternehmer, das Gebiet zurückzuerobern, schlug eine Lichtung mit den Umrissen einer Kidneybohne in den Wald und baute Nach-Wende-Häuser mit dicken Mauern, vergitterten Fenstern, stabilen Türen und großzügigen Innenhöfen. Unsere Straße lag an der Innenseite der Bohne in Waldesnähe, während zwei weitere Straßen in weiten Bögen nach Norden und nach Westen hinausführten. Unsere Straße war kurz mit nur sieben Häusern an der Gegenseite und fünf an unserer, wobei unser Haus in der Mitte lag.
Als wir in unsere Straße einbogen, reckte ich mich, um das Haus zu sehen. Das große dreistöckige Gebäude stand auf über zwei Hektar Land, war eingezäunt, mit Stall und Weide auf der Rückseite. Ich liebte jeden Stein und jedes Brett dieses Hauses. Es gehörte Curran und mir. Es war das Zuhause unserer Familie. Früher hatte ich in einer Wohnung gelebt. Ich hatte in einigen üblen Löchern gehaust. Ich hatte sogar in einer Festung gewohnt, aber hier fühlte ich mich nach langer Zeit zum ersten Mal wirklich zu Hause. Jedes Mal, wenn ich ausging, hatte ich Angst, es könnte nicht mehr dastehen, eingestürzt oder niedergebrannt sein, wenn ich zurückkam. Immer wenn ich mir etwas Schönes aufgebaut hatte, ließ es mir das Schicksal gerade so lange, bis ich daran hing, um es dann wieder zu zerstören.
Ich konnte unser Haus noch nicht sehen – eine Kurve war uns im Weg. Ich widerstand der Versuchung, Knuddel anzutreiben. Sie hatte eine sehr anstrengende Nacht hinter sich.
Curran beugte sich zu mir herüber und legte seine pelzige Tatze auf meine Hand. »Nur noch einen Monat.«
Vor zwei Monaten, am 1. Januar, waren Curran und ich offiziell als Herr der Bestien und Gemahlin des Rudels zurückgetreten. Von einem Tag auf den anderen waren wir nicht mehr für eintausendfünfhundert Gestaltwandler verantwortlich. Eigentlich waren wir schon ein paar Tage früher zurückgetreten, aber das offizielle Datum war der Einfachheit halber der 1. Januar. Wir hatten neunzig Tage Zeit, um unsere Finanzen und geschäftlichen Beteiligungen formell vom Rudel zu trennen. Falls sich jemand dazu entschied, als Teil unseres Teams das Rudel zu verlassen, musste er es vor Ablauf dieser Frist tun.
Heute war der 1. März. Noch dreißig Tage, dann würden wir frei sein.
Formell gehörten wir immer noch dem Rudel an, unterstanden aber nicht mehr seiner Befehlshierarchie. Wir durften auch kein Amt im Rudel mehr übernehmen. Während dieser neunzig Tage durften wir nicht einmal die riesige Festung besuchen, die Curran während seiner Zeit als Herr der Bestien erbaut hatte und die dem Rudel als Zentrale diente, weil unsere Anwesenheit die Autorität des neuen Alphapaars untergraben könnte, das sich gerade erst zu etablieren versuchte. Wenn die Trennungsphase vorbei war, würde man uns nicht aus der Festung weisen, aber man ging davon aus, dass wir nie lange bleiben würden. Das war mir sehr recht.
Das schlechte Gewissen nagte an mir. Das Rudel war Currans Leben. Er hatte es geleitet, seit er es mit nur fünfzehn Jahren zusammengeschmiedet hatte, indem er einzelne kleine Rudel vereinigte. Jetzt war er dreiunddreißig. Was siebzehn Jahre lang sein Leben gewesen war, hatte er mir zuliebe aufgegeben.
Im vergangenen Dezember, bei meinem kleinen Streit um Atlanta mit meinem Vater, hatte derselbe mich vor die Wahl gestellt. Entweder gab ich meine Machtposition im Rudel auf, oder er würde die Stadt angreifen. Auf der einen Seite das Leben Zehntausender, auf der anderen mein Dasein als Gemahlin. Ich entschied mich zu gehen. Wir wären einem Kampf gegen Roland nicht gewachsen gewesen. Viele wären meinetwegen gestorben, und am Ende hätten wir doch verloren. Ich konnte diese Schuld nicht auf mich laden, deshalb verließ ich das Rudel, um Zeit zu gewinnen. Curran entschied sich für mich. Das Rudel war nicht glücklich mit seiner Entscheidung, aber das war ihm egal.
»Vermisst du sie?«, fragte ich ihn.
»Was, die Festung?«
Komisch, dass er sofort wusste, wonach ich fragte. »Ja. Der Herr der Bestien zu sein.«
»Eigentlich nicht«, sagte Curran. »Ich mag es so. Den Job erledigen und dann nach Hause gehen. Damit ist die Sache abgeschlossen. Ich kann zurückschauen und sagen, heute habe ich so viel erreicht. Es ist schön zu wissen, dass niemand an unsere Tür klopfen wird, um mich in irgendeinen dämlichen Mist zu verwickeln. Keine Komitees mehr, keine lächerlichen Rivalitäten mehr und keine Hochzeiten mehr.«
Der große Ahorn vor unserem Haus kam in Sicht. Er war ganz. Vielleicht hatte auch das Haus überlebt.
»Das Rudel vermisse ich nicht. Ich vermisse es, dafür zu sorgen, dass alles funktioniert«, sagte Curran.
»Wie meinst du das?«
»Es ist wie ein kompliziertes Räderwerk. Alle Clans und Alphas mit ihren Problemen. Ich habe gern zwischen ihnen vermittelt und dafür gesorgt, dass es besser funktioniert. Aber ich vermisse den Druck nicht.« Er grinste, drohte mit seinen furchterregenden Zähnen dem Mond. »Weißt du, was ich daran mag, nicht mehr der Herr der Bestien zu sein?«
»Du meinst, davon abgesehen, dass wir essen können, wann wir wollen, schlafen können, wann wir wollen, und in einer herrlichen Privatsphäre ungestört Sex haben können?«
»Ja, davon abgesehen. Ich mag, dass ich tun kann, wonach auch immer mir verdammt noch mal ist. Wenn ich rausgehen und ein paar Ghule töten will, tue ich es einfach. Ich muss nicht erst einen dreistündigen Rudelrat aussitzen und über die Vorteile debattieren, die das Töten von Ghulen bringt, oder über die Auswirkungen auf das Wohlergehen des Rudels im Allgemeinen und für jeden einzelnen Clan im Besonderen.«
Ich lachte leise. Im Rudel gab es sieben Clans, nach den einzelnen Bestien unterteilt, und jeder Clan hatte zwei Alphas. Der Umgang mit Alphas musste einer der Höllenkreise sein.
Curran zuckte mit den muskulösen Schultern. »Lach nur. Als ich fünfzehn war und Mahon mich dazu drängte, nach der Macht zu greifen, tat ich es, weil ich jung und dumm war. Ich dachte, es wäre wie eine Krone. Mir war nicht bewusst, dass es eigentlich eine Fußfessel war. Jetzt bin ich meine Fesseln losgeworden. Das gefällt mir.«
Ich tat, als würde ich zittern. So wie er »Das gefällt mir« gesagt hatte, musste ich mich nicht allzu sehr verstellen. »Von der Kette gelassen. Sehr gefährlich, Eure Majestät.«
Er starrte mich an.
»Du könntest zu furchterregend sein, um dich ins Haus zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich es riskieren darf, neben dir einzuschlafen, du Entfesselter. Wer weiß, was passieren könnte?«
»Wer hat was von Schlafen gesagt?«
Ich öffnete den Mund, um ihn zurechtzuweisen, und klappte ihn sofort wieder zu. Ich konnte das Haus zwar nicht sehen, aber einen Teil des vorderen Rasens, der von einem gelben elektrischen Licht beleuchtet wurde. Es war nach Mitternacht. Julie, mein Mündel, hätte längst im Bett sein sollen. Es gab keinen Grund, dass das Licht brannte.
Curran rannte los. Ich trieb Knuddel voran.
Knuddel stockte. Ihr war wohl nicht nach Laufen zumute.
»Vorwärts, Esel!«, knurrte ich.
Sie ging rückwärts.
Verdammt! Ich sprang ab und rannte zum Haus. Die Türklinke drehte sich in meiner Hand. Ich riss die Tür auf und stürzte hinein.
Unsere Küche war in sanftes elektrisches Licht getaucht. Curran stand an der Seite. Julie saß, in eine Decke gehüllt, am Tisch, das blonde Haar war zersaust. Sie sah mich und gähnte. Ich bremste ab, um nicht gegen den Küchentisch zu prallen und in die Küche zu stürzen. Eine einarmige Frau mit dunkler, lockiger Haarmähne saß Julie gegenüber, vor sich eine Tasse Kaffee. George. Mahons Tochter und die Justizangestellte des Rudels.
Sie wandte mir ihr verstörtes Gesicht zu: »Ich brauche Hilfe.«
*
Julie gähnte wieder. »Tschüss. Ich gehe schlafen.«
»Danke, dass du mit mir aufgeblieben bist«, sagte George.
»Keine Ursache.« Julie nahm ihre Decke und tapste die Treppe hoch.
Etwas schlug dumpf auf.
»Alles gut!«, rief sie. »Ich bin gefallen, aber alles ist gut.«
Sie polterte die Treppe hinauf, dann verkündete der Klang einer sich schließenden Tür, dass sie in ihrem Schlafzimmer war.
Ich zog einen Stuhl heran und setzte mich. Curran lehnte sich an die Wand. Er war immer noch in seiner Tiergestalt. Die meisten Gestaltwandler konnten nur einmal in vierundzwanzig Stunden die Gestalt wechseln. Sich innerhalb kurzer Zeit zweimal zu wandeln führte meistens dazu, dass sie ein paar Stunden bewusstlos waren und dann heißhungrig wieder aufwachten. Curran hatte eine höhere Kapazität als die meisten, aber es war eine lange Nacht gewesen, die Verwandlung würde ihn jetzt noch mehr ermüden. Wahrscheinlich wollte er für das Gespräch fit sein. Nachdem Currans Familie niedergemetzelt worden war, hatte Mahon ihn gefunden und bei sich aufgenommen. Curran war mit George aufgewachsen. Eigentlich hieß sie Georgetta – und drohte, einem den Arm abzureißen, wenn man sie so nennen würde – und war für ihn wie eine Schwester.
»Was ist passiert?«, fragte Curran.
George atmete tief ein. Ihr Gesicht war blass und straff, als wäre die Haut über den Schädel gespannt. »Eduardo wird vermisst.«
Ich runzelte die Stirn. Der Schwer-Clan bestand hauptsächlich aus Werbären, doch einige der Mitglieder verwandelten sich in größere Tiere, zum Beispiel in Wildschweine. Eduardo Ortego war ein Werbüffel. Er war in jeder Gestalt riesengroß. Im Kampf musste er sich gar nicht schlagen, er planierte seine Gegner einfach, und sie standen nicht mehr auf, nachdem er sie überrannt hatte. Ich mochte Eduardo. Er war ehrlich, direkt und mutig, und er würde sich in einer Gefahrensituation, ohne zu überlegen, vor einen Freund stellen. Außerdem war er unfreiwillig komisch, aber das spielte jetzt keine Rolle.
»Hast du mit deinem Vater gesprochen?«, fragte Curran.
»Ja.« George blickte in ihre Tasse. »Er war nicht unglücklich darüber.«
Wie konnte Mahon glücklich sein, dass Eduardo verschwunden war? Der Werbüffel war einer der besten Kämpfer, die der Schwer-Clan hatte. Als wir zum Schwarzen Meer aufbrachen, um ein Heilmittel für das Rudel zu beschaffen, war der Schwer-Clan in unserer Crew mit drei Leuten vertreten. George hatte sich als Erste freiwillig gemeldet, Mahon als Zweiter, und dieser hatte Eduardo als Dritten gewählt.
»George«, sagte Curran. »Erzähl von Anfang an.«
»Eduardo und ich sind zusammen«, sagte George.
»Du meinst, ihr seid ein Paar?« Ich hatte gedacht, Eduardo würde auf Jims Schwester stehen.
Sie nickte.
Ich war platt. Ich hatte die beiden seitdem vielleicht hundertmal gesehen und hätte niemals gedacht, dass sie etwas miteinander hatten. Ich musste blind gewesen sein.
Wenn ich es mir jetzt überlegte, waren sie auf der Rückreise tatsächlich viel zusammen gewesen …
»Wie lange schon?«, fragte Curran.
»Seit wir mit dem Wundermittel zurückkamen«, antwortete George. »Ich liebe ihn. Er liebt mich. Er hat für uns ein Haus gemietet. Wir wollen heiraten.«
Wow.
»Ist Mahon ein Problem?«, mutmaßte Curran.
George zog eine Grimasse. »Ed ist kein Bär. Es wäre schon ein Kodiak nötig. Und wenn kein Kodiak, dann wenigstens irgendein Bär. Deshalb waren wir so vorsichtig. Vor sieben Wochen habe ich versucht, mit Papa zu reden. Es ging schief. Ich fragte ihn, was passieren würde, wenn ich etwas Ernstes mit einem Gestaltwandler hätte, der kein Bär ist.«
Sie starrte wieder in ihre Tasse.
»Was hat er gesagt?«, fragte Curran mit sanfter Stimme.
George blickte auf. Ihre Augen blitzten, und ich stellte mir einen riesigen Bären vor, der brüllend in den Raum stürzte. George war wie ihr Vater ein Kodiak. Sie zu unterschätzen konnte tödlich enden. Ich hatte gedacht, sie wäre niedergeschlagen, aber nun wurde mir klar, warum ihre Gesichtszüge so angespannt waren. George war stinksauer und brauchte ihre ganze Willenskraft, um zu verhindern, dass sie explodierte.
Sie redete mit vor Wut bebender Stimme: »Er sagte, er würde mich enterben.«
»Das ist mal wieder typisch für ihn«, sagte Curran.
Sie schoss vom Stuhl hoch und lief nervös auf und ab, umkreiste die Kücheninsel wie ein Raubtier im Käfig. »Er sagte, ich wäre dem Clan verpflichtet. Ich müsste meine Gene weitergeben und mit einem richtigen Werbär-Mann Werbär-Kinder bekommen.«
»Hast du ihm gesagt, wenn er Werbär-Männer so sehr mag, soll er doch selber einen heiraten?«, erwiderte ich. Ich würde viel dafür geben, Mahons Gesicht zu sehen, wenn er das hörte.
Sie ging weiter auf und ab. »Von all dem archaischen Blödsinn muss sein Gehirn verkrustet sein. Vielleicht ist er senil geworden.«
»Du weißt doch, dass er oft solchen Unsinn von sich gibt«, setzte Curran an.
Sie drehte sich zu ihm um: »Wage es nicht, mir zu sagen, dass er es nicht ernst meint.«
»Doch, er meint es ernst«, sagte Curran. »Dieser Mann glaubt von ganzem Herzen, dass Bären etwas Besseres sind. Er meint jedes Wort, wenn er es sagt, aber er bringt nie etwas zu Ende. In den siebzehn Jahren, als ich das Rudel geleitet hatte, gab es über zwei Dutzend Beschwerden gegen ihn, immer wegen etwas, das er gesagt, aber nie wegen etwas, das er getan hatte. Er hat feste Grundsätze, was unwürdiges Verhalten für einen Alpha und für einen Bären ist. Eduardo zu beseitigen würde nicht zu seinem Charakter passen.«
»Du warst nicht dabei.« George lief weiter auf und ab. »Du hast ihn nicht gehört.«
Wenn ich nicht eingriff, würden sie die ganze Nacht über Mahon reden. »Was ist passiert, nachdem du mit deinem Vater gesprochen hattest?«
George schüttelte den Kopf. »Du weißt, was sein Unsinn über die Weitergabe von Genen bedeutet? Es bedeutet, wenn Eduardo und ich Kinder hätten, würde mein Vater sie für debil halten. Du verstehst das nicht, Kate. Ich bin seine Tochter!«
»Natürlich nicht«, sagte ich. »Schließlich hatte ich noch nie ein Problem mit meinem Vater.«
George öffnete den Mund und stockte. Was Probleme mit dem Vater anging, waren meine unendlich viel größer.
»Was geschah nach dem Gespräch zwischen Mahon und dir?«, fragte ich.
»Eduardo und ich redeten darüber. Eduardo erledigte Gelegenheitsarbeiten für den Schwer-Clan und half mir auch beim Abheften von Dokumenten. Das könnte er alles vergessen. Jim braucht meinen Papa, um seine Machtbasis aufrechtzuerhalten. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass sich auch mein Job beim Rudel in Luft auflöst, wenn mein Papa einen Skandal auslöst.«
»Deine Mama würde ihn umbringen«, sagte Curran.
»Ja, bestimmt«, sagte George. »Aber es würde anschließend passieren, und dann könnte Jim mich nicht wieder einstellen, weil er sonst schwach und unentschlossen wirken könnte. Also machte ich still und leise meine Investitionen in Bargeld, und Eduardo mietete in der Stadt ein Haus und ließ sich bei der Gilde registrieren.«
Die Söldnergilde war die größte gewinnorientierte magische Reinigungsagentur in Atlanta. Wenn man es mit Problemen wie einer gefährlichen magischen Bestie zu tun bekam, rief man als Erstes die Paranormal Activity Division, aber im Atlanta der Nachwende waren die Polizisten überarbeitet und chronisch unterbesetzt. In einigen Fällen rief man als Nächstes den Orden der mildtätigen Hilfe, aber wenn man mit den Rittern zu tun hatte, musste man alle Befugnisse komplett an sie abgeben. Wenn die Polizei nicht kommen konnte und die Sache für den Orden der mildtätigen Hilfe entweder zu geringfügig oder zu zwielichtig war, dann rief man die Gilde. Ihre Söldner arbeiteten als Bodyguards, sie kümmerten sich um die Reinigung von magischem Gefahrengut, sie gingen auf Vernichtungsmission – sie waren nicht wählerisch, solange sie Geld dafür bekamen. Ich war jetzt seit neun Jahren Mitglied der Gilde. Früher war es eine gute Möglichkeit gewesen, um Geld zu verdienen, aber seit dem Tod ihres Begründers war die Gilde den Bach runtergegangen.
»Wie lief es für ihn bei der Gilde?«, fragte ich.
»Sehr gut«, sagte George. »Er sagte, einige hätten ihm Ärger gemacht, aber es wäre nichts, womit er nicht umgehen könnte.«
Eduardo würde in der Gilde gut zurechtkommen. Er passte zu diesen Leuten. Wer die Gilde rief, wollte beruhigt werden, und ein fast zwei Meter großer muskelbepackter Mann, der wie ein Olympiasieger im Ringen aussah, wirkte durchaus beruhigend. Einige der Aktiven würden ihn mobben, weil sie keine Konkurrenz mochten, aber die Gilde teilte die Jobs nach Zonen ein. Jeder Söldner wurde einem Territorium innerhalb der Stadt zugeteilt, und wenn es in diesem Territorium etwas zu erledigen gab, bekam er automatisch den Job. Die übrigen Söldner konnten sich zwar über Eduardo auslassen und ihn schikanieren, aber sie konnten ihn nicht daran hindern, Geld zu verdienen.
»Ich glaube, Papa ist uns auf die Schliche gekommen«, sagte George. »Letzte Woche kam Patrick, um mit Eduardo zu reden.«
Ich blätterte im Geist die Namensliste der Gestaltwandler des Schwer-Clans durch. Patrick war Mahons Neffe, in Einstellung und Größe das exakte Ebenbild seines Onkels.
»Er sagte zu Eduardo, es wäre nicht richtig, was er tut, und wenn ihm wirklich etwas an mir liegt, sollte er mich in Ruhe lassen und nicht von meiner Familie wegzerren.«
Curran verzog das Gesicht.
»Würde Patrick so etwas von sich aus tun?«, fragte ich ihn.
Curran schüttelte den Kopf. »Nein. Wenn Patrick den Mund aufmacht, kommen Mahons Worte heraus. Patrick ist ein Vollstrecker, kein Denker. Deshalb hat ihn Mahon nie für die Alphaposition in Erwägung gezogen.«
»Eduardo sagte zu ihm, er hätte keine Ahnung, wovon er redet. Patrick ging. Am Montag kam Eduardo nicht nach Hause zurück. Ich habe die ganze Nacht gewartet.«
Ich holte einen Notizblock und einen Stift von einem Einbauregal. »Wann hast du Eduardo das letzte Mal gesehen oder gesprochen?«
»Montag früh um sieben Uhr dreißig. Er fragte mich, was ich zu Abend essen möchte.«
Jetzt war es gerade Mittwoch geworden, denn es war kurz nach Mitternacht. Eduardo war seit ungefähr vierzig Stunden verschwunden.
»Er hat mich am Mittag nicht angerufen«, fuhr George fort. »Er ruft sonst immer an. Ich dachte, er wäre vielleicht aufgehalten worden. Ich ging Montagabend in sein Haus. Er kam nicht. Er rief nicht an, und er hinterließ auch keine Nachricht. Ich weiß, es gibt idiotische Regeln, wie lange jemand weg sein muss, aber ich sage euch, das passt nicht zu ihm. Er lässt mich nicht einfach hängen. Es ist etwas Schlimmes passiert.«
»Hast du mit der Gilde gesprochen?«, fragte ich.
»Ich bin heute früh hingegangen und habe nach ihm gefragt. Keiner wollte mir etwas sagen.«
Das war keine Überraschung. Söldner waren allgemein zugeknöpft.
Georges Stimme zitterte vor kaum zurückgehaltener Wut. »Als ich rauskam, war mein Wagen weg.«
Curran beugte sich vor. Seine Stimme klang eisig. »Sie haben deinen Wagen gestohlen?«
Sie nickte.
Das war sogar für die Gilde schäbig. »Sie haben sie für ein leichtes Opfer gehalten«, sagte ich. »Junge Frau, allein, mit nur einem Arm, sieht nicht wie eine Kämpferin aus.« Ihnen war nicht bewusst, dass sie sich im Nu in einen fünfhundert Kilo schweren Bären verwandeln konnte.
Ich stand auf, ging zum Telefon und rief bei der Gilde an. Wenn Eduardo einen Job übernommen hatte, würde es der Buchhalter wissen. Wenn jemand mit einem Problem bei der Gilde anrief, sah der Buchhalter nach, in welches Gebiet es fiel, und holte den betreffenden Söldner. Wenn der Söldner beschäftigt war oder den Job nicht übernehmen konnte, rief der Buchhalter den nächsten in der Reihe an, bis er jemanden fand, der übernehmen konnte. Wenn er niemanden fand, steckte er eine Notiz ans Brett, die sich jeder nehmen konnte. Gewisse Jobs waren für auserwählte Leute bestimmt, weil sie besondere Qualifikationen erforderten, aber die meisten Jobs wurden nach diesem Muster vergeben. Die Vergabe der Jobs lief wie ein gut geölter Mechanismus, und der Buchhalter war schon so lange dabei, dass sich niemand mehr an seinen Namen erinnerte. Er war einfach der Buchhalter, der Typ, der dafür sorgte, dass man einen Job bekam und dafür bezahlt wurde. Falls Eduardo am Montag einen Job übernommen hatte, würde der Buchhalter wissen, wann und wo.
Das Telefon klingelte.
»Ja?«, sagte eine schroffe Männerstimme.
»Hier ist Daniels. Geben Sie mir bitte den Buchhalter.«
»Er ist nicht da.«
Merkwürdig, der Buchhalter übernahm sonst immer in der ersten Woche im Monat die Nachtschicht.
»Was ist mit Lori?« Lori war seine Stellvertreterin.
»Sie ist nicht da.«
»Wann wird einer der beiden da sein?«
»Woher soll ich das wissen?«
Die Verbindung wurde unterbrochen.
Was zum Teufel war in der Gilde los?
Ich wandte mich wieder George zu. »Wir gehen gleich morgen früh hin.« Selbst wenn der Buchhalter jetzt nicht da war, würden wir dann sicher ihn oder einen seiner Stellvertreter antreffen. »Ich weiß, das ist eine harte Frage, aber wäre es denkbar, dass Eduardo kalte Füße bekommen hat und weggelaufen ist?«
George zögerte keine Sekunde. »Nein. Er liebt mich. Und wenn er weggelaufen wäre, hätte er Max nicht zurückgelassen.«
»Max?«, fragte ich.
»Seinen Mops«, sagte sie. »Er hat ihn schon seit fünf Jahren. Er nimmt seinen Hund überallhin mit. Als ich am Montag zum Haus ging, fand ich Max im Arbeitszimmer, mit gerade genug Wasser und Futter für den Tag.«
Eduardo hatte einen Mops. Irgendwie überraschte es mich nicht.
»Was unternimmt Jim in der Sache?«, fragte ich.
»Nichts«, sagte George. »Ich habe ihm privat gemeldet, dass Eduardo vermisst wird. Er sagte, er würde sich darum kümmern, und zwei Stunden später hieß es, Papa hätte gemerkt, dass Eduardo sich nicht gemeldet hatte.«
Ich blickte zu Curran.
»Mahon hat sich auf den Clan berufen«, sagte Curran. »Eduardos Verschwinden ist eine Angelegenheit des Schwer-Clans. Außer wenn der Gestaltwandler beim gesamten Rudel angestellt ist oder wenn der Clan Jim um Hilfe bittet, sind ihm die Hände gebunden. Er kann seinen Leuten sagen, sie sollen nach Eduardo Ausschau halten, aber er wird ihn nicht aktiv suchen.«
»Darf er nicht, oder will er nicht?«, fragte ich.
»Beides«, sagte Curran. »Bei einer aktiven Suche müsste er Mitglieder des Schwer-Clans befragen, was gegen Mahons Autorität als Alpha verstoßen würde. Es gibt klare Richtlinien, die die Autonomie jedes Clans innerhalb des Rudels schützen, und das würde die Grenze überschreiten. George hat recht. Jim braucht Mahon, um seine Machtbasis zu erhalten. Er würde nichts unternehmen, um ihn absichtlich zu ärgern. In ein oder zwei Jahren, wenn Jim etabliert ist, könnte es anders laufen, aber jetzt weiß Jim sehr genau, dass er auf einem Hochseil balanciert. Wenn er aktiv nach Eduardo sucht, kann Mahon es so drehen, als würde Jim ihn beleidigen und seine Stellung als Herr der Bestien missbrauchen. Sobald Mahon Jim öffentlich angreift, würde man es als Misstrauensvotum gegen Jims Führungsqualitäten werten, und die übrigen Clans würden Jim als Diktator verschreien, der gegen ihre Rechte verstößt. Würde das passieren, stünde Jim auf verlorenem Posten. Wenn er nichts unternimmt, wird er schwach aussehen, und wenn er Mahon herausfordert, wird er wie ein Diktator aussehen. Er könnte nur verlieren, aber dazu ist Jim viel zu klug.«
Curran hatte recht, was Mahon betraf. Es war unwahrscheinlich, dass der Bär, wie Mahon auch genannt wurde, für Eduardos Verschwinden gesorgt hatte. Es würde nicht zu seinem Moralkodex passen. Aber falls Eduardo von sich aus verschwunden war, könnte Mahon die Situation ausnutzen. Er müsste einfach nicht zu intensiv nach ihm suchen. George hatte eine riesige Familie auf ihrer Seite. Sie war in Atlanta aufgewachsen, und wenn sie verschwinden sollte, würde der gesamte Schwer-Clan nach ihr suchen. Eduardo hingegen war ein Außenseiter. Er war vor ungefähr drei Jahren nach Atlanta gekommen, und soweit ich wusste, hatte er im Bundesstaat keine Verwandten.
»Ich weiß nicht, ob er tot oder am Leben ist.« George verlor die Fassung. Tränen schossen ihr in die Augen. Ihre Stimme wurde zu einem nervösen Brüllen. »Er könnte irgendwo tot in einem Graben liegen, und niemand sucht ihn. Ich habe ständig das Bild vor Augen, wie er kalt und tot irgendwo im Dreck liegt. Vielleicht sehe ich ihn nie wieder. Wie kann so etwas passieren? Wie kann jemand, den man liebt, plötzlich weg sein?«
Curran stieß sich von der Wand ab und legte sanft seine monströsen Arme um sie. »Das wird schon wieder«, sagte er ruhig. »Kate wird ihn finden.«
Ich wusste nicht, ob ich mich freuen sollte, dass er absolutes Vertrauen in mich hatte, oder ob ich wütend sein sollte, weil er ein Versprechen gab, das ich womöglich nicht halten konnte. Ich beschloss, mich zu freuen, denn ich sah, dass auf unserem Weg eine Mine vergraben war, und musste ihnen davon erzählen.
George weinte geräuschlos, Tränen der Sorge und der Wut flossen aus ihren Augen. Sie hatte mir auf der Reise zum Schwarzen Meer den Rücken gestärkt. Sie hatte für das Rudel gekämpft und ihren Arm geopfert, um eine Schwangere vor der Ermordung zu bewahren. Sie war sonst immer optimistisch und zuversichtlich und fühlte sich wohl in ihrer Haut. Sie lachte viel und sagte immer, was sie dachte, weil sie ihre Meinung sehr gut vertreten konnte. Und jetzt weinte sie und war in Panik, und es machte mich wütend, denn in dieser Welt lief etwas völlig falsch. Das Leben war stets unfair, aber das hier war zu viel. Ich musste es wieder in Ordnung bringen.
George trat von Curran zurück und wischte sich das Gesicht mit der Hand ab, versuchte, die Tränen wegzuwischen.
»Wir haben ein Problem«, sagte ich. »Wenn wir anfangen, an diesem Strick zu ziehen, könnte das andere Ende zum Schwer-Clan führen. Selbst wenn George uns und Cutting Edge offiziell anheuern würde, um nach Eduardo zu suchen, könnte Jim es trotzdem blockieren. So steht es in unserem Vertrag. Als das Rudel Startkapital für Cutting Edge genehmigte, wurde die Klausel eingefügt, dass alle Ermittlungen vom Herr der Bestien abgesegnet werden müssen, wenn ein Mitglied des Rudels an einem Verbrechen beteiligt sein sollte. Jim hat ein Vetorecht.«
»Wer hat das eingefügt?«, knurrte George.
Ich nickte Curran zu. »Er.«
»Damals schien es mir eine gute Idee zu sein«, sagte er.
»Und wie umgehen wir das?«, fragte ich.
Curran blickte zu George. »Ich werde dich etwas fragen, und ich möchte, dass du gut überlegst, bevor du antwortest. Hat Eduardo Ortego jemals die Absicht geäußert, dass er als Mitglied meines Teams das Rudel bei meinem Weggang verlassen möchte?«
Nicht schlecht. Wenn Eduardo zusammen mit Curran das Rudel verließ, wäre Curran berechtigt und verpflichtet, ihn zu beschützen.
George richtete sich zur vollen Größe auf. »Ja.«
Ich hatte das deutliche Gefühl, dass sie soeben gelogen hatte.
»Ich habe ebenfalls die Absicht, zusammen mit dir das Rudel zu verlassen«, sagte sie.
Au weia.
»Überleg es dir gut«, sagte Curran. »Das bedeutet, dass du die Verbindung zu deinem Clan abbrichst. Deine Eltern werden auch nicht begeistert sein. Wenn sich herausstellt, dass dein Vater mit Eduardos Verschwinden nichts zu tun hatte, könntest du es bereuen.«
»Gib mir den Vertrag«, sagte George.
Curran rührte sich nicht.
»Curran, gib mir das Papier.«
Er ging zum Regal, nahm von oben eine Heftmappe, in der ein leerer Trennungsvertrag lag. »Sobald du unterschrieben hast, musst du dich innerhalb von dreißig Tagen vom Rudel trennen.«
George nahm den Stift und schrieb ihren Namen in die Zeile für die Unterschrift. »Das ist kein Problem. Ich kann schon heute Abend gehen.«
»Nein, das kannst du nicht«, sagte ich. »Du musst zurück.«
»Warum?«
»Weil wir nicht einfach in die Festung einmarschieren und Nachforschungen anstellen können«, erklärte Curran. »Das verbietet uns das Rudel-Gesetz. Das weißt du. Es ist ein Kompromiss: Wir werden niemanden beeinflussen, mit uns zu kommen, und Jim darf nicht einschreiten, wenn jemand es tut. Wir gehören nicht mehr dem Rudel an, du aber schon.«