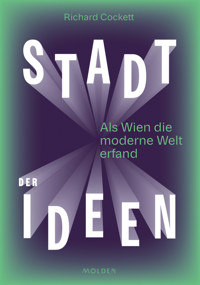
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Molden Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie vermag eine einzige Stadt für die meisten intellektuellen und kulturellen Errungenschaften des Westens im 20. Jahrhundert verantwortlich zu sein? Diese Frage steht im Zentrum von Richard Cocketts Ideengeschichte über Wiens Einfluss auf die moderne Welt. Von visionären Ökonomen über die Rebellen des Roten Wien, von Hollywood-Western bis zu Einkaufszentren, von Orgasmen bis zum Traum vom »Neuen Menschen«: Die jüngere Geschichte ist durchdrungen von jenen Denker:innen und Künstler:innen, die von 1900 an die Zukunft formten. Im Guten wie im Bösen. Cocketts Blick von außen gewährt eine neue Sicht auf eine brodelnde Epoche und erzählt von einer schillernden Elite, die Wien ihre Heimat nannte, von den Nazis ermordet oder in die Welt verstreut wurde – und deren Ideen uns bis heute prägen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Cockett
Stadt der Ideen
Als Wien die moderne Welt erfand
Aus dem Englischen von Stephan Gebauer
Wie Wien den »American Way of Life« erfand. Hier inszeniert von Richard Neutra und seinem 1946 errichteten Kaufmann Desert House in Palm Springs, Kalifornien.
Bildung als Emanzipation: Wiener Schulklasse mit etwa 15-jährigen Mädchen und ihrer Lehrerin, um 1910.
Inhalt
EinleitungWarum Wien?
Teil I: Wiener Erziehung: Das Rationale und das Antirationale
1 Jugend in Wien: Eine Schule des liberalen Denkens
2 Das Schwarze Wien und die Geburt der popul-numistischen Politik
Teil II: Aufstieg und Fall des Roten Wien
3 Der neue Mensch
4 Ein neues Denken für eine neue Epoche: Die Geburt der Wissensökonomie
5 Der Muse reicht’s: Feminismus und Sozialismus
6 Der Krieg gegen die Wissenschaft und das Ende Wiens
Teil III: Emigranten und Exilanten
7 Wach auf, schlummernder Riese! Die Wiener entdecken Amerika
8 Wohltuendes »Gewurschtel«: Die Wiener in Großbritannien
9 Die Neuerfindung der Welt: Der Kriegseinsatz und die offene Gesellschaft
10 Sex, Shopping und der souveräne Konsument
11 Eine Wiener Apotheose: Aufstieg der Österreichischen Schule der Nationalökonomie
Eine BilanzDie Politik des Genies gegen die Herrschaft des kritischen Rationalismus
Anmerkungen
Bildnachweis
Literatur
Dank
Für die tapfere, schöne Harriet
Einleitung
Warum Wien?
Die Behauptung, eine europäische Hauptstadt an der Donau habe den Grundstein für einen Großteil der geistigen und kulturellen Produktion der westlichen Welt im 20. Jahrhundert gelegt, mag maßlos übertrieben klingen. Aber genau das ist die Botschaft dieses Buchs.
Viele Forscher, Politiker und Intellektuelle sind überzeugt, man müsse den Aufstieg der Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert studieren, um die Geschichte der modernen Welt verstehen zu können. Ich würde ihnen raten, ein wenig von ihrer Energie für Wien aufzusparen, zumindest für jene pulsierende, radikale, außergewöhnliche Phase im Leben dieser Stadt, die der Faschismus in den 1930er Jahren beendete.
Die Nachkriegsgeschichte der westlichen Welt wird oft mit Blick auf die »Amerikanisierung« der europäischen Politik und Kultur beurteilt, denn nach dem Zweiten Weltkrieg übte der Sieger des Konflikts seine harte und weiche Macht aus. In diesem Buch spreche ich mich jedoch dafür aus, die Fließrichtung des transatlantischen Einflusses einer Neubewertung zu unterziehen, denn oft brachten die Amerikaner einfach Ideen, die ihren Ursprung in Europa gehabt hatten, nach Europa zurück. Und die bemerkenswertesten Beiträge zu diesem intellektuellen Hin und Her leisteten Wienerinnen und Wiener. Erst in den letzten Jahren haben Autoren und Forscher begonnen, die Entstehung einer »atlantischen Gemeinschaft« zu untersuchen. Fest steht, dass die Einflussnahme im »amerikanischen Jahrhundert«, das der Journalist Henry Luce im Jahr 1941 ausrief, keineswegs wie oft behauptet eine Einbahnstraße war.1
Tatsächlich kann niemand, der einen genaueren Blick auf die Entwicklungen wirft, den Einfluss Wiens auf erstaunlich breit gefächerte wissenschaftliche und kulturelle Felder – von der Kernspaltung über das Einkaufszentrum und die Psychoanalyse bis zur Einbauküche – leugnen. Die Frage ist nur, wie groß jener Einfluss war. Verschiedene Forscher haben einzelne Bestandteile dieses Prozesses untersucht, aber mein Buch stellt den ersten Versuch dar, dem Einfluss Wiens auf die westliche Welt in sämtlichen menschlichen Betätigungsfeldern nachzuspüren. Außerdem lohnt es sich im Auge zu behalten, dass diese Geschichte nicht von einem Land oder einem Großreich, sondern von einer Stadt handelt, die der modernen Welt ihren Stempel aufgedrückt hat. Und es war nicht einmal eine große Stadt: Das kulturelle Herz Wiens, die Innere Stadt, kann man zu Fuß in einer halben Stunde durchqueren.
Wenn wir den Werdegängen einiger außergewöhnlich talentierter Wiener und Wienerinnen nachspüren, stoßen wir auf die Ursprünge vieler Fragen, die gegenwärtig die Welt beschäftigen. Denn Wien brachte nicht nur einige der klügsten und humansten Personen und Ideen hervor, sondern hatte auch großen Anteil an der Entstehung einiger der schädlichsten und zerstörerischsten Pathologien der Neuzeit: des Nationalsozialismus, des organisierten Antisemitismus und des extremen Ethnonationalismus. Am Ende brach die Stadt unter ihren inneren Widersprüchen zusammen. In diesem Buch spüre ich sowohl ihren konstruktiven als auch ihren destruktiven Neigungen nach, in denen auch die wesentlichen Widersprüche unserer Zeit zum Ausdruck kommen. Wenn wir die Entwicklung der gegenwärtigen Gesellschaften und politischen Systeme insbesondere im Westen verstehen wollen, müssen wir zunächst herausfinden, wie und wo viele dieser Entwicklungen ihren Ursprung hatten. Sie begannen in Wien.
Die Matrix der Innovation
Der erste Text, der Wien eine Ausnahmestellung im Geistesleben zugestand, war Fin-de-Siécle Vienna, ein 1980 erschienenes Buch des Princeton-Historikers Carl E. Schorske. (Die deutsche Übersetzung des Buchs erschien zwei Jahre später.) Schorskes elegant und überzeugend geschriebenes Buch eignet sich als Ausgangspunkt für jeden, der sich für die Ideengeschichte Wiens interessiert, und hat Autoren, Künstler und Forscher inspiriert, sich eingehender mit dem Thema zu befassen.
In diesem Buch beschäftige ich mich mit Fragen zum Ausmaß des Wiener Einflusses, die Schorske aufwarf, jedoch nie umfassend beantwortete. Wie der Titel seines Buchs verrät, widmete er sich dem mittlerweile vertrauten Fin de Siècle in der glänzenden Metropole von Sigmund Freud, Alfred Adler, Gustav Mahler, Adolf Loos, Arthur Schnitzler, Robert Musil und Gustav Klimt. Diese Stadt wurde zum Schauplatz zahlreicher Theaterstücke, Memoiren und Filme (eines der jüngeren Beispiele ist Tom Stoppards Leopoldstadt). Aber so wie andere vor mir habe ich den Untersuchungszeitraum erheblich vergrößert.2 In meinen Augen kann man die These von einer intellektuellen Vormachtstellung Wiens nur belegen, indem man dieses Kapitel seiner Geschichte in Zusammenhang mit der weniger bekannten, aber umwälzenden Zwischenkriegszeit betrachtet. Dies war die Zeit des »Roten Wien«, in der die Stadtregierung ein extrem ehrgeiziges demokratisches Experiment begann, das bis dahin in der Geschichte der Menschheit einzigartig war.
Wenn man diese breite Perspektive einnimmt, kann man die Einschätzung, die Stadt sei eine Innovationsmatrix gewesen, sehr viel besser begründen. Wie der Kulturhistoriker Edward Timms erklärte, geht es darum, »die schöpferischen Konvulsionen des im Niedergang befindlichen Habsburgerreichs mit der ideologischen Dymanik der Zwischenkriegszeit zu verknüpfen«. Timms wies darauf hin, dass es nach dem Ersten Weltkrieg auf allen Ebenen zu einer »dramatischen Radikalisierung« kam.3 Dies ist der Schlüssel zum Verständnis des Einflusses Wiens auf Kultur und Denken der westlichen Welt, und zwar sowohl des konstruktiven als auch des zerstörerischen Einflusses.
Ich habe versucht, Wien aus der erdrückenden Umklammerung der »German studies« zu befreien. Der »österreichische« Beitrag zur Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts ist oft Teil der umfassenden Auseinandersetzung mit der »deutschsprachigen« Diaspora. Doch diese verallgemeinernde Zuordnung tut Wien Unrecht, denn die geistige Landschaft der Stadt unterschied sich in mehrfacher Hinsicht erheblich von jener Deutschlands. Tatsächlich verstand sich Wien in Abgrenzung zur Geistesgeschichte und zur Aufklärung Deutschlands, was einer der Gründe dafür war, dass die Wiener Emigranten so wirkmächtig in der westlichen Welt wurden. Beispielsweise leisteten sie im Kalten Krieg wesentliche Beiträge zu jener politischen Neuausrichtung, die dem Westen schließlich den Sieg über den linken und rechten Totalitarismus sicherte.
Was ist dieses Wienerische?
Das Untersuchungsgebiet dieses Buchs wird durch meine Definition des »Wienerischen« eingegrenzt, weshalb eine Erklärung angebracht ist. Nüchtern betrachtet, war Wien natürlich eine räumliche, geografische Einheit innerhalb bestimmter Verwaltungsgrenzen, die sich im Lauf der Zeit verschoben. Doch wie ich in Kapitel 1 darlegen werde, war Wien auch eine kulturelle und intellektuelle Schöpfung.
Ein offenkundiger Unterschied zu anderen großen Hauptstädten bestand darin, dass die Bevölkerung Wiens zu einem großen Teil aus Zuwanderern bestand, die oft aus abgelegenen Regionen des Habsburgerreichs stammten. Sie ließen sich in Wien nieder, wo sie zur Entstehung der dynamischsten und vielleicht tolerantesten intellektuellen Gemeinde der Welt beitrugen und von ihr profitierten. Das war die Eigendefinition der Wienerinnen und Wiener, denen wir in diesem Buch begegnen: Sie lehnten alle ethnonationalistischen, religiösen oder geschlechtsspezifischen Etiketten ab, die ihnen von anderen – manchmal durchaus wohlmeinend – angeheftet wurden. Etwas ganz anderes war die österreichische »Kultur«, wie wir sehen werden.
In der heutigen abgegriffenen Wortwahl könnte man jene Wiener spöttisch als »Leute von nirgendwo« bezeichnen. Sie selbst hingegen betrachteten sich vorbehaltlos als »Leute von irgendwo«, und dieses Irgendwo war Wien. Das ist einer der Gründe dafür, dass dieses Wien, die Stadt aus Stefan Zweigs Die Welt von Gestern, nach wie vor unsere Fantasie anregt. Tatsächlich sollte dieses Wien all jene begeistern, die an einen europäischen Kulturraum glauben, der von Dublin bis Kiew reicht, gleichgültig ob sie diese Kultur in den politischen Institutionen der Europäischen Union verankern wollen oder nicht. Wer hier aufwuchs, ausgebildet wurde und arbeitete, bewegte sich in einer einzigartigen, offenen und kosmopolitischen Umgebung, selbst wenn diese manchen ein Gräuel war.
Daher betrachte ich in diesem Buch all jene als Wienerinnen und Wiener, die in der Stadt ausgebildet wurden und zu ihren geistigen Leistungen beitrugen, selbst wenn sie nicht dort geboren wurden. Beispielsweise beschäftige ich mich eingehend mit Charlotte Bühler und Ernst Mach, obwohl Bühler aus Berlin stammte und Mach einen großen Teil seiner Karriere in Prag verbrachte. Aber beide hatten offenkundig beträchtlichen Einfluss auf mehrere Generationen von Wienern. Zu den Wienern rechne ich auch viele Angehörige der »großen Generation« Ungarns, die in vielen Fällen aus Budapest stammten, aber mit der Haupt- und Residenzstadt des Reichs ebenso vertraut waren wie mit ihrer Geburtsstadt. In einer Zeit, in der es noch keine Reisepässe gab, bewegten sich Forscher und Autoren wie Karl Polanyi, John von Neumann und Abraham Wald ganz selbstverständlich zwischen Budapest und Wien hin und her, arbeiteten mit ihren Wiener Kollegen zusammen und ließen sich teilweise in der österreichischen Hauptstadt nieder.
Ich behaupte keineswegs, diese Personen hätten ausschließlich zu Wien gehört. Zu jener Zeit waren die mitteleuropäischen Länder kulturell so eng miteinander verflochten, dass oft mehrere Orte Ansprüche erheben konnten, die Heimat einer herausragenden Figur zu sein. Und ihre intellektuelle Ausbildung hatten viele von ihnen an mehreren Orten genossen. Beispielsweise hatten die Regisseure, die Hollywood eroberten, darunter Billy Wilder und Fritz Lang, Berlin ebenso viel zu verdanken wie Wien, aber ich betrachte sie hier als Wiener, weil sie in dieser Stadt zur Welt kamen und ausgebildet wurden. Lang kämpfte außerdem im Ersten Weltkrieg in der Armee Österreich-Ungarns.
Da mein Interesse in erster Linie dem Einfluss Wiens auf die Welt gilt, beschränke ich mich in meiner Untersuchung auf jene Wienerinnen und Wiener, deren Leben und Arbeit außerhalb der Stadt großen Widerhall fand. Es gab weitere Personen, die zu den brillantesten Köpfen der Stadt zählten – ein Beispiel ist der Satiriker Karl Kraus –, aber wenn ihre Wirkung im Wesentlichen auf Wien beschränkt blieb, ist dieses Buch nicht der geeignete Ort, um ihre Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, die Leser werden meiner Einschätzung zustimmen, dass die Zahl der Wienerinnen und Wiener, deren Wirken außerhalb der österreichischen Hauptstadt ein Echo fand, groß genug ist, um ein Buch mit ihren Geschichten zu füllen.
Das Buch ist in drei Abschnitte unterteilt. In Teil I beschreibe ich Wiens Wandlung zu einer Stadt der Ideen in der »goldenen Epoche« vor dem Ersten Weltkrieg. In Teil II beschäftige ich mich mit der bemerkenswerten Blüte des Roten Wien und mit seiner Zerstörung durch Austrofaschisten und Nationalsozialisten. Das Thema von Teil III ist der weltweite Einfluss der Wiener Emigranten und Exilanten, vor allem in den USA und Großbritannien, gegen Ende des 20. Jahrhunderts.
Teil 1
Wiener Erziehung: Das Rationale und das Antirationale
Freiheit à la Jugendstil 1908: Die Wiesenthal-Schwestern Grete, Bertha und Elsa (im Bild) begeisterten mit revolutionären Balance- und Schwebetechniken.
Kapitel 1
Jugend in Wien: Eine Schule des liberalen Denkens
Einsam und alt, fern und gleichsam erstarrt, dennoch uns allen nahe und allgegenwärtig im großen, bunten Reich lebte und regierte der alte Kaiser Franz Joseph. Vielleicht schliefen in den verborgenen Tiefen unserer Seelen jene Gewissheiten, die man Ahnungen nennt, die Gewissheit von allem, dass der Kaiser starb, mit jedem Tage, den er länger lebte, und mit ihm die Monarchie, nicht so sehr unser Vaterland wie unser Reich, etwas Größeres, Weiteres, Erhabeneres als nur ein Vaterland.4
So erinnerte sich der Journalist und Schriftsteller Joseph Roth in Die Kapuzinergruft an das Ende einer Ära. Der elegische Roman spielt kurz vor, während und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und endet am 12. März 1938, dem Tag des »Anschlusses«. Zu diesem Zeitpunkt war Kaiser Franz Joseph für viele bereits ein ferner Mythos. Der im Jahr 1830 geborene Monarch regierte das Habsburgerreich von 1848 bis zu seinem Tod im Jahr 1916. In der dokumentierten Weltgeschichte haben nur fünf Monarchen länger auf dem Thron gesessen als er.
Als Roths Roman 1938 in einem Exilverlag in Holland erschien, sahen viele im Kaiser ein Relikt aus einer vergangenen Ära. Franz Joseph I. mit seinem charakteristischen Backen- und Schnurrbart, der stets einen vollkommen zugeknöpften Uniformrock trug, beschäftigte sich kaum mit den außergewöhnlichen technischen und wissenschaftlichen Fortschritten jener Zeit, obwohl viele Neuerungen ihren Ursprung in seinem Reich hatten. Der nüchterne und sparsame Kaiser hatte nichts für neuartige Geräte übrig. Seine Residenz Schloss Schönbrunn hatte 1441 Räume, angeblich jedoch kein einziges Bad, da der Monarch Bäder für einen unnötigen Luxus hielt: Franz Joseph stand jeden Tag um vier Uhr morgens auf und ließ sich mit eiskaltem Wasser übergießen. Er zog Briefe dem Telefon vor, und die Hofburg, wo er sein Privatbüro hatte, wurde bis zu seinem Tod mit Petroleumlampen beleuchtet. Er schlief auf einem eisernen Feldbett. Seine größte Leidenschaft war die Jagd, vor allem auf Hirsche und Gämsen.
Man sollte meinen, der alte Monarch sei kaum geeignet gewesen, einer der faszinierendsten Blütezeiten des europäischen Geistes seit der Renaissance vorzustehen. Das »goldene Zeitalter« Wiens, das von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs dauerte, fiel mit Franz Josephs Regierungszeit zusammen und wurde mit seinem Namen verbunden. Und das war nicht nur ein chronologischer Zufall. Selbst junge Dandys wie Roth räumten ein, dass ihnen ausgerechnet der vermeintlich distanzierte und antiquierte Kaiser die Freiheit gegeben hatte, die Welt auf den Kopf zu stellen. Inmitten des rasanten gesellschaftlichen und politischen Wandels schien die Bedeutung des Kaisers nicht zu schwinden, sondern zu wachsen. Pieter Judson, der eine neuere Geschichte Österreich-Ungarns geschrieben hat, erklärt: »Die Konzepte von Reich und Dynastie standen in einer Zeit des verwirrenden Wandels für Beständigkeit. Der unvergleichlich populäre Kaiser Franz Joseph beaufsichtigte den fortschreitenden gesellschaftlichen Wandel und bremste wenn nötig den sozialen Radikalismus der Politiker«.5
In diesem Kapitel zeichne ich die intellektuellen Grundlinien jener goldenen Ära nach, die eng mit der neuen politischen Doktrin des Liberalismus und dem Charakter des alten Habsburgerreichs verwoben war. Ich zeichne nach, wie die einzigartigen Bedingungen in Wien innerhalb von nur drei Generationen derart viele herausragende Männer und Frauen hervorbrachten, die den Gang der Welt nachhaltig beeinflussten. In jener Epoche in Wien aufzuwachsen, war eine Bildung an sich.
Bürgerliche Werte
Franz Josephs lange Regierungszeit begann unter ausgesprochen ungünstigen Bedingungen. Im Jahr 1848 wurde Europa von Revolutionen erschüttert. Der neue Kaiser machte den Revolutionären anfangs einige Zugeständnisse, ging dann jedoch zu einem »Neoabsolutismus« über. Der Aufstieg des Nationalismus insbesondere in Ungarn zwang die Monarchie jedoch zu einem Kurswechsel, der durch die Niederlagen im Sardinischen Krieg 1859 und gegen Preußen im Deutschen Krieg von 1866 beschleunigt wurde.
An die Stelle des Absolutismus trat eine konstitutionelle Monarchie, in der eine neue Generation liberaler Politiker die Zügel in die Hand nahm. Im Jahr 1867 wurde die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn gegründet, um die ungarischen Nationalisten zu beschwichtigen. In den folgenden fünf Jahrzehnten verfolgte Franz Joseph gleichmütig die Blüte des politischen Liberalismus in seinem Reich.
Wie in anderen europäischen Ländern waren auch in der Habsburgermonarchie der Kapitalismus und die Reformpolitik die tragenden Säulen der liberalen Epoche. Die traditionelle Zunftordnung wurde mit der Verabschiedung der Gewerbeordnung von 1859 beseitigt, welche die freie Wahl des Gewerbes und die Entfaltung einer (teilweise) freien Marktwirtschaft ermöglichte. Im Jahr 1867 verkündete der Kaiser die Dezemberverfassung, welche die Gleichheit vor dem Gesetz unabhängig von der Ethnie sowie Meinungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit garantierte. Es war eine der fortschrittlichsten Verfassungen jener Zeit, die darin festgeschriebenen Grundrechte haben bis heute Bestand.
Die Veränderungen wirkten sich auf Wien nachhaltiger aus als auf jeden anderen Ort in Europa. Eine bedeutsame Folge der Revolution von 1848 war, dass die Monarchie allen Bürgern völlige Bewegungsfreiheit auf dem Reichsgebiet zugestand, was eine Wanderbewegung aus dem ländlichen Raum in die rasch wachsenden Städte auslöste, wo die Menschen besser bezahlte Arbeit (und neue Freiheiten) zu finden hofften. Wien wuchs rasch. Die Bevölkerung der Hauptstadt (einschließlich der Vororte) stieg von 431.000 Menschen im Jahr 1857 auf mehr als zwei Millionen Einwohner im Jahr 1910, womit Wien zur viertgrößten Stadt auf dem Kontinent wurde.
Ein selbstbewusstes Bürgertum nutzte die Chance, Wien seinen Stempel aufzudrücken, und übernahm die Initiative im ehrgeizigsten Stadtentwicklungsprogramm Europas. Die Altstadt, die sich um den gotischen Stephansdom drängte, war von Kirchen, barocken Palais und der kaiserlichen Residenz geprägt. In den Jahren 1858 bis 1863 wurden die aus dem 16. Jahrhundert stammenden massiven Befestigungsanlagen, die der Belagerung durch die Türken standgehalten hatten, geschleift. An ihrer Stelle entstand eine neue Prachtstraße, die Ringstraße. In den folgenden zwei Jahrzehnten errichtete das Wiener Bürgertum nicht nur eine neue Stadt, sondern auch eine neue Zivilisation und feierte in der Architektur »den Triumph des konstitutionellen Rechts über die imperiale Macht, der säkularen Kultur über den religiösen Glauben. Der Ring wurde nicht von Palästen, Festungen und Kirchen beherrscht, sondern von den Zentren der konstitutionellen Regierung und der Hochkultur.«6
Der Historismus war in Mode, und jede Säule der liberalen Ordnung erhielt ihr architektonisches Symbol. Für das monumentale Parlamentsgebäude wurden selbstverständlich Anleihen beim klassischen Griechenland genommen, um das neue Bekenntnis des Habsburgerreichs zur (beschränkten) Demokratie zu verkünden. Das Universitätsgebäude und das Opernhaus wurden im Stil der Renaissance errichtet, um dem Triumph der europäischen Kultur Ausdruck zu geben. Für das Rathaus wurde die Neugotik, für das Burgtheater das Hochbarock ausgewählt.
So wurde der Triumph des Bürgertums in Stein gemeißelt. Die Bauarbeiter, die überwiegend aus Böhmen kamen, errichteten auch die massiven, in vielen Fällen mit aufwendigem Fassadendekor versehenen vier- und fünfstöckigen Wohnhäuser an den Straßen, die in die Ringstraße mündeten. Die Donau wurde gezähmt: Das Flussbett wurde begradigt und vertieft und das sogenannte Überschwemmungsgebiet geschaffen, auch ein Abschnitt des Donaukanals wurde begradigt. Wie London im Jahr 1851 und Paris 1855 richtete Wien 1873 eine Weltausstellung aus, um die Errungenschaften des Reichs zur Schau zu stellen. Auf dem alten königlichen Jagdgrund im Prater entstanden hunderte neue Gebäude und das Messegelände. 1897 wurde anlässlich des goldenen Thronjubiläums des Kaisers im Prater das weltgrößte Riesenrad eingeweiht, ein von englischen Ingenieuren errichtetes Symbol des modernen Wien, das noch heute ein Wahrzeichen der Stadt ist.
Die Ringstraße wurde bald mit dem bürgerlichen Liberalismus gleichgesetzt. Die Prachtbauten entlang des Rings sollten beeindrucken und einschüchtern – und sie taten es. Ein Neuankömmling aus Oberösterreich erstarrte vor Ehrfurcht und erinnerte sich in Mein Kampf: »Stundenlang konnte ich so vor der Oper stehen, stundenlang das Parlament bewundern; die ganze Ringstraße wirkte auf mich wie ein Zauber aus Tausend und einer Nacht.«7 Obwohl Adolf Hitler eine ambivalente Beziehung zu seinem Geburtsland hatte, hatte seine Besessenheit vom Bau eines grandiosen neuen Berlin mit seinem Chefarchitekten Albert Speer ihren Ursprung offenkundig in der Faszination, welche die Wiener Ringstraße auf ihn ausübte.
Fritz Lang wuchs in der Piaristengasse in der Josefstadt nahe des Boulevards auf. »Die einzigartige Bildsprache des Regisseurs insbesondere in seinen epischen Stummfilmen«, schreibt sein Biograf Patrick McGilligan, »wurde geprägt durch die Erfahrungen in seiner Kindheit, als er im Schatten gewaltiger Statuen und massiver Treppenhäuser, hoher Kirchtürme und riesiger öffentlicher Bauten lebte«. Für Lang hatte es einen besonderen Reiz, sich die Ringstraße ehrfürchtig in Erinnerung zu rufen: Sein Vater, ein erfolgreicher Bauunternehmer, hatte viele der schwindelerregenden Treppenhäuser, lichtdurchfluteten Eingangshallen und übergroßen Wohnungen gebaut, die seinen Sohn so sehr beeindruckten.8
Alle europäischen Großstädte hatten zu jener Zeit ähnlich grandiose Bauvorhaben in Angriff genommen. Und wie Wien litten die Hauptstädte der anderen Reiche – London, Paris und Berlin – unter vergleichbarer Ungerechtigkeit und Ungleichheit (mehr dazu im nächsten Kapitel). Doch Wien wies einige besondere Merkmale auf, die ein einzigartiges gesellschaftliches und politisches Umfeld schufen, in dem sich eine ganz eigene intellektuelle und kulturelle Tradition entwickeln konnte.
Wien war wahrscheinlich die ethnisch vielfältigste der europäischen Metropolen. In der Hauptstadt des Vielvölkerstaates tummelten sich unterschiedlichste Menschen, die verstärkt ab den 1860er Jahren aus den Kronländern in die Metropole strömten. Wien war in erster Linie eine Stadt von Zugewanderten, von denen viele erst vor kurzer Zeit eingetroffen waren. Die Volkszählung von 1910 zeigte, dass nur etwa die Hälfte der Einwohner Wiens hier auch heimatberechtigt war, was normalerweise bedeutete, dass der Geburtsort nicht Wien war. Die andere Hälfte war in anderen Teilen des Reichs heimatberechtigt, zumeist in Ober- und Niederösterreich, Böhmen, Mähren, Ungarn, Galizien, Schlesien und dem Deutschen Reich.9 Die meisten der Männer und Frauen, mit denen wir uns in diesem Buch beschäftigen, kamen in Wien zur Welt, aber in vielen Fällen waren ihre Eltern und manchmal Großeltern aus den »Provinzen« oder Kronländern (etwa Böhmen und Mähren) zugewandert. So entwickelte sich eine eigentümliche »wienerische« Identität. Menschen gingen nach Wien, um ihre Vergangenheit abzuschütteln und sich ein neues, kosmopolitisches Selbst anzueignen. Das war möglich in einem imperialen System, das ungewöhnlich offen für Menschen unterschiedlicher religiöser und ethnischer Herkunft war. Im Gegensatz dazu blieben Berlin und Paris trotz des Großmachtstrebens ihrer Staaten ethnisch relativ homogen. Die ethnische Melange Wiens war ein häufiger Gesprächsstoff und gab der Stadt ein eigenes Flair. Der Historiker Carl E. Schorske hat Wien und das habsburgische Mitteleuropa als »Laboratorium« für die multikulturelle Gesellschaft bezeichnet, im Hinblick auf die moderne kulturelle Heterogenität müssen aber auch weitere Faktoren berücksichtigt werden.10
Die Größe der Stadt spielte zweifellos eine Rolle. Anders als die anderen Metropolen war Wien groß genug, um Neuankömmlinge aufnehmen zu können, und zugleich klein genug, um insbesondere innerhalb des Rings Begegnung und Mischung zu ermöglichen. Die Innere Stadt kann man in weniger als einer halben Stunde zu Fuß durchqueren. Dieser geografische Raum wirkte, als wäre er eigens entworfen worden, um zufällige Begegnungen und jene Verflechtung von Menschen und Berufen zu fördern, die Wiens eng verbundene und zugleich unendlich vielfältige Gemeinschaft hervorbrachte. Die Wiener Architekten des 20. Jahrhunderts mochten Pioniere der internationalen Moderne sein, aber sie orientierten sich vor allem an den besonderen räumlichen Eigenschaften ihrer Geburtsstadt. Victor Gruen (geborener Grünbaum), der Erfinder des Einkaufszentrums, bemühte sich in seinem gesamten Berufsleben mit wechselndem Erfolg, diese Merkmale Wiens in den Vereinigten Staaten zu reproduzieren. Im Alter tat er den für einen Wiener Exilanten ungewöhnlichen Schritt, zurückzukehren und sich eine Wohnung im 1. Bezirk zu kaufen, um erneut das Leben in der Stadt seiner Jugend zu genießen. Er schwärmte von dieser Erfahrung:
Von meiner Wohnung aus erreiche ich in wenigen Minuten zu Fuß sehr unterschiedliche Orte: die Oper, den Musikverein, das Konzerthaus und zwei Theater, verschiedenste Läden und Kaufhäuser, elegante Restaurants, sowohl elegante als auch einfache Kaffeehäuser, den zentralen Obst- und Gemüsemarkt (den Naschmarkt) […] und die Kunstgalerien im Künstlerhaus und der Secession. […] Die Einwohner des Gebiets stellen ein Potpourri unterschiedlichster sozioökonomischer und kultureller Gruppen dar, von einfachen Arbeitern bis zu Millionären, aber die Mischung ist so dicht, weil keine wirtschaftliche oder nationale Gruppe der anderen zahlenmäßig überlegen ist.11
Kaffeehäuser und Fußball
Das Kaffeehaus war der Ort der Begegnung, eine komfortable, gepolsterte Erweiterung der öffentlichen Sphäre. Ein Historiker hat das Wiener Kaffeehaus als eine besondere Institution bezeichnet, als einen »demokratischen Klub, in dem man diskutieren, schreiben und Karten spielen konnte«.12 Im Jahr 1900 gab es in der Hauptstadt des Habsburgerreichs etwa 600 Kaffeehäuser. Es gab Wiener, die ihren Arbeitstag im Kaffeehaus verbrachten, ohne dort angestellt zu sein. Oft teilten sie ihren Tag zwischen mehreren Stammlokalen auf. Es wird berichtet, dass sich ein Geschäftsmann tatsächlich seine Arbeitszeiten auf seine Visitenkarte drucken ließ:13
Von 2 bis 4 Uhr – Café Landtmann
Von 4 bis 5 Uhr – Café Rebhuhn
Von 5 bis 6 Uhr – Café Herrenhof
Jedes Kaffeehaus lockte eine eigene Klientel an – Architekten, Ökonomen, Schriftsteller. Aber die Tatsache, dass sich jeder Gast für den Preis einer Melange ihre Vorträge anhören konnte, machte die neuesten Ideen und Spekulationen zu verschiedensten Themen einem ungewöhnlich großen Publikum zugänglich: Dies war ein »demokratischer Klub«. Dazu kam, dass sich im unablässigen Gezeitenwechsel der Kaffeehausgesellschaft jegliche intellektuelle Hierarchie auflöste.
Nehmen wir beispielsweise den Fußball. So wie Komponisten und Politiker hatten auch die Fußballvereine der Stadt ab den 1920er Jahren ihre eigenen Kaffeehäuser: Die Anhänger von Rapid versammelten sich im Café Holub in der Hütteldorfer Straße, die Fans der Austria im Parsifal in der Walfischgasse. Dort kamen nicht nur Spieler, Fans und Trainer zusammen, sondern auch Schriftsteller, Philosophen, Bühnenautoren und Mathematiker, deren Gedankenaustausch den Fußball für immer veränderte. Die Sportjournalisten trafen sich mit den Theater- und Opernkritikern im Ring-Café am Stubenring, der Drehscheibe der intellektuellen Fußballkultur Wiens, »einer Art von revolutionärem Parlament der Freunde und Fanatiker des Fußballs«.14 Das sehr körperbetonte Spiel, ein Sport der Arbeiterklasse, der Ende des 19. Jahrhunderts aus Großbritannien importiert worden war, verwandelte sich im Schmelztiegel des Wiener Kaffeehauses in eine intellektuell anspruchsvolle Auseinandersetzung, in der vollkommen neue Taktiken zum Einsatz kamen, für die eine andere Art von Spielern benötigt wurde.
Fußballer wie der Rapid-Mittelstürmer Josef Uridil und der ebenso schmächtige wie kreative Austria-Goalgetter Matthias Sindelar – der wegen seiner Fähigkeit, sich durch die gegnerischen Abwehrreihen zu »schleichen«, den Spitznamen »der Papierene« erhielt – wurden in den Kaffeehäusern ebenso gefeiert wie der Architekt Adolf Loos oder der Komponist Arnold Schönberg. Der renommierte Fußballhistoriker Jonathan Wilson schreibt: »Damit die Taktik wirklich umgesetzt werden konnte, musste das Spiel von einer Gesellschaftsklasse aufgegriffen werden, die instinktiv theorisierte und dekonstruierte, die sich in der abstrakten Planung ebenso wohlfühlte wie in der Umsetzung auf dem Spielfeld und die nicht unter dem in Großbritannien verbreiteten Misstrauen gegenüber dem Intellektualismus litt.«15 Es ist nicht zuletzt Wien zu verdanken, dass Trainer ohne jede Ironie begannen, eine bestimmte »Spielphilosophie« zu verfechten. Schließlich war es der Theaterkritiker und Schriftsteller Alfred Polgar, der erklärte, Sindelar habe »Geist in den Beinen«.
Daher war es kein Zufall, dass sich die erste Glanzzeit des österreichischen Fußballs – die Zwischenkriegszeit – mit der letzten großen Blüte des Wiener Kaffeehausintellektualismus überlappte. Der nicht zu überhörende Ruf nach einer Aufnahme Sindelars in die als »Wunderteam« bezeichnete Nationalmannschaft wurde zuerst im Ring-Café laut. Das von Hugo Meisl betreute Wunderteam schlug der Reihe nach Schottland (5:0 im Jahr 1931), Deutschland (6:0) und schließlich England im Jahr 1936. Meisls Mannschaft erreichte das Halbfinale bei der Weltmeisterschaft 1934 in Italien. Das übrige Europa, vor allem Italien, verfolgte die Entwicklung aufmerksam, und der Fußball ließ das grobe Kick-and-Rush-Spiel aus seinem Herkunftsland England rasch hinter sich.
Die Kultur der Bildung
Die 1910 als »Wiener Amateur-Sportverein« gegründete Wiener Austria war eng mit dem jüdischen Bürgertum der Stadt verbunden und der rasche Aufstieg des Vereins ging mit dem der jüdischen Gemeinde einher. Unter den Menschen, die zwischen 1848 und 1914 in die Hauptstadt strömten, um in Wien ein neues Leben zu beginnen, waren besonders viele Juden, und diese Gruppe war besonders erfolgreich.
Tausende zogen aus den östlichen Ländern des Habsburgerreichs in die an die Innenstadt angrenzenden Vorstädte der Hauptstadt. Die meisten siedelten sich in der von der Textilindustrie geprägten Leopoldstadt an, die gegenüber der Inneren Stadt am anderen Ufer des Donaukanals liegt. Die Leopoldstadt war sehr viel größer als ihr jüdisches Viertel, und die nichtjüdische Bevölkerung war zahlenmäßig größer als die jüdische, aber in den 1920er Jahren beherbergte der Bezirk immer noch ein Drittel der jüdischen Gemeinde Wiens und wurde mit dem jüdischen Wien gleichgesetzt.16 Dort begann für die Neuankömmlinge die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Assimilation, die ihnen eines Tages vielleicht eine Wohnung am anderen Ufer des Kanals sichern würde. Die Juden waren die Hauptbegünstigten der liberalen Reformen der Habsburgermonarchie im 19. Jahrhundert: Nach der Revolution von 1848 wurde ihnen das Recht zugestanden, sich in Wien niederzulassen, und im Jahr 1867 erhielten sie umfassende Bürgerrechte. In jenem Jahr lebten in Wien 6000 Juden. Bis 1936 wuchs die jüdische Bevölkerung der Stadt auf rund 180.000 Menschen, womit sie etwa ein Zehntel der Einwohner Wiens stellten. Unter den europäischen Hauptstädten hatten nur Warschau und Budapest einen höheren jüdischen Bevölkerungsanteil.
Der jüdische Anteil an der Wiener Bevölkerung und die Frage, inwieweit Kultur und Geistesleben der Stadt spezifisch »jüdisch« waren, sind eingehend untersucht worden. Der Historiker Steven Beller hat gezeigt, dass die Juden großen Einfluss auf einige Disziplinen hatten, darunter Psychoanalyse, Philosophie und Literatur (die Schriftsteller Roth und Zweig sind nur zwei Beispiele), während dies für andere Bereiche wie Wirtschaftswissenschaften und bildende Kunst weniger galt.17 Es gab vermögende jüdische Geschäftsleute, Industrielle und Bankiers, die in einem der prächtigen Ringstraßenpalais wohnten, aber sehr viel mehr Angehörige dieser Glaubensgemeinschaft lebten in tiefer Armut in überfüllten Unterkünften in der Leopoldstadt.
Es ist fast unmöglich, ein allgemeines Urteil über die Geschichte des Wiener Judentums zu fällen, ob es nun assimiliert war oder nicht. Auffällig ist jedoch, dass jüdische und nichtjüdische Angehörige der Wiener Mittel- und Oberschicht vom Wert der Bildung überzeugt waren, von jener Tradition, die ihren Ursprung in der Weimarer Klassik des späten 18. Jahrhunderts hatte. Diese Tradition rückte die geistige Vervollkommnung in den Mittelpunkt und gab dem persönlichen intellektuellen Wachstum den Vorzug vor dem Erwerb von Reichtum oder weltlichem Status – allerdings gelang es vielen der in diesem Buch behandelten Wiener, alle drei Ziele zu erreichen. Die Weimarer Klassik wurde insbesondere mit den Dichtern Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller verbunden, die in Wien ebenso große Verehrung genossen wie im übrigen deutschen Sprachraum.
Das protestantische Preußen und die norddeutschen Staaten hatten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Vorreiterrolle in der Bildung übernommen. Österreich und insbesondere Wien hinkten der Entwicklung zunächst hinterher, aber ab den 1840er Jahren begann die Hauptstadt des Habsburgerreichs, die Rivalen im Norden an Begeisterung für die Werte der Bildung zu übertreffen. Im Lauf der Zeit wurden Unterschiede zwischen der norddeutschen und der wienerischen Vorstellung von Bildung erkennbar, die schließlich konkurrierende intellektuelle Traditionen hervorbrachten.
Das Ideal des »Bildungsbürgers« hing in Deutschland mit dem Klassenbewusstsein und der Vorstellung von angeborener Intelligenz zusammen. Die Bildung wurde oft als Prozess der Selbstverwirklichung betrachtet: Ein Mensch fand seine individuelle Begabung und drückte sie aus, und diese Begabung war ein Produkt der Zucht. Hingegen entwickelte sich in Wien ein sehr viel demokratischeres Bildungskonzept. Die Wiener glaubten, der Intellektuelle sei in erster Linie das Produkt von Bildung und Erfahrung. Daher war die Bildung in Wien unabhängig von den scheinbar unveränderlichen ethnischen, gesellschaftlichen, religiösen und Geschlechterhierarchien des 19. Jahrhunderts leichter zugänglich für jene, die nicht den für die Bildung vorherbestimmten Gruppen angehörten. Das kam zum Beispiel Juden, Protestanten und später Frauen zugute. Der Historiker David Luft hat das österreichische Bildungskonzept als »säkulare, emanzipatorische Vision« mit beinahe religiösen Zügen bezeichnet.18
Im Verlauf der revolutionären Erhebungen in Österreich im Jahr 1848, die von März bis Oktober dauerten, taten sich die Studenten an der Universität Wien als entschiedene Gegner der alten Ordnung hervor und riefen nach einem Ende der seit dem Mittelalter bestehenden kirchlichen Kontrolle über Bildung und Lernen. Die neue liberale Ära ging mit einem klaren Bekenntnis zur freien und offenen Forschung einher. Einer der führenden Köpfe jener Studentenbewegung, der Kunsthistoriker Rudolf Eitelberger, erklärte im September 1848: »Die Haltung, welche die Universität in den Märztagen einnahm, ist Teil einer der berauschendsten Epochen der österreichischen Geschichte. […] [D]as alte Österreich fiel, und die neue Ära mit ihren Hoffnungen und Wünschen, ihrer Begeisterung und Leidenschaft brach sich umso kraftvoller Bahn.«19
Der Neoabsolutismus bekämpfte den revolutionären Geist von 1848, aber der intellektuelle Staatsapparat wurde Schritt für Schritt reformiert, und sei es auch nur, um den Revolutionären den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Universitäten verloren ihre aus dem Mittelalter überkommenen Privilegien und verwandelten sich in staatliche Einrichtungen. Es wurden Lehrstühle und Abteilungen für neue Disziplinen wie Physiologie, Geografie und Physik eingerichtet.20 Der Staat verankerte das für die Bildung grundlegende Bekenntnis zur Freiheit der Lehre in der liberalen Verfassung vom Dezember 1867. In Artikel 17 des Grundgesetzes wurde die Freiheit »der Wissenschaft und ihrer Lehre« festgeschrieben. Damit war der Grundstein für die Emanzipation von Lehre und Bildung von der Kirche gelegt. Entsprechend garantierte Artikel 14 die »volle Glaubens- und Gewissensfreiheit« für »jedermann«.
Im Jahr 1868 wurde der katholischen Kirche die Aufsicht über die öffentlichen Schulen entzogen. In der Folge sank die Zahl der in den Sekundarschulen tätigen Kleriker deutlich. Im Jahr 1861 gehörten 62 Prozent der Lehrer in den österreichischen Gymnasien katholischen Orden an; bis 1871 schrumpfte dieser Anteil auf 36 Prozent.21 Zu der spezifisch wienerischen Vorstellung von Bildung gehörte die unerschütterliche Überzeugung, dass sie ein öffentliches Gut war, und die liberalen Regierungen der 1860er und 1870er Jahre trieben die allgemeine Bildung in Österreich so rasant voran wie in kaum einem anderen Land Europas im 19. Jahrhundert. Für alle Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren wurde eine verpflichtende kostenlose und säkulare Grundschulbildung eingeführt. Die Lehrbücher wurden auf allen Ebenen vereinheitlicht, um allen Kindern dasselbe Wissen zu vermitteln, und viele dieser Bücher wurden von den führenden Köpfen des Reichs verfasst, darunter vom Physiker Ernst Mach. Die Zahl der Gymnasien sowie der eher auf technische Ausbildung und berufliche Bildung konzentrierten Realschulen vervierfachte sich zwischen 1851 und 1910 von 101 auf 432, womit die Ausweitung des Bildungssystems das Wachstum der österreichischen Bevölkerung deutlich überstieg.22 Ab den Achtzigerjahren ging der Staat sogar dazu über, den Zugang zur Sekundarschulbildung zu beschränken, um »die Jugend aus der unteren Mittelschicht davon abzuhalten, Fachberufe und Beamtenkarrieren anzustreben, in denen nur für wenige Platz war«.23
Eine bedeutsame Auswirkung der allgemeinen Schulbildung war, dass auch die Zahl der Studienanfänger stieg. Bis 1860 war Österreich ein Nachzügler in der Hochschulbildung gewesen, aber zur Jahrhundertwende nahm es eine Führungsrolle ein. Im Jahr 1900 studierten 1,06 Prozent der österreichischen Bevölkerung zwischen 20 und 24 Jahren an einer Universität oder einer anderen Hochschule. In Italien studierten 1,02 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe, in Frankreich 0,92 Prozent, in Deutschland 0,89 Prozent und in Großbritannien lediglich 0,79 Prozent. Nur in der Schweiz war der Anteil mit 1,40 Prozent höher als in Österreich.24
Wie wir sehen werden, war der Besuch des Gymnasiums an sich noch keine Gewähr für intellektuelle Vervollkommnung, geschweige denn für Bildungserfolge. Aber indem die liberalen Reformer alles taten, um den Zugang zu erleichtern und möglichst vielen Menschen die Vorzüge des Lernens nahezubringen, trugen sie entscheidend zur außergewöhnlichen intellektuellen Blüte und zur Entfaltung des kulturellen Talents im goldenen Zeitalter Wiens bei. Der Anteil der Bevölkerung, der in den Genuss einer hochwertigen Ausbildung an der Universität Wien gelangte, blieb offenkundig sehr gering, aber er war groß genug, um viele Familien dazu zu bewegen, den Besuch einer Hochschule für ihre Söhne und später auch Töchter zumindest in Erwägung zu ziehen.
Die Idole der Bildung
In Wien waren die Idole der kontinentaleuropäischen Aufklärung Deutsche, die sowohl im übertragenen als auch im buchstäblichen Sinn allgegenwärtig im Leben der Wiener Jugend waren. Sehen wir uns eine Impression aus der Kindheit des Architekten Richard Neutra an, der in seiner Autobiografie Life and Shape schrieb:
Meine älteren Brüder […] bewohnten ein Zimmer, das unseren ungebildeten Eltern große Ehrfurcht einflößte. In ihrem Zimmer stand »der Bücherschrank«, auf dem ein Globus stand, und auf einem Brett standen weitere Bücher; die gegenüberliegende Wand zierten kleine Gipsbüsten Mozarts und Beethovens sowie Bronzebüsten Goethes und Schillers […], hinter den Glastüren des Bücherschranks fand man »das Lexikon«, eine mehrbändige Enzyklopädie. Mir wurde gesagt, es enthalte das gesamte Wissen der Welt.25
Das genannte Quartett – Mozart, Beethoven, Goethe und Schiller – genoss größere Hochachtung als alle anderen Größen der deutschen Kultur, wenn man vom Philosophen und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz absieht. Diese Vorbilder verkörperten durch ihre Dichtkunst und ihr musikalisches Genie eine säkulare, rationale und liberale Weltordnung, die sich über kleinlichen Nationalismus und religiösen Obskurantismus erhob. Später wurden auch Richard Wagner und Friedrich Nietzsche in diesem Pantheon aufgenommen. Es war eine beeindruckende, verlockende Vision, die dem Wiener Bürgertum und dem Habsburgerreich einen intellektuellen Bezugsrahmen gab, der von Generation zu Generation weitergereicht wurde und im Lauf der Zeit an Gewicht gewann. Noch in der Krise des Liberalismus lieferte Gustav Klimt mit seinem Beethovenfries einen extravaganten Ausdruck jener Vision: einen üppigen, sinnlichen Tribut an Richard Wagners Interpretation von Beethovens 9. Symphonie, der »Ode an die Freude«, einem Gedicht Schillers aus dem Jahr 1785. In seinem berühmtesten Bild, Der Kuss, nahm Klimt Bezug auf die Zeile in Schillers Gedicht: »Diesen Kuss der ganzen Welt«. Klimt malte den Beethovenfries im Jahr 1901, erstmals ausgestellt wurde der Bilderzyklus 1902 in einem Saal der Wiener Secession, wo er sich um die Skulptur eines halbnackten Beethovens des deutschen Bildhauers Max Klinger gruppierte. Bei einer privaten Besichtigung der Ausstellung von Klimt und Klinger dirigierte Gustav Mahler eine eigens für diesen Anlass arrangierte Version des Chors der »Ode an die Freude« für sechs Posaunen. Hier wurde ein Bildungsideal gefeiert, das auf der Verbreitung universeller Werte beruhte.
In der jüdischen Kultur nahm das Lernen einen zentralen Platz ein, weshalb sich die Juden leicht in die Wiener Bildungskultur einfügten. Sie nahmen seit jeher die religiösen Studien sehr ernst, und diese Einstellung übertrugen sie einfach auf das säkulare Lernen. »Wichtig war nicht so sehr eine religiöse Bildung«, schreibt Steven Beller, »sondern jede Form von Bildung, ohne die man tatsächlich ein Niemand war.«26 Es sollte hinzugefügt werden, dass eine gute Bildung für die jüdischen Zuwanderer der beste Weg zum wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg war. Insbesondere ein Medizinstudium versprach schon in relativ jungem Alter ein gutes Einkommen in einer Privatpraxis. Daher strömten die Juden in Wien in größerer Zahl als an jedem anderen Ort in die medizinische Fakultät.
Aber die besten Aussichten auf Assimilierung durch Bildung hatten Juden und andere Minderheiten, wenn sie die Gymnasien und Realschulen der Stadt besuchten. Daher kann es nicht überraschen, dass die jüdische Minderheit gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil in der Wiener Schülerschaft deutlich überrepräsentiert war (dasselbe galt im gesamten Habsburgerreich). Im Jahr 1910 war der Anteil der Sekundarschüler unter den Juden mehr als dreimal so hoch als in der katholischen Bevölkerungsmehrheit. Schon im Jahr 1875, zu einer Zeit, als nur ein Bruchteil der Bevölkerung jüdisch war, stellten die Juden fast ein Drittel der Gymnasiasten. Auch die slawische und die protestantische Minderheit waren in den Sekundarschulen überrepräsentiert: Die Protestanten wurden vor allem von den Realschulen angelockt, da sie besonders großes Interesse an Wissenschaft und Technik zeigten.
Ähnlich sah das Bild an den acht Universitäten Österreichs aus, nur dass das Phänomen dort noch ausgeprägter war. Im Jahr 1910 war der Anteil der Universitätsstudenten bei den Juden mehr als viereinhalb Mal höher als bei den Katholiken und zweieinhalb Mal höher als bei den Protestanten.27 Auf dem Höhepunkt der goldenen Ära – zwischen den 1870er Jahren und dem Jahr 1910 – stellten die Juden bis zu einem Fünftel der österreichischen Universitätsstudenten, und noch höher war ihr Anteil an der Studentenschaft der Universität Wien. Die hohe Präsenz ethnischer und religiöser Minderheiten an den Schulen und Universitäten des Habsburgerreichs blieb nicht unbemerkt und weckte bereits um die Jahrhundertwende beträchtliches Ressentiment bei der katholischen Bevölkerungsmehrheit.
Einige jüdische Familien konvertierten zum Protestantismus, der Religion der deutschen Aufklärung, oder vermieden es, ihre Religiosität zur Schau zu stellen. Der Besuch des Gymnasiums und der Universität Wien war gemessen an zeitgenössischen Maßstäben nicht allzu kostspielig, was breiten Bevölkerungskreisen Zugang zur Bildung gab und den Eindruck der sozialen Inklusion verstärkte. Bis zu einem Drittel der Studenten an den österreichischen Universitäten war vollkommen oder zur Hälfte von Studiengebühren befreit.28 Dennoch war einigen »assimilierten« jungen Juden bewusst, dass sie dazu neigten, sich in der Schule oder an der Universität mit den Angehörigen ihrer Glaubensgemeinschaft zusammenzutun, was ihnen stets das Gefühl gab, anders zu sein. Doch in der gebildeten Mittelschicht mischten sich Juden und Nichtjuden im Allgemeinen problemlos, selbst wenn sie aus den fernsten Winkeln des Reichs kamen. Die bevorzugte Zeitung dieser Mittelschicht war die altehrwürdige, seriöse Neue Freie Presse. Die Zeitung fiel im Januar 1939 dem Nationalsozialismus zum Opfer, bis sie 1946 wiederbelebt wurde.
Die assimilierten Wiener Juden und andere Minderheiten waren so fest in der Kultur der deutschen Aufklärung verankert, dass viele von ihnen die Augen vor der Tatsache verschlossen, dass dieser Pantheon von Dichtern, Komponisten und Autoren auch von Gruppen beansprucht werden konnte, die jene Werke vollkommen anders interpretierten, nämlich im Sinn eines deutschen Ethnonationalismus.29 Die Wiener Juden bezogen ihre Kenntnis der deutschen Kultur aus Büchern, weshalb es ihnen fast unmöglich war zu sehen, »dass das Deutschland im wirklichen Leben nicht Schillers Deutschland war«.30 So kam es, dass die Wiener bis zu einem gewissen Grad sich selbst als die eigentlichen Hüter der deutschen Hochkultur betrachteten.
Es wäre auch ein Irrtum zu glauben, dass es nur den assimilierten Juden schwerfiel zu erkennen, dass ihre deutsche Aufklärung von den Ethnonationalisten usurpiert worden war. Nehmen wir beispielsweise den Ökonomen Friedrich von Hayek, der katholischer Herkunft war, jedoch in derselben säkularen Tradition der Aufklärung erzogen worden war. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs schrieb er in dem Bemühen, seine Loyalität gegenüber seiner Wahlheimat Großbritannien unter Beweis zu stellen, an das neu gegründete Informationsministerium und machte der Behörde Vorschläge für wirksame »Propaganda in Deutschland«. Die »politischen Prinzipien des Hitler-Regimes«, erklärte Hayek, könne man am besten bekämpfen, indem man zeige, dass »heute Großbritannien und Frankreich die Grundsätze vertreten, die den großen deutschen Dichtern und Denkern, deren Namen den Deutschen immer noch heilig sind, am Herzen liegen«. Er empfahl, »nach Möglichkeit deutsche Quellen zu zitieren, um die Ideale zu erklären, für die Großbritannien und Frankreich kämpfen«.
Eine von Hayek genannte Quelle war die Schrift Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon, in der Friedrich Schiller die von Solon regierte athenische Republik freier Bürger mit dem autoritären Regime Lykurgs in Sparta verglichen hatte. Die Idee, Hitler-Deutschland mit Schillers Thesen zu beschallen, dürfte realitätsfremd auf die britische Regierung gewirkt haben, die Hayeks Vorschlag in einem freundlichen Brief ablehnte. Im Jahr 1939 war es zu spät für solche Feinheiten.31
Die Bildung eines Universalgelehrten
Die Werte der Aufklärung wurden den Abkömmlingen des Wiener Bürgertums in einem Bildungsprozess vermittelt, der kein formales »System«, sondern ein komplexes Geflecht aus offizieller, informeller und häuslicher Pädagogik war. Die Wiener Bildung war einzigartig und trug wesentlich zur Explosion des Talents in der Stadt bei.
Auf den ersten Blick ähnelte die bürgerliche Bildung in Wien der im übrigen deutschen Sprachraum. Jungen besuchten die Realschule, in der vor allem technische und wissenschaftliche Kenntnisse vermittelt wurden, oder das Gymnasium und studierten anschließend, wenn sie eine akademische Ausbildung anstrebten, drei oder vier Jahre an der Universität Wien, die zu jener Zeit die viertgrößte Hochschule in der Welt und die angesehenste in Europa war. Wer künstlerische Neigungen hatte, konnte die 1867 gegründete Kunstgewerbeschule des k. k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie besuchen. Diese fortschrittliche Institution, die offener für Studentinnen war als die Universität, bot eine Berufsausbildung in Bereichen wie Architektur an; zu ihren Absolventen zählten die Maler Gustav Klimt und Oskar Kokoschka und die Töpferin Lucie Rie.
Die Gymnasialbildung war im Wesentlichen klassisch: Griechisch, Latein, Deutsch sowie Geschichte und Geografie, Mathematik, Physik und Religion. An einigen Schulen konnte man auch Französisch und Englisch lernen. Der Unterricht war streng und anspruchsvoll: Die Schüler mussten bis zu acht Stunden in der Woche Latein studieren. Und zweifellos diente die Schulbildung der Disziplinierung.
Es war »nichts als ein ständiger gelangweilter Überdruss«, klagte der 1881 geborene Stefan Zweig später in seinen Memoiren Die Welt von Gestern. »Schule war für uns Zwang, Öde, Langeweile, eine Stätte, in der man die ›Wissenschaft des nicht Wissenswerten‹ in genau abgeteilten Portionen sich einzuverleiben hatte. […] Man saß paarweise wie die Sträflinge in ihrer Galeere auf niederen Holzbänken, die einem das Rückgrat krümmten, und saß, bis einem die Knochen schmerzten.«32
Das Auswendiglernen wurde übertrieben, und es gab kaum ein Gespräch zwischen den Schülern und ihren strengen und antiquierten Lehrern. Der Managementtheoretiker Peter Drucker erinnerte sich später an inkompetente Lehrer in seinem klassischen Gymnasium: »Die meisten langweilten ihre Schüler die meiste Zeit und sich selbst die ganze Zeit.«33 Sie verlangten, mit dem hochtrabenden Titel »Professor« angesprochen zu werden, ein Recht, das ihnen der Kaiser per Dekret zugestanden hatte.34 Es kann nicht überraschen, dass die Schulabbrecherquote hoch war: So schaffte es nur ein Drittel derer, die das Gymnasium besuchten, die acht Jahre durchzustehen und die als extrem schwierig berüchtigte Reifeprüfung – die Matura – abzulegen. Die Naturwissenschaften wurden vernachlässigt, der Sport galt als unnütz. Die Realschulen waren pädagogisch ein wenig fortschrittlicher, aber nur ein wenig.
Eine derart passive, entmündigende Schulbildung hätte niemals eine derart große Zahl wissbegieriger, brillanter Köpfe hervorbringen können – und sie tat es auch nicht. Die intellektuelle und kulturelle Elite der Stadt wurde hinter den eleganten Fassaden der Häuser entlang der Ringstraße geschult. Das galt insbesondere für die Naturwissenschaften. Die Bildung begann (und endete manchmal) in den Familien.
Die von vermögenden Familien wie den Wittgensteins ausgerichteten Musik- und Literatursalons waren in aller Munde. Weniger bekannt war, dass man in vielen der geräumigen Wohnungen der Wiener Mittel- und Oberschicht genauso viele Amateurzoos, Herbarien und Labore fand wie Schlaf- und Badezimmer. Der Physiker Karl Przibram erinnerte sich an seine Kindheit in dieser Umgebung:
In meinem Elternhaus herrschte der liberale Geist des gebildeten jüdischen Bürgertums, das einen unerschütterlichen Glauben an den Fortschritt hegte und für alle neuen Entwicklungen in Kunst und Wissenschaften offen war. […] Mein Vater, ein begabter Poet, hatte ein ausgeprägtes soziales Gewissen und interessierte sich sehr für die technischen Anwendungsmöglichkeiten der Naturwissenschaften. Er war an der Erfindung einer galvanischen Batterie beteiligt, die er Anfang der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts für die Beleuchtung unserer Wohnung nutzte.35
Der Sohn wollte seinem Vater nicht nachstehen und richtete sich ein eigenes häusliches Laboratorium ein, in dem er einige der elektrischen Experimente des Erfinders Nikola Tesla wiederholte, der selbst einst ein experimentierfreudiger Jugendlicher in einem anderen Teil des Habsburgerreichs gewesen war. Besondere Geduld verlangten die angehenden Naturforscher ihren Eltern ab. Um die Jahrhundertwende kam es in der deutschsprachigen Welt in Mode, in Privatwohnungen immer größere Aquarien und Terrarien zu bauen, die teilweise von fünfjährigen Kindern betreut wurden. Der erste Verein von Aquarien- und Terrarienbesitzern war im Jahr 1882 in Gotha gegründet worden, und im Jahr 1911 gab es 284 derartige Zusammenschlüsse. In Österreich wurde im Jahr 1895 der erste Verein gegründet.
Die berühmtesten Wiener Biologen und Zoologen hatten in ihren Anfängen allesamt Tiere in ihren Elternhäusern gehalten. Karl von Frisch und Konrad Lorenz gewannen 1973 gemeinsam mit einem dritten Forscher den Nobelpreis für Physiologie beziehungsweise Medizin. Frisch hatte im Vorschulalter einen kleinen Zoo in seinem Schlafzimmer gehabt, während Lorenz als Junge im Garten (sowie in den Räumen) des Sommerhauses seiner Eltern im niederösterreichischen Altenberg ein außergewöhnliches Sortiment von Tieren hielt. Als Erwachsener erklärte sich Lorenz gerne bereit, einige der Tiere bei sich aufzunehmen, mit denen nach dem Zweiten Weltkrieg der Wiener Zoo wieder aufgebaut werden sollte. So kam es, dass in einem Käfig in seinem Studierzimmer ein Tiger auf und ab trottete. Ein weiterer vorübergehender Bewohner des Hauses war ein Nilpferdbaby, ein Vorfahr jenes Tiers, das heute im Wiener Zoo zu sehen ist.36
Oder nehmen wir den Biologen Paul Kammerer. Geboren im Jahr 1880, hielt er als Halbwüchsiger in der elterlichen Wohnung am Karlsplatz Exemplare von mehr als 200 Spezies. Seine Leidenschaft hatte mit den üblichen Tieren – Meerschweinchen und Eichhörnchen – begonnen, doch bald gesellten sich zwei große amerikanische Alligatoren, tropische Schildkröten, Australische Schlangenhalsschildkröten, Salamander, verschiedenste Frösche (darunter zwei aus Singapur importierte Spezies, die Ersten ihrer Art in Europa) sowie eine große Sammlung ausgestopfter und präparierter Tiere einschließlich eines Nilkrokodils und 3400 Insektenarten dazu. Es ist nicht bekannt, wie groß die Wohnung der Kammerers genau war, aber die Bestände seiner Sammlung wurden von dem Forscher selbst und von beeindruckten Journalisten detailliert erfasst. (Vermutlich wurden die Reporter von skeptischen Chefredakteuren entsandt, um seine unglaublich klingenden Angaben zu überprüfen.)37
Kammerer verdankte es wahrscheinlich seinem Vater, dass er all diese Tiere versorgen konnte. Karl Kammerer, der aus einer assimilierten jüdischen Familie stammte, war ein wohlhabender Unternehmer, dessen Firma optische Instrumente erzeugte, die an Observatorien und andere wissenschaftliche Einrichtungen in aller Welt verkauft wurden. Es ist anzunehmen, dass er seinem Sohn Paul beim Bau der Glastanks und Käfige half, welche die Alligatoren daran hinderten, die Nachbarschaft zu terrorisieren. Für die Zukunft der biologischen Forschung war Kammerers häuslicher Zoo bedeutsam, weil Paul schon in sehr jungem Alter beginnen konnte, mit der Umwelt seiner Tiere zu experimentieren. Er beheizte die Käfige und entwickelte ein Belüftungssystem, um die Umgebungsluft regelmäßig zu erneuern. Dies waren seine »ersten schüchternen Versuche«, die Umwelt seiner Schützlinge zu verändern und zu regulieren, um »ihre Lebensbedingungen und vielleicht auch die Lebensformen selbst indirekt zu beeinflussen«.
Auch jene jungen Wiener, die nicht zu Nobelpreisträgern in Zoologie oder Physiologie heranwuchsen, begeisterten sich für Wissenschaft und Experimente. Beispielsweise wuchs Hayek umgeben von der riesigen botanischen Sammlung seines Vaters auf, die aus lebenden und getrockneten Pflanzen, Fotos und Drucken bestand. Dazu kam ein Herbarium von vielleicht 100.000 Blättern. Hayeks Vater war Arzt beim Wiener Gesundheitsamt, aber seine große Leidenschaft galt der Botanik, was ihm eine unbezahlte Professur an der Universität einbrachte. Er stieg jeden Morgen in ein Eisbad, um Geist und Körper in Gang zu bringen, und nahm seinen Sohn regelmäßig zu den Treffen der Zoologischen und Botanischen Gesellschaft mit. Alle zwei Wochen fand in der Wohnung der Familie Hayek ein informelles Treffen von Wissenschaftlern statt; das Hauptthema waren die neuesten Entwicklungen in der Botanik.38 Es kann nicht überraschen, dass der junge Friedrich, der eine eigene Insekten- und Pflanzensammlung aufbaute, darüber nachdachte, ebenfalls Botaniker zu werden. Es wirkte sich zweifellos auf seine spätere Arbeit auf dem Gebiet der Ökonomie aus, dass er frühzeitig mit der Methode der wissenschaftlichen Forschung vertraut gemacht worden war.39 Seine beiden Brüder wurden Professoren für Anatomie beziehungsweise Botanik.
In der formalen Bildung war die Pädagogik an der Wiener Universität oft ebenso konservativ wie in den Gymnasien. Doch die Universität machte dies durch verschiedene Vorzüge wett. Zunächst einmal ermöglichte sie eine umfassende intellektuelle Erkundung: Nach bestandener Aufnahmeprüfung konnten die Studenten nach Belieben Vorlesungen belegen, um sich schließlich auf ein Studienfach festzulegen, in dem sie ein Diplom erwerben wollten. So hatten die Studenten viel Zeit, Professoren zu finden, die sie interessierten und inspirierten.
Wie andere Universitäten in den deutschsprachigen Ländern hatte auch die in Wien nur vier Fakultäten: Medizin und Anatomie, Theologie, Recht und Philosophie (ab 1900 die größte Fakultät). Die meisten anderen Disziplinen gingen in einer der zuletzt genannten Fakultäten auf, weshalb die interdisziplinären Grenzen durchlässig waren, sofern sie überhaupt existierten. Beispielsweise wurden die Wirtschaftswissenschaften an der juridischen Fakultät unterrichtet, und die Naturwissenschaften gehörten zur philosophischen Fakultät. Es wurden keine willkürlichen Grenzen zwischen »Naturwissenschaften« und »Geisteswissenschaften« gezogen: Sie gehörten allesamt zur »Philosophie« im reinsten Sinn, zum Studium der grundlegenden Fragen des Lebens. Die Studierenden waren dazu angehalten, ihre eigene Epistemologie zu entwickeln, und die Absolventen der Universität taten dies ihr Leben lang.
Nehmen wir erneut das Beispiel Hayeks. Wie wir gesehen haben, wurde er zu Hause zum botanischen Fachmann ausgebildet. Anschließend machte er einen Abschluss in Rechtswissenschaften und erwarb einen Doktortitel in Politikwissenschaft, verbrachte den Großteil seiner Zeit jedoch mit dem Studium der Psychologie und verwandelte sich schließlich in einen maßgeblichen Ökonomen. Später erinnerte er sich: »Entscheidend war einfach, dass nicht von dir erwartet wurde, dich auf dein eigenes Thema zu beschränken. […] Nominell studierte ich Recht, aber ich hatte genug Zeit, um von Fach zu Fach zu wechseln und mir auch Vorlesungen über Kunstgeschichte oder antikes griechisches Theater anzuhören.«40
Eine solche Bildung war geeignet, außergewöhnliche Universalgelehrte hervorzubringen. Hayek schrieb über Ökonomie, Psychologie, Politikwissenschaft, politische Theorie und mehr. Doch seine Fachkenntnisse waren verglichen mit denen einiger seiner Wiener Zeitgenossen begrenzt. Da war zum Beispiel der 1901 geborene Biologe Ludwig von Bertalanffy, der Begründer der Allgemeinen Systemtheorie. Auch er hatte in seinem Elternhaus ein kleines Laboratorium und einen Seziertisch. Ein Nachbar – ein gewisser Paul Kammerer – hatte sein Interesse an Zoologie und Biologie geweckt. Bertalanffy spezialisierte sich zunächst auf diese Disziplinen, weitete seine Forschungsgebiete im Lauf der Zeit jedoch auf sämtliche Naturwissenschaften sowie auf die Medizin aus und leistete wichtige Beiträge zu Biophysik, Psychiatrie und Krebsdiagnose. Im Lauf seines Lebens veröffentlichte er mehr als 250 Artikel und wissenschaftliche Beiträge und schrieb auch über Mathematik, Wissenschaftsphilosophie … und die Ursprünge der Post im Italien der Renaissance.
Bertalanffy versuchte, die gemeinsamen Grundprinzipien zu entdecken, die in den verschiedenen Untersuchungsgebieten am Werk waren. Seine Allgemeine Systemtheorie beruhte auf der Überzeugung, alle komplexen Systeme hätten bestimmte Prinzipien gemein, die mathematisch dargestellt werden könnten. Einige Historiker sind der Meinung, dieses integrierende Denken sei aufgrund der besonderen Bedingungen in Österreich-Ungarn zu einem Merkmal der Wiener Intellektuellen geworden. »Nirgendwo anders in Europa«, schreibt der Historiker William M. Johnston, »trafen täglich derart widersprüchliche Werte und Standpunkte aufeinander wie in den Straßen Wiens, Prags und Budapests. Die Unvereinbarkeit der erkennbaren Kräfte bewegte die Denker dazu, in ihren Vorstellungen zu synthetisieren, was in den äußeren Ereignissen nicht zusammenhing. […] Eben die Unfähigkeit des österreichischen Reichs, einen raison d’être zu finden, trieb seine Intellektuellen dazu, inmitten der Vielgestaltigkeit nach Einheit zu suchen.«41
Ein intellektuelles Hinterland
Die Studenten mussten sich nicht nur mit vielfältigen Themen beschäftigen, sondern waren auch von ungewöhnlich vielen Personen umgeben, von denen sie lernen konnten. An der Universität Wien unterrichteten neben relativ wenigen fest angestellten Professoren (Ordinarien), mit denen die Studenten kaum Kontakt hatten, zahlreiche Privatdozenten, Personen mit einem höheren Studienabschluss, die zumeist direkt von den Studenten bezahlt wurden, jedoch nicht zum festen Mitarbeiterstab der Universität gehörten. Viele gefeierte Wissenschaftler, darunter zeitweilig Sigmund Freud und der Ökonom Ludwig von Mises (während seiner gesamten Zeit in Wien), waren so wie Bertalanffy Privatdozenten.
So lernten die Studenten von den brillantesten Köpfen in der Stadt, und die Gelegenheitsdozenten konnten ihr Ansehen erhöhen und Anhänger um sich sammeln – oder nicht. Kurt Gödel, der angesehenste Mathematiker der Zwischenkriegszeit, erhielt keine Anstellung an der Universität, weshalb er gezwungen war, als Privatdozent zu unterrichten. Es war keine beglückende Erfahrung für ihn. Der nervöse Gödel, der später phasenweise unter psychischer Instabilität leiden sollte, stand stets mit dem Rücken zum Hörsaal an der Tafel und sprach so schnell, dass er sogar seine begeisterten Studenten ratlos zurückließ. Anfangs drängten sich die Studenten im Vorlesungssaal, doch am Ende des Semesters war nur noch ein einziger Hörer übrig, ein unbeugsamer polnischer Logiker. Das Honorar für Gödels gesamte Lehrtätigkeit reichte aus, um zwei Glas Bier zu bezahlen.42
Doch im Allgemeinen hatte dieses System des Privatunterrichts eine Reihe von Vorteilen: Es verwischte die Grenzen zwischen der Universität und anderen offiziellen Bastionen des Wissens und dem weitläufigen Hinterland der Wissensproduktion. Die Privatdozenten leiteten oft ihr eigenes Seminar oder einen »Kreis«, der normalerweise anregender war als die Vorlesungen an der Universität. Namhafte Beispiele waren die 1902 ins Leben gerufene Psychologische Mittwoch-Gesellschaft Sigmund Freuds (die sich später in die Psychoanalytische Vereinigung verwandelte) und das 1920 gegründete Privatseminar von Mises, die Keimzelle der »Österreichischen Schule«. Für viele Teilnehmer war der Besuch der Privatseminare und Kreise die prägende intellektuelle Erfahrung ihres Lebens.
Viele Privatdozenten hielten auch in Stammcafés Hof, normalerweise zu einer feststehenden Tageszeit und teilweise sogar an einem bestimmten Tisch. Dasselbe galt für andere Personen, die intellektuelles Ansehen genossen, darunter Architekten wie Loos, Schriftsteller, Journalisten und angehende Revolutionäre wie der junge Leo Trotzki. Ein Abend im Café Central, im Landtmann oder im Prückel konnte ebenso lehrreich sein wie ein Vormittag an der Universität oder ein Nachmittag im Privatseminar. Stefan Zweig saß jeden Tag stundenlang in seinem Stammcafé, dem Café Beethoven in der Universitätsstraße, wo er sich über die neuesten Entwicklungen in Kunst, Philosophie und Literatur auf dem Laufenden hielt.43
Am Abend konnte man ins ebenfalls lehrreiche Kabarett gehen, wo sich Bohemiens, Arme und Prostituierte mit unkonventionellen Vertretern des liberalen Wien mischten. Dichter und Künstler wie Kokoschka stellten in den Pausen zwischen den Auftritten von Kabarettisten, die sich über selbstgerechte Politiker und Kirchenmänner lustig machten, ihre neuen Arbeiten vor. Viele Wiener, darunter Lang und Gruen, verbrachten in ihrer Jugend viel Zeit im Kabarett. Gruen war ein Mitglied des Politischen Kabaretts, einer Theatergruppe, die mit Situationskomik das verhasste aristokratischklerikale Establishment verspottete. Der polemische Satiriker Karl Kraus produzierte zwischen 1899 und 1936 fast im Alleingang 922 Ausgaben seiner Zeitschrift Die Fackel, in der er Unternehmer, Politiker, Journalisten und Kirchenmänner mit beißendem Spott überhäufte und eine brillante Prosa mit seinen berühmten Aphorismen mischte. Zu seinen bevorzugten Opfern gehörten auch die seriöse Presse und die neuesten Moden, weshalb er in Wien genug Stoff fand. Die Lektüre von Kraus war an sich eine wertvolle Lernerfahrung.44
Eine wirklich wienerische Bildung war also gleichermaßen formal und nicht formal, ein buntes Mosaik von Lehrmethoden und »Lehrern« im weitesten Sinn des Wortes.45 Auch respektierte und förderte diese Art des Wissenserwerbs den Austausch zwischen Arbeits- und akademischer Welt sowie die gegenseitige Befruchtung der Disziplinen. Die Wiener Bildung war kaum systematisch, aber zweifellos war sie umfassend; die lähmende Spezialisierung lag noch in der Zukunft. Diese außergewöhnliche intellektuelle Erziehung war auch organisch, entsprang sie doch vielfältigen Initiativen: imperialen, nationalen und privaten.46
Das Symbol für die »Welt von Gestern«: Kaiser Franz Joseph pflichtbewusst an seinem Schreibtisch. Zeichnung von Wilhelm Gause, um 1910.
Die Drastik der Grußkarte sollte keinen Zweifel lassen: Das »goldene Wien« pflegte sein Image als Stadt der Genießer. Fotomontage, um 1905.
Ernst Mach, der herausragende Vertreter der wissenschaftlichen Kultur Wiens im Fin de Siècle, um 1910.
Fortschrittlich und offener für Studentinnen als die Universität Wien: die 1867 gegründete Kunstgewerbeschule. Die Aufnahme der Fotografin Marianne Bergler, die 1938 in die USA emigrieren musste, zeigt die Vorbereitungen zu einem Künstlerfest, um 1930.
Unterhaltung mit Witz und Intelligenz: Fritz Grünbaum feierte im August 1927 zusammen mit seinen »Girls« den Erfolg der Revue »Hallo! Hier Grünbaum!« am Boulevard-Theater in der Annagasse 3.
Umstrittener Reformer: Gustav Mahler, der 1897 Wilhelm Jahn als Direktor der Hofoper nachfolgte, sah sich immer wieder heftigen Angriffen der antisemitischen Presse ausgesetzt. Karikatur von Theodor Zasche.
Setzte mit Filmen wie »Die Nibelungen« und »Metropolis« neue ästhetische und technische Maßstäbe: Fritz Lang, um 1928.
Ein eigenständiger »wienerischer Stil« eroberte die Mode: Mäntel, Muffs und Röcke, inspiriert von der Wiener Werkstätte, präsentiert auf der Albertina-Rampe. Foto von Dora Kallmus (Madame d’Ora), um 1914.
Komfortable Erweiterung der öffentlichen Sphäre: das Café des Grand Hotels am Kärntner Ring, um 1910.
Ein Sommer fern von Wien: Stefan Zweig und Joseph Roth im Juli 1936 in Ostende.
Finanzierte 1903 die Gründung der Wiener Werkstätte: der Textilindustrielle Friedrich »Fritz« Waerndorfer. Nach dem Konkurs 1913 emigrierte er mit seiner Familie in die USA.
Idol der Wiener Fußballwelt und Kapitän des »Wunderteams«: der »Papierene« Matthias Sindelar (Mitte) beim Länderspiel gegen Ungarn am 30. April 1932 in Budapest (1:1).
Künstlerisch aufgeladene Erotik I: Das zweite Programmheft des 1907 gegründeten Cabaret Fledermaus, Kärntner Straße 33. Lithografie von Moriz Jung, 1907.
Künstlerisch aufgeladene Erotik II: Arthur Schnitzler wurde von Sigmund Freud als »Kollege« in der Erforschung der »unterschätzten und oft verteufelten Erotik« gesehen. Das Foto zeigt den Skandaldichter 1931 mit der Schauspielerin Elisabeth Bergner.
Gustav Klimt bei einem Künstlerfest der Familie Primavesi, 1916. Der katholische Bankier Otto Primavesi war einer der wichtigsten Förderer des Wiener Jugendstils.
Wien, die Naturwissenschaften und die literarische Moderne
Die Naturwissenschaften beherrschten das geistige Leben Wiens. Die Konzentration auf die Naturwissenschaften war typisch für die Wiener Mittelschicht, insbesondere für die assimilierten Juden – eine Tatsache, die oft nicht angemessen berücksichtigt wird. Im Jahr 1847 war die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften gegründet worden, und im folgenden Jahrzehnt entstanden weitere ähnliche Einrichtungen. Forscher auf fast allen Gebieten unternahmen internationale Expeditionen.47 Die Wissenschaften, vor allem Medizin und Naturwissenschaften, nahmen einen zentralen Platz in der intellektuellen Produktion der Stadt ein.48 Die herausragenden Vertreter dieser wissenschaftlichen Kultur waren Ernst Mach und Ludwig Boltzmann, wobei der Erste sehr viel größere Bedeutung hatte.
Mach, der im Jahr 1838 in Brünn zur Welt gekommen war, leistete wesentliche Beiträge zur Physik. Seine Arbeit zu den Schockwellen, die er 1886 erstmals fotografierte, war bahnbrechend. Das Maß der Geschwindigkeit eines Körpers im Verhältnis zur Schallgeschwindigkeit trägt seinen Namen; weniger bekannt sind der Mach-Krater und der nach ihm benannte Asteroid. Zu einem Helden für Forscher, Philosophen und Schriftsteller wurde er jedoch durch seinen Einsatz für ein modernes, wissenschaftliches Weltbild. Er wurde zum Inbegriff des geistig rastlosen Wien.
Nach einer Professorenkarriere an der Prager Karl-Ferdinand-Universität wurde Mach im Jahr 1895 von der Universität Wien als erster Physiker auf einen europäischen Lehrstuhl für Philosophie berufen. Als Professor für diese provokante Mischung von Disziplinen gründete Mach das vollkommen neue Forschungsgebiet der Wissenschaftsphilosophie. Albert Einstein, der häufig mit Mach aneinandergeriet, schrieb über ihn: »Ich glaube, dass denen, die sich als Gegner Machs betrachten, kaum bewusst ist, dass auch sie ungeheuer viel von Machs Denkweise mit der Muttermilch aufgesaugt haben.«
Mach hatte wahrscheinlich den größten Anteil an der Entstehung einer eigenen Wiener intellektuellen Tradition innerhalb der deutschsprachigen Welt.49 Der energiegeladene Mach, der einen dichten, langen Vollbart trug und seine Umgebung mit tiefliegenden, durchdringenden Augen studierte, führte von seinem Lehrstuhl aus einen Krieg gegen die Metaphysik des deutschen Idealismus, der zu jener Zeit die Philosophie im nördlichen Europa beherrschte. Seine Haltung hatte großen Einfluss auf die geistige Entwicklung Wiens. Mach grenzte den strikt wissenschaftlichen Zugang, der in Wien über sämtliche Disziplinen hinweg entwickelt wurde, gegen die in seinen Augen oft unverständliche und epigrammatische Ausrichtung des deutschen Idealismus ab, den er als »Pseudowissenschaft« bezeichnete. Eine abfälligere Bezeichnung gab es im Wiener Lexikon nicht.





























