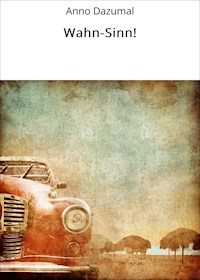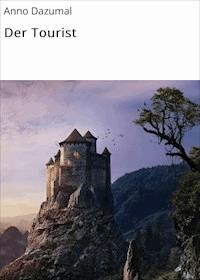Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman aus der Sicht der Täter, der aufzeigt, woher der Haß kommt und wozu er letztendlich führen kann, wenn niemand den Angreifern energisch entgegentritt und ihrem brutalen Wirken Einhalt gebietet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anno Dazumal
Sturm auf Deutschland
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die Attacken
Das neue Leben
Die Entdeckung
Die Flucht
Die Entführungen
Das Ende
Nachwort
Impressum
Die Attacken
„Und?“ fragte die Mutter erwartungsvoll, als Wolfgang die Küche betrat. „Wieder nichts“, antwortete er und ging auf sein Zimmer. Er dachte gar nicht daran, seiner Mutter die Wahrheit zu sagen. Nämlich, daß er überhaupt nicht beim Vorstellungsgespräch gewesen war, sondern sich statt dessen mit seinen Kumpels im Park getroffen hatte. Schon zu oft hatte man ihn zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, ihm dann aber abgesagt. Er glaubte auch zu wissen warum. Wegen seiner Glatze. So unglaublich es klang: Wolfgang, ein überzeugter Nazi, hatte mit der Intoleranz vieler Leute zu kämpfen. Welche Firma konnte es sich schon leisten, einen Rechtsradikalen einzustellen? Was Wolfgang störte war die Tatsache, daß man ihn vorverurteilte. Sobald er ein Büro betrat, spürte er schon, daß man ihn nicht einstellen würde. Nun saß er in seinem Zimmer und hörte Musik. Natürlich deutsche Musik! Momentan lag die CD „Kampf“ der Gruppe „Heil“ im CD-Player. Begeistert sang Wolfgang beim Lied „Arierblut“ mit: „Arierblut, rein und gut, voll von Siegeswillen und Mut, sehen wir die ganze Ausländerbrut, packt uns sofort die kalte Wut.“ Plötzlich kam seine Mutter zur Tür herein. „Mach die Musik leiser!“ schrie sie. „Was?“ rief Wolfgang. Da zog sie einfach den Stecker heraus. „Spinnst Du!“ schimpfte Wolfgang. „Von der Firma Becker ist gerade ein Anruf gekommen. Die wollten wissen, warum Du nicht zum Vorstellungsgespräch erschienen bist.“ Wolfgang erblaßte. „Ich hatte keine Lust“, erklärte er. Auf einmal flippte seine Mutter aus. „Keine Lust, keine Lust! Glaubst Du etwa mir macht es Spaß, den ganzen Tag den Dreck der Leute und der Hunde wegzuwischen? Aber irgendwie muß ich halt auch was verdienen, damit wir nicht unter den Brücken leben müssen. Und was machst Du? Treibst Dich den ganzen Tag mit Deinen Kumpanen herum, ziehst von einer Kneipe zur nächsten und schimpfst über die Ausländer und die Asozialen. Schau Dich doch mal an! Du gehörst auch zu ihnen!“ Wolfgang wurde wütend: „Nenn mich nicht einen Asozialen! Ich liebe mein Land! Außerdem werde ich Dir beweisen, daß ich auch Geld verdienen kann.“ Er stand auf und ging.
„Na, wieder Ärger zuhause?“ erkundigte sich Alfred. „Wie immer“, murmelte Wolfgang. „Stellt Euch vor: Sagt meine Mutter doch tatsächlich, ich wäre asozial.“ „Sollen wir mal mit ihr reden?“ wollte Helmut wissen und zog sein Messer hervor. „Nein. Dazu ist es noch zu früh. Ich habe ihr versprochen, daß ich heute abend Geld nach Hause bringe.“ „Na dann, an die Arbeit!“ rief Berthold und erhob sich. Zwei Straßen weiter brach Karl einen Zigarettenautomaten auf, während die Anderen Schmiere standen. „Lungenkrebs sei Dank!“ entfuhr es ihm, als er das Geld zählte. 300 Mark! 100 bekam Wolfgang, um seine Mutter „ruhigzustellen“, der Rest ging in die „Reichskasse“. Man hätte dazu genauso gut Saufkasse sagen können, jedoch hörte sich „Reichskasse“ natürlich viel deutscher an. Dann ging es auf in das Frankfurter Nachtleben. Wenige Stunden später marschierte die ganze Truppe lallend den Main entlang. Erst gegen vier Uhr morgens kam Wolfgang nach Hause.
„Wo hast Du das Geld her?“ fragte Wolfgangs Mutter, als ihr ihr Sohn lallend mit einem Hundertmarkschein entgegenkam. „Das hab ich mir verdient“, tönte jener. „Behalt es. Ich will Euer kriminelles Geld nicht“, entschied Frau Laschke. „Was heißt hier kriminelles Geld!“ empörte sich Wolfgang. „Hältst Du uns etwa für Verbrecher?“ „Wer für sein Geld nicht arbeitet, holt es sich mit krummen Touren“, stellte seine Mutter fest. „Na gut“, lallte der Junge, „dann kommt es halt in die Reichskasse.“ „Und Du kommst bald ins Gefängnis, wenn Du so weitermachst“, prophezeite seine Blutsverwandte. „Ha ha ha. Als ob die deutsche Polizei ihre besten Freunde einsperren würde!“ lachte Wolfgang.
Sie waren eine Gruppe von neun Leuten. Alfred, der „Führer“, Helmut, Ernst, Wolfgang, Karl, Berthold, Hans, Steffi und Anke. Gemeinsam lungerten sie in der Stadtmitte Frankfurts herum, wo sie Ausländer beschimpften, Bier soffen, Passanten anpöbelten und rechte Lieder und Parolen von sich hören ließen. Geld besorgten sie sich durch „Automaten öffnen“, Überfälle, Einbrüche und Diebstähle. Gerade, als sie wieder in bester nationalistischer Laune waren, kam ein dunkelhäutiger Mann vorbei. „Hey Neger husch, husch, husch - verschwinde in den Busch! Wir hassen Polen, Tschechen, Neger - und langhaarige Bombenleger!“ riefen sie, wobei einige Leute stehenblieben und die Schreihälse betrachteten. „Was glotzt Ihr denn so blöd!“ provozierte Alfred. „Noch nie Deutsche gesehen?“ Einige alte Männer gesellten sich zu ihnen. „Recht habt Ihr“, lobte einer. „Dieses Ausländerpack muß raus aus Deutschland.“ „Du sagst es, Kumpel“, stimmte Alfred zu und gab dem „Glaubensbruder“ eine Dose Bier. Danach tranken die Beiden Brüderschaft. „In meinem Haus leben verdammt viele Kanacken. Wird Zeit, daß die verschwinden“, erzählte der alte Mann. Alfred überlegte: „Da ließe sich vielleicht etwas machen. Wo wohnst Du?“ „In der Arolserstraße“, antwortete Johann Simbeck. „Wir schauen in den nächsten Tagen mal vorbei“, erklärte Alfred bereitwillig. „Du, Opa! Wie war das eigentlich im Zweiten Weltkrieg?“ wollte Berthold wissen. Simbeck begann: „Am Anfang gehorchten alle dem Führer. Es war herrlich. Wir überrollten unsere Feinde. Die deutsche Armee war zweifellos die stärkste Armee auf der ganzen Welt. Aber mit der Zeit schlichen sich Verräter bei uns ein. Sie spionierten uns aus und verrieten unsere Geheimnisse dem Feind. Hätte ich damals einen von ihnen in die Finger bekommen, ich sage Euch, der hätte kein Wort mehr gesagt. Dann kam der schreckliche russische Winter. Nur deswegen haben wir den Krieg verloren. Die Russen waren diese Schweinekälte gewohnt, weil sie ja auch Schweine waren. Wir dagegen hatten große Probleme. Nach Stalingrad war es um uns geschehen. Nach und nach ergaben sich unsere Verbündeten und als dann die Franzosen, Engländer, Russen und Amerikaner unser Deutschland besetzten, war es auch für uns zu spät. Zwar haben wir nie aufgegeben, aber die Zahl der Feinde war am Ende viel zu groß.“ Plötzlich verschwand Simbeck. „Wo will denn der auf einmal hin?“ wunderte sich Karl. Wenige Sekunden später kannten sie den Grund für Simbecks Verschwinden. Zehn dunkelhäutige Männer kamen auf sie zu. Ehrfurchtsvoll und ängstlich wichen ihnen die Passanten aus. „Da schau her! Wird das hier eine Negerversammlung? Der Busch ist doch in Afrika!“ verkündete Alfred provozierend.
Entschlossen stellten sich die Angesprochenen vor die Nazi-Bande. „Habt Ihr irgendwelche Probleme?“ fragte der Stärkste von ihnen. Zunächst wollte Alfred „Ja, Euch“ antworten, doch als er die muskulösen, angespannten Männer betrachtete, zog er es vor, mit „Nein“ zu antworten. „Na, dann ist ja gut. Also, laßt unsere Leute in Zukunft in Frieden, wenn Ihr nicht haben wollt Ärger! Klar?“ Wieder siegte Alfreds Feigheit. „Klar“, antwortete er. Wie Hunde mit eingezogenen Schwänzen saßen die neun Rechtsradikalen da. Kleine Terrier, die erst laut gekläfft hatten, dann aber die Schnauze hielten, als lauter Schäferhunde vor ihnen standen. In der Gruppe fühlten sie sich stark. Jedoch nur, wenn es gegen Einzelne ging. Niemand traute sich etwas sagen, bis die Schwarzen wieder verschwunden waren. Plötzlich tauchte auch Simbeck wieder auf. „He Alter, hast Du Schiß vor den Stinkern?“ wollte Wolfgang wissen. Simbeck verschnaufte: „Die kennen mich. Ich hab ihnen mal gesagt, daß sie Deutschland verlassen sollen. Da haben sie gemeint, ich könnte froh sein, daß sie keine alten Männer schlagen. Seitdem gehe ich ihnen lieber aus dem Weg, um meine Ruhe zu haben. Außerdem: Ihr habt Euch auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert!“ „Was willst Du machen, wenn zehn dieser Kerls vor Dir stehen? Die hätten uns locker auseinandergenommen“, erläuterte Alfred. „Da magst Du Recht haben, Junge. Stark sind sie. Solche Leute kann man nur mit Waffen unter Kontrolle halten. Nur so hatte früher auch die Sklaverei funktioniert“, erinnerte sich der alte Mann. „Ich muß jetzt wieder heim. Hoffentlich seh ich Euch bald wieder. Vielleicht wird die Luft danach besser“, verabschiedete er sich. Alle wußten, worauf Simbeck anspielte. Sie sollten ein paar Ausländer aus dem Haus jagen, in dem er lebte. „Wann greifen wir an?“ erkundigte sich Steffi. „Am besten mitten in der Nacht“, fand Ernst. „Morgen Nacht um ein Uhr. Aber erst woanders. Wir sind schließlich nicht die Befehlsempfänger von dem Alten“, entschied Alfred. Damit war alles klar. Was Alfred sagte, wurde gemacht. Das wußte auch Anke. Sie als seine Freundin erlebte das den ganzen Tag. Aber sie liebte ihn und sein Machogehabe. Darum tat sie alles, was er von ihr verlangte. „Was machen wir jetzt?“ wollte Karl wissen. „Ich schlage vor, wir versaufen die 100 Mark, die Wolfgangs Mutter nicht haben wollte“, sagte Alfred. Natürlich waren alle einverstanden. Sie verließen ihren „Sitzort“ und begaben sich in die „Reichsbar“. Das war eine Kneipe, in der sich ausschließlich „Hitlers Erben“ vollaufen ließen. Darum fand die Gruppe um „Führer Alfred“ recht schnell Anschluß und man diskutierte mit den anderen Gästen über die wirksamsten Möglichkeiten, die Ausländer aus Deutschland zu jagen. Ein Mann, den alle nur Adolf nannten, weil er sein Aussehen dem des ehemaligen Führers angepaßt hatte, ergriff das Wort: „Die Zeit des Wartens ist vorbei. Wir müssen nun endlich etwas tun. Jetzt, da Deutschland orientierungslos auf dem Ozean herumsegelt, haben wir die große Chance, die Ruder der Macht zu ergreifen. Dazu müssen wir Ängste in den Menschen schüren. Ängste vor Gewalt, Verbrechen und allem Fremden. So können wir es schaffen, sie zu überzeugen uns ihre Stimme zu geben. Es gibt nur den einen Weg, den auch unser Adolf einst gewählt hatte. Mit legalen Mitteln an die Macht gelangen, um dann nach und nach das Volk unter Kontrolle zu bekommen.“ Der „Führer“ hatte gesprochen.
Am darauffolgenden Vormittag saßen Ernst, Berthold, Hans und Anke wieder in der Schule, während die anderen Fünf noch ihren Rausch ausschliefen. Ernst und Anke gingen in die achte, Berthold und Hans in die neunte Klasse der Gesamtschule. „Berthold, lies doch mal bitte den Text vor, den ich Euch ausgeteilt habe“, bat der Lehrer, weil er sah, daß jener kurz davor war, einzuschlafen. „Laß mich in Ruhe!“ murmelte Berthold. Das ging dem Lehrer zu weit. „So, Du bekommst jetzt einen Verweis wegen ungebührenden Benehmens“, erklärte er. „Du kannst Dir einen blasen!“ rief Berthold dem Lehrer zu. „Mach nur so weiter, dann fliegst Du von der Schule!“ brüllte jener. Genau das hatte Berthold hören wollen. Seine Chance war gekommen. Bisher war er jedesmal, wenn er nicht in die Schule gekommen war, von der Polizei in der Stadt aufgegabelt und in den „Bau“ gebracht worden. Wenn er es nun schaffte, von der Schule zu fliegen, könnte er den ganzen Tag mit seinen Kumpels zusammensein. Darum stand er auf und rief: „Komm, schmeiß mich runter von der Schule, Du fette Sau, Du Jude, Du Rattenficker!“ Erwartungsvoll blickte die ganze Klasse auf den Lehrer. Jener öffnete die Tür des Klassenzimmers und sprach zu Berthold: „Verschwinde! Ich werde Dich bald einmal im Knast besuchen, weil so Deine Zukunft aussehen wird.“ Berthold schmiß seine Bücher aus seinem Rucksack heraus, trampelte ein wenig auf ihnen herum, stellte sich vor seinen Lehrer, spuckte ihm ins Gesicht und schrie: „Ich werde Dich bald im KZ besuchen, Du Null!“ Dann lief er schnell in die Stadt. Hans meldete sich: „Darf ich auch von der Schule fliegen?“ wollte er wissen. Sein Lehrer hatte sich ein wenig beruhigt. „Aber Hans, warum willst Du denn von der Schule fliegen?“ erkundigte er sich. „Damit ich mit meinen Kumpels zusammensein kann.“ „Das kannst Du doch den ganzen Nachmittag“, entgegnete der Lehrer und setzte den Unterricht fort. In der Pause erzählte Hans Ernst und Anke alles, was passiert war. Jene bewunderten Berthold für das, was er getan hatte und beschlossen, auch zu versuchen, von der Schule zu fliegen. Allerdings gelang es ihnen nicht, weil sie nicht über den Mut und die beleidigenden Ausdrücke Bertholds verfügten. Überhaupt waren jene drei sowieso nur Mitläufer, die Freunde gesucht hatten, und sie in den sechs Anderen auch gefunden hatten. Sie verstanden nicht viel von dem, was Alfred immer erzählte und waren nur deshalb in der Gruppe, weil sie sich dort anerkannt und stark fühlten. Alfred mochte sie eigentlich nicht besonders, weil er spürte, daß sie keine überzeugten Nazis waren. Aber er wußte, daß man viele Mitläufer brauchte, so daß er die drei „Kleinen“ recht freundlich behandelte, sie jedoch nie unbeobachtet ließ. Darum fuhr er Berthold nun an: „Du spinnst wohl! Läßt Dich aus der Schule rausschmeißen! Jetzt haben wir niemanden mehr dort, der sich um unsere „Babys“ und um neue Mitglieder kümmert. Von den drei Schwächlingen läßt sich niemand begeistern!“ „Aber ich wollte doch einfach den ganzen Tag mit Euch zusammensein“, entschuldigte sich Berthold. Alfred klopfte ihm auf die Schulter. „Schon klar. Die Nummer im Bau war wirklich nicht übel. Kannst stolz auf Dich sein!“ Das war Berthold auch, als er die lobenden Worte seines „Führers“ gehört hatte. Als alle neun zusammen waren, bastelte man sich Molotow-Cocktails, um ein paar „Kanackennester auszuräuchern“. Dabei tat Alfred alles, um seine Leute bei guter Laune zu halten. Schließlich war es möglich, daß sie alle in jener Nacht zu Mördern werden würden.
Die Kirchturmuhr schlug. „Los geht’s!“ zischte Alfred und schlich zu einem Haus, in dem Ausländer wohnten. Seine „Untertanen“ folgten ihm. Alle waren maskiert, weil sie keine Lust hatten, von irgendwem wiedererkannt zu werden. Auf einmal flüsterte Alfred: „Schnell, versteckt Euch hinter dem Haus.“ Hastig folgten die Anderen seinem Befehl, was auch besser für sie gewesen war. Denn gerade als der Letzte von ihnen hinter dem Haus verschwunden war, tauchten am Ende der Straße zwei Gestalten auf. Es waren zwei türkische Männer, die laut miteinander sprachen und wenig später in das Haus gingen, das die Nazis anzünden wollten. „Hätten wir Euch beinahe vergessen“, erkannte Alfred zynisch. Durch das Eintreffen der beiden Türken verzögerte sich das geplante „Feuerwerk“ der Nazis. Sie vertrieben sich die Zeit damit, indem sie noch einmal absprachen, wie sie vorgehen wollten und wer welches Alibi bekommen sollte. Nach zehn Minuten war es soweit. Da die Türken ihre Familien nicht aufgeweckt hatten, blieb alles dunkel und ruhig. Aber plötzlich klirrten Scheiben. Wolfgang hatte das Fenster „geöffnet“ und daraufhin warfen die Rechtsradikalen ihre selbstgebastelten Molotow-Cocktails in das Haus. Wenig später stand alles in Flammen. Während sich acht Jugendliche davonmachten, blieb Karl in einem Gebüsch in der Nähe der Brandstätte sitzen. Er hatte von Alfred den Auftrag bekommen, das Geschehen zu beobachten, um den Anderen später davon berichten zu können. Karl war ein richtiger Nazi. Er empfand es als gerecht, daß jene Ausländer, die sich einfach in Deutschland niedergelassen hatten, dafür bestraft wurden. Darum dachte er auch gar nicht daran, ihnen zu helfen, oder wenigstens Hilfe zu holen. Schließlich hoffte er, daß alle, die da drinnen waren, verreckten. Auf einmal hörte er Sirenen, welche immer lauter wurden. Krankenwägen, Polizeiautos und die Feuerwehr kamen angerast. Die Feuerwehrmänner wußten fast gar nicht, wo sie zu löschen beginnen sollten, weil das ganze Haus in Flammen stand. Karl bemerkte, daß die anfänglichen Schreie, die aus dem Haus zu vernehmen gewesen waren, mittlerweile verstummt waren. „Wer lebt in diesem Haus?“ erkundigte sich ein Polizist bei einem Anwohner. „Ach, nur lauter Türken!“ war dessen geringschätzige Antwort. „Na, dann ist’s ja gut“, dachte sich der Polizist beruhigt. „Wie viele?“ fragte er. „Zwölf“, lautete die Auskunft. „Wir gehen jetzt rein“, erklärten die Feuerwehrleute. Wenig später kamen sie mit den ersten leblosen Körpern zurück. Ein junger Mann und eine junge Frau, bei denen die Rettungsversuche des Notarztes absolut sinnlos waren, da sie nicht mehr lebten. Oben an einem Fenster stand ein älterer Mann „Spring!“ riefen die Umstehenden. Unten hielten Feuerwehrleute eine Rettungsmatte. Ein lautes Husten ertönte von oben und eine Gestalt flog vom Fenstersims herunter. Gerettet! Jener Mann sollte der einzige Überlebende sein. Nach und nach brachten die Feuerwehrleute die Leichen der toten Türken heraus. Drei Männer, drei Frauen und fünf Kinder waren in jener Nacht den Flammen zum Opfer gefallen. Die Polizisten begannen langsam mit der Routinearbeit. Sie erkundigten sich unter den Schaulustigen, ob es Zeugen gäbe. Aber zunächst wurde niemand gefunden. Viele Leute standen noch stundenlang vor den Ruinen und weinten. Nach zwei Stunden wurde es Karl zu dumm. Er hatte genug gesehen und konnte Alfred in ein paar Stunden gute Neuigkeiten bringen.
„Bis auf einen Türken sind alle verreckt!“ erzählte Karl seinen Kumpels. Sie saßen in Alfreds Wohnung und klatschten, als sie das hörten. „Hat der Überlebende etwas gehört oder gesehen?“ wollte Wolfgang wissen. „Keine Ahnung. Ich glaube, sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht“, antwortete Karl. „Klasse! Dann fahren wir da hin und bringen ihn zur Strecke, bevor er uns belasten kann!“ rief Berthold. „Bist Du verrückt!“ fuhr Alfred ihn an. „Ihr habt immer noch nichts kapiert. Erstens: Es steht überhaupt nicht fest, daß der Türke uns gesehen hat. Zweitens: Wir haben Masken getragen, also kann er uns auch nicht erkannt haben. Drittens: Ihr könnt sicher sein, daß er im Krankenhaus unter Polizeischutz steht. Was glaubt Ihr, was jetzt in Deutschland los sein wird! Alle Politiker werden auftreten und den Anschlag verurteilen. Auch die, die im Stillen nichts dagegen haben, daß es ein paar Kanacken weniger gibt, können es sich nicht leisten, das zu sagen, was sie denken. Es wird Demonstrationen von Zeckenzüchtern geben und viele Bürger werden mitmarschieren, um zu zeigen, daß sie gegen Ausländerhaß sind, obwohl sie unsere Aktion in Wahrheit gutheißen. Nun wird es sich zeigen, auf wen wir uns verlassen können. Auch die Polizei wird stark ermitteln, weil der ganzen Welt so schnell wie möglich die Täter präsentiert werden sollen.“ Die Anderen schwiegen betreten. Vielen von ihnen wurde erst jetzt klar, was sie in der letzten Nacht getan hatten. Natürlich schweißte jenes Erlebnis die Truppe noch mehr zusammen. Schließlich kannten bislang in ganz Deutschland nur neun Leute die Täter. Das waren sie! Alfred schaltete den Fernseher ein. Es wurden Bilder von den toten Türken und vom ausgebrannten Haus gezeigt, vor dem sich etliche hundert Menschen versammelt hatten, um zu beten, Kerzen anzuzünden oder Blumen niederzulegen. „Schleimige Spießer!“ entfuhr es Berthold. Daraufhin wurde ein Interview mit einem Polizeikommissar gezeigt. „Wir kennen die Brandursache noch nicht. Allerdings steht fest, daß das Feuer nicht durch einen technischen Defekt entstanden ist“, gab jener bekannt. „Was heißt das?“ wollte Hans wissen. „Daß die Bullen wie immer keinen blassen Schimmer haben!“ spottete Helmut. Gelächter kam auf. „Könnte es sein, daß das Feuer von Rechtsradikalen gelegt wurde?“ fragte der Reporter. „Für so eine Aussage ist es noch zu früh“, wich der Kommissar aus. Nach dem Interview wurde eine Rede des Bundeskanzlers ausgestrahlt. „Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger“, begann er. „Letzte Nacht ist etwas Schreckliches geschehen. Elf türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger haben bei einem Brand ihr Leben verloren. Da feststeht, daß kein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich war, wissen wir, daß es Täter gibt. Auch wenn das Motiv bislang unklar ist, fordere ich die Täter auf: Stellen Sie sich! Mit so einer Schuld kann niemand leben! Liebe türkische Freunde, mein herzlichstes Beileid. Ich versichere Ihnen, daß wir nicht ruhen werden, bis die Täter hinter Schloß und Riegel gebracht worden sind.“ „Sprach’s und legte sich zum Schlafen“, lästerte Karl. Schallendes Gelächter brach aus. Alle fühlten sich befreit, da sie wußten, daß man ihnen nicht auf die Schliche gekommen war. „Wir werden in den nächsten Wochen unsere Treffen hier abhalten, um nicht in der Öffentlichkeit aufzufallen“, entschied Alfred. „Wolfgang, laß die Strumpfmasken verschwinden!“ Wolfgang steckte sie in eine Tüte, verließ die Wohnung und brachte die Tüte auf eine Müllkippe, wo man sie sicherlich nie finden würde. Als er wieder in Alfreds Wohnung zurückkehrte, waren die Anderen alle verschwunden.
„Hey Leute! Wo seid Ihr?“ rief Wolfgang laut. Auf einmal entdeckte er auf dem Tisch einen Zettel. Darauf stand: „Sind im Führerbunker! Vernichte den Zettel!“ Wolfgang wunderte sich. Der „Führerbunker“ befand sich in einem verwahrlosten Gebiet mitten in Frankfurt. Dort hatten sie einst jene Höhle entdeckt und zu ihrem Geheimversteck ernannt. Gerade als sich Wolfgang auf sein Fahrrad setzen wollte, hielt neben ihm ein Polizeiauto an. „Einen Augenblick, Junge. Weißt Du, wo wir Alfred Herres finden?“ erkundigte sich ein Polizeibeamter. „Keine Ahnung“, log Wolfgang, um dann neugierig nachzufragen: „Was wollen Sie denn von ihm?“ „Das dürfen wir Dir wiederum nicht sagen“, gestand der Polizist lächelnd und stieg in den Wagen. Wolfgang beschloß daraufhin, zunächst nicht zum „Führerbunker“ zu fahren, weil es ja sein konnte, daß er beobachtet wurde. Deshalb kurvte er eine halbe Stunde lang in der Stadt herum, bis er sich ganz sicher war, daß er nicht verfolgt wurde. Dann fuhr er zum „Führerbunker“. Seine Kumpels warteten bereits auf ihn. „Wo warst Du denn so lange?“ wollte Steffi wissen. „Ich habe die Bullen abschütteln müssen“, verteidigte sich Wolfgang. „Wieso das denn?“ rief Ernst erregt. „Als ich den Zettel fand und hierher fahren wollte, traf ich auf der Straße einen Polizisten, der wissen wollte wo Alfred ist. Ich sagte ihm, daß ich es nicht weiß und fragte ihn, was er von Alfred wolle. Darauf erzählte er mir, daß er das nicht sagen dürfe. Da ich sichergehen wollte, daß man mir nicht nachspionierte, bin ich erst in der Stadt herumgefahren, bis ich wußte, daß mir niemand folgt.“ „Auf Dich kann man sich halt verlassen“, lobte Alfred und gab ihm eine Dose Bier. „Warum seid Ihr eigentlich hierher abgehaun?“ fragte Wolfgang. „Weil ich von einem guten Kumpel informiert worden bin, daß die Polizei mich sucht“, ließ Alfred verlauten. „Du wirst aber nicht jeden Tag vor der Polizei davonlaufen können“, erwähnte Hans, dem ein wenig mulmig zumute war. „Das weiß ich auch. Ich wollte nur noch sichergehen, daß unser Alibi funktioniert“, erläuterte Alfred. „Also, spielen wir es nochmal durch. Ich bin der Polizeibeamte.“ Er stellte sich vor seine Gruppe auf. „Wo wart Ihr gestern abend?“ Anke stand auf. „Ich war mit meinem Freund Alfred im Bett. Mehr werden Sie ja nicht wissen wollen?“ „Ich schon. Aber die Vorschriften erlauben es nicht“, lenkte „Polizist“ Alfred ein. „Und was ist mit Dir?“ Er schaute Ernst an. Jener sprang auf. „Ich habe mit Hans, Berthold und Steffi Karten gespielt“, erzählte er. „Wo?“ wollte der „Beamte“ wissen. „In Alfreds Wohnung.“ „Bleiben noch drei“, deutete „Polizist“ Alfred ein wenig enttäuscht an. „Wir haben in Alfreds Flur Fußball gespielt“, machte Wolfgang deutlich. „Habt Ihr etwa so was wie eine Wohngemeinschaft?“ erkundigte sich Alfred mit tiefer Stimme. Die Anderen riefen: „Genau!“ und lachten. Das Alibi stand. Man hatte keine Unbeteiligten mit hineingezogen, so daß man nicht fürchten brauchte, verraten zu werden. Außerdem konnten genug Leute bestätigen, daß die Neun fast immer zusammen waren, so daß das Alibi nicht so schwach und komisch war, wie es sich zunächst anhörte. Alfred war zufrieden. Vor allem mit sich. Dadurch, daß alle einen Molotow-Cocktail in das Haus geworfen hatten, würde niemand von ihnen auspacken, weil sich ja keine/r selbst belasten wollte. So würde ihnen niemals irgend jemand nachweisen können, daß sie die Brandstifter waren. Allerdings gefiel es ihm überhaupt nicht, daß ihn die Polizei bereits suchte. Jedoch wußte er nicht, daß es sich dabei nur um blinden Aktionismus handelte.
Im Frankfurter Polizeipräsidium war Einiges los. Die Telefone klingelten rund um die Uhr. Unzählige Journalisten, Politiker, aber auch einfache Bürger, wollten wissen, ob die Ermittlungen schon etwas ergeben hätten. Das nervte die Polizeibeamten dermaßen, daß sie etwas auf ihren Anrufbeantworter sprachen. So hörten alle, die im Polizeipräsidium anriefen, folgende Worte: „Hier spricht der Anrufbeantworter des Frankfurter Polizeipräsidiums. Wir können zum momentanen Stand der Ermittlungen nichts sagen. Auf Wiederhören.“ Man hatte eine Sonderkommission gegründet, deren Aufgabe von nun an einzig und allein darin bestand, die Brandstifter zu finden. Zu ihr gehörten auch die Polizeibeamten Harald Lose und Ludwig Wasold. Jene hatten soeben ihrem Vorgesetzten Bericht abzustatten. „Wir haben uns ein wenig in der rechten Szene umgehört. Man merkt zwar, daß niemand etwas gegen diese Morde hat, jedoch scheint man die Täter auch nicht zu kennen. Nur ein gewisser Alfred Herres war nicht zu Hause.“ Auf einmal kam ein Polizeibeamter herein, der sich mit der Brandursache beschäftigt hatte und von einigen Experten unterstützt worden war. „Molotow-Cocktails. Neun Stück!“ meldete er. Erstaunen machte sich breit. „Warum gerade neun Stück?“ fragte sich Kommissar Gerd Wagner. „Entweder waren es neun Täter, oder man will uns auf eine falsche Fährte locken“, meinte Lose dazu. „Also Lose. Neun Täter. Ich bitte Sie“, entgegnete Wagner. „Das wäre ja etwas absolut Neues.“ „Also werden wir nochmal zu diesem Herres fahren und abends mal so eine rechte Kneipe anschauen“, teilte Wasold seinem Chef mit. „Tun Sie das, meine Herren“, verabschiedete sie derselbe. Wagner wußte, daß er der Öffentlichkeit so schnell wie möglich die Täter bringen mußte. Sonst war es um seinen Job geschehen. Darum überlegte er: „Ein brennendes türkisches Haus. Heißt das, daß nur Deutsche die Täter sein können? Wäre es nicht möglich, daß Kurden, oder sogar Türken den Brand verursacht haben? Molotow-Cocktails kann schließlich jeder bauen.“ Daraufhin schickte er ein paar Beamte los, die sich umhören sollten, ob es Streit unter den Türken oder mit Kurden gegeben hatte. Wenig später erhielt er die Nachricht, daß der überlebende türkische Mann wieder voll bei Bewußtsein war. Wagner setzte sich in seinen Wagen und fuhr zum Krankenhaus. „Wie geht es Ihnen?“ fragte er den alten Mann, als er dessen Zimmer betrat. „Oh, recht gut. Sind wirklich alle meine Verwandten tot?“ „Leider ja“, antwortete Wagner. „Können Sie sich noch an letzte Nacht erinnern?“ „Natürlich. Es war gegen 22 Uhr, als ich den Fernseher ausschaltete. Ich fragte meine Tochter, ob ihr Mann und ihr Bruder schon zurückgekehrt wären. Sie sagte „Nein“. Wissen Sie, die Beiden waren abends Kellner in einem türkischen Restaurant, um sich etwas dazu zu verdienen. Danach setzten sie sich oft noch ein wenig dort hin und tranken ein paar Bier. Ich dachte mir, daß das wohl noch dauern wird, bis sie zurückkommen. Da ich sehr müde war und sie einen Schlüssel hatten, legte ich mich schlafen. Gegen ein Uhr wachte ich auf, weil ich Geräusche an der Tür gehört hatte. Als ich aber merkte, daß da unten zwei Männer leise türkisch miteinander sprachen, schlief ich beruhigt wieder ein. Eine kurze Zeit später wachte ich wieder auf. Ich hatte Scheiben klirren gehört und spürte, daß es sehr warm wurde. Ich wollte aus meinem Zimmer laufen, um den Anderen zu helfen, aber die Flammen waren bereits meterhoch. Deshalb verkroch ich mich in eine Ecke meines Zimmers und wartete auf Rettung. Als die Feuerwehr kam, sprang ich runter.“
Lose und Wasold standen vor Alfreds Wohnung. Nach dem zweiten Klingeln hörten sie Geräusche in der Wohnung. Alfred öffnete die Tür. „Guten Tag. Wir sind von der Polizei.“ „Und was wollen Sie dann bei mir?“ erkundigte sich Alfred. „Das ist nur eine Routineuntersuchung. Sie haben doch auch von dem Brand eines Wohnhauses, in dem Türken lebten, gehört?“ „Ach so, ich verstehe. Und weil ich eine Glatze habe und nicht so viel von denen halte, kommen Sie zu mir, weil ich natürlich verdächtig bin“, verkündete Alfred mit lauter Stimme. Die Polizisten wurden ein wenig verlegen. „So dürfen Sie das auch wieder nicht sehen. Sie müssen uns auch verstehen. Auf uns lastet ein riesiger Druck. Die Öffentlichkeit erwartet, daß wir die Täter ganz schnell finden und darum sind wir gezwungen, möglichen Mitwissern auf die Spur zu kommen“, beschrieb Wasold die Situation. „Haben Sie denn keinen Verdacht, wer es getan haben könnte?“ wollte Lose wissen. Alfred beschloß, mit den Polizisten ein wenig zu spielen. „Na ja, natürlich habe ich mir darüber auch meine Gedanken gemacht. Es hat da schon etliche Äußerungen von ein paar Leuten gegeben, die meinten, man sollte sich einmal der Türken annehmen.“ Alfred war schlau. Solche Äußerungen hatte es tatsächlich gegeben und durch sie war seine Gruppe erst auf die Idee gekommen, ein von Türken bewohntes Haus anzuzünden. Die beiden Polizisten horchten auf. „Von wem?“ fragte Lose. „Tut mir leid. Ich will auch noch ein paar Jahre gesund bleiben“, wehrte Alfred ab. „Wir verschaffen Ihnen eine neue Identität und Polizeischutz“, versprach Wasold. „Das ist mir zu riskant. Außerdem fühle ich mich wohl in meiner Haut“, wiegelte Alfred ab. „Können Sie uns nicht wenigstens ein bißchen helfen?“ bat Lose. „Na gut. In der Kneipe „Reichsbar“ findet Ihr vielleicht, was Ihr sucht.“ „Danke!“ erwähnten die Polizisten zum Abschied. „Also, dann halt heute Abend in die Reichsbar“, teilte Wasold Lose mit, als sie im Polizeiauto saßen. „Was hältst Du eigentlich von diesem Herres?“ „Ich weiß nicht, der ist irgendwie total abgebrüht. Wenn der einer der Täter wäre, hätten wir große Probleme, es ihm nachzuweisen“, erläuterte Lose. Wasold gab ihm Recht. Fünf Stunden später saßen sie in der „Reichsbar“. Aus den Lautsprechern tönte „deutsches Liedgut“, wie der Wirt vielsagend meinte. Wasold und Lose waren zwar in Zivil, wurden natürlich dennoch erkannt, weil sie ja schon mit vielen Gästen gezwungenermaßen über den Brandanschlag geredet hatten. Man merkte recht deutlich, daß der Stimmungspegel am Boden war. Das lag zweifellos an der Anwesenheit der Polizisten. Deswegen traute sich selbstverständlich keiner der Rechtsradikalen, auf den Putz zu hauen. Wasold fragte den Wirt, der ebenfalls ein Nazi war: „Ist es bei Euch eigentlich immer so ruhig?“ „Normalerweise nicht“, erwiderte der Angesprochene. Plötzlich kam Alfred auf die beiden Polizisten zu. „Na, meine Herren. Schon gefunden, was Sie suchen?“ „Leider nicht. Die Herren kommen wohl nicht in Fahrt, wenn sich die Staatsmacht in der Nähe befindet“, mutmaßte Wasold mit einem gequälten Lächeln. „Na, das hätten Sie sich doch denken können“, tadelte Alfred. „Ich habe eigentlich ja geglaubt, daß Sie sich ein wenig verkleiden, um hier nicht so aufzufallen.“ „Was wahrscheinlich auch besser gewesen wäre“, stimmte ihm Wasold enttäuscht zu. Sie wußten, daß sie an jenem Ort nichts mehr erfahren würden und verließen deshalb bald die Kneipe. Aber Alfred hatte sie auf eine wirklich gute Idee gebracht.
Im „Führerbunker“ wurde eine Lagebesprechung durchgeführt. Alfred vermeldete: „Wie Ihr wißt ist jetzt bekannt geworden, daß neun Molotow-Cocktails in das Türkenhaus geflogen sind. Darum müssen wir verhindern, daß man uns verdächtigt. Deshalb werden wir uns im nächsten halben Jahr trennen. Wir teilen uns in zwei Gruppen auf, damit es keine Neunergruppe mehr gibt. In der einen Gruppe sind Berthold, Hans, Karl und Steffi, in der anderen Gruppe sind Helmut, Ernst, Anke, Wolfgang und ich. Unsere Treffen, also die gesamte Gruppe, werden nur noch hier im „Führerbunker“ stattfinden. Auf der Straße müssen wir allerdings immer so tun, als wären wir rivalisierende Banden, so daß nie der Verdacht aufkommen kann, daß wir irgendwie zusammengehören könnten. Habt Ihr das verstanden?“ Alle nickten. Dennoch fragte Hans: „Heißt das, daß wir in den nächsten Monaten gar nichts mehr machen?“ „Ganz im Gegenteil. Jetzt geht es erst richtig los. Bald wird das nächste Kanackenheim brennen!“ rief Alfred. Einige Stunden später verließen eine Vierer- und eine Fünfergruppe den „Führerbunker“ in einem zeitlichen Abstand von einer halben Stunde. Beide Gruppen suchten sich neue Plätze in der Frankfurter Innenstadt, wo sie herumlungern konnten. Gerade als sich Alfreds Gruppe vor einem Geschäft niederlassen wollte, kam ihnen Simbeck entgegen. „Na toll. Der alte Knacker hat uns noch gefehlt“, schimpfte Alfred vor sich hin. „Ihr habt das falsche Haus angezündet. Ihr solltet doch das Haus in der Arolserstraße in Schutt und Asche legen“, beschwerte sich der alte Mann. „Wie kommst Du denn darauf, daß wir das waren?“ wollte Alfred wissen. „Na, weil es doch neun Molotow-Cocktails waren und Ihr auch neun seid.“ Simbeck stutzte. „Wo sind denn die anderen Vier?“ erkundigte er sich. „Wie meinen?“ fragte Alfred, um ihn unsicher zu machen. Aber Simbeck hatte ihn durchschaut: „Mir könnt Ihr nichts vormachen. Keine Angst, ich werde Euch nicht verraten“, versprach er schmunzelnd und ging weiter. „Den müssen wir uns ganz schnell vom Hals schaffen“, stellte Wolfgang fest. „Ganz meine Meinung“, stimmte ihm Alfred zu. Gegen Abend gingen Alfred, Wolfgang und Helmut in die Arolserstraße und klingelten an Simbecks Wohnungstür. „Ach Ihr seid es“, meinte jener erfreut. „Kommt herein. Ihr werdet ja immer weniger.“ „Na ja, wir wollten ja nicht das Haus besetzen, sondern uns mit Dir ein wenig über Deine lieben Nachbarn unterhalten“, erzählte Alfred. „Jawohl, so gefällt mir das. Also, vor zwei Jahren lebten hier nur Deutsche. Als dann eine Wohnung frei wurde, nisteten sich die ersten Kanacken ein. Nach und nach zogen einige deutsche Familien weg, weil sie Ärger mit den Kanacken hatten. Dafür zogen immer mehr Kanacken in dieses Haus ein, so daß ich also jetzt der letzte Deutsche hier drin bin“, faßte Simbeck zusammen. „Wo ist denn hier das Klo?“ wollte Wolfgang wissen. „Den Flur entlang links“, antwortete der Alte. Während Wolfgang auf dem Klo einen Schalldämpfer auf die Pistole steckte, erklärte Alfred in der Küche dem alten Mann: „Also, wenn wir da eingreifen, dann darfst Du natürlich nicht im Haus sein, weil die Gefahr für Dich zu groß wäre.“ Simbeck verstand. „Ihr braucht mir nur zu sagen, wann Ihr die Bude ausräuchert und könnt Euch darauf verlassen, daß ich zu der Zeit nicht im Haus bin.“ Wolfgang kam zurück, zog die Pistole hervor und erschoß den alten Mann. Eine große Gefahr war beseitigt worden. „Guter Schuß!“ lobte Alfred. Daraufhin entfernten sie ihre Fingerabdrücke und suchten mit Handschuhen nach Geld. Nach einiger Zeit wurden sie fündig. Jener „Ausflug“ hatte ihnen immerhin 1000 Mark für die Reichskasse gebracht. Blutiges Geld!
„Wir müssen unbedingt diese Leute finden, die das Kanackenhaus angezündet haben“, ließ Armin Witt verlauten. Gemeinsam mit seinen „Waffenbrüdern“ Markus Ohlmann und Werner Höller saß er in ihrem Versteck im Wald, das gut getarnt unter der Erde lag. „Auf jeden Fall. Die wären nämlich genau die Richtigen für die BAF“, stimmte ihm Ohlmann zu. „Wer hätte sich schon gerade jetzt getraut, ein Kanackenhaus abzufackeln, wo fast ganz Deutschland gegen uns ist?“ staunte Höller bewundernd. „Das müssen absolute Profis sein. Man darf nicht vergessen, daß die Polizei immer noch im Dunkeln tappt.“ „Das mag schon sein. Allerdings dürfen wir nicht so blöd sein zu glauben, daß die Bullen es allen sagen würden, wenn sie eine Spur haben“, lenkte Witt ein. „Dennoch stellt sich die Frage, wie wir unsere zukünftigen Mitglieder finden wollen. Schließlich dürfen wir nicht mehr allzu viel Zeit verlieren, weil die BAF ja in wenigen Wochen ihre Arbeit aufnehmen soll. Unsere Kämpfer warten bereits ungeduldig.“ Die BAF, die Braune Armee Fraktion, war von Witt, Ohlmann und Höller gegründet worden, um ganz Deutschland, vor allem aber die Ausländer in Deutschland, in Angst und Schrecken zu versetzen. Man hatte sich im Untergrund formiert und war bereit loszuschlagen. Die Ziele der BAF waren eindeutig formuliert: 1.Vertreibung aller Ausländer aus Deutschland. 2.Welteroberung. Gut 200 Leute gehörten zur BAF. So konnte man in ganz Deutschland Terroranschläge verüben. Jedoch waren ihnen die Brandstifter in Frankfurt zuvorgekommen. Nicht, daß man sich nicht darüber freute, daß es Leute gab, die ebenso tatkräftig gegen die Ausländer kämpften. Ganz im Gegenteil. Aber man wollte die Brandstifter natürlich allzu gerne in den eigenen Reihen haben, weil man glaubte, man könne noch etwas von ihnen lernen. Außerdem wollte man, daß ab sofort alle Terroranschläge von der BAF ausgingen und ihnen nicht die Schau gestohlen wurde. „Ich glaube, hier können wir bei unserer Suche ansetzen“, vermutete Witt und las aus einer Zeitung vor: „Mann in eigener Wohnung erschossen! Racheakt von Ausländern? Gestern wurde der 77jährige Rentner Johann Simbeck in seiner Wohnung erschossen und ausgeraubt. Die Polizei hält es durchaus für möglich, daß Ausländer ihn umgebracht haben, um den Tod der elf Türken zu rächen. Zu dieser Ansicht kamen die Beamten, da Johann Simbeck als Sympathisant der rechten Szene bekannt war. Möglicherweise hat er die Täter provoziert, indem er den Brandanschlag auf die Türken guthieß.“ „Ja und? Was hat das mit unseren Brandstiftern zu tun?“ wollte Ohlmann wissen. „Das liegt doch auf der Hand. Unsere Brandstifter haben ihn umgebracht, weil er sie erkannt hatte“, erklärte ihm Höller. „Glaubt Ihr das wirklich? Es ist doch viel naheliegender, daß ihn Ausländer umgebracht haben, um die Türken zu rächen“, entgegnete Ohlmann. „Siehst Du! Genau das haben sich unsere Mustermörder auch gedacht. Die Polizei ist genauso wie Du auf der falschen Spur“, erläuterte Witt. „Und was machen wir jetzt?“ erkundigte sich Höller. „Wir hören uns erst einmal ein wenig in der Szene um. Dann sehen wir weiter“, entschied Witt. Sie verließen ihr Geheimversteck und fuhren nach Frankfurt, um die Szenelokale abzuklappern. Auf alle Fälle wollten sie den oder die Brandstifter in ihrer Organisation dabei haben. Da es unwahrscheinlich war, daß einer neun Molotow-Cocktails geschmissen hatte, gingen sie von mehreren Tätern aus.
„Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?“ fragte Antje Fierer den jungen, kahl geschorenen Mann, der an ihrer Tür geläutet hatte. „Das Essen machen!“ verlangte jener. „Wie bitte?“ „Na ja, ich habe Hunger“, stellte der Mann klar. „Moment, Sie klingeln da an meiner Tür und wollen, daß ich das Essen mache?“ „Richtig.“ „Was erlauben Sie sich eigentlich?“ empörte sich Antje. „Kochen Sie jetzt endlich was?“ fragte der Mann ungeduldig. „Hören Sie. Ich rufe die Polizei“, drohte Antje und wollte die Türe schließen. „Die ist schon da. Gestatten, Fierer. Hier ist mein Ausweis“, sagte Andreas Fierer. Da erst erkannte ihn seine Frau. „Du meine Güte! Wie siehst Du denn aus?“ rief sie erschrocken. „Wieso? Gefällt es Dir nicht?“ erkundigte sich er. „Ganz und gar nicht. Du siehst ja aus wie so ein Nazi.“ „Das ist ja prima“, freute er sich und gab ihr einen Kuß. Antje verstand die Welt nicht mehr. „Was bitteschön ist daran prima, daß Du wie ein Nazi aussiehst? Und das gerade jetzt, wo dieser Brandanschlag war!“ „Das erkläre ich Dir beim Essen“, versprach er und schaute in den Spiegel. Tatsächlich! Er sah aus wie ein Neonazi! „Also, was ist jetzt?“ wollte Antje später wissen. „Du hast doch bestimmt gehört, daß wir rund um die Uhr die Brandstifter suchen?“ Antje nickte. „Na ja, und um die zu finden müssen wir uns in die rechte Szene einschleusen, um mehr zu erfahren.“ „Aber warum gerade Du?“ wunderte sich Antje. „Warum nicht?“ konterte Andreas. „Wenn wir die Täter finden, könnte ich befördert werden.“ „Das ist doch verdammt gefährlich!“ Antje war sauer. Sie wollte nicht, daß Andreas sein Leben riskierte. Außerdem paßte ihr seine „Frisur“ nicht. „Ach ja, eines hätte ich fast vergessen: Wir sehen uns heute wahrscheinlich das letzte Mal für lange Zeit“, fiel ihm ein. „Schön, daß Du das auch mal erwähnst“, ätzte sie zynisch. „Kannst Du mir vielleicht sagen wieso?“ „Na ja, wenn ich weiterhin hier ein und aus gehe, dann wissen alle, daß ich der Bulle Fierer bin und dann habe ich keine Chance, in die Szene zu gelangen. Darum hat mir mein Boß eine Wohnung in einem Viertel besorgt, in dem ich leicht Anschluß finden werde“, vertraute Andreas ihr an. „So! Das ist ja toll!“ rief Antje wütend. „Willst Du Dich vielleicht auch noch scheiden lassen?“ „Hey, was ist denn los, mein Schatz?“ tröstete er sie. „Schwierige Situationen erfordern schwierige Maßnahmen. Das weißt Du doch. Oder willst Du nicht, daß diese Brandstifter geschnappt werden?“ „Schon. Aber warum muß deshalb unser Zusammenleben enden?“ wollte sie wissen. „Weil es nicht anders geht. Stell Dir vor, einer meiner künftigen Kumpanen beobachtet, wie ich jeden Tag in unsere Wohnung gehe und bei Frau Fierer übernachte, die zufälligerweise die Frau eines Polizisten ist. Dann kann ich meine Körperteile im Main zusammensuchen.“ „Also darf ich Dich wohl ab heute Adolf nennen?“ spottete sie. „Nein. Ich heiße von nun an Oliver Schricker“, antwortete er. „Na dann viel Erfolg, Oli“, wünschte Antje, bevor sie das Geschirr abspülte. „Moment, nicht so schnell.“ Er griff ihr an den Po. „Erst mal will ich noch Andreas Fierer sein. Schließlich werden wir uns lange Zeit nicht mehr sehen.“ „Laß mich!“ forderte Antje. „Ich will nicht von einem Glatzkopf gefickt werden!“ „Auch nicht, wenn der Glatzkopf Dein Mann ist?“ erkundigte er sich. „Auch dann nicht!“ machte sie deutlich. Da fiel er über sie her und vergewaltigte sie.
Natürlich konnten sich die neun „Feuermacher“ nicht mehr in der „Reichsbar“ blicken lassen, weil die Leute dort auch zählen konnten. Es hätte zwar eine Gruppe hingehen können, aber dann hätte es gewiß dumme Fragen gegeben. Außerdem wollte man einen zweiten „Fall Simbeck“ unbedingt vermeiden. Deswegen ging Alfreds Gruppe ab sofort in die „Braune Grube“, während Karls Gruppe im „Heldentreff“ ihre Abende verbrachte. Wie der Zufall es so wollte, waren an jenem Abend Witt, Ohlmann und Höller ebenfalls in der „Braunen Grube“. Alfred fielen sie auf, weil sie doch recht gut gekleidet waren. „Ich hab gar nicht gewußt, daß Bonzen hier auch Zutritt haben“, provozierte er sie. „Und mir war nicht klar, daß man auch linke Zecken hier hereinläßt“, konterte Witt. Alfred mußte sich beherrschen, um nicht eine Schlägerei mit ihm anzufangen. „Was fällt Dir ein, mich einen linken Zecken zu nennen?“ brüllte er. Witt blieb ganz ruhig. „Du hast uns Bonzen genannt. Nur die Linken reden von Bonzen“, entgegnete er. „O.k.. Mein Fehler. Dürfte ich dann vielleicht erfahren, was die gut angezogenen Herren in dieser schmutzigen Kneipe wollen?“ „He, keine Beleidigungen! Sonst kannst Du gleich wieder gehen“, mischte sich der Wirt ein, der mitgehört hatte. „Sorry. War nicht so gemeint“, entschuldigte sich Alfred, da er ja noch einige Male seine Abende in jenen Räumen verbringen wollte. „Das will ich auch hoffen“, bekräftigte der Wirt. Überhaupt war Alfred in letzter Zeit viel ruhiger geworden. Einmal, weil er recht zufrieden mit sich und der Welt war; zum Anderen, da er nicht unnötig auffallen wollte. Mit seinen Provokationen gegenüber ihm unliebsamen Leuten wollte und konnte er jedoch nicht aufhören. „Das darfst Du ruhig wissen. Wir suchen die Leute, die das Türkenhaus angezündet haben“, sagte ihm Ohlmann. „Ach, Ihr seid Bullen. Hätt ich mir ja denken können“, klagte Alfred und wollte gehen. „Tut mir leid, junger Freund. Wir sind gewiß keine Polizisten. Wenn wir Polizisten wären, dann wärst Du ein Neger“, klärte ihn Höller auf. „Sagt mal, wie oft wollt Ihr mich denn noch beleidigen? Fehlt nur noch, daß Ihr mich einen Juden nennt, was ich Euch aber wirklich nicht raten würde. Was wollt Ihr denn von diesen Brandstiftern?“ wollte Alfred wissen. „Das dürfen wir Dir leider nicht sagen“, äußerte sich Ohlmann vorschnell. „Wenn wir es nie jemandem erzählen, dann finden wir sie nie“, zischte Höller. „Wir wollen sie in unsere Organisation aufnehmen“, bemerkte Witt. „Wieso das denn?“ erkundigte sich Alfred neugierig. „Weil wir solche Leute wie sie brauchen können. Wer wagt es schon, in unserer Zeit noch Ausländerhäuser anzuzünden?“ „Danke“, dachte sich Alfred geschmeichelt und fragte dann: „Was ist denn das für eine Organisation?“ Die drei Männer überlegten, ob sie ihm wirklich so viel sagen sollten. Als sie schwiegen, teilte ihnen Alfred mit: „Wißt Ihr was ich glaube? Ihr tragt diese Luxushemden nur, um Euch zu tarnen. Ihr habt es wohl faustdick hinter den Ohren. Vielleicht habt Ihr ja das Kanackenhaus angezündet. Jeder drei Molotow-Cocktails, das würde ja sogar schön aufgehen.“ „Würden wir dann die Brandstifter suchen?“ erwiderte Witt gelassen. „Warum nicht? So käme niemand auf die Idee, daß Ihr es wart.“ „Also, Freundchen, hör mir mal zu: Wir finden das total super von denen, die das gemacht haben und würden sie gerne in unserer Organisation aufnehmen“, offenbarte sich Höller und gab ihm eine Visitenkarte. „Teile es uns bitte mit, wenn Du sie kennst.“ „Ich ruf Euch an, wenn sie mir ihre Tat gestanden haben“, versprach Alfred belustigt und ging.
„Was wollten denn die komischen Typen von Dir?“ fragte Anke Alfred, als sich jener zu ihnen an den Tisch setzte. „Ach, nichts“, murmelte der Gruppenführer. Damit war das Thema erledigt und niemand aus der Gruppe traute sich, weiter zu fragen. Alfred überlegte: „Ich müßte mehr über diese Organisation wissen. Das könnte natürlich auch eine einfache Falle sein. Allerdings gäbe es dann dort bestimmt Bosse, auf die auch ich zu horchen hätte. Da gefällt es mir doch so besser.“
Am Tag darauf saßen sie wieder zu neunt im „Führerbunker“. Alfred hielt mal wieder eine kurze Ansprache: „Nach unserem großen Erfolg wollen wir natürlich weitere Taten folgen lassen. Heute Nacht gibt es wieder ein bißchen was zu tun. Meine Gruppe kümmert sich um das Kanackenhaus des alten Simbeck, Karls Gruppe zündet das Kanackenhaus in der Karlstraße an. Ihr wißt ja, welches ich meine.“ Die Angesprochenen nickten. „Punkt ein Uhr beginnen beide Aktionen. Wir machen es aus zwei Gründen zur gleichen Zeit: Zum Einen, weil dann ein paar mehr Kanacken verrecken, da es zwei Unglücksorte geben wird und zum Anderen, weil wir uns dann danach bei mir treffen. Ihr kennt ja die Geheimwege zu meiner Wohnung. Frische Strumpfmasken habe ich besorgt. Die werden wieder mitgebracht und bei mir entsorgt. Alles klar?“ „Alles klar!“ antworteten alle gemeinsam. Man knackte noch einen unbeobachteten Zigarettenautomaten, um die „Reichskasse“ wieder ein wenig aufzufüllen, da man doch an vielen Abenden sehr viel Geld versoff. Fast 300 Mark waren drin. Besser als nichts. Gegen halb eins machten sich die beiden Gruppen zu ihren „Einsatzorten“ auf. Bei Alfreds Gruppe lief alles wie geschmiert. Punkt ein Uhr zertraten deren Mitglieder zwei Fensterscheiben und warfen die am Nachmittag gebastelten Molotow-Cocktails in das Haus. Alfred hatte sich etwas einfallen lassen. Jeder Gruppenführer schmiß zwei Molotow-Cocktails in das jeweilige Haus, so daß einmal fünf und einmal sechs für Feuer sorgten. Insgesamt elf. Da würde gewiß kein Polizist mehr durchblicken. Während sich Alfreds Gruppe schnell vom Tatort davonmachte, hatte Karls Gruppe ein großes Problem. Ein Polizeiwagen, mit echten Polizisten darin, stand am Straßenrand. Scheiße! „Was machen wir jetzt?“ flüsterte Berthold. „Warten!“ hieß Karls knappe Antwort. Also warteten sie. Auf einmal fuhr der Polizeiwagen mit Blaulicht davon. „Die Anderen haben es geschafft. Jetzt sind wir dran!“ jubelte Karl und los ging’s. Auch bei ihnen ging alles schnell und problemlos über die Bühne. Das Haus brannte und die Täter ergriffen die Flucht. Alfred hatte niemanden beauftragt, am Tatort zurückzubleiben. „Für was gibt es Zeitungen“, hatte er spöttisch gemeint. Bei der Polizei, der Feuerwehr und in den Krankenhäusern ging alles wild durcheinander. „Wir haben zwei brennende Häuser“, hieß es. „Die steigern sich“, erklärte ein Polizist ironisch seinem Kollegen. Aber als sie am Tatort ankamen, verging ihnen das Lachen recht schnell. Feuerwehrleute waren bereits im Haus gewesen und hatten zwei Menschen herausgebracht, um deren Leben die Notärzte verzweifelt kämpften. Am Ende der Rettungsaktionen hatte ein weiteres Mal der Tod klar die Oberhand behalten. Von den acht Bewohnern des Hauses in der Karlstraße lebten gerade noch zwei und von den 14 Bewohnern des Hauses in der Arolserstraße hatten nur vier die Brandstiftung überstanden. Ganz Frankfurt war schockiert. In wenigen Tagen waren drei Häuser, in denen Ausländer lebten, angezündet worden. Die Täter mordeten nun international. Unter den Toten waren Türken, Afrikaner und Griechen.
„So etwas habe ich noch nie erlebt. Drei Hausbrände und ein Mord in so wenigen Tagen. Rollt da eine neue Terrorwelle auf uns zu?“ fragte sich Gerd Wagner. Er war so in sein Selbstgespräch vertieft, daß er gar nicht wahrnahm, daß Fierer sein Büro betreten hatte. „Hier bin ich“, meldete sich jener an. „Ja gut. Sie haben doch bestimmt von den Ereignissen in der letzten Nacht gehört?“ forschte Wagner. „Leider ja“, antwortete Fierer. „Es gibt keine Zeit zu verlieren. Hier sind Ihre Wohnungsschlüssel. Ich verlasse mich auf Sie. Versuchen Sie, so schnell wie möglich in die Szene einzudringen. Aber passen Sie auf! Am besten keine Straftaten. Ich weiß selbst, daß sich das wahrscheinlich kaum vermeiden lassen wird. Geben Sie Ihr Bestes! Und wenn es wirklich nicht ohne Gesetzesüberschreitungen geht, dann lassen Sie sich bitte wenigstens nicht erwischen“, verlangte Wagner augenzwinkernd. „Geht klar. Danke Chef“, verabschiedete sich Fierer. „Nicht Chef, scheiß Bulle heißt das jetzt!“ rief ihm Wagner lachend nach. „Und, hat der Verhör des Nazis was gebracht?“ wollte Lose wissen, der soeben mit Wasold das Büro Wagners betrat. „Leider nichts. Er hat die Aussage verweigert und ich konnte ihm nichts nachweisen“, bedauerte Wagner. „Den kriegen wir schon noch“, versprach Wasold. Die Drei lachten. Wenigstens hatten sie ihren Humor nicht verloren. Man befand sich in einer schwierigen Lage. „Es gibt keine verläßlichen Zeugenaussagen“, grummelte Wagner. „Die Einen wollen sieben Leute gesehen haben, die Anderen fünf, wieder Andere nur drei. Irgendwie habe ich das Gefühl, jemand will uns an der Nase herumführen.“ „Mal wieder Molotow-Cocktails!“ rief der Polizeibeamte, der eben zur Tür hereinkam. „Fünf in der Karlstraße, sechs in der Arolserstraße.“ „Was soll denn das jetzt?“ wunderte sich Wasold. „Einmal neun, einmal fünf, einmal sechs.“ „Sind insgesamt 20. Da muß es ja eine Fabrik in der Nähe geben, welche die Dinger herstellt“, glaubte Lose. „Was hat der Mord an dem alten Simbeck damit zu tun? Kannte er vielleicht die Täter?“ fragte sich Wagner. „Gut möglich. Irgendwie ist es schon komisch: Erst stirbt der alte Nazi und kurz darauf krepieren die Leute, die er wahrscheinlich am meisten gehaßt hat“, erläuterte Wasold. „So kommen wir nicht weiter, meine Herren. Das heißt, wir müssen wohl auf „unseren Nazi“ (er meinte Fierer) hoffen.“ Wagner verließ sein Büro und seine beiden Kollegen folgten ihm. „Fahrt nochmal zu den Zeugen und fragt sie, ob ihnen noch etwas eingefallen ist“, bat er sie. „Ich mache mich auf ins Krankenhaus. Langsam bin ich es leid.“