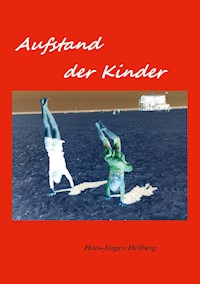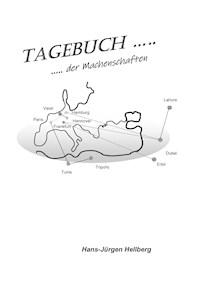
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Geplant war der Aufbau eines neuen Netzwerkes für den Klein- und Mittelstand in einer Kleinstadt in Friesland im Norden Deutschlands. Es galt ausgetretene Pfade zu verlassen. Der Norden sollte eine neue Rolle spielen, es galt eine Region neu aufzustellen, den Klein- und Mittelstand neu zu bündeln, unterschiedliche geeignete Cluster zusammenzuführen und gemeinsam wie ein Großbetrieb sich den internationalen Märkten zu stellen. Doch schnell zeigte sich, wie Seilschaften und Eigeninteressen von Seiten der Politiker, Lokalpolitiker sowie Unternehmen vor Ort ihre Spiele spielten, weil sie um den Verlust ihrer Einflüsse fürchteten. Viele schmutzige Spiele, Intrigen wurden gespielt, die dem Normalbürger verborgen bleiben, aber sehr oft den Alltag bestimmen. Hinzu kommt in diesem Umfeld der Umgang mit anderen Kulturen, das fehlende Wissen und die Arroganz gegenüber anderen. Das vorliegende Tagebuch nimmt den Leser mit, auf eine Reise durch herrliche Landschaften, begegnet Menschen, die etwas zu sagen haben, gefragt und ungefragt. Es werden Versprechungen gegeben, gehalten und gebrochen. Freundschaften entstehen zu Menschen, die es ehrlich meinen, andere haben nur Profit und Macht im Blick. Die Beschreibung ist sachlich, humorvoll, bissig bis satirisch. Menschen kommen zu Wort. Die einzelnen Stationen sind belegt durch Mails, Presseartikel, Bilder von Menschen und traumhaften Landschaften. Könnte man die zahlreichen politischen Reibungsverluste auch nur um ein Drittel reduzieren, würden wir kein Konjunkturprogramm benötigen. Friesland ist überall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 851
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ich sage Danke für die Unterstützung an dem Zustandekommen des Buches: ‚Tagebuch der Machenschaften‘.
Insbesondere geht der Dank an:
Barzan Jusef,
Dr. Bernd Sonntag,
Dr. Jürgen Schlüsing,
Johann Schuster,
Leniana Ibraewa,
Jutta Hellberg sowie
an die zahlreichen Akteure, die durch ihre Einflussnahme Teil
des Tagebuches wurden.
Tagebuch der Machenschaften
Es war die Idee, neue Wege zu beschreiten, ausgetretene Pfade zu verlassen und in der wirtschaftlich schwachen Region Friesland im Nordwesten Deutschlands mit einem neuen Konzept als Antwort auf die Probleme der Region zu reagieren.
Schon ein erster Blick auf die Landkarte ließ erkennen, dass hier ein gigantischer Schatz lag, der darauf wartete, gehoben zu werden. Jeder, mindestens im Norden verfügte über diese Schatzkarte und hätte sofort in die Schatzsuche einsteigen können. Vor einem lag Wilhemshaven mit dem einzigen und relativ verwaisten Tiefseehafen, Deutschlands großes Hafenprojekt von Niedersachsen, Bremen und Hamburg als Gemeinschaftsprojekt geplant. Es war die große und mächtige Hansestadt Hamburg, die um ihre Umsätze fürchtete und so die Gemeinschaft verließ, dabei lag und liegt für jeden sichtbar hier die Metropolregion mit den Kernstädten Wilhelmshaven, Bremen bis Hamburg und Lübeck, mit seinen kleinen Städten wie Varel, die aufgrund der Nähe zum Tiefseehafen, sich als Industriestandorte für die Weiterverarbeitung der in den Containern enthaltenen Güter anbieten.
Die Analysen zeigten die großen Vorteile für die gesamte Metropolregion, insbesondere klein- und mittelständige Betriebe sollten hiervon profitieren, dabei galt es, verschiedene Bereiche zu Cluster zusammenzuschließen und in das zu erstellende Konzept zu integrieren und so ein international wettbewerbsfähiges System zu schaffen.
Möglichst viele sollten davon profitieren, doch erst in dem Augenblick als Planer aus dem Norddeutschen Ausland Schleswig-Holstein, wie die Friesen sie bezeichneten, das Potential erkannten und damit begannen die vorhandenen Puzzlebausteine zu einem tragfähigen Gesamtkonzept zusammenzusetzen, fing die bis dahin sich im Tiefschaf befindende Region Friesland aufzubegehren und ein Immunsystem zu seinem Schutz aufzubauen. Die außerirdischen Wesen aus Schleswig-Holstein hatten es ganz einfach gewagt, ihre Kreise zu stören und so beginnt der Aufbau einer trotzigen Abwehrmauer. Die Macht der Zwerge, als Tagebuch der Machenschaften, beschreibt die Widerstände, die letztlich zum Scheitern der Idee zum Aufbau eines Industrie- und Gewerbecampus kurz IGC führen mussten.
Der IGC als eine Antwort auf die verschiedenen Herausforderungen.
Mit ausschlaggebend für die Entwicklung dieses neuen Konzeptes gegen alle Widerstände war die wirtschaftliche Situation der Region Friesland und die damit verbundenen Schwierigkeiten der kleinen und mittelständigen Unternehmen im Wettbewerb, nicht nur aber auch, gegenüber den Großen und der schnell voranschreitenden Globalisierung.
Kleine und mittelständische Unternehmen bilden zwar das eigentliche Rückgrad der deutschen Wirtschaft, haben aber anders als die Großkonzerne kaum eine Stimme, wenn es darum geht, die wirtschaftlichen Geschicke mitzubestimmen. Für eine Lobbyarbeit, die den großen Konzernen den Machterhalt und einen erheblichen Einfluss auf die politische Gestaltung bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen sichert, fehlen einfach die Mittel. Mit dem IGC galt es dieses Problem für die Region ein stückweit auszuräumen, es sollte möglich werden, eine starke Stimme des Klein- und Mittelstandes aufzubauen, sollte diese Gesellschaftsschicht sich einig sein. Genau hier aber lag die Lösung aber auch das Problem.
Dabei stellte sich als das größte Problem der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen heraus. Anders als die großen Konzerne, die, wo immer es sinnvoll erscheint, wenige Probleme haben zu kooperieren oder geschickt zu manipulieren, kristallisieren sich bei den kleinen und mittelständischen Unternehmern schnell Gruppen und Personen von Einzelkämpfern heraus. Zwar hatte diese Einzelkämpfermentalität in der Vergangenheit nicht nur Nachteile, sondern hatte auch für zahllose Innovationen gesorgt. Oft war es der Wettbewerb oder schlicht der Kampf ums Überleben, was zur Entwicklung neuer Produkte, Erfindungen und Entwicklungen führte, die sich von denen der Konkurrenz in vielerlei Hinsicht abhoben. Spätestens aber mit der Vermarktung zeigten sich auch die Schwächen dieses Verhaltens. Für deren großangelegte Vermarktung reichte und reicht die Wirtschaftskraft bis heute häufig nicht aus, so dass dies künftig immer mehr zu einer existenziellen Bedrohung in der Zukunft werden könnte. Solange die Unternehmen durch Grenzen und Währung geschützt waren, hielt sich zudem die Bedrohung durch Wettbewerber aus dem Ausland in Grenzen. Irgendwie hatte jeder seinen Bereich abgesteckt oder seine Lebensnische gefunden. Eine mögliche Bedrohung für ein Unternehmen war somit eher der Wettbewerber im eigenen Aktionsradius. Auf Kooperationen wurde oft lieber verzichtet, selbst wenn sie einen größeren wirtschaftlichen Erfolg gebracht hätte. Bis heute spielt hier häufig die unterschwellige Angst mit, dass der eigene Kunde zum Konkurrenten wechseln könnte.
Richtig schwierig ist es, wenn der infrage kommende Partner sich auch noch in der direkten Nachbarschaft befindet. Hier kam eine Zusammenarbeit oft gar nicht infrage, da man sich aus der Kommunalpolitik, vom Stammtisch, Vereinen und vielen Dingen mehr her kannte. Oftmals war man auch noch zerstritten und Streitigkeiten wurden oft auf die nächsten Generationen übertragen.
All dies spielte in der Vergangenheit für den wirtschaftlichen Erfolg oft keine Rolle, da die eigenen Kunden für die ausreichende Nachfrage sorgten. Doch der Ausbau der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Europäischen Gemeinschaft und damit die stärker werdende Globalisierung, zwangen die Unternehmen zum Umdenken. Eine wesentliche Veränderung trat ein, mit dem Wegfall des Eisernen Vorhangs, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der Einführung des Euros, Einrichtung des Schengener Raumes und der nachfolgenden EU-Osterweiterung. Den gefühlten Schutz durch die alten Grenzen und die eigene Währung gab es nicht mehr. Die Löhne waren jetzt gegenüber Mitgliedsländern zu hoch und zudem zogen ihre Qualitätsstandards nach. Ihre Kunden, darunter auch Konzerne, konnten jetzt günstiger einkaufen oder gar Preise diktieren. Klein- und mittelständige Unternehmen waren damit mindestens teilweise nicht mehr wettbewerbsfähig, nur innovative Bereiche, wie die Hochtechnologie, hatten noch eine Gnadenfrist. Mehr und mehr verlagerten sich die Märkte innerhalb, aber auch außerhalb der EU, die Entfernungen zu den Kunden wurden größer. Neue Märkte entstanden, die bis dahin keine allzu große Rolle spielten. Russland und China machten sich Stück für Stück bemerkbar. Schwellenländer wie China mit seinen billigen Arbeitskräften sorgten für die Verlagerung ganzer Produktionsstätten und Länder, wie Indien begannen mit einem Heer an Informatikern im IT-Bereich eine führende Stellung einzunehmen.
Als würde dies alles noch nicht reichen, stiegen in der Folge auch noch sämtliche Kosten, sei es durch den Anstieg der Energie-, Rohstoff- oder andere Preise.
Dieser, wenn auch nur äußerst kurze Ausflug in nähere Vergangenheit, hat seine Auswirkungen auf die Gegenwart und fordert Antworten. Antworten die den eigenen Standort sichern sollten und die Lösung konnte keine Einzellösung mehr sein, sondern nur noch eine ganzheitliche Methode. Damit ging der Blick weit über die Kommunal-, Landes oder Staatsgrenzen hinaus in Richtung der EU, Russland, China oder den arabischen Raum.
Für Deutschland, ein Land mit einer rückläufigen Bevölkerungszahl, was die eigene Bevölkerung anbelangt, bedeutet dies radikale Veränderungen im Denken und Handeln. Die aktuelle Politik ist hier oft überfordert, sie verwaltet oft nur, was vorhanden ist, statt aktiv zu handeln. So findet der Motor des Landes, die Binnenkonjunktur, keine Nahrung mehr, ruinöser Wettbewerb sorgt für einen starken Fall der Löhne, die aber nicht nur das Überleben sichern sollten, sondern auch die Kaufkraft und somit Investitionen ermöglichen, um die Konjunktur anzuschieben.
All dies führte zur Idee eines aktiven und nachhaltigen Netzwerkes, als eine mögliche Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen. Damit begann unser eigentliches Abendteuer. Um diese Idee mit Leben zu erfüllen, folgten zahllose Gespräche auf der Suche nach Gleichgesinnten, die Analyse der Möglichkeiten, der Märkte, der Einflüsse auf Regionen, der künftigen Herausforderungen und das Ergebnis war ein Netzwerk, das den Namen Industrie- und Gewerbecampus (IGC) erhielt.
Suche nach einem geeigneten Standort für den IGC.
Hierfür galt es jetzt einen Ort festzulegen, in dem diese Idee umgesetzt werden konnte. Der Blick fiel auf die Kleinstadt Varel mit seiner günstigen Lage zum Tiefseehafen, dem Jade-Weser-Port und seinen möglichen Flächen. Dieses alleine wäre aber noch nicht tragfähig, erst das bereits existierende natürliche Wirtschaftsdreieck, dem Kernbereich Hamburg, Bremen, Wilhelmshaven, mit Hamburg als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Industriestandort für zahlreiche IT- Branchen stand ein wesentlicher Teil des Motors des Dreiecks. Die Stadt verfügt allein mit Airbus und seinem modernsten Containerhafen über zwei Giganten, die zu den Säulen der Stadt gehören, sie verfügt über eines der wichtigsten Einrichtungen im Bereich der Grundlagenforschung, dem Deutschen- Elektronen Synchroton DESY und vieles mehr. Es folgen Bremen mit seiner Uni, dem Flugzeugbau und Wilhelmshaven als Standort für den geplanten Chemiepark und dem künftigen Tiefseehafen. Für eine Metropolregion somit die besten Voraussetzungen.
Jetzt war es naheliegend, die Kleinstadt Varel mit ihren angrenzenden Gemeinden unterhalb von Wilhemshaven weiter zu untersuchen und den endgültigen Standort für den IGC festzulegen.
Sie war weit genug von den geplanten Großprojekten entfernt und eignete sich als Hinterland mit seinen interessanten Betrieben in der Metallverarbeitung, die ihre Kunden in der Region oder im Ausland hatten. Hier machte es Sinn über den Aufbau eines IGC´s nachzudenken. Das Grundkonzept ist denkbar einfach. Anders als die sonst üblichen Industriegebiete, könnten hier Produktionsschwerpunkte aufgebaut werden. Firmen, die hier siedeln, kämen dann aus der Metallverarbeitung, der Chemie und längerfristig auch aus dem Veredlungsbereich für Waren aus dem Hafenbereich. Um jetzt noch die Innovationsfähigkeit zu erhöhen, gilt es darüber hinaus eine gemeinsame Forschung und Entwicklung von neuen vermarktungsfähigen Produkten zu fördern. Doch dieses allein wäre immer noch zu wenig, die Firmen würden zusätzlich zu ihren bisherigen Aktivitäten, über den Campus wie eine große Firma auf den Märkten auftreten. Damit steht fest, dass der Campus zusätzlich, wenn erforderlich, als ein organischer Anbieter gegenüber Großkunden auftritt. Er verfügt über die gesamte Infrastruktur, vom Zentralgebäude, das neben Verwaltungsaufgaben, als Show Case für die verschiedenen Firmen und Produkte dient und Kindergarten, Bank, Café und viele Dinge mehr beherbergt.
Der Campus würde somit als Generalunternehmer im In- und Ausland auftreten, was bedeutet, dass die Kräfte und Mittel gebündelt werden und die Firmen damit ihre Ressourcen schonen.
Vieles hatte jetzt zu geschehen, so musste vor Ort mit den Akteuren gesprochen und verhandelt werden, die Politik war einzubinden oder Auslandskontakte in Europa, im Irak, Tunesien, Libyen oder nach Pakistan und Russland waren aufzubauen. Wie sich herausstellt ein nicht einfacher Weg, so gibt es Gespräche und Verhandlungen mit Politikern und Verwaltungen, von denen die einen den IGC-Gedanken unterstützten und andere ihn überall behinderten. So stellt sich heraus, dass überall ein Zuviel an Verwaltung existiert, es zu viele Bürgermeister, zu viele Landräte und Politiker gibt. Viele wollen mitreden, sich profilieren, argumentierten gegen das Konzept, ohne es überhaupt zu verstehen und wussten zudem oft nicht, was draußen um sie herum vorging. Oft stehen nicht die künftigen Erfordernisse, dem Gemeinwohl zu dienen, im Vordergrund. Auffällig oft geht es nur darum auf der politischen Leiter weiter nach oben zu kommen. Folgerichtig werden unsere Aktivitäten daher von einigen als Störungen oder gar als Bedrohungen empfunden. Um diese Aktivitäten zu behindern, spielt es dann auch, so der Eindruck, keine Rolle, Steuergelder zu vernichten.
Am schlimmsten aber ist es, immer wieder feststellen zu müssen, dass es gerade bei den Politikern an Kompetenz und Wissen fehlt. Immer mehr teilen sie sich auf, in diejenigen die unterstützten, sei es ganz oder teilweise, wie Funke und Hirche und in diejenigen die grundsätzlich nein sagen.
Aber selbst unter den Befürwortern finden sich Leute, die sich sofort zurückziehen, wenn die eigene Position bedroht scheint, dann ist das gegebene Wort bedeutungslos. Es geht soweit, dass Gäste aus dem Ausland, die Aufträge vergeben wollen, wie Minister aus dem arabischen Raum, aus dem kurdischen Norden des Iraks, als die Weisen aus dem Morgenland tituliert werden. Und als wäre dies nicht genug, gilt es auch noch sich mit Bundeseinrichtungen zu befassen, deren Handlungsweisen sich keinem Normalbürger erschließen, so tun sich Botschaft und Auswärtiges Amt schwer bei der Visa-Erteilung.
So ist für die Kurden im Norden des Iraks bis Anfang 2006 erst die Botschaft in Bagdad zuständig, dann heißt es Amman in Jordanien bis schließlich Ankara für den kurdischen Teil des Iraks, dem größten Gegner der Kurden, zuständig ist. Hier drängt sich der Eindruck auf, dass die Furcht vor einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen zur Türkei mitspielt.
Doch es gibt auch zahlreiche Mitarbeiter in den Ministerien, die vom Projekt überzeugt sind und sich einsetzen, wo immer sie können.
Schlimmer aber ist, dass gerade die Verhinderer die Handlungsspielräume einengen und dadurch Kapital vernichten, das gerade bei den kleinen Unternehmen so dringend benötigt wird.
Das Tagebuch gibt wieder, was geschah,
die verschiedenen Begegnungen, Gespräche, Aktivitäten und Verhandlungen wieder. Der Leser erhält zwar einen Einblick in die Denk- und Handlungsweisen einer nordwestdeutschen Region sowie in den arabischen Raum, es könnte sich aber in jeder anderen Region oder Raum genauso abspielen. Er lernt kennen, wie Politiker, Behörden, Wirtschaft und Menschen ticken, wird mitgenommen auf verschiedene Reisen so in den arabischen Raum, um Aufträge zu generieren.
Schonungslos werden die Probleme und Schwachstellen unserer Gesellschaft offengelegt. Es ist ein sachlicher, aber dennoch humorvoller und satirischer Spaziergang mit vielen Wegbegleitern, durch die einzelnen Phasen.
Für mich waren es neben den Erfahrungen, die niemand braucht, auch schöne Begegnungen, Gespräche, Verhandlungen, Gerüchte und viel Menschliches. Erfolge, Freude, Lachen, Gefahren und Enttäuschungen waren ständige Begleiter der Idee. Eine riesige Aufgabe, ein Projekt das nur mit viel Spaß, Ernsthaftigkeit und Humor und vielen Wegbegleitern zu meistern gewesen wäre und trotz des Scheiterns seine Gültigkeit behält. Das Tagebuch zeigt die Schwächen unserer Gesellschaft, unserer Demokratie auf, zeigt wie das Kapital der vielen kleinen Steuerzahler vernichtet und die Zukunft künftiger Generationen verspielt wird. Ich stelle fest, dass es keine Unschuldigen gibt, es sind unsere menschlichen Schwächen, die zur Zerstörung der Ressourcen führen.
Das Konzept selbst wurde von der Regierungsvertretung Niedersachsens in Oldenburg als sehr gut bezeichnet.
Erkenntnis
Zur Demokratie ist es ein weiter Weg. Nur wenige haben verstanden, dass Wahlen und ein Grundgesetz nur notwendige Bedingungen sind, aber keine hinreichenden. Erst wenn die verantwortlichen Menschen über ausreichend Empathie, Kompetenz sowie Sach- und Fachwissen verfügen, sind wir auf einem Weg zu einer gerechteren Welt, dafür aber lohnt es sich zu kämpfen.
Inhalt
2002/-3, Das lange Vorspiel
Es fängt alles mit einer Frage an:
„Kannst du mir helfen?“
Eine erste Idee
Arbeiten an einem strategischen Papier
Der erste Besuch im Rathaus Varel
Bureck-Busch-Bureck
Ein Konzept gewinnt an Profil,
Erfordernissen eines künftigenIndustrie- und Gewerbecampus
Ein Campus muss geleitet werden
Geburt der Stabsstellen, oder Kompetenzcenter
Filmer und der Filmer Clan
Zusammentreffen mit einem Mächtigen der Stadt
Der Fall Schnieder
Begegnung der dritten Art
Schnieders Rache
Macht der Behörden
Besuch bei Ramböll
der große Däne in Hamburg
Ambrosy torpediert den IGC
über Schnieder und Höfer
Zweiter Besuch bei Airbus
Das Spiel des Dr. Lehmann und andere
Jever setzt Bureck unter Druck
Schnieder setzt sein Spiel fort
Der Weg ist wieder frei
der Blick geht nach vorn
Politik und Wirtschaftsmanager
jeder sucht seinen Vorteil
Das Konzept muss in die Öffentlichkeit
das Vorspiel ist vorbei
Es geht auf den 13. Oktober 2003 zu
die Zeit drängt
Ein Campus benötigt Energie
EWE am 13. Oktober 2003
2004, Durch die Instanzen
Ein großer Schritt nach vorn
die schwarze Eminenz
Der 20. Februar, Begegnungen mit den Jade-Weser-Machern
Werner, Kramer und Erdmann
Filmer
oder nur sein, ein zweites Gesicht?
27. April 2004 Besuch beim DESY
Technologietransfer
6. Juli Tarik tritt auf den Plan
kurdische Ideen
19. Juli, Das h+A-Logo
Corporate Identity für alle
22. Juli, Treffen bei Langer
mit Bureck 19:00 Thema Friesland Expo
3-4. August, Bureck muss sich erholen
in Köln, Aachen und Niederlande
Dr. Tarik Muhyaddin
am 3. August Lokaltermin in Kaltenkirchen
Reise in den Irak
findet nicht statt
Langer am 10.September 2004/Friesland Expo 2004
kommt Funke noch?
15.10.04 Braunschweig, Alternative zur EWE
Theede Thema IGC, Erstkontakt Utha
08.11.04 Erstes physisches Zusammentreffen
der große Funke
2005, Der lange Marsch zum Masterplan
13. Februar, zweimal Hamburg, VAW und Wirtschaftsinfrastruktur,
Mitarbeiter werden entlassen,Regierungsdirektor lehnt den Tiefseehafen ab
Filmer,
die graue Eminenz schlägt zu
11. März 2005, Wirtschaftsforum,
der erste Unternehmer aus Varel stößt zur Gruppe
11. April 17:00 Uhr Angebot Masterplan,
Außerordentliche Aufsichtsratssitzung der Wirtschaftsförderungund Stadtmarketing Varel GmbH /Rathaus kleiner Sitzungssaal.Brune schießt gegen den IGC
April Terminwunsch,
suchen das Gespräch zu Hirche in Hannover
Mai 2005, Harald Höhmann
taucht auf
4. Juli, Hirche
mit Bureck, Funke, Boos, Busch, Kose 12 bis 13 Uhr allesrelativistisch
15. Juli 2005, Talibani,
Empfehlungsschreiben
19. Juli 2005, Treffen mit Wilke in Brake,
neue Allianzen
26.07.2005, Treffen am Teich,
Wagner will kandidieren
31. August, IGC 2005 bei Wilke in Brake,
ein zweites Mal an der Weser
Am 19. Oktober nach vielen Anläufen
endlich die Beauftragung des Masterplans
Einladung der Iraker/Kurden,
zum Wirtschaftsforum im November 2005
Die endlose Visa-Geschichte
Wirtschaftsforum DEHARDE,
Donnerstag den 17. November 10:00 Uhr – 16.00 Uhr
2006, Das Jahr der Kurden
16. Januar, Start der Planungsgruppe Masterplan
Einbindung der Politik
26.1.06, die Kurden kommen nach Varel
ein mit der heißen Nadel gestricktes Programm für 2 Tage
27.1.2006, Auf Besichtigungstour mit den Kurden
22.2.2006, Energiesysteme für den Campus
wir wollen Unabhängigkeit
10. April, die erste Kurdistanreise
das Eintauchen in eine andere Welt
Zwischen den Reisen
nachdenken über Künftiges
29. Mai bis 1. Juni, die zweite Kurdistanreise
die Regelung der Finanzen
23. September, die Kurden sind zum zweiten Mal da
der Streit der Ministerien inHannover - oder was gilt schon Funkes Wort
Pläne zur nächsten Kurdistanreise
Tunnelblick
1.11. 2006, Wagner ist Bürgermeister
Vor- oder Nachteil
Vom 7. bis zum 13. November 2006, die dritte Kurdistanreise,
der Azmir Tunnel eine Delegation geht nach Kurdistan
27. November 2006,
Die 130. Sitzung des IHK-Beirats Willhelmshafen/Jever
15.12.-22.12.2006, Sven und Wolfgang in Sulaimanyah
die Analyse wird präsentiert
2007, Ein Masterplan setzt sich durch
10. bis 11. Februar, Treffen in Hamburg,
der kurdische Minister und der geheimnisvolle Investor
19. Februar, der Investor,
Treffen in Berlin
24. Februar bis 4. März 2007, die 4. Kurdistanreise,
Besuch bei Nokan
6. April, ohne Abstimmung nach Kurdistan,
Tariks einsame Entscheidung
4. Mai, letzte Vorbereitungen
,
der große Auftritt
9. Mai, Abstecher nach Meckpom
,
mal sehen was andere so machen
10. Mai 2007, ein Funke springt über,
Präsentation des Masterplans vor derinterfraktionellen Sitzung im Rathaus der Stadt Varel.
18. Mai, der Pakistaner,
ein neues Gesicht
19. Mai, Erbil,
Hilferuf aus dem Ministerium für Wiederaufbau
19. Juni, Die deutsch-irakische Wirtschaftskonferenz in Hamburg,
Macht unser Kommen überhaupt Sinn
2. Juli, Masterplan,
eine endlose Geschichte oder nur Geburtswehen
3. August 2007, Telefonat,
mit der Regierungsvertretung Niedersachsens
21. August 2007, in Hannover,
nicht alle in diesem Beamtenstaat verhalten sich wie solche
17. Sep. 2007, Presse in Varel,
Brune-Tischer lokale Kleingeister
18. September,
aus für die Wirtschaftsförderung?
16. Oktober 2007,
11 Uhr Treffen mit Kramer in Varel, Tod des Chemieparks
17. Oktober 2007,
Spiel der Türken?
22. Oktober 2007, Aufsichtsratssitzung WS Varel,
der größte Gegner des IGC-Projektes will die Zusammenarbeit
30. November, neue Kontakte, Tunis, Tripolis.
Nur ein Geist oder Gaddafi persönlich
5. Dezember, Lebenszeichen,
aus dem kurdischen Ministerium für Wiederaufbau.
16. Dezember 2007 Mail vom Ministerium aus Kurdistan,
einen Masterplan für das Straßennetz
2008, Lahore, Ausflug in eine andere Welt
Jahreswechsel,
Ich weiß nicht, was das neue Jahr uns bringen wird
5. bis 8 Februar 2008, in geheimer Mission,
über Dubai nach Lahore
9. Februar, die Katastrophe,
der Himmel fällt mir auf den Kopf.
März, ohne Schneepflüge
durch den Winter
April, die Zeitmaschine
2009, Mai, alles klärt sich auf?
Es fängt alles mit der Frage an: „Kannst du mir helfen?“
Wir haben bereits Ende 2002 und ich bin im Raum Plön in Schleswig-Holstein unterwegs, um verschiedene Kunden zu besuchen, als mir durch den Kopf schießt, dass ich doch einen kleinen Abstecher nach Dannau machen könnte, um dort meinen zwischenzeitlich zum Freund gewordenen Bernd Bureck zu besuchen.
Um sicherzugehen, ihn auch anzutreffen, rufe ich ihn aus diesem Gedanken heraus, während der Fahrt, in seinem Büro an. Er leitet die Dannauer Werke. Arbeitslose werden hier unter anderem im Bereich der Forstwirtschaft sowie in verschieden anderen Dingen beschäftigt. Wie er mir irgendwann einmal erzählte, ist er für mehrere hundert Mitarbeiter zuständig. Ich habe Glück, er ist da.
Kennengelernt hatten wir uns durch den Arbeitsamtsleiter in Plön Gerhard Kerssen. Durch ihn kam ich dann auch irgendwann auf die Idee, einen Innovativverein zu gründen, der den Zweck hatte, kleine und mittelständische Unternehmen zu bündeln, um so technologisch wie auch kulturell neue Wege zu beschreiten. Die Wirtschaft im Norden brauchte neue Impulse. So hatten wir doch alle zusammen die Nase gestrichen voll von der Politik, wie auch vom verbreiteten Filz in der Wirtschaft. Es ging einfach darum, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und nicht mehr auf irgendwelche wirtschaftspolitischen Impulse aus Kiel, Hamburg oder gar Berlin zu warten. Als ich Jahre zuvor auf Bernd Bureck traf, war er sehr aktiv dabei, alternative Ideen zu entwickeln, um so neue dauerhafte Beschäftigungsmöglichkeiten für die ihm anvertrauten Menschen aufzubauen. Hierzu brachte er Experten aus der Wirtschaft, hochrangige Politiker, Bildungsexperten oder Leute, wie einen Professor Friedjoff Bergmann, der als Philosoph aus den Vereinigten Staaten ganz neue Konzepte entwickelte und teilweise erfolgreich umgesetzt hatte, zusammen. Diese Treffen liefen dann immer einmal im Jahr unter dem Namen Nienthaler Tage, in einer alten leerstehenden Auffahrtsscheune, die über mehrere Stockwerke verfügte und somit reichlich Platz für solche Veranstaltungen bot.
Als ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker freue ich mich auf meinen Milchkaffee aus einem richtigen Kaffeepott, wie ich es aus meiner Studienzeit beim DESY, dem Deutschen Elektronensynchroton in Hamburg, her kannte. Damals half er mir, die nächtliche Müdigkeit, während der Messzeiten am Speicherring Doris, zu vertreiben. Heute mag ich auf dieses mir liebgewordenen Gesöffs nicht mehr verzichten.
Als ich ankomme, regnet es immer noch und so verspüre ich überhaupt keine Lust wie sonst, durch die zu den Dannauer Werken gehörende Werkstatt, über den riesigen Hof zu gehen. Ich nehme daher den trockenen Weg durch den Haupteingang.
Ach ja, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass Bernd die Werke nicht allein, sondern gemeinsam mit Peter Nebendal leitet. So treffe ich zunächst auf Peter, der mich nur kurz begrüßt, um sich sofort in den nächsten Termin zu verabschieden. Immerhin erfahre ich von ihm, dass Bernd sich in der Werkstatt aufhält. Er empfiehlt mir doch die Abkürzung durch verschiedene Verbindungstüren und Flure zu nehmen. So komme ich dann doch noch zu einem kleinen morgendlichen Spaziergang, aber im Trockenen. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass heute ein ganz neuer Abschnitt in meinem Leben beginnen würde.
Bernd empfängt mich an diesem Tag nicht wie sonst. Er wirkt irgendwie geistig abwesend, ist weit entfernt. Ich schaue ihn an, er mit seinem markanten tiefschwarzen vollen Haar und einer breiten silbergrauen Strähne, die irgendwie noch gar nicht zu seinem Alter passen will. Wir gehen vom Lager durch eine weitere Tür, die in ein kleines Büro führt. Hinter diesem schließt sich dann eine kleine offene Küche oder besser eine Kochnische an, die sich wiederum selbst zu einem kleinen Raum mit einer gemütlichen Sitzecke und Rechnerarbeitsplatz erweitert. Ich habe das Gefühl durch einen endlos langen Schlauch, ein Labyrinth gegangen zu sein. Mit den Worten,
>> ich mache uns erst einmal einen Kaffee <<,
hantiert er sogleich mit der zur Kaffeemaschine gehörenden Glaskanne.
Zwei Mitarbeiter, die sich noch im Labyrinth, im Raum, in den Räumen oder doch Schlauch befinden, stehen unvermittelt auf, grüßen flüchtig und verziehen sich. Kaum, dass sie gegangen sind, fängt er an von einer Stadt Varel zu erzählen, ohne dass ich die leiseste Idee habe, was er damit bezweckt:
„Weißt du Varel liegt nur 20 Km südlich von Wilhelmshaven an der Nordsee in Niedersachsen. Die suchen einen Geschäftsführer für ihre Stadtmarketing GmbH. Vielleicht mich!“
Ganz nebenbei erfahre ich zum ersten Mal, dass er eigentlich aus diesem Varel stammt und gerne dorthin wieder zurück möchte:
„Hier bin ich nur hängen geblieben, weil ich an der Kieler Uni Agrarwissenschaften studiert habe. Eigentlich hatte ich einmal den Traum geträumt als Entwicklungshelfer in die dritte Welt zu gehen, aber wie es oft so ist, kamen Frau und Kinder dazwischen.“
Schließlich will er von mir wissen, was ich denn davon halte. Meine Spontanreaktion überrascht ihn dann wohl doch ein wenig. Ich mache ihm klar, dass ich gar nichts davon halte, da die Politik oder besser die Politiker der Gemeinden und Städte diese Stadtmarketinggesellschaften, wie wir eigentlich beide wissen, häufig nur gründen, um ihre Aufgaben, die sie selbst nicht bewältigen konnten, gut in diese Wirtschaftsfördereinrichtungen abschieben zu können. Nach zwei bis drei Jahren dann, hatten in der Regel die Vertreter der Gemeinden es wiederum geschafft, ihr eigenes Versagen vergessen zu machen und konnten jetzt dem Geschäftsführer dieser Wirtschaftsförderung das mögliche Versagen anlasten.
Trotzdem hört Bernd mir kaum zu und bittet mich doch mal den Vertrag durchzuschauen und ihm dann zu sagen, was ich davon halte:
„Ich maile ihn dir zu.“
Ich sage zu und er erzählt mir, wie es dazu kam, dass er sich dafür interessierte wieder nach Friesland zu gehen:
„Und überhaupt …, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, hier in diesem Schleswig-Holstein.“
Wie so oft hing und hängt alles mit der Politik zusammen, die zu verhindern wusste, Erfolge die sich für sie nicht richtig verkaufen ließen, unter den Tisch zu kehren oder zu behindern. Immer wieder erfuhr und erfährt er es gerade auch bei seiner Arbeit, im Einsatz für die ihm anvertrauten Menschen, sie wegzubringen aus der Beschäftigungsgesellschaft, in Jobs zu vermitteln, die sie und ihre Familien wieder ernähren konnten.
„Du weißt, dass mir viel von Seiten der Politik versprochen wurde. Unterstützung wurde mir angeboten, aber wenig oder nichts gehalten.
Was den Geschäftsführerposten anbelangt, so wurde ich von einem Freund, dem Jörg Wilke, angesprochen. Jörg ist Wirtschaftsförderer in Brake. Dies ist eine kleine Stadt an der Weser unterhalb von Nordenham. Jörg stammt genauso wie ich aus Varel. Er hat gerade versucht mir die Sache schmackhaft zu machen.“
Ich nicke, ich kann ihn verstehen, er hat Recht und so verspreche ich ihm, mir den Vertrag anzuschauen. Etwas gedankenversunken blicke ich dabei in mein Spiegelbild, das mir der verbleibende Schluck in meinem Kaffeebecher entgegenhält und verabschiede mich vom diesem, indem ich den Becher leere. Ich sage Bernd Lebewohl und verlasse das Büro nach hinten, durch die kleine, der Einrichtung angeschlossenen, Reparaturwerkstatt. Draußen angekommen stelle ich fest, dass der Regen sich verzogen hat und jetzt eine Art Hochnebel vorherrscht, der aber zur Jahreszeit passt, wir haben schließlich Herbst.
Ich denke über das Angebot nach und weiß, dass seine Entscheidung schnell fallen muss. Mein Eindruck ist, dass Bernd so schnell wie möglich aus Schleswig-Holstein fort will. Auf der Rückfahrt nach Neumünster, wo ich zu diesem Zeitpunkt noch wohne, wollen mir Bernds Pläne nicht aus dem Sinn gehen. Wie so oft nutze ich die Autofahrt, um die Gesprächseindrücke aufzuarbeiten und Strategien durchzuspielen. Mir war aus gemachten und gesammelten Erfahrungen klar, dass Bernd, würde er sich unreflektiert und ohne eigene Vorstellungen und Pläne, aber auch ohne starke Partner, auf das Abenteuer Varel einlassen, zu verbrennen drohte. Diese Erfahrungen beruhten auch zum Teil auf das gemeinsame Abenteuer Nientaler Auffahrtsscheune, die sich in der Nähe Eutins befand. Hier hatte der Eutiner Bürgermeister Masula das Fass zum Überlaufen gebracht. Es ging um Fördermittel, für das von uns ausgearbeitete Projekt Auffahrtsscheune. Masula hatte uns in diesem Zusammenhang im Kieler Wirtschaftministerium angekündigt. So jedenfalls hatte er es uns vermittelt. Als wir jedoch im Ministerium ankamen, teilte man uns mit, dass es eigentlich keinen Termin gäbe, jedenfalls nicht zum Thema Förderung des Projektes Nientaler Auffahrtsscheune. Nun war dies nicht die erste Erfahrung, die ich mit Politikern sammeln durfte. So reiht sich hier zum Beispiel auch der Neumünsteraner Bürgermeister Unterlehberg ein, dieser hatte meiner Meinung nach, wirklich einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, die Kleinstadt Neumünster wirtschaftlich an die Wand zu fahren.
Wirft man einen Blick auf die Schleswig-Holsteinkarte, so findet man diese Stadt an der A7 fast in der Mitte des nördlichsten Bundeslandes. Mit ihren Industriegebieten war die Stadt früher gar nicht mal so schlecht aufgestellt, so hatte der ehemalige Dezernent für Wirtschaft und spätere Oberbürgermeister Kajo Schommer während seiner Schaffenszeit in den Achtzigern doch einiges für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt getan, ging dann aber kurz nach der Wiedervereinigung 1990 als Staatsminister nach Sachsen. Damit verließ er die Stadt mit einem guten wirtschaftlichen Rumpf allerdings ohne einen leitenden Kopf. Sein Nachfolger Unterlehberg, hat es anschließend nicht geschafft, genau diesen Kopf zu installieren.
Hier wird denn auch ein grundlegendes Problem, was die Politiker im Allgemeinen anbelangt, sichtbar. Mit Schuld sind die Anforderungen selbst, die unser demokratisches System an die Politiker stellt. Keiner dieser Politiker muss letzten Endes nachweisen, dass er auch der Experte mit dem nötigen Sach- und Fachwissen für den Bereich ist, für den er sich bewirbt. Die meisten sind Pädagogen, Politologen, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler, Volkswirte oder ganz einfach irgendwelche Beamte. Dies ist verständlich, da ja alle anderen arbeiten müssen. Irgendwer muss sie ja schließlich ernähren.
Wie es sich gehörte, bekam ich die Chance meine Meinung über Unterlehberg, zu festigen. So kam es vor einigen Jahren zu einem Treffen zwischen ihm und mir, das wir nach einer Veranstaltung des Unternehmerverbandes Bund der Selbstständigen, dessen Vorsitzender in Neumünster zum damaligen Zeitpunkt ein Peter Fietzke war, vereinbart hatten. Der zwischenzeitlich zum Oberbürgermeister mutierte Unterlehberg, hielt dort eine kleine Rede, in deren Verlauf es auch um die wirtschaftliche Situation in der Stadt ging. Er beschwerte sich darüber, dass alles immer nur schlechtgeredet wurde, aber keiner positiv gestimmt mit eigenen Ideen kam.
Bei der Erfüllung seiner Aufgaben sowie bei der Lösung der anstehenden Probleme sei er aber auf die Unterstützung aller angewiesen. Schließlich ginge die wirtschaftliche Situation alle Schichten an. Ich konnte ihm damals nur zustimmen. In der Tat sind alle schnell und gut, wenn es darum geht etwas negativ zu bewerten. Es ist ein Leichtes die Arbeit anderer negativ zu bewerten, selbst aber keinen Beitrag zu leisten. Deshalb nahm ich die Gelegenheit wahr und sprach ihn während des allgemeinen Meinungsaustausches im Anschluss an die Veranstaltung an und wir verabredeten einen Termin, um zu sehen, wo man unterstützen kann.
Der Termin kam dann auch wirklich zustande und der Oberbürgermeister bedanke sich während dieses Treffens bei mir, für meine konstruktive Einstellung und der Bereitschaft die Ärmel hochzukrempeln. Ich weiß noch genau, wie ich ihm als erstes eine Analyse der bestehenden Betriebe im Industriegebiet Süd der Stadt vorschlug. Unterlehberg schaute mich daraufhin groß an und fragte, was das denn bringen solle, er sei doch grob gesprochen nur für die Infrastruktur, wie die örtliche Festlegung des Gewerbegebietes oder die Bereitstellung von Grundstücken und Unterstützung bei der Ansiedlung, zuständig. Na ja, wofür die Politik bis heute eben so zuständig ist. Der Rest sei, so meinte er, Angelegenheit der Wirtschaft und die müsse sich, um ihre Belange selbst kümmern. Zwar ist diese Schilderung stark vereinfacht, gibt aber das Wesentliche wieder. Als Politiker habe er die Aufgabe zu verwalten. Nun fragen sie sich bestimmt, was denn dieser Politiker mal gelernt hat. Klar, der Oberbürgermeister ist Jurist. Das Problem für mich als Bürger ist, dass ich erst einmal herausfinden muss, was denn so ein Politiker überhaupt kann. Habe ich das dann herausgefunden und will jetzt auf dieser Grundlage handeln, so ist dieser Politiker entweder nicht mehr im Amt oder hat schon soviel Neues angeschoben, dass er selbst nicht mehr weiß, was die Ausgangssituation war, was er gesagt hat oder woran er selbst beteiligt war. Sie fragen sich, was ich jetzt mit all dem gemeint habe. Fragen sie mal einen Politiker.
Zu diesem Zeitpunkt ging ich bereits mit einer neuen Idee schwanger. Ein Gewerbegebiet der Zukunft hat ganzheitlich und wo möglich, wie eine einzige Firma zu operieren. Die angesiedelten Firmen sollen eine logische Kette bilden, so dass durch das Zusammenwirken der einzelnen Einheiten, die Abwicklung von größeren Projekten möglich werden würde, an der die jeweiligen Fachfirmen beteiligt wären. Dabei sollten die Firmen grundsätzlich ihre Eigenständigkeit behalten. Der Fokus lag auf kleine und mittelständische Firmen. Diese Form könnte dann die wachsenden Risiken für den einzelnen verringern und gleichzeitig neue Absatzmärkte schaffen.
In diesem Zusammenhang sprachen wir unter anderem von den metallverarbeitenden Firmen, die sich im Industriegebiet Süd befanden. Wir sprachen darüber, was zu tun wäre, um den Standort zu sichern. Welche Wirtschaftsbereiche aktiv angeworben werden sollten, wie die zum Beispiel Materialveredlung und entsprechende Zulieferer. Ähnliches galt letztlich auch für andere Bereiche, wie Firmen im Umweltbereich. Immer noch habe ich den Oberbürgermeister vor mir, als wäre es heute:
„Also noch mal Herr Unterlehberg, diese Art der Bündelung der Betriebe würde bedeuten, dass sie sich im Verbund, besser und schneller auf neue Entwicklungen einstellen könnten. Darüber hinaus wären sie, vereinfacht dargestellt, wettbewerbsfähiger. Diese Form könnte darüber hinaus weitere Zersiedlungen einschränken oder vielleicht irgendwann gar beenden. Dies bedeutet aber, dass man sich mit den Nachbarkommunen oder den Gemeinden zusammensetzt und sie an so einem Vorhaben als Partner beteiligt.
Ein Nebeneffekt in den Firmen könnte sein, da sie ihre wichtigen Partner gleich nebenan haben, dass sie sich stärker ortsverbunden fühlen. Selbst wenn einzelne Betriebe abwandern sollten, wäre der Verlust für die Stadt, wie auch für die angrenzenden Kommunen oder Gemeinden leichter zu verkraften.“
Wir verabredeten damals einen zweiten Termin. Ich denke, es ist keine Überraschung, wenn ich sage, dass es kein zweites Treffen gegeben hat. Der Oberbürgermeister hatte mich wohl nicht verstanden.
Rückblickend ist es leicht einen Blick in die Kristallkugel vorzunehmen. So wird dieser Blick in die Website von 2007 zeigen, dass diese Stadt mit ihren knapp 80.000 Einwohnern nur noch über 67 Industrie- und Handwerksbetriebe mit 6802 Angestellten verfügt. Geht man einmal ausschließlich von vierköpfigen Familien aus, so werden hier gerade noch 27208 Menschen ernährt. Wer also kann sich diese Politiker und Verwaltungsmenschen eigentlich leisten, wir die Steuerzahler jedenfalls nicht. Um diese Politik zu verstehen ist ein normales Gehirn, wie ich es verstehe, einfach überfordert und wendet sich ab, bevor ihm richtig übel wird.
Damit bin ich wieder gedanklich bei meinem Freund Bureck gelandet. Mir ist klar, dass er ohne ein Gesamtkonzept dort in Varel nur verbrennen würde.
An diesem Abend sitze ich vor meinem Rechner und nehme eine erste Internetrecherche vor. In dieser an der Nordsee gelegenen Region kannte ich bisher nur Städte wie Wilhelmshaven, Oldenburg und Bremen. Varel, Nordenham oder Brake, die letzten, beide an der Weser gelegen Orte, sagen mir nicht allzu viel. Ich entdecke die Webseite der kleinen Stadt Varel mit seinen rund 25000 Einwohnern und schaue mir zunächst an, wer und was dort alles in der Politik und in der Wirtschaft von Bedeutung ist.
Schon vorher hatte ich die Information, dass ich hier auch ein Airbuswerk antreffen würde, war aber dann doch überrascht weitere interessante Betriebe vorzufinden. Diese Stadt schien relativ gut aufgestellt zu sein, im Bereich der Metallverarbeitung, der Luftfahrt, im Nahrungsmittelbereich sowie in der Papierherstellung. Ich schaue mir die Entfernungen zu den Nachbarstädten an und stelle fest, dass Wilhelmshaven mit seinen rund 25 Kilometern Entfernung von Varel, besonders günstig liegt, zudem spricht die Zahl an Arbeitsplätzen in Varel dafür, dass die Stadt auch Menschen aus Wilhelmshaven und den umliegenden Gemeinden Arbeit bietet.
Der Blick auf die Landkarte zeigt, dass sich geographisch der Jadebusen direkt an die Stadt Wilhelmshaven schmiegt und auch Varel nicht allzu weit davon entfernt ist. Eine nähere Betrachtung der Landkreise ergibt zudem, dass Varel sich in der südlichen Ecke des Landkreises Jever befindet. Ohne den Standort Jever genauer untersucht zu haben, klingt dieser Name für mich aus der Entfernung, sehr nach einem alkoholischen Getränk. Lächelnd erkenne ich, dass dieser Kreis zumindest bei Ebbe über eine Menge Schlick, der auch unter dem Namen Watt bekannt ist, verfügen muss. Bei Flut ist das Zeug selbstverständlich wieder weg, aber auch das Land selbst macht keinen allzu sicheren Eindruck. Ohne die Deiche würde man hier wohl eher nasse Füße bekommen. Was soll ich sagen, so richtig bin ich von dieser Region noch nicht angetan und ich kann immer noch nicht verstehen, was meinen Freund Bernd Bureck hierhin zurückzieht.
Während der weiteren Recherche über Wilhelmshaven stoße ich auf Firmen wie INEOS, die Polyvinylchlorid bzw. PVC herstellt, auf Pläne für einen Tiefseehafen. Sechzig Kilometer südlich von Varel finde ich die Stadt Oldenburg mit ihrer mir bereits bekannten Carl von Ossietzky Universität. Hier fallen die Bereich Energie, Automotive, Informationstechnologie und die Medizintechnik auf. Noch weiter südlich dann Bremen mit seiner Uni und verschiedenen Wirtschaftszweigen wie Airbus. Alles in allem scheint die Umgebung doch interessanter zu sein, als ich es angenommen habe. Irgendwann spät in der Nacht, nachdem ich alles durchgegangen bin, fängt meine vorgefasste Meinung an zu wanken. Es scheint doch einiges für diese Region zu sprechen und vielleicht ist Bernds Idee nach Varel zu gehen, doch nicht so schlecht.
Eines aber fällt mir zum ersten Mal besonders stark auf, es ist die Verteilung der Industrie bzw. die Ansiedlung der Wirtschaftsbetriebe. Der Wirtschaftsraum sieht zusammengenommen aus, wie ein riesiger Flickenteppich oder vielleicht ist hier der englische Begriff Patchwork treffender. Immer weiter dringe ich in Details vor, suche Informationen zur Logistik, zum vorhandenen Schienen- und Straßenverkehr. Je stärker ich in die Recherche eintauche, umso mehr wird mir bewusst, welch eine Verschwendung an Flächen hier stattfindet, welche Umweltbelastungen es gibt und was weiß ich, was hier sonst noch alles um sich greift. Mir wird immer klarer, dass dieser Raum zwar genügend Potential hat, das einfach nur brachliegt, aber schlecht organisiert zu sein scheint.
Mein Blick fällt auf Etzel, auf der Karte links, etwas westlich von Wilhelmshaven. Hier befinden sich die Kavernen und Salzlagerstätten mit Natriumchlorid, die Basis zur Herstellung von PVC.
Schließlich dehne ich die Betrachtung auf den gesamten norddeutschen Raum aus und bleibe irgendwann in Hamburg hängen und mir ist endgültig klar, dass ich zusammengenommen einen natürlichen norddeutschen Wirtschaftsraum vor mir habe. Zugegeben, meine Vorgehensweise wirkt zunächst chaotisch, doch auch das Chaos steht für eine Art Ordnung. Es ist ein Sammeln von Informationen und Fakten und langsam beginnt mich die Angelegenheit Varel zu fesseln, ja zu faszinieren. Es wird ganz deutlich, dass hier eine norddeutsche Region über alles verfügt, was Wirtschaft, Forschung und Entwicklung ausmacht, nur merkt es offensichtlich niemand. Sämtliche Aktivitäten erweisen sich als kleinräumig, jeder scheint ausschließlich mit seinem Thema befasst zu sein, niemand kümmert sich um die Gesamtzusammenhänge, weder die Forschungsinstitute noch die Wirtschaft und am weitesten entfernt ist offensichtlich die Politik. So setzt hier niemand einen Gesamtrahmen, jeder, so mein Eindruck, ist ausschließlich damit befasst, seine Besitzstände zu sichern und hat nicht erkannt, dass nur die ganzheitliche Betrachtung uns jetzt weiterbringen kann.
Irgendwann übermannt mich die Müdigkeit, ein Blick durchs Fenster, zeigt, dass der neue Tag bereits mit Macht auf dem Vormarsch ist. Dieser Ausflug in die Region via Internet war die Zeit wert, Bernd hat recht, ich kann ihn jetzt verstehen.
Kurz nach unserm Gespräch in Dannau hatte mir Bernd Bureck den Vertrag bereits zugemailt, der ihn zum Geschäftsführer der Stadtmarketingeinrichtung der Stadt Varel machen soll. Ich will das Ganze verkürzen: Niemand sollte so etwas unterschreiben, es sei denn, er bringt etwas mit, das ihn von anderen Geschäftsführern bzw. Wirtschaftsförderern, Stadtmarketingleuten unterscheidet. Nun das einzige positive an diesem Vertrag ist wohl, dass er über fünf Jahre laufen soll. Der Inhalt, mit seinen beschriebenen Aufgaben, entspricht mehr einer Verzweiflungstat von Politikern, die nach einem rettenden Strohhalm suchen, um die Vareler Innenstadt vor einem weiteren Sterben der kleinen Geschäfte zu bewahren. Bernd hatte mir erzählt, dass die Stadt ursprünglich so etwas wie Magnet war, für seine Bewohner, den Menschen aus der Umgebung oder aus den größeren Städten, von denen viele hier ihren Arbeitsplatz hatten. Das Angebot hatte gestimmt und so war es denn nur selbstverständlich, dass die Menschen auch am Wochenende von weit herkamen.
Die schlechte wirtschaftliche Situation hatte dann aber, aus einer ehemals wohlhabenden Stadt, eine hoch verschuldete gemacht. Hierzu trugen auch mögliche Fehlinvestitionen bei, die durch falsche Planung von unterschiedlichen Seiten entstanden waren. Es waren unter anderem Dinge, wie die Verlegung eines Flusslaufes und der Bau einer Straße für die ansässigen Papierwerke. Kaum waren diese Maßnahmen abgeschlossen, stellte sich auch schon heraus, dass der dadurch gewonnene Raum für die Erweiterung der Firma nicht ausreichte und erneut Steuergelder eingesetzt werden mussten, um das Betriebsgelände zu erweitern. Es galt die Arbeitsplätze hier zu erhalten. Die Firma hatte mit der Verlegung des Werkes in Billiglohnländer gedroht. Auch wenn später feststand, dass dies sich nicht für den Betrieb gerechnet hätte. Die Stadtkasse war weiter geschrumpft. Investitionen verschiedener Betriebe sorgten zudem für ausreichende Abschreibungsmöglichkeiten und so sanken die Steuereinnahmen mehr und mehr und der zusätzliche Abbau von Arbeitsplätzen, tat ein Übriges.
Der Vertrag ließ auf das Krankheitsbild der Stadt schließen und Bernd hätte intensiv daran zu arbeiten gehabt, diesen Patienten zu heilen oder ihn irgendwann gesundzuschreiben. Um das Problem der Innenstadt zu lösen, bedurfte es schon etwas mehr, als nur eine städtische Marketing GmbH zu gründen und diese damit zu beauftragen, die Situation zu verbessern. Das Krankheitsbild ließ somit nicht auf eine schnelle Heilung hoffen.
Eine erste Grundvoraussetzung, die ein zukünftiger Geschäftsführer hier mitbringen muss, ist zunächst ein selbstverständlich vorhandenes eigenes Rückgrat. In diesem Falle hat der Spruch, „nur wer über ein Rückgrat verfügt, dem kann man den Rücken stärken“, Gewicht. Hier ging es ja nicht wirklich darum, wie im Vertrag erwähnt, die Innenstadt mit Leben zu erfüllen, um so auf die sicherlich gerechtfertigten Beschwerden der Geschäfte in der Innenstadt zu reagieren, sondern der Politik zu helfen, Versäumnisse und Fehlverhalten aufzuarbeiten und abzustellen. Wie sehr ich mit meiner Einschätzung richtig lag, sollte sich später noch zeigen.
Eigentlich ging es weniger um Stadtmarketing, sondern um Wirtschaftsförderung. Mein Tipp für Bernd konnte jedenfalls nur sein, sich dringend noch einmal anwaltliche Beratung einzuholen. Ich denke es war klar, was diesen Vertrag ausmachte, ohne weiter ins Detail zu gehen.
Was diese Stadt somit braucht, ist hauptsächlich eine Förderung der Wirtschaft. Langfristig können nur Steuermehreinnahmen, die Stadt aus dieser Krise helfen. Das Zauberwort heißt Wirtschaftswachstum. Da Bernd schon im Januar 2003 in Varel seinen Posten antreten soll oder will, bleibt uns nicht allzu viel Zeit für die Überprüfung des Vertrages und den gleichzeitigen Aufbau eines für die Zukunft tragfähigen strategischen Konzepts. Daher nehme ich sofort den Kontakt zu einem alten Freund, dem Karsten Heinzmann, auf. Karsten ist Wirtschaftsprüfer und der einzige, der mir auf die Schnelle einfällt, um so Bernds Vertrag abzuklopfen und bei der Neugestaltung zu helfen. Ich hatte den Karsten vor vielen Jahren mal, über einen damals noch gemeinsamen Freund kennengelernt und weiß, dass er der Experte ist. Zudem kennt er sich besonders gut in den kommunalen Strukturen aus oder wie er es immer nennt: den kommunalen Sumpf.
Damit steht fest, dass der Vertrag, den Bernd unterschreiben will, angepasst werden muss. Der Begriff Stadtmarketing sollte in Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing abgeändert werden. Ich kann eine Stadt nur nach vorne bringen, wenn ich die Wirtschaft fördere, alles andere resultiert aus den Erfolgen der Wirtschaft.
Eine erste Idee, Arbeiten an einem strategischen Papier
Alles in Allem wird dringend ein Strategiepapier benötigt, das die Grundlage für alle künftigen Aktivitäten schafft, um so eine Stadt zukunftsfähig zu machen. Die Arbeiten hierzu müssen glücklicherweise nicht bei null beginnen. Die ersten Ideen hierzu hatten wir bereits vor Jahren entwickelt, um genauer zu sein vor rund 10 Jahren. Damals hieß sie Team 10 und setzte sich aus einer entsprechenden Anzahl von Partnern aus den verschiedensten Wirtschaftsbereichen zusammen. Doch kam diese Idee zu früh, der Markt war noch nicht dazu bereit. So enthielt bereits das damalige Konzept die wesentlichen Elemente, die jetzt hier zum Einsatz kommen könnten. Auch hier ging es darum Kunden umfassend zu beraten und zu bedienen.
Einer dieser ehemaligen aus dem Team, war Wilfried Schipper, der auch jetzt wieder mit infrage käme. Ich hatte Wilfried bereits vor der Gründung von Team 10, auf einer Veranstaltung der Technologietransferzentrale TTZ Schleswig-Holstein zur Förderung neuer innovativer Technologien, kennengelernt. Wir hatten uns, wie es halt häufig so ist, zufällig während einer größeren Pause im Speisesaal, für denselben Tisch entschieden und saßen uns gegenüber. Gesprächsthemen waren weniger die Einzelthemen der Veranstaltung, sondern die Stärkung der Marktpositionen unserer Firmen. Es stellte sich ziemlich schnell heraus, dass wir beide aus der Physik kamen. Wilfried tummelte sich noch ziemlich frisch auf dem Gebiet der Nanotechnologie bzw. der Herstellung von Hologrammen. Der zweite aus diesem Team 10 war Gerd Neuner, ein Pädagoge und damals an der Volkshochschule in Kiel tätig. Er hatte einen wesentlichen Beitrag für neue Konzepte im Bereich der beruflichen Bildung geleistet. So kam mit den Teampartnern eine beachtliche Kompetenz zusammen. Einige dieser Partner könnten jetzt zusammen mit anderen, die neue Basis bilden. Es gilt jetzt zügig auch die alte Idee von der neuen Form eines Gewerbepark aufzugreifen, jede Menge Daten über die gegenwärtigen Wirtschaftsstrukturen im friesischen Raum zu sammeln, diese zu analysieren, um dann einen Plan für das künftige Handeln zu entwickeln. Die Zeit rennt und 2002 gehört schon der Vergangenheit an.
Der erste Besuch im Rathaus Varel, Bureck-Busch-Bureck
In der Zwischenzeit hat Bernd seine Zelte in Varel aufgeschlagen und so steht Ende Januar mein erster Besuch in Varel an, beim zwischenzeitlich zum Geschäftsführer gekürten Bernd Bureck. Nun ich gehe nicht wirklich davon aus, ihn auf der großen Festwiese als den Direktor begrüßen zu dürfen, aber die Anschrift Windallee ließ einiges vermuten. Gut 250 Kilometer trennen uns von der heimischen Abfahrt bis ins ferne Friesland. Es ist nicht so sehr die reine Begeisterung oder Vorfreude auf diese Fahrt, nein ich freue mich auf ein Wiedersehen und bin doch auch gleichzeitig neugierig auf seine neue komfortable berufliche Unterkunft. Sie musste ja eine Steigerung zu Dannau darstellen. Die Fahrt selbst gibt mir viel Zeit, über unser, so wie es aussieht, zukünftiges Projekt nachzudenken. Wie verhalten sich hier vor allem die Politiker, sind sie entscheidungsfreudiger als im hohen Norden, in Schleswig-Holstein. Ich stelle eine innere Wunschliste auf, schließlich ist es von großer Bedeutung, eine Liste sein Eigen zu nennen. Selbstverständlich bestücke ich sie mit allem, vermutlich auch nicht erfüllbaren Dingen.
Wie fast immer, wenn ich in Richtung Süden auf Hamburg zufahre, treffe ich vor dem Elbtunnel auf einen kilometerlangen Stau. Ein Geschenk, der wohl hauptsächlich ehemaligen Hamburger Politiker an seine Bürger. Ich nehme an, dass diese wohl aus tiefsitzenden Ängsten einer immer wieder von Schleswig-Holstein und Niedersachsen geforderten Elbquerung nicht zugestimmt hatten. Hier in Hamburg ging damals, so habe ich mir berichten lassen, das Gespenst um, der Verkehr könnte an Hamburg vorbeirauschen und damit die Wirtschaftskraft der Hansestadt schwächen, die von den länger als persönlich geplant, eingeklemmten Fahrzeuginsassen ausgehen sollte. Es ist schlimm mit anzusehen, welche Ressourcen hier unnötig verlorengehen. Zeit, Treibstoff, Umwelt, alles wird hier vernichtet und die Wirtschaftskraft unseres Landes immer mehr gelähmt. Immerhin bekomme ich doch jede Menge Blickkontakt zu den Mitleidenden.
Mit Erstaunen stelle ich fest, wie beliebt wir Deutschen doch sind. All diese verzweifelt wirkenden Verbündeten aus unseren Nachbarländern, die Niederländer, Dänen, Spanier, Letten, Polen und auch ein paar Engländer oder besser Briten, die mit mir auf der Autobahn eingezwängt sind. Und diese Briten in ihren LKWs beweisen mir dann auch, dass das Linksfahren auch auf dem Kontinent noch nicht ganz abgeschafft ist. Rechts, so gehört es sich, stehen die PKW´s eingeklemmt zwischen den von wenigen Brummies zugestellten Ausfahrten. Links wird mehr geschoben als gefahren, hier haben sich die Großen die Spuren gesichert. Ich bin fasziniert von den schnellen LKWs, die sich mit bis zu 100 km in der Stunde in den Tunnel fallen lassen, um sich nach dem Durchfahren der tiefsten Stelle, genüsslich der natürlichen Geschwindigkeitsverzögerung hinzugeben. Deutschlands ganzer Stolz, die stehende Infrastruktur wird hier zu einem Erlebnis der besonderen Art.
Hier wird von politischen Schreibtischen aus, die Energievernichtung geprobt. Es kann nur Absicht sein, denn der Staat ist der einzige, der davon reichlich profitiert. Die auf den Spritpreisen aufgeschlagene Mineralöl- und Mehrwertsteuer ernährt unsere so liebgewonnenen Politiker, Beamte und all die öffentlichen Angestellten. Hier betreiben sie für sich aktive Existenzsicherung und so scheint es, als ob wir nur für sie, immer über die nächste Möglichkeit des Benzin- oder Dieselfassens nachdenken dürfen.
Aber im Ernst, ist man erst einmal durch dieses Nadelöhr Elbtunnel, so sieht es nach fast freier Bahn aus und ich denke nach 1 ½ Stunden für 35 Kilometer über einen Stopp an der A1 in Hollenstedt nach. Eine gute Entscheidung, es gibt LAVAZZA, endlich eine Kaffeetankstelle mit Niveau.
Zwei Blondinen, eine mit Pferdeschwanz mittelgroß und dunkelhaarig und die andere blondiert, groß und somit weitsichtig, die mittelgroße im Fernfahrerdialekt hamburgisch, die große weitsichtige im besten Sächsisch, beides zudem noch gefärbt mit den Dialekten und Sprachen der zahlreich hereinschneienden oder vorbeirauschenden Sprachkünstler. Ich informiere Bernd per Handy, dass es ein wenig später werden kann und kann endlich Gas geben bis 120 oder auch mal drüber. Wo es gefällt trifft man auf sogenannte Vogelkästen oder im Amtsdeutsch Radargeräte zur Überwachung der Einhaltung der Geschwindigkeiten. Da ich keine Lust auf Fotos habe, taste ich mich entsprechend bis Bremen vor, um hier die nächsten freundlichen Baustellen zu entdecken. Dann runter von der A1, rauf auf die A28 und in ab den nächsten Stau. Mich erwartet die kommende Raststätte. Hier will ich den nächsten Kaffee tanken und ein halbes Brötchen mit Mett bestrichen, genießen. Die Wahl fällt dann auch, bei soviel nicht vorhandener Qualität, nicht mehr schwer. Ich verziehe mich in die raucherfreie Raucherecke und darf sodann den sich schwerfällig setzenden alten Raucherduft als Nichtraucher kostenlos einatmen. Zu allem Übel hat sich das halbe Brötchen offensichtlich auch noch mit dem Duft verbündet und so sind beide für mich nur noch eine symbiotische Katastrophe. Mit anderen Worten: es schmeckt scheußlich. Was schon nicht schmeckt, muss dennoch entsorgt werden, als Belohnung für die florierende Marktwirtschaft sind nochmal 50 Cent erforderlich. Immerhin hier wird noch von Hand gereinigt und weiter geht’s erleichtert in Richtung A29, die mich dann, fast verlassen, endlich nach Varel führt.
Vorgewarnt erkenne ich einen dunkeln eckigen Protzbau. Ich kann nicht sagen, wer für diesen architektonischen Charme bezahlt wurde. Es scheint als solle der Bau, die geliebten Bürger vom nicht erkennbaren Treiben im Rathaus fernhalten. Bürgernah befindet sich rückwärtig und angrenzend zur Hauptsstraße der Parkplatz. Mein erster physischer Aufenthalt im fernen Nordwesten, in der Stadt Varel.
Überrascht stelle ich fest, dass auch im Innern eine mehr dunkle Atmosphäre vorherrscht, jetzt aber wohl, um den Bürger dazu zu bewegen, die Räume umgehend wieder zu verlassen. Auch eine Möglichkeit die Aufenthaltszeiten im Rathaus auf angenehme Weise zu verkürzen. Mein Mobile hilft mir, Bernd schnell ausfindig zu machen. Erster Stock, nach der Treppe rechts durch die breite Tür, dann wieder links und wie durch ein Wunder steht Bernd in der weit geöffneten Tür. Ich werde abgefangen, bevor ich auch nur einen ersten Blick in Machtzentrale der Stadt werfen kann.
Bernd dreht sich noch in der Tür stehend um und bittet mich, während er sich umdreht, den Rücken mir schon wieder halb zugewendet hat, die Tür zu schließen:
„Hier hört alles mit. Ich bin zwar erst seit einigen Tagen hier, aber jeder fühlt sich bemüßigt kurz reinzuschauen, um zu sehen wir es so läuft.
Der Bürgermeister kommt alle naselang durch die Tür und erzählt mir was alles von Bedeutung ist, wen ich alles aufsuchen soll und wer hier etwas darstellt.
Kurz, ich komme nicht zum Arbeiten, kann nichts vorbereiten. Es ist wichtig, so schnell wie möglich aus dem Rathaus zu kommen.
Ein eignes Profil, eigene Pläne lassen sich von hier aus nicht umsetzen.“
Erst jetzt nehme ich den Raum wahr, alles in dunkler Eiche oder halbdunkel, der Schreibtisch, Sideboards und Einbauschränke. Nichts worüber man schwärmend herfallen könnte. Hinzu kommen schwere Gardinen, durch die sich das Tageslicht in innere quält und diffus im Raum verteilt. Die Sicht auf das, was da draußen passiert, ist eher versperrt. Kein Raum der zum Aufbruch in neue Aktivitäten einlädt. Das Telefon klingelt, Bernd steht auf und sagt im Rausgehen: „Ich kann dich mal einen Moment zurücklassen.“ Ein Moment der nach zehn Minuten zu Ende ist.
Bernd war zum Bürgermeister gerufen worden und der wollte wissen, wer denn der Besucher bei ihm sei und was er wolle. Der Besucher war ich, sicherlich unschwer zu erraten. Wie Bernd mir erzählt, hat er dem Bürgermeister schnell erzählt, dass ich aus Schleswig-Holstein komme, Unternehmer sei und er, Bernd, mich von zahlreichen gemeinsamen Aktivitäten her kenne. Für ihn dem Bürgermeister spricht, dass er wissen wollte, was denn so einer aus Schleswig-Holstein hier wolle. So einen weiten Weg nimmt man nicht einfach mal so auf sich. Recht hat er!
Während meines immer noch kurzen Aufenthalts hier im Raum, geht dann die Tür mehrmals auf und zu. Entweder schauen die Leute kurz herein, um festzustellen, dass Besuch da ist. Dann heißt es:
„Ich komme nachher noch mal.“
oder es wird einfach nur die Post reingebracht. Kurz, alles typische Rathausaktivitäten. Bernd schaut mich mitleidig an und schlägt vor, diese Stätte umgehend zu verlassen. Irgendwohin, wo man sich ungestört unterhalten kann.
Und dann passiert es doch noch, ein kurzes starkes Klopfen an der Tür. Ohne ein Herein abzuwarten, öffnete sie sich und eine schmächtige angegraute, nicht unsympathische Amtsperson tritt mit den Worten ein:
„Oh, sie haben noch Besuch.“
Und zu mir gewandt:
„Busch, ich bin der Bürgermeister, sie interessieren sich für unsere Stadt!?“
Ich stelle mich mit einem Halbsatz vor und der Bürgermeister meint zu Bernd gewandt, dass er ihn später noch mal sprechen müsse. Ich bin erstaunt und zugleich davon begeistert, wie schnell es gehen kann, einen Bürgermeister kennen zu lernen.
Auf dem Weg nach draußen dann das hektische Treiben zweier, ich schätze Bedienstete, auf dem Weg zum Kopierer. So schnell habe ich noch nie ein Rathaus samt Innenleben und all seine Aktivitäten kennengelernt.
Im Wagen sitzend, schlägt Bernd vor, nach Dangast, in den zur Stadt gehörenden Kurort, zu fahren. Und wieder bin ich unterwegs. Zwar kenne ich diese extrem flache Landschaft an Norddeutschlands Westküsten, dennoch bin ich jedes Mal wieder beeindruckt wie sie, wie vom Nudelholz ausgewalzt, vor mir liegt. Über zahllose Umwege fahren wir durch schmale, endlos scheinende herrliche Alleen, um dann im Nordseebad Dangast anzukommen. Mein erster Eindruck vom Ort selbst: wie kann man hier nur Kuren oder gar Urlaub machen. Links und rechts hält die in den Ort führende Hauptstraße ein paar kleinere Hotels bereit. Rechts noch ein paar Geschäfte, wie eine Bäckerei oder ein Souvenirladen und das war’s. Dann breitet sich der wirklich beeindruckende Jadebusen vor uns aus. Wir haben, wie sollte es anderes sein, Ebbe und durch das wenige, über dem grauen Schlick ausgebreitete Wasser, wirkt das Ganze wie ein riesiger Spiegel, der die Sonnenstrahlen reflektiert, um mich zu blenden. Schließlich mündet die Hauptstraße in einen großen asphaltierten Wendebereich, rechts der Parkplatz, ein Schwimmbad und links eine hässliche unattraktive Wohnwagen- oder Zeltstadt, die mich mehr an ein Zigeunerlager, ok, sagt man nicht mehr, erinnert. Nachdem sich meine Augen etwas an die blendenden Strahlen gewöhnt haben, entdecke ich schließlich auf der gegenüberliegenden Seite die Silhouette, das Panorama der Stadt Wilhelmshaven. Und hier hat er, wie mir Bernd erzählt, als Jugendlicher das Surfen erlernt.
Bernd zeigt in Richtung Wilhelmshaven, wo der neue Tiefseehafen entstehen soll, der selbst bei Ebbe eine Wassertiefe von rund zwanzig Meter aufweisen wird, womit die nächste Generation von Containerschiffen, die einen Tiefgang von 16 ½ Meter haben werden, problemlos festmachen können. Ursprünglich war dieser, als ein Gemeinschaftsprojekt der drei Küstenländer Niedersachsen, Bremen und Hamburg geplant. Dann aber stiegen die Hamburger aus. Sie meinten, der Welthafen Hamburg würde ausreichen und ein Tiefseehafen nicht erforderlich sei. All dies obwohl bekannt ist, dass die nächste Containergeneration keine Chance mehr hat, in Hamburg festzumachen. Selbst wenn, wie von den Hamburgern favorisiert, die Elbe vertieft, also ausgebaggert werden würde, hätten die großen Schiffe keine Chance. Es spricht alles für Wilhelmshaven und mit den Vorbereitungen für den Tiefseehafen, dem Jade-Weser-Port, zeigt sich bereits jetzt eine nie da gewesene Dynamik in dieser Region.
Wir fahren ein kleines Stück zurück, biegen rechts ab, vorbei an der Wohnwagenstadt zum alten Kurhaus, einem Geheimtipp, von dem Bernd erzählt, dass es früher ein Künstlertreff gewesen sei. Leute wie der Kunstprofessor Joseph Beuys, Anatol Herzfeld, Willy Hink haben sich hier getroffen. Bis auf Beuys sagen mir die anderen Namen nichts. Beuys war für mich der Künstler, der sich mit ranziger Butter einen Namen gemacht hatte. Oder war es doch die Putzfrau, die dieses Kunstwerk zu beseitigen wusste und er Beuys oder doch sie, damit ihren und seinen Namen in der Welt der Künstler verewigte. Bernd hat Recht, es ist ein herrlicher Platz. Hier am Fenster zu sitzen, auf den Jade-Busen zu schauen und einfach nur das Frühstück zu genießen, entschädigt mich für die lange Fahrt.
Auf der Rückfahrt machen wir einen Abstecher in die Chemie, besser wir schauen uns von weitem die alte Wirkungsstätte von Ineos sowie die geplante neue an. Hier wird also Polyvinylchlorid, kurz PVC, hergestellt. Das Werk plant den Bau eines Chemieparks in Höhe von rund 1 ½ Milliarden Euro. All das macht für mich Sinn, nachdem ich weiß, dass sie den wichtigsten Rohstoff vor der Haustür haben. Die riesigen Salzvorkommen, laden gerade dazu ein, genutzt zu werden. Ganz nebenbei erfahre ich allerdings auch von den Problemen, die das Werk mit der Realisierung hat. Wie immer gibt es auf der anderen Seite auch Menschen, die hiervon nicht angetan sind. So gibt es Probleme mit der Genehmigung. Das vorgesehene Gelände wurde künstlich aufgeschüttet und dann sich jahrelang selbst überlassen, bis die Natur es eroberte und sich zudem noch ein Rohrdommelpärchen ungefragt niedergelassen hat. Bernd verspricht mir später noch ausführlicher davon zu erzählen. Zunächst einmal aber bin ich von dem gigantischen Potential hier beeindruckt und all dies in der Nachbarschaft oder besser im näheren Umkreis der Stadt Varel. Wieder geht die Fahrt weiter, jetzt über Etzel mit seinen riesigen Kavernen, die hier als Speicher für Rohöl und Erdgas genutzt werden. Schließlich erfahre ich noch einiges mehr über die eigentliche Vareler Wirtschaft, seine Betriebe, von denen viele in der Metallverarbeitung tätig sind oder in der Herstellung von Papier und Karton.
Bevor wir uns vor dem Rathaus wieder trennen, meint Bernd, dass er wohl in Kürze ins neu errichtete, aber noch nicht komplett fertige EWE-Gebäude, zieht. Damit sollte ein ungestörtes Arbeiten möglich sein. Wir verabreden die eigentliche Arbeitsaufnahme in Varel, erst nach seinem Umzug aufzunehmen. Bis dahin folgen wir der vereinbarten Arbeitsteilung: Bernd macht alles und ich den Rest. Selbstverständlich bezieht sich „Alles“ nur auf das Sammeln der benötigten Wirtschaftsdaten für Varel und Umgebung.
Für die Rückfahrt wünsche ich mir möglichst keine Staus, aber auch Bremen kann gut mit Hamburg mithalten. Wie immer nutze ich die Zeit für weitere Planungen, was die mögliche Struktur eines neuen Gewerbeparks anbelangt, welche Kontakte für das Projekt in Frage kommen bzw. erforderlich sind. Bereits Mitte 2002 hatte ich angefangen, mich gemeinsam mit Inhabern verschiedener mittelständischer Firmen mit ganz ähnlichen Fragen zu beschäftigen. Uns war klar geworden, dass wir nach neuen Wegen der Kooperation zu suchen hatten. Auch dabei ging es, um neue Formen der Zusammenarbeit. Dies geschah zwar in einem anderen und wesentlich kleineren Rahmen, als dies wahrscheinlich für Friesland erforderlich sein würde, aber die so gesammelten Erfahrungen konnten jetzt auch hier genutzt werden.
Das Ergebnis war und ist bis jetzt die CEETAS ein Center for Engineering-Environmental Technology and Applied Science. Geplant sind hier im Verbund mit unterschiedlichen Partnern und Firmen vom Juristen, Wirtschaftsprüfer, Ingenieuren, Naturwissenschaftler bis zum Architekten, neue Produkte unter einem Dach zu entwickeln und anzubieten. Insbesondere Martin Koselowske ist hier einer der treibenden Kräfte. Zusammen hat er mit seinem Partner in Kiel ein kleines, aber sehr gut geführtes Planungsbüro. Wenn einer für den zunächst klein zu haltenden Kreis von Beteiligten infrage kommt, ist er es.
Parallel zu den ganzen Planungsarbeiten, hatten jetzt viele Gespräche und Besuche zu laufen und Martin steht für mich ganz oben auf der Liste. Wenige Tage später treffen wir uns in seiner Firma, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Gärtnerstraße in Kiel befindet. Ich erzähle ihm von Bernd Bureck, der Idee und den aktuellen Stand.
Ein Konzept gewinnt an Profil, Erfordernisse an einen künftigen Industrie- und Gewerbecampus
Unsere Zielgruppen sind die Klein- und Mittelständler. In den folgenden Wochen hat die Politik Bernd voll im Griff, er wird rumgereicht und vorgestellt. Daneben plant er sein neues Büro, geht die vorhandenen Strukturen durch, telefoniert, besucht, spricht mit den wichtigen Größen der Stadt und in der Umgebung. Jeder Verein, jeder Kommunalpolitiker, die Firmeninhaber, Kurverwaltung und was es da sonst noch so gibt, alle haben Wünsche, Vorschläge oder geben einfach vor, was seine nächsten Schritte zu sein haben. Abends dann komme ich noch telefonisch hinzu und wenn es geht, treffen wir uns mindestens einmal in der Woche. Wenn er nach Hause kommt, ist es bereits spät in der Nacht, er sieht kaum seine Familie. Bereits nach diesen wenigen Wochen, die er hier ist, macht er auf mich schon einen angeschlagenen Eindruck und das, obwohl es doch gerade erst losgeht. Trotzdem, so sagt er, fühlt er sich wohl, liebt die neue Herausforderung.