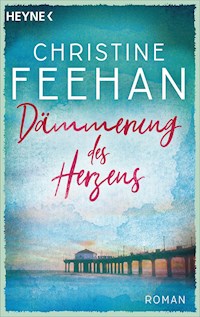9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der Bund der Schattengänger
- Sprache: Deutsch
Die schöne Bella ist eine Schattengängerin und damit Teil einer Gruppe herausragender Kämpferinnen und Kämpfer, deren Fähigkeiten von dem genialen Wissenschaftler Dr. Peter Whitney verstärkt wurden. Als Bella von einem unglaublichen Verrat erfährt, bricht sie mit Dr. Whitney und flieht in die Bayous, um die dort lebenden Schattengänger zu warnen. Einer von ihnen ist der attraktive Arzt Ezekiel, und als sich die beiden das erste Mal begegnen, fliegen augenblicklich Funken. Endlich fühlt sich Bella nicht mehr nur wegen ihrer besonderen Kräfte begehrt. Doch dann schlagen die Feinde zu, und Bella droht Ezekiel für immer zu verlieren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DAS BUCH
Bellisia ist eine Schattengängerin und damit Teil einer Gruppe herausragender Kämpferinnen und Kämpfer, deren Fähigkeiten von dem genialen Wissenschaftler Dr. Peter Whitney verstärkt wurden. Die schöne Spionin hat die Gabe, mit ihrer Umgebung zu verschmelzen, und ist die absolute Topagentin bei streng geheimen Undercover-Missionen. Als sie bei einem ihrer Einsätze erfährt, dass das Schattengängerteam rund um Ezekiel Fortune ausgeschaltet werden soll, flieht sie in die Bayous, um Ezekiel zu warnen. Dort angekommen, hätte Bellisia mit allem gerechnet, nur nicht damit, in den Bann von Ezekiels maskuliner Schönheit zu geraten. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt sich Bellisia um ihrer selbst willen begehrt und nicht aufgrund ihrer außergewöhnlichen Gaben. Doch Dr. Whitneys Häscher sind dem Paar dicht auf den Fersen, und schon bald droht Bellisia ihren Geliebten wieder zu verlieren …
DIE AUTORIN
Christine Feehan wurde in Kalifornien geboren, wo sie heute noch mit ihrem Mann und ihren elf Kindern lebt. Sie begann bereits als Kind zu schreiben und hat seit 1999 mehr als sechzig erfolgreiche Romane veröffentlicht, die in den USA mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet wurden und regelmäßig auf den Bestsellerlisten stehen. Auch in Deutschland ist sie mit ihrer Schattengänger-Serie, der Leopardenmenschen-Saga, den Drake-Schwestern und der Sea-Haven-Saga äußerst erfolgreich.
Mehr über Christine Feehan und ihre Romane finden Sie auf: www.christinefeehan.com
Christine Feehan
TÄNZERIN IM SCHATTEN
Ein Schattengänger-Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Für Neil und Lisa Benson von den »Pearl River Eco Tours«, zwei Menschen, die ich als sehr gute Freunde betrachte. Danke für alles, und wir vermissen Euch wahnsinnig!
DAS BEKENNTNIS DER SCHATTENGÄNGER
Wir sind die Schattengänger, wir leben in den Schatten.
Das Meer, die Erde und die Luft sind unsere Heimat.
Nie lassen wir einen gefallenen Kameraden zurück.
Wir sind einander in Ehre und Loyalität verbunden.
Für unsere Feinde sind wir unsichtbar, und wir vernichten sie, wo wir sie finden.
Wir glauben an Gerechtigkeit und beschützen unser Land und jene, die sich selbst nicht schützen können.
Ungesehen, ungehört und unbekannt bleiben wir Schattengänger.
Ehre liegt in den Schatten, und die Schatten sind wir.
Wir bewegen uns absolut lautlos, im Dschungel ebenso wie in der Wüste.
Unhörbar und unsichtbar bewegen wir uns mitten unter unseren Feinden.
Wir kämpfen ohne den geringsten Laut, noch bevor sie unsere Existenz überhaupt erahnen.
Wir sammeln Informationen und warten mit unendlicher Geduld auf den passenden Augenblick, um Gerechtigkeit walten zu lassen.
Wir sind gnädig und gnadenlos zugleich.
Wir sind unnachgiebig und unerbittlich in unserem Tun.
Wir sind Schattengänger, und die Nacht gehört uns.
DIE EINZELNEN BESTANDTEILE DES SCHATTENGÄNGERSYMBOLS
STEHT FÜR
Schatten
STEHT FÜR
Schutz vor den Mächten des Bösen
STEHT FÜR
Psi, den griechischen Buchstaben, der in der Parapsychologie für außersinnliche Wahrnehmungen oder andere übersinnliche Fähigkeiten benutzt wird
STEHT FÜR
Eigenschaften eines Ritters – Loyalität, Großzügigkeit, Mut und Ehre
STEHT FÜR
Ritter der Schatten schützen vor den Mächten des Bösen unter Einsatz von übersinnlichen Kräften, Mut und Ehre
1
BELLISIAADAMSWARF einen Blick in den Spiegel. Neben ihr saß JinJing, eine nette Frau, die keine Ahnung hatte, dass der Mann, für den sie arbeitete, ein berüchtigter Krimineller war und die Frau an ihrer Seite so wenig chinesisch wie der Mann im Mond. Bellisias langes, glattes Haar, das ihr bis zur Taille reichte, sah aus wie ein Wasserfall aus Seide. Sie war klein und zierlich und hatte kleine Hände und Füße. Sie sprach denselben Dialekt wie JinJing und scherzte und plauderte in der kurzen Pause im Aufenthaltsraum akzentfrei mit ihr.
Sie achtete darauf, dass ihr Herzschlag sich nicht beschleunigte, obwohl die erhöhte Aufmerksamkeit und Nervosität der Wachen ihr verrieten, dass das, worauf sie in der vergangenen Woche gewartet hatte, endlich geschehen würde. Und das war auch gut so. Denn bald lief ihre Zeit ab. Wie die meisten Techniker im Labor trug sie keine Uhr, doch sie war sich der Tage und Stunden, die verstrichen, sehr bewusst.
Als die Glocke erklang, winkte JinJing ihr zu und ging eilig zurück an die Arbeit. Jeder, der nach der Pause auf den Fluren erwischt wurde, wurde umgehend entlassen. Oder zumindest nicht mehr gesehen. Und man erzählte sich, dass einen in dem Fall wenig Angenehmes erwartete. Die Cheng Company bezahlte gut. Bernard Lee Cheng besaß viele Firmen und beschäftigte eine große Anzahl von Menschen, aber er war ein sehr anspruchsvoller Chef.
Bellisia konnte nicht länger warten. Außerdem durfte sie nicht im Aufenthaltsraum erwischt werden. Vorsichtig nahm sie ihre lange Perücke und die lebensechte Gesichtsmaske ab und wickelte beides in ihren weißen Laborkittel. Dann streifte sie die Arbeitskleidung ab, sodass der hautenge, einteilige Bodysuit, den sie darunter trug, zum Vorschein kam – er reflektierte ihre Umgebung. Schließlich zog sie die rutschhemmenden Schuhe mit den Kreppsohlen aus und steckte sie in die Kitteltaschen. Ihr hellblondes Haar hatte sie zu einem festen Zopf verflochten. Nun war sie einsatzbereit. Sobald der schmale Flur vor dem Aufenthaltsraum leer war, schlüpfte sie aus dem Zimmer. Dank ihres scharfen Gehörs wusste sie immer ganz genau, wo die Techniker auf der Etage sich gerade befanden. Und sie wusste auch ganz genau, wo die Kameras waren und wie sie sie umgehen konnte.
Schnell kletterte sie die Wand hoch an die Decke und verschmolz dabei mit der schmutzig weißen Farbe, die aussah, als hätte sie bessere Tage gesehen. Über den Flur des Laborbereichs kroch sie weiter zu den Büros, und dort wurde aus dem Weiß ein frisches Hellblau. Sie wechselte die Farbe, bis sie sich perfekt angepasst hatte, und verlangsamte ihr Tempo, denn jede Bewegung konnte ungewollte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und in dem Großraumbüro gab es viel mehr Angestellte als im Labor. Die meisten saßen in kleinen, offenen Kabinen, doch sie steuerte über eine Reihe von Arbeitsplätzen hinweg auf das eine große Büro zu, das wichtig für sie war. Kurz vor ihrem Ziel wechselte sie mit den Wänden erneut die Farbe in ein mattes Grün und schaute von außen durch die Glasscheibe.
In dem Büro saß eine Frau, mit dem Rücken zu ihr, den Blick auf den Mann hinter dem Schreibtisch gerichtet. Bernard Lee Cheng. Sie war mehr als nur versucht, ihn zu töten, die Chance, so nah an ihn herangekommen zu sein, zu nutzen und ihn einfach zu erledigen. Dann würde die Welt von einem sehr bösen Mann befreit sein, doch das war nicht ihre Aufgabe, so sehr sie es sich auch wünschte. Sie war auf die Frau angesetzt, die Senatorin Violet Smythe-Freeman – nun nur noch Smythe –, hauptsächlich um in Erfahrung zu bringen, ob diese Frau vorhatte, ihr Land zu verraten und damit auch die Schattengänger, denen sie selbst angehörte. Kaum jemand wusste von der Existenz dieser Spezialeinheit.
Es gab keine Möglichkeit, in das Büro hineinzukommen, aber das spielte keine Rolle. Vorsichtig kroch Bellisia über die Decke, vor aller Augen und dennoch unsichtbar. Selbst wenn einer von den Angestellten da unten zufällig hochgeschaut hätte, hätte er Schwierigkeiten gehabt sie zu entdecken, solange sie sich so langsam wie ein Faultier auf ihr Ziel zubewegte. Über der Tür zum Büro hielt sie an, blendete alle Geräusche um sich herum aus und konzentrierte sich auf die Stimmen, die herausdrangen.
Chengs Gesicht war ihr direkt zugewandt. Selbst wenn sie nicht jedes Wort verstehen konnte, das er sagte, weil sein Büro schalldicht war, konnte sie von seinen Lippen ablesen. Er wollte alles über das Schattengänger-Programm wissen. Akten. Alles, was es über sie gab – und ein paar von ihnen als Anschauungsmaterial, um sie zu sezieren. Bellisias Magen verkrampfte sich. Violet sprach sehr leise. Sie besaß die Fähigkeit, Menschen mit ihrer Stimme dazu zu bringen, ihr zu gehorchen, doch Cheng schien dagegen immun zu sein.
Sie wollte Geld für ihren Wahlkampf. Maurice Stuart, der Präsident werden wollte, hatte sie als Vizepräsidentin nominiert. Falls er gewählt wurde, wollte sie ihn ermorden lassen, damit sie das Amt übernehmen konnte. Dann hatte Cheng einen Verbündeten im Weißen Haus. Ein ganz einfacher Deal. Wo das Schwarzgeld herkam, brauchten sie nicht offenzulegen. Keiner würde jemals davon erfahren.
Violet war schön und intelligent. Und sehr gefährlich. Eine Soziopathin. Außerdem war sie weiterentwickelt worden. Sie gehörte zu den Ersten, die Dr. Whitney damals als Mädchen aus Waisenhäusern für seine Experimente geholt hatte, damit er Verbesserungen an seinen Soldaten vornehmen konnte, ohne ihnen selbst Schaden zuzufügen. Violet setzte ihr Aussehen und ihre Stimme ein, um zu bekommen, was sie wollte. Und mehr als alles andere wollte sie Macht.
Cheng nickte und beugte sich vor. Seine Augen waren stechend, sein Gesicht starr. Wieder nannte er seinen Preis. Die Akten und ein paar Schattengänger.
Reglos hörte Bellisia zu, wie Violet ihr Land und seine besten Soldaten verriet. Sie sagte Cheng, wo er ein Team finden und sich einen Schattengänger holen könne. Dann erklärte sie ihm, dass es an verschiedenen Orten Kopien der gewünschten Akten gebe, es aber meistens zu schwierig sei, an sie heranzukommen. Am ehesten sei es noch in Louisiana möglich, im Stennis Center.
Cheng blieb stur und bestand darauf, dass sie ihm die Akten besorgen solle. Sie erwiderte ebenso unnachgiebig, dass sie das nicht könne. Schließlich fragte Cheng sie, was sie eigentlich gegen das Schattengänger-Programm habe.
Bellisia versuchte, näher an die Tür zu kommen, als könnte sie dann besser hören. Der letzte Punkt interessierte sie nämlich auch. Schließlich war Violet eine von ihnen. Eins der ersten Waisenmädchen, die Peter Whitney für seine Zwecke benutzt hatte – eine »Schwester«, nicht blutsverwandt, aber in jeder anderen denkbaren Weise. Auch Violet hatte Experimente zur Steigerung ihrer übersinnlichen Fähigkeiten über sich ergehen lassen müssen, bei denen ihre DNA verändert worden war. Niemand zweifelte daran, dass Whitney ein Genie war, doch genauso sicher war, dass er verrückt war.
Violets leise Antwort entsetzte Bellisia. Die Frau war ein elender Snob. Supersoldaten waren für sie in Ordnung. Weiterentwicklungen mit tierischer DNA ebenso, aber nicht die mit der, die bei den letzten bekannt gewordenen Experimenten verwendet worden war – die von Schlangen und Spinnen. Das ging ihr zu weit und setzte ihrer Meinung nach die anderen Schattengänger herab. Sie wollte, dass alle mit dieser Art von DNA ausgemerzt wurden.
Eine kleine Pause trat ein, so als dächte Cheng über ihre überraschend heftige Hasstirade nach. Bellisia hätte ihr sagen können, dass sie sich in Gefahr gebracht hatte. Nur wenige wussten, dass Violet selber eine Schattengängerin war, doch nach diesem Wutanfall fragte sich ihr listiges, hochintelligentes Gegenüber, ob das, was er so dringend haben wollte, nicht direkt vor ihm saß.
Violet wirkte, als sei ihr die Gefahr, in der sie schwebte, nicht bewusst, hatte ihren Fehler aber wohl bemerkt, denn sie redete hastig weiter und brachte noch einmal ihre Forderungen vor. Dann fingen die beiden wieder an zu feilschen. Als Violet schließlich Anstalten machte zu gehen, hob Cheng eine Hand, um sie davon abzuhalten. Graziös ließ die Senatorin sich wieder auf ihren Stuhl sinken und besiegelte den Deal. Bellisia hörte noch eine Weile zu, während die beiden die Einzelheiten besprachen.
Sie rechnete sich aus, wie groß ihre Chancen waren zu entkommen, wenn sie die Verräterin tötete, sobald sie Chengs Büro verließ, und kam zu keinem guten Ergebnis. Trotzdem spielte sie mit dem Gedanken, so ungeheuerlich war der Verrat dieser Frau. Sie verachtete Violet aus tiefstem Herzen.
Eine plötzliche Aufregung im Büro riss sie aus ihren Gedanken. Wachen kamen hereinmarschiert und befahlen den Angestellten, den Raum zu verlassen. Bellisia spähte in den Flur und beobachtete, wie das gesamte Stockwerk geräumt wurde. Ehe sie es verhindern konnte, schlug ihr Herz schneller. Sie holte tief Luft, damit es sich wieder beruhigte, dann ging die Sirene los, die alle Mitarbeiter aus den Labors und Büros in die großen Schlaftrakte rief.
Das Gebäude wurde abgeriegelt. Weder konnte sie zurück in den Aufenthaltsraum, um ihre Verkleidung zu holen, ehe die Soldaten mit der Durchsuchung begannen, noch blieb ihr genug Zeit abzuwarten, sonst brächte der Virus, der ihr injiziert worden war, sie langsam um. Eine von Chengs endlosen Hausdurchsuchungen würde sie nicht überstehen. Er war so paranoid, dass er seine Angestellten schon mehr als einmal über eine Woche auf dem Gelände festgehalten hatte. Bis dahin wäre sie tot, wenn sie das Gegenmittel nicht bekam. In dem Augenblick, in dem ihre Sachen und ihre Perücke gefunden wurden, würde Cheng die Sicherheitsmaßnahmen bestimmt noch weiter verschärfen.
Langsam kroch sie wieder über die Decke zum Flur. Sie konnte unmöglich ins Erdgeschoss hinunter. Wachmänner strömten dort herein und hatten inzwischen jede Etage besetzt. Sie musste nach oben, zum einzigen Zufluchtsort, den sie vielleicht noch erreichen konnte. Auf dem Dach gab es Wassertanks, die die Sprinkleranlage speisten. Das war ihre einzige Möglichkeit, der Suche zu entgehen, die Cheng anordnen würde, sobald ihre Verkleidung entdeckt worden war. Das hieß, sie musste den Aufzug nehmen.
Während sie über der Aufzugstür wartete, fluchte sie innerlich in jeder Sprache, die sie beherrschte – und das waren einige. Auch die Wachen mussten den Lift benutzen, und das bedeutete, dass sie ihnen sehr nahe kommen würde. Alle waren bereits in Alarmbereitschaft versetzt worden und versammelten sich vor dem Aufzug. Der kleinste Fehler konnte sie das Leben kosten, denn obwohl sie imstande war, mit ihrer Umgebung zu verschmelzen, brauchten ihre Haut und ihr Haar ein paar Sekunden, um sich anzupassen. Ihr Bodysuit würde alles um sie herum spiegeln und sie wie einen Teil vom Aufzug aussehen lassen, doch ihr Kopf und ihre Hände und Füße würden für einen kurzen Moment sichtbar sein.
Mit klopfendem Herzen schob sie sich langsam näher an den Aufzug heran. Sollte sie sich jetzt gleich an ihn anpassen oder warten, bis sie mit einem Dutzend Wachen und Waffen in der Kabine war? Sie hatte die Wahl, aber eine falsche Entscheidung konnte tödlich sein. Sie wechselte die Farbe nicht so langsam wie ein Chamäleon, sondern so schnell wie ein Tintenfisch, dennoch dauerte es ein paar kostbare Sekunden. Sie begann sich zu verwandeln und konzentrierte sich zunächst darauf, dass ihre Hände und Füße nicht mehr von der Aufzugstür zu unterscheiden waren.
Ein Pling signalisierte, dass sie nur noch Sekunden hatte, um in die Kabine zu kommen. Sie wartete, bis die Wachleute einstiegen, schlüpfte mit ihnen hinein und hängte sich an die Decke. Die Tür hätte ihr beim Schließen fast den Fuß eingequetscht, aber sie konnte ihn noch rechtzeitig wegziehen. Auf dem engen Raum standen die Wachen dicht an dicht. Bellisia hatte das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Die Decke der Kabine war nicht sehr hoch, sodass sie den Männern sehr nah war und die größeren von ihnen sie fast mit dem Kopf berührten. Zweimal streifte das Haar des Mannes, der ihr am nächsten stand – und leider sehr groß war – tatsächlich ihr Gesicht und kitzelte sie.
Auf jeder Etage stiegen ein paar Wachen aus, um sie zu durchsuchen und sicherzustellen, dass alle Angestellten dem Ruf der Sirene gefolgt waren und sich unverzüglich in die Schlaftrakte begeben hatten, um sich dort einer Leibesvisitation zu unterziehen.
Die letzten Wachmänner fuhren bis zum Dach hinauf. Das war der gefährlichste Moment. Sie musste direkt hinter dem letzten aus dem Aufzug steigen und war darauf angewiesen, dass alle Wachen nach vorn schauten und nicht zurück zu den sich schließenden Türen. Ihre Tarnung war perfekt, doch auch diesmal würde es einige wichtige Sekunden dauern, bis sie sich an ihre neue Umgebung angepasst hatte.
Sie ließ sich auf den Boden herab, schlich hinter dem letzten Mann aus dem Aufzug und ließ den Blick über die Wassertanks auf dem Dach gleiten. Es gab insgesamt sechs, die die Sprinkler auf den verschiedenen Etagen versorgten. An die Wand gepresst, blieb sie still stehen, bis ihre Haut und ihr Haar von dem neuen Hintergrund nicht mehr zu unterscheiden waren. Erst dann begann sie langsam zu dem Tank zu kriechen, der ihr am nächsten war, während die Wachen ausschwärmten, um das lang gestreckte Dach abzusuchen.
In dieser Höhe blies ständig ein heftiger Wind, der recht tückisch war und die Männer ins Straucheln brachte, wenn sie von einer Böe getroffen wurden. Bellisia blieb so dicht am Boden, dass ihr Bauch ihn fast berührte. Als ein Wachmann in einer Mischung aus Mandarin und Shanghai-Chinesisch zu fluchen begann, erstarrte sie. Natürlich schimpfte der Mann nur über das Wetter, nicht über Cheng. Niemand hätte es gewagt, etwas gegen den Chef zu sagen, weil alle Angst hatten, dass er es erfahren würde.
Cheng betrachtete sich als Geschäftsmann. Sein Geschäftsimperium und seine Intelligenz hatte er von seinem chinesischen Vater geerbt, das gute Aussehen und den Charme dagegen von seiner amerikanischen Mutter, einem Filmstar. Beide Eltern hatten ihm die Türen geöffnet, in China und in den Vereinigten Staaten, und inzwischen hatte er Zugang zu fast jedem Land auf der Erde. Sein Imperium war doppelt so groß wie das seines Vaters, was ihn zu einem der reichsten Männer der Welt machte, doch um das zu erreichen, hatte er Terroristen, Rebellen und Regierungen geheime Informationen, Waffen und alles, was sie sonst noch brauchten, verschafft. Er verkaufte immer an den Höchstbietenden, und niemand legte sich mit ihm an.
Bellisia verstand nicht, was jemanden dazu trieb, so schlimme Dinge zu tun. Gier nach Geld? Oder Macht? Sie wusste, dass ihr Leben sich von dem anderer Menschen unterschied, aber ihrer Meinung nach war die äußere Welt nicht viel besser als ihre. Vielleicht sogar schlechter. In ihrer herrschten Disziplin und Strenge. Das war nicht immer angenehm, und sie konnte nicht sehr vielen Menschen vertrauen, doch der Mehrheit der Leute in der anderen Welt schien es nicht viel besser zu gehen.
Kurz bevor er über sie gefallen wäre, blieb der fluchende Wachmann stehen. Sein Lederstiefel war schon so nah gewesen, dass sie ihn spüren konnte. Mit angehaltenem Atem wich Bellisia ihm ganz langsam aus und kroch weiter. Ihre Bewegungen waren so kontrolliert, dass ihre Muskeln schmerzten und sich verkrampften. Ihr Herz hämmerte heftig, und sie hatte Mühe, ihre Atmung ruhig und gleichmäßig zu halten.
Sie war direkt vor der Nase der Männer. Sie brauchten nur nach unten zu blicken, um sie zu sehen, falls sie ihre Tarnung durchschauten. Aus den Augenwinkeln beobachtete sie sie und hörte ihnen zu, während sie abschätzte, wie weit es noch zu den Wassertanks war. Es schien ewig zu dauern, bis sie den Sockel des ersten erreichte. Ewig.
Sie hob eine Hand und klammerte sich mit den Härchen an ihren Fingerspitzen an die Außenwand des Tanks. Diese Härchen – Setae genannt – waren mikroskopisch klein und spalteten sich am Ende in unzählige noch feinere Härchen auf, die so dünn waren, dass man sie nicht sehen konnte, weshalb sie auch Dr. Whitney trotz seines Genies nicht an ihr entdeckt hatte. Die Haftkraft dieser Härchen an ihren Fingern und Zehen erlaubte es ihr, sich am Tank hochzuziehen. Jedes Härchen konnte eine unglaubliche Menge Gewicht halten, deshalb fiel es ihr so leicht glatte Wände hochzuklettern und kopfüber an der Decke zu hängen. Je größer das Lebewesen, desto kleinere Hafthärchen musste es haben, doch Setae, die das Gewicht eines ausgewachsenen Menschen halten konnten, hatte es wohl zuvor nicht gegeben – bis Dr. Whitney unwissentlich einen erschaffen hatte.
Bellisia hatte vor, sich im Wassertank zu verstecken und zu warten, bis die Lage sich beruhigt hatte. Dann wollte sie sich so weit wie möglich von Cheng entfernen. Sie war sich dessen bewusst, dass ihre Zeit knapp wurde und der Virus anfing, sich in ihrem Körper auszubreiten. Ihre Temperatur stieg bereits an. Das kalte Wasser im Tank würde ihr guttun. Sie verfluchte Whitney und die Tricks, die er sich ausgedacht hatte, um die Frauen an der Kandare zu halten.
Er hatte sie als Kinder aus Waisenhäusern geholt. Niemanden hatte es gekümmert, was aus ihnen wurde. So hatte er an den kleinen Mädchen herumexperimentieren können, ohne befürchten zu müssen, dass jemand sich einmischte. Er hatte sie nach Blumen und Jahreszeiten benannt und sie zu Soldatinnen, Killerinnen und Spioninnen ausgebildet. Damit sie wieder zu ihm zurückkamen, injizierte er ihnen entweder eine Substanz, die er Zenith nannte – eine Droge mit tödlicher Wirkung, die nur durch ein Gegenmittel neutralisiert werden konnte – oder einen Virus, der sie ganz langsam umbrachte. Manchmal erpresste er die Mädchen auch mit ihrer Freundschaft untereinander, sodass sie gelernt hatten, sorgfältig darauf zu achten, ihre Gefühle füreinander nicht zu zeigen.
Als Bellisia sich am Tank hochzog, wechselte sie noch einmal die Farbe und passte sich dem schmutzigen Hintergrund an. Die Böen zerrten an ihr und versuchten sie von der Wand zu reißen. Sie spürte, dass sie Fieber bekam, dennoch fror sie in dem kalten Wind und ihre Muskeln begannen taub zu werden. Trotz all dem zwang sie sich, langsam höher zu steigen und die Wachen im Auge zu behalten, die auf dem Dach herumliefen und jeden Winkel, in dem sich jemand verstecken konnte, gründlich untersuchten.
Plötzlich ging wieder eine Sirene los. Das schrille Heulen war unerträglich. Es klang anders als die Sirene zuvor, die alle unverzüglich in die Schlaftrakte befohlen hatte. Das hier war ein Kreischen, voller Wut und vor Zorn. Offenbar hatten die Wachen ihre Verkleidung gefunden. Sie würden das ganze Gebäude nach ihr durchkämmen. Jeden Schacht, jede Röhre. Jede Ecke, in die ein menschliches Wesen sich irgendwie hineinquetschen konnte.
Sie hatte sich ausgiebig über Cheng informiert, ehe sie sich in seine Welt begeben hatte. Es war eine kleine, strenge, autokratische Welt, in der man ständig auf Kontrollen gefasst sein musste und überall von Kameras und Wachen beobachtet wurde. Cheng traute niemandem, weder seinen engsten Verbündeten noch seinen Angestellten. Nicht einmal seinen Wachen. Deshalb beschäftigte er Wachpersonal, das wiederum die Wachen im Auge behielt.
Daran war Bellisia gewöhnt. Sie war in einem ähnlichen Umfeld groß geworden und daher damit vertraut. Außerdem kannte sie alle Tricks, die Kontrollen und Kameras zu umgehen. Ihr Nachahmungstalent war einzigartig. Sie konnte nicht nur die Farben ihrer Umgebung annehmen, sondern auch alles andere, die Sprache, die Dialekte, das Benehmen. Das hielt Whitney für ihre größte Gabe. Von ihren anderen Fähigkeiten, denen, die für die Einsätze, auf die man sie schickte, viel wichtiger waren, hatte er keine Ahnung.
Die Wachen reagierten auf die heulende Sirene, indem sie mit knallenden Stiefeln durcheinanderliefen und das Dach noch hektischer absuchten. Zentimeter um Zentimeter schob Bellisia sich weiter nach oben. Man brauchte Disziplin, um sich zurückzuhalten, statt dem Selbsterhaltungstrieb zu gehorchen und sich zu beeilen.
Sie verließ sich hauptsächlich darauf, dass sie nicht von ihrer Umgebung zu unterscheiden war, aber das hieß nicht, dass ein scharfäugiger Wachmann sie nicht doch entdecken konnte. Am Anfang hatte sie die Pigmentzellen in ihrer Haut gehasst, doch dann hatte sie begriffen, dass es ein Vorteil war, innerhalb von Sekunden die Farbe wechseln zu können. Whitney benutzte sie als Spionin und schickte sie ständig auf Einsätze, während viele der anderen Frauen wieder eingesperrt worden waren.
Gerade als ein Wachmann seinen Fuß auf die Leiter am Tank stellte, kam Bellisia oben an. Lautlos glitt sie ins Wasser, tauchte bis zum Boden hinab, heftete sich an die Wand, machte sich so dünn wie möglich und wurde wieder unsichtbar.
Sie liebte Wasser und hielt sich so oft wie möglich darin auf. Das kühle Nass linderte das Brennen ihrer Haut. An der Luft kam es ihr oft so vor, als würde sie austrocknen und jeden Augenblick in tausend Teile zerbrechen. Dann schaute sie immer wieder auf ihre Hände und Arme herunter, um sich zu vergewissern, dass dem nicht so war, doch obwohl ihre Haut glatt aussah, blieb das Gefühl. Die Umgebung, die für sie am schlimmsten war, war die Wüste. Whitney hatte sie mehrmals dorthin geschickt, um die Auswirkungen des Wüstenklimas auf sie zu testen, und sie hatte dabei nicht gut abgeschnitten. Eine erhebliche Schwachstelle, wie er es nannte.
Der Wachmann war jetzt oben am Tank und spähte ins Wasser. Sicher schauten die Männer in allen Tanks nach. Falls sie jemanden unter Wasser schickten, hatte sie wohl ein echtes Problem, aber es sah so aus, als genügte es dem Mann oben, auf dem Rand zu sitzen, um sich zu vergewissern, dass niemand sich unter Wasser versteckte. Sie ging davon aus, dass die Suche bei Anbruch der Nacht beendet würde, dann sollte sie imstande sein, an die Oberfläche zu kommen und Luft zu holen.
Augenblicklich genoss sie es, dass das Wasser das Fieber, das der Virus in ihr ausgelöst hatte, nicht weiter ansteigen ließ. Whitney hatte ihn ihr jedes Mal injiziert, wenn sie das Gelände verlassen hatte, auf dem sie festgehalten wurde. Es war ihr stets gelungen, ihren Einsatz in der vorgegebenen Zeit zu beenden, deshalb hatte sie keine Ahnung, wie schnell der Virus wirkte. Im Wasser ging es ihr definitiv besser, aber sie fühlte sich schlecht. Ihre Muskeln taten weh und verkrampften schon wieder. Das war nie gut, schon gar nicht wenn man versuchte, unter den suchenden Augen eines Wachmanns still auf dem Grund eines Wassertanks zu stehen.
Es wurde schnell dunkel, doch die Wachen waren immer noch auf dem Dach und das bereitete ihr Sorgen. Sie musste noch an dem Gebäude herunterklettern, und solange der Wachmann über ihr seinen Posten nicht verließ, kam sie nicht einmal aus dem Tank heraus. Außerdem brauchte sie Luft. Sie riskierte es, ein paar Luftblasen aufsteigen zu lassen, aber so würde sie nicht mehr lange durchhalten. Sie musste an die Oberfläche kommen und den Tank verlassen, ehe sie zu schwach wurde. Sie war sicher gewesen, dass der Wachmann nach einer Weile weggehen würde, aber er schien entschlossen, auf seinem Posten auszuharren. Lange würde sie nicht mehr unter Wasser bleiben können.
Doch sie wollte nicht in Panik geraten. Denn das wäre der sichere Weg in die Katastrophe. Sie musste Luft bekommen und einen Weg finden, sich an dem Wachmann vorbeizuschleichen, um zu dem Lieferwagen zu gelangen, in dem das Gegenmittel auf sie wartete. Sie stieß sich von der Wand ab und ließ sich nach oben tragen, ohne das Wasser in Bewegung zu versetzen. Wieder übte sie sich trotz ihrer brennenden Lungen in Geduld.
Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte sie die Wasseroberfläche. Sie legte den Kopf in den Nacken, damit nur ihr Mund sie durchbrach, und holte Atem. Was für eine Erleichterung. Nie hatte ihr Luft so gut geschmeckt. Reglos schwebte sie im Wasser, sodass selbst der Wachmann, der sie direkt anschaute, nichts als den schimmernden Wasserspiegel sah.
Ein Aufmarsch unten lenkte den Wachmann ab, und sie hängte sich an die Tankwand, um nach oben zu klettern. Doch sie war noch nicht einmal halb aus dem Wasser, als sie die Befehle verstand, die gerufen wurden. Haken sollten durch die Tanks gezogen werden, um ganz sicher zu gehen, dass kein Taucher sich darin verbarg. Inzwischen trampelten so viele Wachleute auf dem Dach herum, dass sie die Vibrationen bis in den Tank spüren konnte. Scheinwerfer gingen an und beleuchteten das gesamte Dach und alle sechs Behälter. Schlimmer noch, Wachmänner umringten jeden einzelnen, und andere kletterten daran empor und versammelten sich auf den Plattformen oben.
Langsam ließ Bellisia sich an der Wand entlang wieder ins Wasser gleiten. Ihr Herz klopfte schneller als je zuvor in ihrem Leben. Es fühlte sich an, als würde es jeden Augenblick aus ihrer Brust springen, dabei war sie nicht besonders ängstlich – normalerweise. Doch ihre Temperatur stieg beängstigend schnell. Ihr war sehr heiß und nicht einmal das kühle Wasser konnte noch verhindern, dass diese schreckliche innere Hitze immer weiter zunahm. Ihre Haut war überempfindlich. Alle Muskeln in ihrem Körper taten weh, und nicht nur das, es fühlte sich so an, als hätten sie sich fest verknotet. Dann begann sie so heftig zu zittern, dass sie es nicht mehr kontrollieren konnte. Das war nicht gerade hilfreich, wenn man sich in grellem Scheinwerferlicht und von Feinden umringt verstecken wollte.
Sie blieb nah am oberen Rand des Tanks, direkt unter der Wasseroberfläche, und presste sich an die Wand. Man musste immer damit rechnen, bei einem Einsatz zu sterben. Das war ein Grund für den … Adrenalinrausch dabei. Es ging darum, ihre Fähigkeiten am Gegner zu messen. Wenn sie nicht gut genug war und einen Fehler machte, war das ihre Schuld. Aber das hier … Peter Whitney hatte sie absichtlich geschwächt. Er war bereit zu riskieren, dass sie einen qualvollen Tod starb, nur um eins klarzumachen.
Sie gehörten ihm. Alle. Jedes einzelne Mädchen, das er aus dem Waisenhaus geholt und für seine Experimente benutzt hatte. Einige waren daran gestorben. Doch das war ihm nicht wichtig. Keine von ihnen war ihm wichtig. Nur die Wissenschaft. Und die Soldaten, die er erschuf, nachdem er seine Forschungen an den Mädchen abgeschlossen hatte. Kinder, die nie eine Kindheit gehabt hatten. Und keine liebevollen Eltern. Sie hatte nicht einmal gewusst, was das überhaupt war, bis ihr in der Welt draußen bewusst geworden war, dass die meisten Menschen anders lebten als sie.
Natürlich hatten die Mädchen darüber diskutiert, ob sie flüchten sollten, ehe Whitney sie für das ekelhafte Programm benutzte, das ihm Babys für weitere Experimente liefern sollte. Doch der Gedanke, das einzige Leben hinter sich zu lassen, das sie je gekannt hatten, hatte sie abgeschreckt. Aber das hier – sie in einem fremden Land sterben zu lassen, weil sie aus Gründen, für die sie nichts konnte, zu spät zurückkehrte – war gemein. Sie hatte die Informationen, die Whitney brauchte, doch da er sie vor ihrer Abreise mit dem Killervirus infiziert hatte, bekam er sie womöglich nie. Der Mann liebte es, Gott zu spielen. Und er war bereit, eine von ihnen zu opfern, um den anderen so viel Angst einzujagen, dass sie ihm gehorchten.
Plötzlich schlug irgendetwas hart auf dem Wasser auf. Bellisia erschrak so sehr, dass sie sich beinah von der Wand losgerissen hätte, und schaute mit zusammengekniffenen Augen in die hellen Lichter, die ins Wasser schienen. Sie konnte sich nicht mehr verstecken. Der kühle, dunkle Tank – ein sicherer Ort – war so hell erleuchtet, dass man fast bis auf den Grund schauen konnte. Als ein riesiger Haken kreischend über den Boden schrammte, erschauerte sie.
Mit einem Unheil verkündenden Klatschen fiel ein zweiter Haken ins Wasser, während der erste wieder hochgezogen wurde. Die nächsten Minuten waren ein Albtraum, in dem der Boden nach und nach mit den Haken abgesucht wurde. Hätte ein Taucher mit Ausrüstung sich dort verborgen, wäre er in Stücke gerissen worden.
Als die beiden Haken wieder eingeholt wurden, stieß Bellisia erleichtert den Atem aus. Bald würden die Männer gehen, und sie konnte fliehen. Sie merkte, wie sie immer schwächer wurde, doch sie hatte noch genug Kraft, um vom Dach herunterzuklettern und den Wagen zu erreichen, in dem Whitneys Supersoldaten darauf warteten, ihr das Gegenmittel zu verabreichen, das dafür sorgte, dass der gefährliche Virus statt zum Tode zu führen nur eine harmlose Krankheit auslöste.
Als wieder ein Haken aufs Wasser aufschlug, zuckte sie zusammen. Fast hätte sie sich von der Wand gelöst, denn nun wurde das Eisen daran hochgezogen, während der zweite Haken wieder ins Wasser klatschte. Das war … schlecht. Sie konnte nirgendwohin. Wenn sie dem Haken zu schnell auswich, würde man sie entdecken. Wenn sie es nicht tat, würde der Haken sie zerfleischen. Was sie auch anstellte, sie war so gut wie tot.
Das Geräusch, das der Haken machte, als er an der Wand entlangschrammte, wurde unter Wasser verstärkt und hörte sich schauderhaft an. Sie sah zu, wie er langsam vom Boden hochkam und immer näher rückte. Der andere Haken war fast auf gleicher Höhe und fräste lange Kratzer in das Stück Wand daneben.
Bellisia versuchte den Zeitpunkt zu berechnen, an dem sie loslassen musste, damit keiner der beiden Haken sie traf und den Männern am anderen Ende signalisierte, dass sie auf ein Hindernis getroffen waren. Vorsichtig stieß sie sich ab, schlüpfte zwischen den beiden Ketten hindurch und versuchte so langsam wegzuschwimmen, dass es nicht auffiel. Dann tauchte sie mit kräftigen Armzügen weiter nach unten und drückte sich unterhalb der Haken wieder möglichst nah an die Wand. Wenn sie sich einfach an den bereits gefassten Plan hielt, hatte sie eine gute Chance, auch diese letzte Gefahr zu überstehen.
Weiter nach unten zu gehen hatte den Vorteil, dass es dort dunkler war, weil das Licht nicht ganz bis zum Grund drang. Sie musste nur den Haken entkommen, die immer wieder ins Wasser sanken. Wenn sie tief genug war, konnten die Wachen oben sie nicht sehen, selbst wenn sie eine schnelle Bewegung machte, um nicht aufgespießt zu werden.
Sie hatte den halben Weg zum Boden geschafft, als die Haken wieder herabfielen und an der Wand nach oben schrammten. Wieder verharrte sie reglos und ertrug das gruselige Geräusch, aber ihr Herz klopfte heftig, als die Haken näher und näher kamen. Diesmal schlug sie einen langsamen Purzelbaum, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Das brachte sie noch etwas weiter nach unten. Sie verstand nicht, wie die Wachen glauben konnten, dass jemand imstande war, so lange unter Wasser zu bleiben, denn einen Taucher mit Pressluftbehältern auf dem Rücken hätten sie längst entdeckt.
Doch die Wachen waren sehr sorgfältig, ließen die Haken immer wieder eintauchen und zogen sie an den Wänden hoch, ohne auch nur ein kleines Stück auszulassen. Sie mussten diese Methode so lange trainiert haben, bis sie sie perfekt beherrschten. Natürlich. Die Tanks waren groß und Cheng war paranoid. Bellisia hatte keinen Zweifel daran, dass die vielen Etagen im Haus nicht weniger gründlich durchsucht wurden.
Während sie unter Wasser den Haken lauschte, die die Wände zerkratzten, dachte sie über den Unterschied zwischen Cheng und Whitney nach. Beide hatten viel zu viel Geld. Whitney schien ein Getriebener zu sein, dessen Forschungen immer weniger mit Menschen und immer mehr mit hellem Wahnsinn zu tun hatten. Keine Regierung würde das, was er tat, jemals genehmigen, dennoch ließ man ihn gewähren. Zumindest wollte er, wenn auch aus verqueren Gründen, bessere Soldaten für sein Land produzieren.
Cheng hatte, soweit sie wusste, nichts mit der chinesischen Regierung zu tun. Er arbeitete zwar eng mit ihr zusammen, war aber kein Patriot. Er dachte nur an sich. Er schien noch mehr Geld und Macht haben zu wollen, als er ohnehin schon besaß. Sie hatte viel über ihn in Erfahrung gebracht und nur wenige auf der Welt hatten mehr als er. Dennoch reichte es ihm nicht. Er hatte keine Familie. Niemanden, mit dem er sein Leben teilte. Er interessierte sich nicht für Forschung und Wissenschaft. Sein einziger Lebenszweck bestand darin, Geld anzuhäufen.
Bellisia merkte, dass ihr Herz mühsamer schlug und der Druck auf ihre Lunge immer stärker wurde. Das war ungewöhnlich. Sie hatte tief Luft geholt, daher hätte sie noch etwas Zeit haben müssen, ehe sie gezwungen war wieder aufzutauchen, aber sie hatte das Gefühl, etwas zu lang unter Wasser geblieben zu sein, selbst für ihre Verhältnisse. Sie hätte sich denken können, dass Whitney etwas finden würde, das ihre besonderen Fähigkeiten im Wasser beeinträchtigte. Offenbar wollte er nicht, dass sie ihr zur Flucht verhalfen.
Sie hatte keine andere Wahl, als wieder an die Oberfläche zu steigen. Sie versuchte an der Seite des Tanks zu bleiben, die bereits abgesucht worden war. Es machte ihr Angst, wieder in die Nähe der großen, schweren Haken zu kommen, die pausenlos gegen die Wand stießen. So gründlich, wie die Soldaten vorgingen, war es fast unvermeidlich, irgendwann getroffen zu werden, und tatsächlich war es kurz darauf so weit. Ein Haken, der vom Boden schräg nach oben gezogen wurde, streifte ihren Rücken und ihren Arm, und obwohl sie sich ganz klein machte und das Wasser ihn abbremste, traf er sie hart.
Sie spürte, wie seine Spitze ihre Haut aufschlitzte. Es war keine tiefe Wunde, aber sie brannte wie Feuer und sie blutete. Sie musste sich darauf konzentrieren, die Blutung zu stoppen, damit die Wachmänner nichts bemerkten. Unter ihrer Haut gab es ein Netzwerk aus sehr flexiblen Muskeln, die ihr halfen, die Farbe und Struktur ihrer Haut zu verändern. Die zog sie nun zusammen, damit kein Blut ins Wasser gelangte, wenigstens nicht bevor die Schweinwerfer ausgemacht wurden.
Der Aufstieg schien ewig zu dauern. Ihre Lunge war kurz vor dem Bersten, und ihre Muskeln verkrampften, während das furchtbare Klatschen und Kratzen der Haken immer weiterging. Zweimal entging sie ihnen nur ganz knapp, dann ritzte wieder eine Spitze ihre Haut. Diesmal fiel es ihr schwerer, die Blutung zu unterbinden, weil sie schwächer wurde und an die Oberfläche kommen musste, ehe ihre Muskeln ihr gar nicht mehr gehorchten.
Als die Haken schließlich aus dem Wasser gezogen wurden und die Soldaten wieder aufs Dach herunterkletterten, war sie sehr erleichtert. Schnell brachte sie den verbleibenden guten Meter bis zur Oberfläche hinter sich und schnappte heftig nach Luft. Dann hängte sie sich einige lange Minuten an die Seitenwand, lehnte den Kopf an und versuchte gegen das Fieber anzuatmen, das in ihr wütete. Sie konnte nicht länger für Whitney arbeiten. Sie würde das nicht überleben. Er gab ihnen allen das Gefühl, nichts wert zu sein. Sie wusste, dass sie nicht die Einzige war, die vor ihm fliehen wollte, weil sie alle ständig darüber redeten, spätnachts, wenn der ein oder andere von ihnen die Kameras und Mikrofone lahmgelegt hatte und sie allein im Schlafsaal waren.
Sie hatte versucht, mit ihrer besten Freundin Zara eine Flucht zu planen, doch ehe es dazu kommen konnte, hatte Whitney Zara auf eine geheime Mission geschickt und Bellisia den Auftrag gegeben herauszufinden, ob die Senatorin ihn betrog. Er hatte dafür gesorgt, dass Violet nach dem Tod ihres Mannes dessen Senatorenposten bekam. Trotzdem traute Whitney ihr nicht, obwohl er sie, wie Bellisia vermutete, mit sich verpaart hatte. Wenn das stimmte, hielt die körperliche Anziehung Violet jedenfalls nicht davon ab, gegen den Mann zu intrigieren, der sie ihr Leben lang benutzt hatte.
Langsam kletterte Bellisia aus dem Wassertank. Sie musste irgendwie trocken werden, ehe sie quer übers Dach zur Kante laufen konnte, sonst entdeckte vielleicht einer der Wachmänner ihre feuchte Fährte. Die Plattform rund um den Tank war noch warm von den leistungsstarken Schweinwerfern, deshalb legte sie sich lang hin und nahm die Farbe der schmutzigen Holzplanken an.
Sie wagte es nicht zu schlafen, solange die Wachen noch auf dem Dach waren, aber sie schienen sich damit zu begnügen, es nach einem bestimmten Muster der Länge nach abzuschreiten und immer wieder die Ecken zu kontrollieren, die als Versteck dienen konnten. Offenbar hatten diese Männer ebenso viel Angst vor Cheng wie sie und die anderen Frauen vor Whitney. Denn ein Leben war diesen beiden Männern nichts wert, zumindest das anderer nicht.
Sobald sie sicher war, dass sie keine Spuren hinterlassen würde, begann sie, langsam am Tank herunterzuklettern. Ihr war jetzt so heiß, dass sie fürchtete, ihre Haut würde aufplatzen. Ihre Muskeln gehorchten nicht mehr richtig und sie konnte nicht aufhören zu zittern. Das war kein gutes Vorzeichen für den Rest der Flucht, doch wenigstens war es dank der inzwischen gelöschten Scheinwerfer sehr dunkel. Sie hoffte, dass die Dunkelheit ihr Zittern verbarg, falls ein Wachmann ihr zu nah kam.
Sie brauchte fast vierzig Minuten, um am Gebäude herabzusteigen. Der Virus war unerbittlich und das Fieber so hoch, dass es ihr vorkam, als würde sie von innen heraus verbrennen. Für eine Frau wie sie, die mehr Wasser brauchte als andere Menschen, war das die reine Qual. Als hätte Whitney sich diese Tortur extra für sie ausgedacht – und wahrscheinlich war es auch so. Doch das bestärkte sie nur in dem Entschluss, nicht mehr zu ihm zurückzugehen.
Sie ruhte sich einen Moment aus, um sich zu erholen und ihren nächsten Schritt zu planen. Sie brauchte das Gegenmittel sofort, und das hieß, sie musste sich wieder in Whitneys Hände begeben. Sie hatte keine andere Wahl. Langsam ging Bellisia über eine Rasenfläche zu der Straße, in der der Lieferwagen auf sie wartete. Sie hatten ihn einen Block weiter unten geparkt, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, und das bedeutete, dass er direkt neben dem Fluss stand.
Als sie den Wagen erreichte, taumelte sie bereits, und Gerald, einer der Supersoldaten, die über sie wachen sollten, sprang heraus, fing sie auf und trug sie hinein. Hastig legte er sie auf eine Liege und zog sein Handy, um Whitney zu melden, dass sie wieder da sei. Bellisia schloss die Augen und ließ den Kopf zur Seite sinken, als hätte sie das Bewusstsein verloren.
»Ich will wissen, was sie herausgefunden hat«, sagte Peter Whitney. »Holt es aus ihr heraus, ehe ihr ihr das Gegenmittel gebt. Dann bringt ihr sie zum Flugzeug. Ihr fliegt nach Italien.«
Fast wäre Bellisia das Herz stehen geblieben. Mehrere Frauen waren dort hingebracht worden, weil sie schwanger werden sollten. Dem Zuchtprogramm in den Vereinigten Staaten hatten die Schattengänger ja ein Ende bereitet. Sie würde auf gar keinen Fall nach Italien gehen.
»Whitney will einen Bericht«, sagte Gerald.
Sie atmete weiter ganz flach und mühsam. Die Augen geschlossen, die Muskeln schlaff.
»Bellisia, Schätzchen, komm schon, komm zu dir. Du brauchst das Gegenmittel. Aber ich darf es dir nicht geben, bis du ihm gesagt hast, was er wissen will.«
Sie rührte sich nicht. Gerald und Adam passten bei fast jedem Einsatz auf sie auf. Dabei hatten sie sich irgendwie angefreundet, soweit man mit seinen Wächtern befreundet sein konnte. Trotzdem täuschte sie einen Zusammenbruch vor.
»Wir verlieren sie, Doc«, meldete Gerald, während Adam ihren Arm nahm und den Ärmel ihres Bodysuits hochschob.
»Pass auf. Sie könnte dir etwas vormachen«, warnte Whitney.
»Nein, sie ist bewusstlos. Sie ist viel später zurückgekommen, als sie sollte. Vielleicht können wir sie nicht mehr retten. Das Gebäude ist abgeriegelt worden, während sie noch drin war«, drängte Gerald.
»Habt ihr Violet oder irgendeinen von ihren Leuten gesehen?«, fragte Whitney.
»Nein, haben wir nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die Senatorin da war oder nicht«, erwiderte Gerald. Bellisia bezweifelte, dass das stimmte. Er konnte die Senatorin sehr wohl gesehen haben, aber Gerald und Adam waren nicht immer damit einverstanden, wie Whitney die Frauen behandelte.
»Seht nach, ob sie wirklich bewusstlos ist.«
Gerald schüttelte sie heftig. Sie reagierte nicht.
»Sie verbrennt fast. Und sie blutet am Rücken und am Oberschenkel.«
»Gebt ihr die Spritze. Sie wird Wasser brauchen.«
»Los, Adam, das Gegenmittel, schnell. Und sie braucht Wasser.«
Bellisia spürte den Einstich der Nadel und das Brennen des Gegenmittels, als es in sie eindrang. Sie hielt ganz still, denn sie wusste nicht, wie schnell es wirken würde. Sie hasste Spritzen; wenn sie sich in ihre Haut bohrten, wurde ihr oft schlecht, denn durch die doppelte Reihe von Muskeln direkt darunter tat jeder Stich höllisch weh.
»Der Doc sagt, wir sollen ihr Wasser geben.«
Adam hielt eine Flasche hoch. »In dem Zustand kann sie nicht trinken.« Das verriet Bellisia, dass er vor lauter Sorge um sie nicht mehr klar dachte – sonst hätte er gewusst, dass sie in Wasser getaucht werden musste.
»Das braucht sie auch nicht. Gieß es über sie.«
Kühles Wasser rann über ihren Arm und ihre Brust. Die Erleichterung war so groß, dass sie fast die Kontrolle über Herzschlag und Atmung verloren hätte.
»Das reicht nicht. Nimm den Eimer, und hol was aus dem Fluss.«
Adam stieß die Türen des Lieferwagens auf und sprang heraus. Dank ihres scharfen Gehörs schnappte Bellisia Whitneys missbilligendes Zischen auf. Es gefiel ihm offenbar nicht, dass sie so nah an einem Fluss waren. Für sie war das wie ein Signal: Sie musste die Gelegenheit nutzen.
Mit einem Satz war sie von der Liege herunter und landete neben einem verdutzten Adam.
»Halt sie fest«, schrie Gerald.
Adam dicht auf den Fersen, rannte sie über die Straße. Um ein Haar hätte er sie geschnappt, ehe sie in den Fluss springen konnte, doch dann schlug Wasser über ihr zusammen, und höchst willkommene kühle Nässe umfing sie.
2
MIT DER PFEIFE in der Hand wiegte Grace Fontenot sich in ihrem knarrenden Schaukelstuhl langsam vor und zurück und betrachtete die Aussicht. Sie lebte seit siebenundsechzig Jahren auf dem Land der Fontenots und seit zweiundachtzig Jahren im Sumpfgebiet und hatte jede Minute davon geliebt. Ihre Knochen sagten ihr, dass sie alt wurde, aber sie hatte noch viel zu tun. Sie musste für ihre Jungs sorgen. Dass diese Jungs inzwischen erwachsene Männer waren, spielte keine Rolle; die meisten hatten nie ein Zuhause gehabt und nie einen Menschen, der sie liebte, und sie war entschlossen, ihnen beides zu verschaffen, ehe sie das Zeitliche segnete.
Ihr Mann hatte das Haus mit der Hilfe seines Vaters an genau dieser Stelle mit eigenen Händen erbaut, damit sie immer auf den Fluss schauen konnte. Ihre Enkelsöhne hatten das Gebäude dann modernisiert und es mit einigen angenehmen Dingen ausgestattet. Das ständige Summen der Insekten war eine wunderschöne Musik, die sie jeden Morgen beim Aufwachen begrüßte. Das Wasser, das an den Steg klatschte, und der Wind, der die Zypressen rascheln ließ, vervollständigten die Symphonie, der sie nun schon so viele Jahre lauschte, seit sie sich damals ihren Mann ausgesucht hatte. Und sie hatte gut gewählt. Sie bereute nichts.
Sie hatte ihren Mann, ihren Sohn und ihre Schwiegertochter bei einem Unfall verloren, aber ihr waren vier Enkelsöhne geblieben, um die sie sich kümmern musste, also hatte sie sich zusammengerissen. Diese Enkel hatten wiederum andere Männer mit zu ihr gebracht – Männer mit gequälten Blicken, die dem Tod ins Auge geschaut hatten. Die Dinge gesehen und erlebt hatten, die niemand sehen oder erleben sollte. Diese Männer dienten ihrem Land auf eine Weise, die die meisten Menschen sich nicht vorstellen konnten. Sie fragte sie nicht danach, denn auch wenn sie mehr darüber erfahren hätte, hätte es ihnen nicht geholfen. Außerdem waren das keine Männer, die viel von sich preisgaben.
Sie gab ihnen einfach ein Zuhause. Etwas, wohin sie zurückkommen konnten. Etwas, das sie daran erinnerte, wofür sie kämpften. Sie waren sehr verschlossen, ihre Jungs. Inzwischen hatte sie neun weitere unter ihre Fittiche genommen. Außerdem waren zwei Töchter dazugekommen, als zwei ihrer Enkel geheiratet hatten, und nun hatte sie drei Urenkelinnen. Später hatte Trap, einer der Männer aus dem Team ihres Enkels, ebenfalls geheiratet, und auch seine Frau Cayenne war für sie wie eine Tochter geworden.
Nachdenklich paffte Nonny ihre Pfeife. Sie hütete sich, zu viele Fragen zu stellen. Sie wusste, dass ihre Jungs etwas mit einem Regierungsprogramm zu tun hatten, das sie verändert hatte. Und wie alles, was von der Regierung kam, war dieses Programm höchstwahrscheinlich nicht gut. Ihre Urenkelinnen waren bei einem fehlgeschlagenen Experiment entstanden, bei dem menschliche DNA mit Schlangen-DNA kombiniert worden war. Die drei kleinen Mädchen hätten wie ihre Mutter Pepper und Cayenne getötet werden sollen, doch die Jungs hatten sie alle gerettet und in ihr Haus gebracht.
Nonny biss auf den Pfeifenstiel, um die Cajun-Flüche zu unterdrücken, die ihr beim Gedanken an diese ungeheuerlichen Experimente zu entschlüpfen drohten. Sie wurden natürlich geheim gehalten. Und das bedeutete, dass diese wahnsinnigen Wissenschaftler ungestraft Dinge tun konnten, die nie einem Menschen angetan werden sollten, und das alles nur, weil sie den perfekten Soldaten erschaffen wollten.
»Nonny? Pepper sagt, du suchst mich.«
Die leise Stimme schreckte sie aus ihren Gedanken. Sie hörte ihn nie kommen. Niemand schaffte das. Mit Ezekiel Fortunes hatte sie eine wirklich harte Nuss zu knacken. Aber sie glaubte, dass ihr Alter ihr dabei einen Vorteil verschaffte. Dieser Mann redete nicht viel. Er hatte seltsame, bernsteinfarbene Augen, die meist einen kühlen, kräftigen Whiskey-Ton hatten. Manchmal schimmerten sie aber auch wie altes Gold aus der Renaissance, einer Zeit voller Kämpfe und Intrigen. Und hin und wieder glühten sie sogar wie geschmolzene Lava, die einen Berg hinunterfließt.
Diese Augen waren zu alt und viel zu gefühllos – es sei denn, er schaute seine beiden Brüder an, dann sprühten sie vor Leben. Und Liebe. Er hatte viele Talente, es war ihm nur nicht bewusst. Er hatte sich auf der Straße behauptet. Im Dschungel. Und in der Wüste. Er war definitiv nicht leicht zu lenken. Sie musste vorsichtig sein.
»Alles in Ordnung, Nonny?« Seine Stimme war leise und sanft, beinah weich, auch wenn dieser Mann sonst nichts Sanftes und Weiches an sich hatte.
Nonny nickte, schaukelte weiter und betrachtete ihn stumm, während sie noch einmal an ihrer Pfeife zog. Er sah umwerfend aus. Aber er war ein harter Brocken. Rau und gefährlich. Das konnte er nicht verbergen, man sah es ihm an. Und er sah nicht nur so aus, er war es auch, deshalb war niemand so dumm, sich mit ihm anzulegen.
Sein schwarzes Haar war ein wenig zu lang, weil er sich nur selten die Mühe machte, es zu schneiden. Da er beim Militär war, war es gut, dass er zur Spezialeinheit der Schattengänger gehörte und die Haare nicht kurz tragen musste, denn sie war ziemlich sicher, dass er sich an eine solche Regel nicht gehalten hätte. Er lebte nach seinen eigenen Regeln. Er hatte breite Schultern, kräftige Arme und eine muskelbepackte Brust, die in schmale Hüften überging, und er bewegte sich so lautlos, dass man manchmal erschrak, weil er wie plötzlich aus dem Boden gewachsen schien.
Nonny nickte noch einmal. »Ja, Ezekiel, ich möchte dich schon wieder um einen Gefallen bitten, wenn es dir nichts ausmacht.«
Seine Augen hefteten sich auf ihr Gesicht, und sie zog ruhig weiter an ihrer Pfeife, um sich ihr Unbehagen nicht anmerken zu lassen. Diese Augen waren zu durchdringend. Sie konnten einem Menschen direkt in die Seele sehen. Nonny gab sich einen Stoß und Ezekiels Augen verdunkelten sich, als hätte er es bemerkt. Dennoch, sie musste es wagen. Irgendjemand musste ihn retten. Sonst würde er sich eines Tages für die, die er liebte, aufopfern.
Er hatte auf der Straße gelebt und sich um seine beiden jüngeren Brüder gekümmert, und später auch um zwei andere Jungs. Er hatte seine Fäuste gebraucht, um Nahrung für sie zu beschaffen. Er hatte mit erwachsenen Männern gekämpft, um sie vor Übergriffen zu schützen, und immer dafür gesorgt, dass sie zur Schule gingen. Wie er es geschafft hatte, den Behörden zu verheimlichen, dass sie auf der Straße lebten, war ihr schleierhaft. Die drei Jungs – Mordichai, Malichai und Ezekiel – waren sehr schweigsam und sprachen nur selten über ihre Vergangenheit, und wenn, dann rissen sie meistens Witze darüber. Nur Ezekiel nicht. Sie hatte ihn kaum jemals lächeln sehen, und selbst wenn er es tat, erreichte dieses Lächeln nie, niemals seine Augen.
Sie musste vorsichtig vorgehen. Sehr vorsichtig sogar. Dies war ein Spiel, eine besondere Form von Schach. Ezekiel war extrem clever und außerdem mit allen Wassern gewaschen. Nonny nahm die Pfeife aus dem Mund und musterte ihn mit ihren schwächer werdenden Augen. »Ich weiß, dass du schon ein- oder zweimal in der Stadt warst, seit die anderen weg sind, aber ich habe ein paar Zutaten vergessen, als ich die Liste für dich gemacht habe. Ich glaube, ich werde langsam alt.« Mit ihrem Alter zu kokettieren verfing bei ihm immer. Dagegen gab es nicht viel zu sagen.
Er sah ihr in die Augen und hielt ihren Blick so fest, dass sie nicht mehr wegschauen konnte. Sie war sehr froh, dass sie über achtzig war und wusste, wie man ein Pokerface machte. Er glaubte ihr kein Wort – wahrscheinlich weil sie ihn anlog. Sie hatte einfach die Eingebung, dass Ezekiel Fortunes unbedingt nach New Orleans fahren musste, und zwar ins French Quarter. Warum? Sie wusste es nicht, nur dass es sein musste. Es hätte ihm bestimmt nicht gefallen, wenn sie versucht hätte, ihm zu erklären, dass sie das zweite Gesicht hatte und ständig Bilder von ihm sah.
Ezekiel antwortete nicht. Er würde es ihr nicht leicht machen. Aber das kümmerte sie nicht, denn dieses Schachspiel machte ihr großen Spaß. »Ich habe eine Einkaufsliste geschrieben. Du musst die Zutaten in dem Delikatessengeschäft im French Quarter holen. Es ist gleich neben dem Jackson Square. Du weißt, welches ich meine. Das mit den Gewürzen …« Ezekiel nickte, hielt ihren Blick aber weiter fest. Sein strenger Gesichtsausdruck war schwer zu ertragen, doch sie zwang sich dazu. Seinetwegen.
»Ich bin letzte Woche schon dreimal da gewesen.«
Sie mochte seine leise, samtweiche Stimme, doch sie enthielt eine Drohung, die ihr einen Schauer über den Rücken jagte, obwohl es nicht viel gab, wovor sie sich fürchtete.
»Ich weiß. Ich hab’s einfach vergessen.«
Ezekiel schüttelte den Kopf. »Du vergisst nichts.«
Das stimmte, doch in ihrem Alter konnte es vorkommen. »Ich werde nicht jünger.«
»Aber du bist nicht dement.«
Hatte sie es nicht gewusst? Sie liebte dieses Spiel. Er konterte jeden Zug so gelassen, dass seine Gegner fälschlicherweise glaubten, ihn in die Enge getrieben zu haben, aber sie wusste es besser. Sie wusste, dass er ihr die Geschichte nicht abkaufte. Das gefiel ihr so sehr, dass sie die Pfeife aus dem Mund nahm und ihn anlächelte. »Nett von dir, Ezekiel, aber die traurige Wahrheit ist, dass ich doch hin und wieder was vergesse.«
Er würde sie gewinnen lassen. Sein Gesicht und seine Augen verrieten es nicht, aber die Energie, die von ihm ausging. Er würde nicht weiter nachfragen, weil er sie mochte. Vielleicht gab er es niemals zu, aber das war auch nicht nötig. Sie wusste es einfach. Nun war es an der Zeit, ihm reinen Wein einzuschenken. Und zu beichten. Sie hatte einen schlimmen Fehler gemacht, und er musste es erfahren.
»Ich bin gestern mit dem Boot raus und habe versucht, in das Gebiet in der Nähe von Stennis zu kommen, aber ein Kanonenboot hat mich zurückgeschickt. Die Soldaten haben ziemlich grimmig ausgesehen und sich nicht gescheut, einer alten Dame zu drohen.«
Nonny achtete auf seine Reaktion. Ezekiel war sehr fürsorglich gegenüber denen, die er zu seiner Familie zählte, und sie glaubte, dass sie in diesen engen Kreis aufgenommen worden war. Sein Gesicht veränderte sich nicht, aber seine bernsteinfarbenen Augen begannen zu glänzen, in jenem besonderen Goldton. Kein gutes Zeichen bei ihm. Sie wollte lieber nicht in den Schuhen der Jungs stecken, die sie verscheucht hatten.
»Nonny«, sagte er sanfter denn je, »du weißt doch, dass du da nicht hingehen sollst. Wenn du etwas brauchst, beschaffe ich es dir. Die Gegend ist für Zivilisten gesperrt.«
Nonny reckte das Kinn. »Ich bin seit über achtzig Jahren in diesen Gewässern zu Hause. Niemand hat mir je vorgeschrieben, wo ich hingehen darf und wann.«
Ezekiel nickte. »Das weiß ich, Nonny, und ich mag es auch nicht, wenn man mir Vorschriften macht, aber die Kanäle und Wasserwege um Stennis herum sind aus gutem Grund gesperrt. Warum hast du versucht, dort hinzukommen? Warum war dir das so wichtig?« Wenn Ezekiel so sanft und geduldig klang, war er am gefährlichsten.
»Ich brauchte eine Pflanze, die ›Schwarzer Nachtschatten‹ heißt und nur dort wächst. Die, die ich umgepflanzt hatte, sind nach den Überschwemmungen eingegangen. Ich muss sie auf höherem Grund anpflanzen. Ich brauche diese besondere Spezies für meine Apotheke. Sie kann giftig sein, deshalb muss man sehr vorsichtig damit umgehen.« Sie achtete darauf, nicht zu störrisch zu klingen, denn ihr war aufgefallen, dass Trotz und Verweigerung bei Ezekiel nicht gut ankamen. Selbst die drei Töchter ihres Enkels Wyatt hatten das bereits begriffen, obwohl sie noch ganz klein waren. Ezekiel war nicht halb so lässig, wie er sich gerne gab, sondern stur und unnachgiebig. Das hatte sie gelernt.
»Das hättest du mir sagen sollen. Dann hätte ich sie dir geholt«, sagte er.
Wie nett. Das war typisch für ihn. Er hätte es wirklich getan. Er würde in den Sumpf gehen und für sie jede Pflanze ausgraben, und wenn sie noch so höllisch stank, solange sie ihn darum bat.
»Irgendjemand hat sie mir schon vor die Tür gestellt.« Sie beobachtete ihn noch genauer, denn wenn es einen Moment gab, in dem er böse auf sie werden sollte, war es dieser – und sie hätte seinen Zorn verdient gehabt.
Ezekiel versteifte sich, und seine goldenen Augen bohrten sich tiefer in ihre. »Sag das noch mal.«
»Ich habe diese Pflanze heute Morgen auf meiner Türschwelle gefunden. Sie war in einer Kiste. Ich habe Pepper und die Mädchen gefragt, aber die haben nichts damit zu tun. Und Cayenne auch nicht. Das sind außer den Soldaten im Boot die einzigen Menschen, denen ich von der Pflanze erzählt habe.«
»Hast du auch Malichai gefragt?«
Nonny nickte. »Ich habe alle Jungs gefragt. Keiner wusste, dass ich diese Pflanze haben wollte, also ist ganz bestimmt auch keiner rausgefahren, um sie für mich zu holen. Sie war sehr sorgfältig in Erde verpackt. Ich dachte, dass du vielleicht …«
Ezekiel schüttelte den Kopf. »Nein. Falls irgendjemand unsere Sicherheitsvorkehrungen durchbricht, müssen wir herausfinden, wer es ist. Dann sind nicht nur die Mädchen in Gefahr, sondern auch Cayenne und Pepper und sogar du. Wyatt, Gator – ach, zum Teufel – alle von uns würden praktisch alles tun, um dich zurückzubekommen, wenn jemand dich entführt.«
Ruhig zog Nonny an ihrer Pfeife. Sie wollte nicht, dass er sich aufregte. Aber was sollte sie sagen? »Ich bezweifle, dass jemand, der mir eine Pflanze bringt, etwas Böses im Schilde führt.« Das war eine Entschuldigung, obwohl sie sich sonst nie entschuldigte. Aber diese Gewässer lagen ihr am Herzen. Sie waren die Verkehrswege der Cajuns. Der Menschen, die in den Sümpfen lebten und so waren wie sie. Diese Menschen durften das Land zu allem benutzen, was sie wollten, und es war ein Verbrechen, ihnen die Kanäle und Bayous wegzunehmen.
Wieder veränderten sich nur Ezekiels Augen. Das Gold begann so stark zu glühen, als stünde ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. »Hier geht es um unsere Sicherheit. Mir ist klar, dass du dein Leben immer auf eine bestimmte Art gelebt hast und dass es schwierig sein muss, all diese Veränderungen hinzunehmen, aber wir haben einen Grund dafür, dass wir das Haus zur Festung machen.«
Sie war kein Kind mehr und noch nicht dement. Nonny biss fest auf den Stiel ihrer Pfeife, damit sie keine freche Antwort gab. Plötzlich ließ das Glühen in Ezekiels Augen einen kurzen Augenblick nach. War das etwa ein Hinweis auf einen Anflug von Humor? Sie konnte es nicht sagen, aber sie war ziemlich sicher, dass er soeben auf dem imaginären Schachbrett einen weiteren Zug gemacht hatte. Einen guten Zug, bei dem er gepunktet hatte. Es war Zeit, ihre Niederlage anzuerkennen. Sie nickte. »Ich verspreche, vorsichtiger zu sein.«
Ezekiel musterte die alte Dame. Sie spielte mit ihm. Er wusste nur nicht genau, was sie vorhatte. Er seufzte. Er war kein Mann, der gern mit sich spielen ließ, aber er würde noch einmal in die Stadt fahren, nur um Nonny einen Gefallen zu tun. Sie machte ihm etwas vor, obwohl sie normalerweise so geradeheraus war.
Nonny gehörte zu den Frauen, auf die man sich verlassen konnte. Sie war so selbstsicher, dass sie nichts aus der Ruhe bringen konnte, und sie hatte stets ein Messer und ein Gewehr griffbereit. Frauen wie sie gab es heutzutage wohl nicht mehr. Er hatte nicht einmal gewusst, dass es überhaupt solche gab. Deshalb war er bereit, das zu tun, was sie aus irgendeinem undefinierbaren Grund von ihm wollte.
»Mir ist durchaus bewusst, dass Dr. Whitney darauf aus ist, Wyatts und Peppers Töchter zu entführen«, sagte Nonny ein wenig verschnupft.
Er hatte sie verärgert. Ezekiel widerstand dem Drang, seine Finger fest auf die inneren Augenwinkel zu pressen. Er wusste nicht, wie man mit Frauen sprach. Er hatte nie Zeit gehabt, es zu lernen, und nun war es zu spät. Er hatte keinen Charme. Er war nicht interessant. Er war Soldat. Und zwar ein verdammt guter. Außerdem war er Arzt, und auch darin verdammt gut. Aber Frauen …
»Das weiß ich, Nonny. Schließlich wäre das für dich noch schlimmer als für alle andern. Es ist nur so, dass einer, der durch unsere Sicherheitslinien kommt, entweder ein Schattengänger oder einer von Whitneys Supersoldaten sein muss. Schon allein die Tatsache, dass irgendjemand gewusst hat, welche Pflanze du brauchst, macht mir Sorgen. Du musst beobachtet worden sein.«
Mit einem kurzen, nicht sehr damenhaften Fluch zog Nonny die Pfeife aus dem Mund. »Jetzt fällt mir ein, dass ich den Soldaten gar nicht gesagt habe, welche Pflanze ich holen wollte. Irgendjemand muss gesehen haben, wie ich die eingegangenen aus dem Beet bei Trap und Cayennes Haus gezogen habe.«
Nonny war wohl die Einzige, die das riesige Gebäude im Sumpf »Haus« genannt hätte, dachte Ezekiel. Trap hatte die ehemalige Fabrik umgebaut und wohnte auch darin, sodass man sie wohl so bezeichnen konnte. Jedenfalls betrachtete Nonny Trap und Cayenne weiterhin als Familienmitglieder.
»Ursprünglich waren es vier Ableger, aber alle sind eingegangen. Der Schwarze Nachtschatten kommt in dieser Gegend nur selten vor. In letzter Zeit habe ich kaum noch wild wachsenden gefunden.«
»Aber heute Morgen lag die Pflanze vor der Tür?«