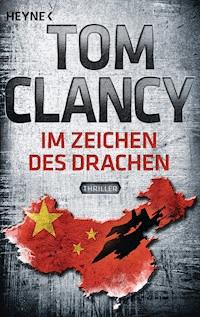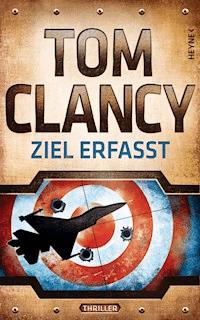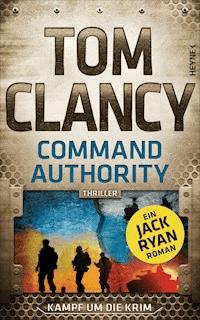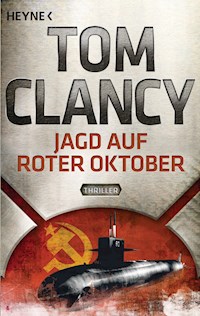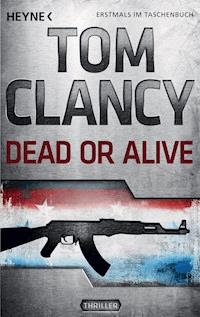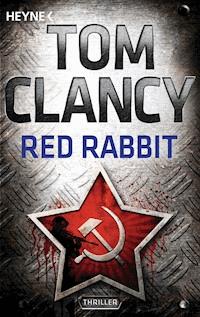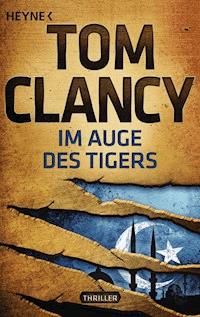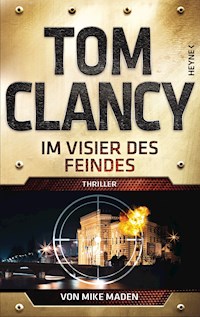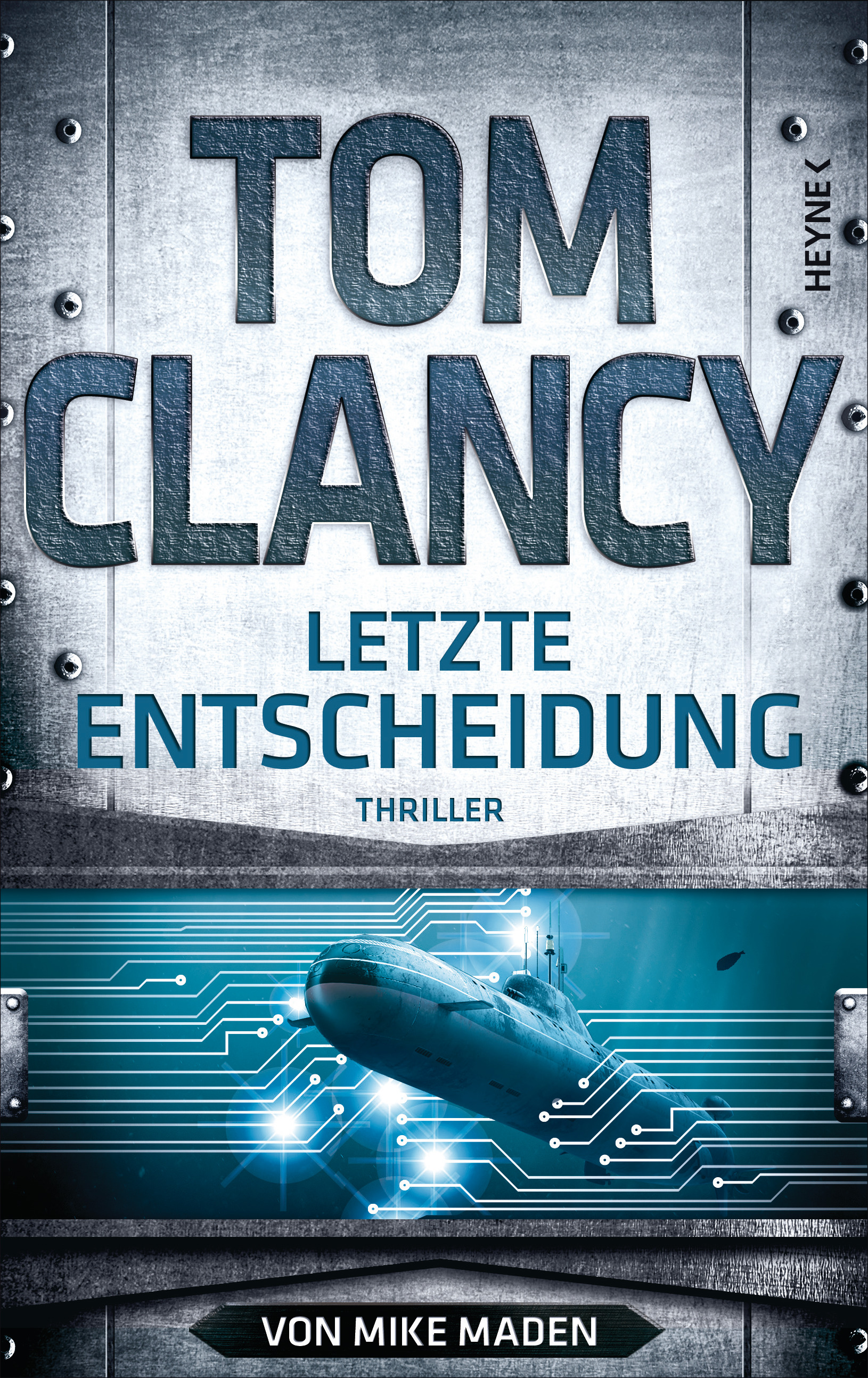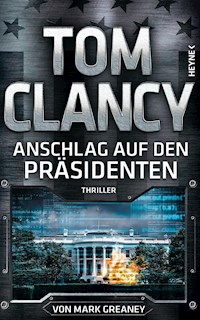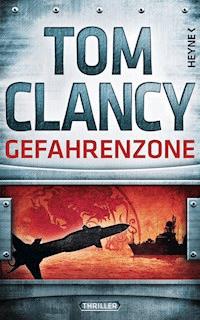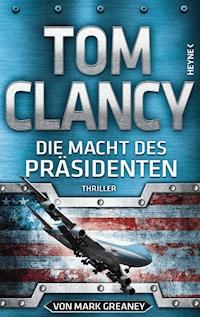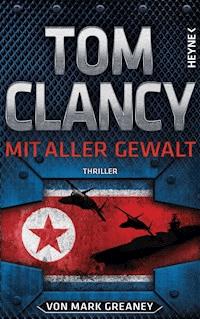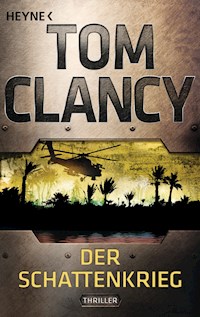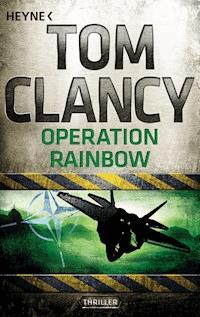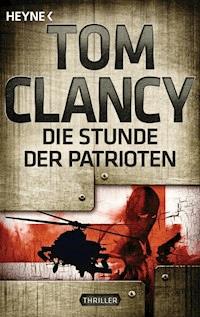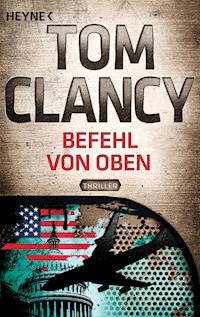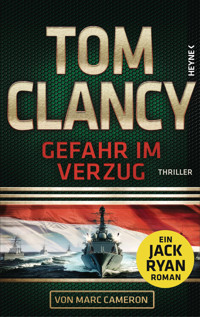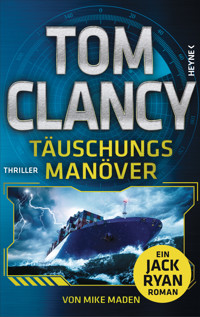
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JACK RYAN
- Sprache: Deutsch
Jack Ryan Jr. hat sich geschworen, den Mörder einer alten Freundin ausfindig zu machen – doch dieser Fall ist eine Nummer größer als gedacht
Jack Ryan Jr. wird in Barcelona Zeuge eines Selbstmordattentats. Unter den Opfern befindet sich auch seine alte Freundin Renée, die mit dem CIA zusammengearbeitet hat. Kurz bevor sie in Jacks Armen stirbt, flüstert sie ihm noch ein einziges Wort zu: »Sammler«.
Der spanische Geheimdienst vermutet eine katalanische Terrorgruppe hinter dem Anschlag, doch Jack Ryan Jr. hat seine Zweifel an dieser Theorie. Er stellt eigene Ermittlungen an und findet heraus, dass Renée in Kontakt mit einem amerikanischen Datenwissenschaftler stand, der an einem streng geheimen Regierungsprogramm gearbeitet hat, Codename RAPTURE. Aber in welcher Verbindung steht das Programm mit dem Attentat? Jack Ryan Jr. bleibt nicht viel Zeit, denn seine Nachforschungen haben Aufmerksamkeit erregt – und er muss aufpassen, nicht vom Jäger zum Gejagten zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nachdem seine alte Kommilitonin Renée Moore bei einem Attentat in Barcelona ums Leben kommt, setzt Jack Ryan Jr. alles daran, die Drahtzieher ausfindig zu machen. Er nimmt Kontakt mit dem spanischen Geheimdienst auf, der die Brigada Catalan, eine Terrorgruppe, die für die Unabhängigkeit Kataloniens kämpft, im Verdacht hat. Doch Jack Ryan Jr. hat Zweifel an dieser Theorie. Und dann ist da noch der kryptische Hinweis, den Renée ihm in ihren letzten Sekunden anvertraut hat.
Unterdessen erhält Präsident Jack Ryan einen besorgten Anruf von einem seiner großzügigsten Unterstützer: Immer mehr seiner Containerschiffe verschwinden unter mysteriösen Umständen – und nun haben ihn Lösegeldforderungen erreicht. Während Jack Ryan Jr. in Spanien ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt, versucht Präsident Jack Ryan den Geschehnissen im Pazifik auf den Grund zu gehen. Doch was beide noch nicht ahnen: Hier soll von etwas viel Größerem abgelenkt werden ...
Tom Clancy
und
Mike Maden
Täuschungsmanöver
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Karlheinz Dürr und Reiner Pfleiderer
Die Originalausgabe FIRINGPOINT erschien erstmals 2020 bei G. P. Putnam’s Sons, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2020 by The Estate of Thomas L. Clancy, Jr.; Rubicon, Inc.; Jack Ryan Enterprises, Ltd.; and Jack Ryan Limited Partnership
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Werner Wahls
Umschlaggestaltung: © Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock.com (GUSAKOLENA, m.mphoto, DedMityay, StudioGraphic, Kindlena, Successful girl)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33652-3V001
www.heyne.de
Hauptpersonen
Regierung der Vereinigten Staaten
JACKRYAN: Präsident der Vereinigten Staaten
MARYPATFOLEY: Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste (DNI)
ARNOLD »ARNIE« VANDAMM: Stabschef des Präsidenten
SCOTTADLER: Außenminister
ADMIRALJOHNTALBOT: Admiralstabschef der US Navy
DICKDILLINGER: US-Konsulat in Barcelona, Spanien, Abteilung für öffentliche Diplomatie
Der Campus/Hendley Associates
JACKRYANJR.: Außenagent und Finanzanalyst
GAVINBIERY: Leiter der Abteilung für Informationstechnologie
GERRYHENDLEY: Direktor von Hendley Associates und Campus
JOHNCLARK: Operationsleiter
DOMINGO »DING« CHAVEZ: Stellvertretender Operationsleiter
DOMINIC »DOM« CARUSO: Außenagent
ADARASHERMAN: Außenagentin
BARTOSZ »MIDAS« JANKOWSKI: Außenagent
Weitere Personen
Vereinigte Staaten
BUCKLOGAN: Präsident von White Mountain Logistics and Security
KATEPARSONS: Wissenschaftlerin am Oak Ridge National Laboratory
Spanien
LAIABROSSA: Agentin des spanischen Geheimdienstes Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
GASPARPEÑA: CNI-Abteilungsleiter
In der Tapferkeit liegt die Hoffnung.
Tacitus
Prolog
POHANG, SÜDKOREA
LEBEND, NICHTTOT.«
So lautete der Befehl. Jack verstand. Rijk van Delden – sofern das sein richtiger Name war – stellte die einzige Verbindung zwischen dem Eisernen Syndikat und der namenlosen Söldnertruppe dar, die das Syndikat für seine schmutzigsten Mordaufträge anheuerte. Die Söldnertruppe war ihr eigentliches Ziel. Wenn sie van Delden fanden, fanden sie auch die Truppe.
So einfach war das.
Aber van Delden war verdammt schwer zu finden gewesen. Nahezu unmöglich sogar. Bis ein Hinweis sie heute Nacht hierhergeführt hatte. Ihre große und womöglich einzige Chance, ihn zu schnappen.
»Lebend, nicht tot« bedeutete, dass sie den großen Niederländer am Leben lassen sollten, damit sie seine Killerorganisation aufspüren und unschädlich machen konnten.
Das Problem war nur, dass van Delden selbst zu den Topleuten seiner Truppe zählte. Der knapp zwei Meter große Killer war ein exzellenter Kämpfer und Taktiker. Er hatte mehr Männer unter die Erde gebracht als ein Totengräberspaten.
»Kommt bloß nicht auf die Idee, es allein mit ihm aufzunehmen. Spürt ihn auf, ruft Verstärkung und wartet, bis die anderen zur Stelle sind. Kapiert?«, hatte Clark bei der Einsatzbesprechung gesagt, bevor das Campus-Team sich aufteilte. Alle waren dabei: John Clark, Ding Chavez, Dom Caruso, Adara Sherman, Midas Jankowski und Jack Junior.
Jeder schlug eine andere Richtung ein, als sie über den weitläufigen Komplex des Stahlwerks ausschwärmten. Das Gelände, das es zu durchkämmen galt, war zu groß, um in Zweiergruppen loszuziehen. Jeder musste den Mann im Alleingang ausfindig machen. Und zwar schnell.
Laut ihrer Quelle hielt sich van Delden an einem von gut einem Dutzend möglichen Plätzen auf dem 80 Hektar großen Areal auf und beabsichtigte, es innerhalb der nächsten Stunde wieder zu verlassen. Er durfte ihnen auf keinen Fall durch die Lappen gehen. Wenn doch, würde er sofort wieder untertauchen, und die einmalige Chance, seine Organisation zu zerschlagen, wäre vertan.
Lebend, nicht tot, das klang ganz vernünftig, sagte sich Jack, als er das höhlenartige Innere des Stahlwerks betrat. Der kühle Abendnebel, der draußen über dem Hafen waberte, endete am Eingang, und die Luft drinnen roch beißend nach Rost, Ozon und verbrannter Kohle.
Jack Ryan Jr., ein großer, blauäugiger Weißer, durchmaß mit selbstsicherem Schritt das dunkle, hangarartige Gebäude. Mit dem weißen Schutzhelm, dem Klemmbrett und der weißen Papiermaske, die er sich organisiert hatte, fiel er hier nicht weiter auf. Er ging zügig, als hätte er zu tun, was ja auch stimmte. Die Stahlkocher schenkten ihm keine Beachtung. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, mehrere Hundert Tonnen Schmelzschlacke in riesige Pfannen zu gießen.
Jack schwitzte, in der Halle war es heiß wie in einem Vulkan. Zum Glück war das Team mit Molar Mics, Backenzahn-Mikrofonen von Sonitus, ausgerüstet. Ohne einen Empfang über die sogenannte Knochenleitung wäre Jack außerstande gewesen, die aus seinem Funkgerät dringenden Lageberichte der anderen zu verstehen. Der Höllenlärm von stampfenden Hydraulikhämmern, dröhnenden Dieselmotoren, plärrenden Alarmen und knirschendem Stahl war kaum zu ertragen.
»Ich habe noch dreißig Sekunden bis zum Ziel«, meldete Dom, der das Büro des Werkleiters ansteuerte.
»Verstanden«, antwortete Clark.
Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, erklomm Jack die gelbe Stahltreppe zur »Kanzel« – dem automatisierten Kontrollraum für die Flüssigstahl-Verarbeitungsanlage hoch über dem Hallenboden. Die Gitterroststufen führten zu dem Absatz direkt vor der Tür zum Kontrollraum. Den Rücken an die Wellblechwand gedrückt, peilte er kurz die Lage. Die behelmten Stahlwerker unten hatten nur Augen für ihre Arbeit.
Vom Treppenabsatz aus führte ein Stahlgittersteg parallel an der fensterlosen Wellblechwand der Kanzel entlang, an der Jack stand. Der von Ost nach West verlaufende Steg mündete an beiden Enden in eine schmale Brücke mit Geländer. Beide Brücken führten nach Norden, parallel zu den Schienen der riesigen Pfannen, die, randvoll mit 200 Tonnen geschmolzenem Stahl, zu den Vakuumentgasern am anderen Ende des Gebäudes rollten.
Mitten in der Stahltür zum Kontrollraum war ein kopfgroßes Guckfenster angebracht.
»Bin auf Position«, flüsterte Jack.
»Verstanden«, sagte Clark, als oben eine Sirene losheulte.
Jack trat vor das Guckfenster.
Er ließ den Blick durch den Raum schweifen. Vor dem großen Panoramafenster zur Halle saßen fünf junge südkoreanische Techniker an ihren Monitoren, redeten aufgeregt miteinander und deuteten auf virtuelle Anzeigen auf ihren Bildschirmen.
Rechts in der Ecke stand Park, der älteste Koreaner im Raum, rundlich, mit grauem Haar unter dem Schutzhelm. Jack kannte Park von dem Foto in seiner Akte. Er war der CEO des Stahlunternehmens und sein Hauptaktionär, ein Mann, der ernste Probleme mit der Yamaguchi-gumi hatte, Japans größtem Yakuza-Syndikat. Laut ihrer Quelle hatte sich Park Hilfe suchend an van Delden gewendet und für heute Nacht ein Treffen vereinbart.
Jack beugte sich vor, um zu sehen, mit wem Park sprach.
Und da war er.
Der hünenhafte Holländer hatte dem kleinen Koreaner, den er um mindestens zwei Köpfe überragte, sein granithartes, längliches Gesicht zugewandt und führte ein ernstes Gespräch mit ihm.
Der Blick des Holländers flog kurz zum Guckfenster. Seine Augen bohrten sich in die Jacks.
Scheiße.
Einen Wimpernschlag später hielt van Delden eine große Glock 17 in der Hand. Jack duckte sich, als der Lauf Feuer spuckte. Die Glasscheibe zerbarst über seinem Kopf.
»Hab ihn gefunden«, brüllte Jack in sein Funkgerät und stemmte sich unten gegen die schwere Stahltür. Weitere Geschosse schlugen gegen das Metall, als ob jemand mit den Fäusten gegen die Tür hämmerte.
»Verhalte dich ruhig«, sagte Clark. »Wir sind unterwegs. Fünf Minuten, höchstens.«
»Verstanden.« Weitere Kugeln prasselten gegen die Tür neben Jacks Ohr.
»Tu ihm nichts, Jack.«
»Verstanden.«
WUMS!
Der Hüne warf sich gegen die Tür. Der Stahl krachte gegen Jacks Schädel und warf ihn ein wenig zurück. Doch Jack hatte sich fest verkeilt. Die Tür öffnete sich nur einen Spalt. Mit der Schulter drückte er sie wieder zu.
Über ihm zersplitterten die letzten Reste der geborstenen Scheibe. Er spähte nach oben. Der schwarze Stahlverschluss der Glock glitt durch das Fenster und neigte sich nach unten. Dicke Finger umschlossen den Griff. Bevor Jack reagieren konnte, gab die Glock drei ohrenbetäubende Schüsse ab, die den Gitterrostboden neben seinen Füßen zum Klirren brachten. Jack wirbelte herum, packte mit der linken Hand den heißen Verschluss und drehte ihn nach oben, sodass van Deldens nächste Kugel in die Stahlträger an der Decke fuhr.
Jack verbrannte sich an dem heißen Lauf, verhinderte durch sein Zupacken aber, dass der letzte Schuss losging, da der Verschluss die Patronenhülse nicht ganz auswerfen konnte.
Mit der Linken weiter die Glock umklammernd, zückte Jack mit der Rechten seine SIG P229 Legion Compact SAO und schmetterte den Griff der Pistole gegen das Handgelenk des Niederländers. Es brach mit einem widerlichen Knacken.
Die Riesenpranke ließ die Glock fallen und zog sich hastig durch das Fenster zurück. Jack kickte die Waffe des Niederländers über den Rand.
»Wie ist die Lage?«, fragte Clark. »Noch Sichtkontakt?«
»Er sitzt hier fest …«
WUMS!
Van Delden warf sich gegen die Stahltür, bevor Jack sich wieder dagegenstemmen konnte. Die Tür flog auf, und Jack wurde nach hinten geschleudert und stürzte rücklings auf den Treppenabsatz.
Er riss die SIG hoch, um dem Niederländer ins Knie zu schießen, doch bevor er abdrücken konnte, trat ihm dessen eisenbeschlagener Stiefel die Waffe aus der Hand. Sie flog zur Seite und schlug weit unten scheppernd auf dem Betonboden auf.
Jacks Hand explodierte vor Schmerz, als wäre sie mit einem Vorschlaghammer zerschmettert worden. Der Schmerz lenkte ihn für einen Moment ab, und das sollte sich rächen. Der schwere Stiefel holte erneut aus und versetzte ihm einen Tritt in den Magen, der ihm den Atem nahm. Jack schnappte nach Luft und griff sich an den Bauch, während der Stiefel ein drittes Mal ausholte. Diesmal zielte er direkt auf seinen Kopf. Jack rollte sich im letzten Moment zur Seite, und die Stiefelsohle krachte gegen den Stahl neben seinem Ohr.
Wieder trat der Holländer nach seinem Kopf, und wieder wich Jack zur Seite aus. Darauf sprang van Delden nach vorn, um ihm einen tödlichen Tritt gegen die Schläfe zu versetzen, übersah dabei aber Jacks federunterstütztes Kershaw-Messer, dessen 3-Zoll-Klinge ihm in die Innenseite des Oberschenkels fuhr.
Van Delden schrie auf und griff an sein Bein, um die Blutung zu stoppen. Er taumelte zurück, bevor Jack wieder zustechen konnte, und humpelte den Steg entlang nach Westen, während Jack sich mühsam aufrappelte.
»Jack, wir sind gleich da. Bleib, wo du bist«, befahl Clark. Jack schüttelte den Schmerz aus der Hand und schnaufte ein paarmal tief durch. Sein Bauch schmerzte, als hätte er eine Kugel abbekommen.
»Jack? Hast du verstanden?«
Jack blickte auf und sah gerade noch, wie van Delden um die Ecke bog, nach Norden, weg von der Kanzel.
»Verstanden«, war alles, was er sagte.
Nur würde er ganz sicher nicht bleiben, wo er war.
Er hatte seine Befehle. »Lebend, nicht tot.«
Aber ihm war klar, dass zwischen beidem ein langer, schmerzvoller Weg lag, und er nahm den Holländer gern auf diese Reise mit.
Er stürmte den Gittersteg entlang dem Hünen hinterher, der trotz seiner Verwundung noch erstaunlich schnell war.
Jack bog um die Ecke, vorbei an der großen Gießpfanne mit geschmolzenem Stahl, die drei Meter unter ihm auf dem Gleis dahinkroch. Noch hier oben brachte die Gluthitze seine Haut zum Kribbeln, als stünde er in einer kalten Nacht zu dicht an einem Lagerfeuer.
»Van Delden! Stehen bleiben!«, brüllte Jack gegen das laute Knirschen der riesigen Gießpfannengetriebe über ihm an.
Van Delden humpelte weiter, wobei er sich schwer auf das Geländer stützte und sich mit blutverschmierter Hand den Oberschenkel hielt. Er blieb erst stehen, als Jack ihn fast eingeholt hatte.
»Dreh dich um, du Arschloch«, rief Jack, der nun endlich seine Ersatzwaffe zücken konnte, eine SIG P365 SAS Subkompaktpistole, 9 mm Luger.
Die breiten Schultern wandten sich um. Auf dem schwach beleuchteten Steg glühten die markanten Gesichtszüge des Holländers förmlich im brodelnden Licht des lavaähnlichen Stahls, der sich ihnen unten näherte. Jack spürte die prickelnde Hitze durch die Hose hinten an den Beinen.
Er richtete die Pistole auf die Brust des Hünen.
Der Holländer grinste.
»Hast du Angst abzudrücken, Kleiner?«
»Nicht die geringste. Aber ich habe meine Befehle.«
»Ein harter Bursche, wie?« Er zuckte vor Schmerz zusammen, und das Grinsen verschwand. Sein Hosenbein war blutdurchtränkt. Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf – er überragte Jack um mehr als einen halben Kopf. Sein Brustkorb glich einem Eichenfass, und unter seinen Hemdsärmeln wölbten sich baumstammdicke Arme.
Jacks Finger spannte sich um den Abzug. »Ich werde dich nicht töten, aber wenn du eine Bewegung machst, wirst du den Rest deines Lebens durch einen Strohhalm pissen.«
Die Augen des Holländers musterten Jack von oben bis unten, berechneten die Geschwindigkeit, taxierten die Entfernung.
»John, hörst du mich?«
»Ich höre«, antwortete Clark. »Hast du die Zielperson im Blick?«
»Ich sitze auf ihr drauf. Beeilt euch.«
»Sind gleich da. Bist du in Ordnung?«
Die Luft dröhnte vom Lärm des automatisierten Krans, der die Gießpfanne unter ihnen zog. Jack sah aus dem Augenwinkel das Gleißen des glühenden Stahls.
»Ich bin wohlauf. Aber van Arschgesicht hat sich wehgetan.«
»Wer schickt dich?«, fragte van Delden.
»Niemand, den du kennst.«
»Was willst du von mir?«
»Du bist die Verbindung zu einer Truppe, an der wir interessiert sind.«
»Inwiefern interessiert? Bist du Polizist?«
»Nicht direkt.«
»Weißt du, für wen ich arbeite?«
»Deine Truppe hat für das Eiserne Syndikat gearbeitet.«
»Das Syndikat ist tot.«
»Ich weiß. Wir haben es ja zerschlagen. Deine Organisation ist die nächste, die wir plattmachen, mit deiner Hilfe.«
»Ha, ihr wisst doch gar nichts über uns.«
»Nein, aber ich versichere dir, dass du uns innerhalb einer Stunde alles sagen wirst.«
Van Delden biss auf die Zähne und bedachte Jack mit einem merkwürdigen Du-kannst-mich-mal-Grinsen.
»Findest du das irgendwie lustig?«
Van Deldens Blick irrte verzweifelt umher, auf der Suche nach einer Waffe oder einem Ausweg. Seine blutigen Finger umklammerten das Stahlgeländer.
Jack begriff, dass der Mann das Geländer als Hebel benutzen könnte, um seinen massigen Körper in seine Richtung zu katapultieren, trotz des verletzten Beins. Sollte ihn eine dieser kräftigen Fäuste am Kinn erwischen, würden bei ihm die Lichter ausgehen.
Jack wich zurück. »Keine Bewegung.«
Van Delden schob sich näher.
»Angst, Kleiner?«
Jack schüttelte den Kopf. »Auf meinen Sack richtet ja niemand eine Knarre.«
Wieder zeigte der Holländer ein Lächeln, ein Sonnenstrahl in einer Gewitterwolke. Doch dann erlosch es.
»Wofür bist du bereit zu sterben, Kleiner?«
»Was ist das für eine idiotische …«
Mit einem einzigen Satz schwang sich van Delden über das Geländer.
Jack sprang nach vorn, um ihn zu packen, doch er kam zu spät.
Der Holländer stürzte mit den Füßen voraus in die glühende Pfanne drei Meter tiefer. Seine massige Gestalt kräuselte die Oberfläche beim Eintauchen nur wenig, und die weiß glühende Flüssigkeit verschluckte seinen letzten, gellenden Schrei.
Jack stand am Geländer und starrte in den Pfannenwagen mit geschmolzenem Stahl, der unaufhaltsam weiterrollte, als Clark, Dom und Adara hinter ihm angerannt kamen.
»Wo, zum Teufel, ist van Delden?«, fragte Clark und beugte sich über das Geländer. »Ich hab dir doch gesagt, dass wir ihn lebend brauchen.«
»Ich weiß«, sagte Jack und steckte die Pistole weg. »Aber er hatte andere Pläne.«
18. Oktober
1
An Bord des Containerschiffs Jade Star
Der Zweite Offizier Luis Loyola stand auf der Steuerbordnock, dampfte ein Juulpod mit süßlichem Menthol-Geschmack und bewunderte die funkelnden Sterne am samtschwarzen Himmel.
Plötzlich erspähte sein Seemannsauge die Heckwelle von etwas, das weit unten auf den Schiffsrumpf zuraste – wahrscheinlich die Flosse eines Delfins. Dann beobachtete er, wie das Etwas ins blauschwarze Wasser abtauchte. Nächtliche Futtersuche. Er lächelte. Faszinierende Tiere. Und immer ein Glücksbringer.
Der Bug des Schiffes steuerte auf einen zunehmenden Mond zu, der wie ein Scheinwerfer leuchtete und das dunkle Pazifikwasser in alle Richtungen erhellte, bis zum Horizont, wie es schien. Lichter irgendwelcher anderer Schiffe konnte Loyola hier draußen im Südpazifik nicht sehen; laut Radar war der nächste Fischkutter rund 140 Kilometer entfernt. Auf dem Mars hätte er nicht mehr Einsamkeit finden können.
Das Schiff durchpflügte mit 15 Knoten – etwas mehr als halbe Rumpfgeschwindigkeit – die glatte See, um teuren Kraftstoff zu sparen. Der 102 000 Tonnen schwere Frachter (Leergewicht) wurde von 93 000 Pferdestärken angetrieben, die tief unter Deck ein Zwei-Takt-Dieselmotor produzierte. Beim jetzigen Tempo verbrannte er 90 Tonnen Treibstoff pro Tag, um die sechsblättrige, aus einer Kupferlegierung bestehende Schiffsschraube anzutreiben, deren Durchmesser über neun Meter betrug.
Loyola warf einen kurzen Blick aufs Deck, auf dem sich rote, blaue und grüne Schiffscontainer stapelten. Tatsächlich war die Jade Star mit 8465 20- und 40-Fuß-Containern beladen, die unter anderem südkoreanische Industrierohre und -armaturen, Waschmaschinen, Kühlschränke, Autoteile, Gummireifen, Röntgengeräte und, seltsamerweise, 700 Liter menschliches Blut enthielten.
Außerdem beförderte das Schiff verbotenerweise 300 Tonnen Ethylen und andere entzündliche Chemikalien, die bei einer Vielzahl von Fertigungsverfahren Anwendung fanden. Die gesetzlichen Vorgaben für Lagerung und Transport der Chemikalien waren geradezu lachhaft und mit enormen Kosten verbunden, die in keinem Verhältnis zu ihrem Wert standen. Loyola sorgte sich nicht um ihre Sicherheit. Als Erster Offizier des Schiffs war er jedoch verpflichtet, solche Dinge zu beachten. Und sollte das Schiff angehalten und durchsucht werden, würde ihm allein das Vergehen angelastet werden.
Doch im Moment bekümmerte ihn das wenig. Er hatte dienstfrei, und es war ihm völlig egal, was sie transportierten. Ihn interessierte jetzt nur, dass sein Sohn gestern Geburtstag gehabt hatte, und soweit er wusste, hatte seine Ex-Frau, die Schlampe, es nicht für nötig gehalten, dem Jungen die Quadcopter-Drohne zu geben, die er ihm letzte Woche geschickt hatte.
Loyola liebte das Leben auf See, aber seinen sechsjährigen Sohn liebte er noch mehr. Er war hin- und hergerissen. Die See hatte ihn seine Ehe gekostet, behauptete jedenfalls seine Frau, die ihm die Schuld daran gab, dass sie es mit jedem Stecher in Lima trieb, weil er nicht da war, um ihre weiblichen Bedürfnisse zu befriedigen.
¡Hija de puta!
Er nahm einen langen Zug von seiner Juul und beobachtete dann, wie der Wind die Dampfwolke in die Nacht davontrug. Wenn er die See nicht aufgab, könnte er seinen Sohn ganz verlieren. Außerdem hatte er seit drei Jahren keine Gehaltserhöhung mehr bekommen, geschweige denn eine Beförderung, und beides stand nicht in Aussicht. Er hatte schon öfter ans Aufhören gedacht, aber so beschissen die außertariflichen Gehälter auch sein mochten, sie waren immer noch besser als alles, was sich zu Hause in Peru mit einem Schreibtischjob verdienen ließ. Wenigstens konnte er jetzt Geld für die Zukunft seines Sohnes sparen, auch wenn er ihn nicht aufwachsen sah.
Er spürte, wie ihn wieder tiefe Verzweiflung überkam, und dachte an die Flasche Golden Blue Korean Whiskey in seiner Kabine. Seine Trinkerei war auf dieser Fahrt schlimmer geworden, und es war wohl an der Zeit, damit aufzuhören. In seiner letzten Beurteilung hatte ihn der Lackaffe von Kapitän deswegen verwarnt, aber dieses Arschloch kapierte natürlich nicht, was er durchmachte.
Loyola atmete tief die salzige Luft ein und zwang sich, seine Sorgen zu vergessen. Bei allem Leid des Seemannslebens – es gab nichts Schöneres, als in einer Nacht wie dieser draußen auf der Brücke zu stehen. Er war schon ein Dutzend Mal um die Welt gefahren und hatte an Land und auf See Dinge gesehen, die kein Nichtseemann jemals zu Gesicht bekam. Nicht schlecht für einen Straßenjungen, der in den dreckigen Slums von Lima Zigaretten und Lotterielose vertickt hatte.
Loyola nahm noch einen tiefen Zug von seiner Juul. Ja, dachte er, vielleicht würde er sich nach einem Job im Hafen umtun, damit er dem Jungen näher sein konnte. Vielleicht würde er ihm sogar das Fußballspielen beibringen, so wie sein Vater ihm. Und mit dem Geld, das er bereits gespart hatte, würde er vielleicht sogar ein Haus kaufen, draußen auf dem Land, wo der Junge …
Eine gewaltige Explosion unter dem Schiff warf Loyola aufs Deck, sodass er mit dem Schädel gegen das Stahlschott schlug. Benommen erhob er sich auf die Knie, als der Rumpf unter dem Kreischen berstenden Metalls auseinanderbrach. Er wurde gegen die Reling der Brückennock geschleudert, brach sich ein paar Rippen, klammerte sich aber verzweifelt an die nächstbeste Stütze, damit er nicht mehrere Stockwerke tief in den Ozean fiel. Sirenengeheul erfüllte die Luft.
Er versuchte, das Blut wegzublinzeln, das ihm aus einer Platzwunde am Kopf in die Augen lief. Mit Entsetzen sah er, wie der Bug und 180 Meter Schiff dahinter wegbrachen und ins Meer eintauchten. Die Heckpartie, auf der er lag, schoss, noch unter Antrieb, nach vorne und krachte in den gekippten Rumpf. Stahlcontainer sprangen aus ihren Verankerungen und stürzten ins Wasser, und mit ihnen ein Dutzend schreiender Besatzungsmitglieder.
Sekundärexplosionen entzündeten die entflammbaren Chemikalien und verwandelten das zitternde Wrack in ein Inferno. Innerhalb von Minuten gingen das gesamte Schiff und seine Ladung verloren und versanken in den Tiefen des warmen Pazifiks.
Es gab keine Überlebenden.
24. Oktober
2
BARCELONA, SPANIEN
Jack stand an der Bar des Avi, seines Lieblingsrestaurants in Barcelona. Es lag in dem Viertel El Born, das zur Altstadt gehörte, die auf Katalanisch, der Sprache der halbautonomen spanischen Region Katalonien, Ciutat Vella hieß. Auch bei den Einheimischen war es sehr beliebt, und das wollte was heißen, denn die Katalanen verstanden, gut zu essen und zu trinken, und taten es recht oft bis spät in die Nacht.
Jack trank noch einen Schluck von seinem süßen, roten Wermut. Dank seiner Zeit in Spanien war Van Deldens Selbstmord nur noch eine ferne Erinnerung. Eine Woche war es jetzt her, dass Jack mitten in der Nacht schweißgebadet aufgewacht war, nachdem er alles noch einmal durchlebt hatte. Obwohl ihn das grausige Ende des Niederländers mittlerweile kaltließ, musste er sich immer wieder fragen, was für eine Art von Organisation das war, die eine solche Loyalität entfachte.
Jack hatte seine Zeit in Madrid zwar auch genossen, aber von Barcelona war er absolut fasziniert. Er konnte sich vorstellen, in der Stadt zu leben, trotz der jüngsten Ereignisse. Spontane Massendemonstrationen von Hunderttausenden Menschen hatten Barcelona in den Tagen vor seiner Ankunft mehrmals komplett lahmgelegt, doch mittlerweile war es wieder ruhig geworden. Aber Jack spürte, dass noch etwas in der Luft lag.
Die meisten Demonstranten forderten die Unabhängigkeit Kataloniens von Madrid, aber nicht alle. Was freiheitsliebende Menschen auf die Straße getrieben hatte, war die Empörung darüber, dass katalonische Politiker, die für die Unabhängigkeit eintraten, unlängst von Madrid zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt worden waren. Spanien lebte noch unter dem langen Schatten des faschistischen Franco-Regimes. Zwar war das Land inzwischen eine Demokratie, doch es weckte bittere Erinnerungen an frühere Zeiten, wenn schwer bewaffnete Bereitschaftspolizei die Barrikaden unbewaffneter katalanischer Bürger attackierte. Es war eine emotionale, keine rationale Reaktion, dachte Jack, aber moderne Politik drehte sich in der westlichen Welt heutzutage nur noch um Emotionen, so auch hier.
Die Proteste änderten nichts. Madrid hatte weiter alle Trümpfe in der Hand, denn es besaß das Gewaltmonopol. Barcelona stand kurz vor einem weiteren Ausbruch von Massenprotesten, aber das machte die Stadt nur noch interessanter.
Mit seinen 1,88 Körpergröße und seinen breiten Schultern überragte Jack die meisten Einheimischen, die jetzt zur Mittagszeit, die überall in Spanien bis mindestens drei Uhr dauerte, das Lokal bevölkerten. Der Energielevel hier drin lag irgendwo zwischen Late Night Disco und Rockkonzert.
Jack konnte kaum einen klaren Gedanken fassen, so laut war das Geschnatter der Gäste, die sich angeregt in einem halben Dutzend Sprachen unterhielten, hauptsächlich aber auf Katalanisch – einem Mix aus Spanisch, Italienisch und Französisch. Die katalanische Sprache gehörte zu den vielen Dingen, die Kataloniens Eigenart und Besonderheit ausmachten, was auch der Grund war, warum Franco sie während seiner Herrschaft verboten hatte.
Jack kannte von der Sprache kaum mehr als si us plau und gràcies, aber schon diese wenigen Worte genügten, um Einheimischen ein dankbares Lächeln zu entlocken, besonders solchen, die sich von Madrid lossagen wollten. Wenn alle Stricke rissen, wusste Jack wenigstens die Namen der Tapas, die er am liebsten mochte – besonders bombas und pa amb tomàquet. Im schlimmsten Fall zeigte er einfach mit dem Finger auf die Speise und lächelte. Das funktionierte immer.
Heute war Jacks letzter Tag in Spanien. Trotz der ausgesprochen geselligen Atmosphäre der Stadt war er allein. Sein Leben als Geheimagent taugte nicht für langfristige Beziehungen, jedenfalls nicht in seinen Augen.
Er hatte die hübsche Blondine am anderen Ende der Bar gleich beim Hereinkommen gesehen und bemerkt, dass sie ihn gemustert hatte. Sie trug keinen Ehering und schien allein zu sein. Sie hatte Bluetooth-Kopfhörer im Ohr und wechselte gelegentlich ein paar Worte mit jemandem am anderen Ende der Leitung. Wenn sie nicht gerade an ihrem perlenden Cava nippte oder von ihren knusprigen Croquetas de Jamòn abbiss, beäugte sie ihn verstohlen im Spiegel hinter dem Tresen.
Selbst wenn sie an ihm interessiert sein sollte, so hatte er doch bereits für seinen Flug mit American Airlines gepackt, der ihn morgen nach Hause bringen sollte. Er reiste nur mit einem Laptop und einer Tasche aus Büffelleder, die mit Klamotten für ein paar Tage vollgestopft war. Er zog es vor, seine Sachen zu waschen, statt sie wegzuwerfen und sich neue zu kaufen wie eine berühmte Romanfigur, die er bewunderte.
Das Einzige, was er morgen früh noch einpacken musste, war sein abgegriffenes Exemplar von George Orwells Mein Katalonien. Das Buch war der Grund für seinen Abstecher nach Barcelona. Er hatte es zum ersten Mal auf dem College gelesen, und seine letzten, prophetischen Seiten waren ihm noch jahrelang nachgegangen. Als Gerry Hendley ihm nach seinem letzten Campus-Einsatz in Südkorea vorgeschlagen hatte, ein paar Wochen freizunehmen, hatte er beschlossen, sich noch einmal mit Spanien zu beschäftigen, und speziell mit dem Spanischen Bürgerkrieg. Er arbeitete gern als inoffizieller Agent für den Campus – die »Geheimorganisation« des Finanzunternehmens Hendley Associates, die für den amerikanischen Präsidenten Aufträge ausführte, die auf dem normalen Dienstweg nicht erledigt werden konnten.
Doch seit einiger Zeit musste Jack immer an die Worte eines alten Jesuiten und Professors denken, dem er vor ein paar Jahren in London begegnet war, und er spielte unterschwellig mit dem Gedanken, wieder zu studieren und einen Doktor in Geschichte zu machen, wie sein Vater.
Mal sehen.
Nichts auf dieser Reise hatte ihn überzeugen können, den Campus zu verlassen. Die Arbeit war zu wichtig und einfach zu aufregend. Allerdings musste er auch zugeben, dass es ihn fasziniert hatte, Spanien mit den Augen des Historikers zu betrachten, und nicht im grünen Licht von Nachtsichtgeräten, während er Zielpersonen verfolgte. Es war eine Sache, über eine geschichtsträchtige Stadt wie Barcelona zu lesen, aber etwas ganz anderes, in einer 900 Jahre alten Kirche zu stehen, auf Steinplatten, unter denen die Gebeine von Kreuzrittern ruhten.
Er schob sich den letzten der glänzenden pimientos de Padrón in den Mund. Die kleinen, in Olivenöl gebratenen und mit Meersalz bestreuten grünen Paprikaschoten zergingen förmlich auf der Zunge. Er zog ernsthaft in Erwägung, noch einen Wermut zu bestellen, beschloss dann aber, den, den er schon hatte, auszutrinken und zu zahlen. Die Uhr tickte, und er hatte eine zeitgebundene Eintrittskarte für das Picasso-Museum, das gleich um die Ecke in der Carrer de Montcada, einer schmalen mittelalterlichen Gasse, lag. Es war der letzte Programmpunkt auf seiner Liste, bevor er morgen abreiste.
Er winkte der Bedienung, die im Vorbeigehen seine Rechnung vor ihn auf den Tresen legte. Er zählte das Geld ab, das er für die Begleichung der Zeche und ein großzügiges Trinkgeld brauchte. Dabei bemerkte er, dass er noch ein paar Euro in der Brieftasche hatte, und so beschloss er, sie ebenfalls in den Teller zu werfen. In Virginia brauchte er keine Euro, und die junge Kellnerin rackerte sich hier ab. Gott segne sie.
Adéu, Barcelona.
3
Jack hatte gerade bezahlt und trank sein Glas vollends aus, da fiel sein Blick auf eine gut aussehende, junge Afroamerikanerin, die sich ins Restaurant drängte und offensichtlich nach jemandem Ausschau hielt.
Renée Moore?
Jack konnte nicht glauben, dass sie es war. Nach all den Jahren.
Sie hatten an der Georgetown University zusammen ein paar Finanzkurse besucht und waren, wie es häufig vorkommt, wenn zwei intelligente, attraktive Menschen viel Zeit miteinander verbringen, eine intensive, aber kurze Beziehung eingegangen. Renée Moore war die karriereorientierteste Frau, der er je begegnet war, und das wollte was heißen, wenn man bedachte, dass er aus einer Familie mit überaus erfolgreichen Frauen kam. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, die Wall Street zu erobern. Sie war absolut feinfühlig, in der Sache aber glasklar gewesen, als sie mit ihm Schluss machte: Sie wolle nicht heiraten. Niemals.
Jack hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie vor sieben Jahren ihr Studium abgeschlossen hatten. Er hatte sich oft gefragt, ob sie möglicherweise deshalb gegangen war, weil sie so viele Eigenschaften besaß, die er an Frauen am meisten bewunderte. Doch andererseits hatte sie sich als oberstes Ziel gesteckt, an der Wall Street ein Vermögen zu machen. Er nicht. Er wollte für Dinge leben, für die zu sterben sich lohnte, und Geld gehörte nicht dazu.
Tatsächlich hatte er vor ein paar Jahren mit dem Gedanken gespielt, wieder Kontakt zu ihr aufzunehmen und sie für ein Bankprojekt in Costa Rica zu gewinnen, das er als Analyst von Hendley Associates in Angriff nahm. Sie wäre ideal für den Job gewesen, denn sie hatte einen messerscharfen Verstand und eine unglaubliche Arbeitsmoral. Er hatte sogar geglaubt, sie davon überzeugen zu können, dass Pflicht, Ehre und Vaterland genauso wichtig waren, wie eine Milliarde Dollar zu machen, bevor sie dreißig wurde. Doch jedes Mal, wenn er nahe dran war, zum Telefon zu greifen, tat er es dann doch nicht. Die Loyalität der meisten Leute galt nur ihren eigenen Ambitionen. Das machte sie nicht unbedingt zu schlechten Menschen. Doch wenn sein Dad ihm etwas beigebracht hatte, dann, dass das einzig lebenswerte Leben ein Leben im Dienst an anderen war.
Und wie hieß es so schön: Man kann nicht zwei Herren dienen.
Er rief ihren Namen in den fröhlichen Lärm der Restaurantbesucher. Sie ließ den Blick über die Menge wandern, bis sie ihn entdeckte, was angesichts seiner Größe nicht schwer war. Ein Lächeln ließ ihr Gesicht erstrahlen, wich aber einem Ausdruck der Verwirrung, als sie sich einen Weg zu ihm bahnte und ihre 168 Zentimeter Lebensgröße neben ihn an den dicht umlagerten Tresen zwängte. Sie streckte sich und umarmte ihn.
»Renée, ich fasse es nicht. Was führt dich nach Barcelona? In dieses Lokal?« Lachfältchen kräuselten sich um Jacks blaue Augen.
»Einen Moment lang dachte ich, du könntest es sein, aber dann …«
Er konnte sie bei dem Lärm kaum verstehen. Er hob die Stimme. »Kann ich dir etwas bestellen? Die Tapas hier sind unglaublich.«
»Nein danke.« Sie schaute sich im Raum um, offensichtlich auf der Suche nach jemandem, stellte sich zeitweilig sogar auf die Zehenspitzen.
»Suchst du jemand Bestimmtes?«
Sie wandte sich Jack zu. »Entschuldige, ich bin unhöflich. Wie ist es dir ergangen? Du siehst großartig aus – du hast ein paar Pfund Muskeln zugelegt, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe.«
»Ja, ich gehe hin und wieder in den Kraftraum«, sagte Jack.
Sie strich über sein Gesicht, eine vertraute Geste. »Der Bart ist neu. Gefällt mir.«
»Erzähl das meiner Mom.«
Er hätte ihr gerne gesagt, wie hinreißend sie aussah – besser, als er sie in Erinnerung hatte. Aber er wusste, dass das zu nichts führen würde, und er hatte nicht die Absicht, sie zu verführen. Er freute sich einfach nur, sie zu sehen.
Auch das hübsche Mädchen mit den Kopfhörern am Ende der Bar wirkte erfreut, sie zu sehen. Sie blickte ständig zwischen ihrem zweiten Cava und Moore hin und her.
»Was machst du so?« Moore sah sich weiter suchend um und behielt auch die Tür im Auge.
»Hendley Associates. Eine kleine Private-Equity-Firma in Alexandria. Und du?«
»Ich bin Vizepräsidentin eines Tech-Start-ups in Kalifornien namens CrowdScope.«
»Tech? Ich dachte, du machst in Finanzen.«
»Mach ich ja auch, nur auf der anderen Seite. Es handelt sich um ein Fintech-Unternehmen.«
»Klingt spannend. Und was ist mit der Wall Street?«
»Hab ich hinter mir.«
Jacks Apple Watch piepte. »O Mann. Ich muss los.«
»Ein heißes Date?«
»Nein. Nur ein Museumsbesuch. Ich habe ein zeitgebundenes Ticket. Können wir später vielleicht was trinken? Oder zusammen zu Abend essen?«
Sie drehte sich wieder zu ihm herum und lächelte ihn an. »Ja, Jack. Das würde ich sehr gerne.« Sie griff in ihre Tasche und zog eine Visitenkarte heraus. »Ruf mich gegen sieben an. Dann überlegen wir, wo wir uns treffen können. Einverstanden?«
»Wunderbar.« Er warf einen Blick auf Adresse und Telefonnummer und steckte die Karte ein.
»Wie lange bist du in der Stadt?«
Jack zuckte mit den Schultern. »Ich reise morgen ab.«
»Schade.« Ihr Lächeln erstarb. »Ich habe dich vermisst, Jack. Ich freue mich so, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Was für ein verrückter Zufall.«
Jack ignorierte die schrille Stimme der Nonne in seinem Kopf, die im Religionsunterricht gesagt hatte, dass es so etwas wie Zufall nicht gebe.
»Probiere den Wermut hier. Und die Tortillas. Die sind fantastisch – ach was, alles hier. Also dann, ich muss los. Ich ruf dich später an.«
»Unbedingt.« Sie schlang ihm wieder die Arme um den Hals und küsste ihn auf die bärtige Wange. »Adéu.«
»Adéu.«
Jack schob sich sanft durch die Menge zum Ausgang. Er warf einen letzten Blick auf Moore, die an der Bar immer noch Ausschau hielt, und auf die Blondine mit den Kopfhörern, die sie immer noch beobachtete. Als er durch die Tür trat, rempelte ihn ein kleiner, kräftiger Mann an. Er war ungefähr in seinem Alter, hatte schulterlanges Haar und trug eine Schildpattbrille von Warby Parker.
»Sorry, man«, sagte er zu Jack im Vorbeigehen.
»No hay problema, Alter«, murmelte Jack, ohne sich dabei etwas zu denken.
Endlich draußen in der schmalen Gasse, blickte er auf seine Uhr. Mit seinem Online-Ticket durfte er in fünf Minuten ins Museum. Perfektes Timing.
Das Schaufenster eines kleinen Juweliergeschäfts gegenüber bot Jack die Gelegenheit für eine kurze Anti-Überwachungsmaßnahme. Er warf einen Blick hinein. Die einzige Person, die er in der Scheibe sah, war ein Mann, ungefähr so groß und so alt wie er selbst. Er hatte kurz geschorenes blondes Haar, eine lange, krumme Nase, ein kantiges Gesicht und tief liegende braune Augen. Und Kopfhörer im Ohr.
Das waren eine Menge Informationen, um sie mit einem kurzen Blick aufzunehmen, aber darauf war Jack von John Clark, dem Operationsleiter des Campus, gedrillt worden.
Wie Jack warf auch der Mann im Schaufenster einen flüchtigen Blick auf ihn, zumindest schien es so. Sie musterten einander kaum einen Wimpernschlag lang, dann wandte sich der andere lässig ab und ging nach Süden, in die entgegengesetzte Richtung. Nur ein Tourist, der telefonierte, vermutete Jack, doch sein Verstand registrierte den kraftvollen, athletischen Gang des Mannes, als er um eine Ecke in den Passeig del Born einbog.
Jack schlug den Weg nach Norden zum Museum ein.
Drei Schritte später war er tot.
Dachte er zumindest.
Die zerstörerische Wucht der Explosion im Avi nahm den einzigen Weg, der ihr blieb: durch die Eingangstür hinaus auf die enge Gasse zwischen dicken Steinmauern, und zwar in Form einer gewaltigen Druckwelle. Schaufenster zerbarsten auf einer Strecke von Dutzenden Metern in beiden Richtungen.
Der Knall der Explosion dröhnte wie ein Gewehrschuss in Jacks ungeschützten Ohren. Der Druckwelle war so groß, dass er nach vorn geschleudert wurde. Er schlug mit dem Kopf gegen eine Mauer, hielt sich aber auf den Beinen.
Benommen drehte er sich um und taumelte zurück in Richtung Explosion. Zerschmetterte Leiber lagen vor ihm in der Gasse. Er blieb nicht stehen, um den Menschen zu helfen. Sie waren tot.
Blut und Fleischfetzen klebten an der demolierten Eingangstür, als er sich einen Weg durch die Trümmer ins Restaurant bahnte. Das Pfeifen in seinen Ohren dämpfte die qualvollen Schreie und das Stöhnen der wenigen Überlebenden. Er besann sich auf die notfallmedizinische Grundausbildung, die er unter den wachsamen Augen Adara Shermans absolviert hatte, doch ohne Erste-Hilfe-Kasten würde er nicht viel tun können. Er lief um Tote und Verletzte herum, vorbei an umgestürzten Stühlen und Tischen, und suchte verzweifelt nach Moore. Schließlich entdeckte er sie. Sie lag zusammengekrümmt am Boden. Ein Arm war am Ellenbogen unnatürlich verdreht, ihre Bluse von der Explosion zerfetzt.
Zerbrochene Teller und Gläser knirschten unter seinem Gewicht, als er neben ihr niederkauerte. Ihr Gesicht war geschwollen, und Blut lief ihr aus Nase, Mund und Ohren. Er legte ihr eine Hand an den Hals, um den Puls zu fühlen, überzeugt, dass sie tot sei, doch plötzlich kam Leben in ihre blutunterlaufenen Augen. Jack schrie fast vor Freude. Ein Flüstern kam über ihre geschwollen Lippen.
»Süße, ich bin’s, Jack. Bleib still liegen. Der Krankenwagen wird gleich hier sein.«
Ihre trüben Augen sahen ihn flehend an. Mit den blutigen Fingern ihrer nicht gebrochenen Hand zupfte sie an seinem Hemdsärmel. Er beugte sich zu ihr hinunter und hielt sein Ohr an ihrem Mund. Er sah, wie sich ihre Augen verdrehten und das Weiße zum Vorschein kam. Doch mit einem letzten Röcheln hauchte sie ein einziges Wort:
»Sammler.«
4
SÜDPAZIFIKAn Bord des U-Boots Glazov der Russischen Föderation
Kapitän ersten Ranges Nikolay Grinko las den Befehl ein drittes Mal und fluchte. Es war kein komplizierter Befehl. Ganz im Gegenteil. Der Marinesender ZEVS bei Murmansk konnte, da er mit extrem niederfrequenter Übertragung (SLF) arbeitete, nur äußerst kurze Nachrichten senden.
Die SLF-Signaldatenrate war so gering, dass U-Boot-Funkgeräte nur Nachrichten aus Murmansk empfangen konnten, und die waren wenig mehr als Klingelton-Benachrichtigungen. Dass eine so mikroskopisch kleine Datenrate übermittelt wurde, war Grinko schon immer wie Ironie vorgekommen. Der Sender war der leistungsstärkste in Europa. Er erforderte bis zu 14 Megawatt Strom, die durch zwei 60 Kilometer lange Antennen gejagt wurden, um ein 82-Hz-Signal mit einer riesigen Wellenlänge von 3,686 Kilometern zu erzeugen. Nur Chinas SLF-Sender – fünfmal so groß wie New York City – war größer und leistungsstärker.
Die geringe Datenübertragungsrate war der Preis für die Fähigkeit von ZEVS, fast überall auf dem Planeten ein Signal durch mehrere Hundert Meter Polareis oder Meerwasser zu schicken. Die Glazov lag momentan 137 Meter tief im Pazifik, tief genug, um einer Sonarortung aus der Luft oder durch Überwasserschiffe zu entgehen. Ein U-Boot wie seines überlebte nur, wenn es unentdeckt blieb. Und SLF sollte dazu beitragen, dass es dabei blieb.
Außer natürlich eine Warnmeldung zwang ihn, aufzutauchen und via hochfrequenter Satellitenkommunikation neue Befehle entgegenzunehmen, so wie jetzt.
Grinko fluchte erneut.
»Kein Irrtum?«
»Nein, Kapitän.«
Grinko suchte in den Augen des Mannes nach Anzeichen von Zweifel. Er fand keine. Das überraschte ihn nicht.
Der vor ihm stehende Oberbootsmann war absolut zuverlässig, wie auch die übrige Besatzung. Der IT-Techniker – Grinko nannte sie immer noch Funker – schrieb die neuen Befehle nicht selbst, er leitete sie nur weiter.
»Danke. Sie können wegtreten.«
Der Mann schloss leise die Kabinentür. Grinko konnte es nicht glauben. Warum sollten sie ihre Position ändern? Der erste Test mit der neuesten Version des Superkavitations-Torpedos VA-111 Schkwal 3 (»Sturmböe«) war perfekt gelaufen und, was ebenso wichtig war, vom Gegner unbemerkt geblieben. Seine Crew hatte alle Anstrengungen unternommen, um ihn vom Versuchsgebiet fernzuhalten.
Angetrieben von einem Feststoff-Raketenmotor und ausgestattet mit einem Endphasenlenksystem, erreichte der neue Schkwal 3 unter Wasser Geschwindigkeiten von 480 km/h und besaß eine Reichweite von annähernd 20 Kilometern.
Solange sie die Waffe geheim hielten, konnten die Amerikaner keine entsprechende Abwehrwaffe entwickeln. Warum also durch Positionsänderung eine Entdeckung riskieren? Zu welchem Zweck?
Grinko rieb sich das glatt rasierte Gesicht und ergab sich seinem Schicksal. U-Boot-Kapitäne der Pazifikflotte führten Befehle aus dem Hauptquartier in Wladiwostok aus, und nicht umgekehrt. Nun gut. Er griff zum Telefon und befahl seinem Ersten Offizier, Kurs auf die neuen Koordinaten zu nehmen.
Grinkos Resignation verwandelte sich in Zuversicht. Er war Kapitän eines der modernsten U-Boote seines Landes, das einige seiner schlagkräftigsten Waffen mitführte. Wladiwostok gab ihm eine weitere Gelegenheit, den arroganten Amerikanern zu zeigen, dass es mit ihrer Vorherrschaft zur See vorbei war.
5
BARCELONA, SPANIEN
Wer, zum Teufel, ist Sammler?
»Sammler« war das Letzte, was sie gesagt hatte, und letzte Worte waren am wichtigsten, sagte sich Jack, während er Moore sanft die Augen schloss. Seine Hand schwebte über ihrem atemlosen Mund. Er berührte ihre Lippen.
Ein letzter Abschied.
Blutverschmiert und mit pochenden Kopfschmerzen wie bei einem Migräneanfall blickte Jack zu einer Frau mittleren Alters hinüber, die am Tresen lag und etwas auf Spanisch wimmerte. Sie hatte die Augen geschlossen, da ihr aus einer Kopfwunde Blut ins Gesicht lief und die verletzte linke Hand heftige Schmerzen bereitete. Sirenen heulten in der Ferne.
Jack stürzte zu ihr, raffte eine Handvoll Papierservietten vom Boden auf und presste sie gegen ihre Kopfwunde. Dann ergriff er ihre unversehrte Hand und legte sie auf die Wunde.
»Su mano, empujar aqui«, sagte er. »Nein, nicht empujar. Sorry. Ich kenne das Wort nicht. Drücken Sie einfach ganz fest.«
Aber die Frau verstand Jacks Mittelstufen-Spanisch gut genug. Sie presste die Hand auf den behelfsmäßigen Verband, während Jack ihre andere Hand nahm und kurz untersuchte, bevor er eine große Glasscherbe aus ihrer Innenfläche zog. Die Wunde blutete, aber nicht so stark wie die am Kopf. Er riss einen Stapel Servietten aus einem Spender, der neben ihm lag, drückte ihn in ihren Handteller und faltete ihre Hand zu einer Faust.
»Festhalten, okay?«, sagte er und sah sich um, um zu schauen, wem er noch helfen konnte, jetzt noch blutverschmierter als zuvor.
Nur ein paar Schritte entfernt sah er Moores Tasche auf dem Boden liegen. Mehrere Passanten traten vorsichtig in das verwüstete Restaurant, die Gesichter schreckensbleich, aber bereit zu helfen. Krankenwagensirenen heulten direkt vor der Tür.
Während draußen Reifen quietschten, ergriff Jack Moores Tasche, deren Inhalt auf dem Boden verstreut war, und durchwühlte sie. Sie war fast leer. Er suchte ihr Smartphone. Wer immer dieser Sammler war, vielleicht hatte sie mit ihm telefoniert oder seine Kontaktdaten gespeichert.
Spanische Rettungssanitäter mit Behandlungskoffern in den Händen stürmten durch die Tür, gefolgt von vier Ortspolizisten, auf deren Uniformen GUÀRDIAURBANA stand.
Einer von ihnen, ein bärtiger und stämmiger Beamter, brüllte etwas auf Katalanisch, als er Jack entdeckte, der mitten in dem Blutbad stand und eine Tasche durchwühlte wie ein Plünderer.
Noch benommen von der Explosion und wie betäubt vor Trauer, verstand Jack kein Wort von dem, was er brüllte, zumal ihm die Ohren dröhnten und vor Schmerzen fast der Schädel zersprang, doch es war unschwer zu erraten, dass der Typ sauer war.
Weitere Sirenen heulten, und weitere Reifen quietschten, und noch mehr Sanitäter und Polizisten kamen durch die zertrümmerte Tür gestürmt.
Jack deutete auf Moores Leiche. »Sie ist eine Freundin von mir. Ich suche nur nach …«
Doch der große Polizist zückte seinen Schlagstock und ging mit wutentbranntem Blick auf Jack los.
Jack ließ die Tasche fallen, doch etwas bei ihm machte klick. Seine Freundin war tot, und auch ihn selbst hätte es beinahe erwischt. Und jetzt hält mich dieses Arschloch für einen Dieb. Jack brachte sich in Stellung, um den Kerl niederzuschlagen, als der den Stock erhob.
»Pari! – Stopp!«, rief eine Frauenstimme von hinten.
Der große Bärtige hielt mitten im Ausholen inne. Er und Jack fuhren herum. Eine Frau in Jeans und Lederjacke, ungefähr in seinem Alter, hielt ihm eine Dienstmarke hin. Ihr schulterlanges Haar war gepflegt, aber nicht modisch geschnitten, und ihre kleine Gestalt wirkte durchtrainiert wie die einer Athletin. Trotz seiner Kopfschmerzen bemerkte Jack die Pistole, die in einem Schulterholster unter ihrer Jacke steckte. Sie brüllte dem Polizisten, der sie weit überragte, einen weiteren Befehl zu. Er protestierte und zeigte mit dem Stock auf Jack.
Sie wandte sich Jack zu. »Er sagt, Sie sind ein Plünderer. Stimmt das?«
»Nein. Ich habe nach dem Handy meiner Freundin gesucht …« Jack versagte die Stimme, seine Beine zitterten. Er deutete auf Moores Leiche. Unerwartet stiegen ihm Tränen in die Augen.
Der Blick der Frau wurde milder, aber nur etwas. Sie nahm Jack am Arm.
»Gehen wir nach draußen, damit Sie sich untersuchen lassen können.«
Jack saß auf der Steintreppe am Hintereingang der gotischen Kirche Santa Maria del Mar. Er war nur 100 Meter vom Restaurant entfernt und blickte auf einen kleinen Platz. Unter den wachsamen Augen der Frau mit der Dienstmarke leuchtete ihm ein uniformierter Sanitäter mit einer Stiftlampe in die Augen. Über ihnen knatterten die Rotoren eines Polizeihubschraubers.
Hunderte von Schaulustigen waren in der Gegend zusammengeströmt, dann aber hinter gelbe Absperrbänder zurückgedrängt worden. Ein Reporter vom Lokalfernsehen stand in der Menge und interviewte Leute, die behaupteten, die Tragödie mitangesehen zu haben.
Der Sanitäter bedachte Jack mit einem letzten skeptischen Blick, während er die Stiftlampe einsteckte. »Keine Kopfschmerzen?«
»Nein«, log Jack. »Mir geht es gut.«
Der Mann kniff ungläubig die Augen zusammen. »Estàs segur? Sind Sie sicher?« Er kratzte sich den dünnen, grau melierten Bart.
»Ja, wirklich. Danke.«
»Sie sollten ins Krankenhaus gehen und sich wenigstens röntgen lassen.«
»Nein, mir geht es gut.«
»Sie wissen, dass die Behandlung hier kostenlos ist?«
»Darum geht es nicht. Ich möchte einfach nicht. Mir fehlt nichts.«
»Dann sollten Sie aber einen Arzt aufsuchen, wenn Sie wieder in den Vereinigten Staaten sind, vale?«
»Das werde ich. Versprochen.«
Der Sanitäter blickte zu der Frau und gab mit einem Achselzucken widerwillig seine Zustimmung, ehe er mit seinem Erste-Hilfe-Koffer zum nächsten Opfer eilte.
»Ich heiße Laia Brossa. Ich arbeite für das Centro Nacional de Inteligencia, kurz CNI. Das ist unser Gegenstück zu FBI und CIA, nur beides in einem. Und wer sind Sie?«
Jack, der immer noch auf der Treppe saß, streckte ihr die Hand hin. Sie drückte sie. »Mein Name ist Jack Ryan. Mucho gusto« – Freut mich, Sie kennenzulernen.
»Igualmente.« Brossa zückte ihr Smartphone. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich unser Gespräch aufzeichne? Das ist einfacher, als Notizen zu machen.«
»Ganz und gar nicht.«
»Sie sagten, dass Ihre Freundin Renée Moore dadrin getötet worden sei.«
Jack senkte den Kopf und nickte.
»Ja.«
Sie tätschelte ihm die Schulter. »Das tut mir sehr leid.«
Jack hob den Kopf. »Ja, mir auch.«
»War sie auch Amerikanerin?«
»Ja.«
»Und wie kommt es, dass Sie die Explosion überlebt haben, Mr. Ryan?«
»Ich war draußen. Ich war gerade gegangen und auf dem Weg ins Picasso-Museum. Hätte ich noch dreißig Sekunden gewartet, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch tot.«
»Sie hatten großes Glück. Und was führt Sie nach Spanien?«
»Tut mir leid, aber ich weiß nicht, warum Sie mir all diese Fragen stellen.«
»Weil es mein Job ist.«
»Ihr Job ist es herauszufinden, wer meine Freundin getötet hat, und all die anderen Menschen.«
»Das wissen wir bereits. Es war eine Terrorgruppe namens Brigada Catalan. Sie hat sich vor wenigen Minuten, während Sie untersucht wurden, im Internet dazu bekannt.«
»Ich kenne die Gruppe aus den Nachrichten. Die hat doch noch nie so etwas gemacht. Nur viel Gerede, oder?«
Brossa zuckte mit den Schultern. »Jeder Terrorist, der tötet, redet viel, bevor er mit dem Töten anfängt, meinen Sie nicht?«
»Doch, wohl schon.« Jack spähte zu den Fahnen hinauf, die an mehreren privaten Terrassen rund um den Platz hingen. Bei den meisten handelte es sich um die offizielle Flagge Kataloniens mit fünf gelben und vier roten waagrechten Streifen, doch einige trugen zusätzlich ein blaues Dreieck mit einem weißen kubanischen Stern – die Flagge der Unabhängigkeitsbewegung. In den letzten Tagen hatte Jack hier in Barcelona kaum spanische Nationalflaggen gesehen. In Madrid war es genau umgekehrt gewesen.
»Aber die Leute von der Brigada Catalan waren nie gewalttätig, jedenfalls nicht so«, sagte Jack. »Das ist eine politische Bewegung, keine terroristische, wenn mich nicht alles täuscht.«
»Bis heute«, sagte Brossa, blickte zu den Flaggen und murmelte etwas auf Katalanisch vor sich hin. Dann wandte sie sich wieder Jack zu. »Für einen Amerikaner sind Sie über die katalanische Politik gut informiert. Ziemlich ungewöhnlich.«
»Wir sind nicht alle Idioten«, entgegnete Jack und bereute es noch im selben Augenblick. Die meisten Amerikaner waren keine Idioten. Sie interessierten sich nur nicht für andere Länder, weil ihr eigenes so groß war und viele eigene Probleme hatte. Und nicht jeder Amerikaner hatte an einer Eliteuniversität wie Georgetown Geschichte und Finanzwissenschaften studiert.
»Es tut mir leid, wenn ich Sie beleidigt habe«, sagte Brossa.
»Keineswegs. Ich entschuldige mich für mein schlechtes Benehmen. Ich bin beinahe getötet worden, das hat mir auf die Stimmung geschlagen. Ich weiß über die Brigada Catalan nur deshalb einigermaßen Bescheid, weil ich gestern in El País zufällig einen Artikel über sie gelesen habe. Auf Englisch. Deshalb ja, vielleicht bin ich auch nur so ein dummer Amerikaner.«
»Irgendwie habe ich da meine Zweifel. Also, was hat Sie nach Spanien geführt? Ms. Moore? War sie Ihre Freundin?«
»Nein, nein, nicht so. Wie waren nur befreundet. Wir hatten uns Jahre nicht mehr gesehen. Es war reiner Zufall, dass sie in das Restaurant gekommen ist.«
»Mein Vater sagt, dass es so etwas wie Zufall nicht gibt«, sagte Brossa.
Jack schmunzelte, trotz seiner Kopfschmerzen.
»Was ist so komisch, Mr. Ryan?«
»Nichts.«
»Und aus welchem Grund sind Sie in Spanien?«
Der wahre Grund war, dass er sich von Campus-Einsätzen in den letzten Monaten in Polen und Indonesien erholen und nach dem Tod seiner Freundin Liliana und dem Selbstmord van Deldens den Kopf wieder freibekommen wollte. Aber davon durfte Brossa nichts erfahren.
»Ich habe am College ein bisschen Geschichte studiert und Orwells Mein Katalonien gelesen – kennen Sie das Buch?«
»Selbstverständlich.«
»Wir haben den Spanischen Bürgerkrieg nicht ausführlich behandelt. Ich wollte meine Wissenslücken schließen und mir selbst ein Bild machen.«
Brossa musterte ihn von oben bis unten und fragte sich, ob er sie verarschen wollte.
»Und haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben, Mr. Ryan?«
»Ich bin gekommen, um mehr über den Bürgerkrieg zu erfahren, und habe mich am Ende in Spanien verliebt. Es ist ein fantastisches Land.«
»Wo genau waren Sie denn in Spanien?«
Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich in Sevilla ein paar Scheißkerle von Waffenhändlern gejagt, rief sich Jack in Erinnerung.
»Es war leider bloß ein Kurztrip. Nur Madrid, und dann hier.«
»Dann müssen Sie wiederkommen und sich den Rest ansehen. Galizien, Andalusien, das Baskenland – Spanien ist nicht nur ein Land, sondern eine Ansammlung vieler kleinerer.«
»Das steht bereits auf meiner Wunschliste, glauben Sie mir.«
»Na dann, Mr. Ryan …«
»Bitte nennen Sie mich Jack.«
»Vale, Jack. Können Sie mir sagen, was Sie vor der Explosion als Letztes gesehen oder gehört haben? Irgendwelche Demonstranten draußen? Jemand Verdächtiges?«
»Das Lokal war brechend voll. Essenszeit. Alle schienen sich wohlzufühlen. Zur Hälfte Einheimische, zur Hälfte Touristen, würde ich sagen. Ich habe Deutsch, Französisch und Norwegisch gehört, aber hauptsächlich Katalanisch.«
»Sie sind ein guter Beobachter.«
»Nur ein neugieriger Tourist.«
»Das Restaurant Avi ist sehr beliebt. Eines der besten in der Stadt. Ich selbst esse dort oft. Keine Rufe wie Visca Cataluña!, bevor die Bombe hochging? Oder sonst etwas, das auf ein Motiv für den Anschlag hindeuten könnte?«
»Nein, nichts dergleichen. Die Leute haben gegessen und getrunken und es sich gut gehen lassen, als ich raus bin, dann plötzlich … na ja, den Rest kennen Sie ja.«
»Und Ihre Freundin? Was macht sie so? Warum war sie in Barcelona?« Sie sprach Barcelona wie ein Amerikaner aus – das C klang wie ein S und nicht wie im kastilischen Spanisch Madrids, wo das C zu einem lispelnden Th-Laut wurde.
»Ich weiß es nicht. Aus beruflichen Gründen vielleicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie im Avi jemanden treffen wollte.« Jack griff in seine Hemdtasche und reichte ihr Moores Visitenkarte.
»Und wen wollte sie treffen?«
»Keine Ahnung.«
Renée auch nicht, so wie sie bei seinem Anblick reagiert hatte, dachte Jack. Als hätte sie im ersten Moment gedacht, dass er die gesuchte Person sei, ehe sie ihren Irrtum erkannte. Das bedeutete, dass sie nicht wusste, wie der Betreffende – und es war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mann – aussah.
»Bevor sie starb, sagte sie noch etwas, einen Namen. Sammler. Vielleicht ist das der Typ, den sie treffen wollte.«
Oder der Mann, der sie umgebracht hat.
»Vorname?«
»Hat sie nicht gesagt.«
Brossa las Moores Visitenkarte. »CrowdScope? Was ist das?«
»Ein Fintech-Start-up im Silicon Valley.«
»Wie bitte? ›Fintech‹?«
»Das sind Unternehmen, die neue Technologien für Finanztransaktionen verwenden, also beispielsweise mithilfe von Datenanalyse neue Kunden gewinnen oder Robo-Advisor betreiben. Solche Sachen. Renée war eine Finanzexpertin.«
»Darf ich die behalten?«
»Natürlich.«
»Haben Sie zufällig Ihren Pass dabei?«
»Ja.« Jack angelte ihn aus einer vorderen Reißverschlusstasche seiner Cargohose, wo er ihn sicherheitshalber verstaut hatte, da es in der Stadt von Taschendieben wimmelte.
Brossa nahm ihn in Augenschein und blätterte in den Seiten für Visastempel. Sie fotografierte die Seite mit Jacks Daten und Passnummer, bevor sie ihn zurückgab.
»Und Sie, Jack? Was treiben Sie so?«
»Ich bin ebenfalls im Finanzgeschäft. Aber nicht in der Fintech-Branche.« Er zückte seine Brieftasche, fischte eine Visitenkarte heraus und reichte sie ihr. »Ich bin Finanzanalyst bei Hendley Associates in der Nähe von Alexandria, Virginia.«
»Interessante Arbeit, könnte ich mir vorstellen.«
»Zahlen erzählen immer eine Geschichte, wenn man sie zu lesen versteht.« Das hat mir Paul Brown vor Jahren beigebracht.
Brossas Handy klingelte. »Entschuldigen Sie, Jack.« Sie wandte sich ab und sprach in ihr Telefon. Ein kurzes Gespräch. Jack beobachtete sie aus dem Augenwinkel. Sie beendete das Telefonat und seufzte.
»Jack, tut mir leid, ich muss gehen. Wäre es möglich, dass Sie noch ein paar Tage in der Stadt bleiben? Ich hätte noch Fragen an Sie, und Sie sind einer der wenigen überlebenden Augenzeugen.«
Jack wusste nicht, ob er den Aufenthalt in seiner Airbnb-Wohnung verlängern konnte oder ob Gerry ihm noch zusätzliche Urlaubstage gewähren würde, aber er würde den Teufel tun und nach Hause fliegen, bevor er herausgefunden hatte, wer Moore auf dem Gewissen hatte, und überzeugt war, dass ihr Mörder zur Rechenschaft gezogen werden würde. Der CNI-Agentin zu helfen, war der einfachste Weg, um beides sicherzustellen.
»Natürlich. Aber Sie müssen mir einen Gefallen tun.«
»Wenn ich kann.«
»Sie müssen für mich diesen Sammler unter die Lupe nehmen. Ich glaube, der Name wird bei der Lösung des Falls eine wichtige Rolle spielen.«
Brossa sah ihn erneut forschend an. Schließlich ein erstes, verhaltenes Lächeln.
»Ich melde mich bei Ihnen.«
6
Es waren 20 Gehminuten bis zu seiner Airbnb-Wohnung in Barceloneta, dem alten Arbeiterviertel unten am Strand, das in jüngerer Zeit wiederbelebt worden war.
Der Anschlag auf das Restaurant hatte die Behörden nervös gemacht. An jeder Kreuzung flackerten Blaulichter von Streifenwagen und Polizeimotorrädern, und Hubschrauber schwebten über der Ciutat Vella.
Trotz gegenteiliger Voraussagen blieben größere spontane Kundgebungen für die Unabhängigkeit Kataloniens aus. Jack wusste nicht, ob die friedlichen Demonstranten Angst vor gewalttätigen Übergriffen hatten oder ob sie fürchteten, verantwortlich gemacht zu werden, falls es in der Nacht zu weiteren Bombenanschlägen kommen sollte.
In diesem Teil der Stadt schienen die Touristen überhaupt nicht mitbekommen zu haben, was sich nur eine Stunde zuvor knapp einen Kilometer entfernt ereignet hatte. In Scharen strömten sie an den Restaurants, Hotels und gelaterias am Passeig de Joan de Borbó vorbei in Richtung Meer. Obwohl Jack an der Kirche versucht hatte, sich zu säubern, fielen den Aufmerksameren unter ihnen die Blutflecken an seiner Kleidung auf.
Sein Schädel brummte noch, als er in den kleinen Carrefour Express schlüpfte und sich eine Packung Aspirin und eine Flasche Wasser kaufte. Er warf gleich zwei davon ein und spülte sie mit einem großen Schluck hinunter, als er wieder auf die Gasse hinaustrat und sich die 57 Stufen der gewundenen Marmortreppe hinaufschleppte, die zu seiner Wohnung im dritten Stock führte.
Er fühlte sich immer noch so, als wäre er von einem Auto über einen steinigen Feldweg geschleift worden. Er zog sich aus, stieg in die enge Dusche und ließ den kräftigen heißen Wasserstrahl und den Dampf ihre Wirkung entfalten. Er musste die ganze Zeit an Moore und das erlöschende Licht in ihren Augen denken. Was für ein Verlust. Eine hochintelligente Frau, die zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war.
Während er sich abtrocknete, versuchte er, ein paar Rätsel zu lösen, die sie ihm aufgab. Eine Fintech-Firma leuchtete ja noch ein – die Finanzbranche war ihr Ding. Aber ein Start-up im Silicon Valley? Er wusste noch sehr genau, dass sie davon geträumt hatte, eine renommierte Investmentfirma an der Wall Street zu leiten oder sogar zu besitzen. Ihre Eltern waren beide Manager und hatten sie auf eine ähnliche Karriere getrimmt. Doch er selbst hatte sie nie als Unternehmertyp gesehen. Im Risiko-Rendite-Kontinuum neigte sie stark Letzterem zu.
Ob mit ihrer Karriere etwas schiefgelaufen war? Hatte sie vielleicht noch mal von vorne anfangen müssen? Und was machte eine Fintech-Managerin aus dem Silicon Valley in Barcelona? Möglicherweise Urlaub wie er, aber wahrscheinlich war das nicht. Sie hatte nicht den verklärten Blick einer Touristin gehabt. Ihr ganzes Verhalten hatte geschäftsmäßig gewirkt, und zweifelsohne hatte sie vorgehabt, jemanden zu treffen, und zwar jemanden, dem sie offenbar noch nie begegnet war. Eine seltsame Art, Geschäfte zu machen.
Nach Aspirin und Dusche ließen Jacks Kopfschmerzen endlich nach, und er griff in den Kühlschrank und nahm sich eine Dose Mahou Radler heraus, ein Mixgetränk aus spanischem Bier und Zitronenlimonade, an dem er in den letzten Tagen Geschmack gefunden hatte und das hier clara genannt wurde. Er setzte sich in die kleine Essecke, die ihm als Büro diente, und klappte seinen Laptop auf, den Gavin Biery, der IT-Direktor von Hendley Associates, aus Sicherheitsgründen verschlüsselt hatte.
Es war erst fünf Uhr nachmittags Ortszeit. Er lud die Kontaktdaten des US-Konsulats in Barcelona hoch, um dort anzurufen und über Renée zu informieren, falls die spanischen Behörden es noch nicht getan hatten. Er stellte fest, dass das Konsulat seit ein Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen war. Er hätte eine 24-Stunden-Hotline anrufen können, wollte die Sache aber lieber persönlich erledigen. Er beschloss, gleich morgen früh hinzugehen.
Dann googelte er Moores Firma CrowdScope und landete auf der Website des Unternehmens. Sie entsprach ungefähr seinen Erwartungen. »Optimierung von Kapitalanlagen und Geschäftslösungen durch Big-Data-Analysen«, bla, bla, bla. Der übliche Firmensprech, Stockfotos und Bulletpoints. Nichts Interaktives. Er klickte auf »Wer wir sind« und fand Moores Kontaktdaten. Sie war als »Vizepräsidentin für Marketing« aufgeführt, genau wie auf ihrer Visitenkarte.
Marketing?
Auch ihre Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse bei CrowdScope waren angegeben. Das waren eine Menge Informationen, nur verrieten sie nicht viel. Aber das war heutzutage ziemlich üblich. Stil ging vor Substanz. Die übliche Clickbaiting-Nummer.
Es war elf Uhr Ostküstenzeit, und Jack sah, dass Gavin zu Hause in Alexandria online war. Er wählte auf seinem Smartphone Gavins Durchwahlnummer.
»Jack! Ich wollte dir gerade eine Nachricht schicken. Ich habe von der Explosion in Barcelona gelesen. Du warst doch nicht irgendwo in der Nähe, oder? Die Fotos im Netz sehen ziemlich schlimm aus.«
»Ja, deswegen rufe ich an.«
»Alles okay?«
»Mir geht es gut. Aber eine Freundin von mir war dort und ist getötet worden.«
»O Mann, das tut mir sehr leid.«
»Du hast sicher Besseres zu tun, trotzdem würde ich dich gern um einen Gefallen bitten.«
»Raus damit.«
»Ich möchte, dass du für mich ein paar Nachforschungen über meine Freundin anstellst. Ich schicke dir die Kontaktdaten und einige Links. Ich möchte mehr über die Firma erfahren, für die sie gearbeitet hat, und noch wichtiger: Versuche herauszufinden, ob es eine Verbindung zwischen ihr und einem Mann namens Sammler gibt – das ist der Nachname, da bin ich mir sicher. Telefondaten, OSINT, was immer du über den Typ finden kannst, und darüber, was er mit Renée zu tun hatte.«
»Nach was für einer Art von Verbindung soll ich suchen? Glaubst du, dieser Sammler hat etwas mit dem Bombenanschlag zu tun?«
»Ich weiß es nicht. Aber sein Name war das Letzte, was sie gesagt hat, bevor sie gestorben ist, daher nehme ich an, dass er ihr wichtig gewesen ist. Und vielleicht weiß er mehr darüber, was passiert ist.«
»Klingt so, als wärst du selbst beinahe getötet worden.«
»Nicht ganz«, log Jack.
»Ich mach mich gleich dran. Im Moment ist es hier ziemlich ruhig. Das Team ist noch komplett im Urlaub, so wie du. Sogar Gerry. Ich habe massenhaft Zeit.«
»Danke, Gav. Das ist wirklich nett von dir.«
»Frage an dich: Hast du in dem Restaurant Überwachungskameras gesehen? Wie heißt es noch mal?«
Jack machte sich Vorwürfe. Warum hatte er daran nicht gedacht? Vielleicht war sein Schädel bei der Explosion stärker durchgerüttelt worden, als ihm bewusst war.