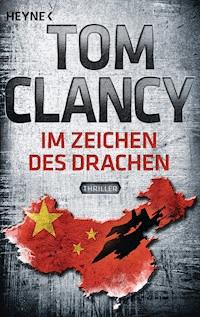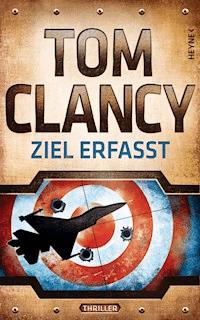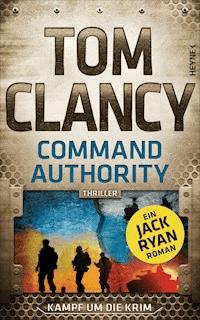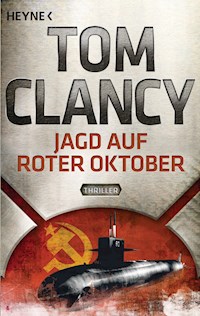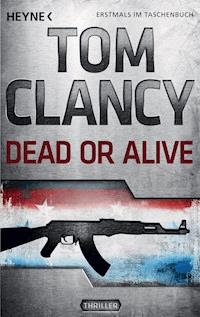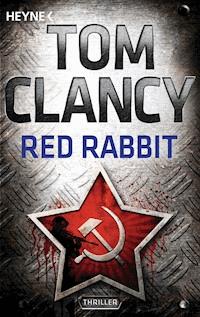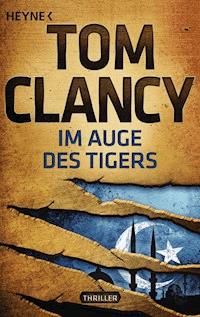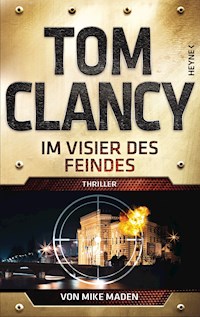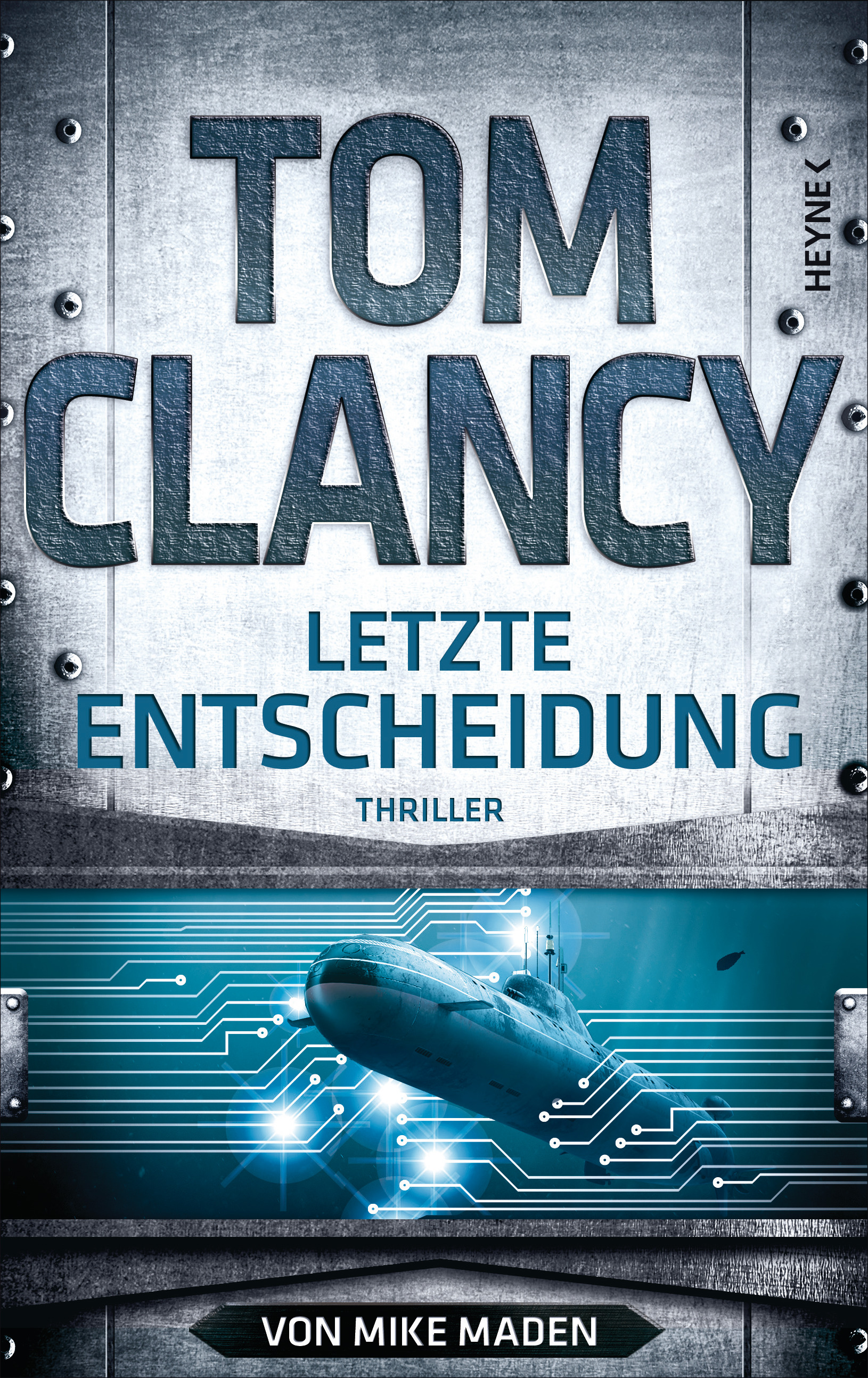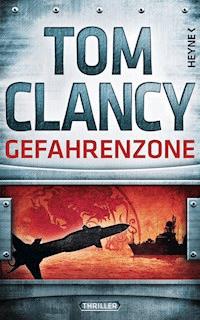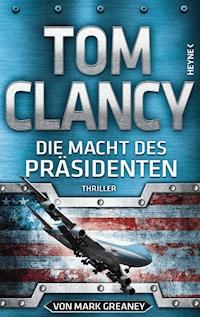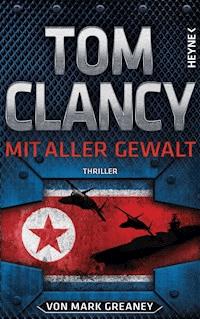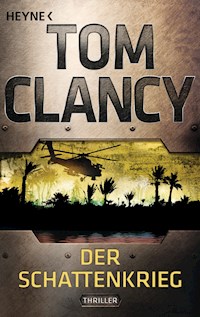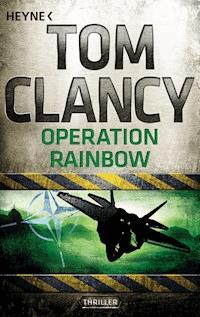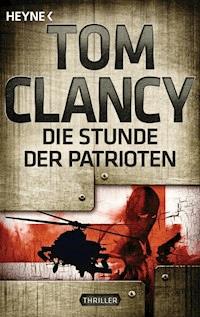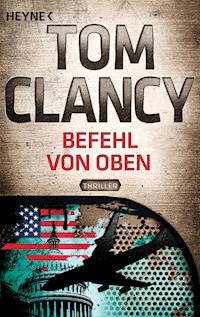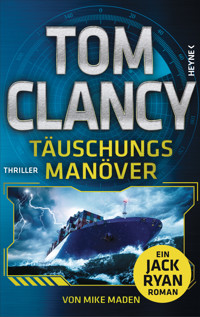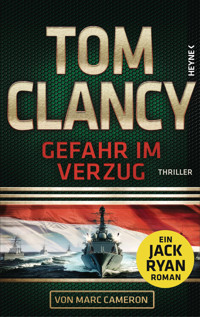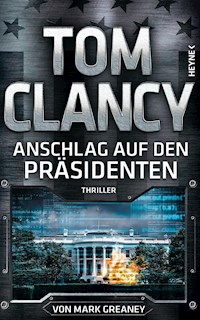
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JACK RYAN
- Sprache: Deutsch
Amerikanische Militärs werden ohne erkennbares System in ihrem privaten Umfeld attackiert. Jahrelang unbehelligte CIA-Agenten werden überraschend im feindlichen Ausland aufgegriffen. Das Muster wiederholt sich um den ganzen Globus. Unbekannte Hacker haben eine Sicherheitslücke in Servern von Regierung und Nachrichtendiensten gefunden und geben hochsensible Daten in die Hände der Feinde. Ist Präsident Jack Ryan das nächste Angriffsziel? Er muss alle persönlichen Gefühle beiseitelegen und mit dem höchsten Einsatz spielen, um die Nation zu retten – indem er den eigenen Sohn in die Schusslinie des Feindes stellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 921
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
TOM
CLANCY
UND
MARK GREANEY
ANSCHLAG AUF DEN
PRÄSIDENTEN
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Karlheinz Dürr
und Reiner Pfleiderer
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel True Faith and Allegiance
bei G.P. Putnam’s Sons, New York.
Copyright © 2016 by The Estate of Thomas L. Clancy, Jr.; Rubicon, Inc.;
Jack Ryan Enterprises, Ltd.; Jack Ryan Limited Partnership
Copyright © 2019 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Werner Wahls
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Herstellung: Helga Schörnig
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-24529-0V001
www.heyne.de
Zum Buch
Amerikanische Militärs werden ohne erkennbares System in ihrem privaten Umfeld attackiert. Jahrelang unbehelligte CIA-Agenten werden überraschend im feindlichen Ausland aufgegriffen. Das Muster wiederholt sich um den ganzen Globus. Unbekannte Hacker haben eine Sicherheitslücke in Servern von Regierung und Nachrichtendiensten gefunden und geben hochsensible Daten in die Hände der Feinde. Ist Präsident Jack Ryan das nächste Angriffsziel? Er muss alle persönlichen Gefühle beiseiteschieben und mit dem höchsten Einsatz spielen, um die Nation zu retten – indem er den eigenen Sohn in die Schusslinie des Feindes stellt.
Die Autoren
Tom Clancy, der Meister des Technothrillers, stand seit seinem Erstling Jagd auf Roter Oktober mit allen seinen Romanen an der Spitze der internationalen Bestsellerlisten. Er starb im Oktober 2013.
Mark Greaney hat Internationale Beziehungen und Politikwissenschaften studiert. Als Koautor von Tom Clancy hat er zu Recherchezwecken mehr als 15 Länder bereist und an Militär- und Polizeiübungen teilgenommen.
Anschlag auf den Präsidenten ist der 22. Band aus dem Jack-Ryan-Universum. Bei Heyne erschien zuletzt Pflicht und Ehre.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Hauptpersonen
Regierung der Vereinigten Staaten
JACK RYAN: Präsident der Vereinigten Staaten
SCOTT ADLER: Außenminister
MARY PAT FOLEY: Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste
ROBERT BURGESS: Verteidigungsminister
JAY CANFIELD: Direktor der CIA
DAN MURRAY: Justizminister
ANDREW ZILKO: Heimatschutzminister
ARNOLD VAN DAMM: Stabschef des Präsidenten
STUART COLLIER: CIA-Operationsleiter
BENJAMIN KINCAID: Konsularbeamter des US-Außenministeriums
BARBARA PINEDA: Analystin, Defense Intelligence Agency
JENNIFER KINCAID: CIA-Operationsleiterin
THOMAS RUSSELL: Special Agent, FBI; Leiter der Joint Terrorism Task Force, Abteilung Chicago
DAVID JEFFCOAT: Leitender Special Agent, FBI
Militär der Vereinigten Staaten
CARRIE ANN DAVENPORT: Captain, U. S. Army; Kopilotin und Bordschützin eines AH-64E Apache
TROY OAKLEY: Chief Warrant Officer 3, U. S. Army; Pilot eines AH-64E Apache
SCOTT HAGEN: Commander, U. S. Navy; Kapitän der USS James Greer (DDG-102)
WENDELL CALDWELL: General, U. S. Army; Befehlshaber des United States Central Command
Der Campus
GERRY HENDLEY: Direktor von Hendley Associates/Direktor des Campus
JOHN CLARK: Operationsleiter
DOMINGO »DING« CHAVEZ: Leitender Außenagent
DOMINIC »DOM« CARUSO: Außenagent
JACK RYAN JUNIOR: Außenagent/Analyst
GAVIN BIERY: Leiter der IT-Abteilung
ADARA SHERMAN: Logistik- und Transportleiterin
HELEN REID: Pilotin der campuseigenen Gulfstream G550
CHESTER »COUNTRY« HICKS: Kopilot der campuseigenen Gulfstream G550
Weitere Personen
DR. CATHY RYAN: First Lady der Vereinigten Staaten
DR. OLIVIA »SALLY« RYAN: Tochter von Präsident Jack Ryan
XOZAN BARZANI: Kompaniechef der kurdischen Peschmerga
SAMI BIN RASHID: Sicherheitsbeamter des Golfkooperationsrats
ABU MUSA AL-MATARI: jemenitischer Staatsbürger und IS-Agent
VADIM RETSCHKOW: in den USA studierender russischer Bürger
DRAGOMIR VASILESCU: Direktor von Advanced Research Technological Designs (ARTD)
ALEXANDRU DALCA: Rechercheur bei ARTD; Fachmann für Nachrichtengewinnung aus offenen Quellen
LUCA GABOR: rumänischer Gefängnisinsasse; Fachmann für die Beschaffung personenbezogener Daten
BARTOSZ JANKOWSKI: Lieutenant Colonel (a. D.), U. S. Army; Rufzeichen »Midas«; ehemaliger Delta-Force-Angehöriger
EDWARD LAIRD: ehemaliger leitender CIA-Beamter; Vertragspartner der US-Geheimdienste
»ALGIER«: algerischer IS-Kämpfer
»TRIPOLIS«: libyscher IS-Kämpfer
RAHIM: Anführer der IS-Zelle »Chicago«
OMAR: Anführer der IS-Zelle »Detroit«
ANGELA WATSON: Anführerin der IS-Zelle »Atlanta «
KATEB ALBAF: Anführer der IS-Zelle »Santa Clara«
DAVID HEMBRICK: Anführer der IS-Zelle »Fairfax«
1
Der Name des Mannes, der mit seiner Familie in dem Restaurant saß, war den meisten Amerikanern, die einen Fernseher oder einen Internetanschluss besaßen, bekannt, aber so gut wie keiner wusste, wie er aussah – hauptsächlich deshalb, weil er es tunlichst vermied, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Und das war auch der Grund, warum er es so verdammt merkwürdig fand, dass der anscheinend sehr nervöse Mann auf dem Gehweg ständig zu ihm herüberstarrte.
Scott Hagen war Commander in der US Navy. Das machte einen nun wahrlich nicht berühmt, doch Hagen hatte sich als Kapitän eines Lenkwaffenzerstörers hervorgetan, der nach Ansicht vieler Journalisten praktisch im Alleingang eine der größten Seeschlachten seit dem Zweiten Weltkrieg gewonnen hatte.
Das Gefecht zwischen den Vereinigten Staaten und Polen auf der einen und Russland auf der anderen Seite hatte nur sieben Monate zuvor in der Ostsee stattgefunden und dem Namen Scott Hagen damals zu einem hohen Bekanntheitsgrad verholfen. Doch Hagen hatte den Medien keine Interviews gegeben, und auf dem einzigen Foto, das in der Presse von ihm kursierte, posierte er stolz in seiner blauen Uniform mit der weißen Kapitänsmütze auf dem Kopf.
Im Gegensatz dazu trug er jetzt T-Shirt, Cargoshorts und Flip-Flops sowie einen Dreitagebart, sodass ihn eigentlich kein Mensch auf der Welt oder gar in diesem mexikanischen Gartenrestaurant in New Jersey mit dem vom Marineministerium ausgegebenen Foto in Verbindung bringen konnte.
Warum also, so fragte er sich, linste der Kerl, der im Halbdunkel neben dem Fahrradständer stand, ständig in seine Richtung?
Die Stadt hatte ein College, und der Typ war im Studentenalter und wirkte leicht angetrunken. Er trug ein Polohemd und Jeans, hielt in der einen Hand eine Bierdose und in der anderen ein Mobiltelefon, und Hagen hatte den Eindruck, dass er etwa zweimal pro Minute über die hell erleuchtete Terrasse voller Gäste hinweg zu seinem Tisch herüberglotzte.
Der Commander war nicht direkt beunruhigt, eher neugierig. Er war mit seiner Familie und der seiner Schwester hier, acht Personen insgesamt, und alle anderen am Tisch unterhielten sich und knabberten Chips mit Guacamole, während sie auf den Hauptgang warteten. Die Kinder tranken Limonade, Hagens Frau, seine Schwester und sein Schwager Margaritas. Er selbst blieb bei Mineralwasser, denn heute Abend war er damit an der Reihe, den Clan in dem gemieteten Van herumzuchauffieren.
Sie waren wegen eines Fußballturniers in der Stadt. Hagens siebzehnjähriger Neffe war der Star-Keeper seiner Highschoolmannschaft, die am folgenden Nachmittag das Finale bestritt. Morgen würde Hagens Frau den Mietwagen fahren, damit er nach dem Spiel in einem Restaurant ein paar kühle Bierchen zischen konnte.
Hagen aß noch einen Chip, sagte sich, dass er sich wegen des angetrunkenen Blödmanns keinen Kopf zu machen brauchte, und konzentrierte sich wieder auf die Runde am Tisch.
Der Militärdienst brachte viele Nachteile mit sich. Aber der größte war, dass man zu wenig Zeit für die Familie hatte. Kein versäumter Geburts- oder Feiertag, keine verpasste Hochzeit oder Beerdigung ließ sich nachholen.
Wie viele Männer und Frauen beim Militär sah auch Commander Scott Hagen seine Familie dieser Tage nicht genug. Die Gelegenheiten, bei denen er sich loseisen und mit seinen Kindern und Neffen etwas unternehmen konnte, wurden immer rarer, sodass er diesen Abend zu schätzen wusste.
Zumal er ein aufreibendes Jahr hinter sich hatte.
Nach der Schlacht in der Ostsee und der bedächtigen Heimfahrt über den Atlantik hatte er die beschädigte USSJames Greer ins Trockendock in Norfolk, Virginia, gebracht, wo sie sechs Monate lang instand gesetzt werden sollte.
Hagen war nach wie vor ihr Kommandant, sodass Norfolk einstweilen sein Zuhause darstellte. Viele Navy-Angehörige hielten die Zeit im Trockendock für besonders beschwerlich, weil es an Bord viel zu tun gab, die Klimaanlage des Schiffes nicht regelmäßig lief und viele andere Annehmlichkeiten wegfielen.
Doch Scott Hagen würde sich nie darüber beklagen. Er hatte den Krieg aus nächster Nähe erlebt und Männer verloren, und obwohl er und sein Schiff als unbestreitbare Sieger daraus hervorgegangen waren, hatte die Erfahrung des Krieges nichts Beneidenswertes, auch nicht aus Sicht der Sieger.
Russland verhielt sich jetzt mehr oder weniger ruhig. Es kontrollierte zwar nach wie vor einen bedeutenden Teil der Ukraine, doch das Atom-U-Boot der Borei-Klasse, das es entsandt hatte, um vor der Küste der Vereinigten Staaten zu patrouillieren, war in seine Marinebasis in der nördlich von Murmansk gelegenen Sajda-Bucht zurückgekehrt und hatte sich auf der Rückfahrt absichtlich gezeigt und vor der schottischen Nordküste fotografieren lassen.
Und die russischen Truppen, die in Litauen eingefallen waren, hatten sich wieder zurückgezogen.
Die Russen hatten im Baltikum eine peinliche Schlappe erlitten, und mit Sicherheit hätte es jeden in diesem mexikanischen Gartenrestaurant in New Jersey überrascht zu erfahren, dass der Durchschnittstyp von Familienvater, der an dem großen Tisch unter Sonnenschirmen saß, dabei eine maßgebliche Rolle gespielt hatte.
Hagen war die Anonymität durchaus recht. Der Vierundvierzigjährige mochte keinen Wirbel um seine Person. Er ging nie in Uniform mit der Familie aus und erzählte nie Geschichten von Gefechten auf hoher See. Nein, im Moment faulenzte er mit seinen Kindern und Neffen und scherzte mit seiner Frau, dass er, wenn er vor dem Essen noch mehr Chips mit Guacamole esse, morgen verschlafen und das Spiel verpassen werde.
Er und seine Frau lachten, und dann sagte sein Schwager Allen zu ihm: »He, Scotty, kennst du den Typ da drüben auf dem Gehweg?«
Hagen schüttelte den Kopf. »Nein. Aber er beobachtet uns schon eine ganze Weile.«
»Kann es sein, dass er unter dir gedient hat oder so was?«, fragte Allen.
»Er kommt mir nicht bekannt vor.« Er überlegte einen Moment und sagte dann: »Aber merkwürdig ist das schon. Ich gehe zu ihm rüber und frage ihn, was das soll.«
Er nahm die Serviette vom Schoß, stand auf und durchquerte das belebte Gartenlokal.
Der junge Mann wandte sich ab, bevor Hagen die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatte, warf seine Bierdose in einen Abfalleimer und trat auf die dunkle Straße.
Er überquerte sie eilends und verschwand auf einem belebten Parkplatz.
Als Hagen an den Tisch zurückkam, sagte Allen: »Merkwürdig. Was meinst du? Was sollte das?«
Hagen wusste nicht, was er davon halten sollte, wohl aber, was er zu tun hatte. »Der Typ ist mir nicht geheuer. Lass uns auf Nummer sicher gehen und von hier verschwinden. Bring die anderen nach drinnen. Verlasst das Restaurant durch die Hintertür und lauft zum Van. Ich bleibe hier, bezahle die Rechnung und nehme dann ein Taxi ins Hotel.«
Seine Schwester Susan hörte alles, hatte aber keine Ahnung, was vor sich ging. Sie hatte den jungen Mann gar nicht bemerkt. »Was ist denn los?«
Allen wandte sich jetzt an beide Familien. »Alle mal herhören. Keine Fragen, bis wir am Van sind, aber wir müssen jetzt gehen. Wir lassen uns im Hotel etwas aufs Zimmer bringen.«
»Mein Bruder wird nervös, wenn er ohne einen Haufen Atomwaffen herumfährt«, bemerkte Susan.
Die James Greer hatte keine Atomwaffen an Bord, aber Susan war Steueranwältin und wusste es nicht besser, und Hagen war zu beschäftigt, um sie zu korrigieren, denn er fing gerade einen vorbeieilenden Kellner ab, um die Rechnung zu bestellen.
Alle ärgerten sich darüber, dass sie aus dem Restaurant gescheucht wurden, obwohl volle Teller zu ihnen unterwegs waren, begriffen aber, dass etwas Ernstes im Gang war, und fügten sich.
Als die sieben sich gerade in Richtung Hintertür in Bewegung gesetzt hatten, drehte sich Hagen um. Da war er wieder, der junge Mann. Er überquerte gerade die zweispurige Straße und steuerte auf das Gartenrestaurant zu. Er trug jetzt einen langen grauen Trenchcoat, unter dem er offensichtlich etwas verbarg.
Hagen kamen Zweifel an Allens Fähigkeit, die Familie zu führen, und auch Susan schien den Ernst der Lage nicht zu begreifen. Darum rief er seiner Frau zu: »Durchs Restaurant! Lauft! Schnell!«
Laura Hagen packte Tochter und Sohn und zog sie in Richtung Hintertür. Hagens Schwester und Schwager folgten dicht dahinter, wobei sie ihre beiden Jungs vor sich herschoben.
Hagen wollte ihnen nach, drosselte aber seine Schritte, als er zu seinem Entsetzen sah, wie der Mann eine AK-47 unter dem Trenchcoat hervorzog. Auch andere Gäste bemerkten es, denn es war kaum zu übersehen.
Schreie erfüllten die Luft.
Die Augen auf Commander Scott Hagen gerichtet, drang der junge Mann in das Gartenlokal ein und hob das Gewehr an die Schulter.
Hagen erstarrte.
Das kann nicht wahr sein. Das glaube ich einfach nicht!
Er selbst hatte keine Waffe. Er war hier in New Jersey, und obwohl er in Virginia eine Schusswaffe tragen durfte und ihm das auch in fünfunddreißig anderen Bundesstaaten gesetzlich erlaubt war, wäre er hier dafür ins Gefängnis gewandert.
Es war ihm auch kein Trost, dass dieser Wahnsinnige gegen das Gesetz verstieß, indem er mitten in der Stadt eine Kalaschnikow in Anschlag brachte. Er bezweifelte, dass es dem Kerl etwas ausmachte, dass er zusätzlich zu versuchtem Mord an rund hundert Restaurantgästen wahrscheinlich auch des unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt werden würde.
Bumm!
Erst als der erste Schuss einen Meter links von ihm in einen gemauerten Zierbrunnen einschlug, löste sich Scott Hagen aus seiner Erstarrung. Er wusste, dass seine Familie direkt hinter ihm war, und dieses Wissen setzte den Reflex, sich zu ducken, irgendwie außer Kraft. Er machte sich groß und breit und benutzte seinen Körper, um die Seinen zu decken, aber er blieb nicht stehen.
Er hatte keine Wahl. Er rannte los, dem Gewehrfeuer entgegen.
Der Schütze gab in schneller Folge drei Schüsse ab, doch in dem nun ausbrechenden Chaos warfen mehrere Gäste Tische und Schirme um, versperrten ihm den Weg und rempelten ihn sogar bei dem Versuch, aus dem Restaurant zu fliehen. Hagen verlor ihn aus den Augen, als ein roter Sonnenschirm zwischen ihnen umkippte, aber das trieb ihn zusätzlich an, denn wenn dem Angreifer die Sicht versperrt war, stiegen seine Chancen, den Mann zu packen, bevor er sich eine Kugel fing.
Und er schaffte es beinahe.
Der Angreifer stieß mit dem Fuß den Schirm beiseite, sah, dass sein Opfer durch eine freie Gasse im Chaos auf ihn zustürmte, und feuerte mit der Kalaschnikow. Hagen spürte, wie eine Kugel seinen linken Unterarm traf – er wurde halb herumgewirbelt und geriet, aus dem Schwung gebracht, ins Straucheln, doch er preschte weiter zwischen den Tischen hindurch.
Hagen war kein Experte im Kampf mit Handfeuerwaffen – er war Seemann und kein Soldat –, aber er spürte, dass dieser Mann kein gut ausgebildeter Kämpfer war. Der Bursche konnte zwar eine Kalaschnikow bedienen, aber er wirkte gehetzt, hektisch, hatte einen irren Blick.
Worum es ihm auch gehen mochte, es war für ihn eine sehr persönliche Sache.
Und für Hagen jetzt auch. Er hatte keine Ahnung, ob jemand aus seiner Familie verletzt worden war, er wusste nur, dass dieser Mann gestoppt werden musste.
Ein Kellner stürzte sich von rechts auf den Schützen, bekam ihn an der Schulter zu fassen und schüttelte ihn, damit er die Waffe fallen ließ, doch der Angegriffene fuhr herum, krümmte den Finger am Abzug und schoss dem mutigen jungen Mann aus einem halben Meter Entfernung mehrmals in den Bauch.
Der Kellner war tot, bevor er auf dem Boden aufschlug.
Dann richtete der Schütze die Waffe wieder auf den angreifenden Hagen.
Die zweite Kugel, die den Commander traf, richtete größeren Schaden an als die erste – sie bohrte sich oberhalb der rechten Hüfte ins Fleisch und rüttelte ihn durch –, aber er stürmte weiter, und der nächste Schuss war zu hoch. Der Kerl bekam den Rückstoß der Waffe nicht in den Griff. Der zweite und dritte Schuss jeder Folge waren zu hoch, da die Mündung nach oben gerissen wurde.
Eine Kugel jagte an Hagens Gesicht vorbei, als er sich mit einem Satz auf den Mann warf und ihn rückwärts über einen Metalltisch riss.
Die beiden Männer schlugen hart auf den Steinplatten des Gartenrestaurants auf. Hagen umschloss mit der rechten Hand den Lauf der Kalaschnikow und drückte die Mündung von sich weg. Das heiße Metall versengte ihm die Finger, aber er ließ nicht los.
Er war Rechtshänder, aber jetzt schlug er dem jungen Mann immer wieder die linke Faust ins Gesicht. Er spürte den Schweiß an den Wangen des Mannes, in seinem Haar, und dann fühlte er das Blut, als die Nase des Angreifers brach und ein roter Schwall sich über sein Gesicht ergoss.
Noch hielt der Mann das Gewehr fest, doch sein Griff erlahmte. Schließlich entriss es ihm Hagen, rollte sich von ihm herunter, stemmte sich auf die Knie hoch und richtete die Waffe auf ihn.
»Dawai!«, schrie der junge Mann. Für Hagen war es der erste Hinweis darauf, dass er es mit einem Ausländer zu tun hatte.
Der Angreifer rollte sich auf die Knie, und während Hagen ihn anbrüllte, er solle sich nicht bewegen und die Hände heben, griff der Mann in die Tasche seines Trenchcoats.
»Ich knall dich ab, verdammt!«, schrie Hagen.
Der Mann zog ein blankes Messer mit zwanzig Zentimeter langer Klinge unter dem Trenchcoat hervor und ging, einen irren Ausdruck im blutverschmierten Gesicht, zum Angriff über.
Er war nur anderthalb Meter entfernt, als Hagen ihm zweimal in die Brust schoss. Das Messer fiel zu Boden, Hagen trat beiseite, und der junge Mann stürzte, Stühle umreißend, mit dem Gesicht in von einem Tisch gefallene Speisen.
Der Anschlag war vorüber. Hagen hörte hinter sich Stöhnen, Schreie von der Straße, das Heulen von Sirenen und Autoalarmanlagen, das Weinen von Kindern.
Er zog das Magazin aus dem Gewehr und warf es weg, dann zog er den Spannhebel bis zum Anschlag zurück, damit die noch im Patronenlager steckende Patrone ausgeworfen wurde, und ließ die Waffe zu Boden fallen. Er drehte den Verletzten auf den Rücken und kniete sich über ihn.
Der Mann hatte die Augen offen – er war bei vollem Bewusstsein, aber sichtlich dem Tode nahe und jetzt so gefügig wie eine Puppe.
Hagen, der sich trotz Adrenalin wieder im Griff hatte, sah ihm direkt ins Gesicht. »Wer sind Sie? Warum haben Sie das getan? Warum?«
»Für meinen Bruder«, antwortete der blutüberströmte Mann. Hagen konnte hören, wie sich seine Lunge mit Blut füllte.
»Wer zum Teufel ist Ihr …«
»Sie haben ihn getötet. Sie haben ihn ermordet!«
Der Mann sprach mit russischem Akzent, und Hagen verstand. Bei dem Gefecht in der Ostsee war sein Schiff an der Versenkung zweier U-Boote beteiligt gewesen. »War er Seemann?«, fragte er.
Die Stimme des jungen Mannes wurde mit jeder Sekunde schwächer. »Er ist gefallen … als Held … der Russischen … Föderation.«
Da kam Hagen ein anderer Gedanke. »Wie haben Sie mich gefunden?«
Die Augen des Mannes wurden glasig.
»Woher haben Sie gewusst, dass ich mit meiner Familie hier bin?« Hagen gab ihm eine kräftige Ohrfeige. Ein Restaurantgast, ein Mittdreißiger mit blutverschmiertem Hemd, versuchte, Hagen von dem Mann herunterzuziehen. Hagen stieß ihn weg.
»Wie, du Hurensohn?«
Die Augen des jungen Russen drehten sich langsam weg. Hagen ballte die Faust und hob sie hoch. »Antworte mir!«
Eine Stimme dröhnte vom Empfangstisch auf dem Gehweg herüber. »Keine Bewegung!« Hagen schaute auf und erblickte einen Polizisten, der mit ausgestreckten Armen eine Pistole hielt, die auf seinen Kopf zielte. Der Mann wusste nicht, was hier vorging, nur dass inmitten von Toten und Verletzten, die in einem verwüsteten Restaurant lagen, irgendein Arschloch auf einen Verletzten einprügelte.
Hagen hob die Hände, und dabei spürte er die Wunden an seiner Seite und seinem Arm.
Alles verschwamm vor seinen Augen. Er rollte sich auf den Rücken und starrte in die Nacht.
Er glaubte, zwischen den Entsetzensschreien und Schreckensrufen seine Schwester hinter sich laut weinen zu hören. Er konnte das nicht begreifen, denn er glaubte, er habe seiner Familie die nötige Zeit verschafft, um sich in Sicherheit zu bringen.
2
Im Unterschied zu seinem berühmten Vater hatte Jack Ryan junior keine Flugangst. Tatsächlich war sein Vertrauen in Flugzeuge recht groß, jedenfalls größer als sein Vertrauen in die eigene Fähigkeit, ohne sie durch die Luft zu fliegen.
Dass er in diesem Moment an sein relativ entspanntes Verhältnis zum Fliegen dachte, lag hauptsächlich daran, dass er beabsichtigte, sich in wenigen Augenblicken vierhundert Meter über der Chesapeake Bay aus der Seitentür eines tadellos funktionierenden Flugzeugs in den blauen Himmel zu stürzen.
Jack hatte seinen Fallschirm unter Anleitung und Aufsicht von Domingo Chavez, dem leitenden Agenten seiner kleinen geheimen Einheit, eigenhändig gepackt, und er war sich sicher, dass er ihn richtig gepackt hatte. Doch sein Verstand arbeitete gegen ihn. Statt ihn in der Überzeugung zu bestärken, dass alles problemlos ablaufen würde, erinnerte er ihn daran, dass er bei seiner letzten Reise vergessen hatte, sein Lieblingspaar Laufsocken ins Handgepäck zu stopfen.
Auch damals hatte er gedacht, er hätte beim Packen alles richtig gemacht.
Das ist nicht dasselbe, Jack. Eine bescheuerte Reisetasche zu packen ist etwas ganz anderes als einen Fallschirm.
Seine Einbildungskraft schien heute Morgen entschlossen, ihm Bauchschmerzen zu bereiten.
Jack absolvierte momentan ein Fallschirmspringertraining, allerdings nicht im Rahmen einer militärischen Ausbildung oder eines normalen Kurses für Zivilisten, sondern eines Lehrgangs, den die Chefs von Jacks Organisation entwickelt hatten. Jack arbeitete für den Campus, einen kleinen, aber wichtigen inoffiziellen Nachrichtendienst, dem ehemalige Soldaten und Geheimdienstler angehörten, von denen einige bewährte Freifallexperten waren.
Und man hatte entschieden, dass Jack Ryan junior sich diese wichtige Fähigkeit ebenfalls aneignen sollte, denn er hatte seine Tätigkeit beim Campus zwar als Nachrichtenanalyst begonnen, war aber in den letzten Jahren immer mehr in eine operative Rolle hineingewachsen. Inzwischen bekleidete er zwei Funktionen: Er konnte wochen- oder monatelang in seinem Kabuff sitzen und die Finanzpraktiken eines korrupten Staatschefs oder einer Terrororganisation enträtseln, es kam aber auch vor, dass er die Tür eines Zielobjekts eintrat und sich in einen Nahkampf stürzte.
Jacks Leben mangelte es nicht an Abwechslung.
Doch in diesem Moment hatte er keine Zeit, über die Ironie seines Werdegangs nachzusinnen. Nein, denn er ging jetzt im Stillen die Liste der Dinge durch, die er tun musste, sobald er aus dem Flugzeug sprang, was in genau …
Jemand aus dem vorderen Teil des Flugzeugs rief: »Ryan! Noch vier Minuten.«
In genau vier Minuten hieß es: »Abspringen, Kopf nach vorne, Arme zur Seite, Bauchlage, Knie leicht gebeugt. Hohlkreuzhaltung einnehmen, Reißleine ziehen, sich auf Ruck gefasst machen und checken, ob Schirm gut geöffnet hat.«
Er murmelte diese hochwichtige To-do-Liste leise vor sich hin, während er auf der Bank saß, die seitlich am Rumpf des Flugzeugs entlanglief.
Dies war nicht sein erster Solosprung. Er hatte vor zwei Wochen mit der theoretischen Ausbildung begonnen, war dann im Freien mit seiner Ausrüstung von langsam fahrenden Pick-ups gehüpft und über einen Grünstreifen gepurzelt. Danach war er zwei Tage lang Tandems gesprungen und, durch Gurte mit Domingo Chavez oder seinem Cousin Dominic Caruso, dem dritten operativen Agenten des Campus, verbunden, über den Himmel gesaust. Chavez und Caruso waren beide erfahrene Freifallspringer, die sowohl HALO-Sprünge (Abkürzung für High Altitude/Low Opening; große Absprunghöhe/niedere Öffnungshöhe) als auch HAHO-Sprünge (für High Altitude/High Opening; große Absprunghöhe/große Öffnungshöhe) beherrschten und ihn Schritt für Schritt durch den Anfängerteil der Ausbildung begleiteten.
Jack tat, was von ihm verlangt wurde, sodass er rasch zu Sprüngen mit Aufziehleine überging, die Ding Chavez als dope on a rope bezeichnete und bei denen der Schirm automatisch öffnete, sobald man aus dem Flugzeug sprang.
In der nächsten Phase erfolgten Sprünge aus geringer Höhe in Wasser, wobei er selbst die Reißleine zog, allerdings unmittelbar nach Verlassen des Flugzeugs – die nannte Chavez hop-and-pops.
Bisher hatte er fünf Hop-and-pops absolviert, und alle waren planmäßig verlaufen. Und obwohl er nun wahrlich kein Naturtalent war und sich noch nicht einmal seinen ersten Freifallsprung verdient hatte, war er von John Clark, dem Operationsleiter der kleinen Organisation, schon mehrmals gelobt worden.
Und das wollte was heißen, denn John Clark kannte sich aus – vor seinem Wechsel zum Campus war er Navy SEAL, paramilitärischer CIA-Offizier und Chef einer Anti-Terror-Spezialeinheit der Nato gewesen und hatte so viele verdeckte Einsatzsprünge absolviert wie nur wenige Männer auf der Welt.
Obwohl Jack seit zwei Tagen Hop-and-pops machte, würde sich der Sprung am heutigen Morgen gründlich von den anderen unterscheiden, denn sobald er im Wasser gelandet war, sollte er zu einer in der Nähe ankernden Jacht schwimmen und zu den beiden anderen Männern des Teams stoßen, die bereits an Bord waren. Zusammen sollten sie dann einen Übungsangriff auf das Boot durchführen, in dem sich Mitarbeiter des Campus aufhielten, die den Part der gegnerischen Partei übernahmen.
Jetzt, wenige Minuten vor seinem Sprung, blickte Jack quer durch die Kabine der Cessna Grand Caravan zu den beiden anderen Männern, die an der heutigen Übung teilnahmen. Dominic Caruso war von Kopf bis Fuß in Schwarz gehüllt – selbst Fallschirmgurt, Schutzbrille und Helm waren schwarz. Seine Einsatzweste war mit 30-Schuss-Magazinen für 9-mm-Patronen gefüllt, und über seine rechte Schulter war eine SIG-Sauer-MPX-Maschinenpistole mit Schalldämpfer geschnallt.
Jack wusste, dass die Magazine für Doms Maschinenpistole und die Glock-Pistole an seiner Hüfte mit FX-Patronen gefüllt waren – Projektilen, die kein Blei, sondern Farbe enthielten, aber nichtsdestotrotz Projektile waren und beim Aufprall verdammt wehtaten.
Clarks und Chavez’ Motto lautete: Je mehr du im Training schwitzt, desto weniger blutest du im Gefecht. Jack verstand den Spruch, doch Tatsache war, dass er im Training häufig geblutet hatte, wie übrigens auch in richtigen Kämpfen.
Jack war ähnlich ausstaffiert wie Caruso und Chavez, mit zwei bemerkenswerten Ausnahmen. Zum einen hatte Jack Schwimmflossen um die Brust geschnallt; die würde er anlegen, sobald er im Wasser war. Zum anderen trugen die beiden Männer, die ihm gegenübersaßen, MC-6-Fallschirme, die mit speziellen, für US-Spezialkräfte entwickelten SF-10A-Schirmen ausgestattet waren, die es ihnen gestatteten, weite Strecken zu fliegen und präzise zu landen, ja sogar ermöglichten, in der Luft langsam nach hinten zu gleiten.
Bei Jacks Fallschirm handelte es sich dagegen um ein viel schlichteres T-11-Modell, das seine Beweglichkeit sehr stark einschränkte. Er würde mit einer Geschwindigkeit von etwa zwanzig Kilometer pro Stunde fallen, und wo er landete, hing weitgehend von der Geschwindigkeit des Flugzeugs, dem Wind und der Schwerkraft ab.
Die anderen beiden würden direkt auf dem Deck der Jacht landen, während Jack nur einen Hop-and-pop hinlegen und zusehen musste, dass er die riesige Wasserfläche der Chesapeake Bay direkt unter dem Flugzeug nicht verfehlte. Jack steckte gewissermaßen noch in der »Stützräderphase«, deshalb musste er schwimmen, bevor er mit den beiden anderen das Boot entern konnte. Das war zwar etwas peinlich, doch er wusste, dass kein anderer Anfänger in der Welt des Fallschirmspringens schon in der zweiten Ausbildungswoche im Rahmen seiner Sprünge simulierte Angriffe durchführte, deshalb kam er sich nicht ganz so leichtgewichtig vor.
Ding Chavez saß Jack gegenüber neben Caruso. Im Moment hatte er ein Headset auf, damit er mit der Crew kommunizieren konnte, der Pilotin Helen Reid und ihrem Kopiloten Chester Hicks. Normalerweise flogen die beiden den campuseigenen Jet, eine Gulfstream G550, doch heute hatten sie sich in die Niederungen der Fliegerei begeben und steuerten die viel leistungsschwächere und technisch simplere Cessna Caravan, aber sie genossen die Abwechslung.
Dom Caruso bemerkte, dass Chavez über das Headset mit den Piloten sprach, und so beugte er sich zu Jack herüber und sagte vertraulich in sein Ohr: »Alles in Ordnung, Cousin?«
»Aber sicher, Mann.« Sie schlugen die behandschuhten Fäuste gegeneinander, wobei sich Jack alle Mühe gab, sein Unbehagen zu verbergen.
Und mit Erfolg, wie es schien, denn Caruso sagte nichts von wegen, dass er kreidebleich im Gesicht sei oder dass seine Hände zitterten. Stattdessen vergewisserte er sich noch einmal, dass Chavez das Headset aufhatte und nicht hören konnte, was er und Jack sprachen. Dann beugte er sich wieder vor.
»Laut Ding werden wir es auf der Jacht mit einer unbekannten Zahl von Gegnern zu tun bekommen, aber unter uns gesagt, werden uns fünf Bösewichte dort erwarten.«
Jack legte den Kopf schief. »Wie kommst du darauf?«
»Per Ausschlussverfahren. Wer von den Campus-Mitarbeitern kann zu einer Schießerei mit uns abkommandiert werden? Adara spielt das Entführungsopfer, das ist ihr gestern herausgerutscht. Und Clark befehligt die Gegnertruppe, versteht sich. Er wartet da unten mit einer Waffe. Damit bleiben nur noch unsere vier Sicherheitsleute: Gomez, Fleming, Gibson und Henson.« Der Campus beschäftigte gründlich durchleuchtete ehemalige Militärs und Nachrichtendienstler als Sicherheitspersonal der Einrichtung. Alle waren ehemalige Green Berets oder SEALs. Darüber hinaus hatten Gibson und Henson beim Global Response Staff der CIA gedient, einem erstklassigen Sicherheitsdienst, der Einrichtungen der Agency in aller Welt schützte. Alle vier waren über fünfzig Jahre alt, aber so fit wie Olympioniken, knallharte Burschen und seit vielen Jahren mit Chavez und Clark befreundet.
Zusätzlich zu ihren Aufgaben im Objektschutz halfen die vier von Zeit zu Zeit in der Ausbildung aus, da sie Experten für Feuerwaffen, Blankwaffen und sogar für den unbewaffneten Kampf waren.
»Du könntest recht haben«, erwiderte Jack. »Aber Clark hat uns schon öfter überrascht. Vielleicht helfen auch ein paar Jungs aus der Analyseabteilung aus, die was vom Schießen verstehen. Mike und Rudy zum Beispiel. Die waren Infanteristen bei der Army.«
Caruso grinste. »Ranger waren sie, das gebe ich zu. Aber Rudy hat mich heute früh vom Büro aus angerufen. Er will vielleicht meinen Truck kaufen und hat mich gebeten, die Schlüssel unter den Sitz zu legen, damit er in der Mittagspause bei mir zu Hause vorbeischauen und eine Probefahrt machen kann. Er hat gesagt, dass Mike mitkommen würde.«
Jack überlegte, wer sonst aus ihrer Organisation die zweieinhalbstündige Fahrt vom Büro in Alexandria, Virginia, unternommen haben könnte, um heute Morgen die Schurkenrolle zu spielen. »Donna Lee war beim FBI. Sie kann mit einer Maschinenpistole umgehen.«
»Adara hat mir erzählt, dass sich Donna am Mittwoch beim Fitnesstraining das Knie verdreht hat«, entgegnete Dom. »Sie wird ein paar Wochen an Krücken gehen.«
Jetzt musste Jack grinsen. »Du hast wirklich an alles gedacht.«
»Wir beide treffen in der wirklichen Welt schon auf genügend Arschlöcher, die uns abknallen wollen. Ich habe nicht die Absicht, heute ein FX-Projektil ins Gemächt zu bekommen. Ich habe am Wochenende etwas vor. Ich trickse das System aus, wenn ich muss.«
Jetzt lachte Jack, froh über die Ablenkung, die ihn davon abhielt, ständig an seine Qualitäten als Fallschirmpacker und den bevorstehenden Sprung zu denken. »Was hast du denn am Wochenende vor?«
Dom sah so aus, als dächte er darüber nach, ob er auf die Frage antworten sollte, doch im selben Moment nahm Ding das Headset ab, und Dominic lehnte sich wieder zurück.
»Was habt ihr zwei Armleuchter für Heimlichkeiten?«
Die beiden Angesprochenen grinsten, antworteten aber nicht.
Chavez hob die Augenbrauen. »Noch zwei Minuten, Jack. Du wirst rund dreihundert Meter vom Boot entfernt abgesetzt, und zwar hinterm Heck, damit du nicht bemerkt wirst. Natürlich ist helllichter Tag, und in der wirklichen Welt würde dich jeder Wachposten beim Blick nach achtern bemerken, aber das ist eine Übung. Die Gegner an Bord konzentrieren sich auf das Boot. Du kannst unbehelligt hinschwimmen, solange du nicht zu sehr auffällst.«
»Ja«, sagte Dominic. »Paddle nicht in einer großen gelben Gummiente hin.«
Jack reckte die Daumen nach oben.
»Sobald du draußen bist, bringt uns Helen auf sechstausend Fuß. Von dort oben springen wir und segeln direkt an Deck. Auf dem Weg nach unten orten wir Ziele und versuchen, sie bei der Landung auszuschalten. Wenn wir gelandet sind und das Gurtzeug ablegen, möchte ich, dass du die Bootsleiter heraufkletterst und bereit bist, uns zu verstärken.«
»Alles klar«, sagte Jack und spähte durch das Fenster. Vor ihm lag eine anstrengende Schwimmstrecke. Das Wasser in der Bucht sah kabbelig aus.
In diesem Augenblick stemmte sich Chester »Country« Hicks aus dem Kopilotensitz und kam nach hinten zur Kabinentür. Er legte den Hebel um, und der Rollladen an der Luke öffnete sich. Ein lokomotivähnliches Dröhnen erfüllte die ohnehin schon laute Kabine, begleitet vom Rauschen der Luft, die an dem mit neunzig Knoten fliegenden Flugzeug vorbeitoste.
Hicks hielt einenFinger in die Höhe. Noch eine Minute bis zum Absprung. Jack erhob sich zusammen mit Dom. Sie stießen erneut die Fäuste aneinander, dann ging Jack zu der offenen Luke.
Dom begleitete ihn und neigte sich zu seinem Ohr. »Und nicht vergessen …«
Jack legte den Kopf schief. »Was nicht vergessen?«
»Alles«, grinste Chavez, klopfte dem Jüngeren auf den Rücken und deutete auf die offene Luke. »Ab mit dir, Jack. Du musst gerade runter wie ein Stein!«
Jack kämpfte gegen einen Anflug von Übelkeit an, wartete, bis Country das Kommando gab, und sprang dann hinaus.
3
Sieben Minuten später dümpelte Jack im Wasser vor der Bootsleiter am Heck der Hail Caesar, einer 21 Meter langen Nordhavn-Jacht, die einem Freund von Campus-Direktor Gerry Hendley gehörte. Das Boot ankerte vor Carpenter Point im Norden der Chesapeake Bay, ein paar Meilen östlich der Mündung des Susquehanna River.
Jack war erschöpft vom Schwimmen, was er dem Susquehanna wie auch dem North East River anlastete, die hier beide südwärts in die Bucht strömten und ihm das Vorankommen erschwert hatten. Er hatte keine Tauchausrüstung getragen, nur die Flossen und eine Tauchermaske mit Schnorcheln, sodass er den größten Teil der Strecke an der Oberfläche schwimmend zurückgelegt hatte. Wegen der Wellen hatte er sich jeden Meter erarbeiten müssen und einiges an Meerwasser geschluckt, und während er jetzt seine überschüssige Ausrüstung am Fuß der Bootsleiter verstaute und seine schallgedämpfte Maschinenpistole feuerbereit machte, würgte er ein wenig.
Ein Blick auf seine Uhr verriet ihm, dass er es gerade rechtzeitig geschafft hatte. Und dann erwachte wie auf Stichwort sein wasserdichtes Headset zum Leben, und Ding Chavez’ Stimme flüsterte: »Eins in Position.«
Gleich darauf meldete Caruso über Funk: »Zwei. Planmäßig auf Zielobjekt.«
Jacks Meldung war nicht so machomäßig wie die seines Cousins. »Drei. Ich bin hier. Komme jetzt rauf.«
»Verstanden«, antwortete Chavez. »Wir sind direkt über dir.«
Jack erklomm die Bootsleiter und erblickte Ding und Dom in ihrer schwarzen Ausrüstung. Ihre Fallschirme waren zusammengerollt und unter einer dicken Taurolle auf dem Hauptachterdeck verstaut, und nur ein paar Schritte vor ihnen saß, mit dem Rücken an die Steuerbordwand gelehnt, Dale Henson, einer ihrer Sicherheitsleute und Mitglied der Gegnertruppe. Zwei rote Kleckse prangten auf der Brust seines Khaki-Overalls, und neben ihm auf dem Teakholzdeck lag eine Maschinenpistole.
Henson hatte einen Schokoriegel aus der Tasche gezogen und begann ihn jetzt zu essen, wobei er zu den drei Angreifern aufschaute, ohne sich im Geringsten den Anschein zu geben, als wollte er für die Dauer der Übung den Toten spielen.
Er zwinkerte Jack zu, dann verdrehte er die Augen und tat scherzhaft so, als hätte er gerade zwei Schüsse in die Brust bekommen.
»Nett«, flüsterte Chavez, und dann: »Fleming ist auf der Flybridge. Dom hat ihn in den Rücken gepikt, bevor er gemerkt hat, dass wir über ihm waren.«
Jack nickte. Zwei Gegner waren in aller Stille ausgeschaltet worden, und keiner war mehr dazu gekommen, über Funk eine Warnung abzusetzen.
Geräuschlos bildeten die drei Campus-Agenten eine taktische Formation und rückten auf dem Steuerborddeck zu der Tür vor, die in den Hauptsalon führte.
Ding ging voraus, Dominic direkt hinter ihm. Jack, der das Schlusslicht bildete, sah, wie Dom die rechte Hand hob und drei Finger abspreizte. Auf diese Weise teilte ihm Dom mit, dass sie es nach der Theorie, die er in der Cessna aufgestellt hatte, nur noch mit drei Gegnern zu tun hatten.
An der Luke zum Hauptsalon blieb Ding stehen und winkte Jack nach vorn. Er bückte sich tief hinab und zückte ein HHIT2 – ein tragbares Inspektionsgerät. Es handelte sich um eine Minivideokamera mit wärmeempfindlichen Sensoren und einem langen biegsamen Schwanenhals zwischen Objektiv und eigentlichem Gerät. Jack bog den Hals nach unten und blickte, während er das Kameraauge langsam unter der Tür durchschob, auf den handygroßen Monitor. Die 13 Millimeter breite Kamera zeigte Jack die Szene dahinter. Dort saßen Pablo Gomez und Jason Gibson, die beiden anderen Übungsteilnehmer, auf Stühlen und sahen fern. Beide trugen Schutzbrillen, hatten Pistolen im Hosenbund stecken und Maschinenpistolen in Reichweite liegen.
Jack hielt für Chavez und Caruso zwei Finger hoch.
Während er seine Beobachtung fortsetzte, nahm Gomez das Funkgerät vom Tisch neben sich, sprach hinein und machte dann ein besorgtes Gesicht. Wahrscheinlich, so vermutete Jack, weil die an Deck wachenden Henson und Fleming nicht antworteten.
Gomez legte das Walkie-Talkie weg, erhob sich vom Stuhl und griff zu seiner MP. Gibson verstand den Wink und folgte seinem Beispiel.
Jack richtete sich auf, verstaute das Gerät in einer Gürteltasche, die er auf dem Rücken trug, und nahm seine MPX hoch. Gleichzeitig wandte er sich Chavez zu und flüsterte in dringlichem Ton: »Sie haben was gemerkt!«
Ding griff nach der Klinke, und als Jack den Feuerwahlhebel seiner SIG auf Dauerfeuer gestellt hatte, drückte Ding die Klinke nach unten und stieß die Tür mit dem Fuß auf.
Jack gab kurze, kontrollierte Feuerstöße auf die beiden Männer ab, erledigte zuerst Gibson mit drei Schüssen gegen seine gut gepolsterte Einsatzweste und dann mit Treffern im selben Bereich auch Gomez, als der gerade seine MP3 auf die Eindringlinge richten wollte. Beide Männer sanken auf ihre Stühle zurück, legten sich die Waffen in den Schoß und hoben die Hände.
Jack schlüpfte in den Raum, schwang die Waffe herum und deckte die toten Winkel ab, während Chavez und Caruso an ihm vorbei zu der Treppe stürzten, die ins Unterdeck führte.
Jack schloss zu ihnen auf. Jetzt war Eile geboten, denn Jacks Waffe hatte trotz Schalldämpfer beträchtlichen Lärm gemacht, und an Bord befand sich eine Geisel, die durch das Geräusch bellender Feuerstöße in Gefahr gebracht wurde.
Sie kontrollierten rasch und effizient die Kabinen, teilten sich aber nicht auf, sondern nahmen sich jeden Raum zusammen vor. Vor der dritten der vier Kabinen angekommen, drückte Dom lautlos die Klinke und stieß die Tür auf. Drinnen saß auf einem Bett Adara Sherman, einen Becher Kaffee in der Hand und eine Zeitschrift auf dem Schoß.
Sie sah nicht einmal von ihrer Lektüre auf. »Juhu, ich bin gerettet!«, kommentierte sie in scherzhaft-spöttischem Ton.
Adara war unter anderem Transportmanagerin des Campus, aber heute spielte sie die Geisel, wie Dom wusste. Was er allerdings nicht wusste, war, ob sie mit einer Sprengfalle versehen oder mit einer Pistole bewaffnet war und den Befehl bekommen hatte, auf ihre Retter zu schießen, ob also ein Stockholm-Syndrom-Szenario angenommen wurde, und so hielt er seine Waffe auf ihre Brust gerichtet, als er auf sie zutrat. Er setzte dabei eine entschuldigende Miene auf und fiel für einen Augenblick aus der Rolle, gerade so lange, dass er es versäumte, die Toilette rechts neben Adara zu kontrollieren.
Der Fehler wurde ihm schon im nächsten Moment bewusst, doch da vernahm er von hinten aus dem Gang die Stimme seines Cousins: »Kontakt!«
Die Tür zur letzten Kabine flog auf, und John Clark stand da, eine MP5-Maschinenpistole im Anschlag und eine Schutzbrille auf den Augen. Er eröffnete das Feuer, vermochte aber nur einen einzigen Schuss abzugeben, bevor ihm Domingo Chavez einen Dreier-Feuerstoß in die Brust jagte. Ding war klar, dass seine Geschosse in die dicke alte Drillichjacke einschlagen würden, die Clark über drei Thermo-Henley-Thermoshirts trug, um die Schmerzen zu mindern, die der Aufprall der FX-Geschosse verursachte.
Clark war schon häufiger von FX-Geschossen getroffen worden, und Chavez wusste, dass er kein Fan davon war.
In der Kabine mit der Geisel hörte Dom, wie Chavez draußen rief, dass die Gefahr auf dem Gang gebannt sei, worauf er die Waffe etwas sinken ließ, denn er war sich sicher, dass alle gegnerischen Schützen ausgeschaltet waren. Er wandte sich wieder Adara zu und durchsuchte sie, wie er es bei jeder befreiten Geisel tun würde.
Dabei gab ihm Jack von der Tür zwischen Kabine und Gang aus Deckung, doch Jack wusste nicht, dass die Nasszelle mit Toilette, Waschbecken und Dusche zur Linken von seinem Cousin noch nicht inspiziert worden war.
Dom kehrte der Nasszelle den Rücken zu, sodass er die Pistole nicht sah, die hinter dem Duschvorhang auftauchte, und auch Jack konnte sie nicht sehen, da die Dusche außerhalb seines Blickfelds lag.
Erst als der Knall einer Pistole die Kabine erfüllte, erkannten Dom und Jack, dass sie Mist gebaut hatten. Dom bekam den Schuss genau zwischen die Schulterblätter und fing sich sogar einen zweiten ein, bevor er zum Zeichen, dass er erledigt war, die Hände heben konnte.
Jack Ryan junior stürzte in die kleine Kabine, hechtete an Dom und Adara vorbei aufs Bett und jagte einen langen Feuerstoß in die Toilette, um die Gefahr zu beseitigen, bevor auch die Geisel getroffen wurde.
Die Projektile schlugen in den Duschvorhang ein und zerfetzten ihn, als wären es richtige Mantelgeschosse.
»Autsch! Okay! Du hast mich erwischt!« Die Stimme hatte einen unverkennbaren Kentucky-Akzent, und Jack stockte das Blut in den Adern.
Gerry Hendley, der frühere Senator Gerry Hendley und jetzige Direktor des Campus, trat, mit roten Klecksen übersät, aus der Dusche und rieb sich einen scheußlichen roten Striemen seitlich am Hals, der in Sekundenschnelle anschwoll. »Du meine Güte, Clark hatte recht. Die fiesen kleinen Dinger tun richtig weh!«
»Gerry?«, krächzte Jack. Hendley war Ende sechzig, und wenn er mal auf etwas schoss, dann allenfalls auf ein paar Wachteln. Er hatte noch nie einer Übung des Campus beigewohnt, geschweige denn daran teilgenommen.
Jack konnte nicht begreifen, warum er hier war. »Das tut mir sehr leid! Ich wusste nicht …«
John Clark rief vom Gang: »Feuer einstellen! Übung beendet! Sichert eure Waffen!«
Jack drückte den Feuerwahlhebel mit dem Daumen nach unten auf Sicher und ließ die Waffe vor der Brust baumeln.
Adara erhob sich vom Bett, riss die Schutzbrille herunter und lief zu Gerry. »Mr. Hendley, lassen Sie uns nach oben zu meinem Med-Kit gehen. Ich werde die schlimmsten Schrammen reinigen und verpflastern.«
Jack versuchte es wieder mit einer Entschuldigung. »Ich bin untröstlich, Gerry. Hätte ich geahnt, dass Sie …«
Hendley hatte sichtlich Schmerzen, machte aber eine abwehrende Handbewegung. »Hätten Sie geahnt, dass ich der Gegnertruppe angehöre, hätte Ihnen die Übung nichts gebracht, oder? Sie mussten auf mich schießen.«
»Äh … ja, Sir.«
»Natürlich hätte ich etwas mehr Treffsicherheit begrüßt«, fügte Gerry hinzu. »Ich habe eine gepolsterte Weste angezogen, weil John mir versichert hat, dass ich ein oder zwei Schüsse in die Brust bekommen würde, aber nicht mehr.«
Jack hatte Gerry an beiden Armen, an Hals, Brust, Bauch und an der rechten Hand markiert. Die Wunden an Hand und Hals bluteten, und sein Hemdsärmel war zerrissen.
Als Adara ihn aus der Kabine und zu der Leiter geleitete, die zum Hauptdeck hinaufführte, blickte Gerry in dem schmalen Gang zu Clark und sagte: »Auf jeden Fall haben Sie Ihr Anliegen auf verdammt drastische Weise deutlich gemacht, John.«
Jack sah zu Clark hinüber und bemerkte, dass der Siebenundsechzigjährige, der normalerweise nur schwer aus der Fassung zu bringen war, sehr betreten dreinschaute.
»Tut mir leid, Gerry. So weit hätte es nicht kommen dürfen, unter welchen Umständen auch immer.«
Jack setzte sich neben Dom aufs Bett. Die beiden jungen Männer sahen aus wie Schüler im Büro des Direktors, kurz nachdem sie beim Unterrichtschwänzen erwischt worden waren.
Chavez lehnte sich an die Kabinenwand. »Verdammt, Jack. Du hast gerade deinen Chef aus kurzer Entfernung mit einem Dutzend FX-Geschossen eingedeckt, die mit einer Geschwindigkeit von 550 Kilometer pro Stunde fliegen. Er wird sich eine Woche lang so fühlen, als wäre er in ein Hornissennest getreten.«
»Was zum Teufel hat er hier eigentlich gemacht?«, fragte Dom.
John Clark trat in die Master-Kabine und blieb an der Tür stehen. »Gerry war hier, weil ich wollte, dass er sich selbst ein Bild macht. Mit nur drei Mann kann der Campus im Feld nicht sicher operieren. Wir haben zuletzt Glück gehabt, aber dieses Glück wird nicht von Dauer sein. Entweder wir bekommen Verstärkung in der operativen Abteilung oder wir können nur noch sehr begrenzte Aufträge annehmen.«
Chavez nickte. »Ich würde sagen, das ist deutlich geworden. Dom ist tot, zwei Schüsse in den Rücken. Hast du das Klo nicht gecheckt?«
»Ich habe mit fünf bösen Jungs gerechnet«, antwortete Dom. »Als der Fünfte erledigt war, bin ich nachlässig geworden.«
»Und das bedeutet?«, fragte Chavez.
Dom sah ihn an. Er unternahm nicht den geringsten Versuch, seinen Fehler zu entschuldigen. »Das bedeutet, dass ich Scheiße gebaut habe.«
Clark war mit dem Ablauf der Übung unzufrieden und machte daraus kein Hehl. »Es hat ja ordentlich angefangen. Jacks Sprung war gut, ich habe ihn durchs Fernglas verfolgt. Ihr seid alle drei souverän auf das Boot gekommen, habt euch schnell und zielstrebig zu der Geisel vorgearbeitet, die Gegenseite überrascht und fünf Gegner ausgeschaltet. Doch das Einzige, was im Gefecht zählt, ist, wie es ausgeht, und ihr habt bei dieser Übung ein Drittel eurer Leute verloren. Deshalb habt ihr versagt, wie man es auch betrachtet.«
Niemand sagte etwas darauf.
»Reinigt eure Ausrüstung«, fuhr Clark fort. »Stellt sie in die Schränke im Campus zurück, und nehmt euch das Wochenende frei. Aber ihr bekommt Hausaufgaben. Ich möchte zwei neue operative Mitarbeiter in den Campus holen, und jeder von euch soll mir einen Kandidaten vorschlagen. Am Montagmorgen reden wir darüber. Ich sehe mir die Kandidaten an, rede mit Gerry und gebe meine Empfehlungen.«
»Einer von den Sicherheitsleuten wäre vielleicht geeignet«, sagte Caruso.
Clark schüttelte den Kopf. »Lauter Männer mit jungen Familien. Lauter Männer, die schon seit Jahrzehnten dienen. Der operative Dienst ist ein Rund-um-die-Uhr-Job, dreihundertfünfzig Tage im Jahr, dafür sind die Jungs oben an Deck ungeeignet.«
Jack teilte Clarks Urteil – sie brauchten frisches Blut und mussten sich extern danach umsehen. Clark hatte sich vor ein paar Jahren aus dem operativen Dienst zurückgezogen, und Dominic Carusos Bruder Brian, der davor dem Team angehört hatte, war bei einer Operation in Libyen getötet worden. Ihn hatte Sam Driscoll ersetzt, der dann in Mexiko umgekommen war. Seit damals hatten sie nur drei operative Agenten.
Jack nahm sich vor, am Wochenende gründlich darüber nachzudenken, wen er gern als Verstärkung in die Truppe holen würde, denn die Krisenherde der Welt wurden nicht weniger, und es lag auf der Hand, dass ein personell dezimierter Campus nicht die erforderliche Stärke hatte.
Zehn Minuten später war Jack wieder an Deck. Er hatte sich noch einmal bei Gerry entschuldigt, doch der hatte erneut abgewinkt, jetzt allerdings mit Pflastern beklebt und einer kühlen Flasche Heineken in der Hand.
Jack fühlte sich ziemlich unwohl. Gerry Hendley hatte ihm erst kürzlich die Rückkehr in den Campus erlaubt, nachdem er wegen Befehlsmissachtung sechs Monate hatte pausieren müssen.
Und jetzt das. Nicht gerade die beste Art, Gerry für das in ihn gesetzte Vertrauen zu danken.
4
Es dürfte niemand sonderlich überraschen, dass der Imam Khomeini International Airport in Teheran für Ausländer nicht der gastfreundlichste Flughafen der Welt ist, doch nach fast fünfstündigem Flug waren die Passagiere des Alitalia-Flugs 756 froh, dass sie die Maschine verlassen und sich die Beine vertreten konnten. Gewiss, für viele Geschäftsreisende, die jetzt die Gangway herabstiegen, war es keine sehr lange Etappe gewesen, aber die meisten von ihnen hatten schon einmal den internationalen Ankunftsterminal passiert und wussten, dass sie aufgrund der zeitraubenden Zoll- und Einreisekontrollen nicht so schnell in ihr Hotel kommen würden.
Mit einer Ausnahme.
Ein Mann, der jetzt von der Fluggastbrücke in den Terminal schlenderte, war regelmäßig Gast der iranischen Regierung und wusste, dass er schneller durch die Kontrollen kommen würde als seine bedauernswerten Mitreisenden. Als Geschäftsmann, der direkt mit verschiedenen Behörden der iranischen Regierung zusammenarbeitete, bekam er sofort nach Verlassen der Maschine einen persönlichen Betreuer zugeteilt. Dieser Betreuer würde ihm während seines dreitägigen Aufenthalts nicht von der Seite weichen und als Dolmetscher und Kontaktmann zu den Behörden dienen. Außerdem wusste der Reisende, dass draußen ein Mercedes der Regierung im absoluten Halteverbot parkte, dessen Fahrer darauf wartete, ihn und seinen Betreuer in den kommenden Tagen in der riesigen Stadt umherzuchauffieren.
Am Ende der Fluggastbrücke lehnte ein Iraner in den Vierzigern an der Wand. Das breite Grinsen auf seinem Gesicht wurde noch breiter, als er den großen blonden Mittdreißiger erkannte, der aus der Schlange der aus Rom kommenden Passagiere ausscherte und ihm zuwinkte.
Der Blonde zog eine Rolltasche hinter sich her und trug einen Aktenkoffer. Auf Englisch rief er: »Faraj! Es ist immer wieder schön, Sie zu sehen, mein Freund.«
Faraj Ahmadi hatte einen buschigen Schnurrbart, dichtes schwarzes Haar und trug einen dunkelblauen Anzug ohne Krawatte. Er legte sich die Hand aufs Herz und deutete eine Verbeugung an, dann streckte er dem Neuankömmling die Hand entgegen und begrüßte ihn mit einem kräftigen Händedruck. »Willkommen zurück, Mr. Brooks. Ich freue mich, Sie zu sehen.«
Das Lächeln auf dem Gesicht des Westlers wich einem gespielten Stirnrunzeln. »Also wirklich. Müssen wir das schon wieder durchkauen? Mr. Brooks war mein Vater. Ich habe Sie doch gebeten, mich Ron zu nennen.«
Faraj Ahmadi verbeugte sich noch einmal höflich. »Ja natürlich, Ron. Ich vergesse es immer. Hatten Sie einen angenehmen Flug?«
»Auf dem Flug von Toronto nach Rom habe ich die meiste Zeit geschlafen und auf dem Weg von Rom hierher gearbeitet. Ich war also auf beiden Flügen produktiv.«
»Ausgezeichnet.« Faraj nahm ihm die Rolltasche ab und schlug den Weg zur Einreisekontrolle ein. »Mittlerweile kennen Sie ja das Prozedere hier am Flughafen.«
»Ich könnte es im Schlaf durchlaufen«, erwiderte Brooks. »Ein- oder zweimal habe ich das wahrscheinlich sogar.«
Faraj grinste noch breiter. »Sie waren ziemlich regelmäßig hier, nicht wahr?«
Brooks ging mit dem Aktenkoffer neben Ahmadi her, der seine Tasche zog. »Ich habe neulich in meinem Kalender nachgesehen. Dies ist mein sechzehnter Besuch innerhalb der letzten drei Jahre. Das macht über fünf pro Jahr.«
Wieder wurde das Grinsen unter dem dichten Schnurrbart des Iraners breiter. Ahmadi war iranischer Beamter, aber er hatte eines der fröhlichsten, angenehmsten Gesichter, die Brooks je gesehen hatte. »Wir freuen uns immer, Sie hier begrüßen zu dürfen. Wie ich weiß, sind meine Kollegen zuversichtlich, dass Sie auch künftig von Kanada aus ohne Umstände werden einreisen können.«
»Ich muss zugeben, dass mich das ganze Gerede über ein Einreiseverbot in den Nachrichten beunruhigt hat.«
Sie bogen nach links ab, und die langen Schlangen vor den Einreiseschaltern kamen in Sicht. Gut und gern dreihundert Leute warteten auf ihre Passkontrolle. Doch die beiden Männer gingen einfach weiter, schlugen einen Bogen links um die Menge herum und folgten einem leeren Gang.
»Wir hoffen alle, dass Geschäftsleute wie Sie von den Vereinten Nationen die Erlaubnis erhalten, weiterzuarbeiten wie bisher«, sagte Faraj.
»Dem kann ich mich nur anschließen«, erwiderte Brooks. »Zumindest wissen wir, wem wir die neuen Verstimmungen zwischen gewissen westlichen Ländern und Ihrem zu verdanken haben.«
Farajs Grinsen blieb unverändert, doch er nickte. »Nur zu wahr. Ich bin nur ein Kontaktmann und kein Politiker oder Diplomat, aber ich schaue mir die Nachrichten an. Offensichtlich droht der amerikanische Präsident meinem friedlichen Land wieder mit erhobenem Zeigefinger.«
»Sie möchten seinen Namen öffentlich nicht in den Mund nehmen, das verstehe ich. Aber ich werde es tun. An allem ist nur dieser verdammte Hurensohn Jack Ryan schuld.«
Jetzt lachte Faraj. »Ich glaube, wenn Sie es so ausdrücken, wird hier niemand etwas dagegen haben.«
Sie kamen an einer Toilette vorbei, und Faraj, stets einfühlsamer Gastgeber, sagte: »Die Kontrolle wird nur ein paar Sekunden dauern, aber der Verkehr auf der Tehran-Saveh-Road ist heute Morgen schlimm.« Er deutete auf die Toilette. »Wenn Sie also gerne …«
»Nicht nötig, Faraj. Ich habe mein Geschäft vor der Landung erledigt.« Brooks zwinkerte seinem Freund zu. »Deswegen nennt man mich Geschäftsmann.«
Sekunden später standen sie vor dem Einreiseschalter. Selbst der Beamte, der an dem VIP-Schalter saß, erkannte den großen Mann mit dem hellen Haar und den blauen Augen. In einem guten Englisch, das aber nicht annähernd so gut war wie das Ahmadis, sagte der weißhaarige Beamte: »Guten Morgen, Mr. Brooks. Willkommen zurück in der Islamischen Republik Iran.«
»Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Sir«, erwiderte Brooks. Er stellte nicht einmal den Aktenkoffer ab, da er schon in Sekunden den Weg zum Wagen fortsetzen würde.
Er händigte seinen kanadischen Pass mit dem Visum darin aus, trat vor die Kamera und lächelte, als er fotografiert wurde. Ein grünes Licht leuchtete an dem Fingerabdrucklesegerät vor ihm auf, und er legte den Daumen darauf, so wie er es schon fünfzehn Mal getan hatte.
»Wie lange bleiben Sie diesmal, Mr. Brooks?«, fragte der Beamte.
»Leider nur drei Tage. Es ist nur eine Stippvisite für ein paar Besprechungen.«
»In Ordnung, Sir.« Der Beamte drückte ein paar Tasten auf seiner Tastatur.
Derweil blickte Brooks zu seinem Aufpasser. »Was steht heute als Erstes auf dem Programm, Faraj?«
Faraj Ahmadi war hinter den Einreiseschalter getreten, hier so vertraut wie ein Flughafenangestellter, da er viele Male Leute abgeholt hatte, die mit der Regierung Geschäfte machten. Er legte seine eigenen Papiere ab, blickte auf den Computerbildschirm und bereitete sich darauf vor, den Kanadier hinauszuführen. »Ich habe mir gedacht, wir könnten in dem Restaurant in der Malek-e-Ashtar-Straße, das Sie so mögen, eine Kleinigkeit essen, bevor wir ins Hotel fahren, wo Sie sich ausruhen können. An dem Dinner heute Abend …«
Ahmadi hielt im Sprechen inne, und sein Dauerlächeln schwächelte ein wenig, als er leicht verwirrt auf den Monitor blickte. Er wandte sich an den Einreisebeamten und sagte etwas auf Farsi.
Der Uniformierte antwortete in derselben Sprache und drückte noch ein paar Tasten. Auch sein Gesicht nahm einen verwirrten Ausdruck an.
Die Männer sprachen leise miteinander, aber Brooks verstand kein Farsi und schaute nur lächelnd auf seine Uhr. Nach ein paar Sekunden blickte er wieder zu seinem Betreuer und glaubte, jetzt einen gewissen Unmut in Ahmadis Gesicht auszumachen.
Der kanadische Geschäftsmann setzte seinen Aktenkoffer auf dem Boden ab. Offensichtlich dauerte es noch einen Moment. »Gibt es ein Problem, Faraj?«
Das breite Lächeln kehrte sofort zurück. »Nein, nein. Es ist nichts.« Dann sprach Faraj wieder mit dem sitzenden Beamten, kniff ihn scherzhaft in die Schulter und riss irgendeinen Witz. Die beiden grinsten, doch Brooks bemerkte, dass der Beamte jetzt schneller tippte, den Kopf schief legte und etwas auf dem Bildschirm betrachtete.
Brooks war fünfzehn Mal hier eingereist, aber das hatte er noch nicht erlebt.
Als die beiden Iraner wieder ein paar Worte wechselten, fragte der Kanadier: »Was ist denn los, Faraj? Lässt meine Ex nach mir fahnden?«
Faraj kratzte sich am Kopf. »Nur ein Problem mit dem Fingerabdruckleser, glaube ich. Würden Sie es noch einmal versuchen?«
Ron Brooks blies theatralisch über seinen Daumen und legte ihn wieder auf das Lesegerät. »Sagen Sie mir, wer Ihnen die Scanner verkauft, und ich besorge Ihnen ein besseres Modell aus dem Ausland und unterbiete den Preis, den Sie jetzt bezahlen.«
Faraj lächelte, hielt die Augen aber auf den Bildschirm gerichtet.
Der Einreisebeamte lachte gar nicht mehr. Seine Hand glitt unter den Tisch, und Ahmadi fuhr ihn wütend an. Die Antwort erfolgte in entschuldigendem Ton, und obwohl Ron die Sprache nicht verstand, begriff er, dass der Beamte auf irgendeinen Knopf gedrückt hatte. Drei weitere Zollbeamte, einer davon in Zivil mit einem Schildchen am Revers, erschienen auf der Bildfläche und starrten auf den Monitor.
Brooks machte einen Scherz. »Ich weiß, ich hätte die Hosentasche voll Pistazien deklarieren müssen, die ich aus dem Iran mitgenommen habe, als ich im Mai hier war.«
Faraj lächelte nicht mehr und hörte dem Kanadier nicht einmal mehr zu. Der leitende Zollbeamte sagte etwas in ruhigem, dienstlichen Ton zu dem Betreuer, und Faraj antwortete auf Farsi mit größerer Erregung, als Brooks jemals bei dem gewöhnlich ruhigen und gutgelaunten Mann gesehen hatte.
Das Gespräch endete damit, dass Faraj Ahmadi sich Brooks zuwandte. »Bitte entschuldigen Sie, Ron. Unser Computer hat ein Systemproblem. Das ist noch nie vorgekommen. Wir werden das in Ordnung bringen, aber bis dahin kann Ihr Visum nicht bearbeitet werden. Würden Sie mir bitte in einen Warteraum folgen? Wir können einen Kaffee trinken, während man den Fehler behebt.«
Ron Brooks zuckte die Achseln und lächelte schwach. »Gewiss, Faraj. Meinetwegen.«
»Es tut mir leid.«
»Machen Sie sich keine Gedanken, mein Freund. Sie sollten mal sehen, was ich über mich ergehen lassen muss, wenn ich die Vereinigten Staaten besuche. So ein Haufen Arschlöcher.«
Nach einem Warteraum sah das für Ron Brooks nicht aus. Er war in ein fensterloses Kabuff geführt worden, nicht größer als fünf auf fünf Meter. Die ganze Einrichtung bestand aus einem einfachen Tisch mit drei Stühlen drum herum und einem ungerahmten Poster des Imam Khomeini Airport und einem zweiten des gegenwärtigen Präsidenten des Landes.
Ein großer Spiegel bedeckte eine Wand, und eine hoch oben in der Ecke angebrachte Kamera war auf den Tisch gerichtet.
Brooks wusste genau, wo er war. In einem Gepäckkontrollraum, in den man Schmuggler brachte, um ihr Gepäck gründlich zu durchsuchen.
Drei Polizisten im Kampfanzug mit automatischen Gewehren vor der Brust standen in der Tür. Sie betrachteten Brooks neugierig, wirkten aber weder nervös noch aufgeregt. Als Brooks sich an Faraj wandte und auf die Anwesenheit der drei Männer ansprach, erbleichte der Betreuer vor Verlegenheit. »Das sind nur die leidigen Vorschriften. Sie werden sich gleich in aller Form bei uns entschuldigen müssen, Ron. In der Zwischenzeit hole ich Ihnen einen Kaffee. So wie Sie ihn mögen. Nur mit einem Stück Zucker.«
Brooks lächelte seinen Freund an, aber das Lächeln fiel ihm jetzt schwerer. »Hören Sie, ich weiß, dass Sie nichts dafür können, aber ich bin wirklich müde und hungrig, und ich bin nicht gerade davon begeistert, dass dieses Empfangskomitee mich wie einen Verbrecher behandelt. Vielleicht könnten Sie General Rastani anrufen, damit er den Jungs hier Druck macht. Er war es schließlich, der darauf bestanden hat, dass ich diese Woche nach Teheran komme. Er wird sicher wissen wollen, was hier vorgeht.«
Ein Hoffnungsschimmer erhellte das Gesicht des Iraners. »Ja, natürlich! Das werde ich sofort tun. Zuerst den Kaffee, dann rufe ich …«
»Ich habe schon im Flugzeug einen Kaffee getrunken. Wie wär’s, wenn wir nur den General anrufen?«
Faraj verbeugte sich. »Gewiss. Wir werden im Handumdrehen hier draußen sein.«
Zwei Stunden und zwanzig Minuten nachdem sein Betreuer mit dem Versprechen, die Angelegenheit zu regeln und in Kürze zurück zu sein, aus dem kleinen Gepäckkontrollraum geeilt war, saß Ron Brooks immer noch allein an dem Tisch. Faraj hatte sich nicht wieder blicken lassen, und die Tür zum Korridor war zwar nicht verriegelt worden, doch die Zahl der bewaffneten Wächter war von drei auf acht angewachsen, und jedes Mal, wenn Ron die Tür öffnete und fragte, ob jemand Englisch spreche, scheuchte ihn ein junger Mann im Kampfanzug mit einem Gewehr vor der Brust mit einer Handbewegung zurück und schlug ihm die Tür vor der Nase zu.
Ron hatte gestanden, war auf und ab gegangen, und jetzt saß er und schaute auf seine Uhr. Wütend blickte er zu der Kamera hoch oben in der Ecke hinauf und deutete auf seinen Schritt, womit er zu verstehen geben wollte, dass er pinkeln musste.
Sekunden später wollte er gerade den Kopf auf den Tisch legen, als die Tür aufging und drei Männer in schwarzen Anzügen eintraten. Keiner lächelte, keiner grüßte, keiner stellte sich vor.
Brooks sah einen nach dem anderen an und erwiderte ihre eisigen Blicke. Er hatte die Nase voll und machte aus seinem Ärger kein Hehl. »Wo ist Ahmadi? Ich brauche meinen Dolmetscher.«
Der älteste der drei Männer setzte sich. Er hatte einen grauen Bart und trug zu seinem Anzug ein kragenloses Hemd. Brooks wusste, dass Krawatten im konservativen Iran als Ausdruck westlicher Dekadenz galten. Es gab sogar Vorschriften, die sie verboten, auch wenn sich viele nicht daran hielten.
Dieser Mann und seine Kollegen aber sehr wohl.
»Sie brauchen keinen Dolmetscher«, sagte der Graubart. »Wir sprechen alle Englisch.«
»Gut. Dann werden Sie mir ja erklären können, was zum Teufel hier los ist.«
»Aber gewiss. Es gibt ein ernstes Problem mit Ihren Papieren.«
Brooks schüttelte den Kopf. »Nein, Kamerad, das kann nicht sein. Ich bin kein vertrottelter Tourist. Das ist nicht mein erster Besuch hier.«
»Es ist Ihr sechzehnter«, sagte der Graubart, was Brooks für einen Augenblick verwirrte.
»Ja … das ist richtig. Und es sind dieselben Papiere, mit denen ich die letzten fünfzehn Male ohne das geringste Problem eingereist bin.«
»Da stimme ich Ihnen zu, Sir«, sagte der Graubart. »Aber im Unterschied zu Ihrem jetzigen Besuch wussten wir bei den letzten fünfzehn Malen nicht, dass Ihr Pass mehrere falsche Angaben enthält.«
Brooks prallte zurück. »Falsche Angaben? Wo denn?«
Der Graubart beugte sich etwas vor. »Zunächst einmal in der Namenszeile.«
»Ich … ich verstehe nicht.«
Der Graubart drehte die Hände um und hielt sie entschuldigend hoch. »Sie heißen nicht Ron Brooks.«
»Was soll der Unsinn? Rufen Sie General Hossein Rastani an und fragen Sie …«
»Ihr Name ist Stuart Raymond Collier«, übertönte der Graubart den laut gewordenen Westler.
Brooks legte den Kopf schief. »Wie? Mein Freund, ich kann Ihnen versichern … Den Namen habe ich noch nie gehört.«
»Und auch Ihr angegebener Beruf stimmt nicht. Sie sind nicht der Eigentümer einer internationalen Import-Export-Firma. In Wahrheit sind Sie Mitarbeiter der CIA.«
»Der CIA