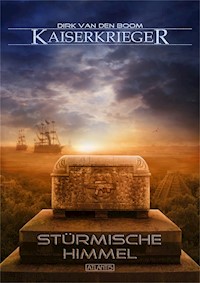Tentakel - Der erste Krieg (Tentakelschatten / Tentakeltraum / Tentakelsturm) E-Book
Dirk van den Boom
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook enthält die Romane 1 bis 3 vom Tentakelkrieg: "Tentakelschatten", "Tentakeltraum" und "Tentakelsturm". In den Jahrhunderten interstellarer Expansion ist die Menschheit nie auf außerirdische Intelligenz gestoßen. Mit sich selbst beschäftigt, verliert man sich in Bürgerkriegen und Misswirtschaft. Und dann, in einer Phase größter Demoralisierung, am Rande des Zusammenbruches nach einem blutigen Kolonialkrieg, wirft der erste Kontakt mit Aliens seinen langen Schatten auf die Welten der Menschen ... Ein Flottenoffizier auf dem Abstellgleis, eine Marinesoldatin im Ruhestand und ein Genie, das alle für verrückt halten, sind die Ersten, die mit den Besuchern zu tun haben. Schnell merken sie, dass dieser Kontakt nur eines bedeutet: Den Beginn eines aussichtslosen Kampfes ... Die Romane der Reihe in der Übersicht: Trilogie 1: 1) "Tentakelschatten" 2) "Tentakeltraum" 3) "Tentakelsturm" Trilogie 2: 4) "Tentakelwacht" 5) "Tentakelblut" 6: "Tentakelreich" Trilogie 3: 7) "Tentakelfürst" 8) "Tentakelkaiser" 9) "Tentakelgott" Alle Romane sind einzeln als Paperback mit Klappenbroschur lieferbar. Die Bände 1 bis 3 gibt als eBook in einem Sammelband: "Tentakel: Der erste Krieg" Diesen Sammelband gibt es auch als Hardcover. Die Bände 4 bis 9 gibt es als eBook jeweils als Einzelband und ebenfalls als Hardcover als E
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1172
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Tentakelschatten
1 Arbedian
2 Lydos
3 Station Thetis
4 Arbedian
5 Lydos
6 Arbedian
7 Lydos
8 Tentakelscout
9 Arbedian
10 Lydos
11 Tentakelscout
12 Arbedian
13 Station Thetis
14 Lydos
15 Arbedian
16 Ambius
17 Lydos
18 Arbedian
19 Tentakelscout
20 Terra
21 Lydos
22 Arbedian
23 Lydos
24 Station Thetis
25 Tentakelscout
26 Arbedian
27 Lydos
28 Ambius
29 Lydos
30 Arbedian
31 Lydos
32 Terra
33 Arbedian
Tentakeltraum
1 Lydos
2 Terra
3 Thetis
4 Lydos
5 Terra
6 Lydos
7 Ambius
8 Lydos
9 Terra
10 Ambius
11 Lydos
12 Ambius
13 Terra
14 Ambius
15 Terra
16 Lydos
17 Terra
18 Station Thetis
19 Lydos
20 Terra
21 Terra – Lydos
22 Lydos
23 Terra
24 Lydos
25 Ambius
26 Lydos
27 Ambius
28 Lydos
29 Tentakeltraum
30 Terra
31 Lydos
32 Ambius
33 Lydos
34 Terra
35 Ambius
36 Lydos
Tentakelsturm
1 Europa
2 Sonnensystem
3 Europa
4 Europa
5 Sonnensystem
6 Luna
7 Station Thetis
8 Europa
9 Luna
10 Sonnensystem
11 Station Thetis
12 Europa
13 Afrika
14 Sonnensystem
15 Station Thetis
16 Afrika
17 Europa
18 Sonnensystem
19 Station Thetis
20 Afrika
21 Europa
22 Station Thetis
23 Asteroidengürtel
24 Afrika
25 Luna
26 Europa
27 Station Thetis
28 Sonnensystem
29 Afrika
30 Europa
31 Station Thetis
32 Afrika
33 Station Thetis
34 Uranus
35 Europa
36 Afrika
37 Europa
38 Uranus
39 Afrika
40 Uranus
41 Europa
Epilog Afrika
Epilog Europa
Weitere Atlantis-Titel
Dirk van den Boom
Tentakel: Der erste Krieg
Tentakelschatten
1 Arbedian
»Sergent, was muss ich mir darunter vorstellen?«
Jonathan Haark versuchte gar nicht erst, besondere Strenge in seine Stimme zu legen. Zum einen nahm man ihm das angesichts des eher laxen Regiments auf der Admiral Malu nicht ab. Zum anderen war Sergent Chef van Vickers nicht der Typ, der auf »Strenge« im Tonfall von Offizieren reagierte. Er war der Unteroffizier mit dem höchsten Dienstgrad an Bord der Malu, oder das, was nach zwei Degradierungen davon übrig geblieben war. Er war Alkoholiker, betrieb im Maschinenraum eine illegale Destille und war der beste Techniker an Bord des heruntergekommenen Torpedobootes.
Außerdem war die Frage im Grunde müßig.
Es handelte sich um Rost.
»Capitaine, es handelt sich um Rost«, war dann auch die zu erwartende Antwort. Van Vickers war ein extrem bulliger Mann, dessen breiten, behaarten Händen man die oft sehr kleinteilige und diffizile Arbeit gar nicht zutraute, zu der sie befähigt waren. Er hielt dem kommandierenden Offizier der Malu ein Stück Schweißmaterial hin.
»Das ist der Bösewicht. Minderwertiges Schweißmaterial. Es war wohl besonders billig, und wir bekommen sowieso immer das Billigste. Ein wenig Feuchtigkeit, und es fängt an zu rosten. Ich habe es vorgestern noch an einer anderen Stelle bemerkt.«
Haark nickte. An Bord der Malu gab es immer etwas zu schweißen. Das Raumschiff war vor 110 Jahren in Dienst gestellt und vor 35 Jahren zum letzten Mal generalüberholt worden. Vor gut einer Woche hatten sie auf Arbedian Terminal das offenbar mangelhafte Wartungsmaterial an Bord genommen – zusammen mit 200 Standardrationen, die sich zur Hälfte als verdorben herausgestellt hatten. Zum Glück hatte Haark hier im Outback seine Quellen, sonst wäre seine Mannschaft längst an Mangelerscheinungen zugrunde gegangen.
»Schmeißen Sie das Zeugs weg!«, befahl Haark schließlich. »Haben wir noch was von dem alten?«
Van Vickers nickte. »Ein wenig. Reicht noch ein bis zwei Wochen.«
»Seien Sie sparsam damit. Morgen haben wir den ersten Run beendet und legen bei Arbedian an. Ein Frachter von Prosperity Lines wird ebenfalls erwartet. Sie können uns sicher was abgeben.«
Van Vickers spuckte auf den Boden. Kein Wunder, dass sich hier Feuchtigkeit ansammelte.
»Prosperity? Arrogante Affen.«
»Aber im Outback zur Hilfestellung für Marineeinheiten verpflichtet«, ergänzte Haark mit warnendem Unterton. Er wusste, was man in der Mannschaft von den Betreibern der modernen und gut ausgestatteten Handelsflotten hielt, die in den Händen der großen Familien lagen und offenbar nie Mangel leiden mussten.
Van Vickers erwiderte nichts mehr und zuckte mit den Achseln. Wenn der Capitaine ihm geeignetes Material besorgen konnte, wollte er im Grunde auch gar nicht wissen, woher es stammte.
Haark wandte sich ab und setzte seinen Rundgang fort. Er verließ den Maschinenraum, ohne nach dem Chefingenieur, Aspirant Sarazon, zu fragen. Er wusste, dass Sarazon immer nur dann zum Dienst erschien, wenn es die Umstände erforderten. Die Definition dessen, was »erfordern« meinte, lag nicht im Einklang mit den Dienstvorschriften. Andererseits gab es niemanden, der so begnadet mit den 110 Jahre alten Triebwerken umgehen konnte, wie der junge Ingenieur. Routinearbeiten konnte man ruhigen Gewissens Männern wie van Vickers überlassen, für den der Maschinenraum ohnehin so etwas wie eine persönliche Kabine war. Die Destille produzierte Qualitätsschnaps, hatte aber die Angewohnheit, zur unpassenden Gelegenheit Feuer zu fangen. Sie bedurfte ständiger Aufsicht.
Haark schritt den Außengang entlang, der den an den Spitzen oval zulaufenden Zylinder des Schiffes direkt an der Bordwand umrundete. Sein Weg führte ihn an einigen großen Bullaugen vorbei, die einen Blick in den Weltraum gestatteten. Es gab nicht viel zu sehen: Die Malu befand sich auf dem Rückweg nach Arbedian, einer relativ jungen Kolonialwelt, deren einzige Auszeichnung darin bestand, dass sie im Orbitalterminal zusätzlich eine kleine Flottendienststation unterhielt. Für die Verhältnisse des Systems herrschte reger Schiffsverkehr: Neben der Fregatte Napoleon, die sich derzeit in diesem Sektor befand und demnächst ihre Rundreise durch die äußeren Systeme fortsetzen würde, war das Große Torpedoboot Admiral Malu ständig hier stationiert. Piraten gab es hier keine, aber seit den vernichtenden Kolonialkriegen, deren letzter erst vor fünf Jahren ein Ende gefunden hatte, hielt die Admiralität es für nötig, in jedem auch noch so unwichtigen System Präsenz zu zeigen. Mit dem in Kürze eintreffenden Prosperity-Frachter waren dann drei Schiffe im System versammelt, was für Arbedian heftigen interstellaren Verkehr bedeutete. De facto, und da machte sich jemand wie Haark nicht die geringsten Illusionen, war dies der Arsch der bekannten Galaxis. Da passte es gut, dass der Kommandant der Malu selbst, ebenso wie ein Großteil seiner Mannschaft, zu den Ausgestoßenen und Geduldeten der Flotte gehörte. Hier passte zusammen, was zusammengehörte. Immerhin, der Gouverneur von Arbedian hatte ihn nicht mit Flüchen empfangen, als Haark vor vier Wochen diesen Posten angetreten hatte. Arbedian war allerdings vor den größten Zerstörungen der Kolonialkriege auch weitgehend verschont geblieben. Andernorts genoss die Flotte einen entsetzlichen Ruf. Das lag nicht an Haark, im Gegenteil.
Und das war gleichzeitig der Grund dafür, dass man ihn aufs Abstellgleis gestellt hatte.
Haark betrat nach seinem Rundgang die kleine Brücke der Malu. Auf dem fleckigen Kommandosessel saß mit halb geschlossenen Augen Sous-Lieutenant Josef Beck, sein Erster Offizier. Er trug, wie immer, eine absolut makellose Uniform, war ordentlich rasiert und von einwandfreier Erscheinung. Dass er die Augen halb geschlossen hielt, hatte nichts zu sagen, denn er hatte die Instrumente des Kommandopults alle im Blickfeld. Beck war gut zehn Jahre jünger als Haark, gleichzeitig war seine Beförderung ebenso zehn Jahre überfällig wie die seines Vorgesetzten und achtzig Prozent der Stammbesatzung dieses Schiffes. Jeder hatte hier sein Päckchen zu tragen, und das von Beck war auf seine Art sicher ebenso schwer und bedrückend wie die Bürde, die Haark auf seinen Schultern trug. Beck redete nicht darüber.
Als der Kommandant die Brücke betrat, ging eine unmerkliche Veränderung mit Beck vor. Saß er vorher relativ entspannt im Sessel, versteifte sich nun seine Haltung. Das geschah jedes Mal, wenn der Mann Dienst hatte und Haark ihn ansprach. Beck würde niemals gegenüber einem Vorgesetzten die Schirme fallen lassen und entspannt, gar leutselig mit ihm umgehen, wie es sonst auf der Malu üblich war. Das hatte vielleicht damit zu tun, warum Beck Erster Offizier eines Seelenverkäufers am Rande des Outbacks war und nicht längst zum Capitaine befördert und kommandierender Offizier mindestens einer Fregatte wie der Napoleon.
Nein, mahnte Haark sich selbst, als er sich freundlich lächelnd die absolut vorschriftsmäßige Meldung Becks anhörte. Keine Grübeleien. Es führt doch zu nichts.
»Danke, Beck. Ich löse Sie ab. Meine Wache beginnt ohnehin in zehn Minuten. Tun Sie mir den Gefallen und checken Sie noch in der Kombüse ab, ob Caporal Tijden die 100 schlechten Rationen tatsächlich in den Konverter geworfen hat. Ich habe gehört, er soll geplant haben, sie auf Arbedian auf dem Schwarzmarkt zu verschachern.«
Trotz aller Steifheit und Förmlichkeit war Beck kein Narr. Er wusste, unter welchen Umständen die Malu operierte. Niemand hier hatte seit einem Vierteljahr so etwas wie Sold erhalten. Jeder, der es konnte, machte seine Geschäfte. Beck würde lediglich nachprüfen, ob die Rationen noch irgendwo an Bord waren und kein großes Aufheben um die Sache machen. Aber er würde es akkurat, schnell und absolut zuverlässig erledigen, dessen konnte sich Haark sicher sein.
Lieutenant Haark ließ sich seufzend in den ausgeleierten Kommandosessel nieder. Er schloss für einen Moment die Augen. Mit seinen 42 Jahren hatten sich längst silbrige Strähnen in sein braunes Haar gemischt und die Falten in seinem Gesicht ließen ihn älter erscheinen, als er war. Beck hatte sich gut gehalten, das musste er ihm neidlos anerkennen. Haark sah aus wie 50, und so fühlte er sich meistens auch. Manchmal wünschte er sich, er hätte nach dem Debakel vor Danuba seinen Abschied genommen. Statt seines Glaubens an die moralischen Werte der Flotte hätte man ihm lieber sein Pflichtbewusstsein herausoperieren sollen. Außerdem hatte er ja eine Weile noch Hoffnung gehabt, Hoffnung auf Verständnis oder Pardon oder Vergessen. Nichts von alledem war eingetreten.
Aber jetzt war es wahrscheinlich zu spät.
Haark merkte, dass er erneut ins Grübeln geriet, und richtete seine Aufmerksamkeit lieber auf die Instrumente. Auf einem modernen Schiff hätte er jederzeit per Neuroimplantaten aktuelle Flugdaten abrufen können, sobald er einen der Hotspots im Schiff erreicht hatte. Die Malu verfügte über keine solchen Hotspots und Haark nicht über Implantate. Er hatte die entsprechenden Operationen nicht erhalten, weil er nie den dafür notwendigen Rang erreicht hatte.
Keine Grübeleien, ermahnte Haark sich erneut.
Die Malu hatte ihre Triebwerke abgeschaltet. Am Ende eines viertägigen Rundflugs durch das System, mit einem kurzen Orbit um den fünften Planeten, einem sehr beeindruckenden Gasriesen, um den eine automatische Forschungsstation kreiste, war das Torpedoboot nach einer längeren Brennphase nun im freien Fall unterwegs. Haark schonte die Triebwerke, wo er nur konnte, denn das altersschwache Schiff knirschte an allen Ecken und Enden. Seine regelmäßigen Schadensberichte an das Flottenkommando wurden im Regelfalle ignoriert. Dass er überhaupt noch irgendwelche Ersatzteile erhielt, war ein kleines Wunder. Haark hätte das persönlich genommen, wenn er nicht gewusst hätte, dass es fast allen Schiffen außerhalb der Heimatflotte so ging. Einigen etwas besser, anderen schlechter – je nachdem, wie gut die persönlichen Beziehungen des Kommandanten zur Admiralität waren. Aber die allgegenwärtige ökonomische Krise, die direkte Folge des mörderischen letzten Kolonialkrieges war, hatte auch und gerade die staatlichen Strukturen der Irdischen Sphäre durchdrungen, und nichts war dort teurer als die Flotte. In jeder Hinsicht.
»Ein Signal von der Napoleon, Capitaine!«
Die Meldung war von Simmons gekommen, der die Nachrichtenstation innehatte. Der blasse, ungelenk wirkende Jüngling wirkte permanent krank – er war es wahrscheinlich auch, aber Haark hatte nie danach gefragt, und selbst wenn, er hatte auf seinem Schiff nur einen Sanitätsmaat und keinen studierten Mediziner. Er tat trotz seines niedrigen Ranges als Caporal die Arbeit eines Offiziers. Nur hatte Haark außer Beck sowie dem Chefingenieur gar keine weiteren Offiziere an Bord. Alles war relativ.
Der Dienstgrad an Bord der Malu entsprach ohnehin selten der Position. Simmons hatte Haark als Capitaine angeredet, obgleich er diesen Rang nie erreicht hatte. In diesem Falle wollten es die Gepflogenheiten der Flotte, dass er als kommandierender Offizier so angesprochen wurde. In seinen dunkleren Momenten schmerzte ihn das.
»Schalten Sie es auf das Kommandopult«, befahl er. Er warf einen schnellen Blick auf den Kursplotter. Dieser zeigte die relative Position der Malu zu anderen Raumschiffen im System an. Außer der Napoleon flog noch ein unbemannter automatischer Erzfrachter, ein Systemschiff, auf seinem vorausberechneten Kurs durch das All. Die Napoleon war rund eine Lichtstunde entfernt unterwegs, die Funknachrichten wurden mit erheblicher Verzögerung ausgetauscht.
Auf dem Schirm erschien das leicht verzerrte Bild von Capitaine Jorge Esterhazy. Der Mann war in etwa in Haarks Alter und hatte drei Dienstjahre weniger, trotzdem entsprach bei ihm der Dienstgrad der Position. Esterhazy trug an der Schläfe die winzigen, schwarzen Punkte des implantierten NeuroLAN-Anschlusses. Marschierte er durch sein Schiff, musste er nicht warten, bis er wieder auf der Brücke war, um über alle Neuigkeiten informiert zu sein.
Haark hatte nichts gegen ihn. Esterhazy gehörte zum besseren Drittel des Offizierscorps und war schlicht nicht in die falsche Gesellschaft geraten. Als Kommandant einer Fregatte, die rund 60 Jahre jünger als die Malu war, hatte er aller Wahrscheinlichkeit auch das Ende seiner Karriereleiter erreicht. Es ging ihm besser als Haark, aber der Unterschied war nicht groß. Esterhazy hatte ihn durchweg anständig behandelt, als gleichwertigen Schiffskommandanten. Haarks Minderwertigkeitskomplex hatte das durchaus gut getan.
»Capitaine Haark, ich grüße Sie. Ich teile Ihnen mit, dass der Run der Napoleon im Arbedian-System so gut wie abgeschlossen ist. Wir warten noch auf die Ankunft des Prosperity-Liners, ehe wir unseren Rundflug in den Randwelten fortsetzen. Ich lade Ihnen den vollständigen Systembericht hoch, der auch mit der nächsten Nachrichtensonde an die Admiralität geht. Sie werden ihm entnehmen können, dass ich dem Dienst der Malu keinen Mangel beschieden habe.«
Unausgesprochen blieb, dass das nichts nützen würde. Seit dem verhängnisvollen Vorfall vor zwölf Jahren war Haarks Dienst tadellos gewesen. Doch solange seine Nemesis noch den Rang eines Admirals hatte und nebenher Oberbefehlshaber der Flotte war, würde ihm das nicht sehr helfen.
Haark drückte die Aufzeichnungstaste und diktierte eine Antwort.
»Capitaine Esterhazy, ich bestätige Ihre Meldung und danke Ihnen. Sollten wir uns nicht mehr sprechen, wünsche ich Ihnen und der Napoleon einen sicheren Transit und alles Gute, auch im Namen meiner Mannschaft.«
Er wollte noch etwas hinzufügen, um seiner Sympathie für den Mann Ausdruck zu geben, unterließ es dann aber. Er wollte nicht den Eindruck erwecken, ein Schleimer zu sein. Außerdem hielt er Esterhazy für klug genug, selbst zu merken, wer ihm Respekt entgegen brachte und wer nicht.
»Simmons, senden Sie das und speichern Sie den Systembericht der Napoleon in meinem Verzeichnis.«
»Sofort, Capitaine!« Simmons atmete für einen Moment pfeifend, wie immer, wenn er etwas gesagt hatte.
Haark würde sich den Bericht später ansehen, das war ohnehin eine reine Formsache. Arbedian war vielleicht relativ unbedeutend und hinterwäldlerisch, aber es war vor allem ein friedliches System, dessen Bewohner selbst während der Kolonialkriege keine besonderen Anstalten gemacht hatten, sich an Kriegshandlungen zu beteiligen. Das mochte auch mit der geringen Bevölkerungsdichte zu tun haben: Die einzig bewohnbare Welt bot zwar akzeptable, aber keinesfalls ideale Lebensbedingungen und der eigentliche Reichtum lag in den gigantischen Vorkommen seltener Erze in dem großen Asteroidengürtel des Systems. Die Hauptstadt Arbed City hatte rund 250 000 Einwohner und war damit gleichzeitig die einzige Stadt von nennenswerter Größe. Im gesamten System mochten vielleicht eine Million Menschen leben, fast alle Angestellte einer der großen Bergbaugesellschaften.
Hier passierte wenig bis gar nichts, zumindest nichts, mit dem die Systempolizei nicht alleine fertig wurde. Haarks Malu hatte einen ruhigen Job, und bis zur Versetzung des Schiffes würde noch ein gutes halbes Jahr vergehen. Die größte Gefahr bestand darin, entweder aus Langeweile zu sterben oder aufgrund einer der zahlreichen Fehlfunktionen des überalterten Raumschiffes in Not zu geraten.
Haark konsultierte seine Datenbank. Die letzte Nachrichtensonde, die unbemannt die Außensysteme mit der Sektorhauptwelt Ambius verband, war vor drei Tagen durch die Brücke gekommen und hatte den aktualisierten Zeitplan des Prosperity-Liners enthalten. Die Tatsache, dass Funkwellen durch die energetischen Zustände in den Brücken förmlich »aufgefressen« wurden, machte den Einsatz der Sonden notwendig. Die Brückenstationen, von denen die Transits gesteuert wurden, übermittelten die Nachrichten nach einem Download dann normal per Funk an den Long Range Array. Da die Brückenstationen im Regelfalle weit außerhalb aller Planeten senkrecht zur Ekliptik standen, brauchte das seine Zeit.
Wenn es keine weiteren Verzögerungen gegeben hatte, würde der Liner innerhalb der nächsten drei Stunden im System eintreffen. Die Napoleon würde den Frachter wahrscheinlich auf ihrem Weg zur Brücke begrüßen und aktuelle Nachrichten austauschen, während die Malu – Haark warf einen Blick auf die Uhr – schon fast Arbedian Station erreicht haben würde.
Mit etwas Glück würde er auf einen verständnisvollen Frachterkommandanten treffen, der ohne größeres Gezicke aus seinen sicher reichhaltigen Vorräten an Reparaturmaterial abgeben würde. Mit etwas Glück.
Haark seufzte.
Das wäre mal eine angenehme Abwechslung.
2 Lydos
»Das haben Sie sehr gut gemacht, Marechal!«
»Nennen Sie mich nicht mehr so.«
Die Antwort war Tooma beinahe reflexartig von den Lippen gekommen, und im gleichen Moment bereute sie es auch schon. Sie hatte nicht auf ihren Tonfall geachtet. Ihr Gegenüber war kein Soldat. Sie musste lernen, sich besser zu beherrschen. Und er hatte es nur nett gemeint.
Erwald Tompkin war ein einfacher, grobschlächtiger Mann, genau das, was man eine »ehrliche Haut« nannte. Dem Landwirt gehörte eine 250 Hektar große Farm auf Lydos, abgeschieden und einsam wie fast alle Ansiedlungen auf der Dschungelebene, und er hatte sie über zehn mühsame Jahre fast ohne jede Hilfe aufgebaut. Jetzt hatte er um Hilfe gebeten, und Rahel Tooma hatte seiner Bitte entsprochen. Mit etwas technischem Sachverstand und einschlägiger Erfahrung hatte sie den Weidezaun um das Tiergehege aufgestellt, unter Strom gesetzt und getestet. Die lydischen Perlhühner waren jetzt sicher wie in Abrahams Schoß, kein Räuber aus dem aus dem nahen Wald würde jetzt noch an die friedvoll pickenden Tiere herankommen. Toomas Werk war das Produkt einer Spezialistin, die darin ausgebildet worden war, Sicherheitsperimeter gegen menschliche, intelligente Gegner aufzustellen. Auch der bemerkenswert schlaue Tigerfuchs, den es noch in großer Anzahl im Dschungel gab, würde keine Möglichkeit haben, den Zaun zu überwinden. Selbst der lydische Python, dessen Vorliebe für die Perlhühner sprichwörtlich war, würde ernsthafte Probleme bekommen.
»Sorry, Erwald«, murmelte Tooma nun, als sie den etwas bedrückten Ausdruck im Gesicht des Mannes sah. Wie alle Farmer in der Ebene, weitab von der nächsten urbanen Siedlung, war er nicht an die Feinheiten menschlicher Umgangsformen gewöhnt, aber vor allem nicht an den reflexhaften Kasernenton in Toomas Stimme. Hier draußen sprach man recht deutlich aus, was man fühlte, und das galt auch für den Respekt, den der Mann zeigen wollte. Doch Tooma war kein Marechal de Logis Chef mehr, seit sie freiwillig den Raummarinedienst verlassen und sich in der Einsamkeit von Lydos angesiedelt hatte. Und sie wollte auch nicht daran erinnert werden. Aber das musste sie nun wirklich nicht an ihrem neuesten Kunden auslassen, der ganz offensichtlich auch noch ein Fan von ihr war.
»Macht nichts«, erwiderte der breit gebaute Mann unbeholfen. »Schaffen Sie es denn heute Abend noch nach Hause? Ich nehme Sie gerne noch eine Nacht auf!«
Es war erfrischend, dass dieses Angebot ohne jeden Hintergedanken kam. Erwald war verheiratet, seine Frau eine etwas schüchterne, aber extrem freundliche Person, die sie mit der gleichen Gastfreundschaft empfangen hatte wie ihr Mann. Im Raummarinedienst wäre ein solches Angebot – vor allem von einem männlichen Vorgesetzten – erst einmal bezüglich möglicher Hintergedanken abzuwägen gewesen. Tooma wusste das genau, denn nicht zuletzt hatte es dazu geführt, dass sie den Dienst freiwillig verlassen hatte.
Vor nunmehr schon fast fünf Jahren.
»Ich denke, ich kann es schaffen, Erwald«, meinte sie nun und lächelte so freundlich, wie sie nur konnte. Ihr eher quadratisch wirkendes Gesicht mit der flachen Nase und den hoch stehenden Backenknochen war nicht wirklich für herzliche Mimik geeignet, aber ihre variationsreiche Stimme beherrschte den Ausdruck von Gefühlen ausgezeichnet. Die Wärme ihres Tonfalls zerstreute Erwalds Bedenken über eventuelle Unhöflichkeiten seinerseits. Sein eigenes Lächeln wurde selbstbewusster.
»Ihr Gleiter ist ein tolles Modell«, lobte er. »Ich habe ihn mir gestern angeschaut. Von außen, meine ich. Eine alte Militärmaschine, nicht wahr?«
Tooma nickte und lächelte. Die einzige Reminiszenz an ihre Vergangenheit war der zwölf Jahre alte, aus dem aktiven Dienst ausgemusterte Feldgleiter, dessen mächtige Maschine für ihre Zwecke eigentlich überdimensioniert und dessen mehrfache Schichtpanzerung völlig überflüssig war. Sie liebte das Fahrzeug. Auf seinem Dach war normalerweise eine schwenkbare 12-mm-Vierlingskanone montiert, an den stummeligen Stabilisationsflossen kleine Raketenwerfer, die wahlweise mit Boden-Boden- oder Boden-Luft-Geschossen bestückt werden konnten. Jetzt waren da nur Abdeckungen und Platzhalter montiert. Auch die in der Nase eingebaute, nach beiden Seiten nur um 15 Grad schwenkbare Sun Ray Powergatling gab es nur für die eigentliche Kampfversion. Im Gegensatz zur restlichen Bestückung hatte Tooma sich allerdings – und hier erwies sich die allgegenwärtige Korruption in der Flotte als hilfreich – eine Sun Ray besorgt, inklusive einiger Kisten mit panzerbrechender Munition, Schrapnellpatronen sowie einen Speicher für hochenergetische Plasmabolzen, gegen die kein Kraut gewachsen war. Tooma hatte dafür viel Geld investiert und es entsprach ihrem Sicherheitsdenken, dass sie nach der Installation der Sun Ray alleine genug Feuerkraft hatte, um so ziemlich alles, was auf Lydos bewaffnet war, in Schutt und Asche legen zu können. Man wusste ja nie …
Natürlich war das paranoid. Tooma war die Paranoia durch jahrelange psychische Konditionierung anerzogen worden. Als sie freiwillig aus dem Dienst geschieden war, hatte man ihre aktiven Kampfimplantate, mit denen sie Waffen kontrollieren und Truppen hatte kommandieren können, entfernt. Inoperabel waren die genmanipulierten Drüsen, hier war ihr aufgetragen worden, dämpfende Medikamente einzunehmen.
Die hatte sie schon lange abgesetzt. Es gab hier keine Situationen, die automatische hormonelle Reflexe auslösten oder die Ausschüttung körpereigener Drogen notwendig machten.
Die dämpfenden Medikamente machten sie müde. Rahel Tooma hasste den Schlaf und vermied ihn, wo sie nur konnte.
Ihre beständige Paranoia widersprach der Tatsache, dass sie den Gleiter die ganze Zeit nicht abgeschlossen hatte. Aber es gab so gut wie keine Kriminalität auf der Ebene, dafür lebten hier schlicht nicht genug Menschen. Und niemand würde auf den abwegigen Gedanken kommen, den »Marechal« zu bestehlen. Tooma kannte ihren Ruf und war darüber nicht sehr glücklich, andererseits hatte er seine Vorteile.
»Ein Lexington Executor«, erwiderte die Frau und reckte sich. Erwald konnte nicht umhin, ihrem muskulösen Körper einen anerkennenden Blick zu zollen. Der Mann war selbst ein Kraftprotz, wirkte dabei allerdings gleichzeitig plump, obwohl man ihm damit wahrscheinlich Unrecht tat. Tooma verband Kraft mit einer tödlichen Eleganz, die sich in ihren geschmeidigen Bewegungen ausdrückte. Ihre Knochen waren mit Keramikstahl verstärkt worden, ihre Gelenke mit Nanomotoren. Die Chirurgen hatten bei ihrer Entlassung die Leistung gedrosselt, so weit es ging, aber die Mischung aus gebändigter Kraft und graziöser Exaktheit ihrer Bewegungen blieb bestehen.
Besondere Wirkung erzielte sie dadurch, dass dieser Eindruck ganz unbewusst vermittelt wurde, an ihren Bewegungen war nichts willentlich Gesteuertes. Rahel Tooma wirkte auch fünf Jahre nach ihrem Abschied wie die tödliche Waffe, die sie einst gewesen war. Die Tatsache, dass jemand wie Erwald gar nicht erkannte, dass Rahel aufgerüstet worden war, führte dazu, dass er es als etwas natürlich Bewundernswertes ansah.
Darüber hinaus, und dessen war sich Rahel ganz genau bewusst, wirkte es bei vielen Männern ausgesprochen erotisch.
»Wenn ich das nächste Mal komme, dürfen Sie mal eine Runde drehen«, beantwortete Rahel die unausgesprochene Frage des Mannes. »Ich soll nächste Woche zu Tomlin, er will auch einen effektiven Zaun für seine Hühnerfarm. Kann es übrigens sein, dass ich diesen Auftrag Ihnen zu verdanken habe?«
Erwald grinste breit, wie ein Junge, dem ein Streich geglückt war.
»Ja, ich dachte mir, das könnte nicht schaden!«
»Vielen Dank dafür«, meinte Rahel und klopfte dem Mann auf die Schulter. Sie bestritt ihren Lebensunterhalt mit der Installation von Sicherheitseinrichtungen und deren Wartung. Ihre Kunden waren die rund 240 Farmer auf der endlosen Dschungelebene. Der Flug zu ihrem entferntesten Kunden dauerte fast vier Stunden. Der Executor war kein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, er war ein Lastentier. Bei rund 300 Stundenkilometern endete die Beschleunigungsfähigkeit der Maschine. Und die Ebene war riesig, wie der gesamte Planet, auf dem sich die Bevölkerung von knapp zehn Millionen fast verlor.
Von Erwalds Farm bis zu ihrer großen Blockhütte, die sie auf einem sehr bescheidenen Stück Grundbesitz errichtet hatte, waren es glücklicherweise nicht mehr als knappe zwei Stunden. Es war bereits früher Abend, und der plötzliche Sonnenuntergang hier am Äquator stand unmittelbar bevor, doch die Ortungsanlagen des Executor waren Militärtechnik und würden sie sicher nach Hause geleiten. Der automatische Peilsender auf ihrem Hausdach würde das Seine dazu beitragen.
Außerdem verlangte es Tooma wieder nach einigen Tagen Einsamkeit. Die Aufnahme bei Erwald war herzlich gewesen und es hatte ihr an nichts gemangelt, doch jetzt war es auch wieder genug und Zeit, allein zu sein.
»Ich komme in zwei Wochen wieder vorbei, um nach dem Rechten zu sehen«, kündigte sie auf dem Weg zum Gleiter an. Erwald nickte. In der Zwischenzeit würde er kaum irgendwelchen anderen Besuch bekommen. Die nächste Farm war gute 25 Kilometer entfernt. Man hatte selten Gesellschaft in dieser Gegend von Lydos, ein Grund mehr, warum Tooma sich hier niedergelassen hatte.
»Haben Sie gehört, dass der Gouverneur zurückgetreten ist?«, fragte Erwald. »Es war gestern in den Nachrichten. Aus Gesundheitsgründen, sagen sie.«
Er lächelte listig. »In Wirklichkeit hat er sich ein paar Mal zu offenherzig kaufen lassen, hat mir mein Schwager erzählt!«
Erwalds Schwester war in der Hauptstadt verheiratet, wie Tooma erfahren durfte. Der Farmer rühmte sich dieses direkten Drahtes in das urbane Leben der Kolonialwelt zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Er war ein Quell politischer Interpretationen, kluger Analysen und gewichtiger Prognosen. Seine Frau ertrug dies offenbar mit stoischer Gelassenheit.
»Nein, das war mir neu«, meinte Tooma neutral. Sie interessierte sich nur am Rande für die Politik von Lydos. Der Gouverneur war im Endeffekt, wie die meisten planetaren Politiker, eine Kreatur eines der großen Konzerne. Das Hauptexportprodukt von Lydos war Genmasse für die Biotechlabore in den Zentralwelten. Wahrscheinlich stand der Gouverneur auf der Gehaltsliste einer einschlägigen Firma. Sein Nachfolger würde vermutlich eine ähnliche Herkunft haben. Immerhin, seit der Wirtschaftskrise ließ der Einfluss der großen Konzerne doch spürbar nach. Alle Firmen waren davon betroffen, und mit ihren ökonomischen Verlusten ging auch eine Einbuße politischer Macht einher. Selbst jene Firmen, die ohne eine enge Verquickung mit dem Staat auf ehrliche Art ihr Geld zu machen versuchten, hatten ernsthafte Probleme. Tooma war froh, dass man hier draußen von der Politik ohnehin so gut wie nie belästigt wurde. Sobald im kommenden Jahr das Koloniale Kuratel auslief und planetare Wahlen wieder zugelassen waren, würde sich das ändern. Auch Erwald war ein Wähler. Tooma schauderte es bei dem Gedanken, dass sich ein Wahlkampfleiter der Ebene erinnern würde. Sie hoffte, ihr eigener Sicherheitsperimeter würde – ganz unabsichtlich natürlich – jeden Politiker, der sich ihr bis auf 500 Meter näherte, sofort vaporisieren.
Da war ihr jeder Tigerfuchs und jeder Python lieber.
An Erwalds Grinsen erkannte sie, dass die Überzeugungen des Farmers nicht allzu weit von den ihren entfernt waren.
Als sie den Gleiter erreicht hatte, verabschiedete sie sich kurz und herzlich. Sie bestieg das schwere Fahrzeug, warf einen Blick in die voluminöse Transportkapsel, in der normalerweise ein 24-köpfiges Dropteam und dessen Ausrüstung reichlich Platz fanden, und setzte sich in die Kanzel.
Auf dem Kopilotensitz lag ein noch warmer Apfelkuchen. Der lydische Apfel hatte zwar nicht mehr als den Namen mit dem irdischen gemein, war aber eine ungemein schmackhafte und vielseitige Frucht. Der Kuchen dampfte.
Tooma musste unwillkürlich grinsen. Sie beförderte das Backwerk an eine sichere Stelle, warf einen Blick auf das Wohngebäude der Familie. Am Küchenfenster stand Erwalds Frau und lächelte. Tooma winkte ihr durch die Sichtscheibe zu und bekam die gleiche Geste zur Antwort. Dann startete sie die Maschine.
Mit dumpfem Brüllen sprang das Triebwerk an. Der Executor war alt und schon länger außer Dienst gestellt gewesen, als Tooma ihn in einem erbärmlichen Zustand erworben hatte. Davon war nun nichts mehr zu sehen, aber es änderte nichts an der Tatsache, dass es sich bei dem Monster um eine alte Maschine handelte. Als Tooma das Prallfeld aktivierte, erhob sich der Gleiter mit hörbarem Ächzen in die Luft. Tooma tippte gegen die Geschwindigkeitskontrolle. War es erst in der Luft, schwebte das massive Fahrzeug sanft in die Höhe. Als es 100 Meter erreicht hatte, schob die Pilotin den Beschleunigungshebel nach vorne. Der Executor reagierte folgsam und presste Tooma in den Sitz. Sie hörte das Glucksen des Beschleunigungsgels in den Polstern, doch vermied sie jedes Gewaltmanöver. Dafür gab es keinen Grund, vor allem hatte sie niemandem etwas zu beweisen. Nach zwanzig Sekunden hatte sie eine Reisegeschwindigkeit von 270 Stundenkilometern erreicht und das Peilsignal ihres Hauses fixiert.
Den Rest würde der Autopilot erledigen. Sie lehnte sich entspannt zurück, holte den Apfelkuchen hervor und riss mit der Hand ein mächtiges Stück ab. Der angenehme Duft von warmem Apfel und lockerem Gebäck stieg in ihre Nase. Es war nicht gut für den Magen, aber wer Standardrationen ertrug, kam auch mit frischem Kuchen zurecht. Er zerging ihr förmlich auf der Zunge, hatte ein köstliches Aroma und war ohne Zweifel aus frischem Obst gemacht. Sie nahm sich vor, beim nächsten Besuch als Teil der Bezahlung ein weiteres Produkt dieser Art zu verlangen. Backen gehörte zu den Fertigkeiten, die sie nie erlernt hatte, und auch heute noch war die Mikrowelle ihre bevorzugte Nahrungszubereitungsapparatur. Sie jagte etwas und konnte Frischfleisch zubereiten, das gehörte zu ihrer Ausbildung. Aber sie empfand nicht die Freude und Befriedigung bei der Bereitung von Nahrung wie offensichtlich Erwalds Frau. Zumindest schmeckte dieser Kuchen nach Leidenschaft, und wenngleich Tooma anderen Leidenschaften frönte, wusste sie die Arbeit einer Expertin zu würdigen.
Sie griff sogleich nach einem zweiten Stück. Da war einiges zu würdigen!
Der Executor glitt in die hereinbrechende Dunkelheit. Der Ortungsschirm blieb leer. Um diese Zeit reiste niemand mehr auf der Ebene, nicht auf dem Boden und nicht in der Luft. Der einzige permanente Datenstrom waren die Signale des GPS sowie der Feed der Kommunikationssatelliten. Es war ein ruhiger, beschaulicher Abend auf Lydos, und wie immer, wenn sich diese Erkenntnis durchsetzte, fragte sich Tooma, warum sie trotzdem nicht entspannt war. Obgleich sie bewusst die Einsamkeit dieser Welt gesucht hatte, um die Enttäuschungen ihres Lebens zu vergessen, hatte sie ihren Frieden im Grunde nie gefunden. Die innere Rastlosigkeit war, so schien es, ein bestimmendes Merkmal ihrer Persönlichkeit. Sie war dafür verantwortlich gewesen, dass sie sich freiwillig bei den Marines gemeldet hatte, anstatt ein vorgeplantes und behütetes Leben auf Terra zu beginnen. Aber dennoch, während ihrer Dienstzeit hatte es immer wieder Momente gegeben, in denen sie völlig entspannt gewesen war. Das war ein Gefühl, das sie auf Lydos trotz aller Ruhe und Beschaulichkeit immer vermisst hatte.
Oder es lag daran, dass sie im Grunde ihres Herzens gar nicht hier sein wollte und stattdessen ihrer Vergangenheit im Raummarinedienst nachtrauerte – trotz der Tatsache, dass sie nach den mehrfachen sexuellen Übergriffen Colonel Barrasos, darunter fünf versuchten Vergewaltigungen, und der Erkenntnis, dass die höheren Hierarchien den Abkömmling aus einer der Handelsfamilien immer decken würden, ihren Dienst zu hassen begonnen hatte?
Sie hatte einmal geglaubt, der Marinedienst sei ihr Leben.
Rahel Tooma presste die Lippen zusammen, als die mittlerweile altbekannte emotionale Welle aus Enttäuschung, Frustration, Sehnsucht und Verzweiflung über sie hereinbrach.
Nein, ihren Frieden hatte sie tatsächlich nicht gefunden.
Sie hatte ihn lediglich gegen Stille eingetauscht.
3 Station Thetis
Er verstand die Leute nicht.
Nein, das war nicht ganz richtig. Er verstand sie schon – Verstehen im Sinne der richtigen Aufnahme der Bedeutung eines Wortes oder Satzes. Was sie sagten, hörte und verstand er. Nur was sie meinten, entging ihm oft. Bewegten sie ihre Arme und verzogen sie die Muskulatur ihres Gesichts, war das für ihn nur Bewegung. Sie hatte kein Ziel. Was sie ausdrückte, blieb ihm verschlossen. Rational wusste er, was manche dieser Bewegungen bedeuteten: Verzog sich der Mund nach oben, dann wurde damit oft Humor ausgedrückt. Aber bei anderen sah das Lachen offenbar anders aus, was sehr missverständlich war, und viele machten zwar die Mimik des Lächelns, meinten aber nicht das, was es eigentlich bedeutete. Für ihn ergab sich kein sichtbarer Zusammenhang zwischen dem Gesagten und dem, mit dem es untermalt wurde.
Und so kam es, dass er die Leute nicht verstand.
Das war verschmerzbar, denn fast jeder, mit dem er zu tun hatte, war ein Idiot.
Solange er seine Arbeit hatte und die damit verbundenen Bedürfnisse erfüllt wurden, war die Verwirrung nicht mehr als ein manchmal störendes, aber im Grunde leicht zu ignorierendes Hintergrundrauschen. Er saß vor seinen Computersimulationen oder im Labor. Leute arbeiteten für ihn, sicher, aber er musste nicht verstehen, was sie meinten. Er gab ihnen Anweisungen – sehr klare dazu, und es gab in diese Richtung offenbar keinerlei Verständigungsprobleme. Waren seine Leute gut, führten sie sie aus und die Computer teilten ihm das Ergebnis mit. Computer sagten und meinten in einem, es gab keine unterschiedlichen Vermittlungsformen.
Er mochte Computer.
Diejenigen seiner Leute, die seine Anweisungen nicht befolgten oder versuchten, ihn in sinnlose Gespräche über ihre Arbeit zu verwickeln, blieben nicht lange. Es gab andere, meist Uniformträger, die das Labor gut beobachteten. Erkannten sie, dass er verwirrt wurde oder in seinen Anweisungen stockte, entfernten sie das Übel. Ihm war das egal, für ihn war der eine Mensch wie der andere. Er erkannte Unterschiede im Aussehen und machte sich die Mühe, dem Äußeren die individuellen Namen zuzuordnen, mit denen sie gerne angesprochen wurden, aber er kannte niemanden, auch nicht jene, die seit Jahren für ihn arbeiteten. Es machte keinen Unterschied, ob jemand seit einer Woche oder einem Jahrzehnt da war. Wenn er funktionierte, war es gut. Wenn er nicht funktionierte, ging er.
Er liebte Probleme.
Dabei kam es nicht darauf an, wer ihm die Probleme bereitete.
Vorstellte. Vorbereitete. Präsentierte. Er selbst hatte keine Probleme, er bekam sie von anderen. Ihn interessierte meist nicht das spezifische Problem – obgleich er solche vorzog, bei deren Lösung er sein umfassendes Wissen einsetzen konnte. Ihn interessierte das Problem an sich. Die Tatsache, dass es eines war. Es reizte ihn. Es war die einzige Herausforderung, die ihn auch emotional werden ließ. Emotionalität drückte sich bei ihm dadurch aus, dass er stundenlang, ohne Unterbrechung, über das Problem zu reden begann, meistens zu sich selbst. Er wusste, dass die Uniformen diese Monologe mitschnitten und sich ganze Teams nur mit dem befassten, was er an Lösungswegen formulierte und verwarf. Es kümmerte ihn nicht. Was seinen Mund verließ, war bereits veraltet. Sein Verstand war schneller, immer zwei bis drei Schritte voraus. Aber das Reden half ihm, die wirbelnden Erkenntnisse zu verarbeiten. Es half ihm, sich zu konzentrieren. Er sortierte sich. Worte waren da nur Abfall, die Zuhörer nicht mehr als die Müllabfuhr. Sollten sie nehmen, was sie durch das Wühlen im Müll fanden, ihm war das gleichgültig.
Es gab keinen Mangel an Problemen. Meist waren es physisch-technische. Manchmal waren es rein theoretische, oft mathematische. Hin und wieder war es eine Frage der Interpretation von Daten. Aber es gab beständigen Nachschub. War eines gelöst – was oft vorkam – oder eines unlösbar – was sehr selten war –, wurde sofort etwas nachgeschoben. Er fraß Probleme. Er ernährte seinen Verstand durch sie. Ihm war es völlig egal, was die Uniformen anschließend damit anfingen. Den einzigen Lohn, den er erwartete, war, dass sie ihm den Nachschub besorgten, den er benötigte. Dass sie ihn kleideten und ernährten und ihn so ertrugen, wie er war. Abgesehen davon war er bedürfnislos. Hin und wieder schickten sie ihm eine neue Uniform, die versuchte, mit ihm zu sprechen. Wenn die betreffende Person gut war, verzichtete sie auf unnötige nonverbale Kommunikation und sprach klare Sätze mit verständlichen Anliegen. War sie darauf nicht vorbereitet, verschwand sie meist auch sehr schnell wieder.
Heute war wieder so ein Tag, an dem er eine neue Uniform zugeteilt bekam. Die letzte war gar nicht so übel gewesen, aber offenbar hatte sie kein Interesse mehr an der Arbeit mit ihm gehabt. Wer das Interesse an ihm verlor, verlor meist auch die Geduld, sich korrekt mit ihm auseinanderzusetzen. Es musste dann einen Wechsel geben, denn die Uniformen waren sehr daran interessiert, mit ihm im Gespräch zu bleiben, und versuchten, die geeignete Person für diese Aufgabe zu finden.
Sie nannten es einen »Verbindungsoffizier«, doch für ihn waren sie alle gleich. Eine gewisse Neugierde konnte er nicht verhehlen: War diese Uniform in der Lage, sich ihm gegenüber verständlich zu machen? Würde sie darauf verzichten, eine »persönliche Beziehung« aufbauen zu wollen? Dann würde er sie als intelligent einstufen, in etwa so, wie ein normaler Mensch einen Hund als intelligent bezeichnen würde. Aber das war das höchste Lob, das jemand von Dr. Jan DeBurenberg erhalten konnte, wenngleich er es nie aussprach.
Capitaine Geraldo Frazier hatte sich dieses Lob noch nicht einmal verdient. Das lag vor allem daran, dass der schlaksige Offizier mit den blassblauen Augen sich neben DeBurenberg gesetzt hatte, als dieser gerade mitten in einem seiner Monologe war. Ohne es zu wissen, hatte er die richtige Entscheidung getroffen und ihn dabei nicht unterbrochen. Erst als der Mittvierziger mit seiner beginnenden Glatze fertig war und seine Aufmerksamkeit auf Frazier gelenkt hatte, ergriff dieser das Wort.
»Dr. DeBurenberg, mein Name ist Geraldo Frazier. Ich bin Ihr neuer Verbindungsoffizier und möchte mich Ihnen vorstellen.«
»Angenehm«, kam die knappe Erwiderung, fast mechanisch. DeBurenberg erkundigte sich nicht nach seinem Vorgänger, der es auf diesem Posten immerhin fast ein Dreivierteljahr ausgehalten hatte. Frazier wunderte sich nicht darüber. Er wusste, dass für den genialen Wissenschaftler ein Mensch wie der andere war. DeBurenberg fehlte die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu seiner Umwelt aufzubauen, fast völlig. Zudem, so meinten zumindest die Flottenpsychologen, war er nicht in der Lage, Gestik und Mimik zu deuten und den möglichen symbolischen oder tieferen Gehalt von Äußerungen zu entschlüsseln. Er nahm das exakt gesprochene Wort wahr – und er verfügte über einen bemerkenswerten Wortschatz und beherrschte sieben Fremdsprachen fließend – und verstand es auch so. Und nur so. Das bedeutete nicht, dass ihm die Interpretation von Sachverhalten fremd war. Diese Fähigkeit schien jedoch in exakt jenem Moment zu erlöschen, in dem er sich direkt mit seinen Mitmenschen auseinanderzusetzen hatte.
Frazier hatte sich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet, obgleich er über keine psychologische Fachausbildung verfügte – im Gegensatz zu seinen Vorgängern. Er hatte keine großen Chancen im Flottendienst gesehen, als Kommunikationsoffizier ohnehin nicht, vor allem nach den letzten Streichungen im Etat.
Die Tatsache, dass sein eigener Bruder am Asperger-Syndrom litt, einer speziellen Form von Autismus, mit in mancher Hinsicht vergleichbaren Symptomen wie jene, mit denen DeBurenberg lebte, hatte möglicherweise dazu beigetragen, dass er für diesen Posten akzeptiert worden war. Seine Versetzung ins irdische Zentralsystem, das er nie zuvor besucht hatte, und auf die den Jupiter umkreisende Forschungsstation war dann nur noch eine Formalie gewesen. Diese Entscheidung konnte sich als Sackgasse für seine Karriere erweisen, oder als neuer Aufbruch. In jedem Falle entfernte sie ihn bis auf Weiteres von gewissen Teilen der Marinehierarchie, mit denen er potenziell aneinandergeraten konnte. Er hoffte, bei Wissenschaftlern eine wärmere Aufnahme zu finden, wenngleich das Konzept menschlicher Wärme diesem Exemplar nur höchst abstrakt bekannt war.
»Dr. DeBurenberg, gibt es Dinge oder Dienstleistungen, die Sie wünschen und die ich Ihnen beschaffen soll?«
»Die Rechnereinheit 17 ist bereits vor einer Woche ausgefallen«, erwiderte DeBurenberg prompt. »Ich will, dass sie ersetzt wird.«
»Ich werde das veranlassen«, sicherte Frazier zu. »Gibt es weitere Dinge?«
»Der Kaffee schmeckt bitter. Der Automat muss neu eingestellt werden.«
»Ich werde mich sofort darum kümmern. Welchen Fortschritt macht Ihre aktuelle Aufgabe?«
»Ich bin fertig und bereits mit dem nächsten Problem befasst.«
Frazier wusste das natürlich. Die Fortschritte des Labors wurden akribisch aufgezeichnet. Aber er wollte die Konversation auf Dinge beschränken, von denen er ahnte, dass sie DeBurenbergs Interesse finden würden. Er nickte, vergaß für einen Moment, dass diese Geste seinem Gegenüber nichts sagte, wenn er sie nicht in einen konkreten verbalen Kontext stellte.
»Ich gehe«, kündigte er an. »Sie können sich jederzeit an mich wenden, wenn Sie etwas benötigen. Zu wirklich jeder Zeit.«
Für einen Moment sah er etwas wie Anerkennung in DeBurenbergs Augen aufflackern. Der Wissenschaftler hatte bereits vor Jahren jeden Bezug zu einem Tag-Nacht-Rhythmus verloren. Er schlief viel und ausgiebig, aber exakt nach seinen Bedürfnissen und ohne Rücksicht auf Zeitpläne. Die Tatsache, dass der Offizier sich diesem Habitus unterwarf, ohne Fragen zu stellen, schien das Wohlgefallen des Genies zu wecken.
Ohne weiteren Gruß, den DeBurenberg als unverständliche soziale Floskel ohnehin nicht wahrgenommen hätte, erhob Frazier sich und verließ das Labor. Er betrat sein direkt angrenzendes Büro, wo der kommandierende Offizier von Thetis, Colonel Robert Delivier, bereits auf ihn wartete.
Der kleine, fast zwergenhafte Mann genoss das Vertrauen der Admiralität. In Fraziers Augen war er damit so etwas wie ein Aussätziger. Immerhin, das musste auch er anerkennen, trug Delivier einen Doktortitel in Nuklearphysik, den, so sagten die Gerüchte, er ganz und gar rechtmäßig erworben hatte. Der Colonel hatte demnach wissenschaftliche Meriten. Trotzdem war sicher einer der Gründe dafür, dass er diesen wichtigen Posten gewonnen hatte, seine Intimität mit der aktuellen Flottenführung. Und mit der wollte Frazier, notfalls auch auf Kosten seiner eigenen Karriere, nicht intim werden. Er stammte von einer der Kolonialwelten – Tantrum – und hatte seine Familie während der Kolonialkriege verloren. Sie waren unschuldige Opfer eines Flächenbombardements, mit dem die Flottenführung die renitente Regierung Tantrums aus der Kolonialallianz hatte lösen wollen. Frazier war zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr in Haft gewesen: Alle Offiziere aus den Kolonien waren mit Beginn der militärischen Auseinandersetzungen in Schutzhaft genommen worden, auch und gerade grüne Aspirants wie er. Bis zum Ende des Krieges hatte Frazier in Haft gesessen, und dann war sein kometenhafter Aufstieg gefolgt, denn letztendlich hatte an seiner Loyalität kein realer Zweifel bestanden – und an seinen Fähigkeiten ohnehin nicht. Dabei hätte man nach dem gewaltsamen Tod seiner Familie berechtigterweise annehmen müssen, dass seine Begeisterung für die Sphäre sehr begrenzt sein würde. Doch Frazier hatte all diese Gedanken tief in sich begraben.
Jetzt, fünf Jahre nach dem Ende des letzten Krieges, war er einer der höchstrangigen Offiziere aus den Kolonien, und obgleich er die Admiralität, die ihm vorstand, mit Inbrunst hasste, liebte er den Flottendienst. Leider wurde diese Liebe nicht erwidert: Mehrfach hatte man ihm bedeutet, dass mit weiteren Beförderungen bis auf Weiteres nicht zu rechnen sei. Kolonialoffiziere hatten immer noch auf besondere Weise ihre Loyalität zu beweisen, und keiner kam an wirklich wichtige Schaltstellen der Macht. Frazier wurde daher seit je her von einem starken inneren Widerstreit gebeutelt, der ihn des Öfteren fast hatte depressiv werden lassen.
Er würde, das wusste er, eines Tages an Magengeschwüren leiden.
»Nun, Capitaine? Haben Sie Freundschaft mit unserem Wunderkind geschlossen?«
Das meckernde Lachen, das Delivier der Frage folgen ließ, verbarg seinen Minderwertigkeitskomplex nur ungenügend. Gerade weil der Colonel eigene wissenschaftliche Meriten hatte, musste eine Person von seiner Persönlichkeitsstruktur unvermittelt Neid empfinden, wenn er auf jemanden wie DeBurenberg traf.
Erst recht dann, wenn sein ausdrücklicher Befehl war, dem Mann jeden Wunsch von den Augen abzulesen.
Oder ablesen zu lassen, denn das war nun Fraziers Job.
»Ich denke nicht, dass dieser Mann jemals Freunde hatte oder jemals welche haben wird«, erwiderte Frazier und setzte sich unaufgefordert. Delivier, das hielt der Capitaine ihm zugute, war kein übertrieben fanatischer Anhänger militärischer Förmlichkeiten, die auf einer reinen Forschungseinrichtung auch eher kontraproduktiv waren. »Er lebt in seiner eigenen Welt, er ist ein absoluter Egoist, ohne dies zu wollen – nein, ohne dies zu reflektieren. Aber er hat mit der Außenwelt ein Geschäft abgeschlossen: Er nimmt sie wahr und kommuniziert mit ihr, wenn sie ihn dafür mit Dingen beschäftigt, die ihn herausfordern. Ich kann nicht mehr tun, als dafür zu sorgen, dass unser Teil des Geschäfts eingehalten wird.«
Delivier nickte nachdenklich und sah Frazier forschend an.
»Das haben Sie gut erkannt, Capitaine. Ich sehe, Sie werden mit DeBurenberg zurechtkommen. Morgen kommt ein Dispatch der Astronomischen Abteilung der Admiralität. Ein Explorator hat interessante Daten gesendet, es scheint, dass man plant, nun doch weitere Brücken zu errichten.«
Frazier hob interessiert die Augenbrauen. Das war eine beiläufig mitgeteilte, aber durchaus spannende Neuigkeit. Seit Beginn der großen Nachkriegsdepression war keine neue Einstein-Rosen-Brücke mehr errichtet worden. Die Mittel dafür waren schlicht nicht ausreichend gewesen. Wenn der Explorator Material versprach, das es nun möglich machte, diese Tatsache zu ändern, mussten die explorierten Systeme wirklich vielversprechende Ressourcen haben – oder schlicht die richtige Schwerkraftkonstellation, um eine Brücke einfach errichten zu können. Ohne die Hilfe der ER-Brücken war es bisher physikalisch nur möglich gewesen, kleine Raumfahrzeuge mit gigantischem Energieaufwand in das übergeordnete Kontinuum zu zwingen, in das einen die Brücken mit großer Leichtigkeit brachten. Die wenigen Explorations- und Brückenbaueinheiten waren sündhaft teuer und hatten den Energieverbrauch ganzer bewohnter Sonnensysteme, und sie waren sehr alt: Von den drei existierenden Einheiten war die jüngste vor rund 100 Jahren gebaut worden. Die Sphäre besaß schon seit geraumer Zeit nicht mehr die ökonomische Kraft, solche Einheiten in Auftrag zu geben. Stattdessen hatte man sich lieber in wiederkehrenden Kolonialkriegen selbst zerfleischt.
Die Tatsache allein, dass man einen der alten Exploratoren entmottet und in den Einsatz geschickt hatte, war eine nahezu revolutionäre Entwicklung gewesen.
In jedem Falle war die Zündung einer Brücke ein erhebliches Unterfangen. Der damit in Monopolstellung betraute Konzern Interstellar Constellations steckte in der schwierigsten Krise seit seiner Gründung und konnte sich durch die Passagegebühren der Händlerfamilien gerade noch so vor dem Bankrott retten. Wollte er eine neue Brücke errichten, würde er Kapital benötigen, aller Wahrscheinlichkeit einen Staatszuschuss. Das heißt, die Regierung würde noch mehr Geld drucken.
Dabei war die Inflation bereits im hohen zweistelligen Prozentbereich angekommen.
Frazier wollte sich mit den Details dieses Aspektes nicht befassen. Ihn faszinierte die Idee neuer Systeme. Deswegen war er der Flotte beigetreten.
»DeBurenberg soll sich die Daten einmal ansehen?«
»Wenn es ihn interessiert. Versuchen Sie es. Ich schicke Ihnen den Dispatch, sobald ich ihn habe.«
»Ja, mon Colonel!«
Im Endeffekt würde DeBurenberg sich mit den Daten nur befassen, wenn er darin einen Sinn sah. Selbst die besten Flottenpsychologen hatten noch nicht herausfinden können, welche Kriterien das Genie tatsächlich anlegte, um dies zu entscheiden. Seit er den kompletten Newsfeed der Flotte sowie der größten interstellaren Konzerne bekam, suchte er sich seine Probleme manchmal selbst. Das führte dazu, dass er sich mitunter mit Dingen befasste, die die Flottenführung eigentlich nicht interessierte. Fraziers Aufgabe war es unter anderem, DeBurenberg ein wenig in die »richtige« Richtung zu schubsen, soweit das überhaupt möglich war. Seine Stellung in dieser Station würde wesentlich davon abhängen, ob und inwieweit er in der Lage war, Einfluss auf den Autisten auszuüben.
Delivier nickte Frazier noch einmal zu und verließ ohne weiteren Gruß sein Büro.
Der Capitaine entspannte sich sichtlich. Durch die einseitig durchsichtige Scheibe hatte er einen guten Blick in DeBurenbergs Arbeitsbereich. Das Genie saß vor einem Computermonitor und biss in einen Hamburger. Ketchup floss ihm das Kinn herab. DeBurenberg wischte ihn abwesend fort, dafür benutzte er den ausgedruckten Tagesbefehl von Thetis mit Deliviers geschwungener, breiter Unterschrift.
Frazier grinste.
Diese Aufgabe begann, ihren Reiz zu entwickeln.
4 Arbedian
Wie immer war der Transit unspektakulär. Auf der Brücke der Admiral Malu, die gerade in Warteposition vor Arbedian Terminal einschwenkte, zeichnete sich die Ankunft des Prosperity Liners nur als Energiespitze ab. Die Napoleon, die sich bereits auf Kurs zur Brücke befand, würde vielleicht sogar den hellen Lichtblitz erkannt haben, mit dem ein Schiff gemeinhin die Brücke verließ. Wie alle ER-Brücken, so war auch die des Arbedian-Systems senkrecht zur Ekliptik, fast direkt »über« dem Zentralgestirn, angesiedelt. Vom derzeitigen Standort der Malu entfernt, würde der Liner etwa sechs Tage benötigen, um den Terminal zu erreichen. Auf halbem Wege würde er die Napoleon treffen. Die Tatsache, dass Prosperity trotz aller ökonomischen Probleme die Außensysteme weiterhin regelmäßig anflog – auch, wenn sich nicht jeder Run lohnte –, hatte auch etwas damit zu tun, dass der Konzern vom Direktorium intensiv gebeten worden war. Die Stimmung nach dem Ende des letzten Kolonialkrieges war ebenso schlecht gewesen wie die wirtschaftliche Lage und daher musste man den Bewohnern der Kolonien zeigen, dass sie nicht abgeschrieben waren. Von den insgesamt 37 besiedelten Systemen waren nur etwas mehr als die Hälfte ökonomisch autark, der Rest wies meist wirtschaftliche Monosysteme auf und war für viele wichtige Kapitalgüter auf Handel angewiesen. Arbedian gehörte dazu, und so wurde der Liner mit großer Freude erwartet. Er lieferte nicht zuletzt die Luxusgüter für die kleine Oberschicht der Kolonie und stellte nicht nur aus diesem Grunde eine willkommene Abwechslung im kolonialen Alltag dar.
Es war daher auch nicht verwunderlich, dass es das Allermindeste war, dass der höchste Flottenoffizier im System dem Kommandanten des Liners seine persönliche Aufwartung machte. In solchen Momenten war Haark dafür dankbar, nicht der höchste Flottenoffizier zu sein. Die Offiziere der gigantischen Frachtschiffe waren sich ihrer wichtigen Stellung im Wirtschaftsgefüge der Sphäre durchaus bewusst. Meist legten sie ein entsprechendes Maß an Sozialkompetenz an den Tag. Kein Prosperity-Kommandant musste zu irgendjemandem höflich sein. Erst recht nicht zu diesen Flottenfuzzis in ihren veralteten Konservendosen. Die Verachtung beruhte auf Gegenseitigkeit. Haark hatte während seiner Karriere noch keinen Linerkommandanten kennengelernt, mit dem er warm geworden wäre. Es hatte sich allerdings auch noch nie einer sonderlich um die Vergabe von Sympathiepunkten beworben.
Haark seufzte. Er musste immer noch seine Bordreparaturmittel aus den Beständen des Liners auffrischen. Die Tatsache, dass Capitaine Esterhazy die Begrüßung für ihn erledigte, enthob ihn leider nicht der Notwendigkeit, trotz aller klaren rechtlichen Regelungen mit dem Frachterkapitän über die kleine »Spende« verhandeln zu müssen. Und die Bereitwilligkeit der Linerkommandanten, von ihren reichhaltigen Vorräten anzugeben, stieg proportional zu der Unterwürfigkeit, mit der man sie darum bat.
Haark verzog das Gesicht.
Er stellte die Tasse mit kalt gewordenem Kaffee ab und reckte sich. Seine Schicht war um, aber der stete Genuss von Koffein hatte jede Müdigkeit aus ihm vertrieben. Obgleich seine Augen brannten, wusste er, dass er jetzt keine Ruhe finden würde. Beck hatte das Kommando und saß auf dem Sitz des Piloten, der mit einer Magenverstimmung zur Krankenstation geeilt war. Beck hatte Haark versichert, Tijden habe die schlechten Rationen vernichtet und keine davon sei der Mannschaft serviert worden. Haark glaubte Beck, aber er traute Tijden nicht über den Weg. Der Smutje der Malu war ein Genie darin, aus den faden Rationen essbare Gerichte zu bereiten, was ihn zu einem der beliebtesten Besatzungsmitglieder machte. Andererseits übertrieb er es mitunter damit, aus »diesem und jenem« dann »doch noch etwas« machen zu wollen. Möglicherweise war doch eine der schlechten Rationen diesmal unter »diesem und jenem« gewesen. Es ging das Gerücht um, dass Tijdens Mageninnenwände mit Keramikstahl verkleidet waren und er daher immer der Letzte war, der bei weniger geglückten Kreationen zu leiden begann. Das verstärkte seine Improvisationsfreude nur noch.
Haark seufzte. Er rieb sich die Augen und blieb noch etwas sitzen. Auf dem Hauptmonitor zeichnete sich deutlich das Spinnengewebe des Terminals ab. Einer der Ausleger würde für einige Tage die Heimat der Malu sein. Sobald angedockt, übernahm die Versorgungsstelle des Terminals die Verpflegung der Mannschaft. Die Küche war nicht gut, aber dafür waren die zubereiteten Speisen frisch, mit Zutaten, die in wöchentlichen Abständen von der Oberfläche herangeschafft wurden. Arbedian hatte etwas Landwirtschaft und Haark hatte es sich sofort nach seiner Stationierung zur Aufgabe gemacht, der beste Freund des zuständigen Nachschuboffiziers zu werden. Das hatte geholfen, wenngleich der Terminalchefkoch die begnadete Hand eines Tijden vermissen ließ. Das wurde durch die Frische der Ware jedoch durchaus kompensiert. Haark machte sich eine mentale Notiz, die Liegezeit zu nutzen, um seine tiefe und innige Freundschaft zum Nachschuboffizier zu erneuern. Manche Dinge bedurften der ständigen Pflege.
Nicht zuletzt deswegen, weil auch der Kaffee nicht das abgestandene, künstliche Flottenpulver war, sondern richtiger, angebauter, frisch gemahlener. Arbedian hatte guten Boden für Kaffee und auch das richtige Klima. Leider wurde diese Ressource in diesem Bergbausystem nicht wirklich genutzt. Haark musste sich immer ziemlich anstrengen, ein paar Kilo zu erhalten. Abnehmer gab es viele, und die meisten hatten deutlich mehr Geld als er zur Verfügung.
»Mon Capitaine …«
Becks Stimme riss Haark aus seinen Überlegungen.
Sie hatte einen seltsamen Unterton gehabt. Haark hatte diesen Unterton das letzte Mal gehört, als vor drei Monaten der Fusionsmeiler der Malu plötzlich durchzugehen drohte. Eine Alarmglocke begann in seinem Kopf zu schwingen.
Er richtete sich auf, jetzt voller Konzentration. Beck starrte vor sich auf die Ortungsanzeigen. Ihm war offenbar etwas aufgefallen.
»Ja, Lieutenant?«
»Das hier ist seltsam, vielleicht können Sie mal …«
Haark runzelte die Stirn.
Beck war ein sagenhaft exakter und kenntnisreicher Offizier. Dieses Verhalten war sehr ungewöhnlich. Er erhob sich und gesellte sich zum Offizier. Der hatte die Ortungsergebnisse aufgeschaltet.
»Das kam eben vom Long Range Array aus Arbed City. Die Sensoren des Terminals haben es auch aufgefangen.«
Haark warf einen kurzen Blick, zwinkerte, beugte sich vor. Dann erhob er sich wieder.
»Geben Sie mir den Chef vom Dienst.«
Augenblicke später tauchte das Gesicht eines jungen Offiziers auf dem Schirm auf. Die Besatzung des Arrays war neben den hier tätigen Schiffen die einzige weitere Marinepräsenz im System – die Offiziere auf dem Terminal gehörten im Regelfalle den Kolonialtruppen an – und entsprechend auf das Notwendigste begrenzt: drei Wachoffiziere und vier Techniker. Haark kannte sie mittlerweile alle. Lieutenant Yakama war ein aufgeweckter Bursche und er wusste offenbar sofort, um was es sich drehte.
»Capitaine, wir haben bereits eine Analyse laufen«, meldete er statt einer Begrüßung.
»Seit wann haben Sie das Objekt auf dem Schirm?«
Yakama warf einen raschen Blick zur Seite.
»Seit exakt 35 Sekunden. Als der Computer gemeldet hat, dass es sich nicht um ein Störungsartefakt handelt, sondern eine reale Ortung vorliegt, habe ich erst mal zu Ihnen durchgeschaltet.«
Haark schaute wieder auf das Ortungsbild.
Ein undeutlicher Blip zeichnete sich auf der Darstellung ab. Es war offenbar kein elektronisches Artefakt, also war es »etwas«.
»Sie haben eine Auswertung laufen?«, vergewisserte sich der Kommandant der Malu.
»Ja.«
»Wo und was ist das?«
»Ich kann Ihnen nur die erste Frage beantworten, Capitaine. Es ist am Rand des Systems, siebzehn Grad zur Ekliptik, und offenbar aus der Oortschen Wolke gestoßen. Der Array muss es durch Zufall entdeckt haben, in der Richtung gibt es eigentlich keinen Schiffsverkehr.«
Stellte man sich das Arbedian-System als flache Scheibe vor, die aus den Umlaufbahnen der Planeten bestand, war der Blip »unterhalb« dieser Scheibe aufgetaucht. Die ER-Brücke befand sich weit oberhalb dieser Scheibe, sozusagen »auf der anderen Seite«.
»Es muss sich also noch am äußersten Rand der Ortungsreichweite befinden, selbst wenn man die leichte Verzögerung durch die Entfernung mit einberechnet.«
»Korrekt, Capitaine. Und wir haben es ohnehin nur bemerkt, weil es strahlt wie ein Weihnachtsbaum. Es emittiert Energie, und zwar reichlich.«
»Halten Sie mich auf dem Laufenden!«
Yakama bestätigte und sein Abbild verblasste.
Haark ließ einige Daten über den Schirm wandern. Die Napoleon war immer noch das Schiff am ehesten in der Nähe des Blips. Die Fregatte befand sich zwar auf ihrem Weg oberhalb der Ekliptik in Richtung ER-Station, die Malu aber war weiter entfernt, da »seitlich« versetzt im Orbit Arbedians. Außerdem war die Napoleon viel, viel schneller als das alte Torpedoboot. Er wandte sich an Beck.
»Senden Sie die Daten an Esterhazy. Was haben wir für Insystem-Schiffe?«
»Zwei automatische Frachter auf Kurs nach draußen, drei nach innen. Die Standardsonden des Satellitensystems. Wir könnten da was machen, wenn der Terminal mitspielt.«
»Geben Sie mir Direktor Lüthannes.«
Beck schaltete.
Er tat dies klaglos, obgleich er für so was eigentlich gar nicht zuständig war. Aber er und Haark waren ein eingespieltes Team, das keinen großen Wert auf formale Zuständigkeitsabgrenzungen legte. Hauptsache, die Ergebnisse stimmten.
Unvermittelt erschien das hagere Gesicht des Terminaldirektors auf dem Kommunikationsschirm. Es schien, als habe der Chef der Station nur auf den Ruf der Malu gewartet. Haark hatte den Chef des Terminals als uninspirierten, aber relativ effektiven Verwalter kennengelernt. Zumindest seine Orbitalstation hatte er im Griff. Er hielt es wie der Lieutenant und kam ohne Umschweife zum Thema.
»Capitaine. Ich vermute, es geht um unsere Ortung.«
»Exakt, Direktor. Ich erbitte um Kontrollgewalt über das Satellitensystem. Ich würde gerne eine der Sonden in Richtung des Bogeys entsenden.«
Lüthannes zögerte.
»Sollte nicht Capitaine Esterhazy …«
Haark hatte mit diesem Einwand gerechnet.
»Die Napoleon wird von uns informiert, aber Esterhazy ist zu weit weg, um auf den starken Terminalsender zugreifen zu können. Ich werde die Satelliten über das Terminal als Relais steuern.«
Lüthannes war ein allzu korrekter und vielleicht etwas langsamer Bürokrat, aber er war kein Idiot, zumindest war das bisher immer Haarks Eindruck gewesen. Dies schien sich nun erneut zu bestätigen.
»Wir wissen noch immer nicht, ob die Ortung so wichtig ist. Es könnte auch ein Artefakt sein!«
»Yakama hat das abgestritten. Und außerdem – schauen Sie sich die Daten doch bitte genauer an! Ein Artefakt mit eigener Energiesignatur und …«, Haark kontrollierte die laufend einströmenden Daten, »… mit Beschleunigung?«
Lüthannes hatte offenbar einen Blick auf seine eigenen Anzeigen geworfen und nickte vorsichtig. Er musste keine Rücksprache mit dem Gouverneur halten. Als Terminaldirektor gehörte ihm alles, was sich außerhalb der Atmosphäre im Orbit befand. Schließlich hatte er seine Entscheidung getroffen.
»Ich sende Ihnen die Codes, Capitaine!«
Dann verschwand das Gesicht des Mannes vom Schirm.
Beck starrte Haark erwartungsvoll an. Er konnte seinem Kommandanten die Verwirrung förmlich von den Gesichtszügen ablesen. Ein eigengetriebenes, energetisch aktives Etwas aus der entgegengesetzten Richtung der Brücke? Das hörte sich ausgesprochen absurd an. Der naheliegendste Gedanke war damit gleichzeitig der verwegenste, und schließlich sprach der erste Offizier ihn aus.
»Capitaine, das könnte ein Erstkontakt sein«, flüsterte Beck. Haark erwiderte seinen Blick.
»Absurd«, murmelte er. »Das ist noch nie passiert.«
Seit über 400 Jahren besiedelte die Menschheit den interstellaren Raum. Sicher, bisher hatte man nur einen winzigen Bruchteil des eigenen Spiralarmes erforscht, aber Hinweise auf intelligentes, außerirdisches Leben hatten sich nie gefunden. Unbeseelte Fauna und Flora war reichlich vorhanden, doch nichts, was über die natürliche Schläue einer großen Raubkatze oder eines Meeressäugers hinausging. Im Grunde hatte sich die Menschheit mehr oder weniger mit dem Gedanken abgefunden, dass der Funke der Evolution intelligenten Lebens nur sehr selten gezündet haben musste. Haark war da keine Ausnahme, und so war für ihn die Vermutung Becks eher schwer zu verdauen. Auch hatte er nicht gewusst, dass sein Erster Offizier zu den Träumern gehörte, die so was für möglich hielten.
»Es musste einmal passieren«, kommentierte Beck. »Wir müssen damit umgehen.«
Nun, der Träumer hatte derzeit gute Argumente auf seiner Seite.
»Capitaine Esterhazy wird damit umgehen«, stellte Haark richtig, »sobald wir Kommunikation etabliert haben. Bis wir seine Befehle kennen, werden wir verfahren wie beschrieben. Ich denke immer noch, dass es eine andere Erklärung für das Phänomen geben muss.«
Beck nahm dies schweigend zur Kenntnis.
Haark reckte sich hoch, hielt einen Moment inne, dann seufzte er.
Seine Hand drückte sacht auf den Alarmknopf.
Als das jammernde Geräusch der Sirene durch die Malu wimmerte, klang es wie das Gemecker einer alten Xanthippe, die man aus dem Schlaf gerissen hatte.
Haark wurde klar, dass er dieses Geräusch gleichermaßen vermisst wie auch gefürchtet hatte.
Fußgetrappel ertönte. Verschlafene Gesichter im Schotteingang. Unausgesprochene Fragen blieben nach einem Blick auf Haarks Gesicht unausgesprochen. Es war unvermittelt klar, dass dies keine Übung war.
Stechender Alkoholgeruch stieg in Haarks Nase, als Signalmaat Sergent Fujikawa seinen Posten am Kommunikationspult einnahm. Fujikawa war ein heftiger Trinker, wie so viele an Bord dieses Schiffes. Haark traute ihm mehr zu, wenn er voll war, als wenn er nüchtern seinen Dienst verrichtete. Es schien, als wäre für den Sergenten der Alarm zur rechten Zeit gekommen. Seine Augen glitzerten unternehmenslustig und sein Gruß, als Haark ihm zunickte, war fast zackig.
»Die Codes vom Terminal«, meldete Beck. Lüthannes hatte sein Versprechen schnell eingelöst. Beck wusste, was zu tun war. Haark setzte sich wieder auf seinen Sessel und nahm die Klarmeldungen der Stationen entgegen, die tröpfchenweise eintrafen. Möglicherweise rächte sich jetzt, dass er die regelmäßigen Alarmübungen vernachlässigt hatte. Andererseits … Haark kalkulierte kurz … das fremde Objekt war selbst bei maximaler Beschleunigung gute fünf Tage entfernt. Kein Grund zur Eile.
Er nahm Verbindung zur Küche auf.
»Tijden?«
»Yessir!«