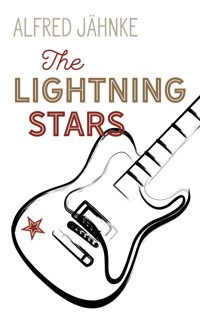
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Warum springt ein Schlagzeuger aus dem Fenster, während seine Band spielt? Alfred Jähnke (englisch ausgesprochen AJ) beschreibt in seinem Erstlingswerk mit Humor und Ironie die Gründung und den Werdegang einer Band in den sechziger Jahren. "The Lightning Stars" gab es wirklich. Fünf Jungs brachen 1965 auf, um es den Beatles gleich zu tun. Durchdrungen vom Beat der Zeit, gestaltete sich das Leben auf dem Gymnasium zum Kampf ums Überleben. Eine Autobiographie zum Schmunzeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Jähnke wurde 1950 an einem eiskalten Januartag in der Pfalz geboren. An seinem Geburtstag brachte ein Nachbar die hochschwangere Mutter in einem gestohlenen Auto ins Krankenhaus. Dies war sein erster Kontakt, noch pränatal, mit dem organisierten Verbrechen. Es sollte bis heute auch sein einziger bleiben.
Bei der Konfirmation 1964 bekam er zwei Geschenke, die sein Leben verändern, eine alte Wandergitarre und die Beatles-LP »With The Beatles«.
Ab diesem Zeitpunkt war nichts mehr, wie es war.
Er beschreibt in einer Autobiografie die Entstehung und den Werdegang einer Band in den sechziger Jahren mit dem Namen »The Lightning Stars«.
Darüber hinaus schildert er mit viel Humor und Ironie seinen »Kampf ums Überleben« an einem Gymnasium, das er überraschend mit dem Abitur in der Tasche 1970 verlässt.
Er studiert Biologie und Sport für das Lehramt, hinterlässt an jedem Gymnasium seine musikalische Spur und bleibt in seiner Freizeit über fünfzig Jahre lang der Bühne treu.
Heute lebt er in Ettlingen.
»Music Was My First Love.«
Disclaimer
Manche Begriffe oder Handlungen, die in diesem Buch auftauchen, sind ein Produkt ihrer Zeit und somit in einem zeitlichen Kontext zu sehen.
Inhaltsverzeichnis
Intro
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Epilog
Outro
Intro
Ich danke Max, Walter, Hans und Gerd für die Illusion, einmal weltberühmt zu werden.
Dank auch an Onkel Edwin. Ohne ihn hätte es The Lightning Stars so nicht gegeben.
Leider kann er das Buch nicht mehr lesen.
Kapitel I
Es war ein heißer Nachmittag im Juli und ich stand im Schatten der mächtigen Trauerweide, die schräg gegenüber dem Haus meiner Großeltern wuchs. Eigentlich umhüllten mich die tief herabhängenden Zweige des Baums wie eine grüne Glocke. Es roch modrig. Mit Ungeduld wartete ich an diesem Treffpunkt auf meine Freunde. Es waren gleichaltrige Jungs, die in meiner Nachbarschaft wohnten. Mit ihnen wollte ich mal wieder in die Schlacht ziehen. Wollte wieder im ungleichen Kampf meinen roten Brüdern gegen die Armee der weißen Unterdrücker und Eroberer beistehen. Der Schauplatz solcher Schlachten war jedoch nicht die weite Prärie Nordamerikas, sondern das kleine Wäldchen in der Nähe unseres Dorfes. Kiefern und Robinien bildeten die vorherrschenden Bäume in diesem kleinen WaId. Er war durchsetzt mit allerlei Büschen und Hecken, die eine hervorragende Deckung für unser Gefecht boten. In letzter Zeit richtete sich aber unser Kampf nicht gegen die Armee der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern gegen die vier Jungs einer zugezogenen Familie, die mehr oder minder in unserem Alter waren. Sie wohnten vorübergehend in einem Bahnwärterhäuschen am Rand des Kiefernwäldchens, das durch die Bahnlinie durchschnitten wurde. Theo, unser Anführer, war ein brutaler Schläger und stets an der Front unserer kleinen Gruppe zu finden. Er hatte keine Angst und wurde von allen Jungs gefürchtet. Es kam oft vor, dass er mit einem Holzprügel, den er immer in seiner Hand trug, rücksichtslos auf andere einschlug. Er war jähzornig und mir höchst unsympathisch.
Ich wartete weiter unter der schattenspendenden Trauerweide, um der brütenden Sommerhitze zu entgehen. Eigentlich wäre jetzt Schwimmen am nahe gelegenen Baggersee viel schöner. Aber Theo hatte gerufen und so wollten wir uns heute treffen. Bisher zeigte sich niemand. Gelangweilt stand ich herum, als ich durch die hängenden Zweige des Baums ein grünes Herrenfahrrad um die Ecke rasen sah. Auf dem Fahrrad stand ein Junge in meinem Alter, vornübergebeugt in windschnittiger Stellung. Er war mir völlig unbekannt. Was mir auffiel, waren seine glatten grünen Lederhosen. Vor vielen Jahren musste ich auch Lederhosen tragen, aber die waren aus rauem graugrünem Leder. Sie hatten vorn einen großen Latz, den man an zwei Hirschhornknöpfen auf- oder zumachen konnte. Durchaus praktisch beim Weitpinkel-Wettbewerb mit meinen Freunden. Doch diese Knabenkluft war fast vergessen. Jetzt trug man stolz die begehrten Bluejeans. Das Fahrrad schoss in vollem Tempo das Tiefgestade in Richtung Baggersee hinab. Gekonnt nahm der Fahrer die steile Linkskurve in den Hof des letzten Hauses. Dort lag eine Schicht aus Kies und somit war dieses rasante Manöver nicht ungefährlich. Respekt!
Meine Freunde trotteten langsam ein, und in der Absicht, den Neuen aufzulauern, versteckten wir uns in den Furchen eines Spargelackers, der zwischen dem Wäldchen und dem Bahnwärterhäuschen lag. Doch es blieb ruhig und der Feind ließ sich an diesem Tag nicht blicken, was mir gerade recht war. Deshalb zogen wir uns zurück und der Vorschlag, den Rest des heißen Sommertags am Baggersee zu verbringen, wurde dankbar angenommen.
Es war eine schöne und beschauliche Zeit damals. Meine Eltern und ich wohnten in einer kleinen Wohnung mitten im Dorf. Vom ersten Stock aus konnte ich das Treiben in unserer Straße beobachten und verpasste kein Fußballspiel meiner Freunde. Die Matches fanden auf den großen Pflastersteinen der Straße statt. Das Ende eines solchen Spiels wurde nicht von einem Schiedsrichter bestimmt, sondern durch den Ruf meiner Mutter zum Abendessen. Ein eigenes Zimmer hatte ich nicht und schlief deshalb auf einer Couch im Wohnzimmer. Die Sommertage zu dieser Zeit waren oft sehr heiß. Manchmal, wenn die Hitze kaum zu ertragen war, schickte mich meine Mutter am Abend zu einer nahen Wirtschaft, um in einer ausgebeulten Blechkanne Bier zu holen. Es war ein kühlendes Zugeständnis an meinen Vater. Auf dem Weg zu dem alten Gasthaus nahm ich die Abkürzung durch einen Garten und eine Scheune. Das letzte Stück durch das halbverfallene Gebäude war mir, gerade in der Dämmerung, etwas unheimlich. Die Wände des Wirtshauses waren mit dunklem Holz versehen und gaben dem Raum eine düstere Atmosphäre. Auf diesen Holztafeln lag eine Patina aus Fett und Staub und es muffelte nach abgestandenem Bier und Schweiß. Die alte Wirtin, immer mit einem schwarzen langen Rock bekleidet, füllte meine Milchkanne zweckentfremdend mit Bier und beugte sich dann ächzend und mit schmerzverzerrtem Gesicht in den unteren Bereich der Theke. Dort öffnete sie ein Fach mit Trockeneis. Sie schlug mit einem Hackebeil ein Stück Eis ab und gab es in die Kanne. Der Eisbrocken schwamm wie ein kleiner Eisberg im weißen Bierschaum. Der Anblick erinnerte mich stets an eine Polarlandschaft. Eine gedankliche Abkühlung in der Hitze des Sommers. Nur die Eisbären fehlten, aber die gab es wohl auch nur in meiner Fantasie. Auf dem Heimweg schleuderte ich die Kanne am Henkel durch die Luft und freute mich, dass aufgrund der Zentrifugalkraft das Bier in der Kanne blieb. Zwischen meinen physikalisch ausgerichteten Darbietungen nahm ich immer wieder einen kräftigen Schluck aus der Kanne. Dadurch, dass das Eis auf dem Weg schmolz, wurde mein kleiner alkoholischer Wegzoll nicht sichtbar und ich schlenderte stets sehr langsam nach Hause. Ich sehe noch heute das Bild vor mir, wie mein Vater mit schweißbedecktem nackten Oberkörper gierig das Bier hinunterkippte.
Samstags wurde in einer großen Zinkwanne gebadet. Meine Mutter schürte einen Kessel, der in der Waschküche stand, um genügend warmes Wasser für die Wanne zu haben. Ich hatte das Privileg, als Erster zu baden, dann kam meine Mutter und zum Schluss mein Vater. Dazwischen wurde warmes Wasser in die Wanne nachgegossen. Anschließend wurde das Badewasser einfach in die Ablaufrinne vor dem Haus gekippt. Danach durften meine Tante und mein Onkel die Wanne benutzen, natürlich mit frischem Wasser. Sie wohnten im Erdgeschoss desselben Hauses. Ich wartete immer, bis meine Tante an der Reihe war. Dann ging ich zur Toilette, die sich ganz hinten im Hof befand. Der Weg führte an der Waschküche vorbei und ich hoffte immer, dass ich meine Tante beim Baden beobachten konnte. Aber jedes Mal waren die Fensterscheiben beschlagen, und das war Pech.
Im Sommer wurde das wöchentliche Wannenbad an den Baggersee verlegt. Meine Mutter packte Seife und Shampoo in die Tasche, schnappte sich das alte Fahrrad und natürlich auch mich. So fuhren wir, der Gepäckträger war als Sitz sehr unbequem, zum Kiesloch, wie wir den Baggersee auch nannten. In der Rheinebene waren die tieferen Bodenschichten voller Kies, und sobald man diesen Kies herausbaggerte, entstand ein See, da der Grundwasserspiegel durch den Rhein sehr hoch war. Einige Besitzer dieser Baggerfirmen machten also mit Kies ihren Kies. Am See angekommen, wurde ich mit Kernseife von Kopf bis Fuß eingeseift. Gelangte die Seife in die Augen, so brannte dies fürchterlich. Danach kamen die Haare dran. Der anschließende Tauchsprung war sehr befreiend. Da ich am und im Wasser des Sees aufgewachsen bin, konnte ich schon sehr früh schwimmen und tauchen. Deshalb wurde ich über die vielen Jahre eine richtige Wasserratte. Das Sternbild des Wassermanns, in dem ich geboren wurde, tat sein Übriges. Nomen est omen!
Meine Tante hatte keine Kinder und so besaß ich zwei Mütter, was in manchen Situationen ganz praktisch war. Wenn es bei uns zum Essen ein Gericht gab, das ich nicht mochte, schaute ich bei meiner Tante vorbei. Gab es dort etwas Leckeres, so setzte ich mich an den Tisch und aß mit meiner Tante und meinem Onkel. Sie besaßen auch einen der ersten Fernseher im Dorf. So durfte ich manchmal nach etwas Bitten und Betteln vor die Glotze. Wurde ein Fußballspiel übertragen, so kamen die Männer der Nachbarschaft und das Wohnzimmer war überfüllt. Manche Nachbarn brachten sogar ihre Stühle mit.
Besonders am Samstagnachmittag lehnten die Leute sich auf einem Kissen aus dem Fenster und blickten zur Straße hinaus. Einige stellten ihre Stühle vor das Hoftor und hielten untereinander einen Plausch. Bemerkungen dazu kamen auch von den oberen Stockwerken. Es wurde viel erzählt und gelacht. Wir Jungs spielten Federball oder Fußball auf der Straße und so manch Erwachsener schwang mit uns den Schläger oder spielte mit uns den Ball. Der geringe Autoverkehr ließ dies ohne Gefahr zu. Das Kaffeetrinken wurde am Samstagnachmittag regelrecht zelebriert und oft hatte meine Mutter einen Kuchen gebacken. Manchmal sangen meine Eltern im Duett. Es waren Lieder aus der erst vor wenigen Jahren zu Ende gegangenen politischen Ära und die fest geschlossenen Reihen, die schwarzbraune Haselnuss oder das Polenmädchen wären heute als Liedgut ziemlich unangebracht. Oft lief das Radio und ein Unterhaltungsprogramm aus irgendeinem »großen Sendesaal« trug zur guten Stimmung bei. Eine friedliche Harmonie und Zufriedenheit lag über der Familie.
Manchmal kam meine Patentante aus der Großstadt zu Besuch. Sie wurde einmal von ihrer Freundin begleitet, mit der ich mein Bett teilen musste oder durfte. Ich hatte mich gleich in diese reife Frau verliebt. Es wurde eine wunderbare Nacht zwischen Traum und Wirklichkeit. In diesem Zustand wurde ich von dieser Frau in die Geheimnisse der Sexualität regelrecht eingeführt. Noch heute, nach so vielen Jahren, weckt ein dunkelblaues Sommerkleid mit großen weißen Punkten eine gewisse erotische Erinnerung und Stimmung in mir. Ich denke oft mit Wehmut an diese Nacht. Aber eine Wiederholung gab es leider nie mehr.
Das Dorf zählte in dieser Zeit gerade mal knapp zweitausend Einwohner.
Der allergrößte Teil dieser Bewohner war katholisch. Ich war protestantisch und lebte somit in der Diaspora. Meine Mutter war eine tragende Säule der religiösen Minderheit und hatte sich bezüglich der Konfessionen einen trotzigen Stolz bewahrt. Kehrten unsere Nachbarn am Karfreitag die Straße, so wurden an Fronleichnam in unserem Hof lautstark die Teppiche geklopft. Aber sonst lebte man in Ruhe und Frieden zusammen. Aufgrund der großen Gottesgläubigkeit meiner Mutter musste ich fast jeden Sonntag in den Gottesdienst. In unserer kleinen Kirche saßen Frauen und Männer getrennt. Vom Altar her gesehen auf der rechten Seite die Frauen, links die Männer. In den vorderen Bänken waren die Plätze für die Kinder und Jugendlichen, natürlich auch in einer trennenden Anordnung bezüglich des Geschlechts. Sie sollten Gott wahrscheinlich ganz nahe sein. Für mich war der Gottesdienst außerordentlich langweilig, besonders wenn unser alter Dekan predigte. Er fand kein Ende. Sehnsüchtig wartete ich auf das erlösende Amen, das er immer in die Länge zog, als ob er damit nochmals Zeit schinden wollte, um seine Schäfchen in der Kirche zu halten. Nach jeder kleinen Pause erhoffte ich das Ameeen und somit das erlösende Ende. Die Interpretation von Gottes Worten erreichte mich schon bald nach dem Beginn der Predigt nicht mehr. Verstohlen blickte ich auf die andere Seite, und beim Anblick der Mädchen füllte sich mein Kopf mit unkeuschen Gedanken. Je mehr ich mich dagegen wehrte, umso erotischer wurden meine Fantasien. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, schließlich befand ich mich im Hause Gottes. Aber der Teufel lag fast jeden Sonntag auch in der Kirche auf der Lauer und lenkte mich vom Prediger ab. Irgendwann rettete mich dann doch ein langgezogenes Amen vor der Hölle. Dieses langgezogene Amen kam in der Schule beim Religionsunterricht durch einen Klassenkameraden einmal zu früh und zu laut. Dieses fremdbestimmte vorlaute Ende kostete die Existenz eines Gesangbuchs, das ein erboster Mann Gottes auf dem Kopf dieses Schülers zerfledderte. So kam manch religiöses Wissen in und auf unsere Köpfe. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Mitschüler zum Märtyrer und zu unserer Ikone glorifiziert. Jahrelang machte dieser Vorfall die Runde. In der Kirche kam es leider nie zu einem solchen Zwischenfall. Es hätte den langweiligen Gottesdienst zweifellos etwas aufgelockert.
Obwohl: An Heiligabend war die Länge der Predigt von einer gewissen Spannung begleitet. Der Pfarrer verfiel angesichts der vollen Kirche in eine besonders lange Predigt. Die Spannung brachten nicht die Worte Gottes, sondern das Abbrennen der Kerzen am Weihnachtsbaum. Die Flammen näherten sich jedes Mal bedrohlich den trockenen Zweigen. Mit Spannung wartete ich auf das Feuer und das Chaos, das in der Kirche ausbrechen würde. Ich war in freudiger Erwartung. Doch in all den Jahren kam das Ende der Predigt gerade noch rechtzeitig. Ich wurde wieder mal enttäuscht. In den letzten Jahren wurden von uns Jungs vor dem Gottesdienst Wetten abgeschlossen, ob es zum Brand kommt oder nicht. Die Kerzen heimlich zu kürzen wurde von den meisten meiner Freunde aus Gottesfurcht verworfen. So viel Macht wollte man dem Teufel doch nicht zugestehen.
Kapitel II
An einem Sonntag traf ich dann den Neuen auf der Kirchenbank, die uns geschlechtsspezifisch und altersgemäß zustand und uns näherbrachte. Er hatte seine kurzen Lederhosen in schwarze Stoffhosen getauscht. Die Langeweile umhüllte uns beide und beim Amen war nicht nur mein erlösendes Aufatmen zu hören. Das führte gleich zu einer gewissen Solidarität. Auf dem Kirchenvorplatz traf ich Maximilian. Er sprach hochdeutsch, was sich in vielen Bereichen noch nach Jahren als enormer Vorteil herausstellen sollte. Natürlich nannte ihn in unserer Gegend niemand Maximilian, sondern Max. Er war einen Monat jünger als ich und kam aus dem Harz, wo immer der auch lag. Seine schmale Gesichtsform erinnerte mich gleich an John Lennon und aus diesem Gesicht ragte eine große Nase hervor. Er war etwas größer als ich und von einer schlanken Körperfigur. Wie er die bei seinem mächtigen Appetit behielt, war mir immer schleierhaft. Endlich traf ich einen gleichaltrigen Jungen, der auch protestantisch war. Mit der Zeit wurde unser freundschaftliches Band immer fester. Wir teilten die Langeweile des Gottesdienstes und vielleicht so manchen unkeuschen Gedanken.





























