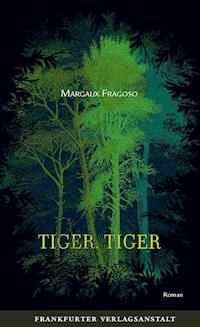
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
An einem Sommertag in einem öffentlichen Freibad trifft Margaux Fragoso auf Peter Curran, der mit seinen Stiefsöhnen dort ist, und fragt, ob er mit ihr spielen will. Sie ist sieben, er 51. Als sie einige Zeit später mit ihrer Mutter in sein ungewöhnliches Haus eingeladen wird, findet das Mädchen dort ein zauberhaftes Kinderparadies vor, voller seltsamer Haustiere, Bücher, Musik und magischer Spielzeuge. Margaux' Mutter ist liebevoll, aber vom Alltag überfordert und psychisch krank. Immer mehr überlässt sie Peter in fataler Verkennung dessen, was vor ihren Augen geschieht, ihre Tochter. Bald will Margaux ihre gesamte Zeit bei Peter verbringen, der eine ganze Welt für sie erschafft - ganz so wie Lewis Carroll es für Alice getan hat. Ihre Beziehung entwickelt sich schnell vom Unschuldigen zum Illegalen. Mit der Zeit erschleicht sich Peter die Rolle von Margaux' Spielkameraden, wird zu ihrem Vater, dann zum Liebhaber und Eroberer. Charmant und abstoßend, warmherzig und gewalttätig, liebevoll und manipulativ dringt Peter in jeden Bereich von Margaux' Leben ein und verwandelt sie von einem vor Phantasie und Gefühl sprühenden Mädchen in eine jung-alte Frau am Rande des Suizids. Die Umwelt wird auf das ungleiche Paar aufmerksam, doch alle Erkundungen von außerhalb verlaufen im Sand. Als sie 22 ist, ist es Peter, der sich, gequält von der Angst, sie zu verlieren, mit 66 Jahren das Leben nimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margaux Fragoso
TIGER, TIGER
Roman
Aus dem Amerikanischen von Andrea Fischer
Für Edvige Giunta,
die den Samen hegte und pflegte
Für John Vernon,
der ihn geduldig erntete
»Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?«
William Blake, The Tiger
»Tiger, Tiger, grelle Pracht
In den Dickichten der Nacht:
Wes unsterblich Aug und Hand
Wohl dein furchtbar Gleichmaß band?«
William Blake, Der Tiger
»Tell me, Lord, how could you leave a lass so lone
so long that she could find her way to me?«
Toni Morrison, The Bluest Eye
»Sag mir, Herr, wie durftest Du ein
kleines Mädchen so lange allein lassen,
daß es seinen Weg zu mir finden konnte?«
Toni Morrison, Sehr blaue Augen
Inhalt
Prolog
Erster Teil
»Kann ich mit dir spielen?«
Das zweistöckige Haus
Eine schlechte Angewohnheit
Wilde
Höher, höher
»Das schönste Alter für ein Mädchen ist acht Jahre«
Karen, meine Schwester, meine Schwester
»Nur wenn du das willst«
»Es ist nicht falsch, dich zu lieben«
»Mit diesem Mann stimmt etwas nicht«
Punkt, Punkt, Komma, Strich
Das geblümte Nachthemd
Unser kleines Geheimnis
Zweiter Teil
Das Wiedersehen
Die Mitgift
Cathy und Paul
»Rescue Me« – Rettet mich
Nina
Der Wasserfall
»Das war der Teufel in mir«
Pretty Babies
Ein Bund fürs Leben
Die Beichte
Ein Fremder im Spiegel
Der Aussteiger
Die Frau im Baum
Der Vertrag
»Wie des Tigers Satz«
Dritter Teil
Rivalen
Das geliehene Geld
Das Erbe
Nachwort
Danksagung
Impressum
Über die Autorin
Prolog
Ich begann, dieses Buch im Sommer nach dem Tod von Peter Curran zu schreiben, den ich mit sieben Jahren kennenlernte und mit dem ich fünfzehn Jahre eine Beziehung hatte, bis er im Alter von sechsundsechzig Selbstmord beging.
In der Hoffnung, dem, was geschehen ist, einen Sinn zu geben, habe ich die Geschichte meines Lebens aufgezeichnet. Selbst wenn ich nicht an ihr arbeitete, wenn sie nur in einem Fach meines Wandschranks lag, überfiel mich täglich um Punkt zwei Uhr nachmittags die Verzweiflung und erinnerte mich an das Geschehene, denn das war die Zeit, wenn Peter mich zu unserer täglichen Spazierfahrt abholte. Dieselbe Verzweiflung quält mich noch heute um fünf Uhr nachmittags, dann, wenn ich ihm immer, den Kopf an seiner Brust, etwas vorlas. Um sieben Uhr abends, wenn er mich in den Arm nahm, und schließlich um neun Uhr, wenn wir zu unserer abendlichen Rundfahrt aufbrachen: zuerst auf dem Boulevard East in Weehawken, dann zur River Road und anschließend hinunter zum Imbiss Royal Cliffs, wo ich einen Becher Kaffee mit viel Sahne und exakt sieben Stück Zucker und einen Brotpudding mit Rosinen und Schlagsahne kaufte oder, wenn Peter etwas anderes wollte, einen Reisauflauf. Wenn ich wieder im Wagen war (dem Granada, dem Cimarron, dem Escort oder dem schwarzen Mazda), wendete er, und wir fuhren über die River Road und den Boulevard East zurück, vorbei an den teuren Häusern im viktorianischen oder neogotischen Stil, blickten über den Hudson River hinüber zu den Lichtern der Wolkenkratzer, die wie tausend Spiegel funkelten, und manchmal hielten wir an und beobachteten ein Gewitter.
In einem seiner Abschiedsbriefe schlug Peter mir vor, ich solle meine Erinnerungen an unser gemeinsames Leben niederschreiben – eine völlig abwegige Idee. Denn unser Leben, unsere gemeinsame Welt hatten ja nur durch Heimlichkeiten bestehen können; hätte man uns unsere Lügen und unsere Geheimsprache, unsere Blicke, Symbole und Verstecke genommen, hätte man uns alles genommen. Und wäre mir das im Alter von zwanzig oder fünfzehn oder zwölf passiert, ich hätte mich vielleicht umgebracht, und niemand mehr hätte von dieser kleinen Insel erfahren können, die aus Lügen und geheimer Sprache, aus versteckten Blicken, Symbolen und Lieblingsorten bestand. Wenn man all diese Geheimnisse zusammen nahm, hätte man den Universalschlüssel gehabt, doch fragen Sie einen Schlosser, ob es den Universalschlüssel gibt, der jedes Schloss der Welt öffnen kann, er wird es verneinen. Allerdings ist es durchaus möglich, einen Schlüssel herzustellen, der in einem bestimmten Gebäude sämtliche Türen öffnet. Die Schlösser sind dann so konstruiert, dass der sogenannte Generalschlüssel in alle passt; einen Schlüssel für jedes schon existierende Schloss zu entwerfen ist hingegen nicht möglich. Peter wusste das, weil er einmal einen Generalschlüssel für ein Krankenhaus angefertigt hatte; er hatte sich das selbst beigebracht, hatte erst abends das Handwerk in Bibliotheken studiert und dann, nachdem er sich in eine Anstellung geblufft hatte, entsprechende Erfahrungen in der Praxis gesammelt.
Stellen Sie sich ein ungefähr siebenjähriges Mädchen vor, das die roten Kugeln aus dem Kaugummiautomaten mag, aber die blauen und grünen nicht anrührt, ein Kind, dessen Turnschuhe keine Schnürsenkel, sondern Klettverschlüsse haben, ein Kind, dessen Beine sich um das metallene Pferdchen im Einkaufszentrum Pathmark klammern, nachdem ein Vierteldollar eingeworfen wurde. Ein Mädchen, das Angst hat vor den Jokern im Kartenspiel und deshalb verlangt, dass sie vor dem Spielen herausgenommen werden, das seinen Vater fürchtet und keine Puzzles mag (zu langweilig!), ein Kind, das Hunde, Kaninchen, Leguane und Wassereis liebt, das gerne hinten auf dem Motorrad mitfährt, denn welches siebenjährige Kind darf das schon? Ein Mädchen, das nie nach Hause gehen will, weil Peters Haus wie ein Zoo ist, und vor allem, weil es lustig ist bei Peter, weil Peter genauso ist wie sie, nur größer, und Dinge kann, die sie nicht beherrscht.
Vielleicht war ihm bekannt, dass sich die Zellen des menschlichen Körpers alle sieben Jahre erneuern und in jedem Zyklus aus den bisherigen Atomen einen neuen Menschen hervorbringen. Man könnte sagen, dass dieser Mann, also Peter, im Verlauf der nächsten sieben Jahre die sprießenden Zellen dieses Kindes neu programmierte. Aufmerksam prägte er sich ein, wie man dem Mädchen Freude bereiten konnte, folgte der deutlichen Spur seiner stillen Wünsche: Vanilleeis mit Orangenüberzug, wie ein Junge ohne Oberteil herumlaufen, sich von einer niedlichen rosa Hundezunge durchs Gesicht lecken lassen und einem Kaninchen zusehen, das frisches Grün mümmelt. Später lernte Peter gewissenhaft die Texte von Madonna auswendig und wusste die Titel von zwanzig Nirvana-Liedern.
***
Als ich vier Monate nach Peters Tod eine Justizvollzugsbeamtin namens Olivia für einen Artikel meiner Collegezeitschrift in ihrer Wohnung, einem Einzimmerapartment in der Nähe des Journal Square im Zentrum von Jersey City, interviewte, und wir Kamillentee tranken und zu plaudern begannen, erwähnte ich, dass ich an einem Buch schreiben würde. Sie wollte wissen, wovon es handelte, und ich erklärte, es gehe darin um einen Pädophilen. Aber es sei nur der erste Entwurf, die Rohfassung. Dann fragte ich die Beamtin, ob sie in ihrem Beruf mit Pädophilen zu tun habe.
»Mit Pädophilen? Klar. Das sind die nettesten Insassen.«
»Nett?«
»Ja. Nett, höflich, machen keinen Ärger. Sprechen einen immer mit ›Miss‹ an, antworten freundlich mit ›Ja, Ma’am‹ oder ›Nein, Ma’am‹.«
Angesichts dieser Gelassenheit von Olivia spürte ich den Drang, weiterzureden.
»Ich habe gelesen, dass Pädophile ihre Taten vor sich selbst rechtfertigen, indem sie sich einreden, alles fände in gegenseitigem Einvernehmen statt, obwohl sie ja in Wirklichkeit Zwang ausüben.« Ich hatte das in meinem Lehrbuch der klinischen Psychologie gelesen, und es hatte mich erschüttert, weil es so exakt Peters Denkweise widerspiegelte. Die nächste Erkenntnis stammte jedoch aus keinem Buch, auch wenn ich das behauptete: »Ich habe auch gelesen, dass es für ein Kind wie ein Drogenrausch sein kann, mit einem Pädophilen zusammen zu sein. Ein Mädchen hat einmal gesagt, es wäre, als würde der Pädophile in einer Zauberwelt leben, und diese Magie würde alles überlagern. Es sei so, als ob der Erwachsene selbst ein Kind wäre, nur dass er ein Wissen besitzt, das Kindern nicht zur Verfügung steht. Pädophile Menschen haben mehr Fantasie als Kinder, deshalb können sie Welten erschaffen, die Kinder nicht einmal erträumen können. Sie haben die Gabe, die wirklich existierende Welt für das Kind irgendwie ekstatisch zu überhöhen. Und wenn das dann vorbei ist, also wenn die Welt wieder normal wird, ist das für einen Menschen, der so etwas erlebt hat, wie ein Heroinentzug. Jahrelang ersehnt er das vertraute Gefühl zurück. Ein Mädchen sagte, es sei so, als wäre die Erde verbrannt und kein Gras würde mehr wachsen. Der Boden sei schwarz und öde, doch tief im Innern würde es noch brennen.«
»Wie traurig«, sagte Olivia und sah so aus, als meinte sie es auch.
Nach einer unbehaglichen Gesprächspause kamen wir auf andere Insassentypen und die allgemeinen Erfahrungen im Strafvollzug zu sprechen. Während des Interviews wurde mir allmählich übel, ich fühlte mich von der Umgebung bedroht, von der warmen Küche, die anfangs so einladend gewirkt hatte. Meine Wahrnehmung war schon immer verstörend scharf, eine Folge der vielen Jahre ohne soziale Kontakte zu der Welt außerhalb der einen, die ich mit Peter teilte.
An jenem Tag in Olivias Küche fühlte ich mich, als sei etwas in mir aufs Äußerste gespannt, als sei die Welt auf höchste Lautstärke gestellt worden und brülle mich an.
***
Ich wuchs auf in Union City, New Jersey, angeblich die am dichtesten bevölkerte Stadt der USA. Man kann sie sich nicht richtig vorstellen, es reicht nicht, nur von den schalen, harten Frühstücksbrötchen, den puppentassengroßen Espressobechern oder den langen teigig-süßen Churros zu reden, genauso wenig wie Sie ein Gefühl für Manhattan bekommen, wenn Ihnen jemand nur vom Schisch-Kebab-Stand bei der Port Authority, dem Strand Book Store mit seinen kilometerlangen Bücherregalen oder von den Skateboardern im Washington Square Park erzählt.
Man kann versuchen, sich die Tauben, Bars und Night-Clubs (geschrieben »Nite-Clubs«) von Union City vorzustellen, die jungen »Hoods«, deren um die Knie schlackernde Baggy-Hosen den Blick auf ihre Boxershorts freigeben, man kann sich ein Bild von den Stoßstange an Stoßstange geparkten Autos machen, von der schon absonderlichen Enge mancher Gassen, wo gerne mal der Außenspiegel von einem vorbeifahrenden Lkw abgebrochen wird. Man hört die Zischlaute von Männern jeglichen Alters beim Anblick jedes weiblichen Wesens über zwölf Jahren, man sieht Obstverkäufer mit den billigen Papayas, Mangos und Avocados in ihrer Auslage (mein Vater, ein Avocado-Fan, behauptete immer, sie würden zu ewigem Leben verhelfen), man sieht die unzähligen schwarz gewordenen Kaugummis im rissigen Beton der Bürgersteige. Es ist nicht ungewöhnlich zu hören, wie Kinder im Chor singen: »Trittst du auf die Spalten, sterben deine Alten!«, und da ich abergläubisch war wie mein Vater, mied ich die Risse sorgfältig, was kompliziert war, weil sie den Beton in Zickzacklinien durchzogen wie Wasserläufe eine zerknitterte Landkarte. Ebenso vorsichtig vermied ich es, auf meinen Schatten zu treten, weil ich Angst hatte, meine eigene Seele zu beschädigen.
Wer Union City besucht, sollte sich auf jeden Fall vor dem Geflügelmarkt Polleria Jorge auf der 42nd Street zwischen New York Avenue und Bergenline Avenue die Nase zuhalten, so stinkt es da. Überquert man die Straße an der Stelle, wo sich zeit meines Lebens das Schuhgeschäft Panda befand, gelangt man zu El Pollo Supremo: Dort empfängt einen wie das Elixier des Atlantiks der freundliche Geruch von Brathähnchen, köchelnder Yucca, schwarzem Reis mit schwarzen Bohnen und frittierten Kochbananen. Peter und ich gingen dort immer essen, und an einem feuchten Halloweenabend während der zwei Jahre, als meine Eltern uns voneinander trennten, hockte er dort in einer einsamen Sitzecke und starrte acht Stunden lang aus dem verregneten Fenster, in der Hoffnung, einen Blick auf mich zu erhaschen, wenn ich mit meiner Mutter von Tür zu Tür zog.
***
Ich besitze noch immer zwölf Spiralblöcke mit datierten Briefen, einen für jeden Tag, die jeweils mit den Worten »Liebe Prinzessin« beginnen. Peter machte ein X für einen Kuss und ein O für eine Umarmung. In jedem Brief brachte er IDADULDFI unter, die Abkürzung von »Ich Denke An Dich Und Liebe Dich Für Immer«. Ich habe sieben Videos, ebenfalls sämtlich datiert, mit Titeln wie Margaux fährt Rollschuh oder Margaux mit Paws oder Margaux winkt hinten auf dem Motorrad.
Diese Videos sah sich Peter gegen Ende seines Lebens tagtäglich an: Margaux, die sich mit dem Hund Paws auf der Erde wälzt, die auf der Couch Verbrecher spielt, die aus einer Baumkrone winkt, die einen Luftkuss herüberschickt. Jetzt sieht sich niemand mehr Margaux an. Sogar Margaux selbst langweilt der Anblick von Margaux mit Stirnband, Margaux mit abgeschnittener Jeans, Margaux mit nassem Haar, Margaux vor dem Götterbaum, an dem früher die weiße Hängematte hing.
Ich war Peters Religion. Niemand sonst würde sich für die zwanzig Alben mit den Fotos von mir interessieren: ich allein, mit Paws, mit Karen oder mit meiner Mutter. Das Holzkästchen, das ich in der achten Klasse im Werkunterricht zimmerte, enthält eine lose Fotosammlung, die ebenso unspektakulär ist. Dazu die beiden miteinander verflochtenen Locken, braun und grau, festgehalten für die Ewigkeit. Ein Album mit getrockneten Herbstblättern, darunter die Namen der Bäume, von denen das Laub fiel: Zuckerahorn, Schwarzeiche, Amberbaum. Mein glitzernder Feenstab, meine kleinen grauen Filzmäuse, die Peter bei einem Streit wegwarf, aber später wieder aus dem Müll holte, der schmiedeeiserne Schlüssel, den wir am Bootsanleger fanden, meine silbernen Armreifen und das riesige goldene Kreuz, das ich im West Village kaufte, die schwarzen Leggings (meine »Madonna-Hose« nannte Peter sie immer), die kurze schwarze Halskette mit dem silbernen Herzen, mein roter Spitzenbody und die Bikerhose aus Vinyl, die Peter mir schenkte, das Buch über Wicca-Zauber, Kassetten mit Liedern von Nirvana, Hole und Veruca Salt für unsere Autofahrten, raubkopierte Nirvana-Videos, die ich ebenfalls im West Village bekommen hatte, Kassetten mit Aufnahmen von unseren vier Romanen (jede Figur mit einer anderen Stimme gesprochen), ein Holzamulett von Peter, auf dem eine Fee in eine Kristallkugel schaut. Das alles bewahrte er in einer schwarzen Truhe mit einem kaputten Riegel auf, die am Fußende seines Bettes stand.
***
Peter, am Ende deines Lebens konntest du nur noch wenige Häuserblocks weit gehen und nicht mehr Motorrad fahren. Du liefst zu Fuß den kurzen Weg zum Rand des Felsens im Palisades Park, machtest noch einen Schritt nach vorn und fielst gute achtzig Meter in die Tiefe, wie es im Polizeibericht steht. In meinen Briefkasten hattest du einen Umschlag mit zehn Abschiedsbriefen und mehreren Mitteilungen auf liniertem Papier geworfen, in denen du mir dein Auto überschriebst. Du hattest eine Karte für mich gezeichnet, damit ich deinen schwarzen Mazda finden konnte und nicht wegen Autodiebstahls angezeigt werden würde. In den Umschlag hattest du einen Zweitschlüssel gelegt, der Originalschlüssel befand sich im Zündschloss des Mazdas. Ich war zweiundzwanzig, und du warst sechsundsechzig.
Erster Teil
1
»Kann ich mit dir spielen?«
1985. Es war Frühling, und wenn der Wind heftig wehte, fielen die Blüten von den Kirschbäumen. Prachtscharten und Astern leuchteten bunt, und ich roch den süßen, schwindelerregenden Duft des Geißblatts, vom Wind herangetragen mit einem Schimmern frisch geraubter rosaweißer Kirschblüten und den fedrigen weißen Samen des Löwenzahns. Es war die Jahreszeit der Wespen, jener trägen Insekten, die ständig Mülleimer und Sprudelflaschen umschwirren. Mit drei Jahren war ich von einer Wespe in die Nasenspitze gestochen worden, worauf meine Nase auf ihre doppelte Größe anschwoll; seitdem hasste meine Mutter Wespen voller Inbrunst.
»Haut ab!«, schrie sie und fuchtelte mit den Händen herum, damit die Wespen verschwanden, die unserem Picknick mit den Freunden meiner Eltern, Maria und Pedro, und ihrem Sohn Jeff auf der Wiese im Liberty State Park unangekündigt einen Besuch abstatteten.
Poppa tropfte ein wenig Pepsi Cola auf das Ende eines Strohhalms und legte ihn auf unser rot-grünes Strandlaken. Alle Wespen schwirrten zum Strohhalm, und Poppa grinste.
»Seht ihr, ich löse Probleme mit gesundem Menschenverstand. Wespen mögen Zucker, und solange sie Cola haben, werden sie sich an den Strohhalm halten. Stimmt’s, Keesy?«
Seit Poppa mir als kleinem Kind angewöhnt hatte, ihm einen Gutenachtkuss auf die Wange zu geben, nannte er mich Kissy (mit seinem spanischen Akzent sprach er es »Keesy« aus). Eine Zeitlang küsste ich alles und jeden: meine Puppen und Stofftiere, sogar mein eigenes Spiegelbild. Poppa nannte mich nur dann Keesy, wenn er mit mir zufrieden war, manchmal auch Baby Bow. Wenn er böse auf mich war, nannte er mich gar nichts, dann sprach er von mir in der dritten Person. Nur selten verwendete er meinen richtigen Vornamen Margaux (ausgesprochen »Margo«), obwohl er selbst mich nach einem edlen französischen Wein von 1976 benannt hatte, den er einmal gekostet hatte: Château Margaux. Meine Mutter sprach er nie mit ihrem Namen Cassie an, auch gab er ihr nie einen Kuss oder umarmte sie. Ich nahm an, das sei überall so, bis ich sah, wie sich andere Eltern küssten, beispielsweise die von Jeff. Ehrlich gesagt, dachte ich, sie wären sonderbar.
Maria war die beste Freundin meiner Mutter und passte hin und wieder auf mich auf. Jeff war sieben, ein Jahr älter als ich. Wenn wir bei Jeff waren und er sich einverstanden erklärte, sich mit mir Geschichten auszudenken, war ich auch bereit, mit den Actionfiguren von G.I. Joe und den Transformern zu spielen. Ich fand Krieg sterbenslangweilig, dafür hasste Jeff Rate- und Rollenspiele, weil man dafür kein Spielzeug brauchte. Unsere Freundschaft wurde nur durch diese Kompromisse zusammengehalten.
Mommy und Maria unterhielten sich über die üblichen Mütter-Themen: die Vorteile von Vitamin C, das am Orchard Beach entführte Kind, der kürzlich in einer Achterbahn gestorbene Junge. »Was für eine Schande«, sagte Mommy dann, oder: »Gottes Wege sind unergründlich«. Mommy hatte einen kleinen Spiralblock, in dem sie jedes Unglück notierte, von dem sie im Radio oder Fernsehen hörte. So hatte sie immer etwas Wichtiges zu berichten, wenn sie eine Freundin anrief oder besuchte. Diesen Block nannte sie ihr »Faktenbuch«. Poppa konnte das Faktenbuch nicht ausstehen. Wenn meine Mutter krank wurde, redete sie von hungernden Kindern und anderen schrecklichen Dingen, die sich in der Welt zutrugen. Zu Hause spielte sie unablässig die Platte Sunshine ab, die Aufzeichnungen einer jungen Frau mit tödlichem Knochenkrebs, die ihrem Mann und ihrer Tochter Abschiedsgrüße aufgenommen hatte. Mommy fand das romantisch.
Ich hörte Maria sagen, dass ich mehr Huhn und Yucca essen müsse, und meine Mutter schrieb es in ihr Faktenbuch. Die beiden konnten sich nicht einigen, was dicker machte: Hühnchen oder Rindfleisch. Poppa stieß Pedro an und sagte: »Was wissen diese Weiber überhaupt? Ich habe mehr Ahnung als beide zusammen. Mädchen sollen nicht so viel Fleisch essen, sonst bekommen sie zu viele Hormone von der Kuh. Schwarze Bohnen und schwarzer Reis, Obst, Spaghetti – das ist das Richtige. Ein Kind soll nicht zu dünn sein, sonst glauben die Leute, man würde ihm nicht genug zu essen geben. Aber ein kleines Mädchen soll auch nicht älter aussehen, als es ist. Deshalb sollen Mädchen nicht zu viel Steak und Schweinefleisch essen. Fisch ist in Ordnung. Jungen hingegen müssen groß und stark werden. Söhnen, denen gibt man viel Schweinefleisch. Vielleicht gebt ihr eurem ein bisschen zu viel davon.« Poppa grinste; er konnte andere beleidigen, ohne dass sie ihm böse waren. »Ich selbst, ich esse gerne Salat. Ich esse oft Pistazien und hin und wieder eine Papaya. Vitamin A. Ich sage nicht, dass euer Sohn dick ist. Ich sage nur, dass er sich leisten könnte, ein paar Pfund abzunehmen. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich sage meinen Freunden immer die Wahrheit. Aber er ist ein kräftiger Bursche, ein gesunder Kerl, ein hübscher Junge!«
Jeff beugte sich zu mir herüber, flüsterte: »Hühnerbein, Hühnerbein!« und machte dazu gackernde Geräusche.
»Hör auf!«
»Gack, gack!« Er bewegte die Arme auf und ab. »Du läufst genau wie ein Huhn! Gack, gack! Gack, gack!«
Hühnerbeine waren mir egal, doch als er sagte, ich würde wie ein Huhn laufen, schlug ich ihm ins Gesicht. »Halt die Klappe, du Fettsack! Hau ab und fahr zur Hölle!«
Alle schauten mich an, und als Maria meinen Blick sah, wandte sie sich ab.
Poppa grinste breit und sagte: »Hütet euch vor meiner Tochter, Jungs!«
»Louie!«, rief Mommy. »Lob sie nicht auch noch dafür!«
Eine Wespe flog Mommy ins Gesicht, und Jeff wollte den Helden spielen und das Insekt mit einem Stock verscheuchen. Er erwischte es und schlug mit lautem Geheul auf die übrigen Wespen ein. Da gingen sie zum Angriff über, und Jeff ließ den Stock fallen. Die Erwachsenen schrien auf, und die gereizten Tiere stürzten sich auf uns alle. Ich hatte Wespen auf dem Kopf, den Armen, Händen, auf der Brust. Poppa sah mir in die Augen und sagte: »Beweg dich nicht, Keesy, beweg dich nicht, sonst stechen sie dich.« Ich spürte ihre winzigen schwarzen Beinchen, ihre zarten Härchen. Und gehorchte. Poppa und ich waren die einzigen, die an jenem Tag nicht gestochen wurden.
***
In den ersten sieben Jahren meines Lebens wohnte ich mit meinen Eltern in einem Mietshaus aus orangefarbenem Backstein auf der 32nd Street. Unsere kleine Wohnung wurde von Kakerlaken heimgesucht, die Poppa einfach nicht loswurde, obschon er sich mit Sprühdosen voll Insektenvernichtungsmittel bewaffnete. »Die kommen aus den anderen Wohnungen rüber. Kriechen unter den Türen durch. Die Leute in diesem Haus sind verwahrlost. In diesem Stadtteil leben nur Verwahrloste. Weiter draußen in Union City ist es besser. Hier gibt es nur Drogensüchtige und Wilde. Ich kann’s nicht erwarten, hier endlich wegzukommen.«
Poppa hasste Graffiti, Feuerleitern, zugemüllte Brachflächen, das Pfeifen und Zischen von Jugendlichen, er hasste Ghettoblaster und den Unrat, den die Menschen überall herumliegen ließen. Aber er ging gerne ein paar Häuserblocks weiter zur Bergenline Avenue, um sich dort einen Espresso und ein gebuttertes Brötchen zu holen (kleine Stückchen davon stopfte er mir in den Mund, ich durfte sogar an seinem Espresso nippen). Es gefiel ihm, dass dort fast nur Spanisch gesprochen wurde, weil es für ihn unglaublich demütigend war, auch nur ein einziges englisches Wort falsch auszusprechen, wenn er Essen bestellte. Als er meine Mutter kennenlernte, zog sie ihn einmal damit auf, dass er das Wort »shoes« wie »tschuus« aussprach. Den Rest des Tages redete er nicht mehr mit ihr.
Poppa ermutigte meine Mutter und mich nie, Spanisch zu lernen, was ihrer Meinung nach Absicht war. Er wollte nicht, dass wir seine Telefongespräche mithören konnten. Das nahm ich ihm übel. Kein Spanisch zu können bedeutete, dass man in den meisten Geschäften nichts lesen und in den ortsansässigen Restaurants und Bodegas nichts bestellen konnte. In Union City glaubten die Leute wegen meines hellen Teints meistens, ich käme aus Kuba oder Spanien, niemand hielt mich für eine halbe Puertoricanerin. Meine Mutter hatte norwegische, schwedische und japanische Vorfahren. Ich hatte dunkle Augen, angeblich von meinem halbjapanischen Großvater, ein herzförmiges Gesicht, üppige Lippen und glattes dunkelbraunes Haar.
Als ich klein war, schlug ich im Bus oder auf der Straße oft nach wildfremden Frauen, was nach Ansicht meiner Mutter darauf zurückzuführen war, dass ich miterlebt hatte, wie sie von meinem Vater verprügelt wurde. Sie sagte, ich sei mit drei Jahren Zeuge gewesen, wie er einen großen Bilderrahmen auf ihrem Rücken zertrümmerte, doch ich sei zu klein gewesen, um mich noch daran zu erinnern. Was ich jedoch weiß, ist, dass mein Vater oft die Lichter an- und ausknipste, um sich über die Nervenkrankheit meiner Mutter lustig zu machen. Meine Mutter, mein Vater und ich schliefen in einem riesigen Doppelbett, weil ich ständig Alpträume hatte und auf gar keinen Fall allein im Bett liegen wollte. Um besser schlafen zu können, breitete mein Vater ein aus einem alten Unterhemd geschnittenes Stück Stoff über seine Augen, und ich fand, er sah mit seinem kastanienbraunen Bart und dem langen braunen Haar wie ein Gangster aus. Wenn er guter Laune war, erzählte er mir morgens Geschichten über einen schelmischen Affen, einen bösen Frosch und einen geduldigen weißen Elefanten. Die Geschichten spielten in Carolina in Puerto Rico, wo er aufgewachsen war. Manchmal erzählte er mir auch von seiner Kindheit: Wie er immer die hohen Kokospalmen hinaufgeklettert war, Arme und Beine um die groben Stämme geschlungen, und sich mit eigener Kraft zentimeterweise hochgehievt hatte.
Mein Vater erzählte gerne Geschichten. Dabei übertrieb er und fuchtelte mit den Händen in der Luft herum. Er kümmerte sich um unseren Haushalt, um Kochen und Putzen, weil er behauptete, meine Mutter sei dazu nicht in der Lage, sie könne nur unsere Klamotten in den Waschkeller bringen und im nah gelegenen Supermarkt einkaufen. Sie brachte die Lebensmittel in einem kleinen roten Wägelchen heim, weil sie nicht Auto fahren konnte. Doch sie kaufte immer mehr als nötig und gab zu viel Geld aus, worüber Poppa sich dann aufregte.
Poppa war ein derart nervöser Typ, dass ich nie verstanden habe, wie er einen Beruf ergreifen konnte, bei dem er den ganzen Tag stillsitzen musste. Er war Goldschmied, spezialisiert auf Eigenentwürfe und deren Umsetzung. Zudem schliff, fasste und polierte er Edelsteine und führte Reparaturarbeiten durch. In den achtziger Jahren hatten Goldschmiede noch keine ergonomisch geformten Werkbänke, sondern arbeiteten den ganzen Tag vornübergebeugt.
Wenn Poppa nach Hause kam, war er immer so gereizt, dass er sich wie ein von der Leine gelassener Hund aufführte. Manchmal auch war er in Hochstimmung, dann riss er Heineken-Dosen auf, während er das Abendessen zauberte, holte die Gewürze singend aus Schubladen und Schränken, bot mir Kostproben seiner Kochkunst auf dem Löffel zum Probieren an oder überließ mir den Reistopf, damit ich die leicht angebrannten knusprigen Körner vom Boden kratzen konnte, von Poppa »Popcornreis« genannt. Wenn er gut aufgelegt war, zupfte er gerne an meiner Nase – seine Art, mir seine Zuneigung zu zeigen, da er mir nur selten einen Kuss gab. Unterdessen lag meine Mutter im Schlafzimmer und lauschte ihren Singles von John Lennon, der Musik von West Side Story, der Sunshine-Platte oder Simon and Garfunkel. Sie kam erst heraus, wenn das Essen auf dem Tisch stand, weil sie wusste, dass mein Vater schlechte Laune bekam, sobald er sie sah. Meine Mutter erzählte mir, als sie sich einmal vor dem Fenster entkleidete, habe Poppa die Vorhänge zugezogen und gesagt: »Du bist kein hübsches Mädchen, du bist eine fette Kuh, dich will niemand sehen.«
Wenn Poppa mit schlechter Laune nach Hause kam, verdrückte ich mich mit Mommy ins Schlafzimmer und drehte ihren Plattenspieler laut auf. Wir bauten uns eine kleine Festung aus Kissen und warfen uns den Quilt über den Kopf. In unserer Höhle lag ich, nuckelte an meinem Plastikschnuller (sogar noch mit fünf und sechs) und drückte mir einen gelben Stoffhund an die Wange, dessen kariertes Ohr durch mein ständiges Herumgezupfe eingerissen war. Poppa schimpfte, sein Chef würde ihn ständig herunterputzen, oder die Geschäfte liefen gerade schlecht. Mindestens einmal im Jahr war Poppa arbeitslos, da es in der Schmuckbranche nach Weihnachten nicht sehr viel zu tun gab. Er redete sich bei seinen Schimpftiraden so in Rage, dass sie zu unkontrollierten Wutausbrüchen wurden, die stundenlang andauern konnten. Wenn es so weit war, glich er einem Besessenen, und wir hatten Angst, in seine Nähe zu kommen. Er tobte, wir hätten ihn zu einem Leben in Elend verdammt, er würde nie wieder frei sein, Gott könne ihn nicht mehr in die Hölle schicken, weil er schon längst mittendrin sei, und er fragte sich laut, was er denn getan habe, um gleich doppelt gestraft zu sein: mit einer kranken Ehefrau und einem wilden Tier von Tochter. Oft wünschte ich mir, er würde auf Spanisch fluchen, damit wir nicht verstünden, was er sagte.
***
In dem Sommer, als ich sieben wurde, wohnten wir immer noch auf der 32nd Street. Von dort aus musste ich zum Schwimmbad auf der 45th Street mehrere Häuserblocks weit laufen. Das Wasser war nur rund einen Meter zwanzig tief und stark gechlort, tote Insekten schwammen auf der Oberfläche. Ältere Kinder nannten das Schwimmbad »Pisspool«. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich zu diesem Namen beitrug – unauffällig ließ ich mich an den blauen Rand treiben und sah mich vorsichtig um, ob mich auch niemand dabei beobachtete.
Das Wasser war von einem weiten, klaren hellen Blau, das sich ausdehnte, um meinen hineintauchenden nassen Körper aufzunehmen, meinen Körper mit seinen geballten Fäusten und den aneinandergedrückten Füßen und Beinen, angespannt wie zu einer langen Flosse, mit meinen zusammengepressten Lippen, die die Luft in mir hielten wie eine zugeschnappte Geldbörse, ich, die Meerjungfrau, der Goldfisch, der Delfin, mein schwereloses Ich. Wenn ich wieder aufstieg und mit dem Kopf durch die Wasseroberfläche brach, um die Luft in mir aufzunehmen, spürte ich, wie mein Kopf leicht vor Wohlgefühl wurde. Kurz darauf schaute ich zu meiner Mutter hinüber, die mit dem um Hals und Schultern geschnallten großen schwarzen Portemonnaie dasaß. Aus Angst vor Dieben legte sie es nie ab. Wenn mir meine selbsterdachten Spiele langweilig wurden, stellte ich mich manchmal in die Mitte des Beckens und schaute mich um. Wenn ich das tat – innehalten und mich umsehen –, dann war es, als würden alle Menschen – Kindergruppen, Mütter, die ihre Babys in Gummitieren schaukelten, Kleinkinder mit Schwimmflügeln um die Arme, Jungen, die am Tauchverbotsschild tauchten – wie aus dem Nichts Gestalt annehmen. Plötzlich überfielen mich die Geräusche, das Spritzen, Schreien, Pfeifen, das Zwitschern der Vögel und Brummen der Autos hinter dem grünen Lattenzaun.
An dem Tag, als ich Peter kennenlernte, sah ich zwei Jungen mit ihrem Vater am anderen Ende des Beckens ringen, planschen, lachen. Einer der Jungen war sehr hübsch. Er war der kleinere von beiden, ungefähr neun oder zehn Jahre alt, dünn, lange braune Locken. Er sah nicht einfach nur süß aus, er strahlte Glück aus. Sein Gesicht und seine Haut leuchteten irgendwie, seine Beine, Arme und Hände besaßen eine zartgliedrige Beweglichkeit, in seinen Augen und seinem Gesichtsausdruck lag eine für einen Jungen seltene Sensibilität. Sein älterer Bruder war wohl auch glücklich, aber nicht mit derselben Lebendigkeit.
Ihr Vater hatte silbrig-sandfarbenes Haar mit einem Pony wie die Beatles. Er hatte volle Lippen, eine lange, spitze Nase, die bei einem anderen abstoßend ausgesehen hätte, bei ihm jedoch nicht, und ein kräftiges, vorspringendes Kinn. Als er in meine Richtung blickte, sah ich, dass seine Augen aquamarinblau strahlten. Er lächelte mich an, sein Gesicht voller Falten: auf der Stirn, um die Augen, am Kinn. Ich wusste, dass er alt war mit den Falten, dem ergrauenden Haar und der lockeren Haut am Hals, doch er besaß so viel Schwung und Energie, dass er nicht alt wirkte. Er erschien nicht einmal erwachsen in dem Sinne, in dem Erwachsene sich normalerweise von Kindern unterscheiden. Kinder spüren die Distanz zwischen sich und Erwachsenen instinktiv, genau wie Hunde wissen, dass sie keine Menschen sind, und selbst wenn Erwachsene bei Kinderspielen mitmachen, weiß man doch immer, dass sie anders sind. Ich glaube, Peter hätte sich in eine Reihe mit hundert Männern von ähnlicher Statur und ähnlichen äußeren Merkmalen stellen können, ich wäre trotzdem zu ihm gegangen und hätte gefragt: »Kann ich mit dir spielen?«
Ich durchquerte das gesamte Becken und stellte ihm genau diese Frage. Er erwiderte: »Natürlich« und spritzte mir sofort Wasser ins Gesicht, tollte mit mir herum, als sei ich eins seiner Kinder. Ich bespritzte die Jungen und sie mich, denn sie schienen nichts dagegen zu haben, mit jemandem zu spielen, der so viel jünger war und dazu noch ein Mädchen. Irgendwann tauchte mich der hübsche Junge vorsichtig unter, und als ich wieder hochkam, prustete ich so heftig los, dass ich einen Moment lang nichts außer meinem eigenen Lachen hörte. Dann schnappte mich der Vater, klemmte mich unter seinen Arm, schleuderte mich herum und freute sich dabei wie ein kleines Kind. Als er stehenblieb, war die Welt aus dem Gleichgewicht geraten, und ein seltsames weißes Licht umstrahlte sein Gesicht wie eine Korona.
***
Als die Bademeister später alle Besucher aus dem Becken riefen, um das Schwimmbad zu schließen, stellte uns der Vater, der Peter hieß, eine niedliche Latina namens Inès vor, die die ganze Zeit im flachen Abschnitt des Beckens herumgewatet war. Peter neckte sie, weil sie sich immer nah am Beckenrand hielt, und scherzte mit meiner Mutter und mir, Inès habe Angst vor Dingen, über die sich niemand sonst Gedanken mache, beispielsweise Karussell oder Fahrrad fahren. Sie hatte ein seltsam schönes Gesicht mit schläfrigen Augen inmitten von Sonnenfalten, lange Locken, die am Ansatz dunkel und weiter unten in einem Apricotton gefärbt waren, dazu den sanften, verwirrten Blick eines wilden Rehkitzes. Inès hatte an den Fingern violette künstliche Nägel, zwei waren abgebrochen, auf den übrigen waren kleine schwarze Peace-Zeichen gemalt.
Peter stellte uns alle mit Namen vor: Der ältere Junge, Miguel, schien um die zwölf oder dreizehn zu sein, der jüngere, Ricky, nur ein paar Jahre älter als ich. Am Ende des Tages hatte ich alle Namen vergessen und erinnerte mich nur noch an die Anfangsbuchstaben der Eltern: P und I. Immer wieder musste ich an sie denken, an P und I und an ihr Versprechen, meine Mutter und mich zu sich einzuladen. Doch als die Zeit verging, ohne dass sich etwas tat, vergaß ich sie wieder.
***
Ich hätte sie für immer vergessen, wenn da nicht dieser vage Eindruck von Freude gewesen wäre, den der Nachmittag bei mir hinterlassen hatte. Wir saßen in Poppas 1979er Chevy, als Mommy sagte, sie hätten angerufen beziehungsweise Peter hätte sich gemeldet.
»Sie haben uns zu sich nach Hause eingeladen. Ist das nicht nett?« Als Poppa schwieg, fuhr sie fort: »Peter und Inès. Und die Jungen, Ricky und Miguel. Miguel und Ricky. Ganz nette Jungen. Gut erzogen, überhaupt nicht grob. Eine nette Familie.«
»In ihr Haus? Ist das in der Nähe?«
»Nicht weit weg. Am Telefon sagte Peter, in Weehawken, da wo es an Union City grenzt. Ich wollte dir nur Bescheid sagen. Was du davon hältst.«
»Wovon?«
»Dass wir dahin gehen. Am Freitag, wenn du arbeiten bist.«
»Ist mir egal.«
»Gut, ich dachte nur, ich sag dir Bescheid.«
»Ist mir egal. Das sind ja wohl keine Gewaltverbrecher, oder?«
»Das ist eine sehr nette Familie. Sehr nette Leute. Eine liebe Familie.«
»Bei dir sind immer alle nett. Alle sind so nett. Alle sind so lieb.«
»Dann ist das abgemacht«, sagte Mommy. »Freitagmittag.«
2
Das zweistöckige Haus
Vor dem Zweifamilienhaus standen ein zweistöckiger weißer Brunnen und drei große Kunstharzfiguren: ein rosa Bär, ein schwarzer Labrador mit Flügeln und eine Meerjungfrau. Der Bär war halb in Efeu versunken. Die seltsamen dunklen Blätter wanden sich bereits um den prallen Schwanz der Meerjungfrau, krochen seitlich am Haus empor, verschluckten die gesprungenen violetten Schindeln wie der Bartwuchs eines Wilden; aus den Efeubüscheln am Boden sprossen hohe rote und rosafarbene Rosen. An einem Mast hing eine zerschlissene rot-gelbe spanische Flagge, rechts und links der Fußmatte standen Blumentöpfe. Meine Mutter drückte auf eine Klingel, die an Drähten aus dem Rahmen heraushing. Als nichts geschah, machte sie Gebrauch von einem schweren goldfarbenen Türklopfer.
Zuerst konnte ich den geschmeidigen schlanken Mann, der uns die Treppe hinaufführte, nicht mit dem Vater aus dem Schwimmbad in Verbindung bringen. Der Anweisung meiner Mutter gehorchend, klammerte ich mich an das Mahagonigeländer. Sie hatte mich gewarnt, die Wendeltreppe sei »vertrackt«. Einmal rutschte ich fast aus, weil ich mich zu sehr auf die Wandbemalung konzentrierte, ein Band aus goldenen Schlüsseln, die nach oben hin immer größer wurden und so den Eindruck vermittelten, mit dem Betrachter das Treppenhaus emporzusteigen.
»Diese Treppe bringt mich noch um«, sagte der Mann und hielt sich den Rücken. »Ich würde lieber in der Wohnung im Erdgeschoss wohnen. Aber die ist zu klein für uns. Außerdem ist sie in keinem guten Zustand. Momentan kann ich sie nicht mal vermieten. Ich will sie schon länger renovieren, aber oben ist auch so viel zu tun. Werdet ihr gleich seh’n.«
Im Treppenhaus hing ein Spiegel, meine Mutter erkundigte sich danach. Der Mann sagte: »Der ist von American Girandole, mit dem Adler der Unionisten obenauf. Ich sprühe ihn jedes Jahr neu mit Goldlack an, damit er gut aussieht. Hab ich vom Flohmarkt. Ist antik.« Dann lachte er und fügte hinzu: »So wie ich.«
Er fuhr fort: »Unser Haus ist nur mit Antiquitäten eingerichtet. Der Herd ist von Bengal, Gasherd mit Gasheizung, 1955 eingebaut. Und wir haben eine alte Badewanne mit Löwenfüßen, so eine richtig tiefe Wanne, die man sonst nirgends mehr findet. Wir haben auch eine ganz große Doppelspüle: Die eine Seite ist für Geschirr, die andere für Wäsche.«
Ich merkte, dass er aus irgendeinem Grund zögerte, die Holztür im ersten Stock zu öffnen; wie alle Erwachsenen spannte er Kinder gerne auf die Folter. Ich drängte mich zwischen ihn und meine Mutter und sah ihn mit meinem strengsten, doch freundlichen Schmollmund an. »Ähm, wie heißt du noch mal?«
»Peter, hast du das vergessen?«
»Peter, kannst du die Tür aufmachen? Bitte!«
Mit einem honigsüßen Lächeln legte er schnell seine große sanfte Hand über meine Augen. »So, nicht schummeln! Ich nehme gleich ganz schnell meine Hand weg, und dann siehst du etwas ganz Tolles, ja? Versprich mir, dass du nicht schummelst!«
»Versprochen.«
Ich hörte, wie die Tür aufging, und versuchte, etwas zu erkennen, sah aber nur das Licht in den Ritzen zwischen seinen Fingern. »Fertig?«
»Ja!«
In der Mitte des Zimmers stand ein gläserner Behälter von der Größe eines kleinen Sofas. Darin befanden sich braune Äste, und auf den Ästen saßen Leguane mit Stacheln auf dem Kopf. In einem schmutzigen kleinen Teich lag ein Wels mit schwarzem Schnurrbart. Auf Stangen am Fenster flatterten Sittiche und Finken; der Boden war mit Zeitungspapier ausgelegt, um den Vogeldreck aufzufangen. Überall an den Wänden waren Futterstellen angebracht, unter der Decke hing Spielzeug: zusammengebundene Glöckchen und bunte Steine. Ein großer wolliger Hund kam hechelnd auf mich zu und wollte gestreichelt werden. Ich schob meine Hand in sein langes herbstbuntes Fell, er legte sich voller Wohlbehagen hin und drehte sich auf den Rücken, damit ich seinen weichen weißen Bauch kraulte.
»Das ist Paws«, sagte Peter. »Er ist der liebste Hund der Welt, halb Golden Retriever, halb Collie.«
»Ach, das sind so nette Rassen«, sagte meine Mutter und streichelte ihn, obwohl sie eine Allergie hatte.
Anschließend führte uns Peter in die Küche, in der ein Aquarium mit einer kleinen schwimmenden Scharnierschildkröte stand. »Schildkröten fressen Würmer«, erklärte Peter und zeigte mir graue Würfel, die aus gemahlenen und getrockneten Würmern bestanden. Er nahm das Drahtnetz vom Aquarium, und ich ließ den grauen Würfel hineinfallen und sah zu, wie der flache schrumplige Kopf hervorkam und nach dem Futter schnappte. Das Aquarium der Schildkröte und das Terrarium im Vorderzimmer verströmten einen wilden, scharfen Duft, der sich mit den anderen Gerüchen vermischte: Vogeldreck, Vogelfedern, alte Zeitungen und das Fell des Hundes mit seinem warmen, erdigen Hundedunst. Paws folgte uns überallhin und sah uns unablässig mit seinen feuchten Augen an. Das Vogelgezwitscher gesellte sich zum Klackern der Hundepfoten auf dem Linoleum in der Küche und zum Peitschen der wild gewordenen Rute, die gegen alles schlug, an dem der Hund vorbeikam. Das gesamte Hinterteil von Paws wackelte ohne Unterlass. »Es sieht aus, als würde er tanzen«, sagte ich.
Wir gingen in das Wohnzimmer, das mit rotem Teppichboden, einem roten Samtsofa und samtgepolsterten Stühlen ausgestattet war, mit roten Vorhängen und drei riesengroßen vollgestopften Bücherregalen. Auf dem Boden stand ein kleiner Drahtkäfig mit einem dicken braun-weißen Hamster, vor dem Fenster schwammen Goldfische – orange, schwarz, gefleckt – in einem Aquarium, das ungefähr halb so groß wie das im Vorderzimmer war. Sie tummelten sich zwischen Wasserpflanzen, einem Steinhaus, einer Meerjungfrau, einer steinernen Kröte und einer Blasen ausstoßenden Windmühle. Links von dem großen Aquarium befand sich ein kleinerer Glaskasten, und mit einem Grinsen führte uns Peter heran und zeigte auf einen kleinen Alligator.
»Das ist ein Kaiman – halb Alligator, halb Krokodil«, erklärte er, und ich sah, dass das Tier halb so lang wie mein Arm war und nur wenig breiter. Seine Haut war geriffelt, die uralten Augen blinzelten nicht, es war reglos wie eine Steinfigur.
»Wieso ist der so klein?«, fragte ich.
»In freier Wildbahn würde er größer werden«, sagte Peter. »Aber hier, in Gefangenschaft, wird er nur ungefähr so groß wie das Terrarium. Sein Körper weiß von selbst, dass er sonst zu groß für seine Umgebung werden würde. Aber er ist glücklich so, siehst du, mit dem kleinen Bach und dem Holz, auf dem er sitzt. Er wird nicht viel größer, als er jetzt ist. Es sei denn, ich hole ein größeres Terrarium.«
»Und, machst du’s?« Ich schaute in Peters lächelndes Gesicht. »Ein größeres Terrarium holen?«
»Irgendwann vielleicht. Aber ich mag ihn in dieser Größe. Willst du mal was sehen, was ganz Tolles?«
»Ja!«
Peter steckte die Hand in den Glaskasten, und Mommy und ich hielten die Luft an. Er jedoch lächelte standhaft, stupste den kleinen Alligator an, und ich traute mich, näher heranzutreten und mir den weichen, weißen, geäderten Bauch und die kurzen Stummelbeine anzusehen, die das Tier wie in einer Geste völliger Unterwerfung in die Luft streckte, dazu das sonderbare Gesicht mit der Schnauze, die aussah, als würde sie selig lächeln, aber dabei winzigste dreieckige Zähne entblößte. Obwohl sie so klein waren, musste man fürchten, sie könnten wehtun, und mein Herz raste aus Angst um Peters Hand. Ich dachte an die Bücher, die ich mir ausgeliehen hatte, an die Tiger und anderen Raubkatzen, von denen ich gelesen hatte, für mich ein unglaublich faszinierendes Thema. Angeblich konnten Krokodile, die sich im schlammigen Wasser versteckten, plötzlich hervorspringen, einen saufenden Tiger am Hals packen und die Wildkatze mit ihren kleinen bösen Zähnen ins Wasser ziehen, die sie ins dicke orangefarbene Fell gruben, auch wenn der Tiger versuchte, sich mit den Hinterläufen am Ufer festzukrallen.
Doch Peter streichelte dem Kaiman den Bauch, und die blassen, klaren Reptilienaugen weiteten sich. Zum Staunen von Mommy und mir schlossen sich die Augen bald, und Peter sagte flüsternd: »Jetzt schläft er.« Ich flüsterte zurück: »Ich dachte, er würde dich beißen. Ich hatte Angst.«
»Alle Tiere werden gerne am Bauch gestreichelt. Es gibt keine Ausnahmen.«
»Wie heißt er?«
»Wächter.«
»So sieht er auch aus«, bemerkte Mommy. »Ich meine, wenn er nicht schläft. Peter, woher nehmen Sie die Zeit, sich um all diese Tiere zu kümmern?«
Peter zündete sich eine King 100 an. Ich wusste, dass sich meine Mutter Sorgen machte, wenn ich passiv mitrauchte, doch sie sagte nichts. »Ich bekomme Invalidenrente. Meine Aufgabe ist es, mich um dieses Haus zu kümmern, denn wie Sie sehen, geht immer etwas kaputt, und ich bin ausgebildeter Schreiner, deshalb weiß ich, wie man so was repariert.« Er blies Qualmringe aus, und ich steckte den Finger hindurch und kicherte, wenn die Ringe sich auflösten.
»Wissen Sie, im Koreakrieg habe ich als Schreiner für die Armee gearbeitet. Irgendwann fuhr ich im Regen einen Hügel runter, und ein Lkw rutschte von hinten auf mich drauf. Es endete mit einer steifen Wirbelsäule. Manchmal muss ich ein Korsett tragen, aber ich lass mich davon nicht runterziehen. Ich beschäftige mich. Werkel am Haus herum und kümmere mich um die Tiere. Sonst würde ich mich ganz schön langweilen. Aber in diesem Haus gibt es immer was zu tun.« Er hielt inne. »Wisst ihr, wie alt dieses Haus ist?«
»Nein, wie alt denn?«, fragte Mommy. Ich zog mit den Fingern Kreise auf der Terrariumscheibe des schlafenden Kaimans.
»Über hundert Jahre. Dieses Haus wurde während des Bürgerkriegs gebaut, es ist eines der ältesten Gebäude in Weehawken. Inès hat es von ihrem Mann geerbt. Er kam bei einem Autounfall ums Leben, als ihre Kinder noch in die Windeln machten.«
Meine Mutter riss die Augen auf. »Wussten Sie, dass täglich über hundert Menschen bei Autounfällen sterben? Deshalb sage ich Margaux immer, dass sie sich anschnallen soll. Mein Mann tut es nicht.« Sie schüttelte den Kopf. »Das muss erschütternd für sie gewesen sein. So was kann ich mir nicht mal ansatzweise vorstellen.«
Peter nickte. »Es war allerdings traumatisch für Inès. Jedenfalls brauchten Miguel und Ricky dringend einen Vater, und Inès – ich weiß nicht, ob sie das alles geschafft hätte, wenn ihr nicht jemand mit dem Haus geholfen hätte. Wirklich, es ist in einem Zustand des ständigen – ach, wie sagt man noch mal? Es fällt auseinander. Inès arbeitet beim Pennysaver, stellt dort die Kleinanzeigen zusammen und so weiter. Irgendwann hat sie auch eine für sich selbst aufgegeben, aber es gab eine Verwechslung, die Anzeige sollte eigentlich nicht an dem Tag gedruckt werden. Wurde sie dann aber doch. Manches ist halt Schicksal. Egal, Sie heißen Cassie, ja? Kommt das von Cassandra?«
»Ja. Cassandra Jean. Den Namen hat mein Vater ausgesucht. Er rief mich immer Sandy.«
»Hätten Sie was dagegen, wenn ich Sie auch Sandy nennen würde? Ich finde es wichtig, dass man die Verbindung zur Kindheit nicht verliert. Eigentlich ist die Kindheit die wichtigste Zeit.«
»Ja, das stimmt. Nennen Sie mich ruhig Sandy.«
»In der Schule musste ich ein kleines Gedicht lernen, das kann ich bis heute auswendig. Schon komisch, was wir alles behalten. Es geht so: ›Segen dir, du kleiner Mann, / ohne Schuh und braungebrannt, / aufgerollt das Hosenbein, / ein Liedchen auf den Lippen fein, / so leuchtend rot, blutrot bemalt / von Erdbeeren, genascht im Wald. / Durchs kecke Hütchen fällt das Licht / auf dein anmutiges Gesicht. / Mein Herz jubelt dir freudig zu, / denn ich lief auch einst ohne Schuh’.‹ Von John Greenleaf Whittier.«
»Bravo!«, sagte Mommy. »Sie haben sich kein einziges Mal vertan.«
Peter räusperte sich. »Was mir auch zustößt, ich versuche immer, diese Einstellung zu bewahren. Ich möchte meine Fröhlichkeit nicht verlieren. Hatten Sie auch schon mal das Gefühl, Sandy, dass Sie im Herzen ein kleines Mädchen geblieben sind, ganz gleich, was Sie als Erwachsene erleben? Ich kann Ihnen das ansehen.«
Mommy errötete und überlegte, ehe sie antwortete. Sie senkte die Stimme; wahrscheinlich dachte sie, ich sei so mit dem Kaiman beschäftigt, dass ich nicht zuhörte. »Nun, wenn es danach geht, wie mein Mann mich behandelt, könnte ich genauso gut ein Kind sein. Er sagt immer, ich würde nichts richtig machen. Als ich klein war, übertrug mein Vater mir Aufgaben. Jeden Abend musste ich abwaschen, und mein Dad gab mir dafür einen Nickel.« Mit glühendem Gesicht sagte sie: »Ich war die Jüngste und der Liebling meines Vaters.«
»Sie sahen damals bestimmt aus wie Shirley Temple.«
»Dies ist ein Zoo, und du bist der Zoowärter!«, platzte es aus mir heraus.
»Ja, so kann man das wohl sagen. Willst du noch mehr Tiere sehen?«
»Ja!«
»Auf dem Dachboden ist ein Meerschweinchen, das ich euch noch nicht gezeigt habe. Da oben ist das Zimmer von Miguel und Ricky. Und draußen sind noch ein paar Kaninchen, im Stall.«
»Wo sind Miguel und Ricky denn heute?«, fragte Mommy. »Ich hatte gedacht, Margaux könnte mit ihnen spielen.«
»Wahrscheinlich in der Spielhalle. Verpassen den schönen Sonnentag.«
»Mit Inès?«
»Nein, Inès kommt immer erst so gegen halb sechs von der Arbeit nach Hause. In letzter Zeit macht sie viele Überstunden. Sie bekommt zwar nichts dafür, aber sie wehrt sich nicht dagegen.« Peter verdrehte die Augen.
»Ich will jetzt die Kaninchen sehen!« Ich nahm seine Hand. »Gehen wir?«
»Na los!«
Als ich davonhüpfte, hörte ich Peter sagen: »Ich finde es herrlich, wenn Kinder hüpfen. Hüpfen ist das Unschuldigste und Sorgloseste, was es gibt.«
***
Als wir wieder zu Hause waren, ging ich in die Küche zum Telefon mit der Wählscheibe. »Komm, wir rufen Peter an und fragen ihn, wann wir ihn wieder besuchen können!«
»Warte, ich gebe dir die Nummer. Du kannst ihn anrufen. Aber ich möchte nicht, dass es so aussieht, als könnten wir es kaum erwarten.« Am Telefon sagte ich: »Peter, können wir wieder zu dir kommen, es ist nicht höflich, wenn man direkt nachfragt, aber es war so toll bei dir, und es ist so lustig mit dir, das hat mir so viel Spaß gemacht, und ich habe Paws total gern, ich mag ihn unheimlich, und Wächter auch, obwohl er manchmal aussieht, als ob er schlechte Laune hätte, und die Kaninchen, die sind so weich, und ich mag ihre kleinen Schnuppernasen. Ich mag Peaches und Porridge! Ich möchte jeden Tag zu dir kommen, solange ich lebe!« Ich überlegte; meine Mutter sprach immer davon, wie wichtig Regelmäßigkeit sei. »Kannst du einen Wochenplan machen, wann wir dich besuchen dürfen?«
Ich konnte nicht erklären, warum ich das Gefühl hatte, es sei in Ordnung, so forsch mit Peter zu sprechen; ich wusste es einfach.
Peter lachte. »Wenn du etwas willst, dann bekommst du es auch, was? Gib mir mal deine Mutter!«
Nach scheinbar unendlicher Zeit hörte ich, wie meine Mutter lachte und sagte: »Also gut, montags und freitags. Das passt uns gut. Mein Mann macht am Wochenende gerne Ausflüge mit uns, also geht das.« Sie überlegte. »Sie können sehr gut mit Kindern; Margaux hat wirklich einen Narren an Ihnen gefressen. Ach, Sie hatten Pflegekinder? Das ist ja schön. Ich habe Menschen schon immer bewundert, die Gutes tun; ich würde auch gerne Gutes tun, aber mein Mann ist nicht dafür, Geld an Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden oder so was. Na ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst …«
3
Eine schlechte Angewohnheit
Nachdem wir drei Montage und Freitage nacheinander zu Peter gegangen, gegen zehn Uhr angekommen und bis ungefähr halb fünf geblieben waren, damit wir noch vor Poppa zu Hause eintrafen, stellte ich mich vor Peter und begann, auf eine bestimmte Weise mit meinem Haar zu spielen, die Poppa immer auf die Palme brachte. Dabei löste ich einzelne Strähnen heraus, wickelte und verdrehte sie. Manchmal hatte ich mich dabei so sehr vergessen, dass das Haar zu unentwirrbaren Knoten verfilzte, die Mommy nicht mehr herauskämmen konnte und wollte. Wir waren im Garten, Mommy lag gemütlich in einem Liegestuhl, ich stand neben der Vogeltränke. Gerade noch hatte ich mit Paws Ball gespielt.
Sofort sagte meine Mutter: »Ach, mein Mann und ich versuchen schon lange, ihr das abzugewöhnen. Wir haben es Margaux schon hundert Mal gesagt. Aber mein Mann mäkelt unablässig an ihr herum. Es ist nur eine nervöse Angewohnheit, so wie Fingernägelkauen.«
»Himmel noch mal, sie ist doch erst sieben! Ich finde es niedlich, wenn sie das macht. Sie ist frei und glücklich dabei. Ich verstehe einfach nicht, warum Erwachsene Kinder immer unter Druck setzen müssen.« Mommy zuckte mit den Schultern, und Peter sagte: »Margaux, mach das doch noch mal! Du bist frei in diesem Garten, lass dich treiben, tu einfach, was du willst. Na los, du bist frei, spiel mit deinem Haar!«
Aber ich wollte nicht mehr. Obwohl Peter beteuerte, er würde es genießen, wenn ich vor ihm mit meinem Haar spielte, löste es plötzlich noch stärkere Schamgefühle aus, als wenn mein Vater mich deswegen schimpfte. Das Einzige, was ich an Peter nicht mochte, war, dass er manchmal nicht locker ließ. Deshalb versuchte ich, ihn abzulenken, indem ich mich auf seinen Schoß warf und ihn dadurch fast aus dem Liegestuhl kippte.
»Sei vorsichtig!«, schimpfte Mommy. »Du weißt doch, dass Peter einen schlimmen Rücken hat.«
Doch Peter wurde nicht böse, sondern fing an, mich zu kitzeln. Irgendwann kam Ricky in den Garten, und Peter gab ihm den Gartenschlauch, damit er mich nass spritzen konnte. Er jagte uns beide herum, bis es Ricky langweilig wurde und er ging. Die Stunden verflogen, und lange Schatten fielen auf den Garten. Nach einer Weile sagte meine Mutter, wir müssten bald zum Abendessen nach Hause. Peter meinte: »Wir könnten doch ein bisschen grillen! Du hast gesagt, freitags gibt es bei euch nur Reste, oder?«
»Ja, freitags geht er nach der Arbeit immer in die Kneipe«, sagte Mommy, und Peter schüttelte den Kopf.
Als Peter auf dem Grill Würstchen briet, kam Inès mit einem Pappteller in den Garten, auf dem ein Sandwich lag. »Willst du lieber ein Würstchen?«, fragte Peter.
»Nee, ich habe Weizenbrot mit Oliven«, sagte Inès und legte sich mit einem Buch auf ein geblümtes Handtuch. Dort las sie und knabberte dabei an ihrem Sandwich herum. »Ich habe den Jungs auch was gemacht«, sagte sie. Sie nannte ihre Söhne immer »die Jungs«.
Später stand Inès auf, um zu telefonieren, und ließ ihr kaum angerührtes Sandwich auf dem Handtuch zurück. Wir aßen Grillwürstchen, dazu Bohnen und kaltes Schweinefleisch aus der Dose. Auf dem Heimweg erzählte meine Mutter, sie sei an Inès vorbeigegangen und hätte gesehen, dass das Sandwich von winzigen braunen Ameisen übersät gewesen war; scheinbar hatte Inès hineingebissen, ohne es zu merken.
»Sie ist eine Träumerin, genau wie du«, sagte Mommy.
***
Manchmal hatte meine Mutter Spaß daran, Peter wütend darüber zu machen, wie schrecklich Poppa war. In letzter Zeit hatte ich ihr dabei geholfen, und eines Freitags aßen wir drei zu Mittag im Blimpie auf der Bergenline Avenue und machten uns dabei über Poppa lustig. Mommy aß Roggenbaguette mit Thunfisch, Peter und ich teilten uns ein mit Öl und Essig getränktes italienisches Landbrot mit Salami und Provolone. Da fing Mommy an, von Poppas Tick mit dem Küchenschrank zu erzählen.
»Alles in seinem Schrank ist säuberlich geordnet, jeder Stift muss ordentlich daliegen, daneben ein perfekt gefaltetes Taschentuch, das er angeblich aus Madrid hat. Und er hat Streichholzschachteln aus den Ländern, in denen er mit der Armee gewesen ist, alle akkurat aufgestapelt. Einmal kletterte Margaux, da war sie drei – sie kann ja manchmal ein richtiger kleiner Teufel sein –, sie kletterte auf die Arbeitsfläche, öffnete den Schrank und brachte alles durcheinander. Als er nach Hause kam – und ich wusste ja nicht, was sie getan hatte –, warf er einen Blick in den Schrank und holte seinen Gürtel aus dem Schlafzimmer. Ich wusste, wie viel Angst Margaux vor seinem Gürtel hat, und stellte mich dazwischen, so dass er schließlich mich damit schlug, aber immerhin hat er Margaux nichts getan. Außerdem hat er, Peter, du glaubst es nicht, er hat ein Paar richtiger Nunchakus im Haus. Kennst du sonst noch jemanden, der solche Dreschflegel zu Hause hat? Er macht Tricks damit, um Eindruck zu schinden, so ein Angeber ist er.«
Mitten im Blimpie ahmte ich vor Peter und Mommy Poppas beste Kunststücke mit dem Nunchaku nach, bis sie vor Lachen heulten. Als ich Poppa am Abend sah, fühlte ich mich ein wenig schuldig. Ich wusste, dass er diese Tricks nur aufführte, um mich zu unterhalten und zu überzeugen, dass er uns schützen konnte, falls jemand bei uns einbrechen sollte.
***
Poppa, Mommy und ich saßen in einem Restaurant in Westchester unter einem großen bunten Sonnenschirm. Auf dem Weg nach City Island machte Poppa hier gerne Pause und aß eine Portion Muscheln; zum Mittagessen würden wir dann bei Tony am Meer Hummer oder frittierte Venusmuscheln aus weiß-roten Pappschalen essen. Bei Tony gab es Videospiele, so dass ich ständig zu Poppa rannte, damit er mir die Vierteldollarstücke aus seiner Hosentasche gab. Er trank Heineken, rauchte Zigarre und unterhielt sich mit Mommy. Zu Hause sprach er nicht viel mit ihr, sondern schrie sie nur an, doch wenn wir in einem Restaurant aßen, hatte er alles Mögliche mit ihr zu besprechen. Vielleicht mochte er die Wohnung einfach nicht, oder er war am Wochenende schlichtweg besser drauf, weil er nicht arbeiten musste. Aus welchem Grund auch immer: Wenn wir ausgingen, konnte er sehr nett zu meiner Mutter sein, gab ihr Piña Coladas ohne Rum aus (wegen ihrer Medikamente durfte sie keinen Alkohol trinken) und kaufte ihr ihre Leibspeise: gebratene Shrimps in Sauce Tartar mit Krautsalat. Dennoch behandelte er sie wie ein kleines Kind, band ihr eine Papierserviette als Lätzchen um den Hals und wischte ihr sogar den Mund ab, was ihr offenbar zu gefallen schien, auch wenn sie sich bei Peter oft beschwerte: »Ich kann es nicht ausstehen, wenn er mich behandelt, als wäre ich seine Tochter und nicht seine Frau.«
Was Mommy wohl auch immer gemacht haben musste, war, Poppa mit Lob zu überschütten: »O Louie, du kochst wie in einem Fünf-Sterne-Restaurant!« oder »Louie, zeig mir doch noch mal das Bild von dir in San Juan! Darauf siehst du aus wie Robert Redford.« Das fiel mir erst jetzt auf, weil sie Peter gegenüber ganz anders von Poppa sprach. Poppa liebte Komplimente. Zu Hause gab es ein Spiel zwischen uns, das hieß: »Erzähl mir von deinem Poppa-pa!« Dabei kuschelte ich mich an ihn und zählte alles auf, was ein Mädchen an seinem Vater toll findet: dass er der größte und schönste Mann ist, der klügste und der beste. Doch in Poppas Augen war ich so oft nicht die Beste.
Als wir in dem Lokal saßen, musste ich mich vergessen haben, denn ich begann, wieder mit meinem Haar zu spielen, und Poppa sagte: »Sieh dir das an! Sie macht sich zum Gespött der Leute. Dieses Kind hat kein Verständnis für nichts. Weder fürs Leben, noch für mich oder sonst irgendwas.« Die letzten Worte sagte er nicht zornig, sondern voller Bedauern. Eine Weile war er still, fast nachdenklich. Dann ging es weiter: »Es gibt nichts Schlimmeres als eine schlechte Angewohnheit. Eine schlechte Angewohnheit«, wiederholte er mit Blick auf Mommy. »Hast du irgendeine Idee, wie man ihr diese schlechte Angewohnheit wieder abgewöhnen kann? Diese Angewohnheit, die …«
Schnell unterbrach Mommy seinen Vortrag, der gerade Fahrt anzunehmen begann, denn sie wusste – wir beide wussten –, dass es lange dauerte, bis er aufhörte, wenn er erst einmal in Fahrt gekommen war. »Sie lässt es bestimmt von allein wieder sein. Dr. Gurney sagt immer, manche Kinder sind nervöser als andere, deshalb sollen wir uns keine Gedanken machen über so eine Kleinigkeit, dass Margaux mit ihrem Haar spielt. Er meint sogar, Nägelkauen sei schlimmer, wir könnten froh sein, dass sie nicht zu der Sorte gehört, davon bekäme man oft Niednägel und Entzündungen. Und P…«, fuhr Mommy fort und hätte fast Peters Namen genannt, spülte ihn jedoch schnell mit einem großen Schluck Hohes C herunter. Sie wusste, dass Poppa sich jedesmal aufregte, sobald von Peter die Rede war, nur über seine Lebensumstände war erlaubt zu sprechen. Poppa hatte Mommy gebeten, ihm zu beschreiben, wie »das Haus da« so war, und hatte gegrinst, als Mommy ihm von der Toilette erzählte, die man nicht immer abziehen konnte, von den Ameisen auf der Fensterbank und davon, dass Peter einmal gesagt hatte, der Großteil seiner Möbel stamme aus dem Sperrmüll vom Bürgersteig. Er hatte damit angegeben, es gebe nichts, das man nicht mit ein bisschen Klebstoff oder Spachtelmasse reparieren könne. Poppa freute sich, als er von der Spüle hörte, in der sich an manchen Tagen das schmutzige Geschirr stapelte, das nicht einmal richtig sauber gewischt war. »Der Gestank von diesen Tieren muss doch unerträglich sein«, hatte Poppa gesagt.
Als Mommy den P-Laut von sich gab, kniff Poppa die Augen zusammen, sagte aber nichts.
»Auf jeden Fall«, fuhr Mommy fort und wandte den Blick ab, »ist es so, wie Dr. Gurney gesagt hat: Das ist nicht von Dauer. Er hat es genau so gesagt: ›Kinder gewöhnen sich so etwas ab.‹ Und Margaux wird sich das Haaredrehen abgewöhnen.«
»Abgewöhnen«, sagte Poppa nicht sehr laut, aber mit einer Ernsthaftigkeit, die nahelegte, dass er dieses eine Verb aus jedem erhältlichen Wörterbuch streichen würde, wenn er für die englische Sprache verantwortlich wäre. Als würde er dem anstößigen Wort eine Chance zur Wiedergutmachung geben, versuchte er dann, es ein wenig anders auszusprechen, in einem freundlicheren Tonfall, während er eine Miesmuschel zwischen Daumen und Zeigefinger hielt.
Poppas Nerven schienen sich beruhigt zu haben.
Er räusperte sich und sagte: »Keesy, ich erzähle dir jetzt die Geschichte eines kleinen Mädchens aus Puerto Rico, das auch schlechte Angewohnheiten hatte; es waren andere als deine, aber genauso schädlich. Die Mutter und der Vater machten sich Sorgen, weil die Kinder in der Schule das Mädchen für verrückt hielten. Aber das Mädchen merkte nicht, dass die anderen es zur Zielscheibe ihres Spotts machten, ebenso wenig sah es, wie es seine armen Eltern demütigte und ihnen Schmerzen zufügte.« Er trank einen Schluck Bier. »Jedenfalls war dieses Mädchen immer in Träume versunken und passte nie auf, wo es hinlief. Eines Tages, so geht jedenfalls die Geschichte, machte das Mädchen einen langen Spaziergang, es sang und summte vor sich hin. Irgendwann kam es an Eisenbahnschienen und setzte sich darauf, sang und schaute in den Himmel. Weil es so versunken in seine Gedanken war, hörte es den Zug nicht kommen. Der Zugführer betätigte das Signalhorn, aber das Mädchen schaute nicht auf, und Züge kann man nicht einfach so anhalten, wenn sie einmal in Fahrt sind. Der Zug rollte dem Mädchen über die Beine und schnitt sie ungefähr hier ab.« Er wies auf seine Hüfte. »Ja, Keesy, du brauchst gar nicht so zu gucken. Die Beine wurden abgetrennt und lagen mitten auf den Bahnschienen, die konnten sich die Bussarde holen. Und das arme Kind hatte zum großen Kummer seiner Eltern nur noch zwei blutige Stumpen.«
»Louie, das ist ja eine furchtbare Geschichte!«, schimpfte Mommy. »Solche Geschichten erzählt man doch keinem Kind!«
»Wie ging es mit dem Mädchen weiter, Poppa?«
»Deine Mutter hat recht, es ist eine komplizierte Geschichte. Wenn ich noch mehr erzähle, bekommst du vielleicht Alpträume.«
Der Kellner trat heran, räumte die leeren Heineken-Flaschen ab und stellte meinem Vater ein neues Bier hin. Ich musste an die beiden blutigen Beinstümpfe auf den Schienen denken.
»Poppa, bitte! Du kannst keine Geschichte erzählen und das Ende weglassen!«
»Du hast viel Fantasie. Denk dir selbst ein Ende aus, Keesy.«
»Du bist betrunken, Louie! Du bist einfach nur betrunken, und wir haben über dreißig Grad! Zweiunddreißig Grad! Du kannst einen Sonnenstich kriegen!«, flüsterte meine Mutter eindringlich. Ihr war klar, wie böse er werden konnte, wenn er öffentlich gedemütigt wurde. »Da drinnen ist ein Münzfernsprecher. Ich rufe jetzt Dr. Gurney an und erzähle ihm, dass du Margaux Angst einjagst!«





























