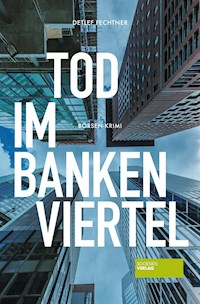Detlef Fechtner
Tod im Bankenviertel
Börsen-Krimi
Alle Rechte vorbehalten · Societäts-Verlag
© 2020 Frankfurter Societäts-Medien GmbH
Satz: Bruno Dorn, Societäts-Verlag
Umschlaggestaltung: Bruno Dorn, Societäts-Verlag
Umschlagabbildung: Agatha Kadar/Shutterstock
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
ISBN 978-3-95542-395-7
Prolog
Es war ein dumpfes Geräusch, kurz, ohne jeden Nachhall. Der Körper war gleich zu Beginn des Sturzes in etwa 150 Metern Höhe gegen die Hauswand geschleudert und danach um die eigene Achse gewirbelt worden. Und er hatte sich auf halber Höhe so ineinander verdreht, dass Schultern und Knie wenig später fast synchron aufschlugen. Trotz der ungeheuren Wucht des Sturzes auf den ausgetrockneten Rasen konnte man den Aufprall nicht mehr vorne auf dem Reuterweg hören, erst recht nicht im Rothschildpark und wahrscheinlich noch nicht einmal nebenan in der Oberlindau. Aber dort war ohnehin niemand mehr unterwegs. Selbst in einer lauen Sommernacht wie dieser verirrte sich um vier Uhr morgens keine Seele mehr ins Frankfurter Bankenviertel – jedenfalls nicht an einem Wochentag. Wer morgens um acht bei der ersten Schalte mit Tokio und London hellwach sein muss, gönnt sich unter der Woche allenfalls einen After-Work-Club, aber spätestens um Mitternacht ist Schluss mit Party. Dann eilen die letzten Banker und Börsenhändler in ihre Westend-Altbauwohnungen, sinken in Himmelbetten oder auf Futons und träumen von fernen Inseln und von Frauen, die nach Lavendel duften. Oder, wenn’s schlecht läuft, von 200-Tage-Linien und Kurs-Gewinn-Verhältnissen.
Die Leiche lag unnatürlich gekrümmt auf der kleinen Grünfläche vor dem Heizungskeller des Bankhochhauses. Rechtsmediziner räumen beim freien Fall aus 20 Metern noch geringe Überlebenschancen ein, nicht aber bei einem Sturz vom Dachgeschoss der 47. Etage der Frankfurter Hypo-Union-Zentrale. Eine dichte Vogelbeerenhecke verhinderte, dass die Leiche zufällig von den Pendlern entdeckt werden konnte, die zwei Stunden später als erste die kleine Anlage Richtung U-Bahn durchquerten. Und dass Schüler des Bischof-Ketteler-Gymnasiums auf sie stoßen konnten, wenn sie um halb acht ihren Schulweg über den kleinen Trampelpfad hinter dem Bankhochhaus abkürzten, war ebenfalls ausgeschlossen. Schließlich war Mitte August, Ferienzeit. Folglich konnte nur einer der drei Haustechniker die Leiche finden, bei der routinemäßigen Kontrolle der Kälte- und Wärmezentrale der Bank gegen halb neun. Zu einer Uhrzeit also, zu der vorne im Foyer der Hypo-Union schon so viel Betriebsamkeit herrschte, dass selbst die Videoüberwachung keine echte Hilfe mehr für die anschließenden Ermittlungen sein würde. Zumindest konnte sich bis dahin jeder unbemerkt unter die Angestellten und Geschäftskunden mischen, die das Foyer am frühen Vormittag bevölkerten. Jeder konnte um diese Zeit unauffällig aus dem Gebäude verschwinden. Auch diejenigen, die etwas damit zu tun hatten, dass hinter der Hecke ein Toter lag. Sie hatten nichts dem Zufall überlassen.
1
Die Innenpolitik war da, der Außenhandel, die Devisenmärkte, das Bankenressort. Und wie immer am hinteren Teil des großen Konferenztisches auch Unternehmen & Bilanzen. Carl Stolberg faltete die aktuelle Ausgabe des Finanzblatts sorgfältig zusammen und legte sie auf den leeren Platz neben sich. Das war das unmissverständliche Signal des Chefredakteurs, mit der täglichen Blattmacher-Runde zu beginnen.
Stolberg, ein schlanker, stets exzellent gekleideter Mann von 58 Jahren, war vor zwölf Jahren zum Finanzblatt zurückgekehrt – an die Spitze jener Wirtschafts-Tageszeitung, bei der er 22 Jahre zuvor als Volontär angefangen hatte. Damals hießen Eon noch Viag und Veba, TUI noch Preussag und die Telekom noch Bundespost. Die Börse war damals noch komplett um die Ecke von der Hauptwache zu Hause, und im Handelssaal wurden die Geschäfte ausgerufen statt in Computer eingegeben. Stolberg war oft auf dem Parkett gewesen, zu einer Zeit, als Lärm und Schweißgeruch im großen Handelssaal noch mehr über die Stimmung im Markt aussagten als die Kurstafel.
Mittlerweile kam er kaum noch zum Schreiben, ab und zu eine Glosse oder einen Leitartikel, hin und wieder eine Personalie über Manager oder Minister, die er meistens schon Jahrzehnte persönlich kannte. Trotzdem war er das, was sie ein Nachrichtenschwein nannten. Hungrig, unaufhörlich wühlend, wenn es darum ging, eine Geschichte auszugraben.
„Bringen wir’s hinter uns“, eröffnete Stolberg die Blattmacher-Runde. Er wusste, dass es heute wieder einmal ein zähes Geschäft werden würde. Aus Sicht eines Wirtschaftsredakteurs sind die Sommermonate geprägt von der ständigen Angst vor der leeren Seite. Es gibt keine bedeutenden Deals, keine Jahresbilanzen, keine Sitzungen der Notenbanken. Das Börsengeschäft ist schleppend, lustlos, umsatzschwach. Nicht einmal die Politik liefert brauchbare Schlagzeilen. Niemand streitet, niemand droht, niemand streikt – es ist schlichtweg entsetzlich. Im August Zeitung zu machen, ist so spannend, wie auf einem Elternabend Protokoll zu führen. Im Grunde gibt es nichts, was es wert wäre, aufgeschrieben zu werden. Aber irgendwie muss man das Blatt ja füllen.
Jan Röber, der Blattmacher am Nachrichtentisch, gab sich erkennbar Mühe, irgendetwas Zeitungstaugliches zu bieten. In Südafrika verdichteten sich Spekulationen über eine Fusion zweier großer Goldminen. Drei deutschen Industrieunternehmen der zweiten Reihe drohten Herabstufungen ihrer Ratings. Und seit Tagen kursierten Gerüchte über Finanzierungsengpässe der Nordwestdeutschen Landesbank.
„Wenn wir selbst mal wieder einen Akzent setzen wollen, hätt’ ich was anzubieten“, meldete sich Sven Schlosser aus dem Kapitalmarktressort zu Wort. „Wir haben heute einen ziemlich großen Auflauf in der Alten Oper. Ein Fachkongress über Risikobewertung in der Bilanz, Value at Risk und solche Sachen“, berichtete er. „Das hat mächtig Sprengkraft für die Großbanken.“
„Fachkonferenz“, wiederholte Stolberg mit gedämpfter Stimme. Der Chefredakteur schien davon nicht gerade begeistert. „Irgendwelche Prominenz?“, fragte er zurück.
Schlosser zählte auf: „Vier Bankvorstände, der Vize der Finanzaufsicht – na ja, und Berenbrink als Stargast.“ Franz Berenbrink, der Bundesbank-Präsident – immerhin.
„Und wer ist für uns vor Ort?“, setzte Stolberg nach.
„Ich“, meldete sich mit selbstbewusster Stimme einer der Jungredakteure, die keinen Sitzplatz mehr am großen Tisch gefunden hatten und deshalb die Konferenz stehend oder an der Wand lehnend verfolgten. Es war Oskar Willemer, einer der wortwörtlich neuen Kräfte – denn er hatte seinen Job beim Finanzblatt erst vor vier Wochen angetreten.
Der Chefredakteur ließ sich langsam in seinen Stuhl zurückfallen, legte seine Stirn in Falten und seinen Zeigefinger an die Unterlippe. „Ich freue mich, lieber Herr Willemer, dass Sie bereits nach nach so kurzer Zeit bei uns derart motiviert Außentermine wahrnehmen. Man hat mir schon geflüstert, dass Sie mit viel Elan gestartet sind – wunderbar. Aber mal Hand aufs Herz: Sind Sie denn auch der Meinung, dass Ihre Berichterstattung über den Fachkongress auf die Titelseite gehört?“
Man sah Oskar an, dass ihm die Situation unangenehm war. Ehrlich gesagt hatte er sich noch keine großen Gedanken über seinen Tagestermin gemacht – und erst recht nicht erwartet, dass ihn der Chef vor versammelter Mannschaft darüber ausfragen würde. Um seinem Ressortchef nicht in den Rücken zu fallen, entschied sich Oskar für eine diplomatische Antwort: „Schlosser hat Recht, das Thema ist explosiv. Aber es sollte gewiss reichen, wenn wir das Wichtigste, was heute in der Alten Oper geschieht, auf Seite eins einspaltig anreißen. Zumal ich ohnehin die Geschichte über die Herabstufungen der deutschen Industriefirmen spannender finde, denn das heißt doch, dass deren Finanzierungskosten steigen.“
Stolberg war anzumerken, dass es ihm gefiel, wie der neue Kollege sich selbstbewusst, aber eben nicht überheblich präsentierte.
„Chapeau!“, sagte der Chefredakteur. „Genau so sollten wir es machen. Im Mittelfeld der Titelseite jeweils Einspalter für die Goldminen und für Willemer mit dem Bundesbankchef und seinen Freunden auf der Expertenkonferenz. Und Körber, du strickst uns bitte einen vierspaltigen Aufmacher. Arbeitstitel: Deutsche Firmen vor Problemen bei der Finanzierung. Mit Zitaten von den üblichen Verdächtigen. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Also macht euch schleunigst an dieselbe.“
Damit war die Konferenz beendet, ein lautes Stühlerücken verwandelte den Tagungsraum in einen belebten Marktplatz, Redakteure und Grafiker riefen sich quer durch den Raum Absprachen zu, während fast alle wieder eilig zurück an ihre Schreibtische drängten. Einzig Schlosser und Willemer blieben zunächst noch auf ihren Plätzen.
„Moment, Carl, wir müssen dich noch kurz sprechen“, rief Schlosser dem Chefredakteur zu.
Stolberg wartete geduldig, bis die Kollegen den Raum verlassen hatten und sich der Lärm vor der Tür gelegt hatte. „Nun, worum geht es?“
Dieses Mal ergriff Oskar direkt das Wort: „Vielleicht wissen Sie ja, Herr Stolberg, dass ich vor meinem Start in Ihrem Blatt Gerichtsreporter für die Frankfurter Nachrichten war. Deshalb interessiert es mich natürlich sehr, wie das Finanzblatt mit dem Toten umgeht, der heute Nacht aus dem Dachgeschoss der Hypo-Union gestürzt ist.“
„Ganz einfach“, entgegnete der Chefredakteur, „ich sehe keinen Grund für Berichterstattung. Natürlich wird der Selbstmord Gesprächsthema in den Handelsräumen sein. Aber ich sehe in der Tatsache, dass da jemand seinen Freitod im Bankenviertel inszeniert, keinen Anlass für eine seriöse Wirtschaftszeitung, darüber zu berichten.“
„Ich würde Ihnen gerne zustimmen, Herr Stolberg“, erklärte der Redaktions-Junior. „Aber ich gehe nicht davon aus, dass es Selbstmord war.“
Der Chefredakteur wurde hellhörig. „Mit wem haben Sie telefoniert?“, fragte er neugierig.
„Ich habe mit niemandem telefoniert“, antwortete Willemer, „aber ich habe nachgedacht. Und ich komme beim besten Willen auf keine logische Begründung für einen Selbstmord. Jemand, der so deprimiert ist, dass er seinem Leben ein Ende setzt, wird gewiss keinen gewaltigen Aufwand mehr betreiben. Es ist jedoch ein gewaltiger Aufwand, unerkannt in den 47. Stock eines Bankhochhauses zu gelangen, dort die Zugangstür zum Dachgeschoss aufzubrechen, um in dieser Höhe an die freie Luft zu gelangen und sich dann genau dort über das Geländer zu stürzen, wo man garantiert erst am Vormittag entdeckt wird.“
„Und warum“, konterte Stolberg, „sollte sich ein Gewalttäter der Gefahr aussetzen, entdeckt zu werden? Ihr Argument, lieber Kollege Willemer, mag ja gegen Selbstmord sprechen, aber es spricht genauso gegen Mord. Warum sollte der Täter sein Opfer, statt es irgendwo in einer stillen Ecke umzubringen, erst ins Zentrum des Bankenviertels lotsen, in die Hypo-Union locken und auf das Dach hochjagen“, fragte er stichelnd zurück.
Oskar Willemer schien vom Einwurf des Chefredakteurs unbeeindruckt. Er wandte sich ihm direkt zu: „Eine Drohung, ein Exempel. Der Mörder schickt damit ein Signal an andere, die er einschüchtern will – wie bei einem Mafia-Mord.“
Der Chefredakteur ging die paar Schritte zum Fenster und blickte auf das hochsommerliche Frankfurt. Hinter den Messehallen ragten die Bankhochhäuser in die Höhe: die Deutsche, die Commerzbank, die Morgan Chase – und natürlich auch die Hypo-Union. „Das klingt ja gruselig. Ist aber ziemlich spekulativ, ich weiß nicht, ob man’s schon in die Zeitung …“
„Nein, natürlich nicht“, fiel Schlosser ins Gespräch ein. „Das wäre ja schon sehr anmaßend, wenn man diese halbgaren Vermutungen ins Blatt schreiben würde. Aber: Ich würde dringend davon abraten, die Geschichte zu ignorieren. Gut möglich, dass dahinter eine Affäre steckt, die Frankfurts Banken noch einige Wochen in Atem hält. Und uns natürlich auch“, mahnte der Ressortleiter.
„Ja, gut möglich“, räumte Stolberg ein, der jedoch nicht wirklich überzeugt war und deshalb noch einmal nachsetzte: „Aber wenn man den Agenturmeldungen trauen kann, dann spricht doch einiges dafür, dass es ein Selbstmörder war. Keine Hämatome, keine Griffspuren, die auf Fremdeinwirkung hindeuten. Halt einer, der sich am Ende nochmal wichtigmachen wollte.“
Oskar schüttelte den Kopf. „Ich bitte Sie, Herr Stolberg: Keine auffälligen Griffspuren, keine Hämatome – tja, das wäre uns beiden doch wohl auch noch eingefallen, wenn wir Polizeisprecher wären und Spekulationen nicht noch anheizen wollten“, spottete der Jungredakteur und redete sich in Schwung. „Den Rechtsmediziner möchte ich sehen, der bei einem völlig zerschundenen Leichnam binnen weniger Minuten feststellen kann, ob es Spuren von Fremdeinwirkung gibt. Nein, nein, Herr Stolberg, wenn es einen ersten Hinweis gibt, über den es nachzudenken lohnt, dann ist es dieser hier“, sagte Willemer und las aus einem Stapel von Agenturmeldungen vor, die er ausgedruckt und mitgebracht hatte. „Hier bei apx steht: Der Tote konnte noch nicht identifiziert werden, da er weder Einlasschip noch Ausweis oder Papiere bei sich hatte. Keine Papiere! Dann erklären Sie mir bitte einmal, wie er ganz allein ohne Ausweise in diesen Hochsicherheitstrakt gekommen sein soll. Oder meinen Sie etwa, er hat die Papiere vor dem Sprung noch extra entsorgt, um es spannender zu machen?“
Ressortchef Schlosser war aufgestanden und ging auf den Chefredakteur zu. „Carl, der Junge hat Recht, diese Geschichte gehört auf jeden Fall ins Blatt. Vielleicht als Ecke ganz unten auf Seite eins. Und ich würde schon im Eingangssatz einflechten, dass es längst nicht sicher ist, ob es sich um Selbstmord handelt.“
„Titelseite untere Ecke“, wiederholte der Chefredakteur und blickte seinen Kollegen in die Augen. „Ja, überzeugt. Links unten auf der eins.“ Er verabschiedete sich mit einem kurzen Nicken, ging zur Tür und drehte sich noch einmal um. „Sie haben mir jetzt richtig Angst eingejagt, Willemer. Die Vorstellung, dass da drüben im Bankenviertel ein skrupelloser Krimineller herumläuft, ist schon ziemlich schaurig.“
2
In der Eingangshalle der Alten Oper drängelten sich jede Menge Banker in ausgesessenen blauen oder anthrazitfarbenen Anzügen. Auch in den Bankentürmen gab es mitten im August so gut wie nichts zu tun. Da war jeder froh um ein wenig Abwechslung – und wenn es auch nur ein Fachkongress mit einem ausgesprochen unlustigen Thema war. Die hochsommerlichen Temperaturen forderten ihren Tribut. Es roch nach Schweiß – und nach süßlichen Rasierwassern, mit denen der Schweißgeruch zu überdecken versucht wurde.
Oskar Willemer war wie immer spät dran. Es war schon Viertel nach zehn, der Oberbürgermeister hatte bereits seine Grußworte gesprochen. Oskar wartete ungeduldig in der Schlange vor einem der Akkreditierungsschalter. Die meisten um ihn herum sahen tatsächlich so aus, wie er sich Banker vorstellte. Blau-weiße Hemden, goldene Armbanduhren, Seitenscheitel, Haargel, frischrasiert – seine Mutter würde sagen: geschniegelt. Keine Nickelbrillen, keine wilden Locken – und auch keine langen Koteletten, wie Oskar sie hatte. Und natürlich besaß in der ganzen Oper an diesem Vormittag auch niemand einen Dreitagebart wie er. Der hätte den anderen um ihn herum allerdings auch wirklich nicht gestanden. Bei Oskar hingegen passten die Bartstoppeln zum markanten, schmalen Gesicht. Mit seinen funkelnden grün-blauen Augen und dem vollen dunkelblonden Schopf war der schlanke 32-Jährige ohnehin einer, der es einfach hatte, Frauen zu gefallen. Selbst seine zerzausten Haare, die bei anderen ungepflegt gewirkt hätten, schienen ihn eher noch interessanter zu machen.
Endlich kam er an die Reihe. „Guten Morgen, ich bin leider nicht vorangemeldet, aber ich habe meinen Presseausweis dabei. Oskar Willemer vom Finanzblatt.“
„Tut mir leid, aber ohne vorherige Akkreditierung kommen Sie heute leider nicht rein. Wir haben erhöhte Sicherheitsstufe“, entgegnete ihm eine ganz in Gelb gekleidete Hostess ebenso freundlich wie bestimmt.
„Hören Sie“, versuchte es Oskar mit seinem freundlichsten Lächeln. „Ich verstehe absolut, dass Sie hier auf Nummer sicher gehen müssen, aber ich kann mich ausweisen und muss unbedingt …“
„Nein, tut mir leid“, fiel ihm die Hostess ins Wort. „Es besteht nicht die geringste Chance. Wenn Sie mir Ihre Visitenkarte geben, kann ich den Pressesprecher der Bankenaufsicht bitten, Ihnen die Reden zuzumailen. Mehr ist beim besten Willen nicht drin.“
Oskar ahnte, dass es die junge Frau mit dem gouvernanten Ton ernst meinte. Wahrscheinlich wäre das dann die erste Frankfurter Bankenkonferenz seit dem Zweiten Weltkrieg ohne Beteiligung eines Korrespondenten des Finanzblatts.
„Ich bitte Sie inständig. Meine Zeitung schmeißt mich raus, wenn ich hier nicht reinkomme.“
„Und wir“, entgegnete ihm die Frau in Gelb ungerührt, „schmeißen Sie raus, sollten Sie es dennoch versuchen. Bitte haben Sie Verständnis. Ich würde ungern den Hausdienst bemühen.“
Oskar hatte nicht die geringste Lust, Bekanntschaft mit den Saaldienern zu machen. Ein Rausschmiss wäre für ihn noch peinlicher, als es die Situation ohnehin schon war. Er schnappte sich deshalb nur noch rasch ein Programm und verschwand nach draußen.
Am Brunnen vor der Oper machte er halt und kühlte sich die Hände. Verdammt nochmal, selbstverständlich war es seine schuld. Natürlich hatte ihm Ressortchef Schlosser aufgetragen, sich anzumelden. Aber da waren die vielen anderen Aufgaben gewesen, die er in seinen ersten Dienstwochen hatte erledigen müssen. Und darüber hatte er die Anmeldung schlicht vergessen.
„Mein lieber Kokoschinski, so lässt sich’s aushalten“, sagte eine heitere, tiefe Stimme.
Oskar blickte sich erschrocken um und entdeckte nur wenige Meter entfernt vom Opernbrunnen Benjamin, einen seiner ältesten Freunde und Rugby-Kumpel, der jetzt als Reporter für die Nachrichtenagentur Worldnews arbeitete.
„Erst mal ’ne Stunde Sonnenbad, dann die dreistündige Mittagspause. Und am späten Nachmittag schreibst du dann 80 Zeilen aus unserem Tickermaterial zusammen. Mannomann, du hast ein scheißfaules Leben, Oz.“
Oz war Oskars Spitzname in der Rugby-Mannschaft.
Benjamin Beckmann war der geborene Rugby-Stürmer. Ein groß gewachsener Kerl mit der Figur eines Tiroler Bauernjungen, mit kräftigen Oberarmen und Schenkeln, die in keiner Jeans genug Platz fanden. Dazu forsch im Auftritt, unverzagt, kühn. Zugleich war er der Prototyp des Agenturreporters. Ein Jäger und Sammler, der alle möglichen Informationen aufsaugte, um sie gefiltert wieder auszuspucken, wenn es dafür einen Anlass gab. Ständig unter Strom, nie abgeschaltet – ein Leben im Stand-by-Modus. Oft den Kragen verdreht, das Hemd hinten aus der Hose, den Schlips viel zu locker und stets ein wenig übernächtigt.
„Ich habe bereits drei Geschichten auf dem Draht“, gab Benjamin keine Ruhe. „Du hingegen hast dich wahrscheinlich eben erst aus dem Bett gepellt und machst trotzdem gleich mal Siesta am Opernbrunnen.“
Oskar war heilfroh, seinen Kumpel zu sehen. „Ben, du musst mich irgendwie in die Oper schleusen“, flehte er ihn an. „Das gibt sonst ein riesiges Ballyhoo beim Finanzblatt.“
Benjamin beruhigte seinen Rugby-Teamkollegen: „Keine Bange. Das kriegen wir schon hin. Worldnews hat wie immer vorsorglich Ersatzleute angemeldet. Du gehst einfach mit dem Ticket unseres Amerikaners rein, Tim O’Bowman.“ Mit diesen Worten legte er ihm freundschaftlich seinen Arm um die Schulter und führte ihn wieder Richtung Opern-Eingang. „Ich bin mir allerdings sicher, Oz, dass du das bereuen wirst. Spätestens beim zweiten Vortrag. Denn vergnügungssteuerpflichtig ist das ganz sicher nicht, was da geboten wird.“
5
Und Sie glauben wirklich, dass sich irgendjemand für diese staubtrockenen Themen interessiert?“, fragte Franz Berenbrink seinen Pressesprecher Tobias Heinen ungläubig.
Die beiden saßen nebeneinander auf der Rückbank des silbernen Daimlers mit den Panzerglasscheiben, in dem der Bundesbankchef zu seinen Terminen gefahren wurde. Berenbrink blickte mit miesepetriger Miene auf den 18-seitigen Text der Rede, die er in wenigen Minuten halten sollte. „Downside-Risk, Volatilität, Barwert – kein normaler Mensch hat bei 29 Grad im Schatten Nerven für solch einen Mumpitz“, schimpfte Berenbrink.
„Herr Präsident, Sie sprechen ja auch nicht vor normalen Menschen“, entgegnete ihm sein Sprecher, der es gewohnt war, dass sein Chef vor Pflichtauftritten auf Bankkongressen oder bei Hearings maulig war.
Von seinem Äußeren her passte Berenbrink durchaus in die Rolle des Notenbankers. Sein schlankes, strenges Gesicht und sein gescheiteltes graues Haar verliehen dem immer noch athletisch wirkenden 65-Jährigen Würde und Autorität. Auch brachte Berenbrink die nötige Kondition mit, um selbst schwierige Verhandlungen zu überstehen. Allerdings passten sein lebhaftes Temperament und sein direkter und manchmal frecher Umgangston so gar nicht zur landläufigen Vorstellung eines staatsmännischen Bundesbankers. Als lästige Pflicht empfand er zudem die vielen gesellschaftlichen Auftritte. Berenbrink war ein Mann wahlweise für den Poker im Hinterzimmer oder für das schnelle Bier an der Theke. Aber garantiert nicht für die Gala im Ballsaal. Und ganz sicher passte sein Arbeitsstil nicht zu dem von Behördengesichtern wie Pressesprecher Tobias Heinen, dem die Krawatte regelrecht an den Hals gewachsen war.
„Schwer zu sagen, mit welchen Fragen Sie die Nachrichtenagenturen heute bombardieren werden“, lenkte Heinen das Gespräch auf das, was seinen Chef bei der Ankunft an der Alten Oper erwartete. Wie bei jedem öffentlichen Auftritt Berenbrinks würden ihn auch an diesem Tag die üblichen Verdächtigen bei der Ankunft abfangen: die Reporter der Nachrichtenagenturen. Realtime, Worldnews, apx, dpx und wie sie sonst alle hießen. Viele waren es ja nicht mehr, denn in Zeiten massenweiser, kostenloser Informationen im Internet war es immer schwieriger geworden, mit Nachrichten Geld zu verdienen. Weltbekannte, traditionsreiche Branchengrößen wie Reuters,Bloomberg oder Dow Jones waren unter diesem wirtschaftlichen Druck gezwungen gewesen, Kräfte zu bündeln und Korrespondentenplätze zusammenzufassen. Das Nachrichtengeschäft von Reuters und Dow Jones war schließlich unter dem neuen Markennamen Realtime gebündelt worden, während der Newsticker von Bloomberg in Kombination mit einigen lokalen Anbietern in der Agentur Worldnews aufgegangen war. Die beiden Marktführer – Realtime und Worldnews – waren die mit weitem Abstand größten Anbieter. In mehr als 80 Prozent aller Handelsräume in London, Frankfurt oder Mailand waren ihre Ticker-Bildschirme die wichtigste, häufig sogar die einzige Informationsquelle für die Wertpapierhändler, die sich an den Nachrichten der beiden Großen orientierten.
In der alltäglichen Praxis – wie etwa heute in der Alten Oper – hieß das für die Reporter der zwei großen Finanz-Nachrichtenagenturen, dass sie Ministern, Notenbankern oder Vorstandschefs ständig aufs Neue Zitate aus den Rippen zu leiern hatten. Zitate, in denen möglichst Wörter wie Zinsen, Wechselkurse oder Inflation vorkommen sollten. Oder die aus irgendeinem anderen Grund als Futter für Spekulationen taugten, um Aktienkurse, Anleihenotierungen, Geldmarktsätze oder Devisen in Bewegung zu versetzen. Schließlich leben Banken und Börsen vom ständigen Auf und Ab der Kurse, von Provisionen und Transaktionsgebühren. Ein öffentlicher Satz eines hochrangigen Managers oder eines Notenbankers war da allemal gut genug, um in den Handelsräumen der Profi-Investoren Spekulationen und Gerüchte auszulösen – und damit Käufe und Verkäufe von Wertpapieren. Selbst wenn Berenbrink sich nur wiederholte, konnte das den Euro am Devisenmarkt einen halben Cent nach oben schieben. Oder die Aktienkurse der Bank- und Versicherungstitel in den Keller rasseln lassen. Die Kunst eines Notenbank-Präsidenten bestand deshalb darin, stets so unverbindlich wie möglich zu bleiben, um ja keine turbulenten Kursbewegungen anzustoßen. Oder wie es der Altmeister des Fachs, der frühere US-Notenbankchef Alan Greenspan, einst auf den Punkt brachte: „Ich hoffe, ich habe mich zweideutig genug ausgedrückt.“
„Eigentlich, Herr Präsident“, fuhr Pressesprecher Heinen fort, „gibt es im Moment so gut wie nichts, worauf die Wertpapier-Profis spekulieren können. Keine Zinsfantasien, keine außergewöhnlichen Konjunkturdaten. Ich tippe mal, dass man Sie deshalb auf die angeblichen Liquiditätsprobleme der NordwestLB ansprechen wird.“
„Na, dann raus mit der Sprache, Heinen. Sie wollen doch bestimmt wieder, dass ich irgendeinen blöden Satz sage, über den heute früh ihre halbe Abteilung gebrütet hat?“, fragte der Bundesbankchef.
„Tja. Ja. Ja, das stimmt. Die Kollegen von der Bankenaufsicht haben sich gestern an uns gewandt und uns um den Gefallen gebeten, die Märkte zu massieren“, antwortete Heinen. Die Märkte massieren bedeutete, der Notenbankchef sollte ein paar beschwichtigende Sätze loswerden, um Aufgeregtheit aus dem Markt zu nehmen und die Investoren zu beruhigen.
„Und was genau würden die von der Bankenaufsicht gerne hören?“, fragte der Präsident nach.
„Ich glaube, Herr Präsident, man würde es als hilfreich empfinden, wenn Sie in der aktuellen Lage eine Unbedenklichkeitserklärung für die deutschen Banken abgeben würden. So etwas wie: Kein Anlass zur Sorge. Oder: Unbegründete Spekulationen. Halt irgendetwas, was Vertrauen stiftet.“
„Na gut, Heinen,“ seufzte der Präsident, „wenn es irgendjemanden nutzt, dann stelle ich mich auch auf den Kopf, wackle mit den Beinen und sage, dass es keinen Grund zur Besorgnis gibt“, versicherte Berenbrink.
Sie passierten den Rothschildpark und der Bundesbankchef blickte hinüber zum Hypo-Union-Tower: „Was ist eigentlich heute bei denen los gewesen?“
„Ein Selbstmörder hat sich aus dem obersten Stockwerk gestürzt“, antwortete ihm Heinen, „und bisher weiß man noch nicht viel. Ich glaube sogar nicht einmal den Namen des Opfers.“
Berenbrink blickte dem Bankenturm einen Moment nach. Er stellte sich vor, wie es wohl sei, aus dieser gigantischen Höhe nach unten zu stürzen. Ob es ein lautes Geräusch geben würde, wenn man unten aufschlug? Aus diesen Gedanken wurde er jedoch jäh herausgerissen, weil sie die Vorfahrt zum VIP-Eingang der Alten Oper erreicht hatten.
„Nun denn, auf in den Kampf“, munterte ihn Heinen auf.
Gleich neben der großen Holztür lungerten bereits die Reporter von Worldnews und Realtime sowie einiger Spezialagenturen wie Bondmarket, ETF, afx und dpx. Berenbrink kannte ihre Gesichter auswendig, weil sie ihm zu allen offiziellen Terminen folgten – immer auf der Jagd nach einem Zitat. Berenbrink pflegte einen herzlichen, mitunter sogar lausbubenhaften Umgang mit der „Meute“, wie sich die Agenturreporter selbst nannten.
„Na, ihr alten Blutegel, was zur Hölle soll ich euch denn sagen, was ich nicht schon gesagt habe?“, fragte er in die kleine Runde, nachdem er die Limousine verlassen hatte.
Berenbrink lächelte das halbe Dutzend Presseleute freundlich an und reichte den Reportern nacheinander die Hand zur Begrüßung – eine höfliche Geste, die die Agenturleute längst nicht von allen Prominenten gewohnt waren. „Auf jeden Fall ziehe ich den Hut vor euch, Leute. Ihr schreckt ja wirklich vor gar nichts zurück.“ Der Bundesbankchef setzte eine mitleidsvolle Miene auf und fuhr fort: „Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann musstet ihr Bedauernswerten bei diesem Schwimmbad-Wetter ein Grußwort des Oberbürgermeisters ertragen – womöglich sogar in seinem eigenwilligen Englisch … uff.“
„Stimmt“, entgegnete ihm ein breitschultriger Typ mit frecher Stimme. „Aber der eigentliche Härtetest steht noch aus: ein Berenbrink-Vortrag über standardisierte Risikomessung in Banken.“ Es war der Worldnews-Reporter Benjamin Beckmann.
„Vorsicht, Beckmann“, warnte ihn der Bundesbankchef mit gespielter Entrüstung, allerdings mit einem breiten Lächeln. „Vorsicht. Nicht so vorlaut. Und vor allem: nicht so voreilig. Das mit den Standardrisikomaßen mag langweilig klingen. Aber natürlich ist es ungemein wichtig, dass Banken ihre Positionen vernünftig und angemessen bewerten, damit ihnen diese Risiken nicht aus dem Ruder laufen.“
„So wie der NordwestLB?“, hakte Beckmann rasch ein.
„Es gibt keinen Grund für argwöhnische Spekulationen über irgendeine deutsche Bank“, versicherte der Bundesbankchef. „Es gibt nicht den geringsten Zweifel an der Solidität der deutschen Banken.“ Berenbrink blickte seinen Pressesprecher Heinen an, der anerkennend nickte. Der Bundesbankpräsident hatte seine Sätze ordnungsgemäß abgeliefert, sein Pressesprecher war zufrieden – und die Meute war es auch. Die Agenturreporter hatten ihren Stoff. „Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte“, sagte der Notenbanker, „denn ich sehe gerade meinen österreichischen Kollegen – und es wäre unhöflich, ihn nicht zu begrüßen.“
Die Agenturreporter ließen Berenbrink fürs Erste gewähren. Er hatte ihnen genug geliefert, und so wählten sie bereits hastig per Handy ihre Redaktionen an und gaben ihre Eilmeldungen durch.
6
Ein paar Minuten war Oskar orientierungslos durch Foyers und Gänge der Alten Oper geirrt. Dann aber hatte er doch den Agentur-Arbeitsraum gefunden. Er war leer, alle Reporter saßen wahlweise unten im Mozartsaal und lauschten den Vorträgen oder warteten am VIP-Eingang, um Bundesbankchef Berenbrink abzufangen. Oskar schlich durch die Reihen und lunste auf die Bildschirme der aufgeklappten Laptops. Überall blinkten Schlagzeilen und Zahlenkolonnen. Schreibfelder warteten darauf, mit neuen Nachrichten ausgefüllt zu werden. Oskar entdeckte vorformulierte Meldungen auf den Bildschirmen und schnüffelte in den handschriftlichen Zetteln herum, die überall auf den Tischen lagen.
Es ist schon ein abgeschmacktes Leben, das die Agenturleute führen, dachte er für sich. Irgendwo ankommen, die Computer anschließen, alle möglichen Quellen anzapfen, um sich so schnell wie möglich auf den aktuellen Stand zu bringen. Dann herumlungern, Prominente abfangen – eine Meldung rausdonnern, vielleicht auch zwei oder drei. Und danach sofort wieder abbauen und abhauen. Journalistische Nomaden, Wegelagerer, deren einzige Verwurzelung in einer kabellosen Verbindung zur Heimatredaktion bestand.
Oskar blieb vor einem Laptop stehen, der augenscheinlich seinem Rugby-Kollegen Benjamin Beckmann gehören musste. Denn erstens lief auf ihm das Programm der Agentur Worldnews, bei der Ben arbeitete. Und zweitens lag daneben ein Adressbuch, auf dem ein Aufkleber der Eintracht-Abteilung prangte: Spende Blut, spiele Rugby!
Auf dem Bildschirm des Laptops blinkten die aktuellen Meldungen der vergangenen Minute, darunter eine Eilmeldung in roter Schrift: Berenbrink: „Kein Zweifel an der Solidität deutscher Banken“. Oskar schüttelte den Kopf. Was für eine überdrehte Welt, was für ein irrer Wettlauf mit der Zeit!
Durch das geschlossene Fenster hatte er den Opernvorplatz im Blick und konnte dort die Limousine des Bundesbankchefs erkennen. Wenige Meter davon entfernt schüttelten sich Menschen die Hände, die wichtig aussahen und von anderen umringt wurden. Oskar erkannte unter ihnen den Präsidenten der Österreichischen Nationalbank. Und ihm gegenüber stand … na klar, das war Berenbrink – jetzt, wo sich der Bundesbankchef drehte, konnte Oskar ihn einwandfrei identifizieren. Mein Gott, da unten, in Rufweite, stand der oberste deutsche Währungsmanager und hatte noch nicht einmal das Foyer betreten. Aber das, was er vor wenigen Sekunden gesagt hatte, als er aus seinem Auto ausstieg, war durch schnellen Zuruf per Handy an die Newsdesks in den Agenturen übermittelt und von dort aus in alle Welt verbreitet worden – und deshalb nun bereits auf jedem Nachrichtenticker in den Börsenhandelsräumen zwischen New York und Singapur zu lesen, also auch hier auf den Laptops in der zweiten Etage der Alten Oper.
Benjamin hatte ihm neulich nach dem Rugbytraining unter der Dusche erzählt, dass sie bei Worldnews und Realtime mittlerweile daran arbeiteten, Nachrichten von Computern schreiben zu lassen, die sie wiederum so formulierten, dass andere Computer sie fehlerfrei lesen konnten. Denn viele Kunden nutzten Programme, die automatische Börsenaufträge in Tausendstelsekunden aufgeben konnten. Mit ihnen war es möglich, um den Bruchteil einer Sekunde eher im Orderbuch der elektronischen Handelssysteme aufzuschlagen und die Gebote auf der Gegenseite schneller abzuräumen, als das selbst dem schnellsten Händler mit manueller Auftragseingabe gelingen konnte. Völlig losgelöst von der realen Wirtschaft, in einer jenseits der Wahrnehmungsgrenze beschleunigten Welt, wechselten milliardenschwere Wertpapier-Pakete ihre Besitzer – und die Nachrichten verkümmerten in diesem entrückten Handelssystem zur Verdichtung von Kauf- und Verkaufsignalen, zu einem Sammelsurium von positiven und negativen Codes, die von Maschinen mit pawlowschen Reflexen formuliert und übersetzt wurden.
Oskar stand am Fenster und beobachtete, wie sich die kleine Menschentraube auf dem Opernvorplatz auf den Eingang zubewegte. Er kippte das Fenster, der leichte Luftzug tat gut. Er drehte sich noch einmal zu Benjamins Laptop um. Dort war der Name Berenbrink bereits vom Bildschirm verschwunden. Die Eilmeldung über die Banken war längst verdrängt durch Rohstoffmeldungen aus Lateinamerika und Schlagzeilen über das Quartalsergebnis einer Schweizer Versicherung. Was vor zwei Minuten noch den DAX bewegte, war jetzt schon Geschichte.
Oskar richtete sich in der letzten Reihe des Arbeitsraums ein. Hier oben war es nicht nur frischer als unten im stickigen Mozartsaal, es gab auch Verpflegung. Außerdem würde er hier inmitten der Agenturen wohl kaum etwas Wichtiges verpassen. Einzig ärgerlich war, dass beim aufgestellten Großbild-Fernseher, der die Reden aus dem Mozartsaal übertrug, der Ton abgeschaltet war. Na gut, dachte sich Oskar, da muss ich mich wohl selbst drum kümmern, das Gerät auch akustisch wieder zum Laufen zu bringen.
Er öffnete eine Colaflasche an der Stahlkante des Serviertischs, trank sie halb leer und krabbelte dann unter den mit einer großen weißen Decke abgehängten Tisch, auf dem der Großbildschirm stand. Hier unten war es ein wenig muffig, der Teppichboden roch leicht säuerlich. Außerdem war es duster, weil die Tischdecke nach vorne hin abdunkelte.
Es gab so viele Kabel und Stecker, dass Oskar einige Momente brauchte, um sich zu orientieren. Er robbte noch ein Stück nach vorne, sodass auch seine Beine und Füße komplett unter dem Tisch und der Tischdecke verschwanden. Dann drehte er sich leicht seitwärts, um besser in die eigene Hosentasche greifen zu können, kramte sein Handy hervor und nutzte es als Taschenlampe, um die Kabel genauer zu inspizieren. Er musste nicht lange suchen, um das Problem zu entdecken. Der Ton konnte gar nicht übertragen werden, denn die Audiokabel waren durchgeschnitten.
„Was soll das denn?“, wunderte sich Oskar. Er versicherte sich noch einmal, dass er die Leitungen nicht verwechselt hatte, aber es gab nicht den geringsten Zweifel: Die Ton-Übertragungskabel waren mit einem scharfen Schnitt durchtrennt – ein Umstand, auf den sich Oskar auch nach einigem Überlegen keinen Reim machen konnte. Ergebnislos brach er seinen Reparaturversuch ab, verstaute das Mobiltelefon wieder in seiner Hosentasche und begann, sich rückwärts zu bewegen, um unter dem Tisch hervorzukriechen.
7
Im Dibbegucker waren zu dieser Tageszeit alle Tische besetzt. Selbst vorne am Buffet, wie in Sachsenhäuser Kneipen der Ausschank an der Theke heißt, war es schwer, einen freien Quadratmeter zu finden. Aber der Wirt des Dibbeguckers, den sie hier alle nur den Dicken Heiner nannten, hatte natürlich immer noch ein paar Plätzchen in Reserve für Stammkunden und gute Freunde des Hauses. Und zu dieser privilegierten Gruppe zählte schon seit Ewigkeiten Carl Stolberg, der Chefredakteur des Finanzblatts. Er konnte auch ohne Voranmeldung mit einem Sitzplatz rechnen – erst recht, wenn er gemeinsam mit Frankfurts neuem Polizeipräsidenten auftauchte.
Christian Herzog, ein großer und kräftiger Mann mit Locken, dessen Stirn im Sommer ständig nass von Schweiß glänzte, hatte eine beeindruckende Karriere vorzuweisen. Er war mit 44 Jahren der mit Abstand jüngste Polizeipräsident, den Frankfurt je gesehen hatte. Das lag sicherlich auch an seinem forschen Auftritt. Herzog vermittelte den Eindruck, dass er die Probleme beherzt anpackte, dass er den Mut auch zu schwierigen Entscheidungen hatte. Und dass er ungewöhnlichen Methoden gegenüber durchaus aufgeschlossen war, solange sich niemand über das Recht stellte.
„Da kommt halt grad mit dorsch hinner ins Kaminzimmer“, lotste der Dicke Heiner den Journalisten und den Polizeichef durch die Menge – und fand für sie tatsächlich noch zwei Sitzplätze im schönsten Gastraum der Apfelwein-Schänke.
„Eigentlich hätte ich ja allen guten Grund, auf Sie sauer zu sein, Stolberg“, eröffnete der Polizeichef, kaum dass er Platz genommen hatte, das Gespräch gewohnt offensiv und hielt sich nicht lang mit Freundlichkeiten auf. „Ihr verdammter Leitartikel über die Pannen beim polizeilichen Personenschutz hat im Präsidium für ziemlichen Wirbel gesorgt“, schimpfte Herzog.
Stolberg reagierte darauf mit unschuldiger Miene: „Mal ehrlich, Herr Herzog, Sie können mir doch nicht ernsthaft böse sein wegen dieses Kommentars? Oder habe ich Ihren Beamten darin unrecht getan?“
Der Polizeichef musterte sein Gegenüber, nahm sein Rautenglas und leerte es mit einem kräftigen Schluck. „Nein, natürlich nicht. Meinetwegen hätten Sie sogar noch fester draufhauen können auf die Kollegen. Was mich ärgert, ist, dass Sie damals besser darüber informiert waren, was bei uns so alles schiefgelaufen ist, als ich.“ Herzog nahm den Bembel und füllte das Rautenglas neu auf. „Und was zur Hölle wollen Sie nun noch von mir wissen? Sie haben doch schon alles geschrieben, was es zu schreiben gibt.“
„Da haben Sie recht“, entgegnete der alte Mann des Finanzjournalismus freundlich. „Ich interessiere mich im Moment auch gar nicht für Ihre Behörde. Sondern nur für einen ganz besonderen Fall, mit dem Sie aktuell zu tun haben. Präzise gesagt, für einen Fall aus dem 47. Stockwerk des Hypo-Union-Towers.“
Mit dieser Anfrage hatte Herzog nicht gerechnet. Er lehnte sich zurück, atmete tief durch und fuhr sich mit der Hand ins Gesicht, um sich den Schweiß von der Nase zu wischen und die Augen zu massieren. Man merkte ihm an, dass er sich konzentrierte, um ja nichts zu sagen, was er schon in wenigen Minuten bereuen würde. Nach einer kurzen Denkpause hatte er seine Gedanken geordnet.
„Am liebsten, Stolberg, würde ich Ihnen überhaupt nichts sagen. Ich meine: Wir sprechen immerhin über eine Tat, die gerade mal ein paar Stunden zurückliegt. Wir wissen bislang nicht viel. Und das Wenige, was wir wissen, ist so verwirrend, dass noch kein klares Bild entsteht … Aber ich fürchte, dass wir Ihre Hilfe noch gut werden brauchen können – und deshalb packe ich die Gelegenheit beim Schopfe und schlage Ihnen einen Deal vor.“
Der alte Journalist traute seinen Ohren nicht. Immerhin hatte er ja um diese Unterredung gebeten und war nun doppelt überrascht, dass Herzog etwas von ihm wollte. „Sie glauben, dass ausgerechnet ich Ihnen bei Ihren Ermittlungen helfen kann?“, fragte er erstaunt zurück.