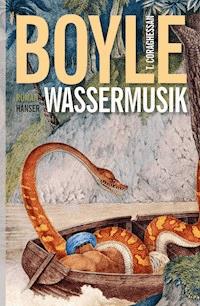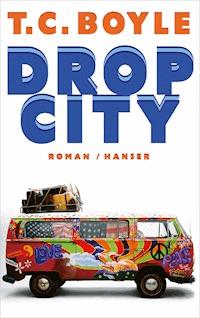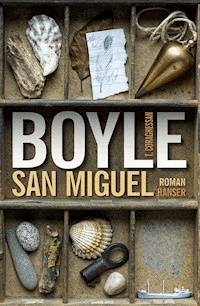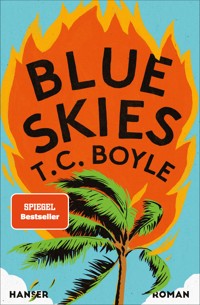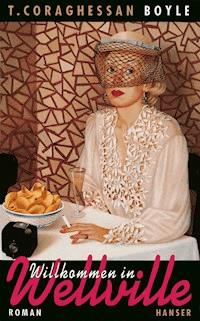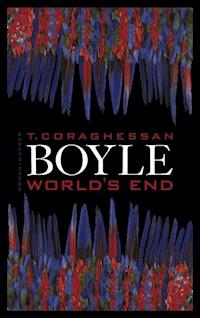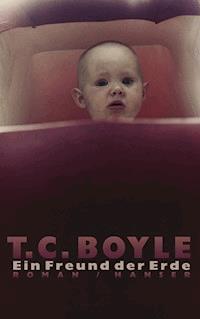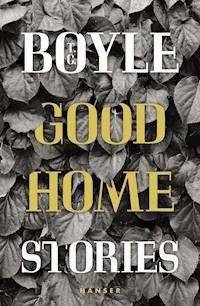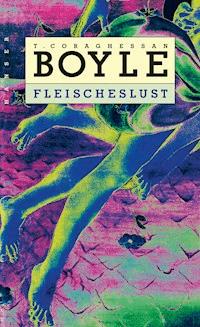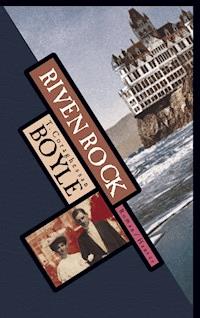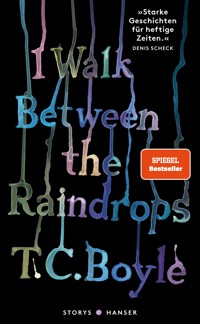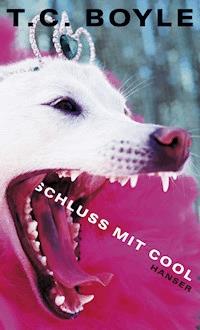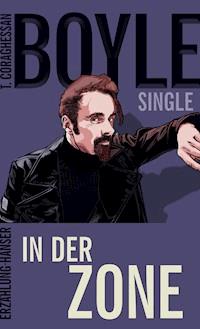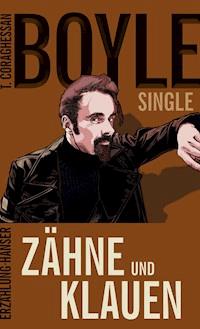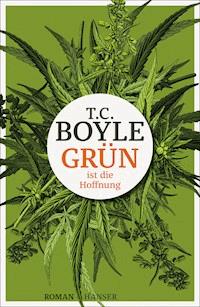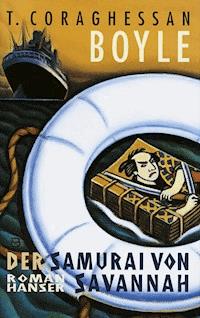Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben einer Familie in der jüdischen Kolonie Kitchawank. Auf ewige Winter folgen Sommer voller Zukunft: Lagerfeuer und Cocktails, die Männer spielen Volleyball auf dem jährlich aufgeschütteten Seestrand. Miriam sieht, wie Kinder Erwartungen enttäuschen, wie unerwünschte Ehen geschlossen werden und Freundschaften zerbrechen. T. C. Boyle setzt die Gesetze der Zeit außer Kraft und erzählt in Momentaufnahmen ein ganzes Leben. Eine von Boyles brillantesten Erzählungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 51
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
T.C. Boyle
Tod in Kitchawank
Aus dem Englischenvon Anette Grube
Samstag kurz nach zwei, die Sonne eine heiße Kompresse auf ihren Schultern und dem Kopf, das Kreischen und Schreien der Kinder, die im flachen Wasser planschen, die übliche Symphonie. In ihrem Rücken das harte Tock des schweren schwarzen Gummiballs, der so regelmäßig wie ein Herzschlag von Schläger zu Schläger schießt und gegen die Mauer prallt, bis einer der Männer sich verrechnet und der Ball im Schlepptau eines unterdrückten Fluches einen Herzstillstand erleidet. Ein Schlag, zwei und dann wieder: Tock. Sie denkt, sie hätte besser den Strohhut mit an den Strand nehmen sollen, weil sie keine schmale rote Linie Sonnenbrand auf dem Scheitel haben möchte, doch darüber wird sie sich später Sorgen machen – oder vielleicht überhaupt nicht. Sie hat den Hut seit einer Woche oder länger nicht aufgesetzt – sie mag Hüte nicht, Hüte sind Dinge aus den Tagen ihrer Mutter –, und sie ist tief gebräunt, auch am Haaransatz. Sie trägt die übergroße Sonnenbrille, die sie gestern in der Drogerie gekauft hat, und den schwarzen Badeanzug vom letzten Jahr, der um die Hüfte und Taille vielleicht ein bisschen eng ist, aber na und? Sie wird hier nicht zur Schau gestellt. Es ist ihr Strand, ihr See, es sind ihre Leute. Die Menschen hier, die in Liegestühlen sitzen oder auf flauschigen Handtüchern oder Stranddecken liegen mit Taschenbüchern und Zeitungen und Wiener Würstchen von National Hebrew, sind ihre Freunde und Nachbarn. Das ist der Frieden im Zentrum ihres Lebens. Dieser Samstag im Juli, an dem ihre Gedanken frei sind und hinauf bis zur Sonne und wieder zurück schweifen, und ihre einzige Sorge ist, die Träger auf ihren Schultern zu verrücken und sich die Lippen einzucremen, damit sie nicht rissig werden.
Im Haus, das sie sehen könnte, wenn sie den Kopf drehen und über die Schulter schauen würde vorbei am Imbissstand und den Paddle-Tennis-Plätzen und der großen, offenen, grasbewachsenen Fläche, auf der junge Paare Hand in Hand herumschlendern und Jugendliche Baseball spielen, steht der Kühlschrank, vor drei Jahren neu gekauft und so voll, als wäre er schon hundert Jahre alt. In seinen kühlen Tiefen liegen die Steaks in Honig-Ingwer-Marinade zugedeckt auf einer Platte, stehen der Kartoffel- und der Krautsalat, die sie nach dem Frühstück gemacht hat, und der Rose’s Lime Juice und Wodka für die Gimlets. Alles ist gut. Was macht es da schon, dass der warme weiche Sand unter ihren Füßen jedes zweite Jahr auf Kosten des Kitchawank-Kolonie-Vereins mit Lastwagen hierhertransportiert werden muss, wo seine Hunderte Milliarden Körner im hohen Gras verschwinden, in den See gespült werden, an Zehen und Fußsohlen und gebräunten sehnigen Knöcheln kleben bleiben, nur um dann auf Badezimmerfliesen und unter der Küchenspüle zu landen? Er ist so wesentlich wie die Luft, wie das Wasser: Wie könnte es einen Strand ohne Sand geben?
Das nächste Mal schlägt sie die Augen auf, weil sich Susan, ihre Jüngste, an sie schmiegt, ein kurzer kalter Schock, und plötzlich ist sie nass, als hätte jemand einen Korb Fische auf ihrem Schoß ausgeleert. Sie spürt die kalten Knie gegen sich stoßen, den bibbernden Brustkasten und die klappernden Zähne, hört ihre eigene erschrockene Stimme: »Geh weg, Schatz, du bist ja ganz nass!« Und Susan, sommersprossig, dürr, zehn Jahre alt, schmiegt sich fester an sie. »Mit ist kalt, Mama.« Sie langt nach hinten zur Strandtasche und zum Handtuch, das sie für sich selbst mitgenommen hat, spart sich die Mühe zu fragen, wo das Handtuch ihrer Tochter ist, denn sie weiß, dass es am Rand des Spielfelds oder am geschmiedeten Klettergerüst hängend wieder auftauchen wird, patschnass wie ein Spüllappen. Und sie wickelt sie ein und drückt sie an sich, bis das Bibbern aufhört und ihre Tochter aufspringt, um einem halben Dutzend anderer Kinder zum Imbissstand nachzulaufen. Um sich ein eiskaltes Coke, Winter in der Flasche, und ein Wiener Würstchen in einem Brötchen zu holen. Mit gehackten Zwiebeln und süßsaurer Soße und viel Senf. Sie hebt einen Augenblick die Sonnenbrille an und sieht ihr nach, und da sind die Sollovays, die Greens, die Goldsteins, die sie begrüßen und miteinander scherzen und sich gut gelaunt neben ihr niederlassen. Marsha Goldstein schlägt die seidigen Beine übereinander, lächelt mit zuckenden Lippen und bietet ihr eine Zigarette an, doch sie zieht ihre eigenen vor, und sie zünden sich beide eine an und lassen sich vom Tabak hochheben, bis sie beide gleichzeitig, als hätten sie es geprobt, den Kopf zurücklegen und zwei lange blaue Rauchwolken ausatmen. »Wann sollen wir heute Nachmittag kommen?«, fragt Marsha. »So um fünf?«
»Ja«, sagt sie, »ja, das wäre perfekt«, und schaut über die Schulter, an den Spielfeldern und dem Maschendrahtzaun und dem Schirm aus Bäumen vorbei zu ihrem Haus, das still auf seiner kleinen Anhöhe steht – das einzige Haus von den über zweihundert Häusern der Gemeinde, das direkt auf den See hinausgeht, und sie versucht, nicht zu sündhaft stolz darauf zu sein. Da steht der Buick, das Modell vom letzten Jahr, auf der Einfahrt wie auf einem Foto aus einer Zeitschrift, und die Schaukel, die sie für Susan und ihre Freundinnen aufgestellt haben, obwohl das große eiserne Gestell der Schaukel auf dem Spielplatz neben dem See nur einen Steinwurf entfernt ist. Der japanische Ahorn, den sie zur Geburt ihrer Tochter gepflanzt hat, hebt sich als Relief vor der Hausmauer ab und wirft einen fein gemusterten Schatten über den gefliesten Weg zur Küchentür. Seine Blätter sind von der Farbe des roten Bordeaux, den Sid gern nach dem Abendessen trinkt. Ihr Blick verweilt dort einen Augenblick, bevor sie ihn zum Haus selbst hebt. Und es ist komisch, denn weil der See das Licht reflektiert und weil sich das große Panoramafenster im Schatten befindet, kann sie in ihre Küche sehen bis zum Tisch, der bereits für das Abendessen gedeckt ist, und zur tickenden Uhr an der gelben Wand, und es ist fast so, als wäre sie an zwei Orten gleichzeitig.