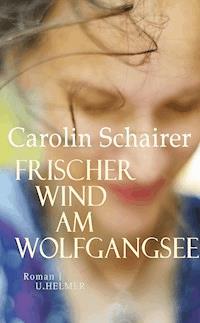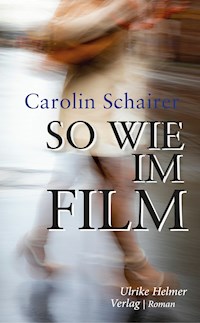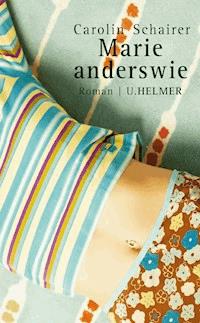9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: CRiMiNA
- Sprache: Deutsch
Kaum hat Gesine Hofmann – frisch getrennt – sich als Ärztin in Niederbayern niedergelassen, erhängt sich eine Frau im Geräteschuppen. Und das offenbar nicht einmal freiwillig …! Gemeinsam mit ihrer jungen Nachbarin Holly taucht Gesine in den Strudel der Ermittlungen ein, die schon bald größere Kreise ziehen: In der beschaulichen Gemeinde brodelt ein erbitterter Kampf um eine Umgehungsstraße. Etliche Honoratioren geraten unter Mordverdacht, aber auch ein Biolehrer und Ökofreak, dessen Bürgerinitiative um den Erhalt der Flussauen kämpft. Als Gesine zu einer jungen Frau gerufen wird, die unter unerklärlichen Bauchkrämpfen leidet, spitzt sich die Lage zu …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Carolin Schairer
Todesursache:ungeklärt
Kriminalroman
ISBN 978-3-89741-981-0
© 2016 eBook nach der Originalausgabe© 2014 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach/TaunusAlle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Atelier KatarinaS / NLunter Verwendung des Fotos »корги_a_9«© katamount – Fotolia.com
Ulrike Helmer VerlagNeugartenstraße 36c, D-65843 Sulzbach/TaunusE-Mail: [email protected]
www.ulrike-helmer-verlag.de
Inhalt
Drei Wochen vorher …
Die Tote hinter dem Teeladen
Abseits der Tagesordnung
Allerlei Ungereimtheiten
Ärger am Morgen
Verräterische Gummistiefel
Die Wirren der Liebe
Roter Fuchs und heiße Küsse
Unterschiedliche Milieus
Hélène Chevalier
Feierstimmung
Ein potenzieller Mörder
Aus Liebe
Potenzprobleme
Ein Date mit Erkenntnissen
Ein Krankenbesuch
Warten auf Fresenius
Branzino und Amore
Kaffee mit Milchschaum
Leichenschau
Gefangen
Drohungen
Faules Obst und Nagellack
Showdown
Verloren
Edith war zu schwach, um selbst zur Toilette zu gehen. Veronika schob ihr zum tausendsten Male seit Beginn ihrer Pflegetätigkeit vor drei Jahren die Bettpfanne unter das knochige Gesäß. Anschließend wischte sie ihr mit einem Tuch die feuchten Oberschenkel trocken. Die Bettlägerige sah mit glasigem Blick durch sie hindurch.
Während sie die Schale mit dem trüben Urin noch in der Hand hielt, spielte Veronika kurz mit dem Gedanken, die schweren Vorhänge aufzuziehen und die wenigen Sonnenstrahlen ins Zimmer zu lassen, die für einen Dezembervormittag ungewöhnlich genug waren.
Sie entschied sich schließlich dagegen. Das Zimmer lag nicht an der Straße, sondern auf der Seite, zur Gärtnerei Meier hin. Im Herbst war in diesem Teil des Gärtnereigeländes kein Betrieb. Aber im Frühling, da würde sie nicht nur die Vorhänge aufziehen, sondern auch die Fenster ganz weit öffnen. So würden die Meiers nicht nur einen erneuten Eindruck davon bekommen, welche Qualen Edith litt, sondern auch gleichzeitig sehen, dass sie weiß Gott keine Mühen scheute, ihrer kranken Schwägerin das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten.
Veronika, du bist eine Seele von Mensch, würde Regina Meier wieder einmal sagen. Dass du das alles für Edith tust. Das würde wirklich nicht jede tun!
In der Küche füllte sie sauren Apfelsaft in Ediths alte Keramikkanne. Jeden Tag gab sie ihr diesen Saft, seit nunmehr drei Jahren, immer aus dieser hübschen, bunt glasierten Kanne, die Edith aus Griechenland mitgebracht hatte und an der sie so sehr hing. Und auch ihr, Veronika, war die Kanne inzwischen wertvoll, ja, geradezu unentbehrlich geworden.
Im ersten Stock hörte sie Edith leises Wimmern.
Nerven-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Lähmungen, die kamen und gingen. Sehstörungen. Müdigkeit. Ein Herz, das nicht mehr regelmäßig schlug. Die Leiden ihrer Schwägerin waren vielseitig.
Edith saß kerzengerade im Bett, als sie das Zimmer betrat, die Augen an die kahle Wand gegenüber gerichtet.
»Die Pflanzen«, sagte sie mit brüchiger Stimme. »Und die Tiere … das muss ich beschützen!«
Sie hob den rechten Arm. Ihre Hand fiel kraftlos nach unten, so, als würde ihr Handgelenk von einer äußeren Kraft geknickt werden. Sie starrte auf die Hand, dann auf Veronika, die Kanne und Becher auf ihr Nachtkästchen stellte, und ließ sich mit einem Stöhnen der Erschöpfung zurück ins Bett fallen.
»Zeit für deine Medizin.« Routiniert griff Veronika nach Spritze und Ampulle. Als sie die Bettdecke zurückschlug, um Ediths Einstichstellen an Bauch und Oberschenkel um einen weiteren bläulichroten Fleck zu ergänzen, ließ eine übelriechende Wolke sie kurz zurückzucken.
Nicht schon wieder.
Das Leintuch, die Bettdecke, Ediths Nachthemd, die Unterhose – alles war mit dünnflüssigem Kot bekleckert. Veronika war lange schon über den Punkt hinaus, an dem ihr Anblick und Geruch Übelkeit bereiteten.
Mit leisem Seufzen holte sie einen Eimer lauwarmes Wasser samt Schwamm herbei, zog die willenlose Patientin aus und bereinigte die Misere. Edith, die nicht einmal mehr einen Zentner wog, ließ sich mühelos umlagern. Inzwischen hatte sie Routine darin, ihren Körper zu heben und zu drehen. Im ersten Jahr hatte sie noch manches Mal die Hilfe ihres Mannes gebraucht. Mit Murren war er ihr zur Hand gegangen, wenn er tatsächlich die Zeit fand, trotz seiner vielen Termine zu helfen. Ihre Weigerung, einen Pflegedienst einzuschalten, verstand er bis heute nicht. Trotzdem sah er ein, dass niemand – wirklich niemand – die Pflege seiner todkranken Schwester so gewissenhaft übernehmen könnte wie sie als Familienangehörige.
Es würde nicht mehr lange dauern, hatte ihr Harald bei seinem letzten Besuch versichert. Sie hoffte jeden Tag, dass seine Prophezeiung endlich eintrat.
Drei Wochen vorher …
Die Tote hinter dem Teeladen
»Ich habe Kreuzschmerzen«, teilte mir mein Patient mit und wirkte dabei fast ein wenig stolz. »Ich will ein paar Spritzen.«
»Ein paar gleich?«, kam es mir süffisant über die Lippen, während ich ihn musterte: ein stämmiger Mann um die sechzig mit geschätzten fünfzehn Kilo Übergewicht, einem geröteten Gesicht und großen, kräftigen Händen, die er vor seinem beleibten Oberkörper verschränkt hielt. Seit drei Monaten war er in Pension. Seine Zugehörigkeit zur einschlägigen Betriebskrankenkasse verriet mir, dass er zuvor sehr lange für einen großen Automobilhersteller, einen der wichtigsten Arbeitgeber dieser Gegend, tätig gewesen war.
»Der Doktor Fischer hat mir immer Spritzen gegeben!«, begehrte mein Patient auf, der mir meine Süffisanz anscheinend tatsächlich gleich verübelte.
Ich unterdrückte ein Seufzen. Mehrmals schon hatte ich die Erfahrung machen müssen, dass die Leute hier in der Region meinen Humor nicht verstanden; ebenso wenig wie ich den ihren. Vor drei Monaten hatte ich als Allgemeinmedizinerin die Praxis meines Vorgängers Dr. Fischer übernommen, der im stattlichen Alter von siebzig Jahren nun endlich auf Druck seiner Frau in den Ruhestand gegangen war. Wenn es mir nicht gelang, mich besser auf die Mentalität der Menschen in diesem Sechstausend-Seelen-Ort einzustellen, konnte ich die Praxis entweder bald schließen oder darauf hoffen, jemanden zu finden, der sich das Landarzt-Dasein so idyllisch vorstellte, wie es diverse Arztserien mit Heimatfilm-Touch glauben machen wollten.
»Ich war am Sonntag deshalb sogar in der Notfallambulanz bei den Barmherzigen Brüdern!« Mein Patient machte ein Gesicht, als hätte er damit alles gesagt, was es zu dem Thema zu sagen gäbe.
Lebhaft konnte ich mir die Kollegen in der Regensburger Klinik vorstellen, wie sie sich nach zwanzig Stunden Dauerdienst voller Begeisterung und Elan um einen übergewichtigen Pensionisten mit Kreuzschmerzen bemühten.
Nehmen Sie ab. Bewegen Sie sich.
Ich hätte vieles sagen können. Stattdessen tat ich, was mein Patient wollte: Bereitwillig infiltrierte ich ihn mit einer Mischung aus Schmerzmittel und Entzündungshemmer.
Während ich ihm die kleinen Nadeln durch die Haut piekste, schlug ich dem Mann das ganze Programm vor: Röntgen. Magnetresonanztherapie. Sonographie. Krankengymnastik. Physikalische Therapie.
»Wenn das bei Ihnen so ernst ist, dass Sie am Wochenende trotz Ihrer Schmerzen dreißig Kilometer in die nächste Universitätsstadt auf die Notfallambulanz fahren müssen, sollten wir der Ursache Ihrer Schmerzen endlich auf den Grund gehen«, sagte ich streng und hörte mich sogar in meinen eigenen Ohren an wie eine Oberlehrerin. »Das gehört ein für allemal abgeklärt!«
Auf einmal waren die Rückenschmerzen doch nicht so schlimm. Er stand auf einem Bein und auf den Zehenspitzen und zeigte mir sogar bereitwillig, wie tief er sich bücken konnte. Ich entließ ihn schließlich mit einer Überweisung zur Physiotherapie und hatte das niederschmetternde Gefühl, dass ich einfach nicht aus meiner Haut heraus konnte.
Ich war keine gute Landärztin.
Als Sozialstation für Einsame, Behelfspsychologin für Menschen mit Kummer und Unterstützerin notorischer Simulanten taugte ich leider gar nicht. Schlechte Voraussetzungen für einen dauerhaften Geschäftserfolg als selbstständige Medizinerin in einer ländlichen Region.
Sogar meine Mutter hatte mir schon prophezeit, dass Aichendorf nicht das geeignete Pflaster für mich war. Ich hatte ihr nicht glauben wollen. Derweil musste es meine Mutter einfach wissen, schließlich war sie hier aufgewachsen.
Auch Susanne hatte schallend gelacht, als ich ihr meine Niederlassungsabsichten unterbreitete, während ich gemeinsam mit drei kräftigen Kerlen meine wenigen Möbel aus unserer ehemals gemeinsamen Wohnung in München-Schwabing holte. Ihre Bemerkung, dass ich die berufliche Selbständigkeit als Ärztin ohne ihre Unterstützung sowieso nicht schaffen würde, gaben mir den nötigen Impuls, um Dr. Fischer endgültig die Praxisübernahme zuzusagen.
Monate nach unserer Trennung überkam mich immer noch blanke Wut, wenn ich an meine Ex-Freundin dachte. Schließlich war sie es doch gewesen, die ständig von »mehr Abstand«, »etwas Distanz« und einer dringend benötigten »Auszeit« in Sachen Beziehung gesprochen hatte und mich damit so lange quälte, bis ich es letztendlich erschöpft aufgab, um unsere Liebe zu kämpfen. Als ich dann den Schlussstrich zog und mit unserer Beziehung konsequenterweise auch die gemeinsame Eigentumswohnung sowie die Gemeinschaftspraxis aufgab, zeigte sie sich komplett irritiert. Anscheinend hatte sie tatsächlich erwartet, dass ich mich zwar auf eine temporär ungewisse Trennung einließ, aber weiterhin mit ihr wohnte und arbeitete, als sei nichts geschehen. Möglicherweise spielte dabei die plötzliche Erkenntnis eine Rolle, dass unsere Trennung auch für sie herbe finanzielle Einschnitte mit sich brachte. Immerhin musste sie mich sowohl hinsichtlich der vor neun Jahren gemeinsam gekauften Eigentumswohnung als auch der Praxis abfinden.
Solange ich noch in einem Münchner Altbau mit Blick auf den Englischen Garten praktizierte, gehörten zu meinem Patientenklientel Schauspieler, Autoren und diverse Künstler sowie Manager, Universitätsprofessoren und höhere Beamte, die allesamt privat versichert waren. Abgesehen von ein paar chronisch Kranken, die zusätzlich vom Facharzt betreut wurden, hatten wir mit Krankheiten wie Depression, Burnout, Migräne, Allergien und Nahrungsmittelintoleranzen zu tun, weniger mit Schlaganfall-Prophylaxe, Dauerschmerzen, Diabetes Typ 2 und anderen altersbedingten Leiden. Dennoch, einfühlsam auf die Patienten eingehen – das konnte Susanne weit besser als ich, wohingegen meine Diagnosen meist treffsicherer waren als die ihren.
Wir hatten uns gut ergänzt.
Aber, aus. Vorbei.
Ich musste mich ändern und an mir arbeiten, wenn ich in dieser neuen, aus Trotz gewählten Situation auf dem Lande dauerhaft bestehen wollte.
Voll der guten Vorsätze erhob ich mich von meinem Drehstuhl und öffnete die Tür des Sprechzimmers. Normalerweise schickte mir meine Sprechstundenhilfe die Patienten der Reihe nach in den Behandlungsraum, doch ein Blick auf die Uhr und die Tatsache, dass Wochenanfang war, ließen mich vermuten, dass Gerlinde gerade anderweitigen Beschäftigungen nachging.
Montag war Labortag und das bedeutete, dass um Punkt elf Uhr ein langhaariger, athletisch gebauter Typ namens Werner erschien, der rein äußerlich Jon Bon Jovi als Leadsänger einer Rockband problemlos hätte doubeln können. Werner war solariumsgebräunt und trug sogar um diese Jahreszeit kurze Hosen, was mich anfangs genauso irritiert hatte wie die Tatsache, dass er mich schonungslos und ungefragt vom ersten Tag an duzte. Mein Titel und meine dunkle Hornbrille, die mich strenger aussehen ließ, als ich in Wahrheit sein konnte, beeindruckten ihn kein bisschen. Werner war der Botenfahrer, der von allen Ärzten der Region Blut- und Stuhlproben einsammelte und sie nach Straubing, der Kreisstadt, ins nächste Labor brachte.
Wenn Werner kam, verwandelte sich Gerlinde, die genauso alt wie ich war, von einer 38-Jährigen in ein pubertierendes Schulmädchen. Sie flirtete ihn an und er flirtete zurück. Allerdings hatte ich ihn einmal durch Zufall in der örtlichen Bäckerei getroffen und dabei erlebt, dass er mit der jungen Bäckerin genauso herumschäkerte wie mit Gerlinde. Daher maß ich dem Geplänkel der beiden nicht viel Bedeutung bei – zumindest, was seinen Part betraf. Trotzdem gönnte ich Gerlinde die Viertelstunde Gekicher, Komplimente und anzügliche Witzeleien. Ihr Mann hatte sie und die zwei gemeinsamen Kinder vor ein paar Monaten wegen einer Jüngeren verlassen und ich wusste, dass sie ihm trotz aller Demütigung, über ein Jahr lang mit ihrer Nachfolgerin betrogen worden zu sein, noch immer nachtrauerte. Gerlinde und ich waren folglich in einer ähnlichen Situation, nur dass ein Werner mir persönlich nicht einmal fünfzehn Minuten lang Glücksgefühle beschert hätte.
Im Gegensatz zu Gerlinde, die irgendwann sicher wieder einmal jemanden fand, der sein Leben mit ihr teilte, würde ich wohl allein bleiben. In dieser Region bestand das einzig denkbare Beziehungsmuster aus Mann-Frau-Kindern und kirchlicher Hochzeit. Als Lesbe würde ich hier ganz gewiss keine Partnerin finden.
Die Suppe, die man sich einbrockt, muss man auch auslöffeln, würde meine Mutter an dieser Stelle sagen, und damit hatte sie leider recht. Niemand hatte mich gezwungen, eine Praxis in Aichendorf zu übernehmen. Ich hätte auch einfach wieder in München am Krankenhaus arbeiten können. Dank des Engpasses an Ärzten, der aufgrund der strikten Numerus Clausus-Regelungen der Vorjahre inzwischen im ganzen Land herrschte, hätte ich mühelos eine Anstellung gefunden.
Allerdings hatte ich den unbarmherzigen Schichtdienst im Krankenhaus noch in bester Erinnerung … Versöhnlich ließ ich meinen Blick über die Patienten im Wartezimmer gleiten. Von den zehn Anwesenden hatte ich acht schon einmal gesehen, bei fünf von ihnen fiel mir sogar der Name ein – nach drei Monaten im Dienst eine Quote, mit der ich zufrieden war.
»Frau Dörfler, bit–«
Ich kam nicht dazu, auszusprechen, denn in diesem Moment stürmte eine schmale Gestalt mit dunklen Haaren in meine Praxis und fiel mir regelrecht in die Arme.
»Frau Doktor! Bitte, kommen Sie, es ist furchtbar!«
Die Frau war vollkommen aufgelöst. Auf ihrer blassen, schon mit einigen Falten durchzogenen Haut leuchteten rote Flecken. Sie war etwas kleiner als ich und starrte mich, die sie mehr oder weniger in den Armen hielt, von unten herauf mit entsetztem Blick an.
»Meine Mieterin … meine Mieterin …!«
Atemlos schnappte sie nach Luft. Einen Augenblick lang hatte ich Angst, sie würde ohnmächtig werden. Zu meiner Überraschung fing sie sich jedoch wieder, befreite sich aus meiner rettenden Umarmung und richtete sich nun kerzengerade vor mir auf. Sie mochte Mitte fünfzig sein, vielleicht auch schon sechzig. Eine gepflegte Frau mit dezentem Makeup. Mit ihrem längeren, offen getragenen Haar und der schlanken Silhouette unterschied sie sich erheblich von den anderen Frauen ihrer Altersklasse, denen ich bisher in Aichendorf begegnet war. Sie trug einen lila Rollkragen-Pulli und einen dunklen Winterrock. Letztendlich waren es ihre Filzpantoffeln, die mir in Erinnerung riefen, dass sie unweit von meiner Praxis wohnte und arbeitete. Ich sah sie fast täglich, wenn sie vor ihrem Geschäft die Straße kehrte oder kurz einmal vor die Tür trat, um Luft zu schnappen: Es war Christl Rauch vom Teeladen gegenüber. Außer einem über die Straße gerufenen, knappen »Grüß Gott« hatten wir noch keinen direkten Kontakt gehabt.
»Was, um Himmels Willen, ist denn passiert?«
Sie warf einen hastigen Blick ins Wartezimmer. Einige Patienten waren bereits aufgestanden, um unseren Dialog aus nächster Nähe zu verfolgen, andere spitzten lediglich aufmerksam die Ohren.
»Bitte kommen Sie mit! Vielleicht können Sie noch helfen.«
Sie zog mich energisch hinter sich her, hinaus aus der Praxis, die Treppe hinunter, auf die Straße. Gerlinde zurufend, sie solle sich inzwischen um die Patienten kümmern, leistete ich keinen Widerstand und stolperte der Teefrau nach.
Ich folgte ihr über die belebte Hauptstraße ins Haus gegenüber und durch das offene Hoftor schnurstracks in den gepflasterten Hinterhof. Zielstrebig steuerte sie auf einen Geräteschuppen am Ende des Grundstücks zu.
Ehe ich einen Blick hineinwerfen konnte, sprang mich ein wütend bellender Schäferhund-Mix aus dem Dunkel an und riss an meinem Arztkittel.
»Arco! Platz!« Während ich, in der ersten Sekunde gelähmt vor Schreck, wehrlos den unerwarteten Angriff über mich ergehen ließ, packte Christl Rauch den Vierbeiner energisch am Halsband und schüttelte ihn heftig. Der Schäferhund-Mix warf sich demütig auf den Boden. Ich hatte als Kind selbst einen Hund gehabt, und somit erkannte ich sofort, was ich vor mir hatte: ein junges, verunsichertes Tier, das aus irgendwelchen Gründen genauso aufgebracht war wie die Besitzerin des Teeladens.
Dicht gefolgt von Christl Rauch und dem Hund betrat ich den Schuppen – und erstarrte.
Von der Decke baumelte der Körper einer Frau.
Es dauert nur ein paar Sekunden, dann hatte ich meinen ersten Schrecken überwunden. Die Ärztin in mir gewann die Oberhand. Leben retten. Dafür war ich ausgebildet worden.
Ohne lange zu überlegen, kletterte ich auf den Hocker, der der Frau offenbar als Aufstiegshilfe zum Gebälk gedient hatte und nun ein paar Meter weiter umgekippt auf dem erdigen Boden des Schuppens lag.
Sie musste ihn umgestoßen haben, um ihr Werk zu vollenden. Blieb nur zu hoffen, dass ihr Versuch noch nicht lange zurücklag.
»Schere!«, brüllte ich in gebotener Knappheit, während ich den Körper der Frau leicht anhob. Sie hatte ungefähr meine Statur, war also nicht dick, aber auch durchaus kein Leichtgewicht. Mit der leicht angerosteten Gartenschere, die mir Christl Rauch eilends anreichte, durchtrennte ich den Strick. Die Frau sackte in meine Arme; ich verlor das Gleichgewicht und fiel mit ihr gemeinsam zu Boden.
Verdammt.
Behände rappelte ich mich auf, klopfte mir die staubige Erde von meinem jetzt nicht mehr ganz weißen Kittel und beugte mich über den reglosen Körper.
Kein Puls.
Dass jeder Versuch, sie wieder zum Leben zu erwecken, völlig zwecklos war, machte mir auch ihre seltsam nach hinten gedrehte Halswirbelsäule klar. Genickbruch. Atlas und Axis, die beiden ersten Halswirbel, hatten sich gegeneinander verschoben und dabei die Rückenmarksnerven durchtrennt. Die Frau hatte ihr Ziel, durch Erhängen aus dem Leben zu scheiden, zweifelsohne erreicht.
Der Hund bohrte seine Nase in den dunklen Pullover der Toten und winselte. Das brachte meinen Verstand wieder zum funktionieren.
»Wir müssen die Polizei rufen.«
Die Tote hieß Barbara Kerschitz, war fünfzig Jahre alt und alleinstehend. Seit über zehn Jahren bewohnte sie die kleine Dachgeschosswohnung im Haus von Christl Rauch. Ich kannte sie vom Sehen, hatte aber noch nie mit ihr gesprochen.
Die Polizei war zunächst nicht gut auf mich zu sprechen, was ich durchaus verstehen konnte. Ich hatte in der Tat kopflos gehandelt, als ich in den Schuppen stürmte und die Erhängte ohne Weiteres vom Gebälk schnitt.
»Nicht, dass wir davon ausgehen, dass es etwas anderes war als Selbstmord«, belehrte mich ein blonder Beamter mit Oberlippenbart. »Aber wir haben unsere Vorschriften.«
Es dauerte rund eine Stunde, bis der Polizeiarzt vor Ort war – ein junger Kollege, der spontan genau das bestätigte, was ich zuvor schon diagnostiziert hatte: Genickbruch durch Erhängen, und sich dann ziemlich rasch wieder verabschiedete, weil er zu einem anderen Ort des Geschehens gerufen wurde.
Christl Rauch hatte sich mit einem der Beamten inzwischen ins Haus zurückgezogen; er wollte ihr noch ein paar Fragen stellen. Sein Kollege machte währenddessen mit einer kleinen Digitalkamera Fotos von der Toten, dem Gebälk, dem zerschnittenen Seil, dem Knoten und dem Inneren des Schuppens.
Ich war mit Frieren beschäftigt – schließlich trug ich im Gegensatz zu den Polizisten, die in dicken Anoraks steckten, nur meinen weißen Arztkittel über einem dünnen Baumwollshirt – und verlor zunehmend die Geduld.
»Ich muss zurück in meine Praxis, die Patienten warten!«, nörgelte ich, obgleich ich mir nicht einmal mehr sicher war, ob sie das noch taten. Das Wartezimmer, ein Behandlungsraum und die Rezeption lagen zur Straße hin. Das Polizeiauto vor Christl Rauchs Teeladen war sicherlich weder meinen Patienten noch Gerlinde entgangen. In Kombination mit der Tatsache, dass ich nun schon über eine Stunde weg war, hatte meine Sprechstundenhilfe gewiss entschieden, die Patienten nach Hause zu schicken.
»Nur noch einen Moment, Frau Doktor«, nuschelte der Polizist, ohne seine auf mich wahllos wirkende Knipserei zu unterbrechen. »Kann ja sein, dass mein Kollege Sie auch noch befragen will.«
»Aber ich kannte die Tote überhaupt nicht«, wehrte ich mich. »Ich wohne erst seit drei Monaten hier! Außerdem wissen Sie doch ohnehin, wo Sie mich finden – im Haus gegenüber!«
»Ich werde das jetzt nicht entscheiden«, erwiderte der Polizist, und ich begriff, dass der andere sein Vorgesetzter war.
»Haben Sie hier eigentlich den Boden gekehrt?«
»Wie bitte?«
»Sehen Sie doch.« Er trat ein paar Schritte zurück und deutete auf das trockene Erdreich, das den naturbelassenen Boden des Schuppens darstellte. »Hier … das sind eindeutig Ihre Fußabdrücke … mit den Gesundheitspantoffeln, die Sie gerade tragen. Man sieht, wie Sie hier mehrmals auf der Stelle getreten sind – wahrscheinlich, als sie den Hocker aufgestellt haben, um Frau Kerschitz vom Seil zu schneiden. Und da, am Eingang, sieht man auch noch andere kleine Fußabdrucke, fast ohne Profil – wahrscheinlich Frau Rauch mit ihren Hausschuhen.«
»Ja, natürlich«, pflichtete ich ihm bei, ohne zu wissen, auf was er hinaus wollte. »Und wenn Sie scharf hinschauen, werden Sie auch noch die Fußabdrücke von Frau Rauch unterhalb der Stelle finden, wo die Dame von der Decke baumelte, denn sie hat mir dabei geholfen, sie abzunehmen. Aber das hatten wir Ihnen ja schon alles gleich am Anfang gesagt.«
»Ja, genau. Und was fehlt?«
Der Gesichtsausdruck, mit dem er mich musterte – abwartend, jedoch auch in der Gewissheit, dass er mir für diesen Moment überlegen war –, erinnerte mich ein bisschen an Günther Jauch, wenn er einen Kandidaten kurz vor der Millionenfrage noch ein wenig verwirrte.
»Was soll fehlen? Keine Ahnung.«
Mein Verstand war inzwischen schon etwas eingefroren; sollte er mich ruhig für minderbemittelt halten, wenn er sich besser fühlte. Ich wollte zurück in meine Praxis!
»Na, die Fußspuren von Frau Kerschitz!«, platzte es triumphierend aus ihm heraus. »Irgendwie muss sie doch zu diesem Balken gekommen sein, sie ist ja nicht von der Eingangstüre bis dort hinauf geflogen!« Aufgeregt fotografierte er den Boden ab. »Das da sind meine Fußspuren«, murmelte er vor sich hin. »Ihre. Die von Frau Rauch. Die Abdrücke von den Hundepfoten.« Nun darauf bedacht, keine weiteren Spuren im Erdreich zu hinterlassen, schlich er vom hinteren Teil des Schuppens an der Holzwand entlang nach vorne.
»Hier. Gleich neben Ihnen, der Reisigbesen, sehen Sie genau – sehen Sie … hier ist gekehrt worden! Jemand hat mit diesem Besen die trockene Erde bearbeitet, um keine Fußspuren zu hinterlassen.«
Wir starrten uns an.
Die Erkenntnis, mit was wir es hier zu tun hatten, brach in derselben Sekunde über uns herein: Das hier war kein Selbstmord. Es war Mord.
Abends weit nach acht Uhr kam ich endlich nach Hause. Ich war insgesamt 215 Kilometer gefahren, hatte seit dem Frühstück nichts gegessen und fühlte mich vollkommen erledigt.
Gerlinde hatte meine Patienten tatsächlich nach Hause geschickt, allerdings mit dem Versprechen, dass ich ihnen allen am Nachmittag einen Hausbesuch abstatten würde. So musste ich zusätzlich zu den üblichen Hausbesuchen bei besonders gebrechlichen Menschen zähneknirschend auch noch jene abfahren, die mobil genug waren, um heute schon in meinem Wartezimmer gesessen zu haben.
Immerhin hatte ich den Landkreis dadurch wieder etwas besser kennen gelernt. Ich würde in Zukunft auch ohne Navigationssystem nach Meierhofen, Deggenbach, Unterkleinzell und Obereggersbach finden – vier der zahllosen kleinen Dörfer, die, von großen Feldern umgeben, zum Einzugsbereich der Marktgemeinde Aichendorf gehörten.
Weite Überlandstrecken zu fahren, um Patienten zu behandeln, war dagegen völlig neu für mich. Gleichzeitig hatte ich im Moment den denkbar kürzesten Weg zu meinem Arbeitsplatz: Mein Wohnhaus und jenes, in dem die Praxis lag, trennte gerade einmal ein schmaler Spazierweg, der vom Ortszentrum weg in die Au-Siedlung führte.
Mein Haus war nicht wirklich mein Haus. Es gehörte Onkel Gustav, dem Bruder meiner Mutter; ich wohnte seit meinem Umzug von München nach Aichendorf in einer Art Wohngemeinschaft mit ihm, dem ewigen Junggesellen.
In Zukunft würden wir hier zu dritt wohnen, denn ich war nicht allein nach Hause gekommen. Während ich mich von meinen soliden Schnürstiefeletten befreite, schnüffelte mein vierbeiniger Begleiter aufgeregt im Vorzimmer herum, schnupperte an den Jacken und Mänteln, die am Garderobenständer hingen, und steckte seine Nase ungeniert in jedes Paar Schuhe.
Ich wollte gerade die Treppe in den ersten Stock hochgehen, um mich von dort zu meinem Zimmer im hinteren Teil des Hauses zu verdrücken, als ich den Lichtstrahl bemerkte, der unter der Küchentüre hindurch auf den Gang fiel. Gustav war offensichtlich zu Hause. Gut so. Ich war keine Freundin davon, Konfrontationen hinauszuzögern.
Entschlossen packte ich Arco, der sich mir gegenüber inzwischen streichelweich verhielt, am Halsband und öffnete die Tür zur Küche. So würde er Onkel Gustav wenigstens nicht genauso aggressiv anspringen, wie er es mit mir bei unserer ersten Begegnung im Schuppen getan hatte.
Doch kaum standen wir in der Küche, riss Arco sich mit einem Ruck los, lief meinem Onkel schwanzwedelnd entgegen und sprang ihm zu meiner Überraschung fast auf den Schoß. Gustav vergrub seine großen Hände in Arcos Fell, streichelte ihm mehrmals über den Kopf und redete besänftigend auf ihn ein. Nach einer Weile, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, hatte er den Hund endlich so weit, dass er ihm zu Füßen unter dem Küchentisch lag und mit großen, ehrfurchtsvollen Augen zu ihm aufsah.
Mein Onkel war wahrlich ein Hundeflüsterer! Zeit seines Lebens hatte er eigene Hunde gehabt; seine letzte Hündin – Micky – war erst vor einem halben Jahr gestorben; sie war an die vierzehn Jahre alt geworden und ich wusste, dass Onkel Gustav immer noch untröstlich über diesen Verlust war. Daher hatte ich auch nicht lange gezögert, als Christl Rauch den Hund nicht übernehmen wollte und die Polizei ein Tierheim vorgeschlagen hatte.
»Gustav, das ist Arco«, begann ich. »Es ist der Hund von Barbara Kerschitz. Du hast vielleicht schon gehört, dass …«
»Ja, ja, natürlich.« Mein Onkel seufzte. »Tragische Geschichte. Das ganze Dorf spricht darüber. Weiß man schon, warum sie sich das Leben genommen hat?«
Offiziell hielt die Polizei noch an der Selbstmord-Variante fest, auch wenn spätestens mit der Spurensicherung klar wurde, dass Frau Kerschitz nicht freiwillig aus dem Leben geschieden war.
»Nein«, brummte ich. Das war so wenig gelogen, wie es der Wahrheit nahe kam, aber als Zeugin hatte ich ein Papier unterschreiben müssen, in dem ich mich zum Stillschweigen gegenüber Dritten verpflichtete. Ich ließ meinen Blick über den Abendbrottisch schweifen. Onkels Teller war benutzt, offenbar hatte er bereits gegessen. In der Pfanne lockte aber noch ein mit Käse überbackenes Schnitzel. Auch die Salatschüssel war noch halbvoll.
Mir stand der Hunger offensichtlich ins Gesicht geschrieben. Gustav stand auf, holte Teller und Besteck. Wenig später hatte ich schon das erste Stück Fleisch im Mund und fühlte mich wieder einmal darin bestätigt, dass es im Moment wirklich nicht notwendig war, nach einer eigenen Wohnung zu suchen. Hier hatte ich ein geräumiges Zimmer, ein eigenes Bad und sogar eine kleine Küche; benutzt hatte ich sie noch nie.
»Hat man also noch keinen Abschiedsbrief gefunden?«
Ich schüttelte den Kopf. Für Worte war mein Mund zu voll.
Über Gustavs Miene legte sich ein Ausdruck tiefer Nachdenklichkeit. Angesichts seines betrübten Gesichtsausdrucks drängte sich mir die nächste Frage regelrecht auf: »Hast du Barbara Kerschitz eigentlich gekannt?«
Mein Onkel nahm einen großen Schluck aus seinem Bierglas, ehe er mir antwortete.
»Flüchtig. – Magst du auch ein Bier?«
Ohne meine Zustimmung abzuwarten, stand er auf und ging zum Kühlschrank.
»Sie lebte immerhin direkt gegenüber«, meinte ich. »Und das schon recht lange.«
»Hmm, ja.« Gustav hatte mir den Rücken zugewandt. Ich hörte, wie seine Bierflasche beim Öffnen zischte.
»Kennt man sich da nicht besser, wenn man so nah beieinander wohnt?«
Gustav stellte das volle Glas vor mich an meinen Teller und ließ sich nieder. Unter dem Tisch legte Arco seine Schnauze auf den Schuh meines Onkels.
»Wir kannten uns vom Sehen«, sagte Gustav. »Ein paar Mal haben wir geplaudert. Über das Wetter. Über den zunehmenden LKW-Verkehr. Darüber, dass nun schon der fünfte Supermarkt im Ort gebaut wird. Nichts Weltbewegendes.«
»Ich habe gehört, sie war Schriftführerin vom Hundesportverein. Bist du dort nicht auch dabei?«
»Ich bin da nur passives Mitglied. Seit die Lanzenhofer Vorsitzende ist, habe ich keine Lust mehr. Das Weib regt mich auf und ihr werter Gemahl sowieso!« Er schob noch ein böses Schimpfwort hinterher, das eindeutig auf Rudolf Lanzenhofer gemünzt war, und brachte mich damit unwillkürlich zum Schmunzeln.
Auch ich hatte mit Lanzenhofer, dem hiesigen ersten Bürgermeister, schon das Vergnügen gehabt. Auf Anraten meines Vorgängers Dr. Fischer hatte ich ihn und den Gemeinderat sowie andere Personen vor Ort, von denen mir gesagt wurden, sie seien »wichtig«, zu meiner kleinen Einweihungsfeier am Tag der offiziellen Praxisübernahme eingeladen. Lanzenhofer hatte sogleich unaufgefordert eine ausschweifende Rede über die Wichtigkeit der ärztlichen Versorgung gehalten. Ich war fasziniert und angewidert zugleich, wie es ihm gelang, seinem Publikum auf subtile Weise zu suggerieren, dass die Nachbesetzung dieser Landarzt-Praxis allein sein Verdienst wäre. In Wahrheit hatte er rein gar nichts damit zu tun gehabt: Dr. Fischer hatte im Ärzteblatt annonciert und ich hatte mich auf die Annonce gemeldet. Ich war, wie ich später erfuhr, übrigens die einzige Bewerberin gewesen …
Das Bier machte mich müde und erinnerte mich daran, dass ein anstrengender Tag hinter mir lag. Ich sehnte mich nach einer heißen Dusche. Wenn mir danach nicht die Augen zufielen, würde ich eventuell noch meine Eltern anrufen und ihnen von Barbara Kerschitz erzählen – vorläufig natürlich die offizielle Version.
Ich erhob mich.
»Gute Nacht, Gustav. Und danke für das Essen.«
Ich war schon fast bei der Tür, als er mich zurückrief.
»Hej! Was ist mit dem Hund?«
»Na, der bleibt bei dir!«
»Warum bei mir? – Du hast ihn doch hergeschleppt!«
Seine buschigen Augenbrauen bildeten ein schmales Dreieck, das in groteskem Kontrast zu seinem ovalen, glatzköpfigen Schädel stand.
»Ich habe einen Vollzeit-Job. Du bist in Pension. Und du hattest immer schon Hunde.«
»Ich hatte immer Jagdhunde. Das hier ist kein Jagdhund.« Er hielt inne. »Das ist nicht einmal ein Schäferhund.«
Ich verdrehte die Augen.
»Seit ich hier wohne, warst du nicht ein einziges Mal auf Jagd.«
Gustav schüttelte den Kopf und grummelte etwas, was ich nicht verstand. Ich verkniff mir jede Frage. Es war besser, wenn ihn nichts vom Anblick Arcos ablenkte, der ihn von unten mit großen Hundeaugen anhimmelte.
Abseits der Tagesordnung
Das automatische Garagentor öffnete sich mit einem lauten Quietschen.
Der Ärger, den Rudolf Lanzenhofer schon seit Stunden mit sich herumtrug, bekam neue Nahrung. Warum konnte sich Uschi nicht darum kümmern, dass es repariert wurde?
Abgesehen von seinem Rennrad und dem üblichen Krimskrams, den sie hier verstauten, war die Doppelgarage leer. Uschi war also unterwegs. Was sie tat, mit wem sie sich traf und womit sie ihre Zeit verbrachte, teilte sie ihm schon lange nicht mehr mit. Nach fast dreißig Ehejahren ging jeder von ihnen seine eigenen Wege. Manchmal störte es ihn, dass sich ihr Verhältnis zueinander so entwickelt hatte – schließlich wusste er nicht einmal, weshalb das so war. Meist allerdings verschwendete er kaum einen Gedanken an Uschi. Sie begegneten sich eben oder auch nicht.
An diesem Abend war er fast erleichtert, dass sie nicht auf ihn wartete.
Barbara Kerschitzs Leben fand sein Ende, während er im Landratsamt in Straubing gerade Rapport über die Fortschritte bei der Diskussion über die neue Umgehungsstraße erstattet hatte. Er musste von ihrem Tod in der Gemeinderatssitzung erfahren, kurz nachdem er aus Straubing zurückgekehrt war.
Selbstmord, hieß es offiziell, aber er als Bürgermeister war viel zu gut mit den Behörden im Landkreis vernetzt, um nicht während einer Sitzungspause in Erfahrung zu bringen, dass inzwischen von Mord die Rede war.
Dass Barbara Kerschitz sich selbst das Leben nahm – allein das wäre zu einem Zeitpunkt wie diesem schon fatal gewesen. Aber Mord! Jetzt hatte die Polizei die Hand auf ihrem gesamten Besitztum, von ihrem rostigen Fiat Punto bis hin zu jedem einzelnen Papierschnipsel in ihrer Wohnung, und er konnte sich ausrechnen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie seine Verbindung zu ihr durchschauten.
Lanzenhofer sperrte die schmucklose Türe auf, die Garage und Wohnhaus verband. Im Inneren war es still.
Ohne die Schuhe auszuziehen, durchquerte er mit schnellen Schritten den Vorraum. Im Wohnzimmer ließ er zunächst die Rollläden herunter, ehe er seinen Weg an die Hausbar fortsetzte. Man musste den Nachbarn ja keine Steilvorlage liefern, damit sie sich ihr Maul darüber zerrissen, dass er sich nach Feierabend einen Selbergebrannten vom Huber-Bauern gönnte.
Er ließ sich auf der Ledercouch nieder und horchte eine ganze Weile in die Stille des Hauses hinein. Kein Knacken, kein Knistern. Uschi war es gewesen, die auf Marmorfliesen im ganzen Haus bestanden hatte, und anders als die Holzparkette, die er sich gewünscht hatte, war dieser Bodenbelag einfach nur kalt und tot.
So kalt und tot wie Barbara Kerschitz.
Er seufzte und leerte sein Schnapsglas auf ex, um sich sofort nachzuschenken.
Barbara hatte ihn mit ihrem trockenen Humor zum Lachen gebracht. Ihre Treffpunkte waren unkonventionell: in seinem SUV auf entlegenen Parkplätzen oder auf einem Jägerstand in seinem eigenen Waldgebiet.
Einmal hatten sie sich auch in München getroffen, im Augustiner-Keller. Sie waren beide viel zu nervös gewesen, um diese Zusammenkunft wirklich zu genießen – zu groß war die Sorge, plötzlich von einem Aichendorfer überrascht zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet an diesem Tag jemand aus der Gegend die rund hundert Kilometer in die bayerische Landeshauptstadt fuhr, um dort im Augustiner-Keller einzukehren, lag wohl nicht übertrieben hoch, war aber auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Lanzenhofer fielen spontan fünf bis sechs Hausfrauen in seiner unmittelbaren Umgebung ein, von denen er wusste, dass sie regelmäßig zum Einkaufsbummel nach München fuhren. Hätte eine davon sie gemeinsam gesehen, wäre ihr vermeintliches Tête-à-tête sofort Ortsgespräch geworden, sein Ruf ruiniert und sein Plan geplatzt.
Einer ging noch. Der dritte Schnaps.
Aber jetzt, jetzt schien alles umsonst. Weil irgendjemand herausgefunden hatte, welches Spiel er trieb, und daher Barbara Kerschitz beseitigt hatte. Je länger er darüber nachdachte, desto weniger zweifelte er daran, dass der Mord an ihr mit dieser Sache zu tun hatte.
Der Landrat machte inzwischen großen Druck wegen der Umgehungsstraße. Bereits vor zwei Jahren hätte der Bau durch die Aichen-Auen beginnen sollen. Doch seither verhinderte die Bürgerinitiative »Freunde der Aichen«, kurz FdA, den Baustart durch immer neue Expertisen über die Zerstörung von regionaler Flora und Fauna.
Seit den sechziger Jahren nahm der Autoverkehr zwischen dem südlichen und dem nördlichen Bayern kontinuierlich zu. Eine Bundesstraße war gebaut worden. Die Dörfer im Westen und Osten setzten damals alles daran, mit dieser wichtigen Hauptroute verbunden zu werden. Sogenannte Zubringerstraßen entstanden – ehemalige Dorfstraßen, die mitten durch die Ortschaften führten. Auf diesen donnerten aufgrund des gesteigerten Verkehrsaufkommens nun täglich zahlreiche Lastwagen und dreimal so viele Autos in Richtung Bundesstraße. So auch in Aichendorf. Tagsüber die Hauptstraße entlangzuspazieren hatte längst nichts mehr mit dörflicher Idylle zu tun.
Kernstück der Diskussion war folglich nicht die Schaffung einer Umgehungsstraße an sich, sondern die Route, auf der sie verlaufen sollte. Der Landkreis würde einen erheblichen Teil der Baukosten tragen müssen. Die für ihn kostengünstigste Variante war die direkte Linie durch die Auen, eine Wiesenlandschaft am südlichen Ortsrand von Aichendorf. Die Aichen, ein kleiner Fluss, der bei Regensburg in die Donau mündete, wand sich wie eine Schlange durch die großteils ursprüngliche Landschaft. Hier und da hatten sich einige Laubwälder um die durch Überflutungen entstandenen Altwässer gruppiert und bildeten in Schilf eingebettete Biotope, in denen sich, wie Lanzenhofer aufgrund des Engagements der Bürgerinitiative inzwischen wusste, neben Tausenden von Insekten, Blumen und Wildgräsern auch eine besondere Froschart angesiedelt hatte, die in Bayern als nahezu ausgestorben galt.
Eine andere mögliche Route, über die aus taktischen Gründen noch nicht allzu ernsthaft öffentlich diskutiert worden war, führte nördlich über ein paar brachliegende Ackerflächen und durch einen Nadelwald, dem die Herbststürme der letzten Jahre erheblich zugesetzt hatten. Der Eigentümer hatte sich nicht mehr um Aufforstung bemüht.
Lanzenhofer wusste das so genau, weil es sein Wald war – ein Erbstück seiner Großeltern väterlicherseits.
Er wollte erneut zur Schnapsflasche greifen, überlegte es sich dann aber anders. Schlimm genug, dass Barbara Kerschitz tot war. Die Dinge durften sich nicht noch fataler entwickeln. Es lag an ihm, eine dramatische Wendung zu verhindern. Schließlich standen sein Ruf und seine Existenz auf dem Spiel.
Entschlossen erhob er sich. Im Vorraum griff er sich den Autoschlüssel vom Schlüsselbrett.
Als er mit seinem SUV aus der Hauseinfahrt fuhr, kam ihm ein Mercedes Kombi entgegen. Neben seiner Frau erkannte er auf der Beifahrerseite das blasse Gesicht seiner Tochter Claudia. Im Kofferraum drückten die Hunde, zwei Doggen namens Abigail und Arthur, ihre nassen Schnauzen gegen das Fenster.
Es gefiel ihm nicht, dass Claudia schon wieder hier war, mitten im Semester. Allerdings hatte er schon längst einsehen müssen, dass er ihren Studienerfolg weder durch Strenge noch durch materielle Anreize beschleunigen konnte.
Rasch hob er die Hand zum Gruß. Weder Uschi noch Claudia reagierten darauf. Fast hätte er daraus schließen können, dass ihn gar nicht gesehen hatten.
Die Zone-30-Beschränkung auf der Siedlungsstraße ignorierend, trat er das Gaspedal kräftig durch.
»Fang schon ohne mich an!«