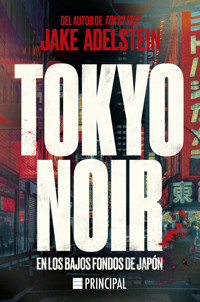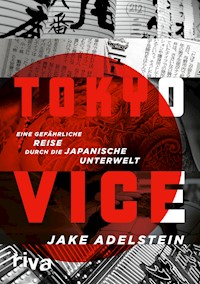
18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Jake Adelstein ist der einzige westliche Journalist, der jemals als Polizeireporter in Japan arbeiten durfte. Er berichtete viele Jahre für die führende japanische Zeitung über die dunkle Seite Japans, wo Erpressung, Mord, Menschenhandel und Korruption ebenso häufig vorkommen wie Ramen-Nudeln und Sake. Doch als er seinen letzten Knüller landen wollte, stand er Japans berüchtigtstem Yakuza-Boss plötzlich persönlich gegenüber. Da ihm und seiner Familie der Tod drohte, gab er auf . . . vorübergehend. Dann schlug er zurück. In »Tokyo Vice« erzählt Jake Adelstein, wie aus einem unerfahrenen Jungreporter – dessen Wing-Chun-Kampf mit einem älteren Kollegen nicht sein einziger Anfängerfehler war – ein wagemutiger Enthüllungsjournalist wurde, auf den die Yakuza ein Kopfgeld aussetzte. Mit seinen lebendigen, emotionalen Geschichten aus der Welt der modernen Yakuza, von der selbst Japaner wenig wissen, ist »Tokyo Vice« von der ersten bis zur letzten Zeile ein ebenso faszinierendes wie informatives Buch und ein einzigartiger, aufschlussreicher Bericht aus erster Hand über die Schattenseiten der japanischen Kultur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
TOKYO VICE
TOKYO VICE
EINE GEFÄHRLICHE REISE DURCH DIEJAPANISCHE UNTERWELT
JAKE ADELSTEIN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2022
© 2010 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2010 bei Pantheon Books, a division of Random House, Inc., New York, unter dem Titel Tokyo Vice. An American Reporter on the Police Beat in Japan © 2009 by Joshua Adelstein. All rights reserved. This translation published by arrangement with Pantheon Bokos, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Penguin Random House, LLC
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Martin Rometsch
Redaktion: Caroline Kazianka
Umschlaggestaltung: Evan Gaffney Design; Maria Verdorfer
Umschlagabbildungen: iStockphoto
Satz: JournalMedia GmbH, München
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7423-2091-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-1857-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-1858-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Ich widme dieses Buch:
Dem Kriminalpolizisten Sekiguchi,der mir beibrachte, was es heißt, ein Ehrenmann zu sein.Ich gebe mir Mühe.
Meinem Vater,der immer mein Held war und der mir beibrachte,für das Recht einzutreten.
Der Polizeibehörde von Tokio und dem FBI,die mich, meine Freunde und meine Familie beschützt habenund sich unaufhörlich bemühen, die Kräfte der Finsternisin Schach zu halten.
Und allen, die ich liebte und die gegangen sindund nicht zurückkehren werden. Ich vermisse euchund werde euch nicht vergessen.
会うは別れの始め
»Eine Begegnung ist nur der Beginn einer Trennung.«
Japanisches Sprichwort
BEGEISTERTE STIMMEN
»Großartig. Mit abgebrühtem Galgenhumor nimmt Adelstein seine Leser mit auf eine Schattenreise durch die japanische Unterwelt und untersucht die verschlungenen Beziehungen zwischen Journalisten, Polizisten und Gangstern. Fachkundig und überaus unterhaltsam erzählt.«
George Pelecanos, Autor von Der Totengarten
»Eindrucksvoll, brutal und nüchtern. Adelstein beschreibt die japanische Mafia wie kein anderer.«
Roberto Saviano, Autor von Gomorrha: Reise in das Reich der Camorra
»Ein packendes und informatives Buch. Auf den Spuren zweier spektakulärer Storys gerät Adelstein in einen Wirbel von Zerstörung, der seine Freundschaften, seine Ehe und sogar sein Leben bedroht. Während er mit tiefgründigen Problemen kämpft, bei denen es um Wahrheit und Vertrauen geht, nähert sich sein Buch einem Ende, das Herzklopfen auslöst. Eine erschreckende, zutiefst moralische Geschichte, die man nicht aus der Hand legen kann.«
Misha Glenny, Autor von McMafia: Die grenzenlose Welt des organisierten Verbrechens
»Jeder, der sich für tätowierte Yakuza, Badehäuser und die vielen anderen Aspekte der morbiden japanischen Unterwelt interessiert, wird von diesem Buch garantiert gefesselt sein.«
Barry Eisler, Autor von Tokio Killer
»Die Geschichte eines gaijin, der auf eine so wichtige und gefährliche Story stieß, dass sein Leben bedroht war. Für den Verzicht auf diese Story bot ihm ein Yakuza eine halbe Million Dollar. Stattdessen schrieb er dieses Buch.«
Peter Hessler, Autor von Über Land: Begegnungen im neuen China
»In dieser düsteren, oft humorvollen Reise durch Tokios Unterwelt erklärt Jake Adelstein präzise, was es heißt, ein gaijin und ein Reporter zu sein. Ob er in Kabukicho Spuren sucht oder einem Yakuza-Mitglied Informationen entlockt, dies ist ein Abenteuer, das nur er schreiben konnte. Ein Muss für alle, die sich für Japan oder für Journalismus interessieren.«
Robert Whiting, Autor von Tokyo Underworld: the Fast Times and Hard Life of an American Gangster in Japan
»Adelsteins messerscharfer Bericht über die Unterwelt Tokios ist ein informatives Sachbuch, das mehr enthüllt, als es verspricht – weil er den Mut hat, die Wahrheit zu suchen, und die Unverfrorenheit besitzt, sie auszusprechen.«
Roland Kelts, Autor von Japanamerica: How Japanese Pop Culture has Invaded the U. S.
»Adelstein schreibt im klassischen, nüchternen Stil von Dashiell Hammett; aber dies ist nicht San Francisco oder New York, und es ist keine erfundene Geschichte. Ein packendes Buch!«
Alex Kerr, Autor von Dogs and Demons: Tales from the Dark Side of Japan
»Ein lebendiger, informativer, schonungslos offener Bericht über die dekadenten, zwielichtigen und sexuellen Aspekte der japanischen Gesellschaft. Pures Vergnügen!«
Karl Taro Greenfeld, Autor von Speed Tribes: Days and Nights with Japan’s Next Generation
INHALT
Einführung: Zehntausend Zigaretten
TEIL 1 朝 日 DIE MORGENSONNE
Das Schicksal ist auf deiner Seite
Es geht nicht ums Lernen, sondern ums Verlernen
Los, ihr Flaschen, packt eure Notizblöcke!
Erpressung, die beste Freundin des Jungreporters
Es ist Neujahr, also lasst uns kämpfen!
Das Handbuch für den perfekten Selbstmord
Der Mordfall »Imbissbuden-Mama«
Begrabt mich in einer flachen Grube – wenn die Yakuza kommen
Die verschwundenen Hundefreunde aus Saitama, Teil 1: Ich soll Ihnen vertrauen?
Die verschwundenen Hundefreunde aus Saitama, Teil 2: Außerhalb des Betts sind Yakuza nur wertlose Blutsauger
TEIL 2 日 常 DER ARBEITSTAG
Willkommen in Kabukicho!
Meine Nacht als Animateur
Was geschah mit Lucie Blackman?
Geldautomaten und Presslufthämmer: Ein Tag im Leben eines Shakaibu-Reporters
Abendblumen
Der Kaiser der Kredithaie
TEIL 3 夕 暮れ ABENDDÄMMERUNG
Das Königreich des Menschenhandels
Zehntausendundeine Zigarette
Zurück im Revier
Yakuza-Geständnisse
Zwei Gifte
Epilog
Anmerkungen über Informanten und deren Schutz
Danksagung
Anmerkung des Autors
Über den Autor
EINFÜHRUNG
ZEHNTAUSEND ZIGARETTEN
»Vergessen Sie die Story, oder wir machen Sie fertig. Vielleicht auch Ihre Familie. Aber zuerst Ihre Familie, damit Sie Ihre Lektion lernen, bevor Sie sterben.«
Der gut gekleidete Vollstrecker sprach sehr langsam, so wie man mit Idioten oder Kindern oder ahnungslosen Ausländern spricht.
Offenbar meinte er es ernst.
»Verzichten Sie auf die Story und auf Ihren Job, und alles ist vergessen. Wenn Sie den Artikel schreiben, werden wir Sie überall in diesem Land aufstöbern. Verstanden?«
Es ist keine besonders gute Idee, Yamaguchi-gumi, Japans größte Verbrecherorganisation, zu reizen. Denn etwa 40 000 wütende Mitglieder sind eine Menge.
Die japanische Mafia. Sie können sie als Yakuza bezeichnen, aber viele ihrer Mitglieder nennen sich lieber gokudo, was wörtlich »der höchste Weg« bedeutet. Yamaguchi-gumi ist die Spitze des Gokudo-Eisberges. Und unter den vielen Einzelgruppen, aus denen Yamaguchi-gumi besteht, ist Goto-gumi mit ihren über 900 Mitgliedern die schlimmste. Sie zerschlitzen Filmregisseuren das Gesicht, werfen Menschen von Hotelbalkons, jagen Planierraupen in Häuser und vieles mehr.
Und der Mann, der mir gegenübersaß und dieses Angebot machte, gehörte zur Goto-gumi.
Seine Stimme war nicht drohend, er grinste auch nicht höhnisch oder kniff die Augen zusammen. Abgesehen von seinem dunklen Anzug sah er nicht einmal wie ein Yakuza aus. Er hatte noch alle Finger. Er rollte das R nicht wie die Ganoven in den Filmen. Eher glich er einem leicht indignierten Kellner in einem schicken Restaurant.
Er ließ die Asche seiner Zigarette auf den Teppich fallen und drückte die Kippe dann automatisch im Aschenbecher aus. Dann zündete er sich mit einem vergoldeten Feuerzeug eine neue Zigarette an. Er rauchte Hope – weiße Packung, Blockbuchstaben. Reportern fällt so etwas auf, aber es waren keine normalen Hope-Zigaretten, sondern eine halb so lange, dickere Version. Mehr Nikotin. Tödlich.
Die Yakuza hatte noch einen weiteren Vollstrecker zu diesem Treffen geschickt, doch der sagte kein einziges Wort. Der Stumme war dünn und dunkel, er hatte ein Pferdegesicht und wirres, langes, orange gefärbtes Haar – der Chahatsu-Stil. Er trug den gleichen dunklen Anzug.
Ich war mit einem rangniederen Polizisten gekommen, der früher in der Einsatzgruppe gegen das organisierte Verbrechen im Bezirk Saitama gearbeitet hatte: Chiaki Sekiguchi. Er war etwas größer als ich, fast so dunkel, untersetzt, mit tiefliegenden Augen und einer Elvis-Frisur. Er wurde oft für einen Yakuza gehalten. Wäre er den anderen Weg gegangen, hätte er es bestimmt zu einem angesehenen Gangsterboss gebracht. Er war ein großartiger Polizist, ein guter Freund, in mancher Hinsicht mein Mentor, und er hatte mich freiwillig begleitet. Ich warf ihm einen Blick zu. Er hob die Augenbrauen, warf den Kopf zurück und zuckte mit den Schultern. Er würde mir keinen weiteren Rat geben. Nicht jetzt. Ich war also auf mich allein gestellt. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich eine rauche, während ich darüber nachdenke?«
»Nur zu«, sagte der Yakuza etwas zurückhaltender als ich.
Ich zog eine Packung Gudang Garam – indonesische Nelkenzigaretten – aus der Jacke. Sie enthielten viel Nikotin und Teer und rochen wie Weihrauch. Das erinnerte mich an die Tage, die ich als College-Student in einem Zen-Tempel verbracht hatte. Vielleicht hätte ich buddhistischer Mönch werden sollen. Doch jetzt war es ein wenig zu spät dafür.
Nachdem ich mir eine Zigarette in den Mund gesteckt hatte, tastete ich nach dem Feuerzeug, doch der Vollstrecker zückte flink seines und hielt es mir hin, bis er sicher war, dass meine Zigarette brannte.
Er war sehr zuvorkommend, sehr professionell.
Ich schaute zu, wie der dicke Rauch in konzentrischen Kreisen die Zigarettenspitze verließ. Die brennenden Nelkenblätter im Tabak knisterten, als ich inhalierte. Es kam mir vor, als sei die ganze Welt still geworden und als gäbe es nur dieses Geräusch: Knacken, Knistern, Glühen. So ist das bei Nelken. Kurz schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass die Funken hoffentlich kein Loch in meinen oder seinen Anzug brannten, doch dann fand ich, dass das momentan meine geringste Sorge sein sollte.
Ich wusste wirklich nicht, was ich tun oder sagen sollte. Keine Ahnung. Denn ich hatte nicht genug Material für den Artikel. Verdammt, es war gar kein Artikel. Trotzdem. Er wusste das nicht, aber ich wusste es. Und meine wenigen Informationen hatten mir diese unangenehme Begegnung eingebrockt.
Aber vielleicht hatte das Ganze auch sein Gutes, vielleicht war es jetzt an der Zeit, nach Hause zu gehen. Vielleicht sollte Schluss damit sein, 80 Stunden in der Woche zu arbeiten, um zwei Uhr morgens nach Hause zu kommen und um fünf wieder zu gehen. Ich war es leid, dauernd müde zu sein.
Leid, Knüllern nachzujagen, von Kollegen ausgestochen zu werden, sechs Abgabetermine am Tag einzuhalten – drei am Morgen für die Spätausgabe und drei am Abend für die Morgenausgabe. Ich war es leid, jeden zweiten Tag verkatert aufzuwachen.
Ich war mir sicher, dass er nicht bluffte. Er schien es sehr ernst zu meinen. Seiner Meinung nach würde die Story, die ich schreiben wollte, seinen Boss umbringen. Natürlich nicht direkt, aber es wäre die Folge gewesen. Und sein Boss war sein oyabun, sein Ersatzvater. Tadamasa Goto, der berüchtigtste japanische Gangster. Deshalb fühlte er sich natürlich dazu berechtigt, mich zu töten.
Aber wenn ich meinen Teil des Handels einhalten würde, würden sie dann ihr Wort halten? Doch das größte Problem war, dass ich die Story nicht schreiben konnte, da mir noch Fakten fehlten. Aber das durfte ich ihnen natürlich nicht verraten.
Alles, was ich wusste, war: Im Sommer 2001 hatte sich Tadamasa Goto im Dumont-UCLA-Leberkrebszentrum eine Leber transplantieren lassen. Ich wusste oder glaubte zu wissen, welcher Arzt den Eingriff vorgenommen hatte. Ich wusste, wie viel Geld Goto für seine Leber bezahlt hatte: nach einigen Quellen fast eine Million, nach anderen drei Millionen Dollar. Mir war bekannt, dass die Tokioter Zweigstelle eines Kasinos in Las Vegas einen Teil des Geldes, das er für die Klinik brauchte, in die USA überwiesen hatte. Absolut unklar war mir aber, wie so ein Kerl überhaupt in die USA gelangen konnte. Er musste einen Pass gefälscht oder einen japanischen oder amerikanischen Politiker bestochen haben. Irgendetwas war hier faul. Denn er stand auf der schwarzen Liste des amerikanischen Zolls, der Einwanderungsbehörde, des FBI und der Drogenbekämpfungsbehörde DEA (Drug Enforcement Administration). Er durfte eigentlich nicht in die Vereinigten Staaten einreisen.
Ich war mir sicher, dass hinter Gotos Reise und seiner Operation eine interessante Geschichte steckte. Deshalb hatte ich monatelang daran gearbeitet. Und ich konnte nur vermuten, dass mich während dieser Zeit irgendjemand verpfiffen hatte.
Ich spürte, dass meine Hände zitterten. Die Zigarette schien sich in meinen Fingern aufgelöst zu haben, während ich nachgedacht hatte. Ich zündete mir eine zweite an und dachte: Wie zum Teufel bin ich nur so weit gekommen?
Ich hatte nur diese eine Chance, um die richtige Entscheidung zu treffen. Denn ein zweites Treffen würde es nicht geben. Ich konnte später keine Gegendarstellung abdrucken. Langsam geriet ich in Panik, mein Magen fühlte sich an wie zugeknotet, mein linkes Auge zuckte.
Seit über zwölf Jahren machte ich diesen Job, und ich war bereit aufzuhören. Aber doch nicht so. Wie war ich da nur hineingeraten? Das war eine gute Frage. Es war eine bessere Frage als die, die ich jetzt zu beantworten hatte.
Ich dachte weiter nach und verlor das Gefühl dafür, wie viele Zigaretten ich schon geraucht hatte.
»Vergessen Sie die Story, oder wir machen Sie fertig«, hatte der Vollstrecker gesagt.
Das war das Angebot.
Ich hatte keine Trümpfe in der Hand und keine Zigaretten mehr.
Schließlich schluckte ich, atmete aus, schluckte noch einmal und murmelte dann: »In Ordnung. Ich werde die Story ... in der Yomiuri ... nicht schreiben.«
»Gut«, sagte er sehr zufrieden. »An Ihrer Stelle würde ich Japan verlassen. Der Alte ist wütend. Sie haben eine Frau und zwei Kinder, oder? Machen Sie Urlaub, einen langen Urlaub. Vielleicht sollten Sie sich einen neuen Job suchen.«
Dann standen alle auf. Wir verbeugten uns äußerst knapp – es war eher ein kurzes Nicken mit starrem Blick.
Als der Vollstrecker und sein Helfer gegangen waren, wandte ich mich an Sekiguchi. »Glaubst du, dass meine Entscheidung richtig war?«, fragte ich.
Er legte mir die Hand auf die Schulter und drückte sie ein wenig. »Du hast getan, was du tun musstest. Es war richtig. Kein Artikel ist deinen Tod wert, keine Story ist den Tod deiner Familie wert. Helden sind nur Leute, die keine Wahl mehr haben. Aber du hattest noch eine Wahl. Und deine Entscheidung war richtig.«
Ich war wie betäubt.
Sekiguchi führte mich aus dem Hotel, und wir stiegen in ein Taxi. In Shinjuku fanden wir ein Café und ließen uns dort in einer Ecke nieder. »Jake«, begann Sekiguchi, »du hast ohnehin mit dem Gedanken gespielt, die Zeitung zu verlassen. Jetzt ist die Zeit eben gekommen. Du bist kein Feigling, wenn du es tust. Du hast keine Trümpfe in der Hand. Die Inagawa-kai, die Sumiyoshi-kai – verglichen mit diesen Leuten sind die wirklich nett. Ich habe keine Ahnung, wie diese Lebertransplantation in den Staaten abgelaufen ist, aber Goto muss gute Gründe haben, wenn er die Geschichte nicht gedruckt sehen will. Was auch immer er angestellt hat, für ihn ist es eine große Sache. Zieh dich da raus.«
Dann klopfte Sekiguchi mir auf die Schulter, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Er schaute mir fest in die Augen und wiederholte: »Zieh dich da raus. Aber gib die Story nicht auf, finde heraus, wovor dieser Bastard Angst hat. Das musst du wissen, denn dein Friedensvertrag mit diesem Mann wird nicht von Dauer sein, das garantiere ich dir. Diese Typen vergessen nichts. Du musst es rauskriegen. Andernfalls musst du den Rest deines Lebens Angst haben. Manchmal muss man erst ein Stück zurückweichen, um dann zurückschlagen zu können. Gib nicht auf. Warte ein Jahr – zwei Jahre, wenn es sein muss.
Aber finde die Wahrheit heraus. Du bist Journalist, das ist dein Beruf, das ist deine Berufung. Das hat dich an diesen Punkt gebracht. Finde heraus, was er unbedingt verschweigen will. Der Mann hat Angst, darum geht er so auf dich los. Und nur wenn du den Grund dafür kennst, hast du einen Trumpf in der Hand. Nutze ihn gut. Dann hast du eine Chance, wieder das zu tun, was du tun willst. Als man mich zur Verkehrspolizei versetzt hat, weil einer meiner eigenen Leute mich reingelegt hat, damit ich degradiert werde, wollte ich kündigen. Jeden Tag wollte ich kündigen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie man sich als Kripobeamter fühlt, wenn man plötzlich gezwungen ist, Strafzettel zu verteilen, weil irgendein ehrloser Versager anders nicht weiterkommen kann. Aber ich musste an meine Familie denken. Die Entscheidung lag nicht nur bei mir. Also wartete ich ab, ich musste es schlucken, Tag für Tag. Aber die Zeit vergeht, und nach einer Weile gab es die Gelegenheit, ich konnte meinen Standpunkt darlegen, und jetzt mache ich wieder das, was ich ziemlich gut kann. Und bei dir ist es genauso, Jake. Gib nicht auf.«
Natürlich hatte Sekiguchi recht. Das war nicht das Ende.
Aber ich greife voraus.
Es gab einmal eine Zeit, als ich noch keine Yakuza ärgerte, als ich kein kettenrauchender, ausgebrannter Exreporter mit chronischen Schlafstörungen war. Damals kannte ich weder Sekiguchi noch Tadamasa Goto und wusste nicht einmal, wie man auf Japanisch einen anständigen Artikel über Taschendiebe schreibt. Yakuza kannte ich nur aus dem Kino. Damals war ich sicher, dass ich zu den Guten gehörte. Das scheint sehr lange her zu sein.
TEIL 1
朝 日DIE MORGENSONNE
DAS SCHICKSAL IST AUF DEINER SEITE
Der 12. Juli 1992 war der Wendepunkt, was mein Wissen über Japan anbelangt. Ich war auf meinem Stuhl neben dem Telefon festgeleimt, meine Füße steckten im Minikühlschrank – in der Sommerhitze ist jede Kühlung willkommen –, und ich wartete auf einen Anruf der Yomiuri Shimbun, der angesehensten japanischen Zeitung. Entweder würde ich dort als Reporter anfangen oder arbeitslos bleiben. Es war eine lange Nacht, der Höhepunkt eines Prozesses, der ein ganzes Jahr gedauert hatte.
Vor Kurzem noch hatte meine Zukunft mich keinen Deut interessiert. Da war ich Student an der Sophia (Joichi) University mitten in Tokio gewesen und hatte ein Diplom in vergleichender Literaturwissenschaft angestrebt und für die Studentenzeitung geschrieben.
Daher besaß ich zwar etwas Erfahrung in diesem Bereich, war aber nicht wirklich für den Einstieg in einen Beruf qualifiziert. Mein nächster Schritt wäre wahrscheinlich gewesen, Englisch zu unterrichten. Außerdem verdiente ich etwas Geld mit Übersetzungen von Kung-Fu-Videos aus dem Englischen ins Japanische. Und weil ich gelegentlich auch noch reichen japanischen Hausfrauen eine schwedische Massage verabreichte, konnte mein Einkommen die täglichen Ausgaben decken. Meine Eltern mussten allerdings die Unterrichtsgebühren bezahlen.
Eigentlich hatte ich keine Ahnung, was ich tun wollte. Den meisten meiner Kommilitonen war schon vor ihrem Abschluss ein Job zugesagt worden. Dieses naitei genannte Vorgehen galt zwar als ungehörig, dennoch war es gängige Praxis. Auch ich hatte eine solche Zusage erhalten, und zwar von Sony Computer Entertainment, aber sie galt nur, wenn ich mein Studium um ein weiteres Jahr verlängern würde. Ich wollte diesen Job nicht wirklich antreten, aber immerhin ging es dabei um Sony.
Ende 1991, als ich nur noch ganz wenige Kurse besuchte und eine Menge Freizeit hatte, beschloss ich, die japanische Sprache genauer zu studieren. Denn ich wollte die Prüfung in Massenkommunikation für künftige Hochschulabgänger ablegen, um dann einen Job als Reporter zu ergattern und auf Japanisch zu schreiben. Ich war überzeugt, dass es nicht viel schwieriger sein konnte, für eine überregionale Zeitung mit acht oder neun Millionen Lesern zu schreiben als für eine Studentenzeitung.
In Japan gelangt man nicht zu den großen Zeitungen, nachdem man sich bei lokalen Kleinstadtzeitungen hochgearbeitet hat. Vielmehr holen sich die Zeitungen die meisten ihrer Reporter frisch von der Universität. Die Anwärter müssen sich dann als Erstes einem standardisierten Eignungstest unterziehen, der wie folgt abläuft: Angehende Reporter berichten vor einer großen Zuhörerschaft und schreiben tagelang Tests. Wenn das Ergebnis gut genug ist, folgt ein persönliches Gespräch, dann noch eines und schließlich ein drittes. Wer dabei einen guten Eindruck hinterlässt und seinen Gesprächspartnern gefällt, bekommt vielleicht eine Jobzusage.
Ehrlich gesagt glaubte ich nicht ernsthaft daran, dass eine japanische Zeitung mich einstellen würde. Wie groß war wohl die Chance, dass ein jüdischer Junge aus Missouri in diese elitäre japanische Journalistenbruderschaft aufgenommen wurde? Aber das war mir egal. Wenn ich etwas lernte und ein Ziel hatte, auch wenn es noch so unrealistisch war, so würde ich auf jeden Fall von meinen Bemühungen profitieren, und wenn nur mein Japanisch besser würde.
Aber wo sollte ich mich bewerben? Japan hat eine Menge Zeitungen, die zudem viel wichtiger sind als in den Vereinigten Staaten.
Die Yomiuri Shimbun hat die größte Auflage – mehr als zehn Millionen Exemplare täglich – in Japan und sogar in der Welt. Die Asahi Shimbun folgte ihr früher dicht auf den Fersen. Jetzt ist der Abstand größer geworden, aber sie liegt immer noch an zweiter Stelle. Die Yomiuri galt als offizielle Zeitung der konservativen Liberaldemokratischen Partei, die Japans Politik seit dem Zweiten Weltkrieg dominiert, die Asahi als offizielle Zeitung der Sozialisten, die heutzutage fast verschwunden sind. Von der Mainichi Shimbun, der drittgrößten Zeitung, hieß es, sie sei die offizielle Zeitung der Anarchisten, weil sie selbst nicht wisse, auf welcher Seite sie stehe. Die Sankei Shimbun, damals wohl die viertgrößte Zeitung, galt als Stimme der extremen Rechten, und einige hielten sie für ebenso glaubwürdig wie die Boulevardpresse. Auch sie brachte oft spektakuläre Storys.
Die Presseagentur Kyodo, die »japanische Associated Press«, war schwerer zu beurteilen. Ursprünglich hatte sie Domei geheißen und war die offizielle Propagandaabteilung der japanischen Regierung während des Zweiten Weltkriegs gewesen. Nicht alle Verbindungen waren abgebrochen, als die Firma nach dem Krieg unabhängig wurde. Zudem hatte Dentsu, die größte und mächtigste Werbeagentur Japans (und der Welt), eine Mehrheitsbeteiligung an Kyodo, und das konnte die Berichterstattung beeinflussen. Einen wichtigen Grund gab es allerdings, der Kyodo als Arbeitgeber sehr attraktiv machte: die Gewerkschaft. Denn sie sorgte dafür, dass die Journalisten den Urlaub bekamen, der ihnen zustand – und das war in den meisten japanischen Firmen eher selten.
Dann gab es noch Jiji Press, eine Art kleinen Bruder der Kyodo, aber einen hart arbeitenden. Jiji hatte eine kleinere Leserschaft und weniger Reporter. Es gab Leute, die scherzhaft behaupteten, Jiji-Reporter schrieben ihre Artikel erst, nachdem sie Kyodo gelesen hätten – ein gemeiner Scherz in einer gemeinen Branche.
Anfangs neigte ich zur Asahi, aber irgendwann widerstrebte es mir, dass die USA bei jeder Gelegenheit in ein schlechtes Licht gerückt wurde. Das passte nicht zu dem Bild, das die meisten Japaner von Amerika hatten – das Land der Demokratie, das Freiheit und Gerechtigkeit in der ganzen freien Welt verbreitete.
Die Leitartikel der Yomiuri waren ziemlich hart, aber sehr konservativ, mit vielen kanji – chinesischen Schriftzeichen, die in der japanischen Schrift verwendet werden – und voller Andeutungen. Die Artikel im überregionalen Teil fand ich jedoch wirklich eindrucksvoll. Als der Begriff »Menschenhandel« im allgemeinen Wortschatz noch fehlte, veröffentlichte die Yomiuri eine Reihe von schonungslos offenen, gut recherchierten Artikeln über das Leid der thailändischen Frauen, die als Prostituierte nach Japan geschmuggelt wurden. Die Autoren schrieben einigermaßen respektvoll über die Frauen und kritisierten die Polizei zumindest moderat, weil sie kaum etwas gegen diesen Skandal unternahm. Die Zeitung schien mir fest auf der Seite der Unterdrückten zu stehen und für Gerechtigkeit einzutreten.
Da die Prüfungen der Asahi und der Yomiuri am selben Tag stattfanden, entschied ich mich für die Yomiuri.
Die Prüfung war Teil des Journalismusseminars der Yomiuri Shimbun, das inoffiziell als gute Gelegenheit galt, Mitarbeiter anzuwerben, bevor die offizielle Bewerbungssaison begann. So konnte die Zeitung die besten Hochschulabsolventen abschöpfen. Da die Yomiuri keine große Werbung für diese Tests machte, musste jeder, der Interesse hatte, die Zeitung sorgfältig durchforsten, um den Zeitpunkt nicht zu verpassen. Alle Studenten, die den Ehrgeiz hatten, Yomiuri-Reporter zu werden, verschlangen daher die Seiten der Zeitung. In einem Land, in dem das Erscheinungsbild so wichtig ist, musste ich natürlich ordentlich aussehen. Als ich meinen Schrank durchwühlte, entdeckte ich, dass der feuchte Sommer meine beiden Anzüge zu Nährböden für Pilze gemacht hatte. Also trottete ich zu einem riesigen Discount-Herrenausstatter und kaufte einen Sommeranzug für etwa 300 Dollar, der aus dünnem Stoff bestand, angenehm zu tragen war und einen schönen schwarzen Farbton aufwies. Ich gefiel mir darin.
So elegant gekleidet wollte ich meinen Freund Inukai, den Chefredakteur der Studentenzeitung, beeindrucken, doch als ich im Büro auftauchte, das sich in einem dunklen, kerkerartigen Keller befand, reagierte er anders als erwartet.
»Jake-kun, mein Beileid.«
Aoyama-chan, eine andere Kollegin, wirkte nachdenklich, aber sie sagte kein Wort.
Ich verstand nicht, was los war.
»Was ist denn passiert? War es ein Freund?«
»Ein Freund?«
»Der gestorben ist?«
»Hä? Niemand ist gestorben. Allen, die ich kenne, geht es gut.«
Nun nahm Inukai die Brille ab und polierte sie mit seinem Hemd.
»Du hast diesen Anzug also selbst gekauft?«
»Klar. 30 000 Yen.«
Inukai fand das offenbar lustig, das konnte ich daran erkennen, dass er die Augen zusammenkniff wie ein glückliches Hundebaby. »Was für einen Anzug wolltest du denn kaufen?«, fragte er dann ernst. »In der Anzeige stand reifuku.«
Aoyama-chan kicherte.
»Was ist denn?«, fragte ich. »Stimmt etwas nicht?«
»Du Idiot! Du hast einen Anzug für Beerdigungen gekauft. Keinen reifuku, sondern einen mofuku!«
»Na und, was ist denn da der Unterschied?«
»Mofuku sind schwarz. Und niemand trägt einen schwarzen Anzug bei einem Vorstellungsgespräch!«
»Niemand?«
»Na ja, vielleicht ein Yakuza.«
»Tja, könnte ich nicht so tun, als käme ich gerade von einem Begräbnis? Vielleicht kriege ich dann noch Sympathiepunkte.«
»Stimmt, die Leute haben oft Mitleid mit geistig Behinderten.« Aoyama warf ein: »Oder du bewirbst dich bei den Yakuza. Die tragen Schwarz. Du könntest der erste gaijin bei ihnen sein.«
»Nein, dafür eignet er sich nicht«, meinte Inukai. »Und was soll er machen, wenn sie ihn rauswerfen?«
»Stimmt«, sagte Aoyama und nickte. »Wenn es nicht klappt, wird er kaum mehr als Reporter arbeiten können. Denn es ist nicht leicht, mit neun Fingern zu tippen.«
Jetzt war Inukai in seinem Element. »Ich glaube nicht, dass er die Organisation mit neun Fingern verlassen könnte. Vielleicht mit acht. Er ist ein echter Schussel, grob, unbeholfen, nie pünktlich. Ein Barbar.«
»Da hast du recht«, stimmte Aoyama zu. »Immerhin könnte er noch jagen und sammeln. Aber was die Karriere betrifft, ist die Yakuza wohl nichts für ihn, obwohl er in einem schwarzen Anzug wirklich gut aussieht.«
»Also, was soll ich jetzt machen?«
»Kauf dir einen anderen Anzug«, riefen sie im Chor.
»Ich hab nicht genug Geld.«
Inukai schien nachzudenken. »Hmmm. Vielleicht kommst du damit durch, weil du ein gaijin bist. Möglicherweise findet jemand den Anzug niedlich ... oder sie halten dich gleich für einen kompletten Idioten.«
In meinem Beerdigungsanzug schleppte ich mich also am 7. Mai zur ersten Stunde des Seminars, das um 12.50 Uhr in einem eindrucksvollen Raum gleich neben dem Hauptbüro der Yomiuri Shimbun begann. Das Seminar sollte zwei Tage daueren. Am ersten Tag fanden Kurse statt, am zweiten enshuu, also »praktische Übungen«, ein Euphemismus für Prüfungen. Ich war überrascht, dass sie dieses Wort benutzten, weil es im Grunde ein militärischer Begriff ist.1
Das Seminar begann mit einer Eröffnungsrede und einem Vortrag »für diejenigen unter Ihnen, die Journalisten werden wollen«, dann folgte ein zweiter Vortrag über ethische Grundsätze des Journalismus. Danach sprachen »Jungs an der Front« – also aktive Reporter – über ihre Arbeit, ihre Freude über eine gute Story und die Enttäuschung, wenn die Konkurrenz ihnen eine Schlagzeile weggeschnappt hatte. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Vorträge. Denn die vielen Stunden, die ich damit verbracht hatte, einigermaßen Japanisch lesen und schreiben zu lernen, hatten einen Nachteil: Ich konnte die Sprache sehr schlecht verstehen und sprach sie auch nicht sonderlich fließend. Aber ich ging ein kalkuliertes Risiko ein. Denn man brauchte eine ausreichende Punktzahl im schriftlichen Test, um überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Deshalb hatte ich mich mehr im Lesen und Schreiben geübt als in anderen Fertigkeiten. Ich möchte nicht behaupten, dass ich die japanische Sprache gar nicht verstand, es war eher so, als wäre ich ein bisschen hör- und sprachbehindert.
Aber soweit ich sie verstand, waren die Ausführungen des Polizeireporters über die Abteilung für öffentliche Sicherheit der Tokioter Polizei ziemlich interessant. Der Mann sah aus wie 40, hatte graues Kraushaar und hängende Schultern – die Japaner nennen das »Katzenpose«.
Er erklärte, dass die Abteilung für öffentliche Sicherheit nur selten Bekanntmachungen und niemals Pressemitteilungen herausgebe. Alles werde bei Pressekonferenzen gesagt, und wer da nicht aufpasse, der gehe eben leer aus. Das sei kein Ort für Adrenalinsüchtige (oder Ausländer). Manche Reporter besuchten diese Konferenzen ein ganzes Jahr lang, ohne ein einziges Wort zu schreiben. Doch wenn eine Verhaftung stattfand, war das immer eine wichtige Nachricht, weil sie die nationale Sicherheit betraf.
Die eigentliche Prüfung – oder der »militärische Drill«, wie man sie nannte – sollte drei Tage später in der Yomiuri-Berufsschule für Technik in einem Vorort von Tokio stattfinden.
Da ich die Firmenbroschüre nicht gelesen hatte, war ich ein wenig überrascht, dass eine Zeitung auch eine Berufsschule betrieb. Damals wusste ich noch nicht, dass die Yomiuri viel mehr war als eine Zeitung. Sie war ein riesiger Firmenkomplex, zu dem unter anderem der Vergnügungspark Yomiuriland, das Reisebüro Yomiuri Ryoko und ein traditionelles japanisches Gasthaus in Kamakura gehörten. Außerdem besaß sie ihre eigene Miniklinik im zweiten Stock der Firmenzentrale, Schlafzimmer in der dritten Etage, eine Cafeteria, eine Apotheke und eine Buchhandlung, sogar ein Massagetherapeut arbeitete im Haus. Und das Baseballteam der Zeitung, die Yomiuri Giants, wurde wegen seiner landesweiten Popularität oft mit den Yankees verglichen. Unterhaltung, Urlaub, Gesundheitsfürsorge und Sport – man konnte sein Leben führen, ohne das Yomiuri-Imperium zu verlassen.
Vom Bahnhof aus folgte ich den vielen jungen Japanern in marineblauen Anzügen und mit roten Krawatten, dem typischen »Rekrutenlook« dieses Jahres. 1992 bedeutete das auch, dass all jene, die ihr Haar entsprechend der gängigen Mode braun oder rot gefärbt hatten, es nun wieder schwarz trugen. Ein paar Frauen waren mit nüchternen marineblauen Kostümen bekleidet.
15 Minuten vor Beginn der Prüfung betrat ich die Berufsschule und schrieb mich ein. Eine Mitarbeiterin am Empfang fragte mich: »Sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind?«
»Ja, ich bin sicher«, antwortete ich bescheiden.
Die Prüfung bestand aus vier Teilen: einem japanischen Sprachtest, einem Test in Fremdsprachen (dabei konnte man sich einige aussuchen), einem Aufsatz, und zum Schluss erhielten die Bewerber die Möglichkeit, sich selbst als künftige Mitarbeiter anzupreisen.
20 Minuten vor allen anderen war ich mit dem ersten Teil fertig. Einige Minuten lang saß ich ziemlich stolz auf mich selbst einfach so da, bis ich das Blatt zufällig umdrehte und entsetzt bemerkte, dass auf der Rückseite ebenfalls Fragen standen. Jetzt musste ich mich anstrengen, um noch fertig zu werden. Als die Zeit abgelaufen war, gab ich ab, was ich ausgefüllt (oder nicht ausgefüllt) hatte, ging wütend an meinen Platz zurück und war überzeugt, den Rest der Prüfung vergessen und nach Hause gehen zu können.
Ich muss ziemlich fassungslos dagesessen haben, als ein Yomiuri-Mann zu mir kam und mir auf die Schulter klopfte. Er hatte eine Beatlesfrisur, trug eine Metallrandbrille und sprach mit einer heiseren Stimme, die nicht zu seiner Statur und zu seinem Aussehen passte. (Erst nach einiger Zeit erfuhr ich, dass er Endo-san hieß und in der Personalabteilung arbeitete. Er starb einige Jahre später an Kehlkopfkrebs.)
»Sie sind mir unter den Bewerbern aufgefallen«, meinte er auf Japanisch. »Warum machen Sie diese Prüfung?«
»Nun ja, ich dachte, dass ich bessere Chancen habe, einen Job bei der englischsprachigen Daily Yomiuri zu bekommen, wenn ich hier gut abschneide.«
»Ich habe einen Blick auf Ihre Unterlagen geworfen. Bei den ersten Fragen waren Sie richtig gut. Aber was ist dann passiert?«
»Ich habe dummerweise zu spät bemerkt, dass es auf beiden Seiten Fragen gab.«
»Ach so. Das werde ich mir notieren.« Er zog einen kleinen Terminplaner aus seiner Jackentasche und kritzelte etwas hinein.
Dann wandte er sich wieder mir zu. »Vergessen Sie die Daily Yomiuri, das wäre nur Zeitverschwendung. Probieren Sie es bei der richtigen Zeitung. Sie haben immer noch eine gute Chance. Sie sind doch Sophia-Student, nicht wahr?«
»Ja«, antwortete ich.
»Dachte ich mir. Halten Sie durch«, meinte er aufmunternd und tätschelte mir dabei die Schulter.
Da saß ich nun also, und meine Gedanken rasten. Aufgeben und nach Hause gehen oder am Ball bleiben? Schließlich stand ich auf und warf meinen Rucksack über die Schulter. Als ich mich im Raum umsah, hatte ich einen Moment lang den Eindruck, die Zeit sei stehen geblieben. Das Geschnatter war verstummt, die Menschen schienen mitten in ihren Bewegungen erstarrt zu sein, und ich hörte ein schrilles Summen. In diesem Augenblick wusste ich, dass ich vor einer der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens stand.
Mit einem dumpfen Knall landete mein Rucksack wieder auf dem Tisch. Dann holte ich meine Bleistifte aus der Tasche, schob meinen Stuhl zurecht und bereitete mich auf die zweite Runde vor. Hätte ich mir die Musik für meinen Lebensfilm aussuchen dürfen, wäre meine Wahl damals sofort auf das James-Bond-Thema gefallen. Zugegeben, das Ausrichten der Bleistifte ist keine tolle Eröffnungsszene, aber für mich war es vergleichbar mit einer Heldentat.
Im nächsten Teil ging es um Fremdsprachen, und ich war schlau genug, Englisch zu wählen. Monatelang hatte ich mich mit Übersetzungen gelangweilt und Kung-Fu-Videos mit Untertiteln versehen. Das sollte sich jetzt auszahlen. Ich musste einen Bericht über die russische freie Marktwirtschaft aus dem Englischen ins Japanische übersetzen und schließlich einen kurzen Text über die soziale Entwicklung in der modernen Gesellschaft aus dem Japanischen ins Englische. Mit beiden Aufgaben war ich vor der nächsten zehnminütigen Pause fertig.
Dann kam der Aufsatz. Das Thema hieß gaikokujin, also Ausländer, ein Thema, nach dem jeder Ausländer immer wieder gefragt wurde und über das er an der Sophia Aufsätze schreiben musste. Diesmal hatte ich also Glück, und manchmal ist es besser, Glück zu haben, als gut zu sein.
Wie sich schließlich herausstellen sollte, hatte ich beim Japanischtest zwar schlecht abgeschnitten, war aber dennoch von 100 Bewerbern 19. geworden. Damit war ich im Japanischen besser als zehn Prozent der japanischen Kandidaten. Im Fremdsprachentest wurde ich sowohl bei der englisch-japanischen als auch bei der japanischenglischen Übersetzung Erster. Bei der englischen Übersetzung hatte ich sogar Punkte verloren, was aber nicht viel darüber aussagte, wie gut ich die englische Sprache beherrschte. Für meinen Aufsatz bekam ich eine Drei, mehr für den Inhalt als für die Grammatik. Insgesamt erhielt ich für die ersten drei Teile der Prüfung 79 von 100 Punkten und kam damit auf den 59. von 100 Plätzen. Das war zwar nicht gerade berauschend, aber ich wurde dennoch zu einem Gespräch eingeladen. Wahrscheinlich lag das auch daran, dass jemand ein Auge zudrückte, weil ich beim Japanischtest die Rückseite des Blattes übersehen hatte.
Das erste Gespräch drei Wochen später war angenehm kurz. Ich hatte zunächst die Möglichkeit, meinen Patzer zu erklären, dann wurde ich gefragt, was ich von dem Job erwarte und ob ich bereit sei, Überstunden zu machen. Natürlich versicherte ich, dass ich bereit war, sehr hart zu arbeiten. Als Nächstes wurde mein Wissen über die Yomiuri geprüft. Ich verwies auf die Artikel über thailändische Prostituierte, die mich sehr beeindruckt hatten. Das brachte mir bei den Tokioter Journalisten sicherlich Punkte ein.
Abschließend hieß es, es werde noch zwei weitere Gespräche geben. Doch dann hörte ich wochenlang nichts mehr.
Jetzt war ich nervös. Was als beinahe spielerische Herausforderung begonnen hatte, lag nun im Bereich des Möglichen. Jeden Tag ging ich früh nach Hause und wartete auf das Klingeln des Telefons. Ich las fleißig die Zeitung und studierte noch intensiver Japanisch. Mir war klar, dass ich besser werden musste, wenn ich in diesem Job bestehen wollte. Also begann ich auch fernzusehen, um mein Hörverständnis zu verbessern.
Eines Tages hatte ich dann doch genug von der Warterei, deshalb ging ich ins Kabukicho-Kino, um mir einen schlechten Horrorstreifen anzusehen.
Als ich danach auf dem Heimweg war, stieß ich auf einen lustig aussehenden Tarot-Wahrsageautomaten am Eingang einer Spielhalle. Vielleicht konnte es ja helfen, in dieser ungewissen Situation einen Experten zu konsultieren, dachte ich.
Also steckte ich 100 Yen in das Gerät. Der Monitor leuchtete auf, dann erschien ein Wirbel in Grün und Rosa. Nachdem ich die Kategorie »Jobs« und meine Wahrsagerin – Madame Tantra – gewählt hatte, gab ich meine persönlichen Daten ein. Madame Tantra, eine sympathische japanische Frau mit Schultertuch und einem roten Mal auf der Stirn wie eine Hindupriesterin, erschien in einem rauchenden Feuer auf dem Bildschirm und ließ mich Karten aussuchen. Dazu rollte ich die Maus in Form einer Kristallkugel hin und her und klickte auf die Kartenstapel auf dem virtuellen Tisch.
Das endgültige Urteil: Schwertkönig, aufrecht.Erfolg.Schlüsselwort: Neugier
Du eignest dich am besten als Werbetexter oder Redakteur oder für einen anderen Beruf, der mit Schreiben zu tun hat. Dafür sind literarische Fähigkeiten und in gewissem Umfang auch eine allgemeine Neugier notwendig. Da du beide Eigenschaften besitzt, kannst du sie bestimmt sinnvoll nutzen. Wenn du deine Antennen immer nach Informationen ausstreckst und deine Neugier wach hältst, IST DAS SCHICKSAL AUF DEINER SEITE.
Ich war begeistert, der Spruch schien mir so zutreffend, dass ich den Ausdruck behielt. Von der Unterstützung des Schicksals beflügelt nahm ich den letzten Zug nach Hause und hörte sofort meinen Anrufbeantworter ab. Die Yomiuri hatte tatsächlich angerufen und mir ein zweites Gespräch angeboten.
Beim zweiten Treffen waren drei Männer anwesend. Zwei von ihnen schienen mir wohlgesinnt zu sein, aber der dritte sah mich an, als wäre ich eine Fliege auf seinem Pausenbrot. Ich hatte den Eindruck, dass ich ein umstrittener Bewerber war. Nach einer Weile fragte mich einer von ihnen ernst:
»Sie sind Jude, nicht wahr?«
»Ja, auf dem Papier.«
»Viele Leute in Japan glauben, dass die Juden die Weltwirtschaft beherrschen. Was halten Sie davon?«
Rasch antwortete ich: »Wenn dem so wäre, wäre ich dann hier und würde mich als Zeitungsreporter bewerben? Ich weiß, was man im ersten Jahr verdient.«
Das war offenbar die richtige Antwort, denn der Mann kicherte und zwinkerte mir zu. Weitere Fragen gab es nicht.
Als ich aufstand, um zu gehen, hielt mich einer von ihnen auf und meinte: »Adelstein-san, es gibt nur noch eine Gesprächsrunde. Wenn Sie dazu eingeladen werden, haben Sie es fast geschafft. Wir rufen die in Frage kommenden Kandidaten am 12. Juli an – und wir rufen nur einmal an.«
Da saß ich dann also angespannt und aufgeregt am 12. Juli 1992 in meiner kleinen Wohnung mit den Füßen im Kühlschrank und einer Hand am Telefon. Und der Anruf kam abends um 21.30 Uhr.
»Herzlichen Glückwunsch, Adelstein-san. Sie wurden für die letzte Gesprächsrunde ausgewählt. Bitte kommen Sie am 31. Juli ins Yomiuri-Gebäude. Haben Sie noch Fragen?«
Ich hatte keine.
Das letzte Gespräch verlief sehr gut. Alle lächelten, und die Atmosphäre war entspannt. Schwierige Fragen gab es kaum. Nur einer der Anwesenden wollte mir eine komplizierte Frage zur japanischen Politik stellen, doch hatte er einen so ausgeprägten Osaka-Dialekt, dass ich ihn kaum verstand. Das versuchte ich zu vertuschen, indem ich wie ein Psychiater Teile seines letzten Satzes wiederholte und dann vage anmerkte: »Ja, so kann man das Problem natürlich auch sehen.« Er wertete meine Antwort offenbar als völlige Zustimmung, und ich machte mir nicht die Mühe, ihn davon abzubringen.
Dann kamen die beiden letzten Fragen:
»Können Sie am Sabbat arbeiten?«
Das war kein Problem.
»Dürfen Sie Sushi essen?«
Das war auch keines.
Danach klopfte mir Matsuzaka-san, einer der Personalleiter, der für einen Japaner erstaunlich jüdisch aussah, auf die Schulter und sagte: »Meinen Glückwunsch. Betrachten Sie sich als eingestellt. Die nötigen Unterlagen erhalten Sie mit der Post.«
Als er mich zur Tür brachte, flüsterte er mir verschwörerisch ins Ohr: »Ich war auch auf der Sophia. Ihre Lehrer haben Sie gelobt. Schön, dass wir jetzt zu zweit sind.« Es war kaum zu glauben, ich hatte wirklich Glück gehabt, dass einer von den Leuten, die über mich urteilen sollten, ein ehemaliger Sophia-Student war.
Ich weiß nicht, warum das Schicksal mir so gewogen war, aber sicherheitshalber warf ich auf dem Heimweg ein paar Münzen auf den Haufen vor dem Buddha im Garten des Nezu-Museums.
Diesem Buddha schuldete ich nämlich noch etwas Geld, das ich mir einmal für die U-Bahn geborgt hatte – und ich bezahle meine Schulden immer.
ES GEHT NICHT UMS LERNEN, SONDERN UMS VERLERNEN
Da ich erst in sechs Monaten bei der Yomiuri anfangen sollte, hatte ich genügend Zeit, um unsicher zu werden. Hatte ich mir vielleicht mehr zugemutet, als ich leisten konnte? Natürlich konnte ich gut genug lesen und schreiben, aber wie sollte ich Leute auf Japanisch interviewen? Matsuzaka, der bei der Yomiuri für die Neueinsteiger zuständig war, war ziemlich überrascht, als ich im Oktober in sein Büro platzte und ihn um ein Praktikum bat, das mir helfen sollte, mich auf den Job vorzubereiten.
»Ich finde es gut, dass sie sich perfekt vorbereiten wollen«, meinte er, »aber bisher hat noch nie jemand vor dem offiziellen Beginn hier gearbeitet. Aber Sie sind ja ein ungewöhnlicher Fall, darum will ich sehen, was ich tun kann.« Dann brachte er mich in den zweiten Stock, bot mir eine Tasse Kaffee an, überreichte mir Info-Material für Jungreporter und schickte mich nach Hause.
Etwa zwei Wochen später rief er an, um mir zu sagen, dass er eine Art Minipraktikum für mich arrangiert hatte. Ich sollte etwa eine Woche in verschiedenen Büros verbringen. Mein erster Einsatz führte mich in den Presseclub des Tokyo Metropolitan Police Department (TMPD).
Matsuzaka erwartete mich im Hauptquartier der Tokioter Polizei, einem riesigen, labyrinthartigen Gebäude, das alle anderen im Regierungsviertel überragte. Es war das Nervenzentrum der Tokioter Polizei, die aus rund 40 000 Beamten bestand. Matsuzaka wollte mich Ansei Inoue vorstellen, einem legendären Journalisten und Autor des Buches Thirty-three Years as a Police Reporter. Inoue war der Star unter den Polizeireportern und wurde im Yomiuri-Imperium geliebt, gefürchtet und beneidet. Berühmt geworden war er dadurch, dass er die Unschuld eines Universitätsprofessors bewiesen hatte, der wegen Mordes an seiner Frau verurteilt worden war. Er hatte nicht nur die Fehler der Polizei und der Staatsanwaltschaft entlarvt, sondern auch den wahren Mörder aufgespürt. Der Fall wurde zum klassischen Beispiel dafür, dass auch Unschuldige verurteilt werden können, wenn sie in das Räderwerk der japanischen Justiz geraten.
Inoue war etwa 1,54 Meter groß und dünn, hatte langes, ungepflegtes Haar und trug einen grauen Anzug, eine schwarze Krawatte und abgewetzte Schuhe. Seine Augen waren hinter braunen Brillengläsern verborgen und blickten trüb. Doch als ich ihm vorgestellt wurde, funkelten sie, denn die Situation schien ihn zu amüsieren.
»Sie sind also der gaijin, von dem ich gehört habe«, sagte er lebhaft. »Sie sprechen Japanisch, stimmt’s?« Obwohl er die Frage eher an Matsu zaka gerichtet hatte als an mich, antwortete ich ihm.
»Ich spreche Japanisch, aber das Schreiben ist eine andere Sache.«
Inoue lachte. »Ach, Sie schreiben wahrscheinlich besser als die Leute, die für mich arbeiten. Gehen wir nach oben.«
Jeder, der das TMPD besuchte, ohne Mitglied des Presseclubs oder Angestellter zu sein oder ohne eine besondere Sicherheitsüberprüfung durchlaufen zu haben, brauchte einen Polizisten als Begleitung, um das Gebäude betreten zu dürfen. Aber Inoue kam und ging nach Belieben. Drei Jahre später, nachdem die Aum-Shinrikyo-Sekte die U-Bahn mit dem Nervengift Sarin besprüht hatte, gab es eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen in ganz Tokio.
Wir fuhren mit dem Aufzug in den neunten Stock, in dem sich die Abteilung für öffentliche Angelegenheiten des TMPD und drei Presseclubs befanden: der für die Zeitungen, der für das Fernsehen und der für den Rundfunk und die Lokalzeitungen des Landes. Für die Wochen- und Monatszeitschriften war kein Platz – die Polizei hielt sie für subversive Skandalblätter und setzte sie daher nicht auf die offizielle Liste der Presseclubs.
Ausländische Journalisten waren ebenfalls nicht vertreten. Die wichtigen japanischen Medien haben dagegen nie protestiert und werden es auch nicht tun. Denn wer Teil eines Monopols ist, hat kein Interesse an Konkurrenz.
Einige Reporter spielten Karten auf einem ramponierten Tisch im offenen Bereich vor der Küche. Weiter hinten auf der Etage gab es einen feuchten Raum mit Tatami-Matten, wo die Reporter ihre Futons ausrollen und ihren Kater ausschlafen konnten, während sie auf die nächsten Pressemitteilungen warteten.
Als Inoue und ich in den Yomiuri-Teil des Presseclubs kamen, der im Wesentlichen ein rechteckiger Raum war, der durch einen Vorhang als Tür vom Rest abgetrennt wurde, hatten sich alle Reporter um einen Tisch versammelt und betrachteten einen Bildband. Der Raum wirkte gar nicht wie das Quartier der größten Zeitung in Japan. An den Wänden standen hohe Bücherregale, Zeitungen und Zeitschriften lagen auf dem Sofa und auf dem Boden verstreut. Papierkörbe quollen über von zerknüllten Telefaxen, Nudelpackungen und Bierdosen, und auf jedem Schreibtisch stand ein Computer. In einer Ecke befand sich eine Klimaanlage, und auf dem breiten Fenstersims standen sechs Fernseher und drei aufeinandergestapelte Videorekorder. Alle Fernsehgeräte waren eingeschaltet, und ein CB-Funkgerät gab den Funkverkehr der Feuerwehr wieder. In einem Etagenbett neben dem Vorhang schlief jemand in seinen Schuhen und mit der Morgenzeitung auf dem Gesicht.
Inoue und ich gingen zu der Reportergruppe. Das Buch, das sie begutachteten, war Sex von Madonna, das gerade veröffentlicht worden war. Die Journalisten – nur Männer – betrachteten und kommentierten ihre Brüste. Inoue stellte mich vor, dann nahm er das Buch und gab es mir: »Finden Sie es obszön?« Da es eine japanische Ausgabe war, waren große Teile der Bilder – Genitalien und Schamhaare – geschwärzt.
»Nein, das finde ich nicht.«
»Tja, wenn sie dieses hier herausgebracht hätten«, fuhr er fort und zog dabei die unveränderte amerikanische Ausgabe aus dem Regal, »hätte die Polizei beim Verlag eine Razzia veranstaltet und jedes Exemplar beschlagnahmt. Die Verleger von Santa Fe2 wären fast verhaftet worden, weil sie ein bisschen Schamhaar gezeigt haben. Aber dieses Zeug aus Amerika kommt Pornografie schon sehr nahe. Vielleicht ist es ja Kunst, aber doch auch Pornografie. Wir hätten eine gute Story gehabt, wenn die japanischen Verlage nicht so feige gewesen wären.«
»Würde die Polizei jemanden wirklich deswegen verhaften?«
»Der oberste Gerichtshof hat 1957 entschieden, dass alles obszön ist, was den Betrachter sexuell erregt, was schamlos ist und die Moralvorstellungen der Gesellschaft verletzt. Und weil obszöne Werke verboten sind, ist ihre Verbreitung eine Straftat.«
»Das heißt?«
»Nun ja, für die Polizei heißt das: kein Schamhaar. Jedenfalls früher.« Inoue kicherte. »Das ist schon ein seltsames Land. Die Polizei kümmert es nicht, wenn Sie mitten am Tag Oralsex haben oder wenn die Betreiber der Sexclubs ihre Dienste öffentlich anbieten. Aber sie regt sich auf, wenn Leute anderen Leuten beim Sex zusehen. Und Schamhaar erinnert zu sehr an Sex. Die Moral der Geschichte ist also: Tut es, aber schaut es euch nicht an.«
»Darf so etwas in den Vereinigten Staaten verkauft werden?«, wollte nun ein Reporter wissen.
Die Frage löste eine zwanzigminütige Diskussion über die Unterschiede zwischen japanischer und amerikanischer Pornografie aus. Die Reporter waren schockiert zu erfahren, dass Genitalien in den USA selten mit Tintenfischen oder anderen Meerestieren verdeckt werden und dass auch Sex in Strumpfhosen nicht gerade beliebt ist. Sie baten mich, von meinem nächsten Besuch in Amerika ein paar Videos mitzubringen.
Als wir gingen, warnte mich Inoue: »Tun Sie das bloß nicht. Bringen Sie keine Pornos für diese Idioten mit. Der Zoll würde Sie verhaften, und das ist das Letzte, was wir brauchen. Diese Typen können auch gut ohne dieses Zeug leben.«
Wir machten uns auf den Weg in ein Café, bestellten grünen Tee und er fragte mich, was ich bei der Yomiuri tun wolle.
»Ich interessiere mich für Enthüllungsjournalismus und für die Seite Japans, von der ich nicht viel weiß«, erklärte ich, »für die Schattenseite, die Unterwelt.« Ich erzählte ihm, dass mein Vater Gerichtsmediziner sei und mich Verbrechen und die Polizei schon immer fasziniert hätten.
Daraufhin empfahl er mir shakaibu, die Gesellschaftsredaktion, die für nationale Nachrichten und Kriminalität zuständig ist. »Das ist die Seele der Zeitung«, meinte er. »Alles andere ist nur das Fleisch auf den Knochen. Aber wir sind die Vertreter des echten Journalismus, der die Welt verändern kann.«
Als ich ihn um ein paar Tipps für meine Karriere als Journalist bat, schwieg er zunächst eine Weile. Er roch ein wenig nach Sake, als er zu sprechen begann, und später erfuhr ich, dass er an diesem Morgen bis fünf Uhr getrunken hatte. Jetzt war es neun Uhr, und wahrscheinlich hätte er nicht so offen geredet, wenn er total nüchtern gewesen wäre.
»Zeitungsjournalismus ist keine höhere Mathematik«, sagte er dann. »Das Muster steht fest. Man hält sich an das Muster und baut darauf auf. Das ist wie in einem Kampfsport. Sie lernen eine Übung, die Sie ständig wiederholen, und verinnerlichen so die grundlegenden Bewegungen. Genauso ist es bei uns. Es gibt etwa drei oder vier Arten, über Gewaltverbrechen zu schreiben. Sie müssen sich den Stil einprägen, Lücken füllen und Fakten ermitteln. Der Rest kommt von selbst. Ein guter Reporter muss acht Regeln einhalten, Jake.
Erstens: Geben Sie nie Ihre Quellen preis. Wenn Sie Ihre Informanten nicht schützen, traut Ihnen niemand mehr. Alle Knüller basieren darauf, dass die anonym bleiben, von denen Sie die Informationen erhalten haben. Das ist das A und O des Journalismus. Ihr Informant ist Ihr Freund, Ihre Geliebte, Ihre Ehefrau und Ihre Seele. Wenn Sie Ihre Quelle verraten, verraten Sie sich selbst, dann sind Sie kein Journalist, nicht einmal ein richtiger Mann.
Zweitens: Schreiben Sie einen Artikel so schnell wie möglich. Denn Nachrichten sind kurzlebig. Wenn Sie eine Chance verpassen, ist die Geschichte vielleicht schon tot oder der Knüller ist geplatzt.
Drittens: Glauben Sie niemandem. Menschen lügen, Polizisten lügen, sogar Ihre Kollegen lügen. Gehen Sie davon aus, dass Sie belogen werden, und seien Sie vorsichtig.
Viertens: Besorgen Sie sich jede Information, die Sie kriegen können. Menschen sind gut und schlecht, Informationen nicht. Bei Informationen spielt es keine Rolle, wer sie Ihnen gibt oder wie Sie sie erlangt haben. Wichtig sind nur ihre Qualität und ihr Wahrheitsgehalt.
Fünftens: Sie brauchen ein gutes Gedächtnis und eine gewisse Ausdauer. Was die Leute verdrängen, sucht sie manchmal in ihren Träumen heim. Was ein unbedeutender Fall zu sein scheint, kann sich später zu einem Knüller entwickeln. Behalten Sie die laufenden Ermittlungen und deren Fortgang im Auge. Lassen Sie sich nicht von dem steten Strom neuer Nachrichten von den noch offenen Geschichten ablenken.
Sechstens: Sichern Sie Ihre Artikel dreifach ab, vor allem wenn sie nicht auf offiziellen Verlautbarungen der Behörden beruhen. Wenn Sie die gleichen Informationen aus drei verschiedenen Quellen erhalten, sind sie wahrscheinlich echt.
Siebtens: Schreiben Sie den Text wie eine umgekehrte Pyramide. Redakteure kürzen von unten nach oben. Was wichtig ist, steht oben, die banalen Details stehen unten. Wenn Ihr Artikel es bis in die Ausgabe schaffen soll, muss er leicht zu kürzen sein.
Achtens: Lassen Sie nie Ihre persönliche Meinung in einen Artikel einfließen. Überlassen Sie das anderen, Experten oder Kommentatoren. Objektivität ist subjektiv.
Das ist alles.«
Das Ganze war ein erstaunlich offener Ratschlag von einem Mann, der als eher hinterlistig galt. Immerhin hatte Inoue einige Male mit harten Bandagen kämpfen müssen, um es so weit zu bringen. Zunächst war er Regionalreporter gewesen, also quasi ein Bürger zweiter Klasse, denn die wanderten von einem Regionalbüro zum anderen, ohne jemals mehr als ein paar Jahre im Hauptbüro zu verbringen. Deshalb konnten sie auch nicht über die großen Ereignisse schreiben oder in Tokio Karriere machen. Doch Inoue hatte das System überlistet. Irgendwie war es ihm gelungen, in die Landesredaktion aufzusteigen und in den Presseclub der Tokioter Polizei aufgenommen zu werden.
Wie jeder Yomiuri-Mitarbeiter wusste er, dass die Abteilung für nationale Nachrichten der richtige Platz für einen angehenden Enthüllungsjournalisten war. Aber es war schwer, dort einen Job zu bekommen, und ihn zu behalten war noch schwerer. Es hieß, dass diese Reporter am längsten arbeiteten, am meisten tranken, am häufigsten geschieden wurden und am frühesten starben. Ich weiß nicht, ob diese Behauptungen jemals statistisch erhärtet wurden, aber fast alle früheren und jetzigen Reporter in dieser Abteilung legen einen beinahe masochistischen Stolz auf ihren Status an den Tag.
Nach drei Tagen beim TMPD schickte man mich für zwei Tage in das Büro nach Chiba. Der Bürochef hieß Kaneko. Er hatte früher in der überregionalen Redaktion gearbeitet und war TMPD-Chefreporter gewesen. Das Büro war sauber und modern, es gab zwei Schreibtischgruppen sowie mehrere Faxgeräte auf Regalen, und alle Akten standen fein säuberlich in chronologischer Reihenfolge in Bücherregalen – das genaue Gegenteil des TMPD-Presseclubs.
Kaneko empfing mich herzlich. Er interessierte sich sehr für meine jüdische Herkunft. Wir setzten uns auf ein Sofa und er begann mich auszufragen, bis er schließlich die Frage stellte, die ihn wirklich interessierte: »Sprechen Sie Hebräisch?«
Als ich verneinte, schien er enttäuscht zu sein. Daher fragte ich ihn, warum das für ihn wichtig war.
»Nun ja, auf den Straßen beim Bahnhof gibt es eine Menge Israelis, die Armbanduhren, Schmuck und Markenwaren verkaufen – natürlich alles gefälscht«, antwortete er. »Und ich vermute, dass sie der Yakuza Schutzgeld zahlen müssen.«
Damals wusste ich noch nicht viel über die Yakuza, nur dass sie Gangster waren und manchmal Gewalt anwendeten.
Kaneko bot mir eine Zigarette an, während er weitersprach.
»Da Sie ein gaijin sind, könnten Sie vielleicht mit ihnen reden und etwas herausfinden. Interessant wäre, welchen Anteil die Yakuza bekommt und wie der Handel abgeschlossen wird. Was meinen Sie?« Natürlich war ich begeistert.
Nun rief Kaneko einen Reporter namens Hatsugai zu sich und ernannte ihn zu meinem Redakteur. Ich bekam einen Füller, einen Notizblock und einen Kassettenrekorder, und 30 Minuten nach meiner Ankunft im Büro wurde ich schon losgeschickt.
Die Straßenverkäufer standen überall, vor allem in der Nähe des Bahnhofs. Die meisten von ihnen waren anscheinend Israelis auf Asienreise, und sie verkauften Waren, die sie in Nepal oder Tibet erstanden hatten. Einige hatten gefälschte Markenuhren und Handtaschen aus Thailand. Ich setzte mich in einen Mister-Donut-Imbiss gegenüber von einem Verkäufer und begann mit meiner Überwachung.
Nach zwei Tagen und vielen Donuts sah ich zwei Japaner in weißen Hosen, grellen bedruckten Hemden und mit Dauerwelle, die auf einen israelischen Verkäufer zugingen. Es waren eindeutig Ganoven. Einer von ihnen war groß und hatte eine breite Stirn, aber der Kleine ging voraus. Sofort verließ ich die Imbissstube und schlenderte an ihnen vorbei.
Die beiden stellten sich an die Seiten des Tisches des Händlers, und ich konnte hören, wie der kleinere Gangster vier oder fünf Worte zu dem Israeli sagte. Ein Wort war shobadai, das ich noch nie zuvor gehört hatte. Der Händler murmelte etwas auf Hebräisch, zog ein Banknotenbündel aus einer Schublade und überreichte es dem kleinen Japaner. Dieser gab es an seinen größeren Kollegen weiter, der die Geldscheine ganz dreist in aller Öffentlichkeit zählte, dann einsteckte und den Händler dann mit seinen Waren allein ließ.
Nun ging ich zu dem Israeli, betrachtete seinen Schmuck und sagte mitfühlend: »Ich wusste gar nicht, dass Sie für einen Straßenstand Miete zahlen müssen.«
Der Mann warf seinen Pferdeschwanz zurück und sah mich misstrauisch an. Dann entspannte er sich, da er mich wohl für einen Landsmann hielt. »Ich muss zahlen, damit die Bullen oder diese Kerle mich in Ruhe lassen. Sie kriegen 35 Prozent von allen meinen Einnahmen.«
»Aber woher wissen die denn, was Sie einnehmen?«
»Sie sehen, was auf dem Tisch liegt und wissen genau, was fehlt, wenn sie wiederkommen. Man kann sie nicht reinlegen.«
»Warum gehen Sie nicht zur Polizei?«
»Mann, Sie müssen hier neu sein. Ich habe ein Touristenvisum, und wenn ich zur Polizei gehe, dann lande ich im Knast. Das wissen die Yakuza, und ich weiß es auch. So ist es eben, wenn man hier Geschäfte machen will. Man hat keine Wahl.«
»Mist!«, sagte ich. »Ich wollte eigentlich auch in dieses Geschäft einsteigen. Ich habe keine Lust mehr, Englisch zu unterrichten.«
»Man verdient nicht schlecht«, gab der Händler zu, »etwa 100 000 Yen (rund 1000 Dollar) am Wochenende. Aber in Yokohama soll das Geschäft noch besser laufen.«
Ich bot ihm ein paar Donuts an, und er erzählte mir von seinen Abenteuern in Thailand. Etwa 30 Minuten später kamen ein anderer Israeli und seine japanische Freundin in einem Lieferwagen an und luden ihre Ware aus.
Händler eins stellte mich vor, Händler zwei hieß Easy und begann sofort, sich mit starkem hebräischem Akzent über die Gangster zu beklagen. »Ich hasse diese Dreckskerle! Je mehr wir verdienen, desto mehr nehmen sie uns ab. Am liebsten würde ich ihnen gar nichts geben, aber Keiko«, und dabei zeigte er auf seine Freundin, »hält das für keine gute Idee.«
Keiko nickte, dann fragte sie: »Kennen Sie die Sumiyoshi-kai?«
Selbst ich hatte von der Sumiyoshi-kai, einer der größten Yakuza-Gruppen in Tokio, gehört und wusste, dass es nicht ratsam war, ihr in die Quere zu kommen. Wenn die Händler weiter Geschäfte machen wollten, mussten sie sich an die Spielregeln halten.
Nachdem ich ins Büro zurückgekehrt war, berichtete ich Kaneko von dem Gespräch. Er war sehr erfreut über meine Erkenntnisse.
»Was bedeutet shobadai?«, fragte ich ihn.
»Das ist ein Slangausdruck für Miete. Basho bedeutet Platz, und dai bedeutet Geld. Aber statt bashodai sagen die Yakuza shobadai. Sie verdrehen gern die Buchstaben, damit normale Leute sie nicht verstehen. Es ist der übliche Jargon, ein Wort, das das Ausnehmen der Straßenhändler bezeichnet.«
Dann forderte Kaneko mich auf: »Schreiben Sie den Artikel.«
Das war der Sprung ins kalte Wasser! Der Ausgangspunkt war, dass die Yakuza ausländische Straßenhändler erpresste, die sich nicht bei der Polizei beschweren konnten, und dass dies eine Einkommensquelle für das organisierte Verbrechen war. Ich bemühte mich wirklich, aber der Artikel war furchtbar, denn ich wusste nicht viel über die Gesetze gegen das organisierte Verbrechen, die damals noch neu waren, und ich hatte keinen Kontakt zur Polizei, um die Story zu vertiefen.
Als Hatsugai den Artikel überflog, meinte er höflich: »Nicht schlecht, ein guter Anfang. Ich werde mit der Polizei in Chiba reden und sehen, was die von der Sache hält. Dann schmeißen wir unser Material zusammen und versuchen, das Ganze in der Lokalzeitung unterzubringen.«
Als ich am nächsten Montag ins Büro kam, begrüßte mich Kaneko aufgeregt. »Adelstein, große Neuigkeiten! Da heute nicht viel los ist, kommt Ihr Artikel in die überregionale Ausgabe. In die Abendaus gabe!«
Er versicherte mir, dass es ein großer Erfolg für einen Reporter aus einem Regionalbüro sei, in der überregionalen Ausgabe gedruckt zu werden. Er war mindestens so begeistert wie ich.
Die Schlagzeile lautete: »Ausländische Straßenhändler Zielscheibe des organisierten Verbrechens. Yakuza beutet illegale Händler, die keinen Polizeischutz anfordern können, aus und erpresst von ihnen Geld.« Das war zumindest an diesem Tag eine Nachricht für die ganze Nation. Natürlich stand mein Name nicht unter dem Text – er fehlte meist sogar bei altbewährten Reportern, also kein Grund zur Klage.
Alles in allem war es eine respektable Leistung, und Inoue rief mich am selben Morgen an und gratulierte mir. Ich war mit einer Schlagzeile in die überregionale Ausgabe gekommen, obwohl ich noch nicht einmal eingestellt war!
Da ich mich nun doch ein wenig selbstsicherer fühlte, beschloss ich, noch etwas herumzureisen, bevor mein Leben als Arbeitnehmer anfangen würde. Die Yomiuri vergab zinslose Darlehen an neue Angestellte, damit diese vor Arbeitsbeginn ins Ausland reisen konnten. Es war ein reizvolles Angebot und machte natürlich gleichzeitig aus Mitarbeitern Schuldknechte. Doch ich wollte das Angebot nutzen, um ein paar Monate in Hongkong zu verbringen und die chinesische Kampfkunst wing chun zu studieren, die mich schon seit Langem interessierte. Doch leider riefen mich Mitarbeiter der Zeitung an, um mir mitzuteilen, dass mein Visum nicht verlängert worden sei und ich sofort zurückkommen und mich darum kümmern müsse, da ich sonst keinen Job bekommen würde.
Die Einreisebehörde befand sich nur drei Minuten vom Haupt büro der Yomiuri entfernt in einem baufälligen Haus. Im Erdgeschoss und im ersten Stock wimmelte es nur so von mürrischen Ausländern. Ich war per Postkarte aufgefordert worden, dort vorzusprechen, und musste über eine Stunde lang warten, bis ich in das entsprechende Zimmer gerufen wurde.
Mein Gesprächspartner war ein alter Bürokrat mit vielen Goldzähnen und grauem Haar, das er mit Pomade an die Seiten geklebt hatte. Da er offenbar lieber englisch mit mir reden wollte, tat ich ihm den Gefallen.
»Sie werden vom nächsten April an für die Daily Yomiuri3 arbeiten?«
»Nein, ich werde von diesem April an für die japanische Yomiuri arbeiten.«
»Die japanische Yomiuri?«
»Ja, die japanische Ausgabe.«
»Dann sind Sie Fotograf?«
»Nein, ich werde als Journalist arbeiten.«
»Als Journalist? Schreiben Sie japanisch?«
»Ja, und deshalb arbeite ich für die japanische Yomiuri und nicht für die Daily Yomiuri.«
»Also die japanische Yomiuri?«
»Ja genau.«
»Wenn Sie japanisch schreiben, ist das dann internationale oder nationale Arbeit?«
»Das weiß ich nicht. Das müssen Sie doch wissen.«
»Hm. Haben Sie einen Vertrag?«
»Nein, keinen Vertrag, ich werde ein festangestellter Mitarbeiter sein, ein seisha-in4.«
»Seisha-in? Aber Sie sind kein Japaner?«
»Soviel ich weiß, nein.«
»Dann brauchen Sie einen Vertrag.«
»Ich habe keinen Vertrag. Ich bin ein seisha-in, und die bekommen keinen Vertrag, die werden einfach für immer eingestellt.«
Er kratzte sich am Kopf und holte dann durch die Zähne Luft.
»Ich denke, Sie sollten einen Vertrag unterschreiben und dann noch einmal zurückkommen.«
»Wann?«
»Wenn Sie den Vertrag haben.«
»Und an wen soll ich mich dann wenden?«
Das verwirrte ihn offenbar, denn er begriff, dass er die Verantwortung für mein Visum übernehmen musste. Nach einem kurzen Blick nach links, so als ob er überlegte, an wen er mich weiterreichen könnte, gab er mir zögernd seine Karte.
»Sie können mich anrufen.«