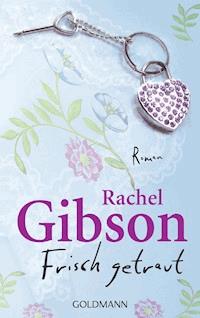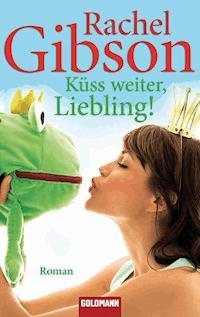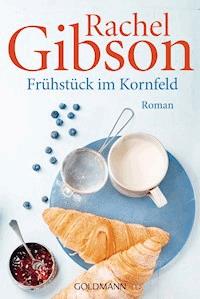6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn es der Traum eines jeden Mannes ist, mit einem unglaublich attraktiven Model auf dem Meer zu treiben, dann möchte Max Zamora lieber schnell aufwachen, denn diese Begleitung hat ihm bei seiner Flucht vor einem rachsüchtigen Drogenboss gerade noch gefehlt. - Aber auch Lola Carlyle kann sich etwas Besseres vorstellen, als ihren Erholungsurlaub mit einem Mann zu verbringen, der mit James Bond ganz offensichtlich mehr als nur den Beruf gemein hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Buch
Als ehemaliges Supermodel ist Lola Carlyle ja einigen Trubel gewöhnt, als aber ihr Ex-Verlobter Sam sehr private Nacktfotos von ihr übers Internet vertreibt, wird ihr die Sache doch zu bunt, und Lola ergreift die Flucht. Die Jacht eines Freundes, die gerade ungenutzt im Hafen von Nassau liegt, ist für sie da wie ein Geschenk des Himmels. Dort will sie – nur in Gesellschaft ihres Zwergpinschers Baby Doll – Ruhe und Abgeschiedenheit genießen. Der Friede ist aber nur von kurzer Dauer, denn die scheinbar unbemannte Jacht kommt dem amerikanischen Geheimagenten Max Zamora gerade recht, der es sehr eilig hat, von den Bahamas wegzukommen: Sein letzter Auftrag ging völlig schief, er überlebte das Fiasko nur mit knapper Not und hat zudem den Tod des Sohnes von Drogenboss André Cosella zu verantworten. Als aber Lola von ihrem Nickerchen unter Deck erwacht, ist sie gar nicht erfreut über diese Wendung ihres Erholungsprogramms. Schnell stellt sich heraus, dass Max und Lola sich zumindest in puncto Willensstärke in nichts nachstehen. Als die Meinungsverschiedenheiten darin gipfeln, dass ein Brand an Deck die Jacht manövrierunfähig macht, ist guter Rat teuer – zumal Max sich sicher sein kann, dass ihnen der Vergeltung suchende Gangsterboss Cosella dicht auf den Fersen ist …
Autorin
Seit sie sechzehn ist, erfindet Rachel Gibson mit Begeisterung Geschichten. Damals allerdings brauchte sie ihre Ideen vor allem dazu, sich alle möglichen Ausreden einfallen zu lassen, wenn sie wieder etwas ausgefressen hatte. Ihre Karriere als Autorin begann viel später, und mittlerweile hat sie nicht nur die Herzen ihrer Leserinnen erobert, sie wurde auch mit dem Golden Heart Award und dem National Readers Choice Award ausgezeichnet. Rachel Gibson lebt mit ihrem Ehemann, drei Kindern, zwei Katzen und einem Hund in Boise, Idaho.
Rachel Gibson
Traumfrau ahoi
Roman
Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Hartmann
Goldmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »Lola Carlyle Reveals All« bei Avon Books, an Imprint of Harper Collins Publishers, New York
Dieses Buch ist ein Werk der Fantasie. Personen, Orte und Ereignisse sind von der Autorin erdacht. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen, lebenden oder toten Personen ist rein zufällig.
Deutsche Erstausgabe Januar 2004
Copyright © der Originalausgabe 2002 by Rachel Gibson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2004 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Satz: deutsch-türkischer fotosatz, Berlin
Redaktion: Andrea Brandl
An · Herstellung: Sebastian Strohmaier
ISBN 978-3-641-06953-7V001
www.goldmann-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Mein herzlicher Dank und meine Wertschätzung gelten den Donnerstagabend-Mädchen: Laura Lee Guhrke, Jill Hill und Cathie Wilson. Ihr bringt mich zum Lachen und sorgt dafür, dass ich nicht völlig den Verstand verliere.
Prolog
Die schlimmste aller Demütigungen, die Lola Carlyle in ihrem Leben hinnehmen musste – und deren Liste war lang und schmutzig –, war zweifellos der Anblick ihrer Nacktfotos im Internet. Jeder, der über ein Modem und eine Kreditkarte verfügte, konnte sie auf fünfzehn verschiedenen Fotos im Evaskostüm bewundern. Und ein Foto war peinlicher als das nächste. Zu wissen, dass diese Bilder der Allgemeinheit zur Verfügung standen, war eine ewige Schmach, eine Last auf ihren Schultern, ein unablässiger Hammerschlag auf den Kopf.
Ihr Ex-Verlobter, Sam der Mistkerl, hatte die Fotos vor einigen Jahren geschossen. Sam, der ihr ewige Liebe geschworen und behauptet hatte, sie könnte ihm in jeder Hinsicht vertrauen, hatte sich ihrer Fotos bedient, um sich aus seinem finanziellen Engpass zu befreien. Vier Jahre nach der Beendigung ihrer Beziehung hatte er www.lola-entblättert.com entwickelt und damit die Quelle ihrer größten Schande ins Leben gerufen.
Schon zuvor hatte Lola für Profifotografen posiert – sogar unzählige Male. Aber Sam war Banker und hatte die Fotos mit einer Einwegkamera aufgenommen, die er bei einer Tombola gewonnen hatte. In einem Moment, den sie rückblickend nur geistiger Umnachtung zuschreiben konnte, hatte sie zugelassen, dass er eine Fotoserie von ihr schoss, splitternackt in seinem Bett, auf seinem Heimtrainer und mitten auf dem Küchentisch sitzend, wo sie Schokoriegel und tütenweise Chips in sich hineinstopfte.
Das allerschlimmste Foto aber zeigte sie, wie sie einen riesigen Tootsie-Roll-Schokoriegel küsste. Damals waren die Aufnahmen als Riesenspaß gedacht gewesen, als alberner Witz über ihren Beruf, der zur Folge hatte, dass sie niemals etwas zu sich nahm, das nicht kalorienfrei gebacken, gebraten oder angemacht war, niemals etwas aß, das dick machte, ohne ihren Körper sofort danach routinemäßig davon zu befreien.
Was die Fotos nicht zeigten, war die Übelkeit, die gleich nach dieser Junk-Food-Orgie eingesetzt hatte. Der Teufelskreis des schlechten Gewissens, der stets auf den totalen Kontrollverlust folgte. Die Panik, dass sie ein Gramm zugenommen haben könnte, die sie jedes Mal direkt in die Tretmühle oder aufs Klo jagte.
Es war ein zwanghaftes Verhalten, das sie inzwischen unter Kontrolle hatte, doch einmal hätte es sie fast das Leben gekostet. Selbst heute noch löste der Anblick ihres Körpers auf alten Fotos – ein Meter achtzig und knapp über fünfzig Kilo – jene Stimme in ihrem Kopf aus, die ihr entweder riet, das Mittagessen ausfallen zu lassen, oder aber sie in den nächsten Imbiss trieb, um eimerweise Brathähnchen mit Kartoffelpüree und Soße sowie eine Diät-Cola zu bestellen.
Schlimmer noch als die Schande, dass alle Welt diese geschmacklosen Fotos im Internet ansehen konnte, war das Wissen, dass sie nichts dagegen unternehmen konnte. Versucht hatte sie es; weiß Gott. Sie hatte Sam angefleht, ihr die Fotos zu überlassen und sie aus dem Netz zu nehmen. Sie hatte ihm Geld geboten, aber selbst nach all den Jahren war er immer noch so verletzt wegen ihrer Trennung, dass er sich weigerte. Sie hatte einen Anwalt hinzugezogen, der ihr lediglich bestätigen konnte, was sie ohnehin schon wusste. Sam war der Besitzer der Fotos und konnte sie veröffentlichen, wo immer er wollte. Trotzdem hatte sie ihn vor den Kadi gezerrt und prompt den Kürzeren gezogen.
Also blieb nur noch eine Möglichkeit: ein Rollkommando. Eine Alternative, die sie tatsächlich in Betracht ziehen könnte, hätte sie nur vorab die Garantie gehabt, dass sie nicht erwischt würde und sich und ihre Familie dadurch noch tiefer in den Schmutz zog. Denn in ihrer Familie, die nicht gerade aus Heiligen bestand, war Lola schon immer das schwärzeste Schaf gewesen. Was angesichts Onkel Jeds jüngster Probleme durchaus etwas heißen wollte. Keiner von ihnen hatte je im Gefängnis gesessen, Verhaftungen jedoch gab es durchaus. Aber Knast nicht. Und Lola in Sträflingskleidung zu sehen, das wäre womöglich der letzte Nagel zum Sarg ihrer armen Mutter.
Lola griff nach der Illustrierten, die sie in ihren Koffer gestopft hatte, und betrachtete ihr Konterfei auf der Titelseite des National Enquirer. Die Schlagzeile unter ihrem Foto lautete: LOLA CARLYLE, SCHWERGEWICHTIGES EX-MODEL, TAUCHT UNTER. Sie schleuderte die Zeitschrift zur Seite und verließ mit ihrem Zwergpinscher Baby Doll unterm Arm den kleinen Bungalow. Anscheinend tauchte ihr Name inzwischen nur noch in Verbindung mit den fünfundzwanzig Pfund auf, die sie seit ihrem Rückzug aus dem Modelgeschäft zugelegt hatte, und der Begriff schwergewichtig gehörte dabei mittlerweile noch zu den charmantesten Formulierungen. Am verhasstesten war ihr der Name Die üppige Lola. Sie versuchte, sich von dessen Umschreibungen nicht kränken zu lassen, aber tief im Inneren trafen sie sie doch.
Sie war nicht dick, und sie war auch nicht untergetaucht. Sie befand sich in einem dringend nötigen Urlaub zur geistigen Gesundung. Auf einer privaten Insel der Bahamas, um sich auszuruhen. Aber nach zwei Tagen des Ausruhens langweilte sie sich zu Tode und war im Begriff, völlig durchzudrehen. Das Leben lag vor ihr; sie hatte ein Geschäft zu führen. Und inzwischen war sie dank der warmen Sonne und der frischen Luft hübsch gebräunt, vollkommen klar im Kopf und mit einem neuen Plan vor Augen.
Vermutlich waren ein guter Privatdetektiv und ein paar ans Tageslicht gezerrte Leichen in Sams Keller alles, was sie brauchte, um ihn zum Zurückziehen seiner Website zu zwingen. Sam hatte in geschäftlicher Hinsicht keine ganz weiße Weste, sodass sich zweifellos eine ganze Menge finden ließ, womit sie ihn erpressen konnte. Es war so einfach, dass sie gar nicht verstand, wieso sie nicht schon früher auf die Idee gekommen war.
Sobald sie wieder zu Hause war, konnte Sam der Mistkerl was erleben.
1. Kapitel
Max Zamora wurde allmählich zu alt, um noch Superman zu spielen. Adrenalin schoss durch seine Adern und bewirkte, dass sich die feinen Haare auf seinen Armen aufrichteten, doch konnte es nicht den glühenden Schmerz vertreiben, der in seine Rippen fuhr und ihm die Luft aus den Lungen presste. Mit seinen sechsunddreißig Jahren empfand er den Schmerz, den die Rettung der Welt ihm einbrachte, entschieden stärker als früher.
Er atmete tief und regelmäßig, um den Schmerz und die drohende Übelkeit unter Kontrolle zu bringen. Über das Hämmern in seinem Kopf hinweg lauschte er auf die Geräusche der Touristen und Taxis, der Inselmusik und der Wellen an den Docks. Er hörte nichts Außergewöhnliches in der feuchten Nachtluft, aber Max wusste, dass sie da draußen lauerten. Irgendwo. Ihn suchten. Wenn sie ihn erwischten, würden sie nicht zögern, ihn umzulegen, und dieses Mal würde es ihnen gelingen.
Die Lichter des Atlantis Casino tauchten den Jachthafen in verschwommenes Licht, und für den Bruchteil einer Sekunde sah er klar, dann wieder doppelt, was ihn beim Auftauchen aus den Schatten aus dem Gleichgewicht brachte. Die Sohlen seiner Kampfstiefel verursachten kein Geräusch, als er auf die Jacht am Ende des Docks kletterte. Blut aus seiner aufgeplatzten Unterlippe rann über sein Kinn auf das schwarze T-Shirt. Sobald der Adrenalinstoß verebbte, würde er gehörige Schmerzen haben, doch vorher wollte er längst auf halbem Weg nach Florida sein, weg von der Hölle, durch die er auf Paradise Island gegangen war.
Max tastete sich bis zu der dunklen Kombüse vor und durchsuchte die Schubladen. Er stieß auf ein Fischmesser, zog es aus der Scheide und prüfte mit dem Daumen die scharfe Klinge. Mondschein sickerte durch die Plexiglas-Oberlichter der Jacht und beleuchtete das tintenschwarze Innere.
Er machte sich nicht die Mühe, die Jacht zu durchsuchen. Viel konnte er ohnehin nicht erkennen, und er würde sich hüten, das Licht einzuschalten und dadurch das Risiko einzugehen, gesehen zu werden. Das Besteck klapperte in der Schublade, als Max sie mit einem Ruck zuschob. Falls die Besitzer an Bord waren, hatte er inzwischen wohl genug Lärm gemacht, um sie zu wecken. Und falls doch plötzlich jemand aus der Dunkelheit auftauchen sollte, musste er eben auf Plan B zurückgreifen. Das Problem dabei war nur, dass er keinen Plan B hatte. Vor einer Stunde schon hatte er seine letzten Notfallstrategien zum Einsatz gebracht, und nun ließ er sich nur noch von seinem Instinkt und dem Überlebenswillen leiten. Wenn dieser letzte verzweifelte Versuch fehlschlug, war er ein toter Mann. Max hatte keine Angst vor dem Tod, gönnte aber auch niemandem das Vergnügen, ihn um die Ecke zu bringen.
Als sich niemand blicken ließ, tastete er sich zurück nach draußen und kappte rasch die Leinen, ehe er die Treppe zur Brücke hinaufstieg. Einige Sekunden lang klärte sich sein Blick, und er erkannte, dass die Brücke ein Segeltuchdach und mit Plastik verschalte Fenster hatte. Im Schatten neben dem Kapitänssessel ging er in die Knie. Wieder sah er doppelt und verschwommen. Eine Woge der Übelkeit überkam ihn, die er wegatmete, so gut er konnte. Mit tastenden Händen stemmte er mit dem Messer ein Stück aus dem Bug. Schweiß brannte in der Platzwunde auf seiner Stirn und sammelte sich in seinen Brauen, während er ein Gewirr von Drähten aus der Öffnung zog. Da er noch immer nicht richtig sehen konnte, brauchte er länger als gewöhnlich, um das Zündkabel zu finden. Er schnitt es durch und hielt die beiden Enden aneinander. Der Doppelmotor sprang an, stotterte und wühlte das Wasser auf, während Max sich mit einer Hand die schmerzende Seite hielt, sich mit der anderen am Bug aufstützte und aufstand. Er legte den Gang ein, drückte den Gashebel durch und lenkte die Jacht vom Anleger fort. Wenn er den Kopf ein wenig nach rechts neigte, war seine Doppelsichtigkeit nicht ganz so schlimm, sodass er die Jacht in der Mitte der Fahrrinne an etwaigen Hindernissen vorbeilenken konnte.
Er steuerte das Boot aus dem Jachthafen hinaus in Richtung des Hafens von Nassau, unter der Brücke hindurch, die Paradise Island mit der Hauptstadt verband, und vorbei an den Kreuzschiffen an der Prince George Wharf. In dieser Nacht war bisher nichts so einfach gewesen, und Max rechnete jeden Moment mit Maschinengewehrfeuer, das das Segeltuchdach zerfetzte und sich ins Deck fraß. Seit dem Augenblick, als er am Nachmittag auf der Insel gelandet war, hatte ihn das Glück mehr und mehr im Stich gelassen, und er glaubte nicht, dass seine Pechsträhne bereits hinter ihm lag.
»Entschuldigung, aber was tun Sie hier?«
Beim Klang der Frauenstimme fuhr Max herum und hielt sich an der Lehne des Kapitänssitzes fest, um nicht zu stürzen. Er starrte auf die doppelten Umrisse einer Frau im verblassenden Licht des Hafens. Ein Leuchtturm am Ende der Insel schickte seinen hellen Strahl über den Boden und beleuchtete zwei identische Paar Füße mit vierzig roten Zehennägeln. Er wanderte weiter und zeigte zwei rotblaue Röcke und flache nackte Bäuche, ehe er auf zwei weiße Blusen glitt, die unter zwei Paar üppigen Brüsten verknotet waren. Dann wanderte der Strahl über zwei volle Lippenpaare und ein Gewirr blonder Locken. Ihr Gesicht blieb im Verborgenen, doch aus ihren Armen kläfften zwei kleine Hunde, so schrill, dass es Max in den Ohren schmerzte.
»Scheiße, das hat mir gerade noch gefehlt«, stieß er hervor, während er sich fragte, woher zum Teufel sie plötzlich kam. Die armselige Karikatur eines Hundes befreite sich aus ihren Armen, schoss auf Max zu, blieb vor seinen Füßen stehen und bellte so leidenschaftlich, dass seine kleinen Hinterbeine vom Deck abhoben. Die Frau trat vor, dicht gefolgt von ihrem Double, und nahm den Köter hastig wieder hoch.
»Wer sind Sie? Arbeiten Sie für die Thatchs?«, fragte sie. Er hatte keine Zeit für Hunde und Fragen oder sonstigen Blödsinn. Sie musste weg. Das Letzte, was er in dieser Nacht brauchte, waren ein bellender Köter und eine keifende Frau. Sie und ihr Hund würden wohl springen müssen. Die Spitze von Paradise Island lag noch nicht ganz dreißig Meter hinter ihnen. Das würden sie schaffen. Und wenn nicht, war es nicht sein Problem.
»Bringen Sie den Hund zum Schweigen, sonst befördere ich ihn mit einem Fußtritt über Bord«, warnte er, statt sie und den Köter gleich ins Meer zu werfen. Verdammt, er wurde wohl weich auf seine alten Tage.
»Wohin wollen Sie mit dieser Jacht?«
Ohne auf ihre Frage zu achten, warf er einen letzten Blick auf die schwindenden Lichter von Nassau, auf die verschwommenen grünen Markierungsbojen und den Strahl des Leuchtturms, dann wandte er sich den Armaturen zu. Er hatte selbst ein paar Fragen, würde aber auf die Antworten wohl noch warten müssen. Im Augenblick beschäftigte ihn Wichtigeres. Sein Überleben zum Beispiel.
Seine Hände zitterten vor Schmerzen und vom Adrenalin. Mit Hilfe purer Willenskraft und dank jahrelanger Erfahrung zwang er sie zur Ruhe. Er hatte noch kein Schiff entdeckt, das ihn verfolgte, aber das hatte nicht viel zu bedeuten.
»Sie können das Boot nicht einfach so nehmen. Fahren Sie zurück zum Jachthafen!«
Hätte sein Kopf nicht so höllisch geschmerzt und wäre sein Körper nicht als Boxbirne missbraucht worden, hätte er sie womöglich echt witzig gefunden. Zurück zum Jachthafen, zurück in die Hölle, die er gerade hinter sich gelassen hatte? Wohl kaum. Es gehörte schon außergewöhnliche Begabung dazu, einen Motor kurzzuschließen, wenn man nicht mal richtig sehen konnte. Er war an Bord so ziemlich jedes nur erdenklichen schwimmenden Gefährts gewesen. Vom Schlauchboot bis zum Kampf-U-Boot. Er konnte ein GPS, das Gerät zur Positionsbestimmung via Satellit, bedienen, notfalls Seekarten lesen und mit Hilfe eines Kompasses manövrieren. Das Problem war nur, dass sein mangelndes Sehvermögen es ihm nur erlaubte, auf gut Glück nach Westen zu steuern.
»Wer sind Sie?«
Er blinzelte in das diffuse goldene Licht der Kontrolllämpchen vor seinen Augen und griff nach dem Funkgerät. Er verfehlte es und versuchte es erneut, bis er die Tasten unter den Fingerspitzen spürte. Statik knisterte in der Luft um ihn herum und übertönte die Fragen der Frau. Er stellte den Sender ein, bis keine Hintergrundgeräusche mehr zu hören waren, und drehte es leicht. Das Funkgerät fing das Gespräch des Hafenmeisters mit einem Passagierschiff auf, und Max wechselte zu einem neutralen Sender. Er erfuhr nichts Außergewöhnliches und suchte weiter. Sämtliche Kanäle klangen normal. Nichts Außergewöhnliches, aber normale, gewöhnliche Kommunikation war nicht das, worauf er wartete. »Sie müssen mich zurückbringen. Ich verspreche auch, kein Wort über die Sache zu verlieren.«
Natürlich nicht, dachte er und warf einen Blick über die Schulter, konnte jedoch mit dem linken Auge nichts sehen und wandte sich wieder den Steuervorrichtungen zu. Wenn sie verdammt noch mal die Klappe halten würde, könnte er vielleicht vergessen, dass sie da war.
Seit zwölf Stunden war der Kontakt zum Pentagon abgebrochen. In seiner letzten Meldung hatte er sie informiert, dass eine Rettungsaktion ebenso wie weitere Verhandlungen überflüssig waren. Die beiden DEA-Agenten, die er suchte, waren bereits seit geraumer Zeit tot. Offenbar nicht an Folter gewöhnt, waren sie unter den Händen ihrer Gegner gestorben.
»Man wird mich vermissen, wissen Sie. Ich wette, das tut man jetzt schon.«
Quatsch.
»Bestimmt ist die Polizei längst benachrichtigt.«
Die Polizei der Bahamas war sein geringstes Problem. Er hatte André Cosellas ältesten Sohn, José, umbringen müssen, und er selbst war nur sehr knapp mit dem Leben davongekommen. Wenn André davon Wind bekam, hatte Max einen ausgesprochen verärgerten Drogenboss am Hals.
»Setzen Sie sich hin, und halten Sie den Mund.« Trotz seiner Sehschwierigkeiten erkannte er die Lichter eines Segelboots, das von backbord auf die Jacht zukam. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sich Drogenschmuggler an Bord des Seglers befanden, doch er war klug genug, nie irgendetwas auszuschließen, und das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte, war eine Frau an seiner Seite, die sich die Lunge aus dem Leib schrie.
Er spürte ihre Bewegung mehr, als dass er sie sah, und bevor sie auch nur einen Schritt tun konnte, packte er ihren Arm. »Machen Sie bloß keine Dummheiten.«
Sie schrie auf und versuchte sich loszureißen. Der Hund kläffte, sprang auf den Boden und grub die Zähne in Max’ Hosenbein. »Nehmen Sie die Finger weg!«, schrie sie, holte aus und hätte um ein Haar seinen ohnehin schon schmerzenden Kopf getroffen.
»Verfluchte Scheiße!« Max drehte sie um, riss sie rücklings an seine Brust und biss die Zähne zusammen, als der Schmerz in seine Rippen fuhr, während er nach ihren Handgelenken griff. Sie wehrte sich nach Kräften, doch es kostete Max keinerlei Mühe, sie unter Kontrolle zu halten. Problemlos kreuzte er ihre Unterarme vor ihrer Brust und presste ihren Körper an sich, sodass sie nicht mehr um sich schlagen konnte. Ihr hochgestecktes Haar kitzelte seine Wange, als er sie über ihre unselige Lage aufklärte. »Seien Sie ein braves Mädchen, und wer weiß, vielleicht erleben Sie dann sogar den Sonnenaufgang morgen früh.«
Sie hielt schlagartig still. »Tun Sie mir nichts.«
Sie hatte ihn missverstanden, aber er machte sich nicht die Mühe, sie zu korrigieren. Vor ihm brauchte sie schließlich keine Angst zu haben. Er würde ihr nicht wehtun, es sei denn, sie versuchte noch einmal, nach ihm zu schlagen.
Das Segelboot glitt durch die ruhige See. Für Max nur verschwommen sichtbar, was ihn überdeutlich an seine schwache Position erinnerte. Im Augenblick sah er im Dunkeln besser als bei Licht, was ungefähr genauso viele Vor- wie Nachteile mit sich brachte. Er brauchte keinen Arzt, um zu wissen, dass seine Rippen angebrochen waren, und er war sicher, dass er mindestens eine Woche lang Blut pinkeln würde. Schlimmer noch: Cosellas Leute hatten ihm sämtliches Spielzeug abgenommen – alle seine Waffen und seine Kommunikationsgeräte, sogar seine Uhr. Er hatte nichts, womit er sich wehren konnte, und wenn sie ihn fanden, war er ihnen hilflos ausgeliefert. Seine Pechsträhne hatte ihm zu allem Überfluss auch noch eine verweichlichte Zivilistin und ihren nervenden Köter beschert. Er schüttelte sein Bein, worauf der kleine Kläffer über den Holzboden rutschte.
»Lassen Sie mich los, dann tue ich, was Sie sagen, und setze mich hin.«
Er glaubte ihr kein Wort. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sie nicht irgendetwas versuchen würde, und in seinem angeschlagenen Zustand würde er es nicht einmal kommen sehen. Er hatte in dieser Nacht schon zu viel durchgestanden, um sich von ihr jetzt den Rest geben zu lassen. Er kniff die Augen zusammen, worauf die doppelten Bilder zu einem einzelnen verschmolzen. Das Hecklicht des Seglers glitt an ihnen vorbei, und zu seiner ungeheuren Erleichterung setzte die Doppelsichtigkeit nicht wieder ein.
»Wer sind Sie?«, fragte die Frau.
»Ich bin einer von den Guten.«
»Klar«, sagte sie, doch es klang keineswegs überzeugt, sondern eher so, als wollte sie ihn beschwichtigen.
»Das ist die Wahrheit.«
»Die Guten stehlen keine Boote und kidnappen keine Frauen. «
Das war ein Argument, aber trotzdem irrte sie sich. Manchmal war die Grenze zwischen den Guten und den Bösen so verschwommen wie seine Sicht. »Ich habe dieses Boot nicht gestohlen, ich habe es requiriert. Und Sie habe ich nicht gekidnappt. «
»Dann bringen Sie mich zurück.«
»Nein.« Max hatte das beste Training erhalten, das das Militär zu bieten hatte. Abgesehen von dem Fiasko dieser Nacht, konnte er besser schießen als jeder andere. Er konnte praktisch jede Alarmanlage umgehen, sich nehmen, was er brauchte, und zum Abendbrot wieder zu Hause sein, doch er wusste aus Erfahrung, dass eine hysterische Frau eine sichere Lage in eine höllisch gefährliche verwandeln konnte. »Ich will Ihnen nichts tun. Ich muss nur zusehen, dass ich aus Nassau wegkomme. «
»Wer sind Sie?«
Er spielte mit dem Gedanken, ihr irgendeinen erfundenen Namen zu nennen, doch da sie wahrscheinlich ohnehin erfuhr, wie er hieß, wenn sie ihn wegen Entführung verhaften ließ, entschied er sich für die Wahrheit. »Ich bin Korvettenkapitän Max Zamora«, antwortete er, was jedoch nicht ganz der Wahrheit entsprach. Er verschwieg, dass er den Militärdienst quittiert hatte und inzwischen für eine Regierungsabteilung arbeitete, die offiziell nicht existierte.
»Lassen Sie mich los«, forderte sie, worauf Max das erste Mal auf das undeutliche Bild seiner Hände an ihren Handgelenken hinabsah. Seine Fingerknöchel pressten sich in ihre weichen Brüste, und schlagartig spürte er jeden Zentimeter ihres schmalen Rückens an seinem Brustkorb. Ihr wohl gerundetes Hinterteil schmiegte sich an seine Weichteile, und Begierde mischte sich in den Schmerz seiner angeknacksten Rippen und in das Dröhnen in seinem Kopf. Es empörte und überraschte ihn gleichermaßen, dass er zu irgendeiner Empfindung außer Schmerzen überhaupt in der Lage war. Das Bewusstsein ihrer unmittelbaren Nähe breitete sich in seinem Körper aus, doch er schob es von sich, unterdrückte es und verbannte es in die dunklen Winkel seiner Seele, wo er sämtliche Schwächen verbarg.
»Versuchen Sie noch einmal, mich zu schlagen?«, fragte er.
»Nein.«
Er ließ sie los, und sie flüchtete aus seiner Umklammerung, als ob ihre Kleider in Flammen stünden. Er sah sie in einer Ecke der dunklen Kabine verschwinden und wandte sich wieder dem GPS zu.
»Hierher, Baby.«
In der Annahme, sich verhört zu haben, starrte er sie über die Schulter hinweg an. »Wie bitte?«
Sie hob ihren Hund vom Boden auf. »Hat er dir wehgetan, Baby Doll?«
»Gütiger Gott«, seufzte er, als wäre er in irgendetwas Ekliges getreten. Sie nannte ihren Hund Baby Doll. Kein Wunder, dass er so eine widerliche kleine Nervensäge war. Er wandte sich dem Radarsystem zu und schaltete es ein. Der Bildschirm wurde hell und ließ eine graue, verschwommene Masse von Linien und Ziffern erscheinen. Max blinzelte und stellte die Schärfe ein. Auf der Backbord-Seite des Bildschirms erkannte er gerade eben die Umrisse der rasch näher kommenden Andros-Inseln, an Steuerbord die Kette der Berry-Inseln. Sein Sehvermögen war noch nicht so weit wiederhergestellt, als dass er die Angaben zu den Längen- und Breitengraden hätte entziffern können, doch er ging davon aus, dass er, solange er noch eine Stunde lang weiter nach Nordwesten hielt, ehe er sich westwärts wandte, gegen Morgen an der Küste Floridas anlangen müsste.
»Wenn Sie wirklich Korvettenkapitän sind, zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere.«
Selbst wenn ihm bei seiner Gefangennahme nicht sämtliche Papiere abgenommen worden wären, hätten sie ihr nicht viel Aufschluss gegeben. Er war unter dem Namen Eduardo Rodriguez in Nassau eingereist, und alles, vom Pass über den Führerschein bis zu allem möglichen Kleinkram, war gefälscht gewesen.
»Nehmen Sie Platz, Lady. Die ganze Sache ist im Handumdrehen vorüber«, sagte er, weil ihm nichts Besseres einfiel. Jedenfalls nichts, was sie ihm geglaubt hätte. Die amerikanische Öffentlichkeit war besser beraten, wenn sie nichts von Männern wie Max wusste. Von Männern, die im Verborgenen arbeiteten. Die nicht nachvollziehbare Missionen für die Vereinigten Staaten ausführten und mit nicht verfolgbarem Geld bezahlt wurden. Die nicht existente Anrufe an nicht existenten Telefonen in einem nicht existenten Büro im Pentagon entgegennahmen. Die geheime Informationen sammelten, terroristische Aktivitäten unterbanden, die Bösen unschädlich machten und der Regierung die Möglichkeit ließen, ihre Hände in Unschuld zu waschen.
»Wohin fahren wir?«
»Nach Westen«, antwortete er. Mehr brauchte sie nicht zu wissen.
»Wohin genau?«
Allein ihr Tonfall verriet ihm, dass sie der Typ Frau war, der das Sagen haben wollte. Eine von denen, die einem Mann in die Eier traten. Auch unter günstigeren Umständen ließ Max sich nicht gern in die Eier treten, und im Augenblick waren die Umstände alles andere als günstig. Und er wollte verflucht sein, wenn er sich diese ohnehin vermasselte Nacht von einer Frau noch mehr vermasseln lassen würde.
»Genau dahin, wohin ich will.«
»Ich habe ein Recht zu wissen, wohin man mich bringt.«
Normalerweise schüchterte er Frauen nicht gern ein, was aber noch lange nicht hieß, dass er es nicht tun würde. Er stellte den Motor auf eine ruhige Geschwindigkeit von etwa zwanzig Knoten ein, aktivierte den Autopiloten und stapfte auf die dunkle Gestalt zu, die mit dem Hund im Arm in einem dunklen Winkel der Kommandobrücke saß. Der Vollmond schien durch die Windschutzscheibe und tauchte ihre Schulter und ihren Hals in Licht. Offensichtlich hatte sie einen Blick auf sein Gesicht erhaschen können, denn sie sog scharf den Atem ein und drückte sich noch tiefer in die Ecke. Gut. Sollte sie doch Angst vor ihm haben.
»Jetzt hören Sie mal gut zu«, setzte er an, baute sich vor ihr auf und stemmte die Fäuste in die Seiten. »Ich kann Ihnen das Leben leicht oder aber verdammt schwer machen. Sie können sich zurücklehnen und die Fahrt genießen, oder Sie können versuchen, sich gegen mich zu stellen. Wenn Sie das tun, kann ich Ihnen garantieren, dass Sie verlieren. Also, wie hätten Sie’s gern?«
Sie sagte kein Wort, doch ihr Hund sprang aus ihren Armen und grub seine Zähne in Max’ Schulter wie ein tollwütiger Vampir.
»Scheiße!«, fluchte Max und packte den Köter am Kragen.
»Tun Sie ihm nichts! Tun Sie Baby nicht weh!«
Ihm wehtun? Max hätte ihn am liebsten zertreten, sodass nur ein Fettfleck von ihm übrig war. Er zerrte ihn weg, wobei der Stoff seines Hemdes riss. Die knurrende Bestie entwand sich seinen Händen, fiel zu Boden, heulte auf und huschte davon.
»Mistkerl!«, schrie die Frau. »Sie haben meinem Hund wehgetan! « Erst als eine Faust auf seine Schläfe traf, wurde ihm klar, dass sie sein mangelndes Sehvermögen ausgenutzt hatte. Es dröhnte in seinen Ohren, alles verschwamm noch ein bisschen mehr vor seinen Augen, und er bedachte sie mit ein paar saftigen Schimpfworten.
Sie holte noch einmal aus, doch dieses Mal war er vorbereitet und packte ihr Handgelenk in der Bewegung. Er riss ihr die Füße unter dem Körper weg, worauf sie unsanft auf dem Deck aufkam. Max hatte keine Lust mehr, nett zu sein. Er drehte sie auf den Bauch und stemmte ihr das Knie in den Rücken. Sie strampelte und wehrte sich und stieß ebenfalls eine Reihe wüster Beschimpfungen aus.
»Lassen Sie mich los!«
Sie loslassen? Kam nicht in Frage. Er würde sie fesseln, knebeln und über Bord werfen. Sayonara, Süße. Trübes Licht vom Armaturenbrett fiel über den Boden und auf ihre nackten Füße und Waden. Sie trat aus, worauf er den Stoff ihres Rocks packte und einen breiten Streifen vom Saum abriss.
»Aufhören! Was zum Teufel soll das?«
Statt einer Antwort setzte er sich rittlings auf sie und drückte die Knie gegen ihre Hüften, um sie zum Stillhalten zu zwingen. Sie versuchte, sich ihm zu entwinden, doch er erwischte einen ihrer wild tretenden Füße und schaffte es, ihr eine Schlinge um den Knöchel zu legen. Dann packte er den zweiten Fuß und band den Stoff als Fessel um beide Knöchel. Sie schrie aus Leibeskräften, während Max ihre Füße fesselte. Schließlich packte er noch einmal ihren Rocksaum, um einen weiteren Streifen davon abzureißen, und hielt das gesamte Kleidungsstück in den Händen. Ihre Beine hoben sich hell gegen den dunkleren Holzboden des Decks ab. Ihr Slip war weiß oder pinkfarben. Max war nicht sicher, hatte aber keine Lust, sich länger mit dieser Frage zu beschäftigen.
Sie flehte ihn an aufzuhören, doch ihre Bitten trafen auf noch immer dröhnende Ohren. Er riss einen weiteren langen Streifen von ihrem Rock ab und legte seine Handfläche auf ihr Hinterteil. Seide. Ihr Slip war aus Seide, stellte er bei dieser Gelegenheit fest. Hastig drehte er sich über ihr um, sodass er nun ihren Hinterkopf statt ihre Füße vor sich hatte. Er kniete über ihr, die Knie seitlich an ihre Taille gepresst, und knüpfte eine Schlaufe. Sie wehrte sich noch immer und schob die Hände unter ihren Körper, doch er packte ihren Arm, drehte ihn ihr ohne große Mühe auf den Rücken, fesselte ihre Handgelenke und richtete sich auf. Nachdem der Adrenalinausstoß allmählich verebbte und er hoffen konnte, doch noch zu überleben, griffen die Neurotransmitter nicht mehr so nachhaltig ein, und die Schmerzen in Kopf und Seite verursachten noch größere Übelkeit als zuvor.
Schwer atmend kletterte er über die am Boden liegende Frau hinweg und ging zum Steuer. Er hatte kostbare Zeit mit der unerwünschten Passagierin und ihrem unerwünschten Hund vergeudet. Er schaltete den Autopilot aus und erhöhte die Geschwindigkeit auf fünfzig Knoten.
Das Kratzen der Krallen des kleinen Hundes, der aus seinem Versteck huschte und an ihm vorbeiflitzte, drang an seine gequälten Ohren. Dann senkte sich Stille über den Raum, und Max griff nach einer Kiste Leuchtraketen neben dem Steuer. Im Lauf der nächsten halben Stunde klärte sich sein Blick soweit, dass er die zehn handbetriebenen Leuchtsignale inspizieren konnte. Doch am Ende verwarf er seine Idee, daraus eine Waffe zu seiner Verteidigung herzustellen, da das Magnesium wahrscheinlich nicht zur Fabrikation einer anständigen Brandbombe ausreichte.
Er deponierte die Leuchtraketen auf dem Bug und warf einen Blick auf das Radarsystem. Inzwischen waren die Umrisse von Andros Island und den Berry-Inseln achtern auszumachen. Er richtete das Steuer ein wenig mehr nach Westen aus, in Richtung auf die Küste Floridas. Nachdem er einigermaßen sicher war, nicht auf einer der siebenhundert Inseln der Bahamas aufzulaufen, drosselte er die Geschwindigkeit wieder und schaltete auf Autopilot. Mit zusammengebissenen Zähnen verließ er die Kommandobrücke und warf einen Blick in die dunkle Ecke. Die Frau hatte es geschafft, sich in sitzende Stellung aufzurichten. In der Dunkelheit erahnte er das Weiß ihrer Bluse; vom Fenster her beleuchtete ein Lichtschimmer ihre roten Zehennägel. Der kleine Hund lag zusammengerollt zu ihren Füßen.
Ohne sich noch einmal umzuschauen, verließ Max die Brücke, tastete sich langsam die Treppe hinunter und hielt sich die Seite, um den Stoß abzufangen, den jede einzelne Stufe verursachte. Das Atmen fiel ihm von Minute zu Minute schwerer, und als er schließlich die beleuchtete Kombüse betrat, sah er bereits Sterne. Neben dem Herd fand er einen Erste-Hilfe-Kasten, und im Gefrierfach lagen Eiswürfel.
Im Kühlschrank entdeckte er außerdem Wein, Rum und Tequila und etwa eine Kiste Dos-Equis-Bier. Gewöhnlich gestattete Max sich höchstens ein oder zwei Biere, doch heute brauchte er mehr, etwas Wirkungsvolleres, also griff er nach dem Rum. Er drehte den Schraubverschluss der klaren Flasche auf und trank. Der Druck an der aufgeplatzten Lippe ließ ihn zusammenzucken, aber er nahm dennoch ein paar herzhafte Schlucke. Dann schlug er die Eiswürfel in ein Handtuch ein und klemmte es sich unter den Arm.
Mit dem Erste-Hilfe-Kasten in der Hand durchquerte er den Salon und schaltete das Licht im Bad ein, wo er sein Gesicht im Spiegel über dem Waschbecken vor sich sah. Er konnte sich nicht entscheiden, was schlimmer war: sein Aussehen oder sein körperliches Befinden. Die linke Seite seines Gesichts war angeschwollen und rotblau verfärbt. Seine Wange war mit trockenem Nasenblut verkrustet, und aus seiner aufgeplatzten Unterlippe rann immer noch Blut über sein Kinn. Max nahm einen tiefen Schluck aus der Rumflasche und betrachtete den Riss in seinem Hemd und den kleinen Hundebiss auf seiner Schulter. Er war nicht tief. Nur ein Kratzer und im Vergleich zu seinen anderen Verletzungen kaum der Rede wert. Er konnte nur hoffen, dass der Köter die notwendigen Impfungen bekommen hatte.
Mit einer Hand zog Max sich das Hemd aus dem Bund seiner schwarzen Jeans und hob es hoch. Übel aussehende Striemen liefen im Zickzack über seinen Rumpf, ein Bluterguss in Form eines Stiefelabsatzes zierte seine linke Seite. Aber immerhin lebte er. Zumindest noch.
Er kramte in dem Erste-Hilfe-Kasten, bis er ein Röhrchen Motrin fand. Er zählte sich fünf Tabletten in die Hand und schluckte sie mit Rum, ehe er sich einen elastischen Verband um den Brustkorb wickelte, der zwar nicht besonders half, aber immer noch besser als gar nichts war. Außerdem fand er ein Stück antiseptische Seife. Während er sich das Blut von Gesicht und Hals wusch, ließ er die Geschehnisse dieser Nacht noch einmal Revue passieren und fragte sich, wie seine Mission von Anfang an dermaßen hatte schief gehen können.
Die Informationen, die er bekommen hatte, waren falsch gewesen, seine gesamte Strategie war fehlgeschlagen, und er wollte wissen, weshalb. Laut Bericht hätten sich Cosellas Leute in einem bestimmten Teil der Kirche des riesigen Areals befinden müssen, aber sie hielten sich eindeutig an einem völlig anderen Ort auf. Die DEA-Agenten wurden vorn in dem Gebäude gefangen gehalten, nicht im hinteren Teil, was im Grunde aber nicht so wichtig war. Das Verhalten von Terroristen ließ sich nun einmal selten eindeutig voraussagen, und geheime Informationen konnten sich von einer Sekunde zur anderen ändern. Das wusste Max, damit war er oft genug konfrontiert gewesen.
Doch nie zuvor hatte er sämtliche Fluchtwege so unerwartet und vollständig abgeschnitten gesehen, und es kam ihm in den Sinn, dass womöglich irgendein Eingeweihter hatte verhindern wollen, dass er das Ganze überlebte.
Er wusch sich die Blutspuren ab und klebte Heftpflaster auf die Platzwunde an seiner Stirn. Das eisgefüllte Tuch in der einen, die Flasche Rum in der anderen Hand, ging er zurück in die Kombüse. Beim Sonderkommando gab es nur einen Menschen, dem er wirklich vertraute: Generalstabschef Richard Winter, ein kettenrauchender, pöbelnder Scharfschütze, der in Vietnam und bei der Operation Desert Storm im Golfkrieg gedient hatte und das eine oder andere über das Leben in Schützengräben und den Kampf zu berichten wusste, wenn man mit dem Rücken zur Wand stand.
Der General war ein übler Schinder, aber immer fair. Er kannte sich mit verdeckten Aktionen aus, wusste, was sie den Männern abverlangten und was sie bedeuteten. Aber Max konnte es nicht riskieren, ihn jetzt schon zu kontaktieren. Nicht über eine ungesicherte Leitung. Nicht, wenn der Funkspruch von jedem im Umkreis von dreißig Meilen aufgefangen werden konnte. Nicht, solange er ein so leichtes Ziel bot.
Noch einmal durchkämmte er die Jacht nach einer Waffe. Er durchsuchte die Schränke in der Passagierkabine und die Fächer im Salon und in der Kombüse, fand aber nichts Bedrohlicheres als Cocktailspießchen und eine Garnitur stumpfer Steakmesser. Er kippte den Inhalt des Röhrchens Motrin in seine Tasche und griff nach einer großen Handtasche auf dem Tisch in einer Essecke. Er schüttete den Inhalt aus, suchte nach rezeptpflichtigen Schmerzmitteln wie Codein oder Darvocet, fand aber nichts außer einer Vorratspackung Tylenol. Die Tasche enthielt Kosmetika und Hundekuchen, eine Zahnbürste, eine Haarbürste und ein paar Jetons. Er klappte die Brieftasche auf und sah einen in North Carolina ausgestellten Führerschein. Mit einer Hand drückte er das mit Eis gefüllte Tuch an sein Gesicht, während er sich mit der anderen den Führerschein dichter vor das funktionstüchtige Auge hielt. Im ersten Moment glaubte er, das Gesicht käme ihm bekannt vor, doch erst, als er den Namen las, wusste er, wer sie war.
Lola Carlyle. Lola Carlyle, das berühmte Dessous- und Bikini-Model. Vielleicht sogar das berühmteste überhaupt. Ihr Name beschwor Bilder einer fast nackten Frau herauf, die sich am Strand oder in seidenen Laken rekelte. Lange Beine, große Brüste, heißer Sex. Ihre Fotos in Sports Illustrated waren bei den Jungs in Little Creek immer überaus beliebt gewesen. Max warf die Brieftasche auf den Tisch. Verdammt. Das machte seine Lage noch ein wenig komplizierter. Machte es der Regierung ein klein wenig schwerer, die Sache geheim zu halten. Und falls er wieder gefangen genommen wurde, ehe er die Staaten erreichte, hatte dieses Luxusweibchen dort auf der Kommandobrücke keine Chance. Noch vor wenigen Minuten hätte er geschworen, dass seine Pechsträhne nicht schlimmer werden könnte, aber, verdammte Scheiße, sie war sogar erheblich schlimmer geworden.
Er presste die Lippen zusammen, griff nach dem Rum und dem ins Handtuch gewickelten Eis und ging zurück auf die Kommandobrücke. Vielleicht war die Frau dort oben gar nicht Lola Carlyle. Dass Lola Carlyles Handtasche in der Kombüse stand, musste ja nicht heißen, dass die große blonde Frau, die er gefesselt hatte, tatsächlich Lola Carlyle war. Ja, vielleicht, und vielleicht konnte er sich auch Flügel wachsen lassen und nach Hause fliegen.
Die Stufen auf dem Weg zur Kombüse hinaufzusteigen, war mindestens ebenso schmerzhaft wie der Abstieg. Er blieb zweimal stehen und hielt sich die Seite, um den stechenden Schmerz zu beschwichtigen, bevor er weiterging. In der Vergangenheit hatte Max sich so ziemlich jeden Knochen im Leib gebrochen, aber Rippenbrüche waren mit Abstand die schlimmsten. In erster Linie, weil sogar das Atmen schmerzte.
In der dunklen Kabine konnte er nur ihre weiße Bluse ausmachen. Sie lag noch an derselben Stelle, wo er sie zurückgelassen hatte, und er trat ans Steuer und deponierte die Rumflasche und das Handtuch neben dem Gashebel. »Diese ganze Geschichte ist bald vorbei«, sagte er beschwichtigend. Allerdings hatte er keinen Schimmer, warum er sich diese Mühe machte, nachdem sie ihm eins über den Schädel hatte ziehen wollen. Vielleicht, weil er dasselbe getan hätte, wäre er in ihrer Situation gewesen.
Allerdings hätte er Erfolg damit gehabt, dachte er und drückte sich den Eisbeutel aufs linke Auge.
»Würden Sie mich bitte losbinden? Ich muss zur Toilette.«
Die einzige tödliche Waffe an Bord lag neben seinem Rum auf der Steuerkonsole. »Und braten Sie mir dann wieder eins über?«
»Nein.«
Max betrachtete ihre Silhouette auf der Suche nach irgendwelchen Einzelheiten, die sie vielleicht als die Frau auswiesen, deren Vornamen die ganze Welt kannte. Doch vergeblich. »Das haben Sie beim letzten Mal auch gesagt.«
»Bitte. Ich muss wirklich.«
Max schaute sich um. »Wo ist Ihr Köter?«
»Hier, er schläft. Er wird Sie nicht noch einmal beißen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, und es tut ihm aufrichtig Leid.«
»Aha.« Er nahm das Fischmesser, überquerte das Deck und ging neben ihr in die Knie, wobei er versuchte, den Rücken möglichst gerade zu halten. In der dunklen Ecke tastete er nach ihren Füßen und zog die Messerklinge durch den Baumwollstreifen. »Drehen Sie sich um«, forderte er sie auf, ehe er auch die Handfesseln durchtrennte. Er hielt sich die Seite und erhob sich mühsam. »All das wäre nicht nötig gewesen«, sagte er unter Schmerzen, »wenn Sie einfach getan hätten, was ich Ihnen gesagt habe.«
»Ich weiß. Tut mir Leid.«
Alarmglocken schrillten in seinem dröhnenden Kopf, als er das Messer wieder in die Scheide steckte und sich hinten in den Hosenbund schob. Er traute ihrer plötzlichen Fügsamkeit nicht, aber vielleicht war ihr ja inzwischen klar geworden, dass sie keine Chance gegen ihn hatte und in ihrem eigenen Interesse aufhören sollte, sich zu wehren. Ja, vielleicht. Oder aber er wurde auf seine alten Tage wahrhaftig weich.
Mit dem Hund in den Armen schlüpfte sie an ihm vorbei in Richtung Tür. Oben an der Treppe angelangt, schien der Mond auf ihren Rücken und ihr Hinterteil, während ihm der Duft ihres Haars in die Nase stieg. Er bezog neben dem Kapitänssessel Stellung und griff nach der Rumflasche. Er hob sie an seine Lippen und nahm einen Schluck, während er durch die Windschutzscheibe den Mond der Karibik betrachtete. Vor ihm erstreckten sich die rollenden Wogen und die endlose Leere des Meeres. Neben einer zusammengefalteten Zeitung entdeckte er ein Fernglas. Vorsichtig hob er es an die Augen, sah aber nichts außer den schwarzen Wassern des Meeres. Er entspannte sich ein wenig.
Max hatte schon immer das Schlimmste hingenommen, was das Leben zu bieten gehabt hatte, und er hatte jede Situation gemeistert. Er hatte die sechs Monate SEAL-Training überstanden, die Operation Desert Storm miterlebt, in Afghanistan, im Jemen und vor Südchina Terroristen gejagt, doch diese Nacht war die schlimmste seines Lebens. Und nur wegen José Cosellas Eifer, seinen Vater mit seiner Brutalität zu beeindrucken, und allein wegen einer beschissenen Handfeuerwaffe war Max noch am Leben. Was man von José nicht behaupten konnte. Max erinnerte sich mit erschreckender Klarheit an die jüngsten Ereignisse – an das Klicken des blockierenden Revolvers, daran, dass José die Augen abwandte, um die Waffe zu untersuchen, und daran, wie er, Max, zugeschlagen hatte. Wie der Stuhl unter ihm zerbrochen war, auf dem er mit gefesselten Händen gesessen hatte. Wie er ein Stück von der Holzlehne benutzt hatte, um sein Leben zu retten. Wie er zu den Docks gelaufen war, stets in den Schatten verborgen, und die Gelegenheit beim Schopf ergriffen hatte.
Max stellte die Flasche auf die Zeitung und bemerkte eine weiß aufblitzende Spiegelung in der Windschutzscheibe. »Wenden Sie das Boot«, befahl die Frau in seinem Rücken ein wenig atemlos mit leichtem Südstaatenakzent. Sie schaltete das Licht an, dessen Helligkeit unvermittelt in Max’ Augen stach. »Wenden Sie, oder ich schieße.«
Max blinzelte gegen den Schmerz und das Licht an, das so plötzlich über die Brücke flutete. Langsam drehte er sich um. Er brauchte nicht mehr zu überlegen, ob er tatsächlich mit der Jacht zusammen versehentlich ein weltberühmtes Dessous-Model gekapert hatte.
Lola Carlyle war leibhaftig genauso hinreißend wie auf den Titelseiten von Modezeitschriften. Sie stand unter der Tür, das Haar halb hochgesteckt, während der Rest in wirren Locken auf ihre Schultern fiel, als wäre sie gerade aus dem Bett gekrochen. Ihre tiefbraunen Augen unter den perfekt geschwungenen Brauen starrten ihn an. Sie hatte den Knoten ihres weißen Hemdes unter der Brust gelöst und es bis zum Saum zugeknöpft. Ihre langen, wohl geformten Beine waren der Traum jedes Mannes. Sie hätte auch sein Traum sein können, wäre da nicht die orangerote Leuchtpistole gewesen, die genau auf seine Brust gerichtet war. Miss Carlyle war nicht untätig gewesen.
Nun ja, er hatte sich gefragt, ob diese Nacht noch schlimmer werden könnte, und genau das war eingetreten. Er hätte es wissen müssen. Er hätte ihr folgen müssen, hätte sich aber lieber einem ganzen Dutzend Leuchtpistolen ausgesetzt, als noch einmal diese Treppe hinuntergehen zu müssen. »Was wollen Sie mit dem Ding da?«, fragte er.
»Sie erschießen, wenn Sie nicht wenden. Und zwar sofort.«
»Wirklich?« Er glaubte nicht, dass sie auf ihn schießen würde. Die meisten Menschen hatten nicht das Zeug dazu, jemandem in die Augen zu sehen und ihn dabei umzubringen.
»Das Ding hinterlässt ein Riesenloch. Und eine Riesenschweinerei. «
»Das ist mir egal. Wenden Sie die Jacht.«
Vielleicht hatte sie doch das Zeug dazu. Vielleicht auch nicht, aber um nichts in der Welt würde er zurück nach Nassau fahren.
»Sofort!«
Er schüttelte den Kopf. »Nicht einmal für Sie, Miss Juli.« Sie kniff die Augen zusammen, während er sie weiter provozierte und darauf wartete, dass sie eine falsche Bewegung machte und er zuschlagen konnte. »Wie hieß noch mal diese Zeitschrift, auf deren Titelseite Sie im roten String-Bikini zu bewundern waren? Hustler?«
»Das war Sports Illustrated.«
Er hob die Hand und befühlte seine aufgeplatzte Lippe. »Ah, ja.« Er betrachtete das Blut an seinen Fingerspitzen und sah Lola wieder an. »Jetzt erinnere ich mich.«
Sie runzelte die Stirn.
»In dem Jahr waren Sie der Hit bei den Mannschaftsgraden. Ich glaube sogar, dass Scooter McLafferty Ihnen zu Ehren ein paar Mal vor dem Bild salutiert hat.«
»Entzückend.« Ihre finstere Miene verriet ihm, dass sie weder geschmeichelt noch entzückt war. »Das Boot«, erinnerte sie ihn und winkte mit der Leuchtpistole. »Wenden Sie. Ich spaße nicht.«
»Wie ich schon sagte, das geht nicht.« Er verschränkte die Arme über der Brust, als wäre er völlig entspannt. In Wahrheit hätte er jederzeit das Messer aus der Scheide ziehen und ihr rechtes Auge treffen können, bevor sie auch nur einen Atemzug machte. Na ja, das wollte er nicht tun. Er hatte keine Lust, ein berühmtes Dessous-Model umzulegen. Die Regierung sah es nicht gern, wenn Zivilisten zu Tode kamen, deshalb sollte er sich vielleicht damit begnügen, ihr die Pistole aus der Hand zu treten. Es würde höllisch wehtun, und er freute sich keineswegs darauf. »Wenn Sie dieses Schiff zurück nach Nassau bringen wollen, müssen Sie schon herkommen und es selbst wenden.«
»Wenn Sie irgendwelche Dummheiten versuchen …« Sie machte zögernd zwei Schritte auf ihn zu, und der Hund folgte ihren bloßen Füßen.
»Dann hetzen Sie wieder Ihren mordlustigen Köter auf mich?«
»Nein, dann erschieße ich Sie.«
Max trat sogar beiseite und deutete auf das Steuerrad. »Bei einer Geschwindigkeit um die fünfzehn Knoten neigt es dazu zu vibrieren«, warnte er sie.
Sie blieb stehen und bedeutete ihm mit der Pistole, vom Steuer wegzutreten.
Max sah ihr kopfschüttelnd zu. Er wartete, bis sie einen weiteren zögerlichen Schritt machte, ehe seine Hand nach vorn schoss und ihr Handgelenk umfasste. Sie versuchte sich loszureißen, wobei sich ein Schuss löste und einen flammend roten Feuerball ins Steuerpult jagte. Er schlug in das GPS ein, zerschmetterte die Rumflasche und versprühte Funken in alle Himmelsrichtungen. Der Rum begann zu brennen und lief wie ein flammender Fluss über die Armaturen und in das Loch, das Max beim Aufstemmen der Paneele geschaffen hatte, als er den Motor kurzschließen wollte.
Sowohl Max als auch Lola stürzten aufs Deck, als der Feuerball sich durch das Holzimitat der Paneele brannte und unter die Steuerkonsole schoss, wo er mit einem lauten Knall explodierte. Flammen schossen aus dem Loch. Die roten Leuchtpatronen entzündeten sich eine nach der anderen und verbrannten den Bug wie zehn kleine Schweißgeräte. Kabel knisterten und zischten. Der Motor setzte aus. Das Licht flackerte und ging schließlich ganz aus – wie auf der Titanic kurz vor dem Sinken. Die tanzenden Flammen und das orangerote Glühen des brennenden Bugs bildeten die einzigen Lichtquellen in der pechschwarzen Nacht.
»O Gott«, schrie Miss Carlyle.
Max erhob sich auf die Knie und blickte auf die brennende Zeitung, auf die Flammen, die an der Windschutzscheibe leckten und das Segeltuchverdeck in Brand setzten. Offenbar hatte ihn die Pechsträhne noch nicht verlassen.
2. Kapitel
Lola richtete den Strahl der Taschenlampe auf den Bug – beziehungsweise das, was davon noch übrig war. Das Segeltuchverdeck über der Kommandobrücke war nahezu ganz abgebrannt. Übrig waren nur ein paar Meter verkohltes Segeltuch und die rußgeschwärzten Aluminiumstangen. Eine leichte salzige Brise fuhr in ihr Haar und ließ den Saum ihres Hemdes um ihre Oberschenkel und den Ansatz ihres Hinterteils flattern. Der Seewind spielte mit der weißen Asche auf dem Boden und mit den Resten des Kapitänssessels und des Steuers.
Es konnte nicht wahr sein. Das alles widerfuhr doch nicht ihr. Sie war Lola Carlyle, und dieses Leben war nicht das ihre. Sie war doch auf Erholungsurlaub. Und morgen brach sie ihre Zelte ab und reiste nach Hause. Sie musste nach Hause.
Das Ganze war völlig verrückt, es konnte nur ein böser Traum sein. Ja, so war es wohl. Sie hatte eine letzte Nasch- und Cocktail-Tour durch Nassau unternommen und war in der Passagierkabine der Jacht eingeschlafen, und jetzt war sie mitten in einem Albtraum und sah sich Auge in Auge mit einem wild gewordenen Verrückten. Jeden Moment würde sie aufwachen und Gott danken, weil alles ja nur ein Traum war. In der Dunkelheit flog der leere Feuerlöscher durch die Luft, schlug auf dem Bug auf und sprang einmal hoch, ehe er endgültig in dem ausgebrannten Loch stecken blieb.
»Was kommt als Nächstes? Haben Sie Napalm in Ihrer Unterwäsche? «, fragte der leider allzu wirkliche Wahnsinnige hinter ihr, und die Wut in seiner Stimme durchschnitt die Nachtluft zwischen ihnen.
Lola warf einen Blick über die Schulter auf sein vom Mond beschienenes, übel zugerichtetes Gesicht. Sie hatte damit gerechnet, umgebracht und den Fischen zum Fraß vorgeworfen zu werden. Als er sie fesselte, hatte sie die schrecklichste Angst ihres Lebens ausgestanden. Wie ein Alb hatte die Furcht auf ihrer Brust gehockt und ihr die Luft aus den Lungen gepresst. Sie war überzeugt gewesen, dass er sie misshandeln und umbringen würde. Doch nun war sie wie betäubt und empfand gar nichts mehr.
»Wenn ich Napalm hätte, wären Sie jetzt Grillfleisch«, platzte sie automatisch heraus, ehe sich ihr Selbsterhaltungstrieb meldete und sie ein paar Schritte zurückwich.
»Oh, daran zweifele ich keine Sekunde, meine Süße.« Er kam auf sie zu und griff hinter sich. »Hier.« Er zog ein Messer in einer hellbraunen Lederscheide und packte Lolas freie Hand. Sie zuckte zusammen, als er ihr die Waffe in die Hand legte. »Wenn Sie mich von meinem Elend erlösen wollen«, sagte er, »dann nehmen Sie das. Das geht schneller und ist nicht so schmerzhaft.« Langsam bewegte er sich in Richtung der Stelle, wo sich noch vor wenigen Minuten die Tür befunden hatte, von der inzwischen nur noch ein Metallrahmen und ein paar Fetzen verkohlten Segeltuchs übrig waren, die im Wind flatterten. Lola hörte, wie er scharf den Atem einsog, bevor er weiter die Treppe hinunterstieg.
Beim ersten Anzeichen von Feuer hatte Baby sich in Sicherheit gebracht. Auch Lola hatte eilig Deckung gesucht und war über den Boden und die Treppe hinuntergekrochen. Sie hatte auf dem Achterdeck gestanden, während dieser Wahnsinnige namens Max gegen die Flammen gekämpft hatte. Fassungslos hatte sie zugesehen, wie der Wind brennende Segeltuchfetzen mit sich davontrug.
Das Geräusch der zuschlagenden Kombüsentür hallte durch die Nacht. Dann herrschte wieder absolute Stille, die lediglich vom leisen Plätschern der Wellen am Bootsrumpf unterbrochen wurde. Lola sah sich um und blickte hinaus in die Dunkelheit, ins Nichts. Auf einmal fühlte sie sich wie eine der Überlebenden eines Hurrikans, die sie schon so oft in den Nachrichten gesehen hatte. Mit wirrem Haar, leerem Blick und wie betäubt. Ihr Verstand konnte kaum fassen, dass diese Situation real war, dass sie auf einem manövrierunfähigen Boot stand, irgendwo auf dem Atlantik, nur mit Unterwäsche und einem weißen Hemd bekleidet, während ein eindeutig geistesgestörter Mann auf dem Deck unter ihr schlief.
Lola wandte sich zur Tür und stieg die Treppe hinunter. Die ganze Nacht erschien ihr surreal, als wäre sie in ein Gemälde von Salvador Dalí geraten. So zerflossen und verbogen, dass sie sich nur umschauen und denken konnte: Was ist denn hier los? Sie richtete die Lampe auf das Achterdeck, und ihre Schritte verlangsamten sich, als sie sich der Kombüse näherte.
»Baby«, flüsterte sie. Sie fand ihn auf der Sitzbank hinter dem Tisch, wo er wach und verängstigt zusammengerollt auf dem weichen Wollschal kauerte, den sie früher am Tag abgelegt hatte. Stück für Stück, als hätte sie Angst, der schwarze Mann könnte sie plötzlich aus einer Ecke heraus anspringen, leuchtete sie mit der kleinen Taschenlampe die Kombüse und den Salon ab. Durch die Tür zur Passagierkabine kroch der Lichtstrahl über den dicken blauen Teppich bis zum Rand der gestreiften Bettdecke. Sie ließ das Licht an der Decke emporwandern und hielt inne, als es auf ein Paar schwarze Stiefel fiel. Erschrocken knipste sie die Taschenlampe aus, während sich die Angst, die sie schon die ganze Zeit über gequält hatte, wieder in ihr ausbreitete.
»Baby«, flüsterte sie noch einmal, beugte sich vor und tastete die Sitzbank ab. Sie nahm das Messer in die Hand, mit der sie bereits die Taschenlampe hielt. Unter den Fingern spürte sie das feine Wolltuch und hob es zusammen mit ihrem Hund hoch. So leise wie möglich durchquerte sie die stockdunkle Kombüse und stand schließlich wieder auf dem Achterdeck. Sie ging zu der Stelle, wo sie Stunden früher gesessen, Wein mit den übrigen Passagieren der Jacht getrunken und den Piratengeschichten des Besitzers gelauscht hatte. Als sie sich setzte, spürte sie das kalte Vinyl der umlaufenden Sitzbank an den Rückseiten ihrer Oberschenkel. Sie zog die Füße unter sich.
Baby leckte ihre Wangen, als sie gegen die Tränen kämpfte. Lola hasste es, wenn sie weinte. Sie hasste es, Angst zu haben und sich hilflos zu fühlen, und trotzdem liefen ihr die Tränen aus den Augen, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte.
Baby hatte keine Angst gehabt. Er war tapfer und angriffslustig gewesen, aber zum ersten Mal, seit sie ihn vor einem Jahr beim Züchter abgeholt hatte, wünschte sie, er wäre ein Rottweiler. Ein großer, mordlustiger Rottweiler, der einem Mann einen Arm abreißen konnte. Oder die Eier.
Lola wischte sich die Tränen ab und dachte an die Schachtel Leuchtraketen, die sie in der Passagierkabine gefunden hatte. Sie nützten ihr jetzt nichts mehr. Die Pistole war im Feuer geschmolzen. Aber selbst wenn die Pistole nicht geschmolzen wäre, hätte sie nicht den Mut aufgebracht, die Kabine aufzusuchen und die Raketen zu holen. Nicht, solange dieser Mad Max unmittelbar neben der Schachtel lag.
Dieser Typ hatte behauptet, er sei Korvettenkapitän, aber sie glaubte ihm nicht. Vielleicht hatte er das nur erfunden. Viel wahrscheinlicher war, dass er einer dieser modernen Piraten war, von denen Mel Thatch, der Besitzer der Jacht, ihnen erzählt hatte.
Lola schlug das Wolltuch auseinander und hüllte sich und den Hund darin ein. Sie blickte hinauf zu den verkohlten Überresten der Kommandobrücke und zu den Sternen am Himmel, die an manchen Stellen so dicht standen, dass sie ineinander zu fließen schienen.
Ihre Hand umklammerte das Messer, das er ihr gegeben hatte, noch ein wenig fester. In ihren Augen war es ziemlich dumm für einen Verbrecher, aber offenbar betrachtete er sie nicht als Bedrohung. Er glaubte nicht, dass sie das Messer gegen ihn erheben würde, womit er wahrscheinlich sogar noch Recht hatte. Mit einer Leuchtpistole auf einen Menschen zu schießen oder sich in der Hitze des Gefechts zu wehren, war eine Sache; sich an sein Bett zu schleichen und ihm im Schlaf die Kehle durchzuschneiden, eine ganz andere.
Vermutlich hatte er ihr das Messer eher gegeben, weil er wusste, dass er sie jederzeit überwältigen konnte, was er ja bereits mehrfach unter Beweis gestellt hatte. Noch immer spürte sie beinahe seinen Klammergriff an ihren Handgelenken und die stählernen Muskeln seines Körpers an ihrem Rücken. Der Mann bestand nur aus harten Muskeln und brutaler Kraft, und sie war ihm beim besten Willen nicht gewachsen.
Nachdem er sie zum ersten Mal losgelassen hatte, war sie ins Dunkel zurückgewichen, in der Erwartung, dass er ihr folgte. Um sie in den Albtraum einer jeden Frau zu stürzen. Um sie zu packen, ihr die Kleider vom Leib zu reißen, sie zu Boden zu stoßen und zu vergewaltigen. Dass sie sich wehren würde, hatte von Anfang an festgestanden. Sie würde kämpfen und Baby beschützen, keine Frage.
Durch Passivität war sie jedenfalls nicht dahin gekommen, wo sie heute im Leben stand. Sie hatte ein Geschäft, das sich von den Körpern junger, blauäugiger Mädchen ernährte, nicht dadurch überlebt, dass sie sich Männern unterwarf. Und sie war nicht aus diesem Geschäft ausgestiegen und hatte ihren eigenen Dessous-Versand aufgebaut, indem sie Däumchen drehte. Ihr Leben lang hatte sie gegen den einen oder anderen Dämonen gekämpft, doch als Max sie zu Boden gedrückt und sie mit ihrem eigenen Rock gefesselt hatte, war sie überzeugt gewesen, dass sie dieses Mal nicht mit dem Leben davonkommen würde. Sie war davon überzeugt gewesen, dass er sie vergewaltigen und töten und Baby, wie angedroht, über Bord werfen würde. Aber er hatte es nicht getan. Sie lebte noch immer, nachdem sie schon geglaubt hatte, dem Tod ins Auge zu sehen. Ein Schluchzen entrang sich ihrer Kehle, und sie presste ihre zitternden Finger auf den Mund.
Ihr Blick wanderte vom Sternenhimmel zur niedergebrannten Kommandobrücke. Als Max sie zum ersten Mal gepackt hatte, war ihr bewusst geworden, dass sie eine Waffe brauchte, wenn sie diese Nacht überleben wollte. Vorzugsweise eine .357er Magnum, wie ihr Großvater Milton eine besessen hatte. Doch sie hatte sich mit der Leuchtpistole begnügen müssen, und jetzt, da alles vorbei war, fragte sie sich, ob sie wirklich auf ihn geschossen hätte, wie Nicole Kidman auf Billy Zane in Dead Calm.
Nachdem das Schlimmste vorüber war, zitterten ihr die Hände, und wirre Bilder stürzten auf sie ein. Wie Baby und sie an Bord der Jacht gegangen waren und wie sie vielleicht ein paar Cocktails zu viel getrunken und nicht genug gegessen hatte. Wie sie sich hingelegt hatte und dann leider desorientiert aufgewacht war und einen Verrückten an der Steuerkonsole vorgefunden hatte. Wie er da an den Instrumenten gestanden und Baby zu seinen Füßen wütend gebellt hatte. Wie er sie mit ihrem eigenen Rock fesselte. Wie sie die Leuchtpistole fand. Der Schock, als sie sein zerschlagenes Gesicht sah.
Lola streckte sich auf der Seite auf der Bank aus und drückte Baby an die Brust. Ihr Weinglas stand noch an derselben Stelle, wo sie es abgestellt hatte, bevor sie die Passagierkajüte aufsuchte, um sich ein wenig auszuruhen. Sie hätte gern gewusst, ob die Thatchs das Fehlen ihrer Jacht schon bemerkt hatten, glaubte es jedoch nicht, denn es war höchstens ein Uhr früh, obwohl sie das Gefühl hatte, dass dieser Albtraum schon eine Ewigkeit andauerte. Frühestens in einer Stunde würden die Thatchs überhaupt erst wieder in den Hafen kommen. Wie lange mochte es wohl dauern, bis festgestellt wurde, dass auch sie, Lola, verschwunden war? Bis man anfing, nach ihr zu suchen? Bis ihre Familie erfuhr, dass sie vermisst wurde?