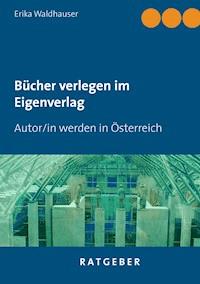Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Erzählung in kurzen Geschichten über Kindheitserinnerungen aus den 50-er Jahren, über die einfachen Verhältnisse am nördlichen Stadtrand von Graz, umgeben von Wiesen und Wäldern. Naturgemäß gab es in dieser Nachkriegszeit nur das Notwendigste zum Leben. Es gab kein fließendes Wasser, keinerlei elektrische Geräte, kein Telefon, kein Auto - nichts von alledem, was unser Leben heute so bequem macht. Außerdem wird die Diskrepanz von vor gerade mal fünfzig Jahren gegenüber dem Heute aufgezeigt und das Gefühl vermittelt, dass die Kindheit trotzdem oder gerade deswegen erfüllt und glücklich war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch:
„... und dazwischen eine Masche“ ist die Erzählung von Kindheitserinnerungen aus den 50-er Jahren in Graz.
Erika Waldhauser, geb. 1948, ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Bis zu ihrer Pensionierung war sie als selbstständige Buchhalterin tätig. Danach konnte sie endlich ihren lang gehegten Wunsch, als Schriftstellerin tätig zu sein, verwirklichen.
Ein Liebesroman, welchen sie als Ghost Writerin schrieb, wurde von einem Verlag angenommen.
Sie verbrachte ihre Kindheit in einfachen Verhältnissen am nördlichen Stadtrand von Graz, umgeben von Wiesen und Wäldern. Naturgemäß gab es in dieser Nachkriegszeit nur das Notwendigste zum Leben.
Es gab kein fließendes Wasser, keinerlei elektrische Geräte, kein Telefon, kein Auto – nichts von Alledem, was unser Leben heute so bequem macht.
Die Autorin erzählt das damalige Leben in kurzen Geschichten, zeigt die Diskrepanz von vor gerade mal fünfzig Jahren gegenüber dem Heute auf und vermittelt das Gefühl, dass sie trotzdem oder gerade deswegen eine erfüllte und glückliche Kindheit verlebte.
Die „vier“ Nachbarkinder vor dem Grazer Uhrturm
Ich danke meinen Fördergebern für die Unterstützung meines Buchprojektes:
Stadt Graz - Kulturamt
Gemeinde Vasoldsberg
Dieses Buch widme ich in Liebe meiner Familie, vor allem aber meinen drei Kindern, die die mir wichtigen Werte meines Lebens übernommen und diese auch ihren Kindern, so weit das in der heutigen schnelllebigen Zeit möglich ist, weitergegeben haben.
INHALT
Vorwort
Einführung
Erste Lebensjahre
Mein Elternhaus
Gemüsegarten
Obst, Beeren und sonstige Früchte
Süßmost
Äcker
Heu
Hausbrunnen
Quelle
Wäsche waschen
Kochen und Heizen
Baden und Waschen
Plumpsklo
Einkaufen
Kleidung
Strom
Telefon - Post – Werbung
Tramway und O-Bus
Besen binden und Körbe flechten
Topfflicker - Scherenschleifer – Bauchladen
Abfall
Transportmittel und Fahrzeuge
Spielzeug
Wiese und Wald
Aussicht
Schwimmbad
Ostern
Nikolaus
Weihnachten
Haustiere
Meine Tiere
Spaziergänge und Ausflüge
Schule
Murfähre
Kugelblitz
Zeppelin
Schlusswort
VORWORT
Anlässlich eines Besuches bei meinem Neffen, der gerade eine kleine Tochter bekommen hatte, führten unsere Gespräche mit meinem Bruder und meiner Schwägerin in die vergangene Zeit unserer Kindheit. Wir mussten feststellen, dass mein Neffe und seine Frau über unsere Erlebnisse und vor allem unsere Art zu leben völlig erstaunt waren und sich nicht vorstellen konnten, dass wir, die Elterngeneration, so lebten. Sie hätten das eher der Zeit ihrer Urgroßeltern zuordnen können – oder jedenfalls viel, viel weiter zurück.
Dies inspirierte und veranlasste mich, meine Erinnerungen an meine Kindheit aufzuschreiben und in Buchform zu bringen.
Vor allem aber will ich den Leserinnen und Lesern nahe bringen, dass vor fünfzig bis sechzig Jahren alles anders war als heute. Die technischen Errungenschaften, die uns jetzt das Leben leichter und nicht selten auch schwerer machen, gab es am Markt nicht.
Man konnte mit wenig finanziellen Mitteln trotzdem ein erfülltes Leben ohne echte Entbehrungen führen - die bescheidenen Wünsche waren auf das Lebensnotwendige beschränkt. Vor allem wir Kinder hatten viel Spaß und Freude, ohne das erdrückende Gefühl der Langeweile zu kennen - ohne Fernseher, ohne Computerspiele, ohne Handy …
… nicht in einer ländlichen Dorfgemeinschaft, sondern am Stadtrand der zweitgrößten Stadt Österreichs.
EINFÜHRUNG
Ich wurde geboren im August 1948 in Graz als Nachkriegskind und Tochter einer gerade mal sechzehnjährigen Mutter. Mein Vater war vierunddreißig und kam drei Jahre zuvor vom Krieg heim.
Hochzeitsbild meiner Eltern im April 1948 – kurz nach dem 16. Geburtstag meiner Mutter. Im August 1948 kam ich zur Welt.
Meinen Namen - Erika - verdanke ich dem Heidekraut gleichen Namens, das zum Zeitpunkt meiner Geburt gerade blühte.
Wir hatten das Glück, dass die ganze Familie aus den Kriegswirren unversehrt hervor ging und auch das Anwesen mit Haus keinen Schaden davon trug – und - wir waren in der Lage, in dieser Nachkriegszeit großteils für unsere Lebensmittel selbst sorgen zu können.
Mein Vater war unverletzt geblieben und hatte sofort Arbeit gefunden. Als Familie lebten wir bescheiden und meine Eltern mussten hart arbeiten. Wir Kinder aber vermissten nichts. Für unsere Bedürfnisse war gesorgt und unsere Wünsche – so wir überhaupt welche hatten – wurden weitestgehend erfüllt.
ERSTE LEBENSJAHRE
An die Zeit als Kleinkind habe ich selbst naturgemäß nicht viele Erinnerungen. Es gibt nur wenige Fotos. Mein Vater ist praktisch nie auf den Fotos zu sehen – er stand immer hinter dem Fotoapparat. Der älteste Fotoapparat, an den ich mich erinnern kann, war ein relativ großes viereckiges Blechkastel mit etwa zehn Zentimeter Kantenlänge, bezogen mit einem lederähnlichen Material. An der oberen Fläche befand sich ein Haltegriff, eine seitliche Fläche konnte man öffnen und so den Film wechseln. Die Linse war nicht verstellbar und man sah das zu fotografierende Motiv verkehrt rum – also auf dem Kopf stehend.
Eines der Fotos zeigt mich in einer Tisch-Bank-Kombination, welche von meinem Vater gebaut wurde. Ich dürfte etwa zwei Jahre alt sein.
Da meine Haare zu diesem Zeitpunkt schon lange genug waren, zierte meinen Kopf erstmals eine große Haarmasche. Diese Haarmaschen aus verschiedenen Bändern in verschiedenen Breiten, Farben und Mustern waren eine Vorliebe meiner Mutter. Die Maschen wurden immer wieder gewaschen und sorgfältig gebügelt. Die Befestigung auf meinen Haaren erfolgte mittels einer einfachen Haarspange. Vorher wurde mein Haar oben auf dem Kopf zu einer Rolle geformt und fixiert und darauf kam die Masche. Diese Masche verfolgte mich von meinen erst Lebensjahren an bis in die dritte Klasse der Volksschule. Ich lehnte sie mehr und mehr ab, je älter ich wurde - aber die Masche musste sein.
Mein Vater war bei den Grazer Verkehrsbetrieben beschäftigt und verdiente das einzige Familieneinkommen. Meine Mutter kümmerte sich vor allem um mich, hatte den Haushalt und den Gemüsegarten zu versorgen und verschiedene Arbeiten am Grund zu erledigen.
Da es keinerlei Geräte gab, die mit Strom betrieben wurden, war praktisch alle Hausarbeit händisch zu verrichten. Meine junge Mutter kam mit ihren Aufgaben offensichtlich gut zurecht und meisterte den Haushalt und meine Betreuung wunderbar.
Nach Erzählungen wurde ich nach dem Abstillen mit Grießbrei, welcher in mit Wasser verdünnter Milch eingekocht wurde, ernährt. Die Milch wurde von einem nahen Bauernhof frisch geholt.
Natürlich gab es damals in der Nachkriegszeit keine Babyfertignahrung, auch keinen aufbereiteten Babygrieß, sondern einfach ganz normalen Weizengrieß, aus welchem man heute zum Beispiel Grießnockerln zubereiten würde. Gott sei Dank hatte ich keine Verdauungsprobleme und wurde auch nicht besonders dick davon.
Ich mit „Käfi“ an meinem eigenen Tisch mit Bank.
Sobald ich andere Nahrung vertrug, gab es Spinat, gekochte Möhren und Erdäpfelpürre (Kartoffelbrei) – alles aus dem eigenen Anbau. Bananen hätten als exotische Frucht gekauft werden müssen und waren damals in meinem Menüplan nicht enthalten. Ich weiß gar nicht, ob es damals überhaupt Bananen zu kaufen gegeben hätte. Bei unserem Greislerladen, in dem wir immer einkauften, jedenfalls sicher nicht.
Im Sommer saß meine Mutter mit mir öfters auf einer Decke auf der Wiese im Schatten eines Baumes. Dann flocht sie mir einen Kranz aus Gänseblümchen oder Löwenzahnblumen, welchen sie mir auf das Haar setzte. Ich kam mir vor wie eine Prinzessin. Leider war der Blumenkranz abends schon wieder welk und mein Prinzessinendasein somit beendet.
Wenn meine Eltern Kirschen pflückten, wurde immer eine lange hölzerne Leiter von meinem Vater an den Kirschbaum gelehnt. Er balancierte diese lange Leiter stehend, bis er die passende Stelle fand, an welcher er sie in der Baumkrone anlehnen konnte.
Mir wurde von meinen Eltern erzählt, dass ich mit zwei Jahren plötzlich in ein paar Metern Höhe auf dieser Leiter stand. Nach dem ersten Schrecken kletterte mein Vater hinter mir hinauf und stieg mit mir Sprosse für Sprosse, mich haltend, vorsichtig wieder herunter. Mir ist nicht bekannt, ob ich dafür bestraft wurde. Jedenfalls probierte ich nach Aussagen meiner Eltern lange nicht mehr eine Leiter zu besteigen, erst wieder als ich alt genug dafür war und so quasi die stillschweigende Erlaubnis meiner Eltern hatte. Höhenangst befiel mich nie - bis heute nicht.
Eines Tages erklärten mir meine Eltern, ich war dreieinhalb Jahre alt und an das kann ich mich wirklich noch genau erinnern, dass meine Mutter vom Storch in das Bein gezwickt worden ist und dass ich deshalb ein Geschwisterchen bekommen würde. Ich hatte dazu keine weiteren Fragen, ein dicker Bauch meiner Mutter fiel mir offensichtlich auch nicht auf. Jedenfalls musste meine Mutter eines Tages ins Spital. Warum meine Mutter ins Spital musste, wusste ich nicht. Es interessierte mich auch nicht, wahrscheinlich wurde sie vom Storch so stark gezwickt …
Nachdem mein Bruder geboren war, besuchten mein Vater und meine Oma mit mir meine Mutter im Spital. Dort konnten wir meinen Bruder hinter einer Glasscheibe besichtigen. Dass ich jetzt einen Bruder hatte, realisierte ich zu diesem Zeitpunkt sicher noch nicht, erst als meine Mutter mit meinem Bruder daheim angekommen war.
Der Schlafkinderwagen für meinen Bruder hatte relativ kleine Räder, sodass der tiefe Wagen sehr knapp über der Straße lag, und ein rückfaltbares Dach. Ich konnte als Dreijährige jedenfalls problemlos in den Kinderwagen hinein schauen und greifen, so niedrig war er.
Meine Mutter mit mir auf der Wiese im Frühjahr 1949.
Später gab es einen Sitzwagen, auch dieser hatte kleine Räder und lag sehr tief. Die Sitzlehne war zu verschiedenen Schrägen verstellbar, sodass ein Kind, wenn es müde war, darin auch schlafen konnte. Vermutlich lag auch ich schon in diesen Kinderwägen oder zumindest in solchen ähnlicher Bauart.
Für mich stellte sich bald heraus, dass meine Mutter mehr Zeit für meinen kleinen Bruder aufwendete als für mich, wodurch ich ins Abseits rückte – zumindest in meiner Wahrnehmung - auf einmal war ich die Große. Nur für meine Oma blieb ich die Kleine und sie schaffte so für mich einen emotionalen Ausgleich.
Wir waren zwar keine klassische Großfamilie - Oma führte mit meinem Onkel einen eigenen Haushalt - aber wir wohnten im gleichen Haus. Dadurch gab es viel Nähe und meine Oma und mich verband eine ganz besondere Liebe. Sie war schon viele Jahre lang Witwe, bereits dreiundsechzig Jahre alt als ich geboren wurde und hatte mit ihrem ersten Enkelkind, also mit mir, große Freude.
Wann immer sie konnte, verhätschelte sie mich, steckte mir Süßigkeiten zu, später natürlich auch meinem Bruder – sehr zum Missfallen meiner Mutter. Aus diesem Grunde gab es öfters Zwistigkeiten zwischen meiner Mutter und meiner Oma, ihrer Schwiegermutter.
Sitzkinderwagen „Bauart etwa 1950“ mit meinem Bruder auf einem Bauernhof
Oma hatte als Leckerbissen vieles zu bieten. Da gab es immer frische Semmeln, die mein Onkel täglich einkaufte, und dazu ein Enzian-Eckerlkäse. Ich weiß nicht, warum das so etwas Besonderes war, aber mir schmeckte es wunderbar. Wahrscheinlich deshalb, weil es bei uns fast nie Semmeln gab, immer nur Brot.
Auch die Eisschokolade in Form eines vielleicht hundert Gramm schweren Schokoriegels in Zellophan eingewickelt, die mein Onkel immer vorrätig hatte, da er sie selbst so gerne aß, war köstlich. Wenn man sie langsam lutschte, schmeckte sie kühl, fast wirklich so wie Eis. Ich kann mich noch an eine Ein-Schilling-Schokolade erinnern. Diese Schokolade dürfte etwa zwanzig bis dreißig Gramm gewogen haben. Ebenso sind mir noch die Stollwerks in Erinnerung. Das waren viereckige Zuckerl, einzeln in Papier eingewickelt und kosteten zehn Groschen pro Stück. Manche waren zäh wie Kaugummi und schmeckten nach irgend einer Frucht und manche waren weich, fast bröselig und hatten einen Karamelgeschmack.
Im Sommer, wenn ich zur Schule ging, gab es hie und da fünfzig Groschen für ein Eis mit einer Kugel in einer Tüte. Das durfte meine Mutter natürlich auch nicht wissen und Oma steckte mir das Geld immer um die Ecke von ihrem Verandafenster aus zu.
Das waren die kleinen Geheimnisse zwischen meiner Oma und mir beziehungsweise uns Kindern.
Meine Mutter und meine Oma mit mir auf dem Arm im Sommer 1949.
MEIN ELTERNHAUS
Elternhaus - fotografiert 1940
Wir wohnten am nördlichen Stadtrand von Graz auf etwa fünfhundert Metern Seehöhe in einem Haus, das meinem Vater und meinem Onkel je zur Hälfte gehörte. Um das Haus herum war ein ein Hektar großes Grundstück, großteils östliche Hanglage, mit einem kleinen Anteil Wald, welcher im Wesentlichen aus zwei großen Buchen und einigem Strauchwerk bestand.
Wir hatten eine herrliche Aussicht Richtung Süden mit dem Schlossberg und dem Stadtpark vor uns. Das Läuten der „Liesl“ vom Glockenturm des Schlossberges jeweils um sieben Uhr früh, mittags um zwölf und abends um sieben Uhr gehörte zu meiner Kindheit.
Das Haus selbst war ein Langhaus. Alle Räume in diesem Haus reihten sich nacheinander an und so sie nicht einen Zugang von außen hatten, waren sie Durchgangszimmer. Ursprünglich bestand das Haus aus einem unterkellerten Wohntrakt und einem angebauten Stallgebäude, worüber sich ein Heuboden und ein Dachboden befanden.
Das ebenerdige nicht unterkellerte Stallgebäude wurde von meinem Vater für unsere Familie ausgebaut – so hatten wir letztendlich alle Platz.
Der Dachboden hatte es uns Kindern besonders angetan. Manchmal schlichen wir einfach trotz Verbot hinauf. Dort gab es alte Schränke, Tische, Sesseln, Bilder, Kleider, Werkzeug … Wir bekamen nicht genug davon, in diesen alten Sachen herum zu stöbern. Es war alles fürchterlich verstaubt, aber das störte uns nicht – nur unsere Mutter war nicht begeistert, sie musste die Kleider wieder waschen - und das Verbot wurde erneuert - bis zum nächsten Mal.
Sämtliche Zimmer hatten Fenster in den Hof hinaus. An der anderen Seite führte die Straße vorbei, dort waren an der Fassade nur Scheinbalken - vielleicht waren früher ja mal auch dort Fenster gewesen. Lediglich die Küche meiner Oma und unsere Küche hatten echte Fenster zur Straße hinaus. Da in dieser Zeit praktisch so gut wie keine Autos auf der Straße fuhren, war das weiter keine Lärmbelästigung.
Das Elternschlafzimmer hatte als Erinnerung an das vormalige Stallgebäude eine Gewölbedecke. Heute hätte ein Fan rustikaler Bauweise seine Freude daran.
Die Einrichtung des Schlafzimmers meiner Eltern bestand, wie in den Sechzigerjahren üblich, aus braun lasierten Möbeln und in den Betten waren dreiteilige Federkernmatratzen. Einteilige Matratzen gab es damals offensichtlich keine. Auch die Psyche mit einem großen Spiegel in der Mitte durfte nicht fehlen. Eine Pendeluhr in einem Uhrkasten mit Glastüre ergänzte noch die Einrichtung. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass mein Vater den Uhrkasten einmal neu strich, sodass er in der Farbe besser zu den übrigen Möbeln passte. Kurz bevor der Lack völlig trocken war, wurde er mit einem Pinsel verwischt – so entstand eine lasurartige Oberfläche. Diese Pendeluhr wurde mit Gewichten aufgezogen. Dazu musste man auf einer Seite das Gewicht, das sich oben befand, herunterziehen. Während die Uhr ablief, ging das herunter gezogene Gewicht wieder hoch und das andere lief langsam herunter. Ich weiß noch, wie ich mich dafür interessierte, wie das funktioniert und mein Vater mir das geduldig erklärte. Die Gewichte jedenfalls hatten die Form von Tannenzapfen aus Messing – sehr originell.
In der hölzernen Truheneckbank, die in der angrenzenden Wohnküche stand, wurde alles Mögliche aufbewahrt: Papiersäcke vom Einkaufen, Zeitschriften und auch die alten Zeitungen, welche man einerseits zum Anheizen benötigte und andererseits zerschnitten als Klopapier verwendete.
Meine Mutter bewahrte dort auch immer die Lesezirkel-Mappe auf. Das war ein Pappkarton-Umschlag mit etwa acht Illustrierten drin, die man sich wöchentlich zum Lesen ausborgen konnte. Je nach Aktualität waren diese Mappen teurer oder billiger. Meine Mutter nahm immer die bereits mehrere Wochen alte Mappe, die war am günstigsten. Hier ging es ja nicht um aktuelle Nachrichten, die entnahm man ohnedies einer Tageszeitung – bei uns war das die großformatige „Tagespost“. Für „Klatsch und Tratsch“ sowie für Fortsetzungsromane und Ähnliches reichten die älteren Lesezirkel völlig.
Vor der Eckbank stand der Esstisch mit Bestecklade und auf der gegenüberliegenden Seite zwei Holzsessel. Unsere Familie hatte also letztlich zu viert bequem Platz. Um die hölzerne Tischplatte besser sauber halten zu können, war immer ein irgendwie gemustertes Tischtuch aus Wachsleinwand darüber.
In der weiß lackierten Kredenz wurde all unser Geschirr aufbewahrt. Teller und Tassen waren aus pastellfärbigem Porzellan, Töpfe aus braunem emailliertem Blech. Eine Kredenz bestand aus einem Unterkasten mit zwei Türl‘n, dahinter einem Fachbrett und darüber zwei Laden. Auf diesem Unterkasten stand ein Oberteil mit zwei Glastürl‘n so erhöht montiert, dass dazwischen die Deckfläche des Unterkastens als Arbeits- oder Abstellfläche dienen konnte. Die Scheiben der oberen Kredenztürl’n hatten Blumenmuster. Ich habe keine Ahnung ob diese Muster im Glas geschliffen oder geätzt waren, es sah jedenfalls sehr hübsch aus. Die Türen hatten zum Öffnen entweder Knöpfe aus Keramik oder Griffe aus geschmiedetem Eisen. Den Mittelpunkt der Wohnküche bildete der große Tischherd, auf welchem meine Mutter viele Jahre lang kochte und backte.
Ein weiteres besonderes Möbelstück, das in dieser Zeit sicher einzigartig war, war ein Abwaschkastel. Das war ein Schrank mit einer tiefen Lade und zwei runden Ausnehmungen, in welche man zwei Schüsseln aus emailliertem Blech einhängen konnte. Die obere Abdeckung konnte man hochklappen und darunter, über den Schüsseln, war eine verzinkte Blechabtropfwanne. Dort wurde das Geschirr nach dem Waschen aufgetürmt. Diese Geschirrtürme liebte ich nicht besonders, denn ich bekam dann, als ich schon größer war, im Normalfall ein Geschirrtuch in die Hand gedrückt und musste das Geschirr abtrocknen und wegräumen.
In der angebauten Speis (kleiner kühler Raum zum Aufbewahren von Lebensmitteln) wurden in einem offenen Regal alle Lebensmittel, die nicht im Keller gelagert waren, aufbewahrt. Als Kühlschrankersatz war das keine schlechte Lösung, zumal zwei Luftlöcher oben und unten für Frischluft sorgten. Da dies nordseitig war, war es immer kühl, auch im Sommer.