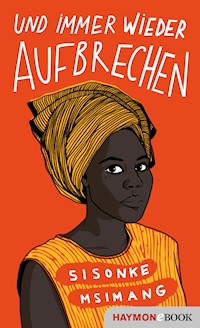
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
IMMER EIN NEUES LAND: SISONKE MSIMANG KÄMPFT FÜR GLEICHBERECHTIGUNG, UNABHÄNGIGKEIT UND IHR RECHT AUF EINEN PLATZ IN DER WELT. SISONKE MSIMANG IST EIN KIND DER FREIHEIT Sisonke Msimang und ihre Geschwister werden in eine REVOLUTIONÄRE GEMEINSCHAFT geboren, die gegen die APARTHEID und für ein UNABHÄNGIGES SÜDAFRIKA kämpft. "Heimat" ist lange Zeit der Traum von Freiheit und kein bestimmter Ort: Sie wird im EXIL geboren, wächst in SWASILAND, SAMBIA, NAIROBI und KANADA auf, studiert in den USA. Als sie Südafrika zum ersten Mal betritt, ist sie schon über 20 Jahre alt. Wie steht es dort heute um FREIHEIT und GLEICHBERECHTIGUNG? WAS IST AUS DEM TRAUM GEWORDEN, der Sisonke Msimang und ihre Mitkämpfer*innen in den Jahren des Exils immer weitermachen ließ? Und die Autorin selbst? Als Kind ist sie umgeben von Frauen, die sich keinen Deut um die Regeln scheren, die man sich für sie ausgedacht hat. Sie inspirieren und bestärken Sisonke Msimang darin, DIE FRAU ZU WERDEN, DIE SIE SEIN WILL. Ist ihr das gelungen? Und welche Bedeutung haben Heimat und Zugehörigkeit heute für sie? KEINE SCHEU VOR KOMPROMISSLOSER UND SCHMERZHAFTER SELBSTREFLEXION Sisonke Msimang erzählt von HOFFNUNG und VERTRAUEN, von ENTTÄUSCHUNG – von sich selbst, von ihren HELD*INNEN – und was das mit ihrem Selbstverständnis und ihrer Identität macht. Davon, wie Stärke sie wachsen lässt und die Welt ein bisschen besser macht. Aber auch darüber, was ihr der Zwang abverlangt, immer stark sein und sich immer weiterentwickeln zu müssen. Sie HINTERFRAGT SICH MIT GROSSER OFFENHEIT, setzt sich immer wieder neu zusammen – um nie wieder das Gefühl haben zu müssen, Idole zu brauchen. Um am Ende – in all ihrer Vielseitigkeit und Widersprüchlichkeit – die HELDIN IHRER EIGENEN GESCHICHTE zu sein. Sie schreibt vom Wunsch, ihr fünfjähriges Ich von damals in den Arm nehmen zu können, um ihm zu sagen: DU KANNST ALLES ÜBERSTEHEN UND STÄRKER UND GLÜCKLICHER WERDEN, ALS DU DIR DAS AN DER SCHWELLE ZU JEDEM NEUEN LAND VORSTELLEN KANNST. WARMHERZIG, KÄMPFERISCH UND AUFRICHTIG: EIN BUCH WIE EIN RICHTIG GUTES GESPRÄCH MIT FREUND*INNEN In Sisonke Msimangs Leben prallen Länder, Träume, Menschen, Rückschläge, Ermutigendes, Ideale – ganze Welten aufeinander: Da sind HEIMWEH und Orientierungslosigkeit, aber auch das Gefühl von ZUGEHÖRIGKEIT, ZUSAMMENHALT und die VIELFALT DES ZWEITGRÖSSTEN KONTINENTS DER ERDE. Da sind KOLONIALISMUS, RASSISMUS, KLASSENUNTERSCHIEDE UND SOZIALE UNGERECHTIGKEIT, aber auch WIDERSTANDSGEIST, VERÄNDERUNG und REVOLUTION. DISKRIMINIERUNG, SEXISMUS und Überforderung, aber auch FAMILIE und FEMINISTISCHER KAMPFGEIST. Das Gefühl von Unvollkommenheit und ZWEIFEL an sich selbst, aber auch VERSÖHNUNG und AKZEPTANZ. Die Herausforderungen in einer Beziehung einer Schwarzen Frau mit einem weißen Mann, aber auch die Bereitschaft, voneinander zu lernen, und die Kraft der LIEBE. Sisonke Msimang ist Revolutionärin, Antirassistin, Mutter, Afrikanerin, Feministin, Partnerin, Schwester – die Heldin ihrer eigenen Geschichte. Ihr Buch ist eine INSPIRATION und ein AUFRUF an Betroffene und Mitkämpfer*innen, sich für SELBSTBESTIMMUNG und GERECHTIGKEIT einzusetzen. Aus dem Englischen von Tatjana Kruse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sisonke Msimang
Und immer wieder aufbrechen
Aus dem Englischen von Tatjana Kruse
Für Mummy
Prolog
Diese Geschichten beginnen mit einem jungen Mann. Eines Morgens im Winter 1962 schließt er sich, wütend und erschöpft davon, was es mit sich bringt, Schwarz zu sein, einer verbotenen Armee an. Im Jahr darauf verlässt er heimlich das Land. Ein weiteres Jahr später wird sein Anführer Nelson Mandela gefangen genommen und der Sabotage angeklagt. Das Gericht verurteilt Mandela zu einer lebenslangen Haftstrafe, aber seine Tapferkeit gerät nicht ins Wanken. Stattdessen zeigt sich Mandela der Lage gewachsen und äußert die berühmten Worte: „Ich bin der Erste, der angeklagt wurde“, und die Welt erlebt mit, wie ein afrikanischer Mann im Angesicht des fast sicheren Todes ungebrochen Haltung zeigt.
Zu dem Zeitpunkt im Jahr 1963, als Mandela sich vor Gericht gegen den Vorwurf der Sabotage zur Wehr setzen muss – zum Zeitpunkt, als er verkündet, dass er bereit sei, für den Kampf gegen die weiße Vorherrschaft zu sterben –, hat der junge Mann, der später mein Vater werden sollte, das Land bereits verlassen. Ein Jahr lang hält er sich in Russland auf, lernt das Morse-Alphabet und wie man mit einem Gewehr umgeht. Ebenso wie alle anderen Rekruten ist er in die Fremde aufgebrochen, ohne sich von seinen Eltern, von seinen Angehörigen zu verabschieden, nicht einmal von seinem besten Freund. Nachdem er monatelang alles sorgfältig und fast ganz allein auf sich gestellt geplant hat, steht er eines Morgens auf und verschwindet im Nebel.
Zehn Jahre später trifft er in Lusaka ein. Davor hat er seinen Abschluss an der Russischen Universität der Völkerfreundschaft in Moskau gemacht und sich nach Tansania begeben, wo er mit anderen Genossen eine Militärbasis aufbaut. Er reist nach Guinea-Bissau und trotzt an der Seite der Truppen von Amílcar Cabral an vorderster Front der portugiesischen Kolonialmacht. Als er endlich in Lusaka ankommt, ist er schon lange nicht mehr jung und hat Freunde sterben sehen.
Er lernt eine hübsche junge Frau aus Swasiland kennen, die in Lusaka studiert. Sie wird seine Frau und schließlich meine Mutter. Sie liebt ihn, auch wenn sie seinem revolutionären Gedankengut zwiespältig gegenübersteht. Sie ist klug genug, den revolutionären Wölfen im Schafspelz zu misstrauen, aber auch weise genug, ihre Skepsis ausschließlich im privaten Umfeld zu äußern. Gemeinsam reisen Mummy und Baba um die Welt. Meine Schwestern und ich kommen in den 1970ern in Sambia zur Welt, wo der ANC, der African National Council, seinen Hauptsitz hat. Von dort ziehen wir erst nach Kenia, dann nach Kanada, anschließend zurück nach Kenia und letztlich für kurze Zeit nach Äthiopien. Als Nelson Mandela 1990 aus der Haft entlassen wird, dürfen wir endlich nach Hause.
Meine Schwestern und ich sind Kinder der Freiheit. Wir wurden in den ANC hineingeboren und innerhalb einer revolutionären Gemeinschaft aufgezogen, deren einziger Zweck es war, gegen die Apartheid zu kämpfen. Man fütterte uns mit kommunistischer Propaganda und schulte uns im radikalen afrikanistischen Diskurs, all das im Schatten der Hoffnungen meines Vaters und des Pragmatismus meiner Mutter. Auf dem Spielplatz hielten wir imaginäre AK-47-Schnellfeuergewehre in unseren mageren Armen, und statt Räuber und Gendarm spielten wir Kapitalisten und Parteikader. Beim Seilspringen riefen wir – im Stakkato-Rhythmus unserer Sprünge – laut die Namen unserer Helden: „Govan Mbeki“, hüpf, spring, „Walter Sisulu“, spring, hüpf.
„Eines!“ Springen.
„Tages!“ Springen.
„Werden!“ Springen.
„Wir!“ Springen.
„Alle!“ Springen.
„Frei sein!“
Südafrika ist heute ein freies Land, doch denjenigen von uns, denen das Land am Herzen liegt, ist klar geworden, dass der Traum von Freiheit eine Art Heimat für uns war. Er war ein Luftschloss, in dessen Mauern jeder von uns ein Held sein konnte. Als wir aus dem Exil zurückkehrten, hatten wir dieses Schloss noch deutlich vor Augen. Wir sagten uns, wir seien etwas Besonderes, und waren fest entschlossen, eine Regenbogennation aufzubauen. Wir wussten, dass Südafrika kompliziert und brutal war, kein Land für Träumer. Das hielt uns aber nicht vom Träumen ab.
Politisch treibt Südafrika mittlerweile hilflos vor sich hin. Viele von uns – jene, die ins Exil gingen, jene, die in Haft waren, und jene, die Freunde und Angehörige durch die Kugeln des weißen Minderheitenregimes verloren haben – fragen sich, wo genau wir in diesem Land stehen und welchen Platz Südafrika in der Welt einnimmt. Anfangs hielten alle Südafrika für den Beweis, dass das Gute über das Böse siegen kann. Wir waren stolz auf uns. Heute findet man nicht nur überall Leid und Armut – früher etwas Edles –, man hat sich daran gewöhnt. Wir lehnen uns nicht mehr dagegen auf. Wir nehmen das Leid der Schwarzen nicht mehr wahr, weil jetzt Schwarze das Sagen haben. Das Elend der Apartheid ist glücklicherweise vorbei, doch irgendwie scheint das Leid der Schwarzen unter einer Schwarzen Regierung weniger gravierend – was den Schrecken nicht verringert.
Hier stehen wir heute: Nelson Mandela ist tot, ebenso wie Walter Sisulu und Govan Mbeki. Lillian Ngoyi, Ruth First, Fatima Meer, Neville Alexander, Dennis Brutus und eine ganze Reihe herausragender Frauen und Männer, die alle eine gerechte Menschlichkeit verkörperten, sind von uns gegangen. Jetzt, wo sie nicht mehr sind, haben wir es mit einem Land zu tun, das ganz gewöhnlich ist, sogar enttäuschend, auch wenn es mit kurzen Momenten verblüffender Brillanz aufwarten kann.
Das Südafrika, das ich mir als Kind vorstellte, war ein Ort des Triumphs, ein Schmelztiegel, aus dem eine würdigere und gerechtere Menschheit hervorgehen würde. Meine Eltern waren Freiheitskämpfer, darum stellten unsere Wanderungen rund um den Globus Teil eines notwendigen Übels dar. Unser Leid war etwas Erhabenes. Eines Tages würde Südafrika groß werden, so träumten wir, und die Demütigungen, die man uns zufügte, würden uns lehren, Ungerechtigkeit zu verabscheuen, und impften uns gegen Ungleichbehandlung.
Und doch haben wir jetzt ein Südafrika, das frei, aber nicht gerecht ist. Für mich persönlich ist das der Punkt, mit dem ich am meisten zu hadern habe. Vielleicht stimmt es ja, dass es in normalen Zeiten kein Heldentum gibt. Als die Waffen schwiegen und sich der Rauch verzogen hatte, stellten wir fest, dass wir nicht die Ausnahme waren. Die ganze Zeit über waren wir einfach nur gewöhnliche Menschen gewesen. Vermutlich kämpfe ich schon mein Leben lang gegen diesen Umstand an. Ich wollte immer an etwas glauben, und das, woran ich mehr als alles andere glaubte, war die Fähigkeit der Südafrikanerinnen und Südafrikaner, über die Apartheid zu triumphieren. Mein Glaube an Gott war nie besonders ausgeprägt, aber ich glaubte an die Menschlichkeit – in der Führung des ANC, in meinen Eltern, kollektiv in den Südafrikanerinnen und Südafrikanern aller races. Ich glaubte, dass sie alle besser sein konnten, als die Umstände es scheinbar diktierten. Und dann endete die Apartheid. Wenn ich ehrlich sein soll, waren die vergangenen zwei Jahrzehnte zwar in vielerlei Hinsicht enttäuschend, aber ich bin dankbar, dass mein rehäugiger Wunderglaube dadurch auf die Probe gestellt wurde. Was wäre das Leben schon wert, wenn wir immer nur rosarot vor uns hinträumen, wenn wir das glauben, was man uns sagt, und wir nicht erkennen, was sich direkt vor unseren Augen abspielt? Die letzten zwanzig Jahre haben mich gelehrt, dass manche Menschen kompliziert sind, dass sie dich enttäuschen werden und du sie trotzdem liebst. Ich habe erkannt, dass es Menschen gibt, die keine Reue empfinden, denen ihre Taten niemals leidtun. Aber auch sie haben ihre Berechtigung, denn die Geschichte lehrt uns, dass Nachsicht wichtiger ist als Rechtschaffenheit, dass ein schwieriger Friede besser ist als Krieg.
Trotz allem, was mir dadurch genommen wurde – ein Großteil der Sicherheit, die man normalerweise mit seinem Zuhause assoziiert, die Fähigkeit, meine Muttersprache perfekt zu beherrschen, Kontakt mit Tanten und Cousins und Nichten und Nachbarn, die andernfalls vielleicht meine Freunde geworden wären: Das Exil war das größte Geschenk meiner Eltern an mich. Ohne einen physischen Ort, den ich Heimat nennen konnte, verliebte ich mich in die Idee von Südafrika. Diesen Traum habe ich mit der Muttermilch aufgenommen – dass es in Südafrika nicht einfach nur um non-racialism und Gleichberechtigung ging, sondern um etwas sehr viel Größeres.
Wenn man als Kind im Exil aufwächst, wie ich es erlebt habe, wenn man Flüchtling oder Migrant ist oder auch einfach wenn der Lebensweg keine gerade Linie ist, lernt man schnell, dass ein Gefühl der Zugehörigkeit ein verbindendes Element ist: Man überlebt nur, wenn man jedes „wenn“, „und“, „aber“, „beides“ und „sowohl als auch“ meistert. Man lernt, dass alles gut ist, solange man an das Kollektiv glaubt, an seine Gruppe, an seinen „Stamm“. Es ist entscheidend für das eigene Überleben, diesen Menschen zu vertrauen und darauf, dass sie nur dein Bestes wollen.
Dieses Gefühl der Zugehörigkeit, der Nähe, ist notwendig, um weiterleben zu können. Ich wuchs mit dem festen Glauben an Helden und Heldinnen auf, darum war es schwer für mich, in den letzten zehn Jahren den moralischen Abstieg jener politischen Partei mitzuerleben, der ich so viel von meiner Identität verdanke. Meine Vorbilder haben sich selbst demontiert. Ihr Verhalten hat mich verstört und oft zutiefst verletzt. Ich habe mich sogar gefragt, ob es ein Fehler war, überhaupt jemals an sie geglaubt zu haben. Ob alles nur eine einzige Lüge war. Ich habe mir Vorwürfe gemacht. Vielleicht war ich einfach nur ein dummes Kind.
Wenn ich fünf Minuten mit meinem jüngeren Selbst verbringen könnte – mit diesem kleinen Mädchen, das jedes Mal weinte, wenn wir in ein neues Land aufgebrochen sind –, dann würde ich die Kleine fest in den Arm nehmen und schweigen. Ich wäre einfach still und würde sie mein pochendes Herz spüren lassen, das im Takt mit ihrem Herz schlägt. Ich würde hoffen, dass die gefestigte Person, die ich heute bin, sie trösten könnte. Dass sie meine stumme Botschaft erreichen würde, dass sie – ungeachtet des Ergebnisses – alles überstehen und stärker und glücklicher werden würde, als sie sich das an der Schwelle zu jedem neuen Land vorstellen konnte.
Ich glaube, mehr hätte sie nicht gebraucht: nur diese stumme Botschaft, damit sie weiß, der Weg mag lang sein, die Antwort letztlich unvollständig und die Wahrheit zerbrochen, und doch ist dieser Weg jede Träne und jeden Kratzer und jede Verletzung und jede Narbe wert. Ich würde sie in ihrem Schmerz festhalten, wenn sie so tut, als wäre sie tapfer, in ihrem Streben und Hoffen und Wünschen. Ich würde wollen, dass sie von ganz allein und ohne allzu großen Kummer das lernt, was ich heute weiß, dass sie den größten Trost in ihren eigenen Instinkten findet und dass ihr Herz immer wieder von Neuem ihr Retter sein wird.
Dieses Buch ist sowohl persönlich als auch politisch – es handelt davon, wie ich durch den Freiheitskampf zu der wurde, die ich heute bin, wie mich die Protagonisten in diesem Kampf zerbrochen haben und wie ich mich – wie wir alle, die wir in Südafrika unseren Weg gehen wollen – immer wieder selbst zusammengesetzt habe, um nie mehr das Gefühl haben zu müssen, ich bräuchte einen Helden. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil zu wenige von uns – Frauen, Flüchtlinge, Schwarze, Homosexuelle, Südafrikanerinnen und Südafrikaner – unseren Instinkten genug vertrauen, um zu wissen, dass es unsere Herzen sind, die uns retten werden.
Burley Court
Als ich klein war, lebten wir in Lusaka und zogen mehrmals um. Zuerst wohnten wir im Burley Court, dann in einigen Apartments in der Nähe des Lehrkrankenhauses und schließlich in einer kleinen Hochhaussiedlung im Stadtviertel Woodlands. Am deutlichsten erinnere ich mich an Burley Court – vielleicht, weil die Wohnung die größte war, vielleicht aber auch, weil Mummy am häufigsten von ihr gesprochen hat. Burley Court lag an der Church Road, einer zentrumsnahen Geschäftsstraße. Wer dort wohnte, gehörte zu einer neuen Generation urbaner Afrikaner, denen es egal war, was die Weißen von ihnen dachten. In jedem der Häuserblocks roch es nach kapenta-Fischen und Bratenfleisch. Wenn man an den offenen Türen und Fenstern vorbeikam, hörte man die blechernen Klänge von Thomas Mapfumos Matiregerera Mambo oder die eleganten Akkorde von Letta Mbulus There’s Music in the Air.
Wie die meisten Kinder im eben unabhängig gewordenen Sambia war ich frei geboren und benahm mich folglich wie ein kleiner Fratz, der allen Grund zu der Annahme hat, dass er der Mittelpunkt des Universums ist. Auch unsere Eltern umgab eine Aura der Selbstsicherheit. Sie verhielten sich, als gehörte ihnen der Boden unter ihren Füßen, als sei die Sonne nur ihnen zuliebe aufgegangen und als ob die Bäume nur wuchsen, um ihnen eine Freude zu bereiten. Sie gaben sich der heiteren Illusion hin, dass ihnen der Kupferabbau dreihundert Kilometer nördlich von Lusaka für alle Zeiten eine glorreiche Zukunft ermöglichen würde. Sie glaubten, sie kämen in den Genuss eines Wohlstands, der Generationen vor ihnen verwehrt geblieben war, weil ihnen das Joch der Kolonialmacht im Nacken saß.
Unsere Eltern dachten – rückblickend gesehen natürlich blauäugig –, dass aus ihren Kindern Ärzte und Anwälte und Konzernchefs würden. Sie waren einfach naiv. Obwohl es sich um erwachsene Männer und Frauen handelte, war ihre Befreiung zu der vielversprechenden Zeit erfolgt, bevor der Kupferpreis ins Bodenlose stürzte, bevor das Geld an Wert verlor und sie nicht mehr ein noch aus wussten. Als ich klein war, erfreuten sich die Erwachsenen in meinem Leben noch an der Vorstellung, dass sie endlich einen Platz an der Sonne ergattert hatten.
Jeden Morgen gingen die Männer, die in unserem Viertel das Geld verdienten, zu ihren Regierungsjobs. Ihre Frauen winkten ihnen nach. Weil sie fast zur Mittelklasse gehörten, hatten sie sich die kuriosen Sitten der Kolonialmacht angeeignet, und zu denen gehörte, dass die Frauen zu Hause blieben und sich um die Kinder kümmerten. Als ob sie deswegen von allen anderen Formen der Erwerbstätigkeit ausgeschlossen wären. Als Hausfrauen – unterstützt von unterbezahlten Hausmädchen – beschäftigten sie sich mit Klatsch und Tratsch und lachten laut und viel. Sie schälten Erdnüsse und legten sich ihre kitenges an und bereiteten die Mahlzeiten für ihre Ehemänner zu, die die Könige in ihrem Heim waren. Die Männer, für die diese Frauen sich schön machten, kehrten in der Abenddämmerung mit weit ausholenden Schritten zu ihren Familien zurück, zurück zu den Tischen voller nsima und Fleischgerichten, zurück zu ihren lächelnden Ehefrauen, deren Körperumfang immer mehr zunahm, weil sie sich an das bequeme Stadtleben gewöhnt hatten, und zurück zu ihren Kindern, die Bücherwürmer wurden und vor Wissensdurst strahlten.
Mummy sprudelte über vor solchen Erinnerungen, wenn sie von Burley Court sprach – wie wir Kinder jeden Nachmittag, sobald wir unsere Hausaufgaben erledigt hatten, die Betontreppe von Gebäude eins oder Gebäude drei auf und ab rannten, ein polyglotter Haufen, der in Nyanja und Bemba herumgrölte und Englisch nur für die besten Beleidigungen aufsparte.
Terrence, eine Bohnenstange von Kind mit einem Dialekt aus sambischem Britisch, war der Geschwätzigste von uns allen. Er schoss mit Witzen um sich, die so taten, als wären sie Beleidigungen, aber eigentlich fast schon Drohungen waren, und es traf alle, die in sein Sichtfeld gerieten. „Du da! Deine Beine sind so dünn. He! Bitte iss etwas, damit ich dich ordentlich verprügeln kann, ohne mir dabei Sorgen machen zu müssen, ob ich dir was breche! Wenn deine Mutter dich abends nach Hause ruft, tut sie dann nur so, als würde sie dir was zu essen geben? Wie kannst du essen und trotzdem so mager bleiben?!“ Terrence selbst war ein knochiger Schlaks mit einer Haut, die aussah, als wäre sie nie in Kontakt mit Vaseline gekommen, geschweige denn mit Body Lotion, und doch waren Witze über Magerkeit sein Spezialgebiet.
Ich war nicht so tapfer wie Terrence. Mir war klar, dass ich eine leichte Beute darstellte. Ich sprach Nyanja – wenn auch nicht so fließend wie die anderen, weil ich nicht aus Sambia kam. Das bedeutete, dass ich zwar das Aussehen und das Benehmen einer Einheimischen hatte, aber trotzdem keine war. Ich konnte es mir nicht erlauben, solche Witze zu reißen. Weil ich wusste, wie verletzlich meine Position war, hielt ich mich immer an das Mittelfeld unserer Clique. Schon ein falscher Witz über das falsche Kind, und die anderen würden sich gegen mich wenden. Gelächter bleibt einem schnell im Hals stecken, wenn man Kind ist: Eben bringst du das Rudel noch zum Lachen, doch schon im nächsten Moment heulst du, weil dich jemand als Flüchtling beschimpft hat.
Ich musste genau entscheiden, womit ich Aufmerksamkeit erregen wollte, und ich wusste, dass ich immer auf Nummer sicher gehen musste.
Darum schloss ich mich Terrence in seinen Attacken nie an, und ich lachte auch nie allzu laut. Ich gehörte einfach zur Meute dazu – spielte Himmel und Hölle auf dem holprigen Bürgersteig vor der Treppe von Gebäude eins, am Abend, wenn sich die Dunkelheit über die Stadt senkte und die Autos auf dem Weg nach Hause vorbeibretterten. Niemand hätte mich mit einem zweiten Blick bedacht, auch meine kleinen Schwestern nicht. Wir waren wie alle anderen – auf unseren braunen Beinen hüpften wir hoch in die Luft und wedelten dabei mit unseren mageren Armen. Abend für Abend war es dasselbe: Wir hüpften, was das Zeug hielt, und warfen unsere Steinchen immer weiter und schneller, wollten unbedingt noch eine letzte Runde spielen, bevor wir nach Hause gerufen wurden.
***
Wir waren zu dritt. Ich war die Erstgeborene. Dann kam Mandlesilo, die 1977 geboren wurde, als ich schon drei war. Und 1979 folgte schließlich Zengeziwe. Als Kind war Mandla dickköpfig, wie es mittlere Kinder sein müssen, wenn sie die Kindheit emotional unbeschadet überstehen wollen. Sie war still, aber eher auf nachdenkliche als schüchterne Art und Weise. Außerdem war sie nah am Wasser gebaut – was sie auch als Erwachsene noch ist. Das ist dem Umstand geschuldet, dass sie von uns allen die freundlichste und sensibelste ist. Zwischen einer herrischen älteren Schwester und einer jüngeren Schwester, die immer allen die Show stahl, war Mandla das gute Gewissen, der moralische Zeigefinger. Sie bewahrte uns vor Schwierigkeiten, allein durch ihre hohen Prinzipien. Zeng und ich hätten unsere diversen Vergehen ohne mit der Wimper zu zucken vor unseren Eltern verheimlicht, aber Mandla ließ das nicht zu. Ihr wäre es am liebsten gewesen, wenn wir erst gar nicht gesündigt hätten.
Zeng war jedermanns Liebling und ist es immer noch. Sie gehörte zu den Babys, die singend aufwachen und dann den ganzen Tag fröhlich gurgeln und glucksen – eine süße Manipulatorin, der man alles vergab, weil sie so dreist und so umwerfend war. Das ist sie bis heute. Sie bringt einen so sehr zum Lachen, dass einem der Bauch wehtut, auch wenn man weiß, dass man eigentlich weinen sollte, weil sie nicht so glücklich ist, wie sie tut, und sie außerdem viel komplexer ist, als sie die Welt glauben lässt.
Als Kinder hatten wir Mondgesichter, geflochtene Haare und stets aschfahle Knie. Wir gingen mit offenen Augen durch die Welt und waren außergewöhnlich sarkastisch. Wir flachsten schon beim Frühstück herum, witzelten uns durch das Mittagessen und erzählten brüllend komische Geschichten, wenn wir abends spielten. Weil die Welt uns noch nicht grausam behandelt hatte, war unser Humor nie bösartig, unsere Schlagfertigkeit milde.
Die Badezeit war immer etwas Besonderes. Wenn wir in der Wanne saßen, neckte uns Mummy oft wegen des Schmutzes unter unseren Fingernägeln und der aufgekratzten Knie, wegen der Blasen an unseren Händen und der rissigen Fußsohlen. Sie rieb uns mit einem feuchten Tuch ab, seifte unsere Rücken ein und fragte sich dabei laut, wie wir nur so schmutzig werden konnten. „Was ist mit diesem Schnitt hier?“, fragte sie mit übertriebener Stimme. „Wie kam es dazu?“ Dann drohte sie spielerisch mit dem Finger und lächelte. Ihr vorgetäuschter Ärger brachte uns zum Lachen, und ihre fröhliche Stimme war wie Honig in warmem Wasser. Wir wussten, wie sehr andere Mütter es hassten, wenn ihre Kinder mit zerrissenen Kleidern und blutigen Knien nach Hause kamen, darum wurden wir es nie müde, dass Mummy sich über unsere ständige Zerlumptheit so amüsierte.
Mummy liebte die kleinen Kollateralschäden der Kindheit, mit denen unsere Körper überzogen waren. Unsere Geschichten fesselten sie – unsere Triumphe auf dem Spielplatz und die Scham, die man empfand, wenn man fiel und sich verletzte. Sie wusste, dass die kleinen Schrammen an unseren Körpern unsere Persönlichkeit schmieden würden. Wir waren in unseren Erzählungen lebhaft und überbordend, weil sie uns ermutigte, zu übertreiben und alles auszuschmücken. Wenn wir berichteten, was uns passiert war, dann wurde aus jeder kleinen Schramme eine klaffende Wunde, aus jedem Kratzer ein böser Riss. Zu Hause waren wir tapfer, auch wenn wir in der Welt draußen etwas vorsichtiger navigierten.
Wir waren kleine Schwarze Mädchen, die in eine Zeit hineingeboren wurden, in der viel über Frauenrechte geredet wurde, diese Rechte aber noch nicht greifbar waren. Die ersten zehn Jahre meines Lebens fielen mit der von den Vereinten Nationen (UN) ausgerufenen „Dekade der Frau“ zusammen, darum gab es ständig Vorträge und Konferenzen zu diesem Thema. Alle sprachen darüber, wie dringend notwendig es sei, die Gleichberechtigung voranzutreiben. In Afrika nahm man die UN damals noch ernst. Mummy spürte möglicherweise, dass die Gleichberechtigung tatsächlich kurz bevorstand, darum erzog sie uns so, dass wir für diese neue Zeit bereit waren – für den Moment, in dem die Zurschaustellung weiblicher Unabhängigkeit auf Lob traf, nicht auf Tadel und Vorwürfe. Sie machte das sehr geschickt. Irgendwie wusste sie, dass der Schlüssel dazu in unseren Schrammen und in dem gemeinsamen Lachen zur Badezeit zu finden war.
***
Obwohl die meisten Mütter von Burley Court nicht zur Arbeit gingen, verdiente bei uns zu Hause Mummy das Geld, während Baba – der Botanik und Entomologie an der Universität von Sambia (UNZA) studierte – alles über Pflanzen und Insekten lernte. Babas Zweitjob war Freiheitskämpfer, aber das Einkommen aus dieser Beschäftigung war vernachlässigbar. Bevor er sie traf, war er mit der Bewegung zur Befreiung seines Volkes verheiratet gewesen. Aber dann begegnete er ihr, und ihm gefielen ihr Lächeln und ihre Beine. Sie unterhielten sich, und er fand heraus, dass sie Tennis spielte, und auch das gefiel ihm. Bald schon ging sie ihm nicht mehr aus dem Kopf: die junge Swasi-Frau mit der Killer-Rückhand, die so tat, als bemerke sie ihn nicht, wenn er und die anderen Guerillakämpfer sie vom Spielfeldrand beobachteten.
Mummy wiederum gefiel der große, gutaussehende Mann in der engen Cordhose. Sie mochte sein Maßhalten in allen Dingen. Er trank, aber nie bis zu dem Punkt, an dem er sich vergaß. Er verbrachte gern Zeit mit anderen, genoss es aber auch, allein zu sein. Er lächelte oft, war aber keiner, der grundlos lächelte. Sie hatte die Erfahrung gemacht, dass solche Männer immer etwas zu verbergen hatten.
Ein Jahr nach ihrer ersten Begegnung machte sie ihren Abschluss als Buchhalterin. Kurz darauf borgte er sich eine Krawatte, sie trug weiße, kniehohe Stiefel und ein cremefarbenes Minikleid, das kaum ihr wachsendes Bäuchlein bedeckte, und sie heirateten im Rathaus von Lusaka.
Die Frauen von Burley Court tuschelten über alles Mögliche, aber nichts beanspruchte ihre Zeit und Energie so sehr wie ein ausführlicher Tratsch über den Guerillakämpfer, der sich weigerte zu arbeiten, und die Swasi-Frau, die ihn so sehr liebte, dass sie das erlaubte. Wann immer das Gespräch auf meine Eltern und ihre Beziehung kam, und das war oft der Fall, spekulierten die Frauen über diesen ganz besonderen Wahn, der einige Frauen überkam, wenn es um Herzensdinge ging.
Weil das Streuen von Gerüchten das Spezialgebiet dieser Frauen war, nannten Mummy und ihre Freundinnen sie nur die Klatschtanten. Mama Tawona war die Anführerin der Klatschtanten. Sie konnte diese unchristliche Beziehung, die sich da vor ihren Augen abspielte, einfach nicht akzeptieren: Sambia war damals – und ist es heute noch – eine zutiefst konservative Gesellschaft. Frauen und Männer hatten getrennte Lebensbereiche und sollten sich nur dort treffen, wo es von Gott gutgeheißen wurde.
Mummy war hübsch und hatte schöne Beine, die sie in ihren überkurzen Miniröcken und -kleidern gern zur Schau stellte. Sie konnte Auto fahren und führte ihr Leben ganz allgemein so, wie es ihr beliebte. Doch in den Augen der Klatschtanten besaß Mummy eine Reihe von Eigenschaften, die sie für ein Scheitern ihrer Ehe förmlich prädestinierten. Zum einen arbeitete sie zu viel. Manchmal kam sie erst nach achtzehn Uhr nach Hause. Ihr Guerillakämpfer kam und ging, wie es ihm gefiel, sammelte Insekten, die angeblich mit seinem „Studium“ zu tun hatten, und nahm auf diesen Ausflügen die Kinder mit, die er dafür in Latzhosen und Jeanssachen steckte. Und immer kamen sie dreckig und verschlammt zurück. Es lag auf der Hand, dass er aus diesen armen kleinen Mädchen Jungs machen wollte: Ihre Haare waren kurz geschnitten, ihre Ohrläppchen ungepierct, und das waren nur die augenfälligsten Verfehlungen. Schlimmer noch, die Familie ging nie zur Kirche. Im Leben der Swasi-Frau, des Guerillakämpfers und ihrer Kinder schien es keine Ordnung zu geben. Es war nicht ganz klar, was genau ihre Familie zusammenhielt: Gott, Familie oder Tradition waren es jedenfalls nicht.
Die Klatschtanten standen oft vor Mama Tawonas Tür und tuschelten, die Köpfe eng an eng. Wenn sie nicht laut lachten, unterhielten sie sich flüsternd. Sie kicherten hinter vorgehaltenen Händen, und sobald jemand vorbeikam, lächelten sie und grüßten und taten höflich. Mummy konnte diese Frauen nicht ausstehen. Sie lächelte freundlich, wenn sie in ihrer schicken Bürokleidung an ihnen vorbeiging, aber sie blieb nie stehen, um sich mit ihnen zu unterhalten. Mummy tat nie etwas, das den Klatschtanten Anlass dazu gegeben hätte, Grimassen zu schneiden und die Mundwinkel nach unten zu ziehen, sobald sie an ihnen vorbei war, aber sie taten es trotzdem, rollten mit den Augen, starrten Mummys neue Schuhe oder ihre alte Handtasche an. Mummy konnte nicht gewinnen, und das wusste sie auch. Sie war entweder eine Angeberin, weil sie zu viele schöne Dinge besaß, oder eine bemitleidenswerte Versagerin, weil sie zu viele Dinge hatte, die geflickt und ausgebessert gehörten.
Mummy schenkte den Klatschtanten so wenig Aufmerksamkeit wie möglich. Ihr Mangel an Interesse schürte allerdings den Neid der Frauen, ließ das Feuer ihrer Wut aufkochen. Samstags ging Mummy immer schon früh zum Französischunterricht, und wenn sie an ihnen vorbeikam, wurden die Blicke der Frauen hart. Ha! So mochte man sich vielleicht in ihrer Heimat benehmen, aber hier in Sambia setzte man seine Ehe aufs Spiel, wenn man das Haus für unnötige Dinge wie Französischunterricht oder Tennis verließ.
Die Bosheit der Klatschtanten beschränkte sich in der Regel auf den Kreis dieser Frauen. Die Erwachsenen blieben unter sich, ebenso wie die Kinder. Aber manchmal überlappten sich diese Bereiche, und dann drang aus den Schatten ein Murmeln, und die Verletzungen, die die Erwachsenen einander zufügten, schlängelten auf uns zu wie Nattern, die ihren Weg auf den Spielplatz fanden und zubissen und töteten.
***
Eines Tages spielten wir Verstecken. Terrence musste suchen. Ich versteckte mich unter der Treppe. Ich wusste, er würde dort nicht nach mir schauen, weil es die Treppe von Gebäude eins war, und in Gebäude eins wohnte Mama Tawona. Deshalb spielten wir nur ganz selten dort. Ich ging jedoch das Risiko ein, weil ich Mama Tawona und zwei weitere Klatschtanten kurz zuvor an der Bushaltestelle gesehen hatte. Ich dachte, es wäre sicher.
Doch ich lag falsch. Gerade hatte ich es mir in meinem Versteck bequem gemacht, als Mama Tawona und die Klatschtanten laut und außer Atem den Gang heruntertrudelten. Vielleicht war der Bus nicht gekommen und sie beschwerten sich darüber, dass die öffentlichen Verkehrsmittel immer unzuverlässiger wurden. Vielleicht waren sie auch auf dem Markt gewesen und kamen zum Mittagessen zurück, ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich weiß noch, wie ich mich in diesem Moment fühlte, nämlich wie immer in ihrer Gegenwart – nervös. Es war ein heißer Tag. Sie unterhielten sich weithin vernehmlich und ohne Scheu – wie es Frauen tun, wenn weder ihre Ehemänner noch ihre Kinder in der Nähe sind.
Vor Mama Tawonas Wohnung blieben sie stehen und tratschten. Bald schon kamen sie auf Mummy zu sprechen. Mama Tawona fragte sich, wie dumm diese Frau sein musste, um sich so einen Mann zu nehmen. Sie erklärte, dass Baba kein richtiger Mann sei – nur ein Junge, der kindischen Träumen hinterherjagte, der mit Waffen spielte und finanziert von der sambischen Regierung durch die Welt reiste. Und immer diese Guerillakämpfer, die zu allen Tages- und Nachtzeiten vorbeikamen! Ständig schlief jemand anderes bei denen – Männer und Frauen, Frauen und Männer, manchmal sogar Kinder. Was ist mit ihren eigenen Kindern? Manche von diesen Leuten sind doch Kriminelle. Die Klatschtanten waren überzeugt, dass viele Vertriebene aus Südafrika die wilden Lebensgeschichten nur fabrizierten, um zu verschleiern, dass sie in Wirklichkeit Diebe und Räuber waren und vor dem Arm des Gesetzes flohen. Es war ja so leicht, hier den Helden zu spielen – aber in Wirklichkeit handelte es sich schlichtweg um Ganoven! Ha. Die meisten ANC-Typen waren doch Kriminelle.
Mir war nie der Gedanke gekommen, meine Eltern könnten Träumer sein. Ich hätte auch nicht gedacht, dass unsere Familie sich von den anderen in Burley Court so sehr unterschied. Die Aunties und Uncles und Studenten, die manchmal wochenlang bei uns in der Wohnung schliefen und dann verschwanden, waren einfach Teil des Lebens. Dachte ich. Doch jetzt erkannte ich, dass das nur ein Teil unseres Lebens war. Genau deshalb riss ich nie solche Witze, wie Terrence es tat – meine Andersartigkeit gab mich allzu leicht der Lächerlichkeit preis.
Erst als ich Mama Tawonas Entrüstung mitbekam, wurde mir klar, dass es auch noch andere Arten zu leben gab. Mama Tawona und die Klatschtanten verkörperten die Moralpolizei. Sie entschieden, wer in ihr Königreich der Rechtschaffenheit Einlass fand und wer nicht. Sie allein – und nicht der Vermieter – befanden darüber, ob man zu Burley Court gehörte oder nicht.
Mama Tawona war völlig anders als die Frauen, die ich sonst kannte. Alle anderen waren wie meine Mutter. Sie waren Parteimitglieder des ANC oder Studentinnen mit festen Wurzeln in der Befreiungsbewegung. Viele von ihnen gehörten dem bewaffneten Flügel des ANC an, das hieß, sie ließen sich zu Soldatinnen ausbilden.
Diese Frauen liebte ich am meisten. Sie hatten eine scharfe Zunge, einen hungrigen Blick, und sie bildeten ein Rudel. Sie waren so unterschiedlich, wie Afrikanerinnen es sind – groß und schlank mit einem kleinen Hintern oder kräftig gebaut mit breiten Hüften. Sie hatten schmale Knöchel und Handgelenke, breite Füße und schmalgliedrige Finger. Sie waren dunkel mit kurzgeschorenem Haar oder hatten riesige Afros, die ihren walnussbraunen Teint wie ein Heiligenschein umgaben.
Sie rauchten und tranken und lachten laut – in gewisser Weise frei, nur nicht dort frei, wo es am meisten zählte. Sie trugen Minikleider, kniehohe Stiefel und Jeans, in denen sie sich mühelos so bewegen und laufen konnten, wie Frauen eigentlich nicht laufen sollten. Ihre Arme waren stark genug, um ein AK-47-Schnellfeuergewehr zu halten. Ihre Zöpfe waren unglaublich eng geflochten, die Brauen immer perfekt gezupft. Sie strahlten gewissermaßen Gesetzlosigkeit aus. Es war, als ob ihre Lippen – halb zu einem Lächeln, halb verächtlich verzogen – dazu geformt wären, die Regeln zu brechen. Ihre Lässigkeit im Umgang mit Worten, die Leichtigkeit, mit der sie einander, aber auch Frauen, die zufällig vorbeigingen – Rivalinnen wie Freundinnen –, spitze Bemerkungen zuwarfen, brachte mein Herz zum Pochen. Poch, pochpochpoch, pochpochpoch. Ich liebte diese Frauen!
Mit dicken Hintern oder knochigen Hüften, aber immer breitbeinig saßen sie an unserer Küchentheke, ließen die Füße baumeln, Schulter an Schulter in schwesterlicher Solidarität. Wenn jemand eine Boney-M-Platte auflegte, liefen sie in die Mitte des Raumes und lachten sich zu. „Haiwena, sukuma!“, riefen sie und zogen alle, die dachten, sie könnten einfach sitzen bleiben, während die Musik spielte, auf die Beine. „Sana, ngiyayithana le ngoma.“ Und dann tanzten alle den Pata Pata zu Brown Girl in the Ring.
Heute ist mir klar, dass sie sich die alte Haut abschälten. Diese jungen Löwinnen brüllten. Sie kauten Kaugummi und sprachen darüber, wie lange sie wohl warten mussten, bevor man sie in die Lager rief. Sie lachten über ihre elegant-schäbigen Männer. Sie grinsten und zogen den Bauch ein, wenn ein gut aussehender Mann, mit dem sie sich etwas vorstellen konnten, zufällig des Wegs kam. Sie atmeten Feuer und Revolution, und ich wollte unbedingt eine von ihnen werden.
Die Männer waren nicht weniger berauschend. Bis spät in die Nacht tranken und lachten sie mit meinen Eltern. Wir nannten sie Uncle und kletterten auf ihren Schoß, wenn sie uns Süßigkeiten mitgebracht hatten. Diese Männer waren alle „Erste“: der erste Afrikaner, der an dieser oder jener Universität studierte, der erste Schwarze, der an diesem oder jenem Ort wohnte, der erste Schwarze, der an dieser oder jener Bildungseinrichtung lehrte. Deswegen umgab sie alle die Aura der Unbesiegbarkeit, und sie strahlten ein unwahrscheinliches Selbstvertrauen aus – selbst dann, wenn sie betrunken auf dem Teppich lagen.
Die Poesie ihres Intellekts verzauberte uns. Jedes Wochenende gab es Diskussionen, wann Afrika einen Mann auf den Mond schicken würde. Und weil sie nicht grinsten und das anscheinend nicht für absurd hielten, taten wir das auch nicht. Im Lusaka meiner Kindheit lag es absolut im Bereich des Möglichen, dass wir aus eigener Kraft in den Weltraum fliegen würden. Ich hatte keine Ahnung, dass bereits ein Mann den Mond betreten hatte und dass dieser Mann Neil Armstrong hieß. Als ich klein war, verglichen wir uns nur dann mit dem Westen, wenn wir die Nase vorn hatten.
Die Männer, die zu uns nach Hause kamen, gehörten einer neuen Generation von Afrikanern an. Sie hatten Südafrika, Simbabwe und Mosambik verlassen, um zu strahlen, zu glänzen, ihr Licht leuchten zu lassen. Sie waren vom Geheimnis der Freiheit besessen, besaßen ein inneres Feuer, das sie vorantrieb und sie – zumindest in meinen Augen – hell leuchten ließ.
Diese Männer waren außerdem umwerfend schön. Sie räkelten sich lässig und mit ausgestreckten Gliedmaßen auf unseren Sofas. Sie hatten Guerillabärte und struppige Haare und sehnige Schenkel und trugen Schlaghosen aus Jeansstoff. Sie fuhren verbeulte Autos, die aussahen, als würden sie jeden Moment auseinanderfallen. Sie lachten, als würden ihre Herzen nicht brennen, und tranken, als hörten ihre Alpträume niemals auf.
Sie waren Idealisten und Gangster und Abzocker und wissensdurstige Studenten, die ihre Freundinnen und Mütter und Ehefrauen und Babys zurückgelassen hatten. Ihre Kinder würden nie die Umarmung ihrer Väter erleben – aus ihren kleinen Mädchen würden Frauen werden, die die Männer, die sie liebten, dafür hassten, dass sie nicht ihre Väter waren.
Aber in unserem Haus waren diese Männer Helden. Meine Schwestern und ich wussten nichts von dem Leben, das sie hinter sich gelassen hatten, darum trugen sie für uns nicht die Narben ihrer Verantwortung, waren nicht mit unsichtbaren Fäden mit ihrer schmerzlichen Vergangenheit und ihrem profanen Gestern verbunden. Im Exil erschufen sie sich aus Schlamm und Erde neu.
Als sie Südafrika verließen, häuteten sie sich und wurden zu den Männern, als die sie geboren waren. Ihr Rücken wurde gerader, als sie sich in die eisige Umarmung Moskaus begaben. Ihre Muskeln wurden stärker, während sie durch das Buschland und die moskitoverseuchten Sümpfe von Angola marschierten. Sie gingen aufrechter, wenn sie durch den Morast wateten, und es mag Unsinn über ihre malariaverseuchten Lippen gekommen sein, während sie Kongwa durchquerten, aber sie waren frei. Sie zogen quer durch Afrika und sangen ihre Freiheitslieder, bis ihre Stimmen rau wurden, bis sie nur noch krächzend und mit trockenem Mund am Ende ihrer verschlungenen Reise in Lusaka eintrafen, diesem Ort der Zigaretten und der Fröhlichkeit und der harten-weichen Frauen. Sie waren erschöpft, aber jederzeit bereit, wieder zu lächeln.
Am Hauptsitz der Bewegung angekommen, dem Ort, von wo die Befreiung ihres Volkes ausgehen sollte, brachen viele von ihnen zusammen. Heute ist mir klar, dass wir sie genau so vorgefunden haben. Wir fanden sie dicke braune Kinder zeugend und freie Frauen liebend vor. Wir fanden sie vor, wie sie auf der roten Veranda saßen und den warmen Regen Lusakas auf ihre braunen Schultern fallen ließen. Wir fanden sie kiffend vor, wie sie Bob Marleys Buffalo Soldier sangen.
Wenn diese Männer nach Lusaka kamen, waren sie von viel mehr als nur vom Kampf um Gerechtigkeit gebrochen. Aber ihre Dämonen waren hier nicht wichtig. Es kam nur darauf an, dass sie beschlossen hatten, unsere kleine Stadt zu ihrem Hort der Sicherheit zu machen – unser Lusaka, mit seinem übergroßen Ehrgeiz und seinen ordentlichen Kreisverkehren. Für diese Männer wurde Lusaka zu dem Ort, an dem Schwarz zu sein gleichbedeutend war mit frei zu sein. An dem ihnen niemand – weder Queen Elizabeth noch John Vorster oder Richard Nixon – etwas vorschreiben konnte. Lusaka – in all seiner friedlichen, futuristischen, pan-afrikanischen Pracht – gehörte ihnen, und sie wollten nichts weiter, als sich eine Zeitlang im Frieden der Stadt zu vergraben.
Einigen Bewohnern von Burley Court missfielen die Frauen und Männer, die meine Familie besuchten. Sie waren ihnen zu laut, und es gefiel ihnen nicht, dass der Präsident von Sambia, seine Exzellenz Dr. Kenneth Kaunda, diesen Revolutionären einen besonderen Status im Land eingeräumt hatte. Dr. Kaunda war ein Träumer, der glaubte, dass Afrika den Afrikanern gehörte. Er hatte erklärt, dass das unabhängige Afrika eine Verantwortung gegenüber jenen Teilen von Afrika habe, die immer noch in Ketten lagen. Und weil die Afrikaner in Südafrika, Simbabwe und Mosambik nicht frei waren, gewährte Dr. Kaunda ihnen Zuflucht in Sambia.
Für gewöhnliche Sambier war unsere Anwesenheit eine tägliche Realität, nicht nur ein politischer Slogan. Die meisten waren freundlich und unterstützten unsere Sache. Für andere, wie Mama Tawona, waren wir Regelbrecher und Herumtreiber. Die Bezeichnung „Flüchtling“ war für diese Menschen eine Beleidigung. Ihrer Meinung nach bezirzten die Flüchtlingsfrauen sambische Männer, und die Freiheitskämpfer verführten die sambischen Frauen und brachen ihnen das Herz.
Ich machte mich unter der Treppe immer kleiner, wartete darauf, dass man mich fand.
Mummy und Baba stellten offenbar ein noch viel größeres Problem dar. Sie waren nicht nur Flüchtlinge. Sie liebten sich, und diese Vorstellung war für Mama Tawona einfach lachhaft.
Sie tratschte über diesen höchst merkwürdigen und lächerlichen Umstand. Dabei warf sie den Kopf in den Nacken und kicherte. Sie sprach über meine Mutter, als wäre sie ein naives Kind. „Ha, mwana! Weil sie ihn liebt, denkt sie, er sei wunderbar. Dabei wissen wir doch alle, wie dumm das ist. Wenn man liebt, kommt einem selbst die Wüste wie ein herrlicher Wald vor.“ Sie brüllte vor Lachen, und Mrs. Mwansa (die keine Kinder hatte, aber wenigstens einen Ehemann, was sie vor der völligen Bedeutungslosigkeit bewahrte) und Mama Terrence nickten zustimmend.
„Sie wird es schon noch lernen“, meinte Mama Terrence.
„Haha, und wie sie es lernen wird! Der Schmerz wird ihr Lehrmeister sein“, erklärte Mrs. Mwansa.
Mama Tawona fuhr fort: „Ihr kennt doch die Männer. Eines Tages wacht er auf, und ihm ist klar, dass das Einzige, was er im Leben will, die eine Sache ist, die sie ihm nicht geben kann. Wir werden ja sehen, ob sie dann immer noch lächelnd grüßt, wenn sie auf ihren hohen Absätzen an uns vorbeistöckelt. Ich glaube nicht! Oh nein. Sie wird weinen. Tränen des Kummers. Tja. Männer sind eben so. Wenn sie keinen Erben bekommen, verlassen sie dich. Solange sie keinen Sohn zur Welt bringt, kann sie sich der Liebe ihres Mannes niemals sicher sein.“
Und so offenbarte sich mir, wie besessen die Welt von Jungs ist. Wir brauchten einen kleinen Bruder – und zwar bald. Meine Schwestern und ich wären niemals genug. Keinen Sohn zu haben würde unseren Eltern unvorstellbaren Kummer bereiten. Mir war bis dahin nicht klar gewesen, dass Jungs wichtiger waren als Mädchen, dass ein fiktiver Erstgeborener mehr bedeutete als eine Handvoll Mädchen. Diese Erkenntnis – dass eine Familie ohne einen Sohn eigentlich keine Familie ist – war so erschütternd für mich, dass ich nicht hörte, wie Terrence um die Ecke gelaufen kam. Ich kauerte unter der Treppe, dachte an die Jungenlosigkeit meiner Familie und überlegte, wie ich Mummy danach fragen sollte, wenn sie von der Arbeit kam, als ich plötzlich Terrences knochiges Knie im Gesicht spürte. Ich schrie auf, und die Klatschtanten zuckten zusammen. Meine Wange lief sofort knallrot an, aber ich entdeckte kein Mitgefühl in den Augen von Mama Tawona. Sie sah mich an, als sei ich es, die etwas verbrochen hatte.
Das tat weh.
Den Begriff „Primogenitur“ lernte ich erst sehr viel später im Leben, aber dieser Moment war meine einführende Lektion in Sachen Erstgeburtsrecht. Was für eine absurde Idee: dass mein Vater allen Grund hätte, sich eine andere Frau zu suchen, um mit ihr ein weiteres Kind zu zeugen, einen Jungen, der scheinbar mehr dem Bild meines Vaters entsprechen würde als wir alle drei. Dieser Gedanke schoss mir durch den Kopf, während meine Wange immer weiter anschwoll. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder mich erbrechen sollte.
Wie konnte es jemanden geben, der Baba ähnlicher sein sollte als ich? War Babas Gesicht nicht auch das meine? War er nicht unser Papa, der uns mehr als alles in der Welt liebte? Der uns überallhin mitnahm – zum Markt und in die Autowerkstatt und zu seinen Freunden –, um mit uns anzugeben?
Und doch verstand ich es genau, kaum dass ich es gehört hatte. Es erklärte all die Male, in denen Mummy von Frauen, die sie gerade erst getroffen hatte, gefragt worden war, ob sie es nicht noch einmal versuchen wolle. Nun begriff ich, warum Mummy immer verärgert den Blick abgewandt und uns rasch weitergezogen hatte, sobald jemand erklärte: „Ihr könnt erst aufhören, wenn ihr einen Jungen habt.“
***
Ein paar Tage nach dem Zusammenstoß im Flur tat meine Wange immer noch weh und war geprellt. Tawona und ich spielten Himmel und Hölle, und sie verlor – völlig untypischerweise. Ich warf den Stein und er landete punktgenau im Kasten. Ich fing an zu hüpfen. „Du hast die Linie berührt“, rief sie.
Ich hatte die Linie nicht berührt.
„Hab ich nicht“, sagte ich also.
„Doch, hast du. Du schummelst.“
„Nein, du schummelst. Nur weil ich am Gewinnen bin, erfindest du jetzt Geschichten? Geh bloß weg und schummele woanders!“, rief ich. Ich war immer noch wütend auf ihre Mutter, musste immer noch ständig an das Gespräch denken, das ich belauscht hatte, und mein Gesicht tat immer noch weh.
Tawona pflegte Beleidigungen nicht schweigend hinzunehmen. Sie brüllte: „Vielleicht solltest du zum Hexendoktor gehen und nicht deine Mutter!“
Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach, aber ich spürte, wie ich rot wurde.
„Ach, jetzt verschlägt es dir die Sprache, was?“, fuhr sie fort. „Ich sag dir mal was, du dummes Ding. Wenn deine Mutter von unserem Stamm wäre, hätte man sie schon längst zum Hexendoktor gebracht. Vielleicht liegt es ja daran, dass ihr Ausländer seid. Aber in Sambia gibt es so etwas nicht. Wie kann eine Frau drei Mädchen nacheinander bekommen? Am Stück. Drei? Zwei geht ja noch, aber drei?! Bäh, das ist ein Fluch.“
Sie plapperte immer weiter. War fest entschlossen, den größtmöglichen Schaden anzurichten.
„Wenn sie sich nicht um ihr Problem kümmert, wird dein Vater sie für eine Frau verlassen, die ihm geben kann, was er will. Es gibt keinen Mann auf dieser Erde, der keine Söhne will. Also ehrlich! Sie sollte sich besser vorsehen. Glaubst du wirklich, er bleibt bei euch, wenn er niemanden hat, der ihn beerbt?“
Sie konnte nicht aufhören.
„Ein Mann kann seine Töchter nie so lieben, wie er seine Söhne liebt. Jungs gehören dem Vater. Und was hat dein Vater? Nur Mädchen! Also hat er nichts!“
Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich auf sie eindrosch. Ich weiß nur noch, dass überall Blut war und es mir nicht leidtat, auf sie eingeschlagen zu haben. Es tat mir überhaupt nicht leid. Tawona stand unter Schock. Das hämische Grinsen war ihr vergangen, und deshalb fühlte ich mich etwas besser, obwohl sie mir gerade das Herz gebrochen hatte.
Plötzlich standen schreiende Kinder um uns herum. Tawona war fuchsteufelswild. Sie stürmte zur Treppe, die Menge hinter ihr her. Sie hielt sich die aufgeplatzte Lippe. Ihr blutiges Kleid spannte über ihrem Bauch. Ich ließ mich zurückfallen, hatte Angst. Terrence drehte sich um und kam auf mich zugelaufen. Er schaute ernst. Ihm war die Schwere der Situation bewusst. „Du kommst besser mit. Du machst es sonst nur noch schlimmer.“
Terrence nahm mich an der Hand. Wir standen vor Tawona, die mittlerweile blutüberströmt war. Jemand hatte ihr den Zahn gegeben, den ich ihr ausgeschlagen hatte. Er war schmutzig und ganz klein, und als sie ihn sah, fing sie wieder an zu jammern. Meine Unterlippe zitterte. Ich hatte ihr den Zahn nicht ausschlagen wollen. Ich hatte Angst, schlimme Angst. Mama Tawona würde meinen Kopf fordern.
Als wir den Treppenkopf erreichten, wartete Mama Tawona schon. Tawonas kleiner Bruder war vorausgelaufen und hatte seiner Mutter erzählt, dass seine große Schwester geschlagen worden war, und zwar von mir. In Mama Tawonas Augen funkelte der Blutdurst. Ich wartete nicht, bis sie anfing, mich auszuschelten. Ich konnte einfach nicht. Stattdessen beging ich eine noch viel größere Sünde: Ich lief davon. Ich brach die Kardinalregel aller afrikanischen Familien und rannte vor einer Erwachsenen davon, die mich disziplinieren wollte. Ich lief an ihr vorbei zu unserer Wohnung. Hoffentlich war Baba zu Hause.
War er. Er saß am Esszimmertisch, vor ihm seine Bücher und ein paar Käfer. Mummy hasste es, wenn er seine Insekten auf dem Esstisch kennzeichnete, und unter normalen Umständen hätte ich ihm das auch gesagt, aber das hier war ein Notfall, darum rannte ich zu ihm und kletterte auf seinen Schoß, wofür ich eigentlich schon zu groß war. Dann fing ich an zu weinen. Im ersten Moment dachte er, ich sei verletzt. Er suchte meinen Körper nach offenen Wunden ab.
„Wo tut es weh?“, fragte er verwirrt.
„Nirgends“, rief ich. „Aber Tawona sagt, du hast mich nicht lieb, weil ich ein Mädchen bin.“ Die Worte purzelten aus mir heraus – zusammen mit Tränen und Rotz. „Sie hat gesagt, dass du nur Söhne willst und dass wir nicht nach Sambia gehören, weil wir Ausländer sind, und dass wir dahin zurückgehen sollten, woher wir kamen. Und dann hat sie gesagt, dass Mädchen ein Fluch sind und nur Jungs zum Vater gehören.“
Mir brach die Stimme.
Er sagte nichts, und das beruhigte mich. Wie jedes Kind weiß, ist Schweigen immer der Anfang des Zuhörens.
Baba zog mich näher an sich. Ich konnte sein Herz spüren. Es pochte eine Sonate: „Du gehörst mir, du gehörst mir, du gehörst mir.“ Tawonas Worte verloren ein wenig von ihrer Schärfe. Mein Herz schlug nun im Gleichklang: „Ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir.“
Als meine Mutter an diesem Abend von der Arbeit kam, brachte sie mich zu Tawona, damit ich mich bei ihr entschuldigte. Wir klopften gemeinsam an die Tür. Mama Tawona öffnete mit strengem Blick.
„Ihr wollt etwas sagen?“, fing sie an.
Mummy ließ sie nicht weiterreden. „Wir sind gekommen, um uns zu entschuldigen. Sonke hätte Tawona nicht schlagen dürfen.“
Mama Tawona unterbrach sie. „Du denkst, es würde ausreichen, wenn du einfach sagst, dass es dir leidtut …“
Mummy ließ sie nicht ausreden. „Deine Bitterkeit muss sich ein anderes Ziel suchen. In unserer Familie ist sie nicht willkommen. Und wenn du nicht aufhörst, wenn du mit diesem Unsinn weitermachst, wird das Folgen haben. Wann immer du mich siehst, wirst du Bescheid wissen. Der Fluch, der deiner Ansicht nach auf mir lastet, wird auf dich übergehen. Du wirst auf eine Art und Weise verflucht sein, wie es die Leute hier noch nie erlebt haben. Kennst du Swasis? Kennst du Zulus? Wenn du erfahren willst, was wirkliche Macht ist, dann mach nur so weiter.“
Mama Tawona stemmte die Hände auf die Hüften, während Mummy sprach, aber nun erstarrte ihr Gesichtsausdruck. Mummy sah sie eisig an. „Hast du mich verstanden?“
Mama Tawona blieb stumm. Verschämt.
„Ich habe dich etwas gefragt.“ Mummy klang bedrohlicher, als ich es je gehört hatte. „Ob du mich verstanden hast?“
Mama Tawona nickte. Dann sah sie zu Boden. Sie gehörte nicht zu den Frauen, die einen Fehler einräumen konnten. Das hätte eine Innenschau erfordert, die Mama Tawona gewissenhaft vermied. Wenn man die Regeln der Rechtschaffenheit wie ein Blockwart beobachten will, braucht man eine knallharte Wachsamkeit, die Einfühlungsvermögen und Nachdenklichkeit ausschließt. Meine Mutter wusste das, darum war es unwahrscheinlich, dass sie mit einer Entschuldigung rechnete.
Aber ich war noch klein und dachte, wir würden warten, bis auch Tawona sagte: „Es tut mir leid.“ Es lag doch auf der Hand, dass Tawona und ihre Mutter sich auch bei mir entschuldigen mussten. Aber das passierte nicht. Mama Tawona zog angesichts von Mummys Wut zwar den Schwanz ein, aber ihrer Meinung nach hatte sie nichts falsch gemacht – sie war einfach nur erwischt worden.
Mummy nahm meine Hand und ging mit mir nach Hause. Als wir die Tür hinter uns schlossen, stand Mama Tawona immer noch vor ihrer Wohnung – wie festgewurzelt und ausnahmsweise sprachlos.
Baba brachte uns Mädchen wie gewöhnlich zu Bett. Er erzählte uns eine Geschichte von einem Mädchen, das einen Stein fand, der sich in einen Stern verwandelte und über den Himmel flog, und ich war sehr müde, aber ich wusste, dass er mir damit etwas sagen wollte. Ich war dieses Mädchen, und ich war auch der Stein, der sich in einen Stern verwandelte. Und vielleicht war ich auch der Himmel. Er wollte mich wissen lassen, dass ich einen festen Platz in seinem Herzen hatte, dass ich der Mittelpunkt seines Universums war.
S.E.X.
Meine früheste Erinnerung an Sex hat mit Vergnügen und Voyeurismus zu tun. Ich war erst sechs Jahre alt, als ich einen Mann und eine Frau in flagranti ertappte, aber ich war alt genug, um zu wissen, dass die beiden mehr Spaß hatten, als erlaubt war. Das entnahm ich dem Glucksen der Frau. Ich wusste, dass sie eigentlich nicht glucksen durfte, weil sie nämlich gerade etwas tat, an dem nur Männer Gefallen finden sollten. Auch wenn ich nicht hätte sagen können, woher ich das wusste. Es hatte etwas Verbotenes an sich, wenn Männer einer Frau mit drallen Hüften, die an ihnen vorbeiging, nachschauten. Frauen mussten so tun, als würde ihnen das nicht auffallen. Und andere Männer mussten das als Aufforderung verstehen, ebenfalls zu schauen.
Ich war noch sehr jung, als mir klar wurde, dass Männer gern Dinge mit den Körpern der Frauen anstellten, wohingegen sich Frauen vor den Dingen schützen mussten, die Männer mochten. Frauen durften nicht lächeln und mussten unbeteiligt tun. Männer mochten Sex, Frauen waren verrückt nach Liebe.
Die Frauen in meinem Umfeld müssen über Männer und Sex und Vergnügen geredet haben, aber da solche Gespräche nichts für Kinderohren waren, bekam ich davon nichts mit. Ich durfte nur zuhören, wenn es um Liebe und Romantik ging. Ich sah die Blicke, die die Frauen austauschten, und spürte, dass es etwas gab, was sie nicht aussprachen, aber ich hörte sie nie über Sex reden.
Die Männer waren da ganz anders. Sie sprachen über alles, auch wenn wir Kinder dabei waren: über weiße Siedler und über Liebhaberinnen, die sie in den Wind geschossen, und über gefallene Frauen, denen sie aufgeholfen hatten. Meistens hatten sie dabei zu viel getrunken. Sie grinsten anzüglich und achteten nicht auf ihr Verhalten, außer die Frauen machten sie darauf aufmerksam, dass Kinder anwesend waren und dass sie gefälligst ruhig sein sollten.
***
Meine Schwestern und ich verbrachten viel Zeit im Haus von Aunty Tutu. Aunty Tutu war eine von Mummys besten Freundinnen. Sie hatte einen Sambier geheiratet, Uncle Ted. Die beiden hatten drei Kinder im Alter von meinen Schwestern und mir. Wir formten eine Bande, weniger lärmend als die Truppe von Burley Court, aber auch nur, weil wir nicht so viele waren.
Masuzyo, kurz Suzie, war mit ihren sieben Jahren eine kugelrunde Quelle der Weisheit. Sie tat zu allem ihre Meinung kund. Zudem ließ ihre Brille sie älter wirken, als sie war. Wongani war fünf, nur ein Jahr jünger als ich, aber auch sie schien viel älter zu sein: Sie war der Liebling ihrer Mutter. Tapelwa war erst vier, ein derart unbedeutendes Alter, dass er immer für sich bleiben musste – nicht so klein, dass er zu den Babys gehörte, aber auch noch nicht alt genug, um mit uns großen Mädchen mithalten zu können.
Mandla und Zeng blieben immer im Hintergrund, merkten nicht einmal, dass sie ausgeschlossen wurden. Wongani, Suzie und ich sprachen meistens über die neuesten Nachrichten und diskutierten über Episoden von Wonder Woman. Aunty Tutu war meistens unterwegs. Sie fuhr quer durch die Stadt und besuchte Leute, damit sie sich hinterher über deren Wohnungen, die Qualität ihres Gebäcks und die Sauberkeit ihres Personals auslassen konnte.
Trotz aller Nachteile war einer der größten Pluspunkte von Suzies und Wonganis Zuhause das Gästezimmer – gerade groß genug für eine beigefarbene Couch und ein Himmelbett. Beim Spielen lauschten wir immer, ob wir das Knirschen von Aunty Tutus Auto auf dem Kies der Auffahrt hören konnten. Wir wussten, wenn sie uns mit unseren dreckigen Füßen und unseren schmutzigen Fingernägeln im Gästezimmer erwischte, würde das ernste Folgen haben. Und jedes Mal waren wir so sehr ins Spiel vertieft, dass diejenige von uns, die Wache schieben sollte, alles um sich herum vergaß und zu spät bemerkte, dass Aunty Tutu bereits hinter ihr stand.
Eben hüpften wir noch herum, kicherten und landeten auf der Matratze, und im nächsten Moment riss uns Aunty Tutu den Arm auf den Rücken und flüsterte mit ihrem rauen Vibrato und einem seltsam melodischen und gleichzeitig bedrohlichen Timbre ins Ohr: „Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr hier drin nicht spielen dürft?!“
In den Sommerferien vor meinem siebten Geburtstag wurde unser Spaß im Gästezimmer zwei Wochen lang unterbrochen. Aunty Tutus Bruder und dessen deutsche Freundin kamen aus Berlin zu Besuch. Solange sie in der Stadt blieben, war unser De-facto-Spielplatz für uns tabu. Das bedeutete natürlich, dass wir den beiden anfangs feindselig gegenüberstanden. Lange bevor sie in einem klapprigen Taxi ankamen – von der Reise zerknautscht und nach Zigarettenrauch riechend –, hatten wir schon entschieden, dass wir sie nicht leiden konnten. Sie waren nicht unser Besuch. Sie waren nicht gekommen, um uns Gesellschaft zu leisten und uns zum Lachen zu bringen. Nein. Sie waren einfach nur eine zweiwöchige Unannehmlichkeit.
Der Onkel und Die Freundin waren natürlich sehr viel mehr als das, hauptsächlich weil sie keinem der Erwachsenen ähnlich waren, die wir bisher kannten. Sie entzündeten Räucherkerzen, was mich an das indische Restaurant in der Innenstadt erinnerte, das wir manchmal aufsuchten, wenn es etwas zu feiern gab.
Außerdem waren sie merkwürdig gekleidet – vor allem die Freundin. Während Mummy und Aunty Tutu ihre immer noch schlanken Körper in enge Polyesterhosen und kniehohe weiße Stiefel zwängten, trug die Freundin knöchellange, weit geschnittene Röcke und kurze Bolero-Blusen. Man konnte so gut wie immer ihren Bauch hervorblitzen sehen, was wir ebenso eklig wie faszinierend fanden. Die Frauen, die wir kannten, hätten niemals ihren Bauch zur Schau gestellt. Arme und Beine waren das eine, aber für Afrikanerinnen – selbst für jene, die den Stereotypen trotzten – war der Bauch etwas völlig anderes.
Der Onkel wirkte, ganz im Gegensatz zu unseren Vätern, schmuddelig. Babas zotteliger Bart und sein Afro hatten eine ganz besondere Ausstrahlung: eine kultivierte Verwahrlosung, die überlegt schien und daher einen eigenen Guerilla-Stil besaß. Nicht so beim Onkel. Der Onkel sah eindeutig zerlumpt aus. Seine Haare dünnten an manchen Stellen deutlich aus, wie bei dem Verrückten, der neben dem Theater in der Stadt obszön tanzte und jede Frau mit einem großen Hintern anmachte und weggeworfene Zeitungen einsammelte, als könne er die Zukunft vorhersagen, wenn er nur genug davon besaß.
Nicht nur, dass sie zerlumpt aussahen, der Onkel und die Freundin verbrachten auch sehr viel Zeit mit etwas, das sie „kritische Auseinandersetzung“ nannten. Wenn ein erschöpfter Erwachsener ihre hitzigen Debatten beenden wollte, dann erwiderte die Freundin mit ihrem gutturalen deutschen Akzent: „Du darfst keine Angst vor kritischen Auseinandersetzungen haben. Die Angst vor dem Fragen und Hinterfragen ist der Tod der Neugier, und das ist das Ende jeder Gesellschaft, die nach Freiheit strebt.“ Der Onkel sagte dann Sachen wie: „Was soll aus Afrika werden, wenn jene, die die Macht haben, zu kritischen intellektuellen Auseinandersetzungen nicht in der Lage sind?“ Dann schüttelte er den Kopf und seufzte.
Uncle Ted, Suzies und Wonganis Vater, war ziemlich wichtig, denn er arbeitete für die Fluggesellschaft ZambiaAirways. Anstatt ihn erst einmal ausruhen zu lassen, wenn er von der Arbeit kam, bestanden der Onkel und die Freundin darauf, mit ihm über den Antikolonialismus zu reden. Wir wussten alle, dass wir ins Freie gehen mussten, sobald Uncle Ted nach Hause kam, damit er sich regenerieren konnte. Die Besucher wussten das nicht. Also löcherten sie ihn mit Fragen und ignorierten unsere staunenden Blicke. Uncle Ted nahm dann die etwas ratlose und erschöpfte Haltung eines Mannes ein, der zu hart gearbeitet hatte, um nun noch nachdenken zu müssen. Er versuchte jedes Mal, das Gespräch auf ein Terrain zu lenken, das unproblematischer und vernünftiger war. Uncle Ted interessierte sich nicht für soziale Interaktionen. Selbst in seinen besten Zeiten überließ er Aunty Tutu das Reden und zog es vor, gedankenlos in sein Bier zu lächeln.
Der Onkel und die Freundin kümmerten sich nicht um seine Ratlosigkeit und seine Körpersprache. Sie waren so sehr darauf aus, ihre Meinung kundzutun, dass sie die Signale einfach übersahen. Jeden Abend hetzten sie ihn, stellten ihm Fragen, deren Antworten sie schon kannten, führten Gespräche, die sie bereits mit ihm geführt hatten. Ihr Lieblingsthema war die sambische Fluggesellschaft. ZambiaAirways war ein Prestigeprojekt, ein sinnloses, Geld verschlingendes Unternehmen, das dem nationalistischen Ego schmeicheln sollte. „Es ist doch pure Ironie“, lästerte der Onkel, „dass die Kräfte des Neokolonialismus sich jetzt die große nationalistische Agenda angeeignet haben.“ Die beiden argumentierten überspitzt und provokant und sagten Dinge wie: „All diese afrikanischen Präsidenten fliegen nach Jakarta und wieder zurück, nur um einen Konsens unter den Blockfreien zu finden. Aber damit wird die grundlegende Infrastruktur nicht aufgebaut! Sie stehlen den Armen dadurch nur das Einkommen, das ihnen schon längst zustehen würde.“
ZambiaAirways war der Stolz der Nation, und jedermann wusste, dass die Marketingabteilung ausschließlich Leute einstellte, die der afrikanischen Einheit positiv gegenüberstanden. Uncle Ted hatte keine Ahnung, worauf der Onkel und die Freundin mit ihrer Kritik an Nationalismus und Neokolonialismus abzielten. Und das war auch gut so, denn sonst wären seine Gefühle verletzt worden. Mit das Beste, wenn man für ZambiaAirways arbeitete, war nämlich der Umstand, dass die Angestellten nichts weiter vorweisen mussten als euphorische Vaterlandsliebe.





























