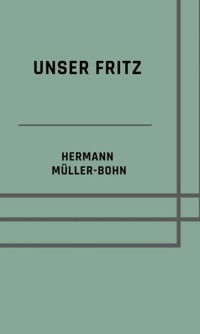
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der 18. Oktober ist in der deutschen Geschichte ein hochbedeutsamer Erinnerungstag. Am 18. Oktober 1813 war es, als auf den Schlachtfeldern von Leipzig im wilden Völkerringen die deutsche Freiheit wieder zurückerkämpft wurde, die der übermütige Korse fast zehn Jahre hindurch freventlich in den Staub getreten hatte. War auch dieser Tag nicht der letzte in jenem gewaltigen Kampfe, so bezeichnete er doch den Höhepunkt in demselben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unser Fritz,
Deutscher Kaiser und König von Preußen.
Hermann Müller-Bohn
1. Prolog.
9. März 1888.
10. März 1888.
15. Juni 1888.
2. Die Jugendjahre Kaiser Friedrichs.
3. Die Jünglingsjahre Kaiser Friedrichs.
4. Die Studienzeit des Kaisers und die Jugendjahre seiner „Vicky“.
5. Die Gründung des Heims.
6. Die Morgenröte der neuen Zeit.
7. Auf dem Wege zum Ruhme.
8. Der Sieger von Königgrätz.
9. Friedenwerke.
10. Auf dem Siegeswege zur deutschen Einheit.
11. Die Feuertaufe der deutschen Einheit.
12. Des Traumes Erfüllung.
13. Unser Fritz daheim.
14. Kaiser Friedrich und die deutsche Jugend.
15. Bei des Reiches Ausbau
16. Kaiser Friedrich als Freund der Musen.
17. Trübe Tage!
18. Sonnenschein nach den Stürmen.
19. Kaiser Friedrich als Volkserzieher.
20. Kaiser Friedrich und die Volkswohlfahrt.
21. Der Abend naht.
22. Zu kurz — das Glück!
.
„Du edler Fürst, erprobt in Kriegesstürmen, Ein Held auch, wenn es galt, den Frieden schirmen, Du bist an uns geknüpft mit tausend Banden, Du hast dein Volk, Dein Volk hat Dich verstanden. Und bist Du uns entrückt — Dein Geist lebt weiter! Dein liebes Bild wird ferner uns umschweben, Ein Stern der Zukunft uns’re Wege leiten — Du, „unser Fritz“, wirst ewiglich uns leben!“Hermann Müller-Bohn.
1. Prolog.
9. März 1888.
Im Märzeswehen war’s — in bangen Klagen Auf seinen Knieen lag das Vaterland: „Wie hast du unsern Fritz so hart geschlagen, Der krank nun weilet an des Südens Strand!“ — Doch blieb der Himmel unserm Flehn verschlossen, Und drohend zog ein andrer Sturm herauf, Der mit des Blitzes zündenden Geschossen Gen Norden nahm den unheilvollen Lauf — Da horch! ein Schmerzensschrei die Luft durchzittert: Die Kaisereiche hat der Sturm zersplittert!
Gefesselt noch von schwerer Krankheit Bande, Die mit des Herzens tiefem Leid gepaart, Kehrt Kaiser Friedrich heim in seine Lande — O, wie ergreifend diese Kaiserfahrt! Und zu der Trauerglocken dumpfem Klange, Dem hingeschiednen Heldengreis geweiht, Schwingt sich empor aus tiefstem Herzensdrange Manch still Gebet zum Herrn der Ewigkeit: „Du gabst ihn uns zurück, o güt’ger, weiser, Barmherz’ger Gott, nun schütze uns den Kaiser!“
10. März 1888.
Vor Luisens Denkmal.
Im stillen Park, umrauscht von schatt’gen Bäumen, Blinkt hell entgegen mir ein Marmorbild — Hier will ich sitzen, von der Vorzeit träumen, Und an Luisens Auge wundermild Soll mir der Zukunft Hoffnungsstrahl sich zünden: „Wie Du einst warst der Zukunft heller Stern, „Da wir die letzte Hoffnung sahen schwinden, Sei uns auch jetzt mit deinem Trost nicht fern! „Luise, teurer Schatten, gieb uns Kunde:„Wie heilen wir des Kaisers schwere Wunde?“ — Und siehe! Da gewinnt der Marmor Leben, Ein warmer Hauch durchdringt den toten Stein; Ich fühlte ihrer Stimme leises Beben Mir dringen bis ins tiefste Herz hinein: „Ich wall’ als Preußens Schutzgeist Euch zur Seite, „Ich hab’ mit Euch geteilt so Leid wie Lust; „Ich war Euch nahe oft im blut’gen Streite, „Ich flößte milden Trost Euch in die Brust, „Als Preußens Adler trauernd in den Lüften „Dem Kaiser folgte zu der Väter Grüften. „Und wollt Ihr wahren dem ein treu’ Gedenken, „Der friedlich nun bei seinen Eltern ruht,„Müßt alle Liebe Ihr dem Sohne schenken! „Und Eurer Thränen warme Liebesglut, „Als heilend’ Mittel hab’ ich sie ersehen, „Zu hemmen seiner Krankheit bösen Lauf: „Ich will da nit vor Gottes Throne stehen, „Daß milder Balsam blüh’ aus ihnen auf.„So wird mit Eurer Liebe mächt’gem Wallen„Ein heilend Öl in seine Wunde fallen.“
15. Juni 1888.
Umsonst!
Es hat sich Gott im Zorn von uns gewendet, Ob wir ihn flehten mit gerung’nen Händen, Ob ihm Luise wies des Volkes Thränen, Die er in heilend’ Balsam sollte wenden. Nun ist’s gescheh’n! Du mächt’ge, deutsche Eiche, Vom gift’gen Wurm im edlen Mark getroffen, Erschüttert stehen wir vor Deiner Bahre — Umsonst! Umsonst all’ unser Wünschen, Hoffen!
Ein Sonnenblick nur war’s, ein Frühlingsgrüßen, Ins Land der Zukunft nur ein trostreich’ Schauen; Schon sahn wir es mit froher Hoffnung sprießen — Da fiel der Todesreif auf Frühlingsauen! So auf der Sonnenhöhe Deines Glückes, Das Du Dir selber hast bereiten dürfen, Bewundert und geliebt von Deinem Volke — So mußtest Du des Todes Becher schlürfen.
Doch thatest Du’s mit edlem Duldermute, Und zu dem Lorbeer, der Dein Haupt umschlungen, Hast Du im Kampf auf Deinem Schmerzenslager Des Sieges höchste Palme Dir errungen. Kein Laut der Klage kam aus Deinem Munde; So durftest Du dem Sohn die Worte sagen, Die Du bewährt in mancher schweren Stunde:„O lerne, wie man leidet ohne Klagen!“
So hast Du bis zum letzten Augenblicke, Die Todesahnung schon im wunden Herzen, Gewirkt, geschafft zu Deines Volkes Glücke, Am Schreibtisch festgebannt in heißen Schmerzen. Dein edles Herz, es hat uns längst geschlagen, Eh’ Du zu kurzer Herrschaft Dich thatst schmücken, Wie hast Du Sorg’ und Müh’ für uns getragen, Nur hoffend, wünschend, ganz uns zu beglücken!
Auf schreit das Herz in namenlosem Wehe, Wenn unser Mund verstummt zu bitt’rer Klage, Wenn unser Aug’ nicht findet mehr der Thränen, Die es geweint an jenem schweren Tage. Was ließest Du den Traum, den wonnig süßen, Da er sich wollt’ zur Wirklichkeit gestalten, O Gott, so grausam in ein Nichts zerfließen? Wie unerforschlich ist Dein ew’ges Walten!
O schlafe sanft! Zu Deines Lorbeers Zweigen, Die Du erwarbst auf blut’gen Kriegesauen, Soll man ins Grab des Friedens Palme neigen, Den einst Du hütend, Du nun selbst darfst schauen, Soll man das schlichte, blaue Veilchen legen, Das schöne Sinnbild deutscher Volkestreue, Daß, die gefolgt Dir auf des Lebens Wegen, Dich auch in Deinem Grabe noch erfreue. — —
Nun fort den Schmerz, nicht ziemt es uns zu klagen, Wir wollen Deines Beispiels Wege wandeln. Die Zeit ist ernst und dunkel ihre Fragen — Du hast es uns gelehrt, im Schmerz zu handeln. Du bist uns nun entrückt, Dein Geist lebt weiter, Dein liebes Bild wird ferner uns umschweben, Ein Stern der Zukunft uns’re Wege leiten: Du, „Unser Fritz“, wirst ewiglich uns leben!
Hermann Müller-Bohn.
2. Die Jugendjahre Kaiser Friedrichs.
Lieblich hüpften, voll der Jugendfreude. Seine Tage hin im Rosenkleide. Und die Welt, die Welt war ihm so süß — Und so freundlich, so bezaubernd winkte Ihm die Zukunft, und so golden blinkte Ihm des Lebens Paradies.Schiller.
Der 18. Oktober ist in der deutschen Geschichte ein hochbedeutsamer Erinnerungstag. Am 18. Oktober 1813 war es, als auf den Schlachtfeldern von Leipzig im wilden Völkerringen die deutsche Freiheit wieder zurückerkämpft wurde, die der übermütige Korse fast zehn Jahre hindurch freventlich in den Staub getreten hatte. War auch dieser Tag nicht der letzte in jenem gewaltigen Kampfe, so bezeichnete er doch den Höhepunkt in demselben. Auf den Schlachtfeldern von Leipzig einten sich wieder deutsche Brüder, die unselige Schwäche dazu getrieben, die Waffen gegeneinander zu kehren; auf den Schlachtfeldern von Leipzig zeigten sich die segensreichen Folgen all der freiheitlichen Errungenschaften, die in der Aufhebung der Leibeigenschaft, der Städteordnung, der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht — jenen heilsamen Reformen eines Stein und eines Scharnhorst — ihren Ausgangspunkt hatten.
Es erschien wie ein glückverheißendes Vorzeichen für die Zukunft unseres deutschen Vaterlandes, daß derjenige Zweig der ruhmreichen Hohenzollerngeschlechts, dessen Bild in dem Herzen des deutschen Volkes neben dem des verewigten Heldenkaisers am tiefsten Wurzel geschlagen, an einem so denkwürdigen Tage geboren wurde. Der 18. Oktober 1813, der Tag von Leipzig, hat gezeigt, wie nur durch Einigkeit die Güter der Freiheit und des Rechts geschützt werden können; am 18. Oktober 1831 erblickte im Neuen Palais zu Potsdam der Mann das Licht der Welt, der an der Einigung und Ausgestaltung unseres jungen deutschen Reiches einen hervorragenden Anteil hat.
Schloß Friedrichskron
Unter all den zahlreichen Palästen und Prachtbauten, welche die herrliche Umgebung der Stadt Potsdam, „dies Idyll im Brandenburger Sande“, schmücken, ragt das in dem westlichen Teile des berühmten Parkes von Sanssouci gelegene Neue Palais (Dasselbe führt jetzt den Namen: Schloß Friedrichskron.) durch monumentale Schönheit und die wahrhaft fürstliche Pracht seines Innern ganz besonders hervor. Friedrich der Große hat diesen Bau in den Jahren 1763 — 1769 unmittelbar nach jenem gewaltigen Kriege errichten lassen, der Preußen mit einem Schlage aus der Reihe der Mittelstaaten erhob und es zu einem der angesehensten Reiche Europas machte. Das imposante, aus roten Backsteinen im holländischen Stile errichtete Gebäude mit seinen breiten Sandsteinterrassen, den mächtigen, kühn emporstrebenden korinthischen Säulen, den vornehmen, rings um das Dach laufenden Brustwehren, die ebenso wie die den prächtigen Bau einschließende Terrasse mit hunderten von Sandsteinfiguren geschmückt sind — alles das sollte ein beredtes Zeichen sein von Preußens erstarkter Macht und wachsender Größe. Die Schönheit in der Gliederung dieses Prachtbaues wird ganz besonders noch erhöht durch die zu beiden Seiten der Hauptfaçade befindlichen, von Kuppeln überragten Eckpavillons. Was aber dem ganzen Bau seinen monumentalen Charakter verleiht, das ist die mächtige, weithin sichtbare Kuppel, die sich in einer Höhe von 176 Fuß über dem hervorspringenden Mittelbau erhebt. Sie trägt die Standbilder der drei Grazien, welche eine Krone über sich halten. Grazie und Schönheit sollen die milden Begleiterinnen der Macht sein — das mag der leitende Gedanke des großen Königs gewesen sein. Der Volksmund hat allerdings für die drei Grazien eine andere, wenn nicht verbürgte, so doch nicht minder treffende Erklärung. Er machte aus den drei Frauengestalten die drei Gegnerinnen Friedrichs: Maria Theresia von Österreich, Kaiserin Elisabeth von Rußland und die Marquise von Pompadour, durch deren Niederlagen die Krone des Preußenkönigs zu neuem Glanze und zu erhöhter Macht gelangt war.
Dem glänzenden Äußeren dieses Palastes stellt sich die innere Ausstattung würdig zur Seite. Die mit wahrhaft königlicher Pracht eingerichteten Säle und Zimmer sind ein Sammelplatz für Statuen, Büsten und Gemälde, die teils in sehr wertvollen Originalen, teils in künstlerisch vollendeten Nachbildungen den Geschmack mehrerer Jahrhunderte repräsentieren. Eine große Anzahl der Gemächer gehört, wie der ganze Bau, schon seit langer Zeit zu den Stätten, welche bereits geschichtlichen Wert haben.
Dieses prächtige Schloß, um dessen Mauern und Gärten bereits die Sage ihren lustigen Schleier gewoben, ist das Geburtshaus Kaiser Friedrichs.
Das Geburtszimmer des Kaisers. Nach einer Photographie.
Es war gegen 10 ½ Uhr am Vormittage jenes denkwürdigen 18. Oktober, als sich die Thür eines der Flügel öffnete, vor welchem sich eine zahlreiche Menschenmenge angesammelt hatte, und der laute Ruf erscholl: „Ein Prinz!“ Der damalige Oberst von Auerswald wurde sofort an den König abgesandt, um ihm die frohe Kunde von der Geburt eines Enkels zu überbringen.
König Friedrich Wilhelm III. war im Sommer des Jahres 1831, als zum ersten Mal in so furchtbarer Weise die Choleraepidemie in Berlin auftrat, mit dem königlichen Hof nach Charlottenburg übergesiedelt, während die übrigen Prinzen und Prinzessinnen in Sanssouci geblieben waren, denn in jener Zeit glaubte man, die bis dahin noch völlig unbekannte, aus Asien herübergekommene Krankheit durch eine möglichst strenge Absperrung voneinander bannen zu können. So mußten denn die in Potsdam zurückgebliebenen Mitglieder des königlichen Hauses, zu denen auch die Gemahlin des Prinzen Wilhelm von Preußen gehörte, hier einen förmlichen Belagerungszustand über sich ergehen lassen, und so groß war damals die Furcht vor der Ansteckung, daß sämtliche Zugänge zu den königlichen Schlössern und den sie umgebenden Gärten militärisch besetzt waren, und Lebensmittel und Briefe nur in gehörig desinfiziertem Zustande mittelst Glasstäbe in Empfang genommen werden durften.
Da König Friedrich Wilhelm III. an jenem Tage gerade in Potsdam anwesend war, so konnte er noch an demselben Tage im Palais erscheinen, um seinen Glückwunsch zu dem neugeborenen Enkel persönlich darzubringen. Die frohe Kunde von der Geburt eines Prinzen löste in der Umgebung von Potsdam die bange Spannung, in welcher die entsetzliche Cholerafurcht die Gemüter bisher befangen gehalten, und die Freudenfeuer, welche auf den Bergen der Umgebung von Potsdam zur Erinnerung an die gewaltige Völkerschlacht bei Leipzig am Abende jenes Tages aufloderten, sollten nun in Zukunft eine doppelt frohe Bedeutung erlangen.
Daß man es in dem Neugeborenen, der ein gar kräftiges Prinzlein war, gleich mit einem angehenden Soldaten zu thun hatte, darauf deuteten viele der kleinen Erlebnisse hin, die ihm in den nächsten Tagen begegnen sollten. Die ersten musikalischen Töne, die an seine Wiege drangen, waren die Klänge eines militärischen Ständchens, welches der Prinzessin-Mutter und dem neugeborenen Prinzen seitens der Offiziere des Lehr-Infanterie-Bataillons dargebracht wurde. Da das Bataillon in diesem Jahre nicht seine Winter-Quartiere aufgesucht hatte, wie es sonst um diese Zeit bereits der Fall war, sondern in seinen Sommer-Quartieren, den sogenannten Kommuns, verblieben war, so kam der kleine Prinz auch gleich unter militärische Bewachung, und, als wollte er diese Zugehörigkeit zu seinen „Kameraden“ auch äußerlich zu erkennen geben, bedeckte sein Köpfchen, gleich als ihn die Kinderfrau zum ersten Mal ins Freie trug, eine kleine Feldmütze, und gegen den zudringlichen Wind, der sich diesen jüngsten preußischen Rekruten gern etwas genauer angesehen hätte, schützte ihn ein allerliebster kleiner Soldatenmantel, welcher ebenso wie die Mütze die Abzeichen des 1. Garderegiments zu Fuß trug.
Am 13. November, einem Sonntage, erhielt der Prinz im Neuen Palais die Taufe; es wurden ihm in derselben die Namen Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl beigelegt. Ein hoher, glänzender Kreis von Taufzeugen umstand das Becken, vor welchem Bischof Eylert die feierliche Handlung vollzog. An der Spitze der Zeugen standen: König Friedrich Wilhelm III. und seine zweite Gemahlin, die Fürstin von Liegnitz, der Kronprinz, der nachmalige König Friedrich Wilhelm IV., und die Kronprinzessin, der Prinz und die Prinzessin Karl.
Von den anwesenden Zeugen verdient der Herzog Karl von Mecklenburg-Strelitz, der jüngste Bruder der edlen Königin Luise, noch einer ganz besonderen Erwähnung. Auch noch ein Zeuge der großen Zeit, der Prinz August, letzter Neffe des „alten Fritz“, war unter den Paten und hörte mit Vergnügen das laute Schreien des „jungen Fritz“; ja einige der vornehmen Paten vermeinten in scherzender Weise in dieser ersten Äußerung des kleinen Weltbürgers bereits das kräftige Kommandowort des späteren Feldherrn zu vernehmen. Zu den abwesenden Zeugen gehörte eine große Reihe der glänzendsten Namen unter den europäischen Fürsten und Fürstinnen, so der Schwiegersohn Friedrich Wilhelms III., der Kaiser Nikolaus von Rußland, der Kaiser Franz von Österreich, die jüngere Schwester des Königs, Königin Wilhelmine der Niederlande, und viele andere Prinzen und Prinzessinnen deutscher und europäischer Fürstenhöfe.
Die erste leibliche Pflege wurde dem kleinen Prinzen durch die Kinderpflegerinnen Fräulein Rösener und Fräulein Weber zu teil, während die Erziehung in der zartesten Jugend der Frau Godet und der Frau von Klausewitz anvertraut war. Unter dieser fürsorglichen Leitung und unter der Obhut der liebenden Mutter entfalteten sich die geistigen und körperlichen Anlagen des kräftigen Knaben in der herrlichsten Weise. In den Jahren 1833 und 1836 unternahm die fürstliche Mutter mit dem kleinen Prinzen eine Reise nach Weimar, um ihre Eltern teilnehmen zu lassen an ihrem Mutterglücke. Zurückgekehrt von der letzten dieser beiden Reisen, dachte man bereits daran, die ersten Keime des Wissens in die junge, empfängliche Seele des Prinzen zu pflanzen, und zu einer Zeit, wo Bürgerkinder sich noch vollständig der goldenen Kinderfreiheit erfreuen, rechnete und zeichnete der kleine Prinz schon fleißig und trieb tapfer deutsche und lateinische Grammatik. Seine Lehrer waren: im Schreiben La Pierre, im Deutschen und Rechnen der Oberlehrer Ernst, im Zeichnen der berühmte Professor Strack und der Maler Asmus, und im Lateinischen der Lehrer Heller. Bei alledem wuchs die körperliche und geistige Kraft unseres kleinen Helden ganz vortrefflich und sein lebendiges, alle Dinge schnell und glücklich erfassendes Wesen, sein ausgezeichnetes Gedächtnis, sein reines, kindliches Gemüt berechtigten zu den schönsten Erwartungen und gewannen ihm schon damals die Herzen aller derer, die mit ihm in Berührung kamen.
Aus jener Zeit der zartesten Jugend, der ersten fröhlichen Kinderspiele, sind leider nur wenige Züge des geliebten Herrschers in das Volk gedrungen. Eine rührende Episode, die dadurch nicht an Eindruck verliert, daß sie uns erst durch eine fremde Zunge zugänglich gemacht worden ist, wollen wir aber nicht unerwähnt lassen, weil sie uns das tiefe, echt religiöse Gemüt unseres Helden schon damals in den herrlichsten Anlagen zeigt. In den von Charles Marelle herausgegebenen „Poésies enfantines et amusantes“ ist folgende Kinderfabel abgedruckt, deren Held niemand anders war, als der nachmalige Kaiser Friedrich. Der Inhalt dieser Fabel beruht auf einer beglaubigten Mitteilung des berühmten Theologen Tholuck; sie lautet im Urtext:
Le pieux petit prince.
Mére, j’ai du chagrin, disait un petit prince, Qui devait conquérir un jour mainte province, Mére, je ne retrouve pas Deux cavaliers de mes soldats. Je voudrais bien le dire au bon Dieu, mais je n’ose. Je les retrouverais cependant sʻil voulait. Mére, crois-tu que le bon Dieu permet Qu’on le prie aussi pour si peu de chose?
Et sur son cœur pressant l’enfant pieux La princesse, sa noble mére, Lui dit: Oui, cher petit, dis à Dieu tous tes vœux, Comme un enfant, qui dit tout à son père. Dieu ne dédaigne rien d’un cœur pur et sincère, Et ne voulût-il pas pourtant comme tu veux, Il agréera néanmoins ta prière, Et pour ta confiance il t’en aimera mieux.
In freier Übersetzung:
Der fromme kleine Prinz.
Betrübt sprach einst ein kleiner Prinz — Der später gewann so manche Provinz —: „Mutter, ich finde nimmermehr Zwei bleierne Reiter aus meinem Heer. Ich möcht’ es dem lieben Gott wohl klagen, Doch weiß ich nicht, ob ich’s ihm darf sagen? Am Ende meint der liebe Gott, Man treibe mit ihm gar seinen Spott?“
Gerührt umarmt das liebe Kind Die edle Fürstin, hochgesinnt: „Ja, klag’ ihm alles, was dich drückt, Wie für ein braves Kind sich’s schickt. Was aus dem reinen Herzen kommt, Das wendet Er, daß es dir frommt. Gott schenkt der kleinsten Bitt’ Gehör Und liebt dich fortan nur noch mehr.“
Aus der Zeit des ersten Unterrichts stammt auch ein Glückwunschschreiben des kleinen Prinzen für seinen königlichen Großvater, Friedrich Wilhelm III., welches als ein Heiligtum auf der Pfaueninsel aufbewahrt wird. Es ist in französischer Sprache abgefaßt, weil der kleine Enkel wohl in kindlichem Stolze dem geliebten Großvater, der hier auf der Pfaueninsel zum letzten Mal seinen Geburtstag verlebte, gleichzeitig seine Fortschritte in dieser Sprache beweisen wollte: „Je vous félicite, mon cher Grand-Papa, pour votre Fête et je souhaite de tout mon cœur que vous vous portiez toujours trés-bien. Le 8 août 1838. Fritz“ (Ich gratuliere Dir, lieber Großpapa, zu Deinem Geburtstage und wünsche von ganzem Herzen, daß es Dir immer recht wohl ergehen möge.)
Um diese Zeit — es war am 3. Dezember 1838 — wurde das prinzliche Elternpaar noch durch die Geburt eines Töchterleins erfreut, das zu Ehren der unvergeßlichen Königin den Namen Luise erhielt.
Daß neben der geistigen Ausbildung des jungen Prinzen auch die militärisch-praktische nicht vernachlässigt wurde, sondern in hervorragender Weise zur Geltung kam, ist bei einem jungen Hohenzoller wohl selbstverständlich. Da der ganze spätere Beruf derselben schon von vornherein als ein militärischer aufgefaßt wird, so muß die Erziehung nach dieser Seite hin schon so früh wie möglich beginnen. Es ist daher eine alte Sitte in unserem preußischen Herrscherhause, die jungen Prinzen schon in ihrem Knabenalter in des „Königs Rock“ zu stecken. Sie sollen dadurch von Jugend auf an militärische Einfachheit und an das Bewußtsein gewöhnt werden, sich als Zugehörige zu dem großen militärischen Ganzen zu fühlen. Sie sollen alles das, was sie später als Befehlshaber und Feldherren von dem Soldaten fordern, in ernster Arbeit selber erprobt und selber erlebt haben, und da kein Prinz als solcher auch schon ein geborener Feldherr ist und man eben Selbsterlebtes und Selbsterarbeitetes am besten zu beurteilen vermag, so werden die jungen Prinzen von frühester Jugend angehalten, die kleinsten Einzelheiten in dem militärischen Dienst selbständig kennen und ausführen zu lernen. Auf diese Weise erhalten sie einen gründlichen Einblick in die unbedeutendsten Teile des ungeheuren militärischen Getriebes und die Überzeugung, daß, wenn sie dereinst befehlen wollen, sie zuvor selbst gelernt haben müssen, zu gehorchen, daß in jedem Gemeinwesen, im höchsten wie im niedrigsten, eine Über- und Unterordnung sein muß, drängt sich ihnen durch diese Art der Erziehung gewissermaßen von selbst auf.
Wenn man von dem alten Unteroffizier Friedrich des Großen erzählt, daß derselbe später, als er schon zu den Invaliden zählte, jedesmal, wenn er von einem neuen Siege seines Königs Kunde erhielt, voll Entzücken ausrief: „Das hat er von mir gelernt!“ — so mag das im ersten Augenblicke etwas wunderlich klingen. Aber der Alte hatte dabei nichts weiter als den alten preußischen Grundsatz ausgesprochen, daß es eben nur die Schule von unten auf ist, die den tüchtigen Feldherrn macht, und so haben es denn unsere Prinzen immer als eine Ehrenpflicht angesehen, sich freiwillig unterzuordnen und sich eins zu fühlen mit jedem einzelnen Glied des großen gewaltigen Heerkörpers; sie haben eine Ehre darin gesucht, sich nicht allein da hervorzuthun, wo es galt, um die höchste Palme des Ruhmes zu ringen, sondern auch bei solchen Gelegenheiten, wo es darauf ankam, zu zeigen, daß der preußische Prinz nicht nach den Grundsätzen einer verweichlichenden Rücksichtnahme erzogen sei, sondern wie jeder andere preußische Soldat Hunger und Durst und die Strapazen langer, aufreibender Märsche und ermüdender Ritte mit Ausdauer und ohne Murren zu ertragen weiß. Und dieser gründlichen, von keiner zarten Schonung irgendwie beeinflußten militärischen Durchbildung unserer Prinzen und ihrem vorbildlichen Verhalten im Dienste ist denn auch zu einem guten Teile die treffliche Manneszucht des deutschen Soldaten zuzuschreiben, der das Bewußtsein hat, daß seine Führer die Freuden und Leiden, die angenehmen und schweren Stunden eines Feldzuges getreulich mit ihm teilen.
Von den eben entwickelten Gesichtspunkten aus betrachtete denn auch der Vater unseres Prinzen den militärischen Unterricht seines Sohnes, und so dachte er denn daran, nachdem Prinz Friedrich Wilhelm sein 6. Lebensjahr zurückgelegt hatte, mit der Vorbereitung auf den militärischen Dienst nach und nach den Anfang zu machen.
Das freundliche, an der Havel gelegene Dorf Paretz bei Potsdam war bekanntlich ein Lieblingsaufenthalt Friedrich Wilhelms III. auch in seinen letzten Lebensjahren. Schöne wehmütige Erinnerungen an die glücklichsten Stunden seines Lebens wurden hier wieder in ihm lebendig, Erinnerungen, welche sich nur immer und immer wieder an den einen unvergeßlichen Namen — Luise! knüpften.
Wenn der König dann auf längere Zeit in seinem lieben Paretz weilte, nahm sein Enkel Friedrich Wilhelm oft die Gelegenheit wahr, zum Besuch des königlichen Großvaters herüberzukommen, und der alternde König, der in dem Aufblühen des frischen, geweckten Knaben noch einmal in seinen Erinnerungen die Jugend seiner Söhne mit durchlebte, suchte dem Enkel den Aufenthalt hier so angenehm wie möglich zu machen. An den kindlichen soldatischen Spielen, die er ihm zu Liebe arrangierte, und die nach der Meinung des lebhaften, phantasievollen Knaben einen furchtbar kriegerischen Ernst hatten, nahm bald darauf auch der Vetter des Prinzen — Prinz Friedrich Karl — teil. Diese kriegerischen Scherze erweiterten sich bald zu dem Umfange, daß die ganze Dorfjugend zu denselben herangezogen wurde, die nun, mit kleinen Kanonen ausgerüstet, unter dem Oberbefehle der beiden Prinzen, sich wohl so wichtig vorgekommen sein mag, als hänge das Schicksal des ganzen Europa von ihren kleinen Heldenthaten ab.
Damals in der überschäumenden Jugendlust der sorgenlosen Knabenjahre ahnten die beiden nicht die ernste Vorbedeutung, die diese fröhlichen Kinderspiele für sie haben sollten. Einige Jahrzehnte später — und die beiden Prinzen sollten an ganz anderen Spielen, auf einem ungleich ernsteren Terrain teilnehmen und, im Dienste des Vaterlandes gemeinsam wirkend, haben sich die alten Spielkameraden oft im Donner blutiger Schlachten zusammengefunden. —
Kaiser Friedrich als Knabe. Nach einem Gemälde von Professor Julius Schoppe.
Jene zunächst nur scherzhaft betriebenen kriegerischen Spiele sollten indes bald ernsteren militärischen Übungen Platz machen. Unteroffizier Bludau vom 2. Garde-Regiment war dazu ausersehen, dem Prinzen den ersten Exerzierunterricht zu erteilen. Zu seiner Ergänzung wurden dann die Unteroffiziere Göring und Kubon von der Leib-Kompagnie des 1. Garde-Regiments zu Fuß herangezogen, die bald darauf wieder — um die Übungen ganz lückenlos zu gestalten — den Unteroffizieren Bantow und Tietz vom 2. Garde-Regiment zu Fuß Platz machen mußten. Der Prinz trug bei diesen Übungen eine kleine Dienstjacke, die ebenso wie der Mantel die Abzeichen des Garde-Landwehr-Bataillons zu Stettin zeigte. Schon aus der Heranziehung so verschiedenartiger Lehrer ist zu ersehen, daß dem kleinen Prinzen in Bezug auf das „Drillen“ — wie dieser erste Exerzierunterricht in der Kunstsprache der Rekruten heißt — durchaus nichts geschenkt wurde, und damit der kleine Soldat als zukünftiger Feldherr sich möglichst bald den „weiten Blick“ aneigne, wohnte er im Jahre 1837 einem Korps-Manöver auf dem Tempelhofer Felde bei. Der Anblick dieses glänzenden und bewegten Schauspiels hatte dem lebhaften Knaben große Freude verursacht. Im Winter 1838 — 1839 wurde der Exerzierunterricht auf Wunsch der Prinzessin-Mutter mit ganz besonderem Eifer betrieben, galt es doch eine ganz besondere Überraschung für den Vater. Der Unteroffizier Bludau war als erster Waffenlehrer des Prinzen dazu ausersehen, zu möglichst vollkommener Erreichung des eben erwähnten Zweckes noch einmal alle Übungen gründlich durchzuarbeiten, und um den Unterricht recht anregend zu gestalten und den Eifer des Prinzen zu erhöhen, wurden ihm zu diesen Waffenübungen noch zwei Kameraden, Rudolf von Zastrow und Graf von Königsmark, beigegeben, von denen der erstere, wie wir unten sehen werden, bald noch in nähere Beziehungen zu dem Prinzen treten sollte. Es wurde nun mit verdoppeltem Feuereifer geübt, und die Prinzessin-Mutter hatte denn auch die Freude, zum Geburtstage ihres Gemahls, am 22. März, ihren Sohn demselben als ausgebildeten Rekruten vorstellen zu können, der zur höchsten Freude seines Vaters mit echt soldatischer Strammheit demselben die Meldung machte: „Rapport von der Potsdamer Thorwache. Auf Wache und Posten nichts Neues! Sie ist stark 1 Unteroffizier, 1 Spielmann und 78 Grenadiere.“ Auf diese Meldung folgten dann die militärischen Exerzitien, die Unteroffizier Bludau nunmehr seinen Zögling vorführen ließ, und die so sicher und ohne Fehler vor sich gingen, daß es eine Freude war. Der kleine Soldat bediente sich bei dieser Gelegenheit eines allerliebsten, ihm von dem Großvater geschenkten Gewehres; er hatte das Lederzeug vorschriftsmäßig umgehängt, und der Tschako, der keck auf dem Haupte saß, stand dem hübschen, frischen Gesichtchen ganz vortrefflich.
Die Augen des prinzlichen Vaters leuchteten vor Freude bei dem Anblick des hübschen und kräftigen jungen Sohnes, und der Prinz hat es später wiederholt ausgesprochen, daß von allen Rekrutenvorstellungen keine sein soldatisches Herz so nahe berührt habe wie die eben geschilderte. Er war denn auch mit seinem Lobe dem jungen Rekruten gegenüber nicht karg.
In diese Zeit, die trotz aller wissenschaftlichen und militärischen Übungen doch bisher immer noch von der Sonne der frohen, sorgenlosen Kinderzeit durchleuchtet war, fallen drei Ereignisse, die nicht allein für das Land von weittragender Bedeutung waren, sondern auch den jungen Prinzen zum ersten Mal mit dem tiefen Ernst des Lebens berührten. Es war am 1. Juni 1840, als vor dem Königlichen Palais in Berlin Unter den Linden die Grundsteinlegung zu dem Reiterdenkmal Friedrichs des Großen stattfand, das, von Rauchs Meisterhand modelliert, uns den großen König inmitten der bedeutendsten Männer seiner Zeit vor Augen führt. Unter den Teilnehmern an jener bedeutungsvollen Feier befand sich auch Prinz Friedrich Wilhelm. Noch einmal sollten hier die glorreichen Überlieferungen altpreußischen Ruhmes in der glanzvollen Feier ihren Ausdruck finden, ehe die neue Zeit, die sich bereits allenthalben machtvoll ankündete, ihren siegreichen Einzug in die Lande hielt, und während hier, der Grundsteingrube gegenüber, an jenem Tage ein aufstrebender junger Hohenzollernsproß stand, der dazu berufen war, die neue Zeit mit herauf führen zu helfen, senkten sich dort drüben die welken Blätter eines von dem Stamme der mächtigen Hohenzollerneiche absterbenden Zweiges, denn dort hinter den Fenstern seines Palais saß, alt und lebensmüde, der vielgeprüfte König Friedrich Wilhelm III. und beobachtete, seinen letzten Stunden entgegensehend, von hier aus die Feierlichkeit.
Die Zahl 40 ist für das Hohenzollernhaus immer bedeutungsvoll gewesen. Im Jahre 1440 starb Friedrich I., der Begründer und Ahnherr der ruhmreichen Hohenzollernherrschaft. 1640, genau zwei Jahrhunderte später, ging Kurfürst Georg Wilhelm zur ewigen Ruhe ein. Mit dem Regierungsantritt seines Sohnes, des nachmaligen Großen Kurfürsten, begann ein neuer, ruhmreicher Zeitabschnitt in der preußisch-brandenburgischen Geschichte. Hundert Jahre später, am 31. Mai 1740, starb der treffliche Friedrich Wilhelm I., der Begründer der inneren Macht Preußens, und mit dem Regierungsantritt seines großen Sohnes Friedrich II. beginnt wiederum eine neue Epoche in der Geschichte des preußischen Staates.
Am 7. Juni 1840, 6 Tage nach der vorerwähnten Grundsteinlegung, schloß Friedrich Wilhelm III. für immer die müden Augen. Prinz Friedrich Wilhelm hatte an dem Sterbebette des königlichen Großvaters gestanden, und jene Stunde hatte einen tiefernsten Eindruck auf das junge Gemüt des Prinzen gemacht, welches der Schmerz bisher noch nicht berührt hatte. Das ganze Volk nahm teil an dieser Trauer, und wenn auch mancher still gehegte Wunsch, manche nationale Hoffnung des Volkes nicht erfüllt worden war, so war doch der König durch das gemeinsam mit diesem Volke durchlebte Unglück und durch seine Milde und patriarchalische Einfachheit dem Herzen und Bewußtsein des Volkes teuer geworden.
In dem Trauergefolge auf dem Wege zum Dome, wo vier Tage nach dem Tode die feierliche Einsegnung der Leiche stattfand, schritt auch Prinz Friedrich Wilhelm, ihm zur Seite sein fürstlicher Vater, der von nun an „Prinz von Preußen“ hieß, und der Großfürst Thronfolger Alexander von Rußland. — In mitternächtlicher Stunde bewegte sich ein schwarzer Leichenzug auf Charlottenburg zu.
Wie summt es in den Straßen und ist doch Mitternacht! Des guten Königs Leiche wird heut’ zur Ruh’ gebracht. Ich meint’, er gebot, das sollte in tiefer Stille gescheh’n? Nun ist wie am lichten Tage das ganze Volk zu seh’n!
Das Volk war nicht gerufen, es kam von selbst heran, Es sprang vom Ruhelager manch arbeitsmüder Mann! Er läßt bei der letzten Ehre den König nicht allein, Er giebt ihm das Geleite im düstern Mondenschein.
Da steht das Volk vom Dome bis hin zum Siegesthor, Bis an das Thor und weiter, noch mehr, noch mehr davor! Den ganzen Weg erfüllt es im meilengroßen Wald, Der, wie von Bienenschwärmen, von Menschenstimmen hallt.
Und hinter dem Walde steht es noch bis zur andern Stadt Und durch die Stadt und endet fern um die Grabesstatt. Das Grab ist tief im Garten, da ruht die Königin schon: Seitdem sie ruht, sind manche, ja manche Zeiten entfloh’n!(A. Kopisch.)
Das Mausoleum in Charlottenburg.
Hier im Mausoleum unter den schattigen Bäumen des alten Schloßgartens, wo der „gute Engel für die gute Sache“, die unvergeßliche Luise schon längst ruhte, wurde der entschlafene König beigesetzt, auch im Tode vereint mit derjenigen, die der leuchtende Stern seines Lebens gewesen war in dunkler, dunkler Zeit.
Auf die Trauerfeierlichkeiten für den heimgegangenen König folgte eine Zeit der Stille und Zurückgezogenheit am preußischen Hofe. Erst nachdem Friedrich Wilhelm IV. den Thron seiner Väter bestiegen, brachten die Krönungsfeierlichkeiten mit ihrem äußeren Glanz wieder Leben in die Kreise der königlichen Familie. Den Huldigungsfeierlichkeiten zu Ehren der Thronbesteigung seines königlichen Oheims wohnte auch der junge Prinz in seiner schlichten Militärdienstjacke bei. Dieselbe sollte aber bald einem stolzeren Kleide Platz machen, denn an seinem 10. Geburtstage, am 18. Oktober 1841, sollte ihm die hohe Freude zu teil werden, das Ziel seiner sehnlichsten Wünsche und Hoffnungen während der letzten Monate und Wochen erreicht zu sehen; an jenem Tage trat er mit dem Patent als Sekonde-Lieutenant in die Leibkompagnie des 1. Garde-Regiments zu Fuß ein. Es war ein bedeutungsvoller Augenblick, als König Friedrich Wilhelm IV. am nächstfolgenden Sonntage seinen heute zum ersten Mal mit dem Schwarzen Adlerorden geschmückten Neffen dem Regiment vorstellte und vor dem versammelten Offizier-Korps folgende Worte an ihn richtete: „Du bist zwar noch sehr klein, Fritz, aber lerne diese Herren nur kennen, damit Du sie einst übersehen kannst, wie sie gegenwärtig Dich noch übersehen.“
Und Prinz Friedrich Wilhelm hat sich diese Worte zu Herzen genommen. Trotz seines jugendlichen Alters wußte sein früh gereifter Geist schon jetzt die Bedeutung dieses Augenblicks zu ermessen, in welchem er in die preußische Armee eintrat, deren ruhmreiche Thaten sein kindliches Herz bereits in den Geschichtsstunden mit Begeisterung und Bewunderung erfüllt hatten. Die erste Staffel auf der Leiter der militärischen Rangstellungen war erreicht, und mit jenem Pflichteifer, der den Prinzen schon seit seiner frühesten Kindheit auszeichnete, suchte er nun, eingedenk der Worte seines königlichen Oheims, die eben erlangte Würde in ernster Arbeit und gewissenhafter Vorbereitung für seinen künftigen hohen Beruf zu verdienen. Die Fortschritte, die denn auch der junge Sekonde-Lieutenant unter der trefflichen Leitung des Obersten von Unruh, der ihm bereits seit dem 1. Januar 1840 als militärischer Erzieher beigegeben war, sowohl in der praktischen, als auch in der theoretischen Seite seiner militärischen Ausbildung machte, erregten die höchste Zufriedenheit seines Vaters und seines königlichen Oheims.
Aber nicht bloß den späteren Soldaten, den künftigen Feldherrn wollten die Eltern in dem Sohne vorgebildet wissen; bei der kinderlosen Ehe Friedrich Wilhelms IV. lag die Möglichkeit sehr nahe, daß Prinz Friedrich Wilhelm dereinst berufen sein würde, den Thron seiner Väter zu besteigen. Es galt also um so mehr, seine Neigungen und Anlagen für die Güter des Friedens zu entwickeln, seinen Geist schon frühzeitig auf die hohen Errungenschaften der Wissenschaft und der Technik zu richten, seinen Blick zu schärfen und seine Sorge zu erwecken für die Entwickelung des Handels und Gewerbes, der Industrie und der Landwirtschaft, sein Gemüt empfänglich zu machen für die Schönheiten der Kunst und des Kunstgewerbes. Besonders war es die hochbegabte Mutter, die nach dieser Richtung hin anregend und aufmunternd auf den Sohn einwirkte.
Die allertüchtigsten Kräfte wurden zu diesem Zwecke herangezogen. An seiner wissenschaftlichen Ausbildung arbeitete zunächst der Prediger Godet, der Sohn der vorgenannten Erzieherin. In seinem 13. Lebensjahre erhielt der Prinz zum Erzieher den nachmals so berühmt gewordenen Altertumsforscher und Freund Emanuel Geibels, den Professor Dr. Ernst Curtius, dessen Schriften in der wissenschaftlichen Welt bereits gerechtes Aufsehen erregt hatten. Dieser ausgezeichnete Gelehrte blieb ihm im unmittelbaren persönlichen Verkehr ein Lehrer, Freund und Berater bis zur Beendigung seines ersten Studiensemesters. Er stand auch später, nachdem er längst zu seiner akademischen Wirksamkeit zurückgekehrt und der Prinz als Kronprinz des deutschen Reiches auf der Bahn des Ruhmes immer höher hinaufgestiegen war, noch in innigster geistiger Gemeinschaft mit ihm, und manches Samenkorn, das der für die Ideale klassischer Kunst begeisterte Gelehrte dem empfänglichen Herzen des Prinzen Friedrich Wilhelm eingepflanzt, hat sich später zur schönsten Frucht entwickelt. Die Ausgrabungen von Olympia, welche die großartigen Schöpfungen der alten klassischen Kunst in Griechenland der erstaunten und bewundernden Nachwelt wieder vor Augen führen, und für welche der nachmalige deutsche Kronprinz in edelster Kunstbegeisterung so anregend und fördernd gewirkt, bieten ein unvergängliches Beispiel hierfür. — Den Religionsunterricht leitete der Rektor Bormann, der später durch seine umfassende Wirksamkeit auf dem Unterrichtsgebiete ebenfalls eine bekannte Persönlichkeit geworden ist. Für die mathematischen Fächer war der Professor Schellbach herangezogen. Sprachstudien, namentlich im Englischen und Französischen, wurden mit besonderem Eifer betrieben. Im Französischen unterrichteten Caillaud, Ackermann und Bartholmés, im Englischen Solly und Frau Görner. Neben dieser Pflege des rein Wissenschaftlichen wurde auch die ästhetische Bildung nicht vernachlässigt. So waren es namentlich Musikstudien, die mit Lust und Liebe betrieben wurden. Der Lehrer Aghte und der treffliche Musikdirektor Taubert waren in diesen Fächern die bewährten Lehrmeister. Den Gesangunterricht leiteten Nehrlich und der als Komponist rühmlichst bekannt gewordene Reichardt. Wie aber die alten Griechen eine harmonische Ausbildung aller geistigen und körperlichen Kräfte erstrebten, so sorgten die fürstlichen Eltern dafür, daß auch dem jugendlichen Körper, an den bei so umfassenden Studien, wie leicht ersichtlich, große Anforderungen gestellt wurden, sein Recht werde. Es wurde fleißig geturnt und auf dem Fechtboden der Schläger geschwungen; selbst das Tanzen wurde nicht vernachlässigt, und Meister Taglioni vom königlichen Ballet war hierin der Lehrer.
Es besteht eine alte, schöne Sitte in unserem Herrscherhause, daß jeder junge Prinz sich eine Zeitlang praktisch mit einem Handwerk beschäftigen muß. Die segensreichen Wirkungen dieses löblichen Gebrauchs liegen auf der Hand. Der junge Prinz soll durch eine solche Beschäftigung vor der Geringschätzung des Handwerks, einer der Hauptsäulen des Staatslebens, bewahrt werden; er soll sehen, daß die Befriedigung über ein gelungenes Werk durch der Hände Arbeit eine ebenso große sein kann, wie die Freude über ein vollendetes geistiges Werk oder über eine geglückte politische That. Der Prinz lernte die Tischlerei bei dem Hoftischlermeister Kunath, und in der Werkstatt des Hofbuchbindermeisters Moßner wurde er in die Geheimnisse der Buchbinderkunst eingeweiht. Jedenfalls hat die Beschäftigung mit diesen beiden Handwerksarten auf die Schärfung seines praktischen, weitschauenden Blickes, auf seine warme Fürsorge für das Aufblühen der Künste und Gewerbe und namentlich auch auf die Ausbildung seines Schönheitssinnes großen Einfluß gehabt.
Die Kunsttischlerei hat später durch seine unmittelbaren Anregungen und durch sein warmes — infolge seiner praktischen Vertrautheit mit diesem Handwerk — noch erhöhtes Interesse eine nicht unwesentliche Förderung erhalten, und in Bezug auf das Buchbinderhandwerk hat sich der spätere Kronprinz — wie dem Verfasser von einem der namhaftesten Buchbindereibesitzer Berlins mitgeteilt wurde — stets als ein gründlicher Kenner und feiner Beurteiler eleganter und geschmackvoller Büchereinbände erwiesen.
Weniger bekannt ist es bisher geworden, daß der Prinz auch ein begeisterter Jünger der edlen Gutenbergschen Kunst gewesen ist. Erst in späteren Jahren, nachdem der deutsche Kronprinz längst die Sonnenhöhe seines Ruhmes erstiegen hatte, ist es den dankenswerten Bemühungen des „Journals für Buchdruckerkunst“ in Hamburg gelungen, die Thatsache festzustellen, daß Prinz Friedrich Wilhelm sich in der That, nicht nur oberflächlich, sondern sehr eingehend mit der Erlernung der Buchdruckerkunst beschäftigt habe. Es war im Jahre 1843, als die damalige Prinzeß Wilhelm von Preußen, die jetzige Kaiserin-Witwe, in Begleitung des Prinzen Friedrich Wilhelm der Hänelschen Buchdruckerei in Berlin einen Besuch abstattete. Dem jungen Prinzen, der schon von Jugend auf für gewerbliche Dinge ein offenes Auge hatte, bereitete die Besichtigung der großartigen Anstalt, die sämtliche Zweige der typographischen Kunst, auch Schriftgießerei und Stempelschneiderei in sich vereinigte, großes Vergnügen, und mit Spannung folgte er, von dem Chef der Anstalt selbst geleitet, den einzelnen Vorgängen beim Setzen und Drucken, sein großes Interesse häufig durch Fragen an den Besitzer der Anstalt kundgebend. Dieser faßte im Stillen den Entschluß, dem Prinzen zum nächsten Weihnachtsfeste eine kleine, aber vollständig zusammengestellte Buchdruckerei-Einrichtung, bestehend aus einer kleinen Handpresse und Typen von Messing, die in hübschen Ebenholzkästen lagen, zum Geschenk zu machen. Der Prinz war entzückt über diese seltene Überraschung, und die Prinzessin Augusta ließ einige Tage darauf den Herrn Hänel ins Palais bescheiden und dankte ihm für seine Aufmerksamkeit mit den Worten: „Mit der kleinen Druckerei haben Sie dem Prinzen eine große Freude bereitet, seine ganze freie Zeit sitzt er dabei, um es zu einiger Fertigkeit zu bringen. Ich bitte Sie nun, dafür zu sorgen, daß der Prinz deren richtige Handhabung erlernt.“ Es wurde nun sofort damit begonnen. Die Unterweisung im Setzen wurde dem Setzerlehrling Geldmacher aus Magdeburg übertragen, während Herr Hänel, der Besitzer der Anstalt, dem Prinzen in der Handhabung der Druckerpresse selbst Unterricht gab.
In Bezug auf diese seine Lehrzeit als Setzer und Buchdrucker hat der spätere Kronprinz gelegentlich der in den Jahren 1881 und 1883 seitens der Gewerbedeputation des Berliner Magistrats angeregten Lehrlingsausstellungen wiederholt Bemerkungen gemacht, die davon zeugten, daß derselbe den Fortschritten dieser Kunst seither seine regste Aufmerksamkeit zugewendet habe. So bewunderte er bei der zweiten Lehrlingsausstellung im Jahre 1883 bei Gelegenheit der Besichtigung der ausgestellten Buchdruckereiarbeiten die großen Fortschritte der Typographie, besonders im Hinblick auf die geschmackvollen Randeinfassungen. Dann wendete er sich an den Vorsteher der Ausstellungsgruppe für Buchdruckerarbeiten, Herrn Grunert, und fragte ihn, ob er wohl wisse, daß auch er Buchdrucker sei. Auf die bejahende Antwort des Gefragten erkundigte sich der Kronprinz, woher er diese Kenntnis habe, worauf Herr Grunert antwortete: „Ich habe in derselben Anstalt, wo Ew. Kaiserliche Hoheit Anleitung erhielten, zwei Jahre lang als Gehilfe gearbeitet.“ „Wissen Sie,“ sagte der Kronprinz, „damals hatte doch die Buchdruckerei wenig Hilfsmittel; einige kleine oder größere Einfassungen auf Cicero, einige Zierlinien, — gar kein Vergleich gegen jetzt — großartiger Fortschritt!“
Auch sonst bei anderen Gelegenheiten hat Kaiser Friedrich in späteren Jahren, besonders als Kronprinz des deutschen Reiches, oft in scherzhafter Weise auf seine „Lehrzeit“ als Tischler, Buchbinder und Buchdrucker Bezug genommen. So fragte er einst bei einer Prüfung in der unter Leitung des Rektors Paulick stehenden größten Fortbildungsschule Berlins, deren regelmäßiger Besucher er jedes Jahr war, einen der Zöglinge nach seinem Berufe. Als dieser ihm antwortete, er sei Kunsttischler, antwortete der Kronprinz in einem Anfluge von Selbstironie: „Tischler bin ich auch gewesen, aber bis zum Kunsttischler habe ich es nicht gebracht.“ — —
Ferien-Reisen, die nach der märkischen Schweiz, dem Thüringer Walde, der sächsischen Schweiz und dem Riesengebirge unternommen wurden, und die meist in tüchtigen Fußtouren bestanden, gewährten dem Prinzen die notwendige Erholung von seinen geistigen Anstrengungen. Auch das ewige Meer erblickte er im Jahre 1845 auf seiner ersten Seereise nach der Insel Rügen, und der Anblick desselben machte auf sein empfängliches Gemüt einen tiefen Eindruck. Bei dieser Gelegenheit stattete er auch den alten Hansastädten Hamburg und Lübeck einen Besuch ab, und seine lebhafte Phantasie fand an diesen Stätten des regsten modernen Weltverkehrs mit ihren zahlreichen ehrwürdigen Erinnerungen an die glanzvolle Zeit des Mittelalters reichliche Nahrung. Auf diesen Reisen lernte er Land und Leute kennen, und im ungezwungensten, unmittelbarsten Verkehr mit dem Volke lernte er es lieben und achten, schärfte er seine Welt- und Menschenkenntnis. So verliefen die Jugendjahre des Prinzen in ungetrübtester Harmonie, und so entwickelten sich unter der liebenden Pflege der Eltern alle die herrlichen Anlagen des Geistes und des Herzens, die den Prinzen, als er zum Manne herangewachsen war, zu einer so liebenswürdigen Persönlichkeit machten. Die wahrhaft schlichte und einfache Erziehung, die die Eltern ihm zu teil werden ließen und die an die Tage Friedrich Wilhelms III. und seiner Luise in Paretz erinnerte, hat reichen Segen gewirkt, nicht nur in der Familie des späteren Kronprinzen selbst, der seine Kinder in derselben Weise erzog, sondern auch in allen Schichten des Volkes, das eine so einfache, verständige Kindererziehung als ein nachahmungswertes Beispiel empfand. Aus jener Zeit ist ein Brief interessant, den die Prinzessin-Mutter an ihren Schützling, den bereits vorn erwähnten Spielkameraden und Studiengenossen ihres Sohnes, den so früh verstorbenen Rudolf von Zastrow, gerichtet hat. Der Brief möge an dieser Stelle einen Platz finden, weil er einen tiefen Einblick gestattet in das warme, mitfühlende Herz und die edlen Erziehungsgrundsätze der Mutter unseres Kaisers.
Lieber Rudolf!
Ich schreibe diese Zeilen am Vorabend des Tages, an welchem Dein letztes Examen beginnen wird und im bangen Vorgefühl der Trennung. Dies Gefühl wurzelt in meiner mütterlichen Gesinnung für Dich; Deine Eltern hatten Dich uns anvertraut und ich erkannte vom ersten Augenblick an die Größe der Verantwortlichkeit, die wir übernommen hatten, sowie die Dankbarkeit, die wir Deinen Eltern für ihr Vertrauen schuldig waren. Ich habe Dich stets wie mein eigenes Kind betrachtet und behandelt. Gott, der in mein Herz blickt, kennt meine Liebe und meine Fürsorge. Er hat seinen Segen, „an welchem alles gelegen“, dieser Erziehung geschenkt und ich freue mich, Dir sagen zu können, daß Du uns bisher nur Veranlassung zur vollsten Zufriedenheit gegeben hast. Ich danke Dir von Herzen dafür und rechne fest auf Dich für die Zukunft. Nun, nur noch einen Rat und eine Bitte: das Leben ist ernst und doch ist es nur die Vermittelung, Vorbereitung zu einem anderen, höheren Leben; wir müssen also die uns gegebene Frist wohl benutzen; das Leben bringt Anfechtungen und Verführungen aller Art, wir müssen uns daher täglich von Gott die Kraft ausbitten, gegen sie zu kämpfen, um unserem Grundsatze treu zu bleiben. Die Äußerlichkeiten des Lebens vermindern oft unseren Sinn für ernste Beschäftigung; wir müssen uns erinnern, daß wir täglich noch zu lernen haben, und daß wir das bereits Erworbene verlören, wenn wir es nicht vervollkommneten. Das Wünschenswerteste ist die Vereinigung von Charakter und Gemüt! Wohl denen, welchen Gott diese Gaben verliehen hat.
Ich glaube, sie bei Dir voraussetzen zu dürfen. — Meine Bitte besteht darin, daß Du ein Sohn für mich bleiben möchtest, ohne Dich irgendwie auch in veränderter Stellung entfernen zu lassen. Du wirst immer eine Freundin, eine Mutter in mir finden. Ferner bitte ich, daß Du immer ein Freund und ein Bruder meines Sohnes bleiben möchtest. Fürsten haben leider selten wahre Freunde. — Sein Herz bedarf ein solches Verhältnis, und Du wirst ihm in mancher Beziehung von großem Nutzen sein können. Du hast es mir versprochen, ich baue auf Deine Dankbarkeit, wie auf Dein Ehrenwort! — Nun lebe wohl, mein lieber Rudolf, gebrauche diese drei Bücher nach ihrer verschiedenen Bestimmung und gedenke dabei immer Deiner zweiten Mutter.
Augusta, Prinzessin von Preußen, Herzogin zu Sachsen.
3. Die Jünglingsjahre Kaiser Friedrichs.
Wie sprang, von kühnem Mut beflügelt, Beglückt in seines Traumes Wahn, Von keiner Sorge noch gezügelt, Der Jüngling in des Lebens Bahn. Bis an des Äthers bleichste Sterne Erhob ihn der Entwürfe Flug; Nichts war so hoch und nichts so ferne, Wohin ihr Flügel ihn nicht trug.Schiller, die Ideale.
Während Prinz Friedrich Wilhelm, durch rastlose Arbeit und den zunehmenden Ernst des Lebens längst den goldenen Kindesträumen entrückt, unvermerkt hinübergetreten war in das Alter der himmelstürmenden Jünglingskraft, hatte sich in Preußen sowohl, wie in den meisten übrigen Ländern Europas, mit mächtigem Flügelschlage der Geist einer neuen Zeit Bahn gebrochen.
Am politischen Horizonte wetterleuchtete es. Die Hoffnung, die ein großer Teil des Volkes nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. auf die neue Gestaltung der Dinge gesetzt, war nicht in dem Sinne verwirklicht worden, wie man es gewünscht hatte. „Es rächte sich furchtbar, daß nach den Befreiungskriegen die Wege Steins verlassen und die Metternichs statt dessen befolgt worden waren, sowie daß die Pläne Friedrich Wilhelms IV. zur Umgestaltung des Bundes keine Zeit gefunden.“ Wie ein drohender, unglückverheißender Schatten hatte sich zwischen Fürst und Volk eine Scheidewand aufgerichtet, und die finsteren Wolken des Mißmutes ballten sich zu einer unheilschwangeren Gewitterwolke zusammen.
Von Frankreich war der erste Anstoß zu dieser Bewegung ausgegangen, und sie setzte sich mit unwiderstehlicher Kraft nach Osten fort. Überall gährte und kochte es. Der Ruf nach freieren Verfassungen, nach Preßfreiheit und größerer Berücksichtigung der unteren Volksklassen hallte in allen Kulturländern Europas wider. Bald zuckten grelle Blitze aus dem finsteren, drohenden Gewölk hernieder, und ihr blendender Schein ließ das altersschwache Europa in fieberhaften Zuckungen erblicken und leuchtete hinein in das Dunkel mancher veralteter Anschauungen und vieler verkehrter, längst verrotteter Einrichtungen. Damals sang Moritz Graf Strachwitz in ergreifender Weise von unserem deutschen Vaterland:
Land des Rechtes, Land des Lichtes, Land des Schwertes und Gedichtes, Land der Freien und Getreuen, Land der Adler und der Leuen, Land, du bist dem Tode nah’, Sieh dich um, Germania!
Dumpf in dir, o Kaiserwiege, Gährt der Keim der Bürgerkriege, Tausend Zungen sind gedungen, Tausend Speere sind geschwungen; Fieberträumend liegst du da, Schütt’le dich, Germania!
Und so gewaltig hatte sich durch das unaufhörliche Schüren des erbitterten Parteikampfes der Zündstoff angehäuft, daß er sich zur tiefsten Betrübnis aller ruhigen Elemente nur in den Mündungen der Gewehre, in dem blutigen Straßenkampfe auf den Barrikaden entladen konnte. Am 18. März 1848 spielten sich auf den Straßen Berlins jene unseligen Scenen ab, die so viel Thränen über die Hauptstadt heraufbeschworen, die in dem Verhältnis zwischen König und Volk leider einen dauernden Riß herbeiführten, der nicht wieder gänzlich heilen, sondern für das ganze Leben des ersteren verhängnisvoll werden sollte. Manches ist damals geschehen, was nur blindem Hasse und fanatischer Leidenschaft seinen Ursprung verdankte; mancher unselige Irrtum hat schwere Folgen gehabt. Für die königliche Familie waren diese schweren Tage eine lange Reihe von bitteren Enttäuschungen. Wenn ein Blitz herniederzuckt, wenn der Gewittersturm brausend durch die Lüfte fährt, so werden die Kronen der Bäume gewöhnlich zuerst getroffen. Die Mitglieder der königlichen Familie hatten in jenen bangen Märztagen eingesehen, daß die Stürme des Lebens den Höchsten ebensowenig verschonen wie den Niedrigsten im Volke. Aber sie hatten das feste Vertrauen, daß in Preußen einst bessere Zeiten wiederkehren würden, daß das Band, welches zwischen dem Hohenzollernhause und dem Volke immer so fest geknüpft war und nun zu zerreißen schien, sich fester denn je um Fürst und Volk schlingen würde, wenn die Leidenschaft erst ruhigen Erwägungen Platz gemacht und an Stelle der vielen, wirklich verbesserungsbedürftigen Zustände heilsame Reformen getreten sein würden.
Am schwersten trafen alle diese Schicksalsschläge die Familie des Prinzen von Preußen, den man wegen seiner ausgesprochenen Vorliebe für das Militärwesen in einem großen Teile des Volkes für die Hauptstütze absolutistischer und feudaler Grundsätze ansah. So mußte denn der Prinz als ein Opfer des Irrtums der leidenschaftlich erregten Massen auf Befehl des Königs Friedrich Wilhelms IV. das Land verlassen und nach England gehen. Auch die königlichen Truppen hatten die Stadt räumen müssen. Wie wenig Prinz Wilhelm abgeneigt war, den berechtigten und zeitgemäßen Forderungen des Volkes nachzukommen, beweist der Umstand, daß er den mehrmonatlichen Aufenthalt in dem Mutterlande der Konstitution dazu benutzte, sich mit den Grundsätzen des englischen Verfassungs- und Verwaltungslebens gründlich vertraut zu machen. Und die folgenden Jahrzehnte haben mit ihren welterschütternden Ereignissen gezeigt, wie dieser ausgezeichnete Mann, der bald eine Popularität erreichen sollte, wie sie wenige vor ihm gehabt, den Anforderungen des Zeitgeistes und den Fortschritten auf politischem, wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Gebiete stets Rechnung zu tragen wußte, selbst wenn solche nicht immer mit seinen Empfindungen und Ansichten übereinstimmten.
Es mochten bange und schwere Tage gewesen sein, die die Familie des Prinzen Wilhelm während seiner Abwesenheit aus dem Vaterlande in tiefster Zurückgezogenheit in Potsdam verlebte, und auch Prinz Friedrich Wilhelm war bereits in dem Alter, um den tiefen Ernst des Augenblicks seinem ganzen Umfange nach richtig zu erfassen. Die neue Zeit lag in den schweren Wehen ihrer Geburt, und was morsch und altersschwach war, hielt dem Sturme nicht Stand. Jeder Morgen brachte neue Überraschungen, jeder Abend neue Ungewißheit, und der lärmende Widerhall jener aufregenden Tage drang auch bis in die Mauern der stillen, friedlichen Besitzung Babelsberg.
Aber solche Stunden der Gefahr und der Trübsal sind die beste Schule für einen Mann, der später einmal das Steuerruder eines so gewaltigen Staatsschiffes regieren soll. Sie reiften auch hier den Jüngling in kurzer Zeit zum Manne, stählten seinen Willen, festigten seinen Charakter und lehrten ihn auch die Endlichkeit und Nichtigkeit einer jeden Erdenmacht kennen. Die Zeit der Trennung von dem geliebten Vater sollte auch nicht allzu lange dauern, denn schon am 6. Juni wurde die stille Zurückgezogenheit, in der die prinzliche Familie bisher in Potsdam gelebt, durch den lauten Jubel unterbrochen, den die Heimkehr des Prinzen in seiner Familie erregte.
Inzwischen hatte bei dem Hofprediger Heym der Konfirmandenunterricht für den Prinzen begonnen. Keine Zeit war wohl zu innerer Sammlung, zu stiller Einkehr und zu würdiger Vorbereitung mehr angethan, als jene ernsten Tage, die noch unter dem frischen Eindruck der soeben durchlebten schweren Prüfungszeit standen. Am 19. September 1848 vollzog der Oberhofprediger Dr. Ehrenberg in der Schloßkapelle zu Charlottenburg den feierlichen Akt der Konfirmation, bei welcher Gelegenheit der Prinz einen von ihm selbst verfaßten Aufsatz verlas, welcher das evangelische Glaubensbekenntnis und seine Ansichten über die Grundwahrheiten des Christentums enthielt.
Noch in demselben Jahre war Prinz Friedrich Wilhelm wieder in den praktischen Dienst übergetreten. Für seine militärische Ausbildung war es von großer Bedeutung, daß nach der Pensionierung seines bisherigen militärischen Lehrers, des Generalmajors von Unruh, Oberstlieutenant Fischer, ein ebenso kenntnisreicher wie allen Standesvorurteilen völlig abgeneigter Offizier, die Stellung des ersteren einnahm. Bald darauf — am 3. Mai 1849 — wurde er der Leib-Kompagnie des 1. Garde-Regiments zu Fuß einverleibt.
Bei der Parole-Ausgabe im Lustgarten zu Potsdam empfahl der Prinz von Preußen seinen Sohn dem versammelten Offizier-Korps mit herzlichen Worten. „Meine Herren“, sagte er unter anderem, „ich kann mir die Freude nicht versagen, Ihnen persönlich meinen Sohn zuzuführen, Sie mögen sich denken, mit welchen Gefühlen ich das thue. Ich empfehle ihn Ihrer Kameradschaft. Er ist in einer schweren Zeit dem praktischen Leben entgegengewachsen. Ich übergebe ihn Ihnen in der Hoffnung, daß er Gehorsam lernen wird, um seiner Armee Ehre zu machen, dafür bürgt mir der Geist, den Gott in ihn gelegt hat — nicht wir!“ Und dann wandte er sich wieder an seinen Sohn und sagte mit einer Stimme, die von innerer Bewegung zeugte: „Und dann wünsche ich Dir, daß Du dereinst dasselbe erfährst, was Dein Vater erfahren hat! Meine Herren, ich spreche es Ihnen nochmals aus, es ist die schönste Freude meines Lebens gewesen, zu sehen, wie die Treue und innige Teilnahme meiner Untergebenen sich in schweren Tagen — in der Nähe und in der Ferne — nicht verleugnet hat. Und das wünsche ich auch Dir! Und so thue Deine Schuldigkeit!“
Aber die Tage des Sturmes und der Aufregung sollten noch nicht vorüber sein. Ganz Süddeutschland stand noch in hellem Aufruhr, und am 11. Mai 1849 war in der Bundesfestung Rastatt eine Meuterei unter den badischen Truppen ausgebrochen, die alle Bande militärischer Disciplin zu zerreißen und einen gefährlichen Umfang anzunehmen drohte. In offenen Versammlungen beratschlagten die Soldaten in brüderlicher Gemeinschaft mit den Bürgern über ihre Rechte und Pflichten. Einige Tage später empörte sich die Garnison der badischen Hauptstadt Karlsruhe, stürmte eine Kaserne, verwüstete die Häuser mehrerer Vorgesetzten und nahm eine immer drohendere Haltung an, so daß der Großherzog Leopold es vorzog, in der Nacht zum 14. Mai unter dem Schutze einer ansehnlichen Kavallerie-Bedeckung das Land zu verlassen. Er wandte sich Hilfe suchend an den König von Preußen. Friedrich Wilhelm IV. willfahrtete den Bitten des bedrängten Fürsten. Zum Ober-Befehlshaber des Heeres, das dazu bestimmt war, den Aufstand in Baden niederzuwerfen, hatte er seinen Bruder, den Prinzen Wilhelm von Preußen, ernannt, der in diesem Feldzuge seine ersten Lorbeeren erringen sollte. Am 9. Juni verabschiedete er sich von den Seinen in Potsdam, und bereits am 13. Juni rückte er mit seinen Heeresabteilungen auf drei Straßen in die Pfalz ein. Nach mehreren glücklichen Gefechten, die den Namen des Prinzen von Preußen bei den Aufständischen rasch gefürchtet machten, gelang es ihm, die zerstreuten Reste derselben über die Schweizer-Grenze zurückzudrängen und so den Aufstand in kurzer Zeit mit energischer Hand vollständig zu unterdrücken. Schon am 18. August zog Großherzog Leopold wieder in seine Residenz ein. Der Sieger aber in diesem Feldzuge wurde von dem Könige von Preußen mit dem Orden pour le mérite geschmückt. Prinz Friedrich Wilhelm, obgleich bereits vor dem Ausbruch des Feldzuges zum Premierlieutenant ernannt (3. Juni 1849), hatte auf den Wunsch des Vaters, zum großen Leidwesen des frischen, thatkräftigen Offiziers, an dem Feldzuge nicht teilgenommen.
Indessen hatten sich die politischen Ereignisse so schnell entwickelt, wie dies nur immer in so stürmischen Zeiten zu geschehen pflegt, und wenn sie auch oft wilden Wogen vergleichbar waren, die über ihre Ufer hinwegschäumen und, anstatt sie zu befruchten, ein Werk der Zerstörung zurücklassen, so sind sie doch immerhin — mit all ihren Irrtümern, mit all ihrem Unheil, das sie angestiftet, mit all ihren Thränen, die sie hervorgerufen — als der Ausgangspunkt einer neuen Zeit zu betrachten, die sich mit frischem, pulsierendem Geistesleben auf den Trümmern der alten aufbaute. Sie haben vor allen Dingen dazu beigetragen, dem Volke zu jenen Rechten zu verhelfen, „die droben hangen unveräußerlich und unzerbrechlich wie die Sterne selbst“; sie haben den Grund- und Ehrenvertrag zwischen Fürst und Volk, die Verfassung, geschaffen, ein Band, das von nun an dazu berufen sein sollte, ein neues, weit innigeres Bindemittel zwischen Volk und Krone zu werden. Nach und nach hatten sich denn auch die Stürme gelegt und der Besonnenheit und einer ruhigeren Erwägung der Dinge Platz gemacht.
Nur eins hatte das tiefste Bedauern aller wahren Patrioten hervorgerufen, daß der edelste und — neben dem Verlangen nach einer Volksvertretung — auch der sittlich am meisten berechtigte Kern der ganzen Bewegung, der Einheitsgedanke, nicht zur Verwirklichung gekommen war. Am 3. April 1849 spielte sich im Rittersaale des königlichen Schlosses zu Berlin ein Ereignis ab, das vielleicht schon jetzt geeignet gewesen wäre, die größte geschichtliche That des Jahrhunderts zu werden, das aber erst 22 Jahre später zu einer weltgeschichtlichen Begebenheit werden sollte, welche der Politik des ganzen Europa mit einem Schlage eine völlig veränderte Richtung zu geben berufen war. An diesem Tage war es, wo die Abgeordneten der Frankfurter National-Versammlung, mit dem Präsidenten Simson an der Spitze, dem König Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kaiserkrone anboten, die derselbe aber zum tiefsten Schmerze aller Vaterlandsfreunde ablehnte. Aber in demselben Saale, dicht in der Nähe des Königs, weilten noch zwei andere Männer, der eine in der Vollkraft der Jahre und in der Schule des Lebens bereits gereift, dessen Ruhm einige Jahrzehnte später hinausstrahlen sollte, weit, weit in alle Zonen der Erde; der andere ein Jüngling mit kühnem, thatendurstigem Herzen, auf dem schon lange die Augen des ganzen deutschen Volkes mit stiller Sehnsucht ruhten. Was ging in diesem Augenblicke in der Seele dieser beiden Männer vor? Konnten sie damals schon ahnen, daß es ihnen vielleicht dermaleinst beschieden sein sollte, mit starker Hand das zu verwirklichen, was seit fast einem Jahrhundert der Traum und die Sehnsucht der Edelsten der deutschen Nation gewesen?
4. Die Studienzeit des Kaisers und die Jugendjahre seiner „Vicky“.
„Ich bin zwar noch sehr jung, aber ich „werde mich zu meinem hohen Berufe mit „Ernst und Liebe vorbereiten und mich „bestreben, einst die Hoffnungen zu er- „füllen, welche mir dann als Pflichten von „Gott auferlegt werden.“
Es waren schöne Worte, die Prinz Friedrich Wilhelm kurze Zeit nach seiner am 18. Oktober 1849 erfolgten Großjährigkeit zu den Vertretern seiner Vaterstadt Potsdam sprach. Auch die Hauptstadt Berlin hatte ihn zu diesem für ihn so wichtigen Tage beglückwünscht und ihm durch den Magistrat und die Stadtverordneten, an ihrer Spitze der Bürgermeister Naunyn, eine prächtig ausgestattete, von Menzels Künstlerhand gearbeitete Adresse überreicht, in welcher es zum Schluß heißt: „ ... Zur Weisheit erzogen, wollen Sie tiefer und länger noch die Lehren des Rechtes der Fürsten und Völker, die strengen Lehren der Geschichte, die festigenden Lehren dessen vernehmen, was unvergänglich, wahr und gut ist. Durchdrungen von solcher Weisheit und Liebe, erhoben durch das große Vorbild der Ahnherren Ihres Hauses, hinblickend auf den hohen Geist und die Tugenden unseres erhabenen Königs, werden auch Sie ein Schirm sein den Unterdrückten, ein Hort jeder echten Freiheit, als Freund der Könige ein großherziger Freund eines freien Volkes! Der Tag Ihrer Geburt, ein deutscher Siegestag der Vergangenheit, sei die Gewähr des Ruhmes und der Größe des preußischen, wie des deutschen Vaterlandes. Heil Ihrer, Heil unserer Zukunft!“
Wie ernst der junge Prinz und seine Eltern es in der That mit seiner Vorbereitung nahmen, konnte man aus dem Umstande ersehen, daß der Prinz sich kurze Zeit darauf anschickte, die Universität Bonn zu beziehen. Wenn er in der Armee lernen sollte, die Waffen aus Stahl und Eisen für das Vaterland zu schwingen, so sollte er auch in den Dienst der Kämpfer für die Wissenschaft treten. Er hatte die juristische Fakultät gewählt, denn als späterer Landesfürst, der den glühenden Wunsch hatte, seinem Volke ein gerechter Herrscher zu werden, mußte er sich vor allen Dingen mit den Grundzügen des römischen und deutschen Rechtes, der Verfassungsgeschichte und allen den Wissenschaften vertraut machen, die ihn auch zu einem umsichtigen Staatsmanne befähigten. Von seinen Universitätslehrern sei vor allen der Dichter der Freiheitskriege, der alte Ernst Moritz Arndt, erwähnt, bei dem der Prinz vergleichende Völkergeschichte hörte. Der treffliche Dahlmann las über Politik, und bei Mendelsohn hörte der Prinz englische Verfassung.
Wie der Prinz sich bei allen seinen Studien und praktischen Übungen nur von dem einen Streben leiten ließ, seine körperlichen und geistigen Kräfte dereinst im Dienste des Vaterlandes gebrauchen zu können, so suchte er, wo es immer ging, selbst seine freien Stunden in ähnlichem Sinne zu verwerten. Er benutzte die Zeit, die ihm von seinen Studien übrig blieb, zu größeren Ausflügen in die Provinz, besuchte Köln, Trier, Aachen, Düsseldorf, stärkte sich an den Erinnerungen, die große, geschichtliche Ereignisse denkwürdiger Stätten in ihm wachriefen, sah, wie in den industriereichen Bezirken der Rheinprovinz ein arbeitsames, fleißiges Volk die neuesten Errungenschaften der Technik verwertete und ließ sich bei all diesen Besuchen immer von dem Bestreben leiten, Land und Leute in nächster Nähe kennen zu lernen. Er trat, wo es immer anging, mit dem Volk in die engste Berührung, und sein liebenswürdiges, freundliches Wesen, die bürgerliche Einfachheit und Anspruchslosigkeit, mit welcher er überall auftrat, gewannen ihm schon damals aller Herzen.
Die Studienzeit des Prinzen erlitt im Frühjahr 1851 eine Unterbrechung durch eine Reise nach England, die derselbe mit seinen Eltern und seiner Schwester dorthin unternahm. Hier in dem Mutterlande der Industrie und des Handels war von dem Prinzen Albert, dem allen politischen und wirtschaftlichen Freiheiten so geneigten Gemahl der Königin Viktoria von England, der hochherzige Plan zu einer Weltausstellung gefaßt worden, an dem sämtliche Mächte der neuen und alten Welt im friedlichen Wettkampfe teilnehmen sollten. Bei dieser Gelegenheit lernte der Prinz zum ersten Male die spätere teure Gefährtin seines Lebens, die damals 10jährige Prinzessin Viktoria, kennen. Das einfache, kindliche Wesen, die Poesie, die um diese zarte, aufblühende Knospe schwebte, zogen schon damals die Aufmerksamkeit des Prinzen auf sich, und das anmutige Bild dieses Kindes mag bis zu dem nächsten Wiedersehn, welches noch eine Zeit lang dauern sollte, seitdem wohl nicht aus der Seele des Prinzen gewichen sein.





























