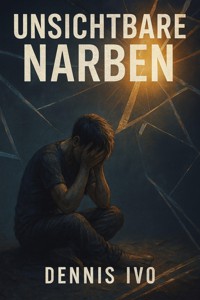
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Unsichtbare Narben ist die autobiografische Geschichte von Dennis Ivo – ehrlich, roh und poetisch. Sie erzählt von Kindheit zwischen Diagnosen, dem Verlust des Vaters und dem Ringen mit PTBS und Sozialphobie. Doch zwischen Schmerz und Stillstand findet sich auch Hoffnung: ein Zeugnis dafür, dass Verletzlichkeit keine Schwäche ist, sondern eine Form von Stärke.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unsichtbare Narben
Dennis Ivo
Unsichtbare Narben
Unsichtbare NarbenTeil III – Abschluss und NeubeginnUnsichtbare Narben
Unsichtbare Narben
Dennis Ivo
Verlag:Dennis Ivo
Am Hartenbauer 23
52525 [email protected]
Prolog
Warum ich schreibe
Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass mein Leben nicht nur aus Diagnosen, Akten und Absagen besteht. Nicht nur aus Sätzen wie: „Er hat sich bemüht – im Rahmen seiner Möglichkeiten.“
Lange war ich jemand, der nur reagierte. Auf Anträge, auf Gutachten, auf Bescheide. Auf das, was andere über mich entschieden. Ärzte. Sachbearbeiter. Lehrer. Menschen, die mich in Spalten eintrugen, als wäre ich ein Excel-Sheet. Ich stand immer mit dem Rücken zur Wand – und nickte, weil es sicherer war.
Aber da ist auch etwas anderes in mir.
Etwas, das nie ganz verstummt ist.
Etwas, das Geschichten speichert.
Nicht die Geschichten, die in Akten stehen, sondern die echten: Das Neonlicht im Inkubator. Die Blicke im Klassenzimmer. Der erste Satz, der wirklich meinte: „Dieser Junge denkt tiefer, als er sprechen kann.“ Die Musik, die schrie, als ich es nicht konnte. Die Liebe, die nach Mitleid schmeckte. Der Tee mit einer Freundin, die mich nahm, wie ich war.
Ich schreibe dieses Buch nicht, weil ich ein Ratgeber sein will. Ich bin keiner.
Ich schreibe, weil ich glaube, dass meine Brüche kein Einzelfall sind. Dass viele Menschen durch Raster fallen, die zu eng genäht sind. Zu laut für die Stillen, zu oberflächlich für die Tiefen, zu glatt für die, die Ecken haben.
Dies hier ist kein Lebenslauf.
Es ist ein Tagebuch.
Ein Mosaik aus Erinnerungen, die manchmal klar sind, manchmal verschwommen.
Ein Versuch, Linien in das Chaos zu ziehen – ohne es glattzubügeln.
Es geht nicht darum, ob ich „normal“ bin.
Es geht darum, dass kein Mensch auf eine Diagnose reduziert werden darf.
Dass man nicht verstehen kann, wer ich bin, wenn man nur die Defekte zählt.
Man muss die Zusammenhänge sehen. Die Übergänge. Das Schweigen. Die leisen Explosionen.
Vielleicht schreibe ich, um mir selbst zu beweisen, dass ich mehr bin als meine Akte.
Vielleicht schreibe ich, weil Worte mein einziger Weg sind, sichtbar zu sein.
Vielleicht schreibe ich, damit irgendwo jemand liest und denkt: Das kenne ich. Ich bin nicht allein.
Das reicht schon als Grund.
Teil I – Frühstart & Kindheit
Nicole – die Schwester, die nicht blieb
Ich war nie wirklich das jüngste Kind. Vor mir war Nicole. Geboren 1971. Gestorben 1976. Elf Jahre, bevor ich das Licht der Welt sah.
Sie war da — und doch nicht. Ein Foto hängt in meinem Zimmer. Kaum Geschichten blieben. In meiner Familie wurde ihr Name nur selten ausgesprochen, als sei er ein zerbrechliches Glas, das man besser in Schubladen lagerte. Trotzdem begleitet sie mich, als hätte sie sich in meine Zellen eingeschrieben. Es ist, als hätte jemand ein leises Signal in meinen Körper gelegt, das gelegentlich aufleuchtet: da war jemand vor mir.
Wenn alles in mir bricht, spüre ich sie manchmal neben mir. Unsichtbar, aber nah. Keine Stimme, kein Gesicht — eher ein warmer Schatten, eine stille Gewissheit, die mich umfängt. Manchmal glaube ich, sie hält mich fester als jedes Gerät. Fester als jede Hand, die mich je berührt hat.
Meine Erinnerung an sie ist mehr Gefühl als Bild. Manchmal ist es ein Geruch — Seife oder kalte Luft — der kurz an etwas Verlorenes rührt. Manchmal ist es ein falsch sitzender Schalter im Kopf: Wenn alles in mir bricht, spüre ich sie neben mir. Unsichtbar, aber nah. Keine Stimme, kein Gesicht — eher ein warmer Schatten, eine stille Gewissheit, die mich umfängt. Ich kann nicht sagen, ob ich glaube, dass sie wirklich da ist. Vielleicht ist es Wunsch, vielleicht Erbe, vielleicht nur die Art, wie Menschen Lücken mit Geschichten füllen. Was bleibt, ist das Gefühl: gehalten zu werden, wenn niemand anders da ist.
Als Kind fragte ich mich, wie es wäre, mit einer echten Schwester aufzuwachsen — nicht dieses Geister-Ich im Hinterkopf, sondern jemand, mit dem man die Zimmer teilen, Geheimnisse flüstern, Streiche planen würde. Ich stellte mir vor, dass sie lacht, dass sie meine schlechten Witze mit einem Augenrollen straft, dass sie mir Bücher leiht und irgendwann meine Lieblingsjacke trägt. Diese Fantasien sind wie kleine Monumente, die ich gebaut habe, um eine Abwesenheit zu benennen.
In der Familie war die Stille um sie herum kompliziert. Manche erinnern sich an Daten, andere weichen aus, wenn das Thema kommt. Vielleicht wissen sie nicht, wie sie über etwas sprechen sollen, das schon vor meiner Geburt geschehen ist. Vielleicht ist Schweigen auch Schutz — vor der Traurigkeit, vor Erinnerungen, die wieder schmerzen würden. Ich habe gelernt, dass Schweigen manchmal lauter ist als Worte: es formt Räume, die man dann mit eigenen Gedanken füllt.
Manchmal denke ich: Nicole ist mein erstes Geheimnis. Nicht das intime Geheimnis, das man behält, weil man niemandem wehtun will, sondern das stille Wissen, das mich auf seltsame Weise definiert. Sie ist die Lücke, die mir das Recht gegeben hat, unsichtbar zu sein — und gleichzeitig die stille Verpflichtung, sichtbar zu werden. Wenn ich mich klein fühle, dann ist da diese Stimme, die sagt: „Du bist mehr als die Akten, mehr als das Etikett.“ Vielleicht ist das nur Projektion. Vielleicht ist es ein Geschenk.
Und ganz praktisch: manchmal, allein nachts, klappe ich mein Fotoalbum auf, blättere an Bildern vorbei, die von anderen Händen ausgewählt wurden, und suche nach einem Hinweis auf sie — eine Notiz am Rand, ein verschwommenes Foto, eine Handschrift. Meistens finde ich nichts. Aber selbst das Suchen ist wie ein Ritual: ich halte kurz inne, atme, und erkenne, dass die Suche selbst ein Weg ist, ihre Anwesenheit zu bestätigen. Vielleicht hat sie mich gehalten, bevor jemand anders es konnte. Vielleicht ist es nur eine Metapher. Beides hat Gewicht. Und in Momenten, in denen alles auseinanderzufallen droht, ist dieser unerklärliche Halt genug, um weiterzugehen.
Frühstart
26. Juni 1987. Elf Wochen zu früh.
Das erste Bild meines Lebens ist kein Garten, kein Zimmer, keine Mutter im Arm. Es ist Neonlicht. Kaltes, klares Licht, das an Wänden springt und alles gleich macht. Piepsende Monitore, das ständige, mechanische Atmen von Maschinen. Ein Inkubator, eine gläserne Schale, die mehr Zuhause war als jeder Schoß. Ich weiß das nicht, nicht wirklich. Aber die Geschichten, die man mir später erzählte, riechen nach dieser Zeit: Desinfektion, Plastik, die süßliche Wärme von Wärmelampen.
Schläuche hielten mich am Leben, bevor ich selbst wusste, was Leben ist. Ein dünner Schlauch am Hals, ein Draht am Kopf. Ärzte sagten später „Hydrocephalus“ — ein Wort, das wie ein Fremdkörper klingt. Druck raus, fürs Erste. Ein Schnitt, eine kleine Operation, eine Hoffnung, dass es reicht. Als Kind habe ich mir nie das Bild dieser Hände gemalt, die mich eröffneten; ich habe nur das Gefühl der Reparatur im Körper, als wär etwas in mir wieder an seinen Platz geschoben worden.
Während andere Babys noch im Bauch reiften, lag ich unter Glas. Ich war in einem Zwischenraum: nicht draußen, nicht wirklich zuhause. Atmen — Baustelle. Kreislauf — Baustelle. Essen — Baustelle. Alles, was für andere selbstverständlich war, musste an mir eingestellt werden wie ein Gerät.
Fremde Hände hielten mich, aber deren Hände waren Funktion: fixieren, wärmen, messen. Nicht die Hände, die trösteten, sondern die, die dafür sorgten, dass ich nicht aus dem Leben abrutschte. Berührung hatte einen Zweck. Sie war Teil eines Programms zur Erhaltung, kein zärtliches Zu-sich-holen. Manche Berührungen brannten sich trotzdem ein: ein vorsichtiges Streichen über den Kopf, ein Flüstern, wenn die Geräte kurz tiefer piepsten. Kleine Gesten, die vielleicht für die, die sie taten, Routine waren — für mich waren sie eine Art Fremdform von Nähe.
Vielleicht hat mein Körper damals gelernt: Wärme ist medizinisch. Nähe ein Vorgang, kein Gefühl. Vielleicht ist daher vieles in mir später so vorsichtig gewesen — die Erwartung, dass Zuwendung an Bedingungen geknüpft ist, dass jede Umarmung ein Instrument ist, das geprüft werden muss. Das misstrauische Gefühl, dass Nähe erst verdient werden will, bevor sie echt sein darf.
Und trotzdem, mitten im Orchester aus Piepen und Stimmen, glaube ich manchmal, dass etwas anderes mich hielt — leiser als jedes Gerät. Nicole. Nicht als Gesicht, nicht als Gestalt, eher als ein leises Haltesignal in mir. Manche Nächte, wenn das Gedächtnis sich weitet und die Erinnerungen dünn werden, ist da dieses Gefühl: eine Wärme, die nicht vom Gerät kam, eine Hand, die nicht gemessen wirkte, ein Schatten, der nicht klinisch ist. Vielleicht hat da etwas anderes gewacht, eine unsichtbare Anwesenheit, die nicht in den Akten stand.
Ich weiß nicht, ob das Erinnerung oder Erfindung ist. Vielleicht beides. Menschen füllen Lücken — besonders, wenn sie einmal kalt gewesen sind. Aber das Bild reicht: ein kleines Ich, warm unter einer Lampe, umgeben von Technik und der Überzeugung, dass es jemanden gibt, der mehr will als nur zu stabilisieren. Dass da jemand ist, der hält, ohne zu fragen, ob es sich lohnt.
Die frühen Tage sind auch eine Geschichte von Geräuschen: Schläge von Pumpen, Stimmen, die meinen Namen sagen, den Geruch von Kaffee in nächtlichen Diensten. Später erzählte man mir von den Nächten, in denen mein Vater am Fenster saß und sich nicht traute, die Tür zu öffnen, aus Angst, mich zu stören. Von einer Mutter, die draußen vor dem Inkubator die Luft anhielt, als wäre ihr Atem der Hebel, an dem mein kleines Leben hing. Solche Bilder sind Fragmente, zusammengesetzt aus Erzähltem, aber sie tragen eine Wahrheit: Es gab Menschen, die wach blieben.
Manchmal stelle ich mir vor, wie es gewesen sein muss, in diesem Raum klein zu sein und trotzdem ein ganzes Leben in sich zu tragen — die Möglichkeit zu wachsen, zu fallen, erneut aufzustehen. Und ich frage mich, ob die Körper, die mich damals berührten, ahnten, wie sehr ihre Routine später in mir nachhallen würde: als Angst, als Misstrauen, aber auch als unbegründete Dankbarkeit. Denn ohne sie wäre dieses Buch nicht möglich.
Vielleicht hat mein Körper damals gelernt: Nähe ist ein Vorgang.
Vielleicht hat er aber auch gelernt, dass es Menschen gibt, die trotz allem bleiben. Und manchmal reicht dieser unscharfe Beweis, dieses Gefühl, um weiterzugehen.
Alarmlicht im Körper
Wenn ich heute unruhig werde, denke ich: Vielleicht ist das nur altes Alarmlicht, das noch in mir blinkt. Ein Rest Neon im Nervensystem. Ein Echo der Maschinen, die damals über mich wachten.
Es fängt manchmal ganz banal an: ein zu lauter Schritt auf dem Flur, das grelle Aufleuchten einer Straßenlaterne im Fenster, das Piepen eines Signals — und plötzlich ist da dieser Start: Herz, das schneller geht; Atem, der flach wird; die Hände, die sich krümmen, als müssten sie etwas festhalten. Der Körper reagiert, bevor der Verstand verstanden hat, warum. Als hätte jemand vor Jahren einen Schalter umgelegt und das Relais vergessen auszuschalten.
Im Supermarkt, wenn Neonröhren summen und Regale in gleichmäßiges Licht tauchen, kneift etwas in der Mitte meiner Brust. In Gesprächen kann ein harmloses Wort wie ein Kurzschluss wirken, und ich bin wieder das Baby unter Glas: anfällig, roh, alarmiert. Manche Geräusche ziehen an alten Nerven wie Magneten — das rhythmische Piepen, das Husten in der Nacht, das Klick-Klick von Schlüsseln. Und ich weiß: das ist nicht nur heutige Angst. Das sind Nachwehen.
Manchmal frage ich mich: Hat nur Technik mich gehalten — oder auch dieses unsichtbare Band zu Nicole? Waren es die Hände im weißen Kittel, die Ventile und Pumpen, die mich stabilisierten — oder war da noch etwas anderes, ein leiser Halt, der sich nicht messen ließ? Vielleicht beides. Vielleicht erklärt das die seltsame Zwiespältigkeit: Vertrauen in Apparate und gleichzeitig die Sehnsucht nach einer Nähe, die nicht klinisch ist.
Wenn das Alarmlicht blinkt, suche ich nach Regeln, nach Ankern. Atmen zählen hilft manchmal. Den Blick auf einen festen Punkt richten. Einen Satz in Gedanken wiederholen, der mich zurückruft: Hier ist Sicherheit, jetzt. Therapie hat mir Techniken gegeben — Gradmesser, die mir erlauben, die Signale zu lesen, statt von ihnen überwältigt zu werden. Manchmal reicht ein bewusstes Ausatmen, um den grellen Balken in mir ein Stück zu dimmen.
Und doch bleibt da die Scham: dieses Gefühl, auf Knopfdruck überzureagieren, als wäre ich weniger belastbar, weniger „normal“. Ich sehe Leute, die in ähnlichen Momenten ruhig bleiben, und es nagt an mir. Dann erinnere ich mich, dass die Reaktion nicht meine Schuld ist — dass sie ein Echo einer Zeit ist, in der mein Körper um sein Überleben kämpfte. Das nimmt die Schärfe nicht komplett, aber es gibt mir Perspektive.
Es gibt auch kleine Befreiungen. Nächte, in denen das Piepen anfängt und ich es diesmal nur beobachte, wie man einer entfernten Sirene lauscht, ohne aufzustehen. Treffen, bei denen Licht und Lärm nicht das Innere überrollen. Das sind keine großen Siege, keine Feuerwerke — eher das leise Üben, das Relais Stück für Stück abzuschalten. Und manchmal, wenn ich ganz still werde, höre ich kein technisches Echo mehr, sondern nur ein kaum hörbares Menschsein: die Erinnerung daran, dass ein Körper, so alarmiert er auch sein mag, auch zur Ruhe kommen kann.
Die erste Frage: Wird er normal?
Noch bevor ich „ich“ war, hing eine Frage über mir wie eine unsichtbare Decke: Wird er normal?
Es war selten ausgesprochen, aber es lag in der Luft, dick wie Desinfektionsgeruch.





























