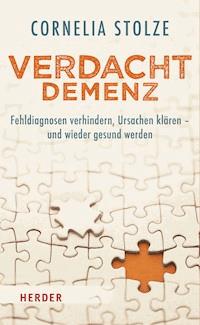9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Alzheimer – die erfundene Krankheit »Alzheimer« ist keine Krankheit. Sie ist ein Phantom. Ein gezielt geschaffenes Konstrukt, mit dem sich Ängste schüren, Forschungsmittel mobilisieren, Karrieren beschleunigen, Gesunde zu Kranken erklären und riesige Märkte für Medikamente schaffen lassen. Ärzte, Wissenschaftler und Pharmafirmen verheißen »epochale Schritte« in der Erforschung des grausamen Leidens, sie versprechen endlich »Gewissheit« bei der Diagnose und »neue therapeutische Strategien« gegen den Gedächtnisverfall. Doch hinter all den Verheißungen steckt ein fundamentaler Schwindel. Dieses Buch enthüllt, wie aus einem rätselhaften Sonderfall eine neue »Volkskrankheit« wurde. Es zeigt auf, warum bis heute niemand eine präzise Diagnose stellen – und deshalb auch niemand zielgerichtete Tests oder Therapien entwickeln kann. Die »Angst vor dem Vergessen« trifft den Nerv alternder Gesellschaften: Millionen Menschen schlucken Mittel, die den Verfall des Hirns bremsen sollen. Nie wurde bewiesen, dass sie etwas nützen. Denn viele klassische »Alzheimer-Symptome« sind in Wahrheit die Folge von Fehlernährung oder Depressionen, von Durchblutungsstörungen oder anderen Leiden – oder aber Nebenwirkungen jenes Medikamentencocktails, den viele Hochbetagte täglich schlucken. »Alzheimer« ist in den meisten Fällen kein unausweichliches Schicksal. Ob und wann ein Mensch daran erkrankt, ist auch und vor allem eine Frage der Bildung – und des Lebensstils.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
CoverTitel1 Das Geschäft mit der Angst vor dem Vergessen2 Schon verrückt – oder doch (noch) normal? Die Krux mit der Diagnose3 Kaputtes Hirn, gesunder Geist? Wirrer Geist, intaktes Hirn? Fehldiagnose Demenz4 Trügerische Gewissheit: Warum die Früherkennung von Alzheimer ein leeres Versprechen ist5 Wirkung fraglich, Nebenwirkungen garantiert: Wenn Ärzte ins Blaue hinein behandeln6 Willig durch Angst: Von der Kunst, besorgte Gesunde zu Versuchskaninchen zu machen7 Das Kartell8 Strategien gegen das Vergessen: Was dem Hirn hilft – und was ihm schadetBuchAutorImpressum[Menü]
1 Das Geschäft mit der Angst vor dem Vergessen
»Neue Risikogene für Alzheimer-Krankheit entdeckt!« »Mediziner sagen erfolgreich Alzheimer voraus!« Wer die Erfolgsmeldungen von Universitäten, Wissenschaftlern und Pharmafirmen liest, erfährt neuerdings von »epochalen Schritten« in der Erforschung des grausamen Leidens. Moderne Verfahren, heißt es, wurden endlich »Klarheit« schaffen bei der Diagnose. »Weltweit neue therapeutische Strategien«, so scheint es, werden den fatalen Gedächtnisverfall schon bald wirksam stoppen.Hinweis
Der Haken daran ist nur: Mit der Wirklichkeit hat das wenig zu tun. Hinter all den Verheißungen steckt ein fundamentaler Schwindel. Denn Alzheimer ist keine Krankheit wie Tuberkulose oder Krebs. Der »Morbus Alzheimer« ist ein Konstrukt. Ein nützliches Etikett, mit dem sich wirkungsvoll Forschungsmittel mobilisieren, Karrieren beschleunigen, Gesunde zu Kranken erklären und riesige Märkte für Medikamente und diagnostische Verfahren schaffen lassen.
Denn so ungeheuerlich es klingt: Bis heute weiß niemand, was »Alzheimer« wirklich ist.Hinweis Über die Merkmale und Ursachen der Krankheit kursieren die unterschiedlichsten Theorien. Für die einen Experten sind es giftige Proteinklumpen, die das Leiden hervorrufen sollen, für die anderen Infektionen, Diabetes, Entzündungen oder Metalle wie Eisen und Zink. Die Vertreter der verschiedenen Schulen widersprechen sich nicht nur untereinander. Manch eine Koryphäe widerspricht sich in Vorträgen, Interviews und Veröffentlichungen sogar selbst.
Auch das gesamte Konzept von Früherkennung, Diagnostik und Therapie steht auf tönernen Füßen. Denn nicht einmal Spitzenexperten können das rätselhafte Leiden zuverlässig diagnostizieren. Und zwar selbst dann nicht, wenn ein Mensch bereits schwer an Demenz erkrankt ist. Die Diagnose erfolgt nach dem Ausschluss-Prinzip: Wenn der Arzt nichts findet, was in seinen Augen erklärt, warum der Betroffene verwirrt, vergesslich oder desorientiert ist – dann muss es wohl Alzheimer sein.
Dabei ist Demenz nicht gleich Demenz. Mediziner unterscheiden nicht nur eine Vielzahl degenerativer Erkrankungen, die einen irreparablen Verfall des Gehirns hervorrufen können. Vielmehr können hinter Gedächtnis- und Orientierungsstörungen – selbst wenn sie längere Zeit andauern – auch zahlreiche Ursachen stecken, die sich gut behandeln oder verhindern lassen. Vorausgesetzt Sie werden nicht als Alzheimer verkannt.
Tödliche Selbstdiagnose – der Fall Gunter Sachs
Doch der Irrglaube an Alzheimer hat längst die gesamte Gesellschaft erfasst. Jeder hat davon schon gehört. Jeder meint zu wissen, was darunter zu verstehen ist. Und fast jeder fürchtet sich inzwischen davor, selbst einmal daran zu erkranken.
Umfragen zeigen, dass Alzheimer zu den Leiden zählt, vor denen sich die Menschen in Deutschland am meisten ängstigen – und deren Folgen sie sich und den Angehörigen ersparen möchten.Hinweis
Kein Wunder. Denn »Alzheimer« steht nicht nur für eine Krankheit. Alzheimer ist das Schreckensbild unserer Zeit, der Inbegriff einer Vielzahl von Ängsten, die mit dem Alter verbunden sind: die Angst vor Schwäche und Hilflosigkeit, vor Nackt-auf-der-Straße-Herumlaufen und Inkontinenz, vor Angegurtet- oder Eingeschlossen-Werden, vor Einsamkeit und Abgeschoben-Werden, vor Ohnmacht und Liebesverlust. In dieser Krankheit spiegelt sich die Furcht, das Letzte zu verlieren, was uns am Ende des Lebens bleibt: das eigene »Ich« und das Gefühl von innerer Würde.
Für manch einen ist allein schon der Gedanke an einen solchen Zustand unerträglich. Das zeigt der Fall Gunter Sachs. Jahrzehntelang galt der Millionenerbe, Fotograf und Kunstsammler als einer, der das Leben und die Frauen liebt und der stets vom Erfolg verwöhnt wird. In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai 2011 nahm er sich im Alter von 78 Jahren das Leben.
Die Begründung lieferte er in seinem Abschiedsbrief: Durch die Lektüre »einschlägiger Publikationen« habe er in den letzten Monaten erkannt, »an der ausweglosen KrankheitA. zu erkranken«. Er stelle dies heute noch »in keiner Weise durch ein Fehlen oder einen Rückgang meines logischen Denkens fest – jedoch an einer wachsenden Vergesslichkeit wie auch an der rapiden Verschlechterung meines Gedächtnisses und dem meiner Bildung entsprechenden Sprachschatzes«. Dies führe schon jetzt zu gelegentlichen Verzögerungen in Konversationen. »Der Verlust der geistigen Kontrolle über mein Leben«, so Sachs, »wäre ein würdeloser Zustand, dem ich mich entschlossen habe, entschieden entgegenzutreten.«Hinweis
Genau das tat er denn auch. Er setzte sich an den Schreibtisch, schoss sich mit einer Pistole in den Kopf – und war umgehend tot.
Noch kurz vor seinem Tod ist er witzig, eloquent und schlagfertig wie immer
Schon einige haben nach der Diagnose »Alzheimer« den Freitod gewählt. Im März 2008 zum Beispiel schied der belgische Schriftsteller Hugo Claus mit ärztlicher Hilfe aus dem Leben – in Belgien eine legale Möglichkeit. Und die Öffentlichkeit applaudiert. Sachs’ Tat sei »mutig und richtig«, »nachvollziehbar« und »konsequent«, hieß es nach seinem Tod.
Unklar ist, bei wie vielen der Entschluss – wie bei Gunter Sachs – auf einer Selbstdiagnose beruht. Einen medizinischen Befund gab es bei dem ehemaligen Playboy nämlich offensichtlich nicht. Zumindest keinen Demenzbefund. In der Tat, so berichten zahlreiche Quellen, war Gunter Sachs jedoch depressiv.Hinweis Sowohl Demenz als auch Depressionen können aber, wie man seit Langem weiß, gerade bei älteren Menschen ähnliche Symptome verursachen. Beide Leiden lassen sich deshalb häufig nur schlecht voneinander unterscheiden. Gunter Sachs, so scheint es, war allerdings geistig hellwach. Noch etwa fünf Wochen vor seinem Tod, erzählte ein Bekannter von Sachs dem Stern, sei dieser wie immer gewesen, schlagfertig, eloquent und witzig, so wie man ihn gekannt und geliebt habe.Hinweis Die Aussage stammt nicht von irgendwem. Es sind die Worte des Medizinprofessors Florian Holsboer, ein renommierter Depressionsforscher und Direktor des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie.
Auch das, was Sachs unter der Lektüre »einschlägiger Publikationen« verstand, wird vermutlich kein Mensch je erfahren. Fest steht allerdings: An Informationen über Alzheimer mangelt es nicht. Im Gegenteil. Seit Jahren werden wir mit Meldungen über die vermeintliche Krankheit bombardiert.
Vom exotischen Hirnsyndrom zur weltweiten Seuche
Bereits Ende der 1980er machte die Weltgesundheitsorganisation WHO Alzheimer als »eines der größten medizinischen Probleme in der heutigen Welt« aus. Das einst ausgefallene Hirn-Syndrom, berichtete Der Spiegel damals in einer Titel-Geschichte, habe sich in eine »Seuche verwandelt, die sich in den westlichen Industrieländern unaufhaltsam ausbreitet«.Hinweis Gleich einem Apokalyptischen Reiter, hieß es darin, sei der Morbus Alzheimer aus dem Dunkel aufgetaucht, und er schicke sich an, seine altbekannten Gefährten – Krebs, Herzinfarkt und Arteriosklerose – im Parforceritt zu überholen. »Sehr bald schon wird er, wie der Heidelberger Molekularbiologe Konrad Beyreuther glaubt, überall in der westlichen Welt die Rolle des ›Top-Killers‹ übernehmen.«
Inzwischen ist das Thema allgegenwärtig. Zeitschriften und Zeitungen berichten fast täglich von der neuen »Volkskrankheit«, an der allein in Deutschland schon 1,3 Millionen Menschen leiden und von der weitere fünf Millionen als Angehörige betroffen sein sollen. Selbst angesehene Blätter unterscheiden dabei häufig nicht einmal zwischen Alzheimer und Demenz.Hinweis Die Verbreitung des Leidens, so ist zu lesen, habe das Ausmaß einer globalen Epidemie erreicht, die ganze Staaten arm machen wird und das Gesundheitssystem lahmzulegen droht. Offiziellen Angaben zufolge sind heute weltweit 26 Millionen Menschen alzheimerkrank. Manche Berichte nennen sogar 36 Millionen und prophezeien: 2050 werde es mehr als dreimal so viele Betroffene geben, weltweit um die 115 Millionen.Hinweis
Allen ist klar, dass etwas geschehen muss. Verlage organisieren Zukunftsforen, um mit Vertretern der Arzneimittelindustrie zu diskutieren, wie sich »das Schlimmste, was einem im Alter widerfahren kann: an Demenz zu erkranken«, stoppen oder verhindern lässt.Hinweis Lebensmittelkonzerne wie Nestlé kündigen an, künftig spezielle Nahrungsmittel gegen Alzheimer auf den Markt zu bringen.Hinweis Alzheimer wird zum Sujet erfolgreicher Romane, Biografien und Krimis von Schriftstellern wie Martin Suter, Arno Geiger, Tilman Jens, Michael Jürgs oder John Katzenbach. Die Krankheit liefert Stoff fürs Kino und Fernsehen, mit Filmen wie »Small World«, »An ihrer Seite« oder jenem »Tatort« von 2011, bei dem ein dementer Verdächtiger im Zentrum der Ermittlungen steht.
Fernsehanstalten wie das ZDF warnen vor einer »tickenden Zeitbombe für unsere alternde Gesellschaft«Hinweis: Anfang 2011 strahlte der Sender eine zweiteilige Dokumentation über die »Reise ins Vergessen – Leben mit Alzheimer« aus. Es seien Geschichten, so das ZDF, in denen es um die Belastung, aber auch um Liebe, Freundschaft und Verantwortung gehe. Sie erzählten von Trauer und Verzweiflung, aber auch davon, wie sich »aus Lebensangst Lebensmut und neu gewonnene Nähe entwickeln« könnten. Das klingt – trotz aller Tragik – doch noch ein bisschen romantisch und hoffnungsvoll.
Wen kümmert es da, dass einige der in der TV – Dokumentation portraitierten Patienten gar keine Alzheimer-Diagnose hatten?
Dement durch Medikamente? Der Fall Walter Jens
Derlei Irrtümer und Fehler in der Zuschreibung der Alzheimer-Krankheit sind keine Seltenheit. Oft geschehen sie aus Unwissen. Mitunter aus Faulheit und Schlamperei. Manchmal womöglich sogar bewusst. Sicher ist nur, dass Fehldiagnosen mitunter fatale Folgen haben. Das zeigt unter anderem das Schicksal des renommierten Literaturkritikers Walter Jens.
Als sein Sohn Tilman Jens 2009 das Buch »Demenz. Abschied von meinem Vater« veröffentlicht, bricht in den Feuilletons ein Sturm der Entrüstung aus.Hinweis »Verräter! Vatermörder! Denunziant!«, wettern die Rezensenten. Denn Tilman Jens schildert nicht nur, wie sein einst so scharfsinniger und wortgewaltiger Vater mit Mitte 80 wieder zum Kind wird. Wie dieser heute Windeln trägt und sich freut, wenn er eine Puppe im Arm wiegen und Kaninchen füttern kann.
Zorn erregt auch Tilman Jens’ gewagte These von der Krankheit des Vaters als Flucht vor der eigenen Biografie. Nur wenige Wochen nachdem 2003 bekannt wurde, dass der 1923 geborene Rhetorikprofessor seit 1942 als Mitglied der NSDAP geführt worden war, verliert er sein zuvor phänomenales Gedächtnis und seine Sprache. Die Diagnose: Alzheimer. »Man könnte sagen, das ist alles reiner Zufall«, sagt Tilman Jens in einem Interview. »Aber ich kann das nicht ganz glauben.«Hinweis
Tatsächlich spricht vieles dafür, dass die Erkrankung von Walter Jens kein Zufall ist. Das macht den Fall auch aus medizinischer Sicht interessant. Jens litt nicht nur seit seiner Kindheit an Asthma, das er mit oft hohen Dosen von Kortison bekämpfte. Immer wieder plagen ihn auch psychische Krisen und krankhafte Ängste. Nach einer schweren Depression im Alter von 63 Jahren wird er abhängig von Medikamenten. Er schluckt Antidepressiva, Schlafmittel, Benzodiazepine – jahrzehntelang, hoch dosiert und zum Teil ohne jegliche Kontrolle.
Fragwürdige »Gottesgeschenke«
»Immer neue Psychopharmaka«, schreibt Tilman Jens, »längst sind es wahre Cocktails, werden ausprobiert, gelegentlich auch ohne ärztliche Rücksprache.« Darunter etliche Medikamente, die als Mittel mit der höchsten Missbrauchsrate in Deutschland gelten.Hinweis
Walter Jens macht kein Geheimnis daraus. Noch in den 90ern schwärmt er offen von seinen Pillen. Diese Medikamente seien »Gottesgeschenke«, sagt er in einem Gespräch mit dem Spiegel.Hinweis Offenbar ahnt er nicht, wie leicht einige der Präparate, die er schluckt, abhängig machen und welchen Schaden sie ihm zufügen. Auch seine Frau Inge registriert zwar längst »den Mix von mehr oder minder regelmäßig eingenommenen Medikamenten«, wie sie in ihrer 2009 erschienenen Autobiografie schreibt.Hinweis Doch selbst als der auch für sie »erschreckende Verbrauch an Psychopharmaka« unübersehbar und Walter Jens bereits abhängig ist, unternimmt sie nichts.
Er, der früher mit höchstem Genuss vor über tausend Zuhörern eine Rede hielt, traut sich nicht einmal mehr, ohne Tablette einen bis zur letzten Silbe vorformulierten Vortrag öffentlich abzulesen. »Inge, wo ist das Tavor?«, fleht der 81-Jährige seine Frau vor einem Auftritt an – und sie gibt nach. Überall zu Hause, so zeigt sich später, hat er kleine Tabletten-Depots, Tavor in Schubladen, Anzugtaschen, ja sogar zwischen Fontanes Werkausgabe versteckt.Hinweis
Zudem hortet er Rezepte. Die Verschreibungen, stellt der Sohn später fest, stammen von unterschiedlichen Ärzten in verschiedenen Städten und fast alle ermöglichen dem Vater den Bezug von Benzodiazepinen. Er bekommt diese Gaben, seine »Benzos«, bei Bedarf auch ohne Verschreibung, berichtet Tilman Jens. »Für einen Promi wie ihn gilt, was wir erst später herausfinden, in kaum einer Tübinger Apotheke Rezeptpflicht.«
Viele der Mittel, die Walter Jens nahm, sind seit Langem für ihre Gefahren bekannt. Ihre Nebenwirkungen und Entzugserscheinungen reichen von Verwirrung, unkoordinierten Bewegungen, Artikulationsstörungen und einer erhöhten Gefahr von Stürzen bis hin zu Bewusstseinsausfällen, Angstzuständen, Entfremdungserlebnissen und unbeabsichtigten Gewalttaten. Sie alle können noch auftreten, wenn man längst mit dem Schlucken der Mittel aufgehört hat. Denn die Wirkstoffe werden im Körper nur langsam abgebaut. Mehr noch: Gerade bei älteren Menschen ähneln die Nebenwirkungen und Entzugserscheinungen auf fatale Weise den Symptomen einer Demenz.
Auch Tilman Jens beobachtet bei seinem Vater merkwürdige Veränderungen. Als die Debatte um seine NSDAP – Vergangenheit losbricht, ist Walter Jens nicht nur depressiv. Auch die Psychopharmaka-Dosen haben sich »erheblich erhöht«, erinnert sich der Sohn. Walter Jens zeigt, wie es Demenztherapeuten nennen, »herausforderndes Verhalten«. Er schwankt zwischen Aggression und Apathie, zwischen Ohnmacht und Wut. Er ist verwirrt, hat Beklemmungszustände, ist schlecht auf den Beinen und leidet unter Albträumen.
Was Tilman Jens und seine Mutter Inge offenbar nicht ahnen: Nicht nur Glukokortikoide wie Kortison haben – vor allem, wenn sie über längere Zeit eingesetzt werden – beträchtliche Nebenwirkungen, die sich zum Teil in psychischen Störungen bis hin zu Psychosen äußern können.Hinweis Auch Psychopharmaka bergen Gefahren, die Laien häufig unterschätzen: Die meisten dieser Mittel wirken bei Menschen über 65 deutlich stärker als bei jungen. Oft reicht im Alter ein Drittel oder ein Viertel der Dosis, um die gleiche Wirkung zu erzielen.Hinweis Zudem dürfen die Mittel eigentlich nur für kurze Zeit, höchstens einige Wochen, verabreicht werden. Doch beides – auch das belegt der Fall Walter Jens – wird nur selten beachtet, geschweige denn kontrolliert.
Krankheits-PR mit Promi-Faktor
Woher der geistige Verfall des einstigen »Virtuosen des Wortes« rührt, ist ungeklärt. Vieles spricht jedoch dafür, dass seine Demenz sowohl auf Nebenwirkungen und Spätfolgen seines Medikamenten-Missbrauchs als auch auf einer Vielzahl kleiner Schlaganfälle und Hirnverletzungen durch Stürze beruht.
Trotzdem wird sein Schicksal auch von denen, die es besser wissen könnten, öffentlich als Alzheimer-Fall vermarktet. Aktuelles Beispiel: ein Symposium der Pharmafirmen Pfizer und Eisai im Herbst 2010. Zwei Tage lang referierten Professoren der Universität Frankfurt und anderer Hochschulen im Auftrag der Unternehmen darüber, wie man »offensiv gegen Alzheimer« vorgehen könne. Gemeinsam vertreiben die beiden Arzneimittelhersteller das am meisten verkaufte Alzheimer-Medikament Aricept. Als Highlight der Veranstaltung lockte ein Abendessen mit Dinner-Speech im Sheraton Frankfurt Congress Hotel. Der Gastredner: Tilman Jens.Hinweis
Derlei Krankheits-PR mit Promi-Faktor ist bei Alzheimer keine Seltenheit. Seit Jahren arbeiten Arzneimittelhersteller, Forscher und Verbände wie die Alzheimer Gesellschaft daran, das Leiden noch stärker ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Und wer immer die Massen erreichen will, setzt auf Prominente als Identifikationsfigur. Ob Walter Jens, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Ursula von der Leyens Vater Ernst Albrecht oder der kürzlich verstorbene amerikanische Columbo-Darsteller Peter Falk – je bekannter und salonfähiger Alzheimer durch berühmte Opfer wird, desto besser fürs Geschäft.
Dann nämlich setzt ein sich selbst verstärkender Mechanismus ein: Je häufiger ein Leiden zu sein scheint, desto häufiger wird es von Ärzten diagnostiziert. Und je häufiger eine Krankheit diagnostiziert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit weiterer gleicher Diagnosen. Am Ende entsteht so ein Zirkelschluss, in dem sich die Behauptung »viele ältere Menschen haben Alzheimer« durch die häufig gestellte Diagnose Alzheimer scheinbar selbst beweist.
Die Karriere einer Epidemie
Tatsächlich hat die Alzheimer-Krankheit eine erstaunliche Karriere hinter sich. Sie begann vor mehr als hundert Jahren in der »Städtischen Anstalt für Irre und Epileptische« in Frankfurt am Main. Lange Zeit allerdings nahm kaum ein Mediziner von dem ausgefallenen Hirnsyndrom Notiz. Ihren Aufstieg zur Volkskrankheit startete die Diagnose »Morbus Alzheimer« erst Jahrzehnte, nachdem sie fast vergessen war, in den USA.
Es ist die Geschichte einer beispiellosen PR – Kampagne, die mithilfe von Wissenschaft, Politik und Medien aus einer rätselhaften Anomalie bei einer jungen Frau ein scheinbar unausweichliches Schicksal für Millionen von älteren Menschen gemacht hat. Es ist, so der amerikanische Neurologe Peter J. Whitehouse, die Geschichte eines Mythos’, der gezielt erschaffen wurde, um Gelder für die Erforschung des Hirns und des Alters zu mobilisieren.Hinweis
Dass ausgerechnet ein Mann wie Whitehouse derart provokante Worte äußert, ist eine kleine Sensation. Denn der Mediziner von der Case Western Reserve University in Cleveland ist nicht nur selbst seit einem Vierteljahrhundert in der Alzheimer-Forschung aktiv. Einem Rating der Fachzeitschrift Journal of Alzheimer’s Disease von 2009 zufolge zählt er zu den Top 100 von weltweit schätzungsweise 25 000 Forschern auf dem Gebiet.Hinweis
Doch durch das, was er über die Jahre als Insider der medizinischen Forschung erlebt hat, hat sich sein Bild von der eigenen Zunft grundlegend gewandelt. Natürlich würden wir alle im Laufe unseres Lebens nach und nach einige unserer geistigen Fähigkeiten einbüßen, so Whitehouse. Der Glaube an die Alzheimer-Krankheit jedoch sei »ein Hirngespinst«. Schließlich würden mit dem Alter auch andere Kennzeichen der Jugend schwinden: Der Haarwuchs lässt ebenso nach wie die Sehkraft, die Hormonproduktion, die Spannkraft der Haut und die Muskulatur. »Alzheimer«, behauptet Whitehouse ketzerisch, sei die Erfindung einer milliardenschweren Industrie, die zum Großteil von Pharmafirmen und ein paar akademischen und anderen Experten gesteuert werde. Diese nutzten ihre medizinische Deutungshoheit, um sich eine optimale Unterstützung ihrer Arbeit zu sichern.
In nur wenigen Jahrzehnten, so Whitehouse, sei ein wahres »Alzheimer-Imperium« entstanden, mit Milliardenumsätzen, Forschungsinstituten und Lehrstühlen, immer neuen Medikamenten und Behandlungsansätzen.
Die rätselhafte Veränderung der Auguste Deter
Von alldem konnte der deutsche Nervenarzt Alois Alzheimer freilich nichts ahnen, als er 1901 auf den Fall der Auguste Deter stieß – jener Patientin, die später in die Medizingeschichte eingehen sollte. Berichten ihres Mannes zufolge war Deter stets ordentlich und liebenswürdig gewesen. Doch auf einmal wurde sie innerhalb weniger Monate immer vergesslicher, entwickelte Wahnvorstellungen, wurde ruhelos und begann, in allen Ecken und Winkeln der Wohnung Dinge zu verstecken.
Als Alois Alzheimer die Frau untersucht, ist sie gerade einmal 51 Jahre alt – und zeigt bereits alle Anzeichen von Demenz. Sie ist verwirrt, ruhelos und leidet unter Verfolgungswahn. Sie hat Probleme, Worte zu finden und willkürliche Bewegungen auszuführen. Selbst auf einfachste Fragen antwortet sie mit sinnlosen Sätzen. Sie schreit stundenlang herum und hat sowohl das Rechnen als auch das Schreiben verlernt. Zum Test lässt Alois Alzheimer sie multiplizieren: »Wenn Sie sechs Eier kaufen, das Stück zu sieben Pfennig, was macht das?« Deter antwortet darauf: »Pochieren.«
Die Krankengeschichte fasziniert und beschäftigt Alzheimer vor allem, weil sie so außergewöhnlich ist. Schon zuvor hat er ähnliche Symptome bei etlichen Patienten beobachtet. »Altersschwachsinn« ist auch damals bereits ein bekanntes Phänomen. Doch Auguste Deter unterscheidet sich von allen anderen in einem entscheidenden Punkt: Sie ist viel zu jung. Mit gerade einmal Anfang 50 hat sie Krankheitsanzeichen, die man sonst nur bei Demenzpatienten im Alter von 70, 80 oder 90 Jahren findet.
Als Alzheimers Ausnahmepatientin im April 1906 stirbt, lässt er sich ihr Gehirn schicken. Er hofft herauszufinden, was in dem kranken Organ verändert ist. Als Alzheimer die Gewebeproben unter dem Mikroskop betrachtet, entdeckt er außerhalb der Zellen »hirsekorngroße Herdchen«– zahlreiche Ablagerungen, sogenannte Amyloid-Plaques, die weite Teile des Gehirns durchsetzen. Zudem sieht er Unmengen rätselhafter, gedrehter Fasern, die aus abgestorbenen Nervenzellen herausragen, die sogenannten Tau-Fibrillen.
Weder Alois Alzheimer noch sein Chef, der international renommierte Psychiater Emil Kraepelin, wissen, wie sie die Rarität einordnen sollen. Die klinische Bedeutung, das gestehen beide Männer offen ein, ist unklar. Das zeigt unter anderem die letzte Notiz von Alois Alzheimer auf Deters Krankenakte. Unter der Überschrift »Art der Erkrankung« steht: einfache geistige Störung.
Ein Konkurrenzkampf bringt ein neues Leiden hervor
»Doch Kraepelin hatte ein Interesse daran, eine neue Krankheitskategorie zu kreieren«, so Whitehouse.Hinweis In Europa habe damals ein Konkurrenzkampf unter Psychiatern getobt. Es ging um Stolz und Prestige, Reputation und finanzielle Mittel, kurz: um die Vorherrschaft über die Definition seelischer Störungen in Europa. Und jede geistige Krankheit, die ein Mediziner neu entdeckte und beschrieb, konnte seinen Ruhm in der Fachwelt mehren.
Tatsächlich verschaffte Kraepelin der eigenartigen Erkrankung wenig später einen festen Platz in der Medizin: 1910 nahm er die Alzheimer-Krankheit erstmals als eigenständige Diagnose in die achte Ausgabe seines Lehrbuchs »Psychiatrie« auf. Damit war sie offiziell eingeführt.
Doch die Resonanz der damaligen Kollegen ist gering. Als Alois Alzheimer 1906 auf der Versammlung Südwestdeutscher Irrenärzte einen Vortrag über einen »eigenartigen, schweren Erkrankungsprozess der Hirnrinde« hält, sind die Zuhörer nicht sonderlich beeindruckt. Sie halten seinen Bericht für wenig relevant. Und Alzheimer selbst gesteht am Ende seines Vortrags: »Mein Fall AugusteD. bot klinisch ein so abweichendes Bild, dass er sich unter keine der bekannten Krankheiten einreihen ließ.«
Auch lange danach führt die Alzheimer-Krankheit ein Schattendasein. Über Jahrzehnte benutzen nur wenige Kliniker die Kennzeichnung. Und wenn, dann in jenen seltenen Fällen, wo die schweren Symptome einer Demenz schon bei Patienten im Alter von 40, 50 oder 60 Jahren auftreten.
Doch in den frühen 1970er-Jahren ändert sich die wissenschaftliche und gesellschaftliche Großwetterlage. Zum einen beginnen Industrienationen wie die USA auf einmal, rasant zu altern. Seit den späten 1960er-Jahren erreichen immer mehr Menschen das 85. Lebensjahr oder ein noch höheres Lebensalter. Die sogenannten »alten Alten« werden die am schnellsten wachsende Gruppe der Bevölkerung.
Zum anderen hatte sich die medizinische Technik in der Zwischenzeit enorm entwickelt. Bildgebende Verfahren ermöglichten auf einmal Einblicke ins Gehirn. Zudem hatten Forscher etliche neue Labormethoden entwickelt, mit denen sich selbst geringste Konzentrationen von Botenstoffen, Eiweißen und anderen Molekülen im Blut, im Gehirn oder im Nervenwasser messen lassen. Den führenden Neurowissenschaftlern in den USA war offenbar bewusst: Um all diese Methoden einsetzen und sowohl Alterungsprozesse als auch normale Funktionen des menschlichen Denkorgans erforschen zu können, brauchten sie Geld. Also begannen sie, sich nach einer vermehrten finanziellen Förderung ihrer Forschung umzuschauen.Hinweis
Eine fast vergessene Krankheit wird zum perfekten PR – Etikett
Dabei sei klar gewesen, so Whitehouse, dass man mit der Erforschung eines so vagen Themas wie dem »Alterungsprozess« keine Gelder würde lockermachen können. »Ihre Arbeit musste auf etwas sehr Reales und Unmittelbares gerichtet sein, etwas Furchteinflößendes und dennoch zum Menschen Zugehöriges – eine spezifische Krankheit, die massive Forschungsanstrengungen nach den Ursachen und Heilungsmöglichkeiten verdienen würde, eine Jahrhundertkrankheit. Diese Nische wurde von der Alzheimer-Krankheit perfekt ausgefüllt.«
Die Strategie zeigte Erfolg. 1974 gründete die US – Regierung das »National Institute on Aging« (NIA). Der erste Leiter des Instituts, der 2002 verstorbene Psychiater Robert Butler, setzte es sich zum Ziel, die Alzheimer-Krankheit mit aller Macht ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. »Ich hatte entschieden, dass wir sie zu einem alltäglichen Begriff machen mussten«, so Butler.Hinweis Der Begriff Senilität sei von nun an ein Wort »für den Papierkorb«.Hinweis Denn mit diesem Ausdruck werde unterstellt, dass ein Nachlassen der Hirnleistung unabwendbar und irreversibel sei. Und Butler wusste: Nur wenn man den Menschen eine Aussicht auf »Heilung« versprach, würde sich Geld vom Staat und von Spendern mobilisieren lassen.
Tatsächlich, so Whitehouse, habe Butler bereits in den 1970er-Jahren verkündet, dass man das Problem der Alzheimer-Krankheit innerhalb von fünf Jahren in den Griff bekommen werde. Regelmäßig erwähnte das NIA in seinen Verlautbarungen zudem die Worte »Heilung« und »Alzheimer«, wenn es darum ging, Gelder für Forschung einzuwerben.
Zudem kannte das NIA die entscheidende Rolle der Medien – und nutzte sie. Ein Mitarbeiter Butlers, Zaven Khachaturian, entwarf eine Strategie für die systematische Verbreitung des Alzheimer-Mythos. Bald tauchten Fürsprecher der »Krankheit« in den Medien auf, um über die neue Epidemie zu berichten. Der renommierte Neurologe Robert Katzman, damals am Albert Einstein College of Medicine in New York, behauptete im Leitartikel einer Fachzeitschrift, dass die Erkrankung Platz vier oder fünf in der Liste der häufigsten Todesursachen in den USA einnehme.Hinweis Beweise dafür gibt es bis heute nicht. Selbst überzeugte Alzheimer-Anhänger wie der Psychiater Harald Hampel von der Universität Frankfurt am Main betonen, dass man mit dieser Krankheit stirbt, nicht an ihr.Hinweis
Des Kaisers neue Kleider
Auch vielen Forschern seien Katzmans Behauptungen damals übertrieben vorgekommen, so Whitehouse. Doch dann setzte ein interessanter Mechanismus ein: Obwohl längst nicht jeder von der Existenz der neuen Krankheit überzeugt gewesen sei, sei es unter Hirnforschern und Medizinern »politisch unkorrekt« geworden, persönliche Zweifel daran zu äußern, dass es sie in dieser Form gibt.
Anders als in dem bekannten Kindermärchen »Des Kaisers neue Kleider« haben es Zweifler im Fall Alzheimer allerdings deutlich schwerer, den Schwindel zu enttarnen. Bei genauer Betrachtung ist es nämlich schlicht unmöglich, die Nichtexistenz einer Krankheit nachzuweisen. Das macht ein verblüffend einfaches Gedankenexperiment deutlich: Genauso, wie irgendjemand behaupten kann, dass ein diffuses Konglomerat von psychischen Störungen, Alterserscheinungen und Medikamentennebenwirkungen eine Krankheit namens Alzheimer ist, kann man auch postulieren, dass es blaue Schwäne gibt. Das Gegenteil zu beweisen, ist schlicht unmöglich. Wer kann schon sicher sagen, dass es keine blauen Schwäne gibt?
Die Strategie der Forscher jedenfalls ging auf. Schon bald sprang der Funke auf die Öffentlichkeit über. 1979 beschloss das NIA, gemeinsam mit den Vertretern einiger kleiner Selbsthilfegruppen, eine US – weite private Organisation zur Förderung der Alzheimer-Forschung zu schaffen. Im April 1980 wurde die Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (ADRDA) aus der Taufe gehoben.Hinweis
Bereits zwei Jahre später beauftragte die ADRDA eine Beraterfirma mit der Organisation ihrer Lobbyarbeit. Ziel der Aktion sei es gewesen, so Whitehouse, dem Verband einen besseren Zugang zu Repräsentanten und Senatoren zu verschaffen und so in Washington für mehr Beachtung und Aufmerksamkeit zu sorgen. Und siehe da: Bald wurde die Alzheimer-Krankheit im Kongress zu einem häufigen Tagesordnungspunkt.
Rita Hayworth und traumhafte Steigerungen des Forschungsbudgets
Das Engagement zahlte sich aus. 1979 hatte das NIA noch rund 4 Millionen US – Dollar für die Alzheimer-Forschung zur Verfügung. 1991 waren es bereits 155 Millionen Dollar und damit das 38-Fache der Summe von 1979. 2007 betrug das Budget 643 Millionen Dollar.Hinweis Von solchen Steigerungsraten können selbst hochprofitable Unternehmen nur träumen.
Um die breite Öffentlichkeit zu erreichen, nutzte die ADRDA, die heute nur noch Alzheimer’s Association heißt, einen weiteren Trick. Sie setzte auf die Zugkraft berühmter Namen. Einer davon ist Rita Hayworth. Die einstige »Liebesgöttin« Hollywoods erhielt 1981 die Diagnose Alzheimer. Mitte der 1980er-Jahre begann ihre Tochter Prinzessin Yasmin Aga Khan die Krankheit ihrer Mutter für zahlreiche Awareness-Kampagnen zu instrumentalisieren.
Vieles spricht auch hier für einen Etikettenschwindel. Denn Rita Hayworth war nicht nur unbeherrscht und launisch. Jahrelang hing die Diva auch an der Flasche.Hinweis Im Rausch warf sie ihrem Nachbarn leere Ginflaschen über die Hecke und irrte mitunter verwahrlost und selbstvergessen durch die Straßen von Beverly Hills. Und seit Langem weiß man: Alkoholexzesse verursachen schwere Schäden im Gehirn und sind eine der häufigsten Ursachen für eine irreversible Demenz.
Doch bis heute hält ihre Tochter Aga Khan unter dem Label Alzheimer in mehreren Städten der USA jährlich »Rita-Hayworth-Galas« ab. Ziel der Veranstaltungen ist es, durch Spenden der High Society Geld für die Erforschung der Alzheimer-Krankheit zu sammeln. Nach Angaben der Alzheimer’s Association sind so über die Jahre in den verschiedenen Städten jeweils zweistellige Millionenbeträge an Dollar zusammengekommen.
1984 wurde Aga Khan zudem Präsidentin der damals neu gegründeten internationalen Alzheimer-VereinigungADI, einem hocheffektiven Lobby-Verband der Pharmaindustrie. Eine Funktion, die Aga Khan bis heute innehat. Um die Botschaft von der »Alzheimer«-Krankheit auch über den Rest des Globus zu streuen, erklärte die ADI 1994 den 21. September zum Welt-Alzheimer-Tag. Seither sorgen die ADI und alle ihre Mitglieder dafür, dass die Öffentlichkeit auf die Krankheit aufmerksam wird.
Längst hat die Welle auch Deutschland erreicht. In den vergangenen Jahren ist hierzulande ein kaum sichtbares Kartell um die Alzheimer-Krankheit entstanden. Mediziner, Forscher und Pharmafirmen bringen dabei mithilfe von Selbsthilfeorganisationen und Medien ihre Botschaften unters Volk und unterdrücken unbequeme Wahrheiten, um sich gegenseitig in ihrer Karriere zu pushen.
Die Alzheimer-Story – Version 3.0
Inzwischen bricht sich schon der nächste Trend Bahn. Das geht aus einem denkwürdigen Positionspapier hervor, das eine internationale Gruppe führender Alzheimer-Forscher im Oktober 2010 in der Fachzeitschrift Lancet Neurology veröffentlicht hat.Hinweis Die Experten schlagen darin nämlich vor, die Alzheimer-Krankheit völlig neu zu definieren.
Aus den Zielen, die dahinterstecken, machen sie keinen Hehl. Mithilfe der neuen Definition soll es zum einen möglich werden, künftig noch mehr Menschen noch viel früher mit dem Etikett »Alzheimer« zu versehen als bisher. So sollen zum Beispiel all diejenigen Personen, denen man bisher die schwammige Diagnose »leichte kognitive Störungen« oder »Mild Cognitive Impaivment« (MCI) gegeben hat, künftig nicht mehr nur als »Risikokandidaten« für eine spätere Erkrankung an Alzheimer gelten. Mediziner sollten vielmehr »anerkennen«, dass diese Menschen bereits Alzheimer haben und dass ihre Erkrankung über kurz oder lang unweigerlich zu einer echten Demenz führen werde – obwohl es dafür keinen Beweis gibt.
Die neue Definition, schreiben die Experten, sei ganz im Sinne der Patienten. Für diese nämlich sei die Diagnose im Hinblick auf Prognose und Behandlung der Krankheit sehr viel »wertvoller«. Genau das aber ist, wie dieses Buch in den folgenden Kapiteln genauer darlegen wird, mehr als zweifelhaft.
Zum anderen soll das neue »Lexikon« Forscher und Mediziner von den lästigen Widersprüchen ihrer eigenen Theorien befreien. Immer wieder, beklagen die Autoren des Positionspapiers, komme es nämlich zu Verwirrung, weil die zu Lebzeiten gestellten Alzheimer-Diagnosen in vielen Fällen nicht mit den späteren Befunden bei der Obduktion übereinstimmen wollen.
Vergesst Alois! Oder: Wenn die Krankheit nicht mehr zur gewünschten Diagnose passt
Für die Diagnose »Alzheimer«, so ihr Vorschlag, soll es künftig keine Rolle mehr spielen, ob das Gehirngewebe tatsächlich, wie bei Alois Alzheimers Patientin, auffällig verändert ist.
Lange Zeit galt der Nachweis bestimmter Eiweißablagerungen im Gehirn nach dem Tod als einziges zuverlässiges Verfahren, Alzheimer zu diagnostizieren. Längst hat sich jedoch gezeigt, dass auch diese Untersuchung massive Widersprüche liefert (s. Kapitel 2).
Die Verfasser des denkwürdigen Positionspapiers griffen daher zu einem Trick: Das, was der Pathologe unter dem Mikroskop finde, fordern sie, sei künftig von der neuen Alzheimer-Krankheit klar zu trennen. Die „eigentliche“ Alzheimer-Krankheit solle von nun an das sein, was die Mediziner mithilfe von Biomarkern und anderen Verfahren zu Lebzeiten des Patienten diagnostizieren – damit es (angesichts der Widersprüche) nicht mehr zu „Verwirrung“ komme.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Kunstgriff höchst ungewöhnlich. Normalerweise funktioniert es in der Forschung umgekehrt: Wer feststellt, dass das, was er in seinen Experimenten beobachtet, der eigenen Theorie widerspricht, gibt irgendwann zu, dass er sich irrt. Für die Autoren des Positionspapiers gilt das offenbar nicht. Statt zu hinterfragen, warum so vieles an ihrem Theoriegebäude der »Alzheimer-Krankheit« hinten und vorne nicht zusammenpasst, schaffen sie lieber den einzigen Pfeiler ab, auf den ihre gesamte Story aufgebaut ist.
Eine mögliche Erklärung für die erstaunlichen Vorschläge der Autoren findet sich im Kleingedruckten der Veröffentlichung in Lancet Neurology. Unter dem Stichwort Interessenkonflikte zeigt sich: Die Verfasser des Positionspapiers haben beste Beziehungen zur Industrie. Fast alle haben offiziell einen akademischen Job. Gleichzeitig stehen die meisten von ihnen jedoch auf der Honorarliste genau jener Pharmafirmen und Medizingerätehersteller, die von der neuen Definition der Alzheimer-Krankheit erheblich profitieren würden.
[Menü]
2 Schon verrückt – oder doch (noch) normal? Die Krux mit der Diagnose
Von Psychiatrieprofessoren, so sollte man meinen, kann man erwarten, dass ihnen klar ist, was sie öffentlich über ihr Fachgebiet sagen. Doch beim Thema Alzheimer sind offenbar selbst führende Experten verwirrt. Anders ist kaum zu erklären, warum sich manch einer von ihnen diametral widerspricht.
»Die heutige Diagnose von Demenzerkrankungen«, heißt es zum Beispiel auf der Website des Kompetenznetzes Demenzen, gebe eine »medizinische Erklärung« für die Leistungseinschränkungen und Verhaltensänderungen und schaffe »Klarheit«, auch in Bezug auf geeignete Therapiemaßnahmen.Hinweis In dem Forschungsverbund sind die auf diesem Gebiet führenden psychiatrischen Universitätsklinken Deutschlands zusammengeschlossen. Durch spezielle Tests könnten Mediziner sogar feststellen, wer in einigen Jahren an Alzheimer erkranken werde, behauptet zum Beispiel Jens Wiltfang, Psychiatrieprofessor von der Universität Duisburg-Essen und Vorstandsmitglied im Kompetenznetz Demenzen. Derlei Früherkennung sei sinnvoll, betonte Wiltfang schon vor Jahren. Denn: Je früher die Behandlung beginne, desto besser.Hinweis
In einer anderen Rubrik der Website dagegen gesteht Wiltfang: »Bislang lassen sich verschiedene Demenzen nur durch den Ausschluss anderer Krankheiten indirekt feststellen.« Und: Eine direkte Diagnostik, mit der man Demenzen schon im Frühstadium zuverlässig erkennen könne, fehle.Hinweis
Der Laie ist verblüfft. Wie kann man eine Krankheit Jahre im Voraus erkennen, wenn man sie nicht einmal diagnostizieren kann, nachdem sie bereits ausgebrochen ist? Und: Plädieren die Experten tatsächlich dafür, gesunde Menschen mit Medikamenten gegen Demenz zu behandeln, ohne sicher sagen zu können, ob diese je daran erkranken werden? Werden den Patienten und ihren Angehörigen hier womöglich Potemkinsche Dörfer vorgespiegelt, um die Forschung und die Karrieren einzelner Mediziner zu beflügeln?
Schizophrenie mit System: Was Ärzte über Alzheimer nicht wissen – und wie sie trotzdem so tun, als ob
In der Tat sprechen mehrere Indizien für eine solche Vermutung. Beispiel Kompetenznetz Demenzen: Allein das Bundesforschungsministerium (BMBF) hat den 2002 geschaffenen Forschungsverbund in den vergangenen Jahren mit jährlich 2,55 Millionen Euro gefördert.Hinweis Ein beträchtlicher Teil davon ist auch in das Projekt »Früherkennung und Diagnostik von Demenzen« von Jens Wiltfang und seinem Erlanger Kollegen Johannes Kornhuber geflossen.
Künftig fällt der Geldsegen hierzulande sogar noch größer aus. 2009 haben das Bundesforschungsministerium und mehrere Bundesländer mit dem »Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen« (DZNE) ein neues Netzwerk zur Erforschung der Alzheimer-Krankheit und anderer Demenzen geschaffen. Bis 2015 soll es auf die vorgesehene Größe wachsen. Jahresbudget: 60 Millionen Euro. Das ist mehr als das Zwanzigfache dessen, was das Kompetenznetz erhielt. Damit können Demenzforscher in nächster Zeit aus dem Vollen schöpfen.
Warum sollte der Staat das tun, wenn die heutigen Verfahren für die Früherkennung, Diagnose und Therapie der Alzheimer-Krankheit bereits bestens funktionierten?
Was ist Demenz – und wenn ja, wie viele?
Tatsächlich tappen Mediziner und Forscher in Sachen Alzheimer-Krankheit und Demenzen (lat: Dementia »ohne Geist«) noch ziemlich im Dunkeln. Sie kennen häufig weder die Ursachen der nachlassenden Hirnleistungen noch können sie vorhersagen, wie die Erkrankung bei einem Patienten verlaufen wird.
»Wir gehen mit der Alzheimer-Krankheit um, als sei sie so real wie die Pest«, konstatiert der US – Neurologe Peter J. Whitehouse. »Und doch können nicht einmal die Spitzenexperten des Fachgebiets eine präzise Diagnose stellen.«Hinweis
Wie viel Sprengstoff in den Sätzen liegt, zeigt sich erst auf den zweiten Blick:
•
Ohne zuverlässige Diagnose kann niemand wissen, wer von all jenen Menschen, die heute schon mit der niederschmetternden Diagnose Alzheimer leben müssen, in Wirklichkeit eine ganz andere körperliche oder psychische Erkrankung hat.
•