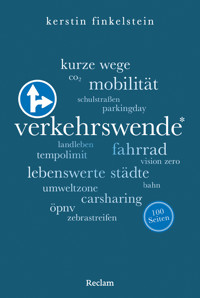
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit Vollgas auf die Bremse? »Der innerstädtische Raum ist aufgeteilt; keine deutsche Stadt klagt über zu wenig Verkehr und zu viel ungenutzte Fläche. Für eine Verkehrswende hieße es also, den bereits aufgeteilten Platz neu zu vergeben.« Hat die Verkehrswende nur Verspätung oder fällt sie einfach aus? Das fragen sich viele, wenn sie wieder einmal im Stau stehen oder am Bahnsteig warten. Und mit den guten Vorsätzen beim Klimaschutz ist es ja auch so eine Sache. Kerstin Finkelstein beschäftigt sich seit Jahren mit Verkehrspolitik und zeigt, was in Deutschland falsch läuft – aber auch, wie die Mobilitätswende doch noch gelingt. Mit 4-farbigen Abbildungen und Infografiken. - Das Buch für alle, die klimafreundlich mobil sein wollen - Eine kluge Bestandsaufnahme und ein Blick voraus - Von einer ausgewiesenen Expertin mit klarer Haltung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kerstin Finkelstein
Verkehrswende. 100 Seiten
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962480
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: zero-media.net, München
Bildnachweis siehe Anhang
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962480-8
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020784-0
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Als Radfahrerin in Deutschland – die Bestandsaufnahme
Die Kosten
Das Recht
Das Landleben
Die Vorbilder
Die Zivilgesellschaft
Das verkehrsgewendete Deutschland
Lektüretipps
Bildnachweis
Über die Autorin
Über dieses Buch
Leseprobe aus Biodiversität. 100 Seiten
Als Radfahrerin in Deutschland – die Bestandsaufnahme
Ich bin Radfahrerin, fast immer und fast überall. In meiner Kindheit und Jugend fuhr ich auf dem Rad zur Schule und konnte die nahe Kleinstadt ein paar hundert Meter vor dem Ortsschild schon riechen. Während der Studienzeit genoss ich die Freiheit, dank des Rades jederzeit nach Hause fahren zu können, ohne auf Fahrpläne oder konsumierte Getränke achten zu müssen. Beruflich fuhr ich an Krokodilen in Burkina Faso vorbei, radelte bei Vollmond in der Sahara und unternahm die herausragend gruseligste Radtour meines Lebens im chinesischen Chengdu: Mit örtlichen Guides nahm ich dort den kürzesten Weg aus der Stadt. Und der führte nun einmal über die nicht abgesperrte Autobahn, auf der Lkw an uns vorbeidonnerten.
Inzwischen fahre ich vor allem in Berlin, zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Oft bin ich nicht mehr allein unterwegs – was die Messlatte dieses Buches beeinflusst. So fand ich vor ein paar Jahren noch, dass eine lebenswerte Stadt sich dadurch auszeichnet, dass eine Frau mit Minirock nachts um vier Uhr allein sicher nach Hause radeln kann. Inzwischen will ich mehr: eine Stadt, in der ein kleines Kind tagsüber mit seiner Mutter sicher zur Kita und zum Spielplatz radelt. Und in der es ein paar Jahre später sicher zur Schule und zu seinen Freunden fahren kann – und zwar allein.
In deutschen Städten sieht es diesbezüglich trübe aus. Dank Jahrzehnten »autofreundlicher« Politik sollen auch kleine Menschen überall aufpassen, anstatt frei zu leben und herumzutollen. Da sie das naturgemäß nicht können, werden Kinder zu ihrer körperlichen Sicherheit in die ständige Aufsicht ihrer eine Armlänge entfernten Eltern gezwungen – während Autos frei spielen können. Viele Kinder kennen das Elterntaxi besser als den Geh- oder Radweg. Das ist weder für die Eltern noch für die Kinder gesund. Klimafreundlich auch nicht. Ja nicht einmal volkswirtschaftlich sinnvoll: In Deutschland wird der motorisierte Individualverkehr von der Politik gefördert, subventioniert und allen anderen Verkehrsmitteln vorgezogen. Das Ergebnis ist eine gesellschaftlich bezuschusste steigende Anzahl von Pkw sowohl in Großstädten als auch in Deutschland insgesamt.
Aber ist es nicht deutlich cooler, mit einem stylischen Rad über der Schulter am Eiscafé vorbeizuschlendern, als auf der Suche nach einem Parkplatz alle Gäste dreimal mit einer Abgasfahne zu belästigen? Ist es nicht entspannender, im Zug oder Bus gefahren zu werden, anstatt selbst aufpassen zu müssen, dass Tank oder Batterie gefüllt sind – und dass man unterwegs keinen Unfall verursacht? Nur: wie hinkommen zum verkehrsgewendeten Land, dessen öffentlicher Raum nicht von Abgasen, Lärm und Gestank bestimmt wird, sondern Platz für Lebensfreude, Sinnlichkeit und Glück bietet? Und in dem ein Leben mit Arbeit, Familie und Hobbys autofrei organisierbar ist? Wie müsste die Infrastruktur aussehen, die eine wirklich freie Entscheidung zwischen Verkehrsmitteln ermöglicht, die Leben schützt und finanzierbar ist?
In diesem Buch soll ein Überblick gegeben werden: über den Ist-Zustand und wie es so weit kommen konnte. Über Vorbilder, die Verkehr bereits anders handhaben. Über Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Und über Bausteine, die Deutschland zur Verkehrswende leiten könnten.
Der Ist-Zustand lässt sich zum Beispiel am Platz ablesen, an der Verteilung öffentlichen Raums also: Derzeit ist von einer »Verkehrswende« zwar häufig zu lesen, aber nichts zu sehen. Die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Autos steigt seit Jahren massiv. 2014 waren noch 43,9 Millionen Pkw gemeldet, zehn Jahre später sind ganze 59 Millionen Kfz unterwegs – was einer Steigerung von 34 Prozent entspricht. Zugleich geht das Auto mit dem Alter auch immer mehr in die Breite. Der VW Golf zum Beispiel war bei seiner Entwicklung 1974 noch 20 Zentimeter schmaler als heute. Und ist trotzdem noch ein Hänfling im Vergleich zu SUV, die inzwischen fast ein Drittel der Neuzulassungen ausmachen.
Mehr Blech, weniger Raum: Wenn Autos wachsen, schrumpft die Stadt für alle anderen.
Autofahrerinnen haben also nicht nur gefühlt, sondern auch ganz real heute individuell viel weniger Platz als früher. Allerdings wurden die Räume nicht in erster Linie durch gezielte politische Entscheidungen für andere Verkehrsarten enger, sondern durch den Erfolg des Konzepts Auto: Aufs Auto wurden Städte ausgerichtet, Autobahnen und Schnellstraßen verbinden alle größeren Ortschaften, selbst der kleinste Badesee ist per Pkw erreichbar, Autos parken an allen Straßenrändern. Und der Großteil dieser riesigen Infrastruktur steht den Autonutzern ohne Extrakosten in Form von Maut oder Parkraumbewirtschaftung zur Verfügung, Erreichbarkeit per Auto ist eine gefühlte Selbstverständlichkeit. Alternativen wie Bus und Bahn wurden zeitgleich zurückgefahren, regionale Infrastruktur vom Krämerladen bis zum Krankenhaus abgebaut – was das Auto als Verkehrsmittel für die Bevölkerungsmehrheit interessant bis notwendig machte. Inzwischen gibt es so viele und so große Autos wie nie zuvor, was weniger Bewegungsspielraum für jedes einzelne Kfz bedeutet.
Tatsächlich entspricht wenig Bewegung indes gewissermaßen dem Charakter dieses Verkehrsmittels: Das Auto ist mehrheitlich ein Autoimmobil – durchschnittlich wird es 23 Stunden am Tag parkend irgendwo abgestellt. Dabei produziert es zwar immerhin keine Schadstoffe und bringt niemanden in Unfallgefahr, verbraucht aber Platz: Für jeden Pkw werden drei Parkplätze von den Stadtbauingenieuren eingeplant, einer vor dem Zuhause der Besitzerin, einer in der Nähe des Arbeitsplatzes und ein dritter an Orten, wo man sonst so hinmöchte, etwa zum Einkaufen oder Essengehen. Das macht nach der heutigen Parkplatznormgröße 33 Quadratmeter Flächenverbrauch – ausschließlich fürs Nicht-genutzt-Werden. Nur einmal zum Vergleich: Auf die Frage, wie groß sie sich ein Kinderzimmer wünschen, antwortete fast die Hälfte der Befragten mit 16 bis 20 Quadratmetern, ein Drittel fand sogar die Größe eines einfachen Parkplatzes (11 Quadratmeter) wünschenswert. Und das ist Wunsch und nicht die (kleinere) Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht hingegen so aus, dass Autos immer größer konzipiert und verkauft werden und heutige Modelle gar nicht mehr auf herkömmliche Parkplätze passen – weshalb vom Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger (BVS) bereits gefordert wird, Verkehrs- und Stadtplanerinnen hätten sich an die neue Realität anzupassen, indem sie größere Parkplätze planen.
Semantisch nimmt das Auto schon lange einen extra breiten Platz ein. Das Wort »Straße« bezeichnet nämlich eigentlich alle öffentlichen Plätze und Wege. »Auf der Straße« ist in größeren Ortschaften, wo kaum ein Weg oder Platz in Privatbesitz ist, also eigentlich ein Synonym für »draußen«. Radverkehrsinfrastruktur und Gehwege gehören genauso zur »Straße« wie Marktplätze mit Parkbänken. Die »Fahrbahn« hingegen bezeichnet den Bereich, auf dem unter anderem mit Autos gefahren wird. Dank jahrzehntelanger Stadtplanung pro Auto sind wir Menschen durch das Erleben täglicher Realität so trainiert, dass viele glauben, die derzeitige Raumaufteilung zugunsten des Transportmittels Auto sei naturgegeben. Früher waren Straßen jedoch auch Orte der Begegnung, wo man kurz für einen Plausch mit dem Nachbarn stehen blieb. Heute spielt kein Kind mehr auf der Straße, menschliches Leben ist weiträumig zugunsten des Autoverkehrs verschwunden. Der öffentliche Personenverkehr, also alle Angebote mit Bahn, Tram, Bus, Schiff und Seilbahnen, die gemäß einem definierten Fahrplan durchgeführt werden, nimmt vergleichsweise wenig Platz ein.
Wie viel Raum Autos zur Alleinnutzung zugesprochen wird, kann jeder beim Blick aus dem Fenster erahnen. Wirklich ausgerechnet hat das indes noch keine Kommune in Deutschland. Schließlich ist es die Norm, dass 70 oder 80 Kilogramm schwere Menschen mehr als 1000 Kilogramm schwere Maschinen nutzen, um sich einige Kilometer weit bewegen zu lassen. Diesem Denken folgend müssen Autos überall fahren und parken – und Aufgabe der Kommune ist es lediglich, ihnen dafür Platz zu schaffen.
Doch mit dem Platz gibt es derzeit ein Problem. Der innerstädtische Raum ist aufgeteilt; keine deutsche Stadt klagt über zu wenig Verkehr und zu viel ungenutzte Fläche. Für eine Verkehrswende hieße es also, den bereits aufgeteilten Platz neu zu vergeben.
Und wie sieht die derzeitige Verteilung aus, welche Flächen darf wer nutzen? Während diese Frage für den motorisierten Verkehr (= Fahrbahn), zu Fuß Gehende (= Gehweg) und Züge (= Schienen) leicht zu beantworten ist, gelten für den Radverkehr diverse unübersichtliche Regeln. Diese sind vom Gesetzgeber zur vollständigen Verwirrung zum Teil als »kann« und nicht als »muss« ausgelegt worden. Durch die unübersichtliche Rechtslage ergeben sich zum Teil sogar Unklarheiten, was bei einem Unfall von der jeweiligen Versicherung gedeckt ist. Daher hier eine Übersicht der wichtigsten Regelungen, die den verfügbaren Raum für Fahrradfahrerinnen festlegen:
Der Gehweg ist für Fußgänger da. Radfahrer dürfen ihn indes auch nutzen, wenn:
sie höchstens zehn Jahre alt sind. Sind sie jünger als neun Jahre, müssen sie den Gehweg sogar nutzen und dürfen nicht auf der Fahrbahn fahren. Es sei denn, der Gehweg birgt besonderes Gefahrenpotential (ist zum Beispiel sehr schmal), dann dürfen/müssen auch jüngere Kinder in Begleitung eines Erwachsenen auf der Fahrbahn fahren;
sie als Begleitperson ein höchstens zehn Jahre altes Kind begleiten;
sie das Rad als Roller nutzen. Dabei muss der rechte Fuß auf dem linken Pedal stehen, der linke Fuß darf Schwung holen;
sie das Rad schieben;
ein Schild den Weg als gemeinsamen Fuß- und Radweg ausschildert.
Die Fahrbahn ist für den motorisierten Verkehr da. Radfahrer dürfen sie auch nutzen, wenn:
es keinen Radweg gibt;
es zwar einen Radweg gibt, dieser aber nicht durch ein Schild als zur Nutzung verpflichtet ausgewiesen ist. Radfahrerinnen können in diesem Fall frei entscheiden, ob sie lieber Radweg oder Fahrbahn nutzen wollen;
eine Fahrradspur auf der Straße markiert ist, allerdings nicht mit einem Schild ausgewiesen wurde.
Dass Radfahrer oftmals kreuz und quer durch die Stadt fahren, liegt somit zu einem guten Teil an den unübersichtlichen Regeln. Denn nicht nur dürfen sie den Raum der Fußgängerinnen und Autofahrer zum Teil ebenfalls nutzen – ihr eigener Raum ist ebenso vielfältig wie unklar.
Zur Radinfrastruktur zählen:
baulich angelegte Radwege: Solche Radwege unterscheiden sich zum Beispiel durch den Belag oder die Farbe von dem meist daneben verlaufenden Fußweg. Radwege sollen nach den Verwaltungsvorschriften der Straßenverkehrsverordnung (StVO) 1,50 bis 2 Meter breit sein. Faktisch gibt es aber vielerorts noch Radwege von 60 Zentimetern Breite (was der Schulterbreite eines gut trainierten Menschen entspricht);
Radfahrstreifen: auf die Fahrbahn aufgetragene, weiße, durchgezogene Linien (in der Regel benutzungspflichtig);
Schutzstreifen: auf die Fahrbahn aufgetragene, weiße, durchbrochene Linien (in der Regel nicht benutzungspflichtig);
gemeinsame Geh- und Radwege;
getrennte Geh- und Radwege.
Gemeinsamer Geh- und Radweg
Radweg (Benutzung Pflicht)
Getrennter Geh- und Radweg
Zusammengefasst dürfen beziehungsweise müssen Radfahrende mal so, mal so, mal hier und mal dort fahren.
Doch wie viel Raum wird dafür bereitgestellt? Den Versuch, zahlenmäßig Sicht in den Nebel zu bringen, hat die Agentur für clevere Städte unternommen. Zusammen mit einer Gruppe von Studierenden hat sie sich die Mühe gemacht, Berliner Straßen zu vermessen. Sie stellten fest: Zwanzigmal mehr Verkehrsflächen sind für Autofahrerinnen gegenüber Radfahrern reserviert.
Verkehrsflächenverbrauch je Nutzungsart
Nach ihren Berechnungen wurden im Jahr 2014 58 Prozent der hauptstädtischen Verkehrsfläche vom Autoverkehr beansprucht – und drei Prozent vom Radverkehr. Die Verteilung der zurückgelegten Wege sieht jedoch ganz anders aus: 26 Prozent der Wege entfallen hier auf das Auto; 18 Prozent der Wege auf das Fahrrad (wobei der Radanteil seit Jahren stetig steigt, jener der Autonutzung langsam sinkt).
Der Infrastrukturatlas der Heinrich-Böll-Stiftung von 2020 kommt zu ähnlichen Ergebnissen: 2017 waren in Berlin insgesamt etwa 48 Quadratkilometer für Autos vorgesehen, während Schienenfahrzeuge lediglich rund acht Quadratkilometer und Fahrräder knapp fünf Quadratkilometer beanspruchten. Der Verkehrsmittelnutzung entspricht die Raumverteilung nicht:
Wegeanteile nach Verkehrsmittelgruppen für Berlin – Binnenverkehr (2018)
Auch in anderen Städten wird dem Auto der meiste Platz überlassen, obwohl es für die innerstädtische Mobilität nur einen nachgeordneten Rang hat: Anders als auf dem Land werden die meisten Wege in der Stadt nicht mit dem Auto zurückgelegt. Was zum einen am Vorhandensein öffentlicher Verkehrsmittel liegt und zum anderen an der durchschnittlichen Weglänge von sechs Kilometern – eine klassische Raddistanz!
Flächenverbrauch nach Verkehrsmittel
Sinnvolle Aufgabe von Verkehrspolitik wäre es also, durch eine Anpassung der innerstädtischen Flächenverteilung an tatsächliche Nutzungsgewohnheiten eine Verkehrswende zu unterstützen.
Und wie sieht es im großen, ländlichen Rest Deutschlands aus? Wie hoch ist der Anteil der einzelnen Verkehrsmittel an den insgesamt zurückgelegten Kilometern in ganz Deutschland? Laut der gerade mit neu erhobenen Daten in Überarbeitung befindlichen Studie »Mobilität in Deutschland 2017« des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur legen in Deutschland im Durchschnitt alle Menschen zusammen jeden Tag gut drei Milliarden Personenkilometer auf rund 257 Millionen Wegen zurück. Rund 57 Prozent dieser Wege werden mit dem Auto zurückgelegt, auf dem Land sind es bis zu 70 Prozent. Den größten Anteil am motorisierten Individualverkehr in Deutschland hatten 2016 Urlaubs- und Freizeitfahrten mit über 35 Prozent. Nur 20 Prozent waren Berufs- und knapp 15 Prozent Ausbildungs- und Geschäftsverkehr.





























