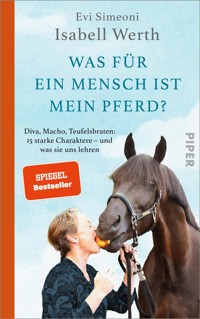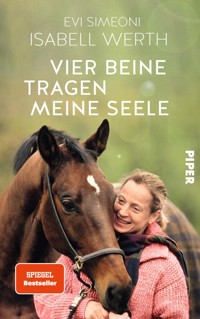
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Isabell Werth ist die erfolgreichste Reiterin der Welt. Dieser Erfolg wäre nicht möglich gewesen ohne ihren einzigartigen Zugang zu Pferden. Gemeinsam mit der renommierten Sportjournalistin Evi Simeoni, die Isabell Werths Werdegang von Anfang an miterlebt und beschrieben hat, zeichnet sie ihr Leben nach und erzählt damit auch die Geschichte ihrer wichtigsten Pferde. Schon in ihrer Kindheit auf dem Bauernhof am Niederrhein zeigte sich ihre besondere Fähigkeit, sich in ein Pferd einzufühlen und vorauszusehen, wie es wenig später reagieren wird. So erfährt man nicht nur etwas über Isabell Werths Ausnahmekarriere, sondern auch viel über unterschiedliche Pferdecharaktere und den Umgang mit diesen sensiblen und talentierten Tieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
In memoriam Dr. Uwe Schulten-Baumer
© Piper Verlag GmbH, München 2018Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Jacques ToffiDatenkonvertierung: Uhl + Massopust, Aalen
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Motto
1 Rheinberg
2 Gigolo
3 Der Doktor
4 Rollkur-Alarm
5 Satchmo
6 Madeleine
7 Totilas
8 Bella Rose
9 Die Piaffe
10 Doping
11 Weihegold
12 Der Mensch darf sich tragen lassen
Danksagung
Anhang
Isabell Werths wichtigste Pferde
Isabell Werths größte Erfolge
Bildteil
Bildnachweis
Liebst du den Tanz? Das Pferd ist ein Tänzer an deiner Hand: ein Tänzer in die Unendlichkeit. Aus dem Schwung, den du ihm mitteilst, folgt die Leichtigkeit, folgt das Schweben. Alle Kraft fühlst du sich unter deinem Sattel vereinigen. Das Land bleibt hinter dir zurück. Die Welt fließt an dir vorüber. Dein Tänzer trägt dich davon.
Aus Rudolf G. Binding: Reitvorschrift für eine Geliebte
Der Autor erhielt für diese Schrift bei den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam, wo Kunstwettbewerbe noch zum Wettkampfprogramm gehörten, eine Silbermedaille.
1 Rheinberg
Dem, der einem guten Pferd ins Auge blickt, braucht man nichts mehr zu erklären. Ein Pferd ist ein Pferd ist ein Pferd. Das Beste an ihm ist sein Pferd-Sein. Es schaut uns an, aufmerksam und gelassen, und wir sehen uns selbst neu in seinem dunklen Blick. Wir schnuppern sein Aroma. Es ist herrlich, duftet nach herbem Gras und Getreide, nach der wohligen Wärme des Stalls und der Süße von Äpfeln und Rüben. Und wonach noch? Fernweh? Sehnsucht nach Nähe? Mit appetitlichem Krachen zerbeißt es eine Möhre, während es uns weiter beobachtet.
Es erlaubt uns, seine Nüstern zu berühren – sie sind so zart, vergleichbar nur mit der Haut eines Babys. Wenn es mit seinen Lippen ein Stück Apfel aus unseren Händen klaubt, kräuselt sich die Nase. Das Pferd atmet schnaubend aus. Wenn es sich auf der Weide langsam voranarbeitet, stetig und vorsichtig das Gras rupfend, strahlt es Frieden aus. Es gibt uns ein Gefühl von ruhiger Gegenwart. Wenn es einen Hügel hinaufgaloppiert, verwandelt es sich in eine Wolke aus Tempo und Sauerstoff. Pferde können einen Menschen fesseln und nie wieder loslassen.
Mit kaum einem anderen Lebewesen kann sich der Mensch über so viele Jahre so eng verbinden wie als Reiter mit einem Pferd. Er pflegt, putzt und bürstet es, lässt zu, dass es seine Nase an seiner Schulter reibt, er steigt auf, umfängt es mit seinen Beinen, manchmal für Stunden. Er folgt mit seinem Körper der faszinierenden Mechanik seiner Bewegungen, er wird gewiegt, geschaukelt, hochgeworfen und wieder aufgefangen, er bewegt nicht sein Pferd, sondern lässt sich von seinem Pferd bewegen. Es ist bereit, ihn zu tragen.
Wieso nur interessieren sich die Pferde so sehr für uns? Wieso sind die meisten beseelt von dem Wunsch, uns Menschen zu gefallen? Es uns recht zu machen? Wieso haben viele von ihnen das Bedürfnis, sich von uns anführen zu lassen? Es ist ein Geschenk, das sie uns machen, und sie haben im Lauf der Jahrhunderte einen hohen Preis dafür bezahlt, aber sie bleiben beharrlich auf unserer Seite.
Die Verbindung des Reiters mit dem Pferd ist immer gegenseitig. Körperlich. Sinnlich. Und im idealen Fall korrespondieren hier zwei Seelen aus verschiedenen Welten auf einem Terrain, das nur ihnen beiden gehört.
Auch Isabell Werths Passion für Pferde beginnt nicht beim Ehrgeiz. Sie lebt eine lange Liebesgeschichte. Zu der gehört allerdings, dass sie viel von den Pferden verlangt, intensiv mit ihnen arbeitet. Disziplin und Selbstkritik sind selbstverständlich für sie als Sportlerin und Unternehmerin. Das zeigen auch die Ströme von Tränen, die sie im Laufe ihrer Karriere auf allen möglichen Siegerpodesten geweint hat, wenn endlich der Leistungsdruck nachließ. Dort oben auf dem Treppchen hat aber nur selten das uneingeschränkte Glück auf sie gewartet. Dort oben empfindet sie vielmehr Stolz, Genugtuung, Bestätigung, Befriedigung ihres Ehrgeizes und Erleichterung. Die vollkommenen Augenblicke des Glücks erlebt sie im Stillen, zu Hause, ganz ohne Publikum, wenn sie auf ihren Pferden sitzt im Hier und Jetzt.
»Der Winter ist vorbei, das Frühjahr naht, und alles fängt an, grün zu werden und zu blühen. Du kommst mit deinem Pferd raus und reitest und du denkst, schöner kann es nicht sein. Das ist für mich einer der totalen Glücksmomente auf dem Pferd. Das Gefühl zu haben, ganz unabhängig von einem Wettkampf, dass das Pferd bei mir ist, und ich bei ihm, das ist Glückseligkeit.«
Wer auf ihrem Hof in Rheinberg die Pferde besucht, kann sich auf ausgiebige Streicheleinheiten freuen. Da stehen sie nebeneinander im ordentlich aufgeräumten Stall, die Stars der Branche, und spitzen die Ohren. Weihegold, die schwarze Schöne. Bella Rose, die Kate Moss unter den Pferden. Der einst so unberechenbare Satchmo, der längst in Rente ist und sich zunehmend in einen Pferde-Buddha verwandelt. Emilio, der Shootingstar. Belantis, Isabells große Zukunftshoffnung, der in seiner Box steht wie ein Pegasus aus Nebel. Sie alle wenden sich freundlich ihrem Besucher zu, beschnuppern ihn und fangen an zu kommunizieren. Offensichtlich sind sie auf ihre Art genauso kontaktfreudig wie die Chefin.
Auch Don Johnson, genannt Johnny, der übermütige Rowdy, schaut so sanftmütig und aufmerksam, als könnte er kein Wässerchen trüben. Erst ein genauerer Blick in seine Box mit ihren seltsamen Sicherungen und Gummiteilen bringt es an den Tag: Wenn ihn der Spieltrieb packt, macht er Kleinholz aus seiner Umgebung, macht seine Tränke kaputt, ohne Rücksicht darauf, dass er sich selbst dabei verletzen könnte. So hat er schon wichtige Turniere verpasst, sogar die Olympischen Spiele 2016. War ihm egal, Hauptsache Rabatz. Kein Teil in seiner Box, das nicht schon einmal ersetzt werden musste. Don Johnson hat es sogar schon fertiggebracht, in der Reithalle einen Spiegel einzuschlagen. Isabell winkt gelassen ab, ja, das ist eben ein frecher Junge. Er bockt auch gerne mal, wenn sie in seinem Sattel sitzt, und riskiert sogar, sie in den Dreck zu werfen. Natürlich wehrt sie sich und weist ihn in die Schranken. Johnny, mach keinen Quatsch! Vielleicht weiß er ja, dass sie in Wahrheit ganz gerne mit ihm in den Ring steigt. Später sagt sie dann milde lächelnd, er ist nur beleidigt, ich habe mich nicht genug um ihn gekümmert.
Mit Kopf und Herz, Leib und Seele hat sich Isabell den Pferden verschrieben. Sie ist ein Mensch, der Sicherheit ausstrahlt, Seelenruhe, eine feste Erdung, unerschütterliche Stabilität. Nichts an ihr ist auf Wirkung aus, es zählt, was geschieht. Ihre Nerven scheinen aus Stahl zu sein, sie schaut mit herausforderndem Blick in die Welt hinaus und macht allen klar, dass sie vor nichts und niemandem Angst hat. Und doch stürzen ihre Pferde, diese großen, empfindlichen Tiere, sie immer wieder in tiefe Zweifel und manchmal sogar fast in Verzweiflung.
Diese Isabell kennt die Öffentlichkeit kaum. Sie kann strahlend und lustig sein, in Interviews oder auf Empfängen, und manchmal so schallend lachen, dass sich die Leute umdrehen. Das weist eher auf eine rheinische Frohnatur hin als auf ein Sensibelchen. Und die Wettkämpfe, die man auf Turnieren und im Fernsehen verfolgen kann, sind erst recht nichts für Romantiker. Im Dressurviereck spitzt sie die Lippen vor lauter Konzentration, runzelt die Stirn vor lauter Willenskraft, steckt die Zunge in die Wange, man sieht ihr an, dass sie mit jeder Faser auf Höchstleistung ausgerichtet ist. Das war am Anfang so, als sie im großen Sport die Zügel aufnahm. Und das ist drei Jahrzehnte und viele Medaillen später nicht anders. Ja, es scheint sogar manchmal so, als wären die Dosen der Droge Wettkampf, die sie regelmäßig braucht, noch ein wenig größer geworden. Immer wieder bereitet sie sich – wohl unbewusst, aber zuverlässig – ihre Adrenalinbäder. Und das geht ungefähr wie das Spiel der Katze mit der Maus: Wenn sie den Sieg in einer Prüfung einem Herausforderer überlassen muss, und der womöglich schon so töricht war, zu hoffen, dass das nun in dem Stil weitergehen werde – dann kann es ihm ganz schlecht ergehen. Am nächsten Tag schlägt das Isabell-Werth-Imperium zurück und zerbricht den Widerstand ihres Gegners nur noch schmerzhafter. Sie hat ihm den Teppich bereitet, und zieht ihn gleich wieder weg. So tankt sie auf. Das ist ihr ganz persönlicher Kampfstoff.
Isabell, das Wettkampf-Monster? Natürlich braucht sie für solche Extravaganzen ein Pferd, mit dem sie das Feld kontrollieren kann, und darauf hat niemand eine Garantie, selbst der stärkste Reiter nicht. Immer wieder hat sie Durststrecken durchgemacht, in denen der Erfolg ausblieb, weil die Spitzenpferde fehlten, und eine Weile nur noch zähes Durchhalten gefragt war. Doch in der Spätphase ihrer Karriere ist es ihr gelungen, sogar mehrere Asse ins Spiel zu bringen. Es ist kein Zufall, dass sie es fertiggebracht hat, in der Weltrangliste gleichzeitig mehrere Toppositionen zu besetzen. Seit den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro ist sie die erfolgreichste Reiterin der Geschichte. Sie gewann sechs olympische Goldmedaillen in vierundzwanzig Jahren, sieben Weltmeistertitel und siebzehn Europameistertitel. Das Erstaunlichste daran ist die Vielfalt: Während auch die prägenden Figuren ihres Sports meistens nur mit einem oder zwei Pferden hochkarätige internationale Erfolge erreichten, qualifizierte Isabell Werth insgesamt acht Pferde für Championate, also Olympische Spiele, Welt- und Europameisterschaften.
Etwa dreißig Pferde hat sie in den Spitzensport gebracht. Eine monumentale Leistung, wie sie keinem anderen Reiter nur annähernd gelungen ist. Darum wohl hat sich nach Jahren des Kampfes und der Rechtfertigungen ihre Rolle langsam verändert: Sie wird immer mehr zur respektierten Grande Dame des Dressurreitens, die nichts mehr beweisen muss. Manchmal schon jenseits von Neid und Missgunst erlebt sie die dritte Etappe ihrer Laufbahn, in deren besten Momenten nicht mehr der Kampf, die Konkurrenz und die Bewährung im Vordergrund stehen und Sterne auf sie herabregnen wie bei ihrem Sieg 2017 beim Weltcup-Finale in Omaha. Alles schien da auf einmal ganz leicht. Und auf dem Siegerpodest strahlte sie und verspritzte Champagner, statt schmerzhafte Tränen zu weinen. Eine neue Isabell. Sie machte aus der Zeremonie ein Freudenfest.
»Es sind solche Momente, die mich manchmal innehalten lassen. Bin ich angekommen? Schließt sich jetzt der Kreis? All die Herausforderungen, die noch auf mich warten, all die jungen Pferde, die ich noch voranbringen will, dazu das Unternehmen und die Familie füllen meistens meine Gedanken so aus, dass keine Zeit bleibt für Sentimentalitäten. Meistens falle ich abends erschöpft in mein Bett und weiß schon, dass auch der kommende Tag wieder genau durchgetaktet sein wird, ob nun auf dem Turnier, in der eigenen Reithalle oder bei den Promotion-Terminen. Aber fest steht: Am liebsten schlafe ich zu Hause ein, auf unserem Hof in Rheinberg, umgeben von meiner Familie.«
Da gehört sie hin seit dem Tag ihrer Geburt am 21. Juli 1969. Es war der Tag, als der erste Mensch den Mond betrat. Isabell aber ist erdverbunden geblieben. Sie braucht den Ort, an dem sie aufgewachsen ist, der ihr ganzes Leben, ihre Persönlichkeit und ihre Träume widerspiegelt. An den sie sich sehnt, wenn sie irgendwo über die Autobahn jagt. Und an dem sie die Energie tankt, die sie für den angespannten Alltag braucht.
Als Isabell ein Kind war, hat sie sich an der Abgeschiedenheit ihres Zuhauses manchmal gestört. Überall musste man hingefahren werden, auch zum Reitverein. Heute ist sie glücklich über das Idyll und fühlt sich enorm privilegiert, in einer solchen Geborgenheit aufgewachsen zu sein. Es gab zwar keine gemeinsamen Urlaube mit den Eltern – einer musste immer zu Hause bleiben und sich um die Tiere auf dem Hof kümmern. Aber wenn sie zu Hause war, dann waren ihre Eltern immer da, immer greifbar, und nicht nur, wenn es Probleme gab.
Bodenständig ist ihre Familie – Landwirte seit Generationen. Auf dem Hof im Winterswicker Feld in Rheinberg am Niederrhein leben die Werths auch heute noch wie glückliche Insulaner, die sich gegenseitig Schutz und Sicherheit bieten. Familie ist alles. Zu den besten Zeiten lebten vier Generationen auf dem Hof. Die Großmutter, die 102 Jahre alt wurde, und erst in ihren letzten beiden Jahren ernsthaft schwächelte. Die Eltern Heinrich und Brigitte, zwei lebhafte, nicht sehr groß gewachsene Menschen, die dem Hof die Seele geben. Isabell mit ihrem Lebenspartner Wolfgang Urban und Sohn Frederik und ihre drei Jahre ältere Schwester Claudia mit Familie. Isabell ist heute die Chefin. Dass sie jetzt die Entscheidungen trifft, macht ihrem Vater Heinrich, einem fröhlichen Mann mit reichlich rheinischem Mutterwitz, nichts aus. Im Gegenteil.
»Sie ist der King im Familienclan«, sagt er stolz bei einem Kaffeestündchen an Isabells langem Esstisch.
Als Isabell Kind war, bestellte er die 22 Hektar Land nahezu alleine. Mutter Brigitte bestritt den Haushalt, der umfangreich war. Siebenundzwanzig Jahre lang wohnten Vater Heinrichs Eltern mit im Haus. Er produzierte auf den Feldern Gerste, Hafer, Mais oder Zuckerrüben. Dazu kam Tierhaltung, hauptsächlich Milchkühe, Schweinezucht und Ferkelaufzucht. Außerdem gab es Hühner mit Hahn, Gänse, Enten, Hunde, Katzen.
»Alle Tiere, die der liebe Gott geschaffen hat«, sagt Heinrich Werth.
Eine Zeit lang züchtete er sogar Nutrias und Tauben. Und natürlich Pferde, allerdings schon lange nicht mehr für die Arbeit, sondern fürs Vergnügen. Er betrieb eine klassische Mischwirtschaft, wie es sie jahrhundertelang fast unverändert gab, die aber heute fast ausgestorben ist. Inzwischen sind die Höfe im ganzen Winterswicker Feld stillgelegt, die Gebäude in Wohnhäuser umgewandelt, und die Familien haben ihr Land an große Agrarunternehmen verpachtet. Die alte Lebensform stirbt aus. Es geht heute um Masse und Fläche, es wird intensiv gedüngt und mit großen Maschinen gearbeitet – kleine Betriebe lohnen sich nicht mehr.
Heinrich Werth gehört zur letzten Generation von Landwirten, die auf die altbewährte Art wirtschafteten. Er ist ein Bauer durch und durch, aber sein Leben war noch härter als das seiner Vorfahren. Er konnte sich keine Angestellten mehr leisten wie die Generation seiner Eltern. Auch Brigitte Werth musste anders anpacken als ihre Mutter und Schwiegermutter, die zeitlebens ein Dienstmädchen für sich beschäftigen konnten. Dafür warf der Hof nun nicht mehr genug ab. Und auch eine Kinderschar als kostenloser Arbeitstrupp war keine Lösung mehr wie einst, als zwölfköpfige und noch größere Familien keine Seltenheit waren.
Heinrich Werth hat als Kind sogar die Zeit noch erlebt, als mit Pferden geackert wurde. Er musste sein Arbeitsleben lang, tagaus, tagein schwere Lasten heben und tragen, weil zunächst die Mechanisierung nicht so fortgeschritten war wie heute. Die Ankunft des Mähdreschers etwa bedeutete eine große Erleichterung. So arbeitete Heinrich Werth bienenfleißig auf seinem Hof, stand im Morgengrauen auf, um zu füttern und zu melken, saß tagelang auf dem Trecker, und war irgendwann platt. Es sei ihm mit fünfzig Jahren erheblich schlechter gegangen als mit achtzig, sagt er. Sein Rücken streikte, die Bandscheiben, der Ischiasnerv, zeitweise musste er sogar im Rollstuhl sitzen. Aber er beklagte sich nie. Zufriedenheit sei ihm das Wichtigste, sagt er. Und eine Familie, die zusammenhält.
»Meine Schwester und ich wuchsen inmitten all der Tiere auf. Wir liebten und hätschelten die Ferkel und die Kälbchen und hatten die Pflicht, uns um die Kaninchen zu kümmern. Jeden Tag konnte man mit einem neuen Tierbaby rechnen, und wir liefen hin, streichelten sie und fanden sie süß. Wir wussten natürlich, dass diese Tiere irgendwann geschlachtet und gegessen würden. Aber so war das eben, man lebte von dem, was auf dem Hof produziert werden konnte. Wir hatten auch kein Problem, der Biologielehrerin das obligatorische Schweineauge zum Sezieren in die Schule mitzubringen, während die Klassenkameradinnen entsetzt zu kreischen anfingen. Sobald ein Ferkel fünfzig Kilo hatte, war es so weit. Wenn ein Schwein geschlachtet wurde, freuten wir Mädchen uns auf den Veterinär, der das Fleisch auf Trichinen untersuchte. Er ließ uns durch das Mikroskop schauen. Auch Wurstmachen war für uns eine selbstverständliche Sache und bestimmt nichts Abstoßendes. Ganz spannend – und ganz lecker. Am Abend wurde ein Stück vom frischen Fleisch gebraten oder gekocht und alle freuten sich darauf und ließen es sich schmecken.«
Der Vater kannte jede einzelne Kuh und jedes Schwein und übernahm die Verantwortung für ihr Wohlergehen. Es war ein Leben mit und von den Tieren des Hofes. Selbst wenn man sie eines Tages schlachten ließ, verlor man nicht den Respekt vor ihnen. Man war ihnen körperlich nahe und ekelte sich nicht. Wenn sie krank waren, wurden sie behandelt, und es wurde nicht geruht, bis sie wieder gesund waren. Dreihundertfünfundsechzig Tage im Jahr kümmerte sich die Familie darum, dass die Tiere versorgt waren und es ihnen gut ging. Trotzdem war klar: Es waren Nutztiere, keine Schmusepartner und kein Spielzeug.
»Als Kind geht man total unvoreingenommen vor, ohne darüber nachzudenken. Das Pferd ist da, der Hund ist da. Und man entwickelt nicht von Haus aus eine Angst, sondern das Tier ist Teil des täglichen Lebens, ist fast schon Teil der Familie. Man geht morgens in den Stall, die Tiere werden gefüttert, es ist ein Rhythmus, ist schlicht Verantwortung, und damit wächst man auf.«
Isabell kriegte alles mit. Wenn die Sauen ihre Ferkel bekommen hatten, durften sie sich zum Beispiel auf der Wiese tummeln. Und einen Eber gab es auch. Allerdings lehrte einer dieser aggressiven Kaventsmänner Isabell eines Tages das Fürchten.
»Mein Vater hatte einen neuen Eber gekauft. Einem Eber wurden normalerweise gleich, wenn er kam, die Hauer abgesägt, weil die messerscharf sein konnten, aber bei diesem war das noch nicht gemacht worden. Nebenan war die Kuhwiese, und dieser Eber hatte offenbar nie in seinem Leben Kühe gesehen. Er drehte völlig am Rad und hat drei Kühe aufgeschnitten, davon war eine sofort reif für den Schlachter. Die anderen versuchte man noch zu nähen. So was zu erleben, wie schnell so was umschlagen und gefährlich werden kann – das hat mich tief beeindruckt.«
Durch das enge Aufwachsen mit all den unterschiedlichen Tieren hat Isabell eine selbstverständliche Beziehung zu ihnen entwickelt. Ausgesprochen natürlich und instinktgeleitet. Die Tiere haben sich auf sie eingelassen, und sie hat sich sehr für sie interessiert, sich geöffnet, und ist Beziehungen eingegangen, die nicht mit Worten zu beschreiben sind. Kinder gehen auf Tiere zu, ohne gleich etwas von ihnen zu erwarten, einfach, weil es sie gibt. Einen so unverstellten Zugang kann ein Stadtkind sich unmöglich erwerben. Es kann sich nicht vorstellen, wie das ist, mit einem Tier so eng zu verwachsen und ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis einzugehen. Die Zuwendung, die damals begann, ist der Schlüssel zu Isabells Freude am Leben mit Pferden. Und auch zu ihrem Erfolg. Mit den Jahren hat sie dieses besondere Verständnis weiterentwickelt, verfeinert, mit neuen Erfahrungen angereichert. Und professionalisiert. Vermenschlicht, nennt sie das Instrumentalisieren einer Fähigkeit, die sie einst so mühelos erwarb, wie andere Kinder neben ihrer Muttersprache von der Nanny noch Französisch oder Portugiesisch mitlernen. Nur dass Isabell sich mit der Sprache, die ihr zuflog, nicht nur ein Land, sondern ein ganzes Universum erschließen konnte.
Die Tiere scheinen zu Isabell zu sprechen, und sie scheint sie hören zu können.
»Eine Gabe«, sagt ihr Vater. »Wir haben da nicht dran gedreht oder geschraubt.«
»Wir werden manchmal gefragt, woher sie das hat«, sagt ihre Mutter. »Es war der liebe Gott, der ihr so viel Gefühl gegeben hat.«
Isabells Antizipationsfähigkeit ist legendär. Sie weiß, was ein Pferd gleich tun wird, obwohl ein Außenstehender keinerlei Anzeichen dafür wahrnehmen kann. Sie ist auf diese Weise in der Lage, vorzubeugen, die Reaktionen in sinnvolle Bahnen zu lenken, oder Schlimmeres zu verhüten. Sie kann sich in das Sensorium eines Pferdes einklinken und seine individuellen Verhaltensweisen verstehen und interpretieren lernen.
»Ich spüre es irgendwo in einer Faser meines Körpers. In einem mir selbst bisher unbekannten Nerv. In der Hand, im Hintern, in der Seite, irgendwo im Körper. Irgendwie erstarrt das Pferd ganz kurz, es wirkt ein winziges bisschen nervös, es reagiert eine Nuance anders als sonst. Ich kann es nicht erklären, aber das Gefühl ist da. Nur eine kleine Wahrnehmung manchmal, ein instinktives Stutzen, ein Bauchgefühl, das sich später bestätigt. Dann sage ich mir: Schau an, da hast du richtig gelegen, und integriere diese Facette in meinen Erfahrungsschatz. Es ist eine Form von Kommunikation und Instinkt. Der Instinkt spielt eine große Rolle. Er hat sich im Laufe der Zeit stark verfeinert und weiterentwickelt durch die vielen unterschiedlichen Pferde, die ich geritten habe. Von meinem dicken kleinen Pony bis zum Grand-Prix-Pferd.
Gigolo, mein erstes Gold-Pferd, war in Sachen Kommunikation ein großzügiger Lehrmeister. Er gab sich mir ganz und brachte eine extreme, ehrliche Leistungsbereitschaft mit. Ich horchte nicht nur in ihn hinein und lernte, mit seinem überschäumenden Ehrgeiz umzugehen. Er konzentrierte sich auch auf mich und die Wettkampfsituation und spielte mit. Als Grand-Prix-Debütantin nahm ich das als selbstverständlich hin. Aber das zuverlässige Herz dieses Pferdes war ein großes Geschenk für mich in dieser Phase meiner Laufbahn.«
Mit Gigolo konnte sie jahrelang den Attacken von Anky van Grunsven standhalten, ihrer größten Rivalin aus den Niederlanden, mit der sie sich atemraubende Duelle lieferte.
Später kam Satchmo und warf alles über den Haufen, was Gigolo Isabell gelehrt hatte. Auch ein gehfreudiges Pferd. Aber mit welch einem Überraschungsmoment! Sie spitzte die Ohren, schärfte den Blick, strengte den Verstand an und stellte ihr Nervensystem auf Empfang. Und doch blieb er selbst für sie unberechenbar.
»Keiner hat meine Sinneswahrnehmung ähnlich gefordert und geschärft wie Satchmo, mein zweiter großer Lehrer nach Gigolo.«
Je sensibler ein Pferd ist, desto schwieriger ist es. Ein Pferd, das charakterlich normal ist, bereitet einem Reiter wenig Probleme. Es eignet sich allerdings nicht für die Aufgaben, die Isabell ihm stellen will. Es ist in der Lage, Lektionen zu lernen, aber es wird sich nicht in der Weise in die Darbietung einbringen können, wie es sollte. Es wird nicht merken, wann es ums Ganze geht und im entscheidenden Moment nicht mitkämpfen. Es wird keinen Zauber entfalten, die Zuschauer nicht anrühren. Es fehlt ihm das Besondere. Und es würde Isabell Werth unterfordern.
Sie liebt und braucht die Pferde, die in Reiterkreisen als heiße Öfen bezeichnet werden. Sie neigen dazu, sich bei der Arbeit mental mit Strom aufzuladen, sich in einen Zustand des Eifers hineinzusteigern. Je heißer sie werden, desto ausdrucksvoller sind ihre Auftritte. Bis zu dem einen Punkt, an dem alles kippt, an dem sie nicht mehr erreichbar sind für ihren Reiter und vor lauter Übereifer in die totale Hysterie verfallen. An dieser Kipplinie entlangzuarbeiten, ist die große Herausforderung für einen Weltklasse-Dressurreiter. Jeder Auftritt ein Grenzerlebnis, dort, wo das Genie jeden Moment in den Wahnsinn umzukippen droht. Dort, auf Messers Schneide, fühlt sich die Wettkämpferin Isabell am wohlsten. Diese Momente lassen sie nicht etwa vor Angst erstarren. Sie genießt sie wie eine Akrobatin den Kitzel ganz oben im Zirkuszelt und zieht daraus Energie.
Ohnehin sieht Isabell ihre Aufgabe nicht darin, möglichst reibungslos ans Ziel zu kommen. Das Ganze muss einen besonderen Kick haben. Und noch wichtiger ist der Weg dorthin: Die Kunst, die unterschiedlichsten Pferde über ihre Schwachpunkte hinweg zur Höchstleistung zu bringen.
Ihre Eltern sind immer wieder verblüfft von ihrer Tochter.
»Sie schaut sich ein vierundzwanzig Stunden altes Fohlen an«, erzählt Vater Heinrich munter, »und sagt Ihnen so ungefähr, wo sein Weg entlangführen wird.«
Das beeindruckt ihn als erfahrenen Landwirt ganz besonders.
Oder die Geschichte mit Amaretto: Das arme Pferd war eigentlich der Kronprinz, der Gigolo nachfolgen sollte, doch es war nicht gesund. Ständige Koliken quälten den Wallach, sodass er schließlich in die Tierklinik Hochmoor gebracht werden musste. Wenn sie nicht zu einem Turnier musste, besuchte und beobachtete Isabell ihr Pferd stundenlang in der Krankenbox, sie stand ihm bei und versuchte herauszufinden, wie sie ihm doch noch würde helfen können. Irgendwann sagte sie zu Professor Bernhard Huskamp, dem Leiter der Klinik: Immer, wenn Amaretto die Lefzen hochzieht und kräuselt, kündigt sich eine Kolik an. Der Chef winkte erst ab, wurde dann stutzig, schließlich neugierig, nahm sich einen Stuhl und setzte sich ein paar Stunden zu Amaretto in die Box. Und tatsächlich: Er stellte fest, dass Isabell recht hatte. Wenn Amaretto die Lefzen auf eine bestimmte Weise hochzog, war eine Kolik im Anmarsch und das Pferd legte sich kurz darauf hin.
Auch Vater Werth, der erfahrene Bauer, staunte: »Der Professor sagt: Ich sag nichts mehr. So was kann man nicht lernen.«
Immer, wenn Pferde krank werden, ist Isabells Sorge groß. Schließlich kann ein Erreger ihre ganze Pferdepopulation bedrohen. So wie Anfang 2018, als sich von einem Tag auf den anderen ein rätselhafter Infekt in Isabells Stall ausbreitete. Gerade zurückgekehrt von einem glanzvollen Turnierauftritt, wurde sie fast überrollt von dieser Heimsuchung. Die fiebrige Krankheit äußerte sich zum Teil derart dramatisch, dass sie zwei Pferde verlor. Der Kampf gegen den Erreger brachte sie und ihr ganzes Team an den Rand ihrer Kräfte. Mehr als hundert Pferde mussten über Wochen mehrmals täglich kontrolliert werden. Darunter nicht nur ihre eigenen, sondern auch wertvolle Gastpferde, für die sie die Verantwortung übernommen hatte. Der Tierarzt war Dauergast, und wenn er nicht da war, permanent am Telefon. Irgendwann versagten sogar mehrere Fieberthermometer wegen Überlastung den Dienst und mussten ersetzt werden.
Draußen war es so kalt, dass die Kanister mit Desinfektionsmittel einfroren. Es wurden Schleusen mit Desinfektionsmatten eingerichtet, um eine Übertragung auszuschließen. Glücklicherweise standen Isabells aktuelle Turnierpferde in einem separaten Stalltrakt und waren darum von der Infektwelle nicht betroffen. Sie erhielten Stärkungsmittel für das Immunsystem. Das ganze Team im Stall Werth musste plötzlich eine regelrechte Schlacht schlagen.
Isabell, die Nervenstarke, die jede sportliche Herausforderung fast schon mit Vergnügen annimmt, war angesichts der ungewissen Lage und ihrer eigenen Ohnmacht so angespannt wie selten. Gerade noch hatte im Pressedienst des Weltverbandes gestanden, so glücklich und entspannt wie in dieser sportlichen Phase habe sie noch niemals in ihrer Karriere gewirkt. Einen Tag später bestätigte sich abermals die alte Weisheit: Die Probleme kommen immer dann, wenn du am wenigsten darauf gefasst bist. Das mag für viele Bereiche gelten. Aber ganz besonders im Umgang mit verletzbaren Lebewesen. Und in Momenten, da die ganze Erfahrung nicht mehr weiterhilft.
Mit Pferden umgegangen und geritten wurde schon immer in der Familie Werth. Vater Heinrich nahm an Jagden teil. Mutter Brigitte, Tochter von Gemüse- und Obstbauern aus der Nähe von Bonn, brachte eine Stute namens Palette mit in die Ehe, mit der sie spazieren ritt und sich im Verein mit etwas vergnügte, was Isabell ein bisschen despektierlich »typisches Hausfrauenreiten« nennt.
Isabell begann so früh mit dem Reiten, dass sie sich an ihr erstes Pony kaum mehr erinnern kann. Mit fünf Jahren saß sie zum ersten Mal auf Illa. Ein schwarzes Pferdchen – mehr weiß sie nicht mehr. Dann kam Sabrina. Isabell war noch keine acht Jahre alt, als sie die erste Feuerprobe bestehen musste. Sabrina erschrak direkt vor dem Haus vor irgendetwas, scheute, Isabell fiel herunter und stürzte auf die Treppe, direkt aufs Gesicht. Noch heute hat sie kleine Narben auf der Stirn von den Steinchen, sie sich dort hineingebohrt hatten. Die Nase war aufgerissen, die Lippen sogar innen aufgeplatzt – sie wurde ins Krankenhaus gebracht und genäht. Zu den Wunden im Gesicht kam eine Gehirnerschütterung. Eine Woche lang musste sie in der Klinik bleiben und alles mit der Schnabeltasse zu sich nehmen. Zu ihrem Vater sagte sie wütend, dass jetzt Schluss sei mit der Reiterei, er könne Sabrina weggeben. Einen Tag später, so erzählt Heinrich Werth, habe sich das schon wieder ganz anders angehört.
»Hör mal Papa«, kündigte sie an, »der werde ich zeigen, wer hier das Sagen hat.«
Die Schimmelstute durfte dann aber doch nicht auf dem Hof bleiben – zu schreckhaft für kleine Mädchen.
Isabell und ihre Schwester Claudia wuchsen wie von selbst in das Reitervereinsleben hinein, genau wie man sich das bei geselligen Rheinländerinnen so vorstellt. Im Reitverein Graf von Schmettow Eversael, nicht weit vom Hof gelegen, spielte sich ein großer Teil ihrer Jugend ab.
»Die erste Zigarette wurde hinter der Reithalle geraucht. Den ersten Apfelkorn gab es hinter dem Wall.
Dreimal die Woche erschienen wir beiden Schwestern mit unseren Ponys zum Reitunterricht, zweimal zur Dressur, einmal zum Springen. Am Wochenende wurde ausgeritten mit zehn oder fünfzehn Kindern, alle mit einem Rucksack auf dem Rücken. Wir machten Spielchen, Geschicklichkeitsreiten, Indianerspiele, Ringestechen, Karnevalsreiten. Die Pferde mussten Hütchen, Herzchen, Glitzer und Glimmer tragen, sie wurden ebenso fantasievoll verkleidet wie wir. Es wurde über Wiesen gejagt und mit den Pferden im Rhein gebadet. Beim Ponyrennen verzweifelte ich fast, weil meine Funny kleiner war als Claudias Fee und nicht den Zug in die Führungsposition spürte, sodass ich es trotz äußerster Bemühungen nicht schaffte, an meiner Schwester vorbeizukommen. Funny war ein 1 Meter 27 großes Welshpony, Fee zwei Zentimeter größer und eher der drahtige Typ. Funny schaffte es bei unseren Rennen im allerbesten Fall nur bis zu Fees Schweif. Aber sie war trotzdem super. Brav, faul, dick, klein, ein bisschen mopsig. Sie sprang überhaupt nicht gerne, ich fiel trotz all meiner Überredungskunst regelmäßig herunter, eigentlich immer, manchmal zwei- oder gar dreimal die Stunde. Die Herausforderung war es, einmal eine Springprüfung zu beenden, ohne herunterzufallen.«
Doch Isabell blieb zäh. Und ihre Mutter scheint angesichts der durch die Luft katapultierten Tochter gute Nerven bewahrt zu haben. Sie fragte sich nur, woher ihre Tochter die Energie nahm, immer wieder aufs Pferd zu klettern, wenn sie heruntergefallen war. Mutter Brigitte fuhr ihre Töchter nicht nur zum Verein, sondern auch zu den ersten Turnieren und unterstützte ihre Leidenschaft, so gut sie konnte. Mit ihren Ponys boten sie auch anderen Kindern auf Großpferden unverdrossen Paroli. Heinrich Werths Eltern, mit denen die Familie das Haus teilte, und die noch aus der alten Bauernwelt stammten, opponierten zwar. Pferde zum Spaß halten? Nur für die Kinder? Nutzloses Herumfahren, obwohl in der Zeit zu Hause gearbeitet werden könnte? Mutter Brigitte setzte sich aber über die Einwände hinweg. Die Mädchen durften reiten. Allerdings sagte die resolute Mutter ihnen: »Wenn ihr nur spazieren reiten wollt, dann müssen wir den ganzen Aufwand nicht betreiben. Und wenn ihr Turniere reiten wollt, dann intensiv. Dann machen wir es richtig, und keine Spielerei.«
Von Stund an waren sie fast jedes Wochenende zusammen unterwegs. Die Frage, von wem Isabell den Ehrgeiz mitbekommen hat, dürfte sich damit erübrigen.
Für die Schule lernte Isabell nachts. Ganz ähnlich wie sie das später, als sie schon internationale Erfolge sammelte, mit dem Jurastudium machen sollte. Sie kam immer durch – allerdings nicht mit dem bestmöglichen Resultat. Schwester Claudia spezialisierte sich auf die Vielseitigkeit, ritt Pferde aus der eigenen Zucht, wollte sich aber der Reiterei nicht mit Haut und Haar verschreiben wie ihre kleine Schwester. Isabell ritt alles, was sie kriegen konnte, egal welche Disziplin und welches Pferd. Erst als Dr. Uwe Schulten-Baumer, der Pferdemann aus der Nachbarschaft, auf sie aufmerksam geworden war, spezialisierte sie sich auf die Dressur. Mit siebzehn Jahren begann sie, systematisch seine Pferde zu reiten. Er brachte die Erfahrung eines bereits langen Lebens als Ausbilder mit. Sie das Einfühlungsvermögen und den Mut. Beide wollten nach ganz oben.
Die beiden ergänzten sich und wuchsen zu einem Erfolgsteam zusammen. Isabell brauchte allerdings ihre exzeptionelle Courage nicht nur, um mit den jungen Pferden zurechtzukommen und um gegen übermächtig scheinende Gegner anzutreten. Sondern auch, um dem Doktor die Stirn zu bieten. Ein schrecklich erfolgreiches Duo.
Heinrich Werth, der Isabell in diesen schwierigen Jahren energisch den Rücken stärkte, sagt kategorisch: »Dieses Verhältnis brauchen Sie nicht einzuordnen. Es reicht, wenn ich das einordne.«
Auch als 2001, nach sechzehn Jahren, die Zusammenarbeit mit dem Doktor zu Ende ging, fing das Elternhaus sie auf. Und Madeleine Winter-Schulze, ihre Freundin, Gönnerin und Pferdebesitzerin, kam wie gerufen. Sie kaufte dem Doktor mehrere Pferde ab und lud Isabell ein, bei ihr und ihrem Mann in Mellendorf bei Hannover zu wohnen und trainieren. Es war ein Ausweg, wie er sein soll: Er wies in die Zukunft.
Der Doktor hatte Isabell am Anfang den Weg geebnet – er verhalf ihr überhaupt erst in den bedeutenden Sport. Und er brachte ihr alles bei, was sie brauchte, um selbst Pferde auszubilden und zum Erfolg zu führen. Madeleine half ihr, die neue Freiheit zu leben und minimierte das Risiko, indem sie für Isabell Pferde kaufte. Bis heute hält sie ihr den Rücken frei. Andere müssen Kompromisse machen und immer wieder Pferde verkaufen, um das Unternehmen rentabel zu halten. Bei ihr sorgt Madeleine als Pferdebesitzerin für eine solide finanzielle Basis. Beide Begegnungen kamen zur rechten Zeit, fast magisch, beinahe als hätte es so sein müssen. Talent allein reicht nie – es muss Glück hinzukommen.
In jener Phase arbeitete Isabell als Rechtsanwältin in einer Kanzlei in Hamm und später bei Karstadt in Essen, wo sie ihren späteren Lebensgefährten kennenlernte, den damaligen Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Urban.
»Er ist meine große Stütze, der wichtigste Mensch an meiner Seite, der mir Orientierung gibt, der mir mit seiner Erfahrung in vielen Situationen hilft und an dem ich mich festhalten kann. Obwohl er nicht aus der Fachwelt kommt, stellt er mir die richtigen Fragen und führt mir vor Augen, wo ich mir Dinge schönrede oder mir etwas vorgemacht habe.«
Isabells Leben diversifizierte sich, inhaltlich und geografisch, sie legte Abertausende von Kilometern auf überfüllten deutschen Autobahnen zurück. Von Rheinberg nach Mellendorf, von Mellendorf nach Hamm, von Hamm nach Mellendorf, von dort aufs Turnier nach München, Stuttgart oder Neumünster. So konnte es nicht weitergehen. Sie musste eine Entscheidung treffen und beschloss, weder als Anwältin noch als Managerin weiterzuarbeiten, sondern sich als Berufsreiterin und Ausbilderin selbstständig zu machen. Bisher war ihr Berufsleben die Begleitmusik zu ihrer wahren Leidenschaft gewesen, ein Nebenschauplatz, genau wie beim Doktor. Jetzt machte sie ihre Leidenschaft zum Beruf.
Und dann kam die Nacht, in der Isabell zum Oberhaupt ihrer Familie wurde. Sie saß zu Hause mit ihrem Vater auf der Couch, und sie besprachen ihre Lage.
Er sagte: »Vielleicht kannst du irgendwo in der Nähe eine Anlage erwerben, es stehen inzwischen so viele Höfe leer, das wäre ein Ausweg.«
Sie fragte: »Willst du mich jetzt nicht mehr zu Hause haben?«
Heinrich Werth sagte nicht mehr viel. Nur noch: »Danke schön. Das reicht.«
Am nächsten Morgen sagte er zu seiner Frau: »Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. Wir werden den Betrieb Isabell überschreiben. Damit sie nicht denkt, wir möchten sie hier nicht auf dem Hof haben.«
Innerhalb von ein paar Wochen wurden die Formalitäten erledigt, eine gerechte Lösung für beide Schwestern war gefunden. Klare Kante.
»Wenn mein Deckel zugemacht wird«, sagte Heinrich Werth, »dann möchte ich nicht, dass sie sich zerstreiten.«
Isabell übernahm den Hof. Im Herbst 2003 zog sie ein – ihre Schwester wohnt in einem eigenen Haus auf dem Gelände. Mit Unterstützung Madeleine Winter-Schulzes erweiterte Isabell die Anlage und baute für sich und ihre Familie ein neues Wohnhaus. Jeder Baum, jeder Strauch, den sie auf dem Hof heute sieht, wurde in ihrer Lebenszeit gepflanzt. Nun ließ sie auch noch Weißdornhecken setzen, um ihren Bewegungsraum zu strukturieren.
Sie ist jetzt die Chefin eines Turnierstalls, eines Ausbildungsbetriebs, einer kleinen Pferdezucht, die vom Vater betrieben wird, und einer Landwirtschaft, die einen Teil des Pferdefutters produziert. Geritten werden etwa vierzig bis fünfzig Pferde, vom dreijährigen Newcomer bis zum vollendet ausgebildeten Grand-Prix-Pferd. Zusammen mit den Mutterstuten, den Fohlen, den Gastpferden und einer fröhlich auf der Weide grasenden Rentnerherde sind ungefähr hundert Pferde untergebracht. Vierzehn Mitarbeiter kümmern sich um ihr Wohlergehen und ihr Training. Fast täglich kommt der Tierarzt in den Stall. Sehr selten nimmt Isabell private Schüler auf. Aber eigentlich drehen sich der Betrieb und das ganze ambitionierte Team immer nur um eine Person und ihr System: Isabell. Und sie wirbelt von früh bis spät.
Jeden Morgen, an dem sie zu Hause ist, bringt Brigitte Werth der Chefin ein Glas frischen Orangensaft in die Reithalle. Der Vater hat ihn ausgepresst. Das ist die Gelegenheit, sich mal auszutauschen.
Isabell fragt vom Pferd aus: »Ist was?«
Wenn es etwas gibt, wird über die Bande diskutiert. Länger andauernde Misstöne hält hier keiner aus. Einen großen Teil ihrer Streitlust hat Isabell beim Doktor zurückgelassen.
»Wenn du auf dem Land lebst, kannst du mal in die Stadt gehen – umgekehrt ist es schwieriger. Ich habe hier meine Insel. Eine Insel braucht man, vor allem, wenn man so oft weg muss wie ich. Dann liebt man sie umso mehr.«
Im Oktober 2009 wurde Frederik geboren. Isabell war vierzig Jahre alt und hatte ihr Leben schon geregelt. Jeden Morgen hatte sie sich einen Plan gemacht – alles um die Pferde herum. Nun war plötzlich alles anders. Sie musste lernen, die Pferde um Frederik herumzuplanen. Eine einschneidende Verschiebung von Wichtigkeit in Richtung Zweibeiner.
»Frederik ist ein absolutes Wunschkind, mein größtes Glück, meine größte Liebe und die bedeutendste Horizonterweiterung meines Lebens. Nichts ist wirklich wichtig, Hauptsache, Frederik geht es gut.«
Oft hat sie ein schlechtes Gewissen, weil sie so viel verreist ist, und er hat längst ein Gespür dafür entwickelt, wie er möglichst viele Entschädigungen an Land ziehen kann. Isabell sucht die Turniere nun auch danach aus, ob sich Frederik dort wohlfühlt. Wer neben dem Platz einen Streichelzoo hat, kann eher mit ihrer Teilnahme rechnen als ein Ort voller Stress und Verpflichtungen, wo Isabell an jeder Ecke ohne Frederik für Selfies posieren muss. Frederiks Kindheit spielt sich nicht mehr auf einer idyllischen Insel ab wie die seiner Mutter. Auch er hat ausgiebigen Kontakt zu Tieren, aber nicht auf diese selbstverständliche Art wie Isabell. Seine Eltern versuchen, kein verwöhntes Einzelkind aus ihm zu machen und ihm das bescheidene Leben der Generationen vor ihm zu vermitteln. All dies beruht aber auf Entschlüssen, auf Planung und ergibt sich nicht wie von selbst aus dem Alltag. Seine Welt ist komplizierter und organisierter. Dafür sitzt er nicht auf dem Hof fest. Er ist mobil und schon oft mit dem Flugzeug geflogen. Und er muss nicht ständig alleine sehen, wie er zurechtkommt, sondern wird ständig betreut – fast jeden Abend ist entweder die Mutter oder der Vater zu Hause.
»Wenn Frederik in die Reithalle kam, wollte er früher immer aufs Pferd. Nicht etwa auf das Pony seiner Kusine, das ihm dann sofort angeboten wird. Nein, auf Mutters Pferd, nicht um zu reiten, sondern um mir nahe zu sein. Das war oft unmöglich, weil meine Pferde zu wild sind, und das ärgerte den Jungen, und er fing an, sich zu beschweren, weil es sich so anfühlte, als nähmen die Pferde ihm seine Mutter weg.«
Isabells Eltern machen inzwischen keine großen Reisen mehr. Früher sind sie zusammen mit einer munteren Gesellschaft aus dem Reiterverein in den Bus oder ins Flugzeug gestiegen und haben Isabell zu ihren großen Turnieren begleitet. Bei den Olympischen Spielen 1992 fing das an. Der Vorsitzende des Reitvereins hatte alles arrangiert. Einen Autobus für fast dreißig Personen. Hinten mit einem Skiträger für den Proviant, bei dem auch das Bier nicht fehlte. Eine fröhliche Truppe vom Niederrhein, die lachend und palavernd auf dem Weg nach Spanien Frankreich durchquerte. Es wurde viel gefeiert. Und viel gebechert. Irgendwie kamen sie immer wunderbar unter. In Barcelona in einer Ferienwohnung, von der aus sie als gut gelaunter Fanclub ins Stadion zogen. Vier Jahre später, bei den Olympischen Spielen in Atlanta, erwischten sie sogar ein Haus, das näher am Turnierplatz stand als die Reiterquartiere. Sie kamen auf ihren Isabell-Fan-Reisen nach Rom und Lipica, nach Göteborg und Jerez de la Frontera und eroberten in ihren späten Jahren die Welt. Sie holten nach, was sie versäumt hatten, als zu Hause noch die Tiere nach ihrem Futter und die Felder nach der Präsenz des Bauern verlangten.
Und wenn Isabell mit einem Erfolg nach Hause zurückkehrte, wurde noch einmal ganz groß gefeiert. Der Verein richtete prächtige Empfänge aus. Dann wurde sechsspännig gefahren. Erst als der Vorsitzende 2010 am Ende der Weltreiterspiele in Kentucky einen Herzinfarkt erlitten hatte, machten sie Schluss mit den anstrengenden Reisen. Die Sache ging glimpflich aus. Isabell sorgte dafür, dass er reibungslos nach Hause kam. In der Ankunftshalle des Flughafens standen schon die Sanitäter mit einer Trage bereit. Der Mann gehörte schließlich zum erweiterten Clan.
Heute sind die Empfänge immer noch herzlich, aber die Vereinsstruktur hat sich verändert, die nächsten Generationen kennen Isabell oft nicht mehr persönlich. Das Vereinsleben ist insgesamt nicht mehr so ländlich bestimmt wie einst.
Und Vater Heinrich fährt nur noch auf den heimischen Wiesen herum. Fast jeden Tag, erzählt er, schnappe er sich die Hunde und seinen Enkel Frederik und schwinge sich aufs Quad. Die Flächen, die er früher gepflügt hat, sind jetzt sein Spielplatz. Vielleicht lässt er, während er vorwärtsknattert, mitunter die Gedanken ein wenig zurückwandern in die Zeit, als er noch nach alter Tradition gewirtschaftet hat. Oder noch weiter zurück in die Epochen, die er selbst nur aus Erzählungen kennt.
1915 kaufte Heinrich Werths Großvater das Anwesen. Die Industrie hatte ihn von seinem Hof in Walsum auf der anderen Rheinseite vertrieben. Es gab weder fließendes Wasser noch Strom – die Pumpe am Brunnen wurde mit der Hand bedient. Abends saßen die Leute bei Kerzenlicht zusammen, aber nicht sehr lange, weil ihnen vor Müdigkeit die Augen zufielen. Um vier Uhr morgens mussten sie raus zum Melken.
»Die Menschen damals hatten viel zu tun«, sagt Heinrich Werth. »Aber Stress hatten sie nicht.«
Vielleicht denkt er manchmal an seine Kinderjahre zurück, an den Zweiten Weltkrieg, in dem fünf seiner Onkel auf dem Schlachtfeld fielen. An die hungrigen Städter, die aufs Land kamen, um Lebensmittel zu erbitten. All das hat dieser Hof gesehen. Die amerikanischen Besatzungssoldaten, die hier Quartier nahmen − man sieht am Haupthaus sogar Einschusslöcher aus dieser Zeit.
Doch jetzt setzt Mutter Brigitte energisch ihre Kaffeetasse ab und macht einen Punkt:
»Wenn wir weiter nur von früher reden, sitzen wir ja heute Abend noch hier!«
2 Gigolo
Nachdem Isabell sich erstmals auf den Rücken von Gigolo gesetzt hatte, sagte sie im Geiste zu ihm: Na, mein Freund, du wirst dich aber gleich ganz toll anstrengen müssen, sonst wird das nichts mit uns. Sie dürfte Mühe haben, sich vorzustellen, was aus ihr geworden wäre, hätte Gigolo sich damals nicht von seiner eifrigsten Seite gezeigt. Aber es bestand keine Gefahr: Gigolo strengte sich immer ganz toll an.
Kurz vor ihrem ersten Ritt auf Gigolo hatte sie in dem Stall in Warendorf bereits ein anderes Pferd ausprobiert, es hieß Whiskytime, war ein talentierter Riese, und hatte ihr auf Anhieb gut gefallen. Gigolo war jünger als Whiskytime, erst sechs Jahre alt, und hatte eine Blesse wie ein verwischtes Aquarell. Isabell ritt eigentlich nur noch mit ihm los, um sich nachher nicht vorwerfen zu müssen, sie hätte nicht alle Möglichkeiten in Betracht gezogen. Für einen von beiden sollte sie sich entscheiden. Und nun war da dieses Nichts von einem Hals, das sie bei Gigolo vor sich hatte.
»Hinter dem Widerrist ging es erst einmal 20 Zentimeter bergab, dann ragte ein schmaler, verblüffend langer Hals ohne jede Muskulatur nach oben. Ich hatte das Gefühl, vor einer Abschussrampe zu sitzen. Schöner Gigolo? Zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Doch dann machte er seinen ersten Trabtritt, und war wie verwandelt. Ich wusste: Der ist es. Und kein anderer. Es gibt so ein paar Pferde, wo eine Sekunde ausreicht und du weißt, es ist deins. Der erste Trabtritt von Gigolo. Der erste Moment, in dem ich Bella Rose gesehen habe. Der erste Blick auf Belantis. Das war wirklich so, ich bin geritten, er trabte, ich sagte mir, das ist ja unglaublich. Diese Athletik, diese Sportivität, dieses Tragen, dieser Schwung – so etwas hatte ich noch nie erlebt und noch nie gefühlt.«
Isabell war neunzehn Jahre alt damals. Sie und der Doktor waren zu seinem Sohn gefahren, Dr. Uwe Schulten-Baumer Junior, dem einst wichtigsten Reiter im Stall des Vaters, der als Chefarzt immer weniger Zeit für seine Pferde hatte. Als Dressurreiter hatte er eine Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft und einen Europameistertitel gewonnen, doch diese Lebensphase war vorbei. Nun wollte er eines seiner Pferde abgeben. Gigolo hatte er fünfjährig von der Familie Düfer gekauft, die das Pferd in Warendorf, am Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei, der Leistungsschmiede der traditionsreichen Reiternation, ritt. Die Experten dort hatten aber damals keine Ahnung, was sie hatten gehen lassen – Gigolos Talent war nicht wahrgenommen worden. Einer der damals wichtigsten deutschen Experten des Dressursports hörte ein halbes Jahr später, dass der Doktor ihn für Isabell gekauft hatte, und sagte da noch: »Wirklich? Musste es ausgerechnet dieser sein?« Als Isabell ihn Jahre später damit neckte, gab er zu: »Sag das bloß niemand, dass dieses Pferd in Warendorf stand und wir das nicht erkannt haben, das ist ja ein Armutszeugnis.«
»Ich fühlte es buchstäblich im Hintern. Der Doktor musste an diesem schicksalhaften Tag im Jahr 1989 nur in meine Augen schauen und wusste, nun fing etwas Großes an. Er fragte noch einmal, bist du auch sicher? Und ich strahlte und sagte, ja, ich bin sicher. Es hat mich stolz gemacht, dass er schon damals so sehr meinem Gefühl vertraut hat. Und dass wir mühelos übereinstimmten.«
Und los ging es: Gigolo, der Hannoveraner-Fuchs mit dem dünnen Hals, wurde das erfolgreichste Turnierpferd der modernen Reiterei. Seine Medaillensammlung ist legendär: Viermal olympisches Gold, zweimal Silber. Vier Titel bei Weltmeisterschaften, acht bei Europameisterschaften, vier deutsche Meistertitel. Gigolo besiegte den hochdekorierten Rembrandt und prägte eine Ära, die eigentlich nach dem Willen der internationalen Funktionäre für die Konkurrenz aus den Niederlanden reserviert gewesen war. Und er prägte Isabell.
»Ich lernte von ihm, wie sich das Ideal anfühlte. Er zeigte mir, welche Zusammenwirkung und Zusammenarbeit mit einem Pferd möglich ist, das mit Leidenschaft vorwärtsgeht. Welche Leichtigkeit daraus entsteht, selbst bei maximalem Schwierigkeitsgrad. Was Leistungswille ist. Er lehrte mich, dass es möglich ist, einen Grand Prix, der Höchstschwierigkeiten verlangt, zu gehen, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Für ihn waren diese Schwierigkeiten nicht wirklich schwer, weil er eine solche Freude daraus zog.
Sein Körperbau wurde mit den Jahren des Trainings harmonischer, auch am Hals baute er Muskeln auf. Aber zeit seines Lebens überzeugte er weniger als Standbild, denn als Sportler. Das war er durch und durch. Ein Athlet. Bis zum letzten Atemzug behielt Gigolo diesen starken Charakter. Er war intelligent, hatte eine große innere Unabhängigkeit, ein Schmusebär war er ohnehin nie – und gleichzeitig war er fest entschlossen, mit mir zusammen im Viereck das Äußerste zu geben, was nur möglich war. Er war immer wach, immer tatendurstig und schien zu fragen: Und? Was machen wir als Nächstes? Er musste sich nicht an eine andere Persönlichkeit anlehnen, sondern machte sein Ding. So als wäre es seine Aufgabe gewesen, mich mitzunehmen – und nicht umgekehrt.
Diese Haltung pflegte er in jungen Jahren regelmäßig so zu übertreiben, dass ich seinen Ehrgeiz kaum mehr kanalisieren konnte.«
Wer Gigolos überschäumende Energie am ersten Tag eines Turniers erlebte, konnte kaum glauben, dass er einen oder zwei Tage später einen dynamischen, aber losgelassenen Grand Prix würde gehen können. Er bockte nicht etwa, er wehrte sich nicht gegen die Aufgaben. Er wurde einfach derart heiß, lud sich derart mit Eifer auf, dass er kaum mehr zu kontrollieren war.
»Seine Gehfreude war so übermächtig, dass er irgendwann nicht mehr wusste, welches Bein er zuerst nehmen sollte. Mir schien es, als forderte er mich ständig auf, jetzt endlich loszulegen. Immer komm, komm, mach, mach, lass uns vorwärtsgehen. Hypermotiviert. Durch und durch leistungsbereit. Nichts interessierte ihn mehr außer den Lektionen, die er gleich bestreiten würde.
Noch mit über zwanzig Jahren hatte Gigolo diesen Spirit. Da konnte es passieren, dass er von der Weide hereingeholt wurde, zur Mähnenpflege oder zum Abwaschen, und auf der Stallgasse plötzlich anfing zu piaffieren und sich umschaute, gewissermaßen mit der Frage im Blick: Wo ist das Klavier?
Erst im Nachhinein, nach vielen Erfahrungen mit anderen Pferdecharakteren, wurde mir klar, was für ein Glück ich mit Gigolo gehabt hatte. Gleich am Anfang meiner Karriere hatte ich es mit einem so gehfreudigen Pferd zu tun. Nie musste ich ihn ermuntern. Meine Aufgabe bestand hauptsächlich darin, mit seinem überreichen Temperament umzugehen, und das, ohne ihm den Schneid abzukaufen.«
Das gehört zu den wichtigsten Kunststücken im Dressurreiten: Ein Pferd, dieses stets fluchtbereite Tier, in einen inneren Zustand zu bringen, in dem es seine Potenziale voll entfaltet und trotzdem nicht die Nerven verliert. Das Vorbild ist die Natur. Im Zustand der Erregung vollführt ein Pferd die Bewegungen ganz von selbst, die der Dressursport kultiviert hat. Das ist der Grund, warum ein Grand Prix im Idealfall einer der berühmten Ritte auf der Rasierklinge sein sollte. Gigolo und seine Reiterin passten wirklich bestens zueinander. Zwei Offensivspieler, die stets bereit waren, volles Risiko zu gehen.
Es war die Zeit des Aufbruchs, Rückschläge kannte Isabell noch nicht. Es ging vorwärts in rasantem Tempo, eventuelle Alarmsignale wären gar nicht bis zu ihr durchgedrungen, so stark und ungetrübt war ihr Selbstvertrauen. Stürze von ihren jungen, ungebärdigen Pferden steckte sie mit einem Achselzucken weg. Über mögliche Folgen dachte sie nicht nach, sie hatte weder die Verantwortung für ein eigenes Unternehmen noch war sie eine Mutter. Sie überlegte damals noch nicht, ob es vielleicht sicherer wäre, ein junges Pferd vor dem Reiten erst einmal an der Longe gehen zu lassen, damit es sich ein wenig austobte. Nein. Drauf und los.
Isabell lernte, wie sie mit Gigolos Charakter beim Turnier umzugehen hatte. Dass es nicht richtig war, ihn direkt vor der Prüfung eine Stunde lang exerzieren zu lassen, weil er dann seine Frische und seine Lust verlor. Besser war es, mit ihm morgens zu arbeiten, sodass der erste Dampf verflogen war. Vor der Prüfung wurde er dann nur noch eine halbe Stunde abgeritten und nahm so seine Freude an der Action mit ins Dressurviereck.
»Eines der liebsten Bilder, die ich vor Augen habe, wenn ich an Gigolo denke, stammt aus dem Aachener Dressurstadion. Es goss in Strömen, und das Sandviereck stand fast unter Wasser. Besonders an den Stellen, wo ich in der Kür meine heikelsten Höchstschwierigkeiten platziert hatte, den Übergang vom starken Galopp zur Pirouette, spiegelten tiefe Pfützen den Wolkenhimmel wider. Jedes andere Pferd hätte vielleicht versucht, den Pfützen auszuweichen. Aber Gigolo sagte: Yeah. Er ließ sich nicht von seiner Performance abbringen, knallte mit voller Inbrunst im Galopp durch das Wasser, dass es nur so spritzte. Dabei riss er sich nicht einmal zusammen – er genoss es.
Er liebte Wasser in jeder Form. Zu Hause im Stall brachte er all seinen Boxennachbarn bei, wie man sein Heu in die Tränke tunkte und es dann genussvoll schmatzte. Er pantschte für sein Leben gern herum. Und auch sonst war er ständig aktiv in seiner Box, bastelte und werkelte herum. Seine Tür musste mit einem speziellen Verschluss gesichert werden, weil er so clever war, dass er es immer wieder schaffte, den alten Riegel aufzuknobeln.«