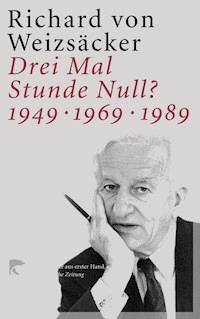Inhaltsverzeichnis
Vier Zeiten zum Geleit
Erster Abschnitt – Weimarer Republik
Wurzeln in Württemberg; der Großvater
Die Eltern in ihren Familien
Frühe Jahre in Basel und Kopenhagen
Vater, Mutter und Geschwister; Kindheit und Schuljahre in Berlin; jüdische ...
Zweiter Abschnitt – Hitler und Weltkrieg
Machtübernahme. Als Diplomat im Ausland bleiben?
Schulzeit in Bern; Vater Staatssekretär in Berlin; Münchner Abkommen und die Folgen
Abitur in Berlin; Studium in Oxford und Grenoble
Reichsarbeitsdienst
Rekrut; Kriegsausbruch, Tod des Bruders
Kriegsdienst bis zum Ende
Dritter Abschnitt – Teilung Europas und Deutschlands in der bipolaren Welt
Deutschland kapituliert; bei der Familie in Lindau
Studium in Göttingen; die Freunde
Hilfsverteidiger im Nürnberger Prozeß des Vaters
Großbritannien und der deutsche Widerstand
Berufswahl, Heirat; Familie Kretschmann
Wirtschaftspolitische Abteilung bei Mannesmann
Soziallehren der Kirchen; CDU
Fünfzehn Jahre in der privaten Wirtschaft
Vom Rhöndorfer Patriarchen zu den Achtundsechzigern
Deutscher Evangelischer Kirchentag
Ökumenischer Weltrat der Kirchen
Übergang zur Entspannungspolitik; der Nachbar Polen; Ostdenkschrift der ...
Erste Fühlung mit Helmut Kohl
Ostpolitische Initiativen aus Berlin; die Harmel-Doktrin der Nato
Wer wird Nachfolger von Bundespräsident Lübke?
Wahl in den Bundestag; die Ostpolitik der Regierung Brandt/Scheel
Ratifizierung der Ostverträge im Bundestag
Gipfelkonferenz der KSZE in Helsinki; noch einmal Polen-Verträge
Außenpolitik in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre; Auslandsreisen mit ...
Innenpolitik in der Ära Schmidt; Grundsatzprogrammarbeit der Parteien
Nach Berlin
Zwei Wahlkämpfe in der geteilten Stadt
Regierender Bürgermeister; Schwerpunkt Deutschlandpolitik
Berliner Innenpolitik: Arbeit, Wirtschaft, Sozialwesen, Ausländer, Kultur
Wahl zum Bundespräsidenten
Das Amt
Konzentration auf Außenpolitik
Ansprache am 8. Mai 1985
Auslandsreisen; erster Austausch von Staatsbesuchen mit Israel
Begegnung mit Gorbatschow in Moskau
Besuche von Honecker, Bush und Gorbatschow in Bonn
Vierter Abschnitt – Vereinigung
Die Mauer fällt
Der außenpolitische Erfolg auf dem Weg zur Vereinigung
Freundschaft mit Tadeusz Mazowiecki in Warschau und Václav Havel in Prag
Die inneren Aufgaben der Vereinigung
Unrecht, Gerechtigkeit, Versöhnung
Kirchen in der DDR
Parteistrategien bei der Vereinigung
Zusammenarbeit zwischen Kanzler und Präsident
Entwicklungspolitik in der südlichen Hemisphäre
Die Schöpfung bewahren
Kultur, Zusammenleben, Kunst
Die letzten vier Wochen im Amt
In der Freiheit bestehen
Personenregister
Copyright
Vier Zeiten zum Geleit
Als meine Tochter mit mir über mein der Erinnerung geltendes Buch sprach, riet sie in einer spontanen Regung davon ab, es nach dem zu Ende gehenden Jahrhundert zu betiteln. Für junge Menschen beginnt die Welt stets von neuem, zumal an der Schwelle zur kommenden Zeitrechnung. Sie wissen sehr wohl, daß sie nicht wurzellos herangewachsen sind. Aber was nun kommt, wollen sie selbst in die Hand nehmen. Das ist ein gutes Zeichen ihres Lebenswillens.
Gilt also, was Rilke empfahl: »Sei allem Abschied voran, als wäre er hinter Dir, wie der Winter, der eben geht«? Als wäre er hinter Dir – ganz so ist es nicht. Jahreszeiten der Natur haben sowenig eine Stunde Null wie die Zeitfolgen in der Geschichte. Beider Zukunft ist schon in der Vergangenheit enthalten. Niemand entgeht diesem Zusammenhang. Deshalb erinnern wir uns.
Dabei erfahren wir aus der Geschichte nicht, was wir morgen tun sollen. Sie hält keine Handlungsanweisungen für uns bereit. Jacob Burckhardts Zuspruch, Geschichte mache »den Menschen nicht klug für ein andermal, sondern weise für immer«, klingt in unseren Ohren heute befremdlich. Der große Skeptiker hatte den Weg unseres Jahrhunderts nicht vorhergesehen. Doch auch an dessen Ende würde er uns wohl ans Herz legen, seine Aussage nicht zu überhören, vielleicht nun erst recht nicht.
Das zwanzigste Jahrhundert hat uns in extreme Lagen menschlicher Existenz geführt. Seine Prüfungen machen es schwer und legen es um so eher nahe, über bewußt erlebte Vergangenheit Rechenschaft abzulegen. Den Jungen wird das in ihrer eigenen Meinung nicht vorgreifen. Wenn Erziehung und Weitergabe von Erfahrung einen Sinn haben sollen, dann gehört dazu, die junge Generation in ihrer geistigen Freiheit zu bestärken. Sie sollen das Zutrauen finden, den eigenen Augen, Gefühlen und Werten Glauben zu schenken. Für ihre Kraft, sich selbst zu entscheiden, wird ihnen aber die gewissenhafte Einsicht helfen, daß eine Zukunft auf sie wartet, in der ziemlich viel von der Vergangenheit wirksam sein wird. Ein Geschichtsverständnis muß weiter zurückreichen als die eigene Biographie.
Was ich hier aufschreibe, ist kein Geschichtsbuch, sondern ein persönlicher Bericht über ein aus der Familie kommendes und in sie eingebettetes Leben. Ihrer Einstellung entsprach es, sich aktiv an den allgemeinen Aufgaben ihrer Zeit zu beteiligen. Immer wieder waren ihre Erlebnisse mit der historischen Entwicklung verknüpft. So war es auch bei mir. Bei meiner Schilderung kann ich daher das eine vom anderen nicht säuberlich trennen. Dennoch geht es mir weniger um generelle Analysen als vielmehr um die Wiedergabe eigener Eindrücke und konkreter Begebenheiten.
Mein Weg führte mich durch vier Zeiten unseres Jahrhunderts, die ich aus meinem Blickwinkel kurz charakterisieren will: Weimarer Republik – Hitler und Weltkrieg – Teilung Europas und Deutschlands in der bipolaren Welt – Vereinigung.
I.
Die dramatischen Jahre der Weimarer Republik erlebte ich als wohlbehütetes Kind zu Hause, zumeist in Berlin. Mein Großvater hatte seine landespolitisch führende Tätigkeit in Württemberg beendet. Mein Vater war als Diplomat vorwiegend mit Fragen des Völkerbunds beschäftigt. Die außerordentliche kulturelle Kreativität des zu einer europäischen Metropole herangewachsenen Berlin überstieg in dieser Zeit meiner ersten sieben Schuljahre meinen Horizont bei weitem. Aber die politische Ruhelosigkeit und die sozialen Spannungen waren uns Schülern deutlich bewußt. Ohne die Ereignisse in ihrem Zusammenhang zu begreifen, diskutierten wir sie auf dem Schulhof mit kindlichem Temperament. Als Zwölfjähriger lernte ich, täglich zweimal eifrig und neugierig Zeitung zu lesen.
II.
Dies war auch mein Alter, als Hitler an die Macht kam. Die folgenden Jahre verbrachte ich wegen des Diplomatenberufs meines Vaters fast ganz im Ausland. Nach Deutschland kehrte ich 1938 zurück, um meinen Wehrdienst abzuleisten. Bald darauf brach der Krieg aus; sieben Jahre lang war ich Soldat.
Es herrschte eine Dämonie, die wir nicht begriffen. Unsere ethischen Maßstäbe, mit denen wir aufgewachsen waren, reichten an sie nicht heran. Wir blickten in Abgründe und gerieten, bewußt oder unbewußt, in sie hinein.
Unausweichlich und notwendig bleibt es, daß jede heranwachsende Generation, gerade weil ihre eigenen Erfahrungen und Urteilskriterien mit jener Zeit so unvergleichbar sind, immer von neuem forschend fragt, wie es zu den ungeheuerlichen Verbrechen unter dem Nationalsozialismus kommen konnte. Am Ende des Krieges hatte ich mit meinen fünfundzwanzig Jahren ein Lebensalter erreicht, in dem ich noch selbst zu den Fragenden und doch auch schon zu den Befragten gehörte. Mir liegt es besonders am Herzen, über die Erfahrungen dieser Zeit zu berichten. Sie sind mir nicht weniger wichtig als die Dinge, die mich Jahrzehnte später in die Öffentlichkeit führten.
III.
Die dritte meiner vier Zeiten erlebte ich in der alten Bundesrepublik Deutschland. Es kam zur Befreiung von der Hitler-Diktatur. Zugleich brachten die ersten Nachkriegsjahre schweres menschliches Leid für ungezählte Menschen. Man lese nur, um ein Beispiel zu nennen, die Aufzeichnungen des Arztes Hans Lehndorff über die Jahre 1945 bis 1947 in Ostpreußen.
Es gab kein neues Versailles und keine Wiederholung von Weimar. In der Bonner Republik, wie wir sie nennen, wurden wir ein fester Bestandteil der westeuropäischen und transatlantischen politischen Zivilisation. Grundgesetz, soziale Marktwirtschaft und Allianzgefüge waren ihre Kennzeichen. An die Stelle der traditionellen Großmächte mit ihrem prekären Balancesystem waren die Supermächte getreten. Ost-West-Konflikt und Kalter Krieg im atomaren Zeitalter beherrschten auch uns.
Zwölf Millionen Vertriebene und Flüchtlinge wurden aufgenommen und, so gut es ging, neu beheimatet – ein größeres Wunder noch als das berühmte Wirtschaftswunder. Lange wurde das Land von der alten Generation mit ihren Erfahrungen aus Weimar regiert. Sie zeigten wenig Verlangen nach einer Mitwirkung von uns Jüngeren. In einer neu entstandenen, demokratisch egalisierten Gesellschaft erfolgte erst während der späten sechziger Jahre der Abschied von den Alten.
Der Weg in die westliche Partnerschaft mit ihrem Kern in der deutsch-französischen Aussöhnung war das Werk der politischen Führung. Dagegen wurden die Beziehungen zum anderen Teil Deutschlands und zu den östlichen Nachbarn zunächst stärker aus der Gesellschaft selbst heraus entwickelt. Einen erheblichen Anteil daran hatten die Kirchen dank ihrer nie abgerissenen Ost-West-Verbindungen. Dort lagen auch meine eigenen ersten öffentlichen Aktivitäten mit den Schwerpunkten Polen, DDR und Berlin. Erst später wurde ich in politische Ämter gewählt.
Im Zeichen des atomaren Patts wandelte sich die Sowjetunion allmählich zu einem Sicherheitspartner, auch wenn eine Wiedergeburt des alten Rußland noch nicht zu ahnen war. Die Bipolarität schien weiterzuleben, bis Gorbatschow erkannte, daß gründliche Reformen unausweichlich würden, um seinen Herrschaftsbereich zu stabilisieren und wettbewerbsfähig zu machen. Doch was er damit lostrat, wurde zu einer Lawine der Befreiung von diktatorischer und imperialer Beherrschung. Der Prozeß von Helsinki hatte sie in den Befreiungs- und Bürgerrechtsbewegungen der Ostblockländer vorbereitet. Die Öffnung der Mauer wurde erzwungen. Der Warschauer Pakt löste sich auf. Der Kalte Krieg ging zu Ende. Ohne neuen konstitutionellen Akt wurde Deutschland staatlich vereint. Die Europäische Union wurde auf den Weg von Maastricht geschickt.
IV.
Die vierte meiner vier Zeiten, in der ich als erster Präsident im vereinigten Deutschland amtierte, stellt uns vor die zentrale Herausforderung, in der Freiheit zu bestehen, die errungen ist. Es ist unsere schönste und zugleich unsere schwerste Aufgabe. Noch haben wir sie nicht bewältigt. Bei ihr wird mein Bericht am Ende ausklingen.
Erster Abschnitt
Weimarer Republik
Wurzeln in Württemberg; der Großvater
Mein Leben begann im Zeichen einer dem Auge wahrnehmbaren Spannung. Geboren wurde ich am 15. April 1920 in einer Mansarde des königlichen Schlosses zu Stuttgart, aber nicht als Gast des Königs, sondern unter der roten Fahne, die auf dem Dachfirst wehte.
Die Revolution, die den Ersten Weltkrieg beendete, hatte auch das Königreich Württemberg in eine Republik verwandelt. Sie war recht friedlich verlaufen. Als das Schloß besetzt wurde, gab es Gewalt nur beim Hissen der neuen Fahne, sonst wurde in der Königlichen Residenz nicht das geringste beschädigt.
Nun neigen die Württemberger im allgemeinen ohnehin nicht zu extremen Ausschlägen. Sie suchen den vernünftigen Ausgleich. Auch unter Revolutionären ging es bedächtig und gesittet zu. Ihr letzter König, Wilhelm II., machte es ihnen nicht schwer. Nachdem er am 30. November 1918 in würdiger Form seine Abdankung erklärt hatte, schrieb der führende Sozialdemokrat Wilhelm Keil in einer Stuttgarter Zeitung, die revolutionäre Bewegung habe sich nicht im geringsten gegen die Person des Königs gerichtet, sondern gegen den Gedanken der Monarchie, den der gleichnamige Kaiser in Berlin Bankrott gemacht habe. Die persönliche Achtung, die das Volk dem König selbst bisher entgegengebracht habe, bleibe ungemindert bestehen. Sogar der Spartakist Seebacher erkannte das korrekte Verhalten des Königs an und meinte zur Notwendigkeit, die Monarchie abzuschaffen, nur: »S’ischt halt wegge dem Sischteem.« Schon beim 25. Thronjubiläum im Jahre 1916 hatte der Vorsitzende der Sozialdemokraten erklärt, sie seien zwar Republikaner, aber wenn es soweit sei, würden sie den König zum Präsidenten wählen. Dieser war bis zuletzt ein nobler, humaner, tüchtiger Monarch. Nach Kräften förderte er die freie Entwicklung seines Landes. In seiner Zeit wurde Württemberg zum »Musterländle«.
Doch nun war Frühling 1920. Meine Eltern hatten das Winterhalbjahr mit ihren drei Kindern, meinen älteren Geschwistern, in Den Haag verbracht, wo mein Vater als Marineattaché an der deutschen Gesandtschaft in den Niederlanden tätig war. Dort gingen der Dienst und das Gehalt zu Ende. Meine Mutter stand unmittelbar vor der Geburt eines Kindes. Die Familie schickte sich eilig zur Heimreise an, aber wie? Überall in Deutschland gärte es, von rechts und links. Immer wieder kam es zu blutigen Zusammenstößen. Die Schulden des Reichs beliefen sich auf 300 Milliarden Mark. Der Kapp-Putsch brach aus. Er war ein von weit rechts inszenierter Umsturzversuch. Die Reichsregierung mit Friedrich Ebert an der Spitze wich zunächst nach Dresden und später nach Stuttgart aus; von dort rief sie die Arbeiterklasse zum Schutz der Republik auf. Es folgte der Generalstreik. Die Eisenbahnen lagen still.
Nach vieler Mühe fanden meine Eltern einen kleinen holländischen Rheinfrachtdampfer, auf dem die Familie von Nimwegen aus aufbrechen konnte. Es folgte eine sechstägige Fahrt auf dem Strom ohne Schiffsverkehr, vorbei an verwaisten Häfen, an Schießereien in Duisburg, an alliierten Fahnen in Köln und Bonn. Gemäß dem verheißungsvollen Schiffsnamen »Kinderdyk« wäre ich beinahe an Bord auf dem Rhein ein veritabler Sohn des Stromes geworden. Doch wurden glücklicherweise unmittelbar vor meiner Geburt der rettende Mannheimer Hafen und von dort aus die Württembergische Landeshauptstadt erreicht. So kam ich, wie schon meine beiden Eltern und drei meiner vier Großeltern, in Stuttgart zur Welt.
Die väterliche Familie stammt aus dem fränkischen, hohenloheschen Land, das sich der Kurfürst und spätere König Friedrich von Württemberg 1805 nicht ohne französische Hilfe einverleibt hatte. Für die Hohenloher blieb Württemberg noch lange die Fremde. Eine Symbiose mit den Schwaben ging ihnen gegen den Strich. Als mein Ururgroßvater aus der alten Hohenloher Residenz Öhringen zur Ausbildung in das württembergische Blaubeuren fahren mußte, legte ihm seine Mutter warm ans Herz, nicht das häßliche Schwäbisch zu lernen, sondern der fränkischen Mundart treu zu bleiben. Dennoch wuchs man in Württemberg schließlich friedlich zusammen.
Es ist eine parzellierte, vielfältige, oft etwas enge Landschaft, die den neugierigen Drang in die Welt fördert, ohne daß er die Heimatliebe lockern würde. Man ist eher bedächtig als redselig, eher bewahrend als umstürzlerisch. Man hat starke Gefühle wie alle Menschen, behält sie aber vorzugsweise für sich, um nicht aufdringlich zu wirken. Viele Familien stammen vom Land. Auch die Industrialisierung beseitigt die zumeist ländliche Prägung nicht ganz. Wer in der Fabrik arbeitet, versucht sich sein kleines »Gütle« zu erhalten. Es gehört sich, fleißig und sparsam zu sein, wobei die Leistungen oft weit über das gebaute Häusle hinausgehen.
Schwäbische Tüftler und Erfinder haben der Welt das astronomische Fernrohr und den Benzinmotor, die Mundharmonika und den Volkswagen beschert. Schon früher waren wichtigste Impulse zur geistigen Entwicklung und Einigung der Deutschen aus dem Schwabenland gekommen. Die Namen Kepler und List, Hegel und Schelling, Schiller und Uhland, Hölderlin und Mörike erinnern daran. Manche von ihnen zog es aus der engeren Heimat in die Ferne, wo sie zuweilen rascher berühmt wurden als zu Hause. Helmut Thielicke, dereinst nach Württemberg verschlagener rheinischer Theologe, pflegte zu sagen, es gehöre zu den Besonderheiten der Schwaben, daß sie für ihren beschränkten Horizont zu klug seien. Sie taten sich gar nicht leicht, die einmal Abgewanderten wieder an ihr Herz zu drücken. Als der weltberühmte Hegel 1831 in Berlin starb, begnügte sich der »Schwäbische Merkur« damit, die amtliche Todesmeldung der »Allgemeinen Preußischen Staatszeitung« wörtlich abzudrucken und anstelle eines würdigenden Nachrufs lediglich drei Worte hinzuzufügen: »aus Stuttgart gebürtig«. Diese entscheidende Tatsache hatte das Berliner Blatt unterschlagen.
Andererseits fehlte es nie an schwäbischem Selbstbewußtsein gegenüber den Preußen. Als König Friedrich Wilhelm IV. 1848 in Frankfurt am Main den mit meinem Urgroßvater befreundeten württembergischen Abgeordneten Rümelin auf die Nennung seines Heimatortes Nürtingen fragte, wo das Nest denn liege, antwortete ihm Rümelin: Auf dem Wege vom Hohenstaufen zum Hohenzollern.
Meine Vorfahren Weizsäcker waren Bürger vom Land. In der Nähe von Öhringen schufen und bewahrten sie, wenn auch mit wechselndem Erfolg, ihre wirtschaftliche Selbständigkeit beim Müllerhandwerk. Es war die überkommene Armut, die die Kräfte der Selbsthilfe wachsen ließ. Allmählich entwickelte sich eine Familie der Pfarrer und Wissenschaftler, der Beamten und Politiker. Es ging ohne Vererbung von Titeln, Höfen und Vermögen vor sich. Jede Generation hatte sich ihren Platz selbst zu erwerben. Entscheidend blieb die individuelle Qualifikation, gemäß den Regeln der werdenden Bürgergesellschaft, die die Leistungselite der Geburtselite gegenüberstellte.
Gewiß war das Herzstück dieser Bürgergesellschaft in der Wirtschaft zu finden, im kleinen und mittleren Unternehmertum, im Handwerk, im Handel und in der Produktion. Selbständigkeit, Individualität und Autonomie anzustreben und zu bewahren, sich niemandem zu verdingen, das war ihr berufliches Lebensprinzip. Nicht Objekt, sondern Subjekt sein zu wollen, frei zu sein und zu bleiben bedeutete aber notwendigerweise, sich aus den Angelegenheiten des Gemeinwesens nicht herauszuhalten, sondern eine bürgerliche Öffentlichkeit zu schaffen und mitverantwortlich auszufüllen. Es galt, den Horizont zu erweitern, sich eine allgemeine Bildung zu erwerben, die einem dann auch im eigenen Unternehmen sehr nützlich werden konnte. Über diese Entwicklung hat Lothar Gall am Beispiel der Mannheimer Familie Bassermann eine lehrreiche Geschichte vom Bürgertum in Deutschland geschrieben.
»Wo käm die schönste Bildung her, und wenn sie nicht vom Bürger wär«, schrieb Goethe. Gemäß der Idee des Neuhumanismus galt es, sich durch allgemeine Bildung zu fördern, an öffentlichen Aufgaben teilzuhaben und die Kultur zu pflegen. Mehr noch als die Kunst fand die Wissenschaft starke Impulse im Bürgertum.
So gingen handwerkliches, unternehmerisches und Bildungs-Bürgertum ineinander über, und so entwickelten sich auch die Weizsäckers. Der begabte Sohn des letzten zum Müllerhandwerk gehörenden Vorfahren, mein Ururgroßvater, wurde der erste Studierte der Familie. Er hatte von seinem hohenloheschen Landesfürsten ein Stipendium erhalten, wurde Theologe und Stiftsprediger in Öhringen.
Sein jüngerer Sohn Julius, von Haus aus zunächst Theologe, nahm 1848 an der Tübinger Stiftsrevolte teil. Das Tübinger Stift war in der Reformationszeit als »Hochfürstliches Stipendium« für den theologischen Nachwuchs gegründet worden und spielte in der ganzen Geistesgeschichte des Südwestens von Deutschland eine prägende Rolle. Hegel, Hölderlin und Schelling sind aus ihm hervorgegangen. Julius Weizsäcker bekannte sich zur Einheit und Republik für ganz Deutschland, wurde unter Rankes Einfluß Historiker und verbrachte seine akademische Laufbahn an sechs Universitäten. Seinen Lehrstuhl in Tübingen errang er im Wettbewerb gegen Jacob Burckhardt. Zuletzt war er Professor an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin – ein stets politisch denkender, unabhängiger Gelehrter, wie es damals bei uns gar nicht so selten war.
Der ältere Sohn des Öhringer Stiftspredigers, Carl Weizsäcker, mein Urgroßvater, wurde und blieb Theologe in Württemberg. Sein Thema wurde die Kirchengeschichte, sein Hauptwerk trug den Titel: Das apostolische Zeitalter der christlichen Kirche. Mit seiner ganz undogmatischen Frömmigkeit konzentrierte er sich um des Glaubens willen auf die Erforschung historischer Tatsachen. Weithin bekannt wurde er durch seine zwölfmal wiederaufgelegte Übersetzung des Neuen Testaments, mit der er sich bemühte, Ergebnisse der Geschichtsforschung aus dem griechischen Urtext heraus im Deutschen verständlich zu machen. Er galt als unorthodox, völlig selbständig, liberal und konservativ zugleich.
Sein wacher politischer Sinn bewahrte ihn vor der Isolierung in einem wissenschaftlichen Elfenbeinturm. Er wurde Rektor der Universität Tübingen, später ihr Kanzler, nach damaligen Begriffen also Vertreter des Staates an der Universität und damit ex officio Mitglied des Württembergischen Landtages. Dort übte er Sitz und Stimme in großer Unabhängigkeit von der Regierung aus.
Er war ein ökumenischer Vorkämpfer für den konfessionellen Frieden. Aus seiner nahen Freundschaft mit dem katholischen Bischof Hefele von Rottenburg ist eine kleine Begebenheit überliefert. Der Bischof war vom I. Vatikanischen Konzil aus Rom zurückgekehrt, auf dem das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes, von seiner »Infallibilität« beschlossen worden war. Der Rottenburger Bischof war der letzte der deutschen Bischöfe gewesen, der seinen tiefen Widerwillen gegen dieses Dogma schließlich aufgegeben hatte. Als Weizsäcker ihn am Bahnhof in Tübingen abholte, war der Bahnsteig mit Glatteis überzogen. Da bot er dem Bischof seinen Arm als Stütze mit der Bemerkung an: »Es ist halt wegen der Hinfallibilität.« Bald darauf bekam er selbst einen Spiegel der Hinfälligkeit vorgehalten. Täglich pflegte er in Tübingen bei einer Bäckerei eine Laugenbrezel für drei Pfennige zu erwerben. Ein kleiner Bub verkaufte sie ihm. Eines Tages fand er in seiner Tasche nur noch zwei Pfennige und fragte den Buben, ob er ihm die Brezel auch dafür geben würde. Darauf erhielt er zur Antwort, er könne den Pfennig ja morgen nachbringen. Aber was sei, fragte er zurück, wenn er es vergesse? Antwort: Das werde er schon nicht vergessen. »Aber wenn i heut nacht sterb?« Antwort des Buben: »Dann isch au net viel hin.«
Mein Urgroßvater Carl Weizsäcker (1822-1899) war Theologe und Rektor der Universität Tübingen. Bekannt wurde er durch seine zwölfmal neu aufgelegte Übersetzung des Neuen Testaments. Mit seiner ganz undogmatischen Frömmigkeit erforschte er um des Glaubens willen historische Tatsachen und war ein ökumenischer Vorkämpfer für den konfessionellen Frieden.
Mit dem Sohn des Theologen, meinem Großvater Karl, führte der Weg nun ganz in die Politik. Nach Teilnahme am Krieg 1870/71 als siebzehnjähriger Freiwilliger und nach juristischer Ausbildung arbeitete er als Richter und im Justizministerium. Bei der Einführung des deutschen Jahrhundertwerks im Zivilrecht, des Bürgerlichen Gesetzbuches, wirkte er maßgeblich mit, insbesondere durch Anpassung der Landesgesetze. Später wurde er, wie es in Württemberg damals noch so schön hieß, Kultminister, dann Staatsminister des Äußeren, bis er 1906 zum Württembergischen Ministerpräsidenten berufen wurde, was er bis zur Revolution 1918 blieb. Stets hielt er Distanz zu Bürokratie und Parteien. Seinem König blieb er lebenslang treu.
Ich erinnere mich an seinen kleinen Wuchs und seinen spitzen Bauch, seine rasche und scharfe Zunge, seinen Witz und sein Wohlwollen. Als junger Amtsrichter hatte er es einmal mit der Scheidungsklage eines eifersüchtigen Ehemannes zu tun. Er fragte ihn: »Jetzt gucket se emol Ihre Frau an, glaubet se wirklich, daß mit dere einer durchgeht?« »Ha – noi«, war nach einigem Zögern die Antwort, und der Kläger nahm seinen Antrag zurück. Weizsäcker galt als klug, diplomatisch geschickt und temperamentvoll, bald sarkastisch, bald liebenswürdig, von ausgeprägtem Selbstbewußtsein und einem zumeist zurückgehaltenen, aber strengen Urteil. Sein Freund und Kollege Egelhaaf meinte, er habe die »eiserne Hand im Samthandschuh«. Ein anderer naher württembergischer Studienfreund, Kiderlen-Wächter, der spätere Außenstaatssekretär, nach heutigen Begriffen Außenminister des Reiches, nannte ihn wohlmeinend einfach Pascha. Niemand sprach ihm das bedeutende Gewicht ab.
Mein Großvater Karl Weizsäcker hatte maßgeblich bei der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches mitgewirkt. Von 1906 bis 1918 war er Ministerpräsident der »Königlichen Republik Württemberg«, wie Kaiser Wilhelm II. sie wegen ihrer Liberalität nannte. Neben meinem kleinen, rundlichen, scharfsinnigen und witzigen Großvater (rechts) geht der württembergische Gesandte in Berlin, Varnbüler.
Während seiner Leipziger Studienzeit lernte er die Tochter des aus Hessen stammenden Reichsgerichtsrats von Meibom kennen. Bald verlobten sie sich, und am Tag danach kam es zu einem heiteren Gedankenaustausch. Er fragte sie, warum sie ja gesagt hätte. Ihre Antwort: »So was läßt mer halt net naus.« Auf ihre Gegenfrage, wie seine Reaktion im Falle ihres Nein gewesen wäre, hätte er sich, wie er sagte, mit dem Gedanken getröstet: »Des isch aber e rechte Gans.« Nein, das war sie, meine Großmama, wahrlich nicht. Sie hatte einen klaren Verstand, war von einer eher lautlosen, nüchternen Warmherzigkeit und von einem ausgeprägten Gefühl für Sitte und Anstand. Handele, wie du es vor dir selbst verantworten kannst, das war ihre Maxime für sich und für uns. Sie war hilfreich und streng zugleich. Nicht um die Wirkung nach außen ging es ihr, sondern um innere Maßstäbe.
Es waren unruhige, immer schwerer werdende Zeiten für den Ministerpräsidenten. Die internationale Isolierung des Reiches nahm zu. Im Spannungsfeld zur Zentralmacht verfügten die Länder kaum über Einfluß auf die Außenpolitik des Reiches, zu schweigen von den provozierenden Bravaden des Kaisers.
Im Königreich Württemberg ging es immer noch recht liberal zu. 1907 kam es in Stuttgart zu einem internationalen Sozialistenkongreß unter Teilnahme von Bebel und Rosa Luxemburg, Lenin und Trotzki, Jean Jaurès und einem linken Revolutionär aus Italien mit dem Namen Mussolini; gemeinsam wurden Kapitalismus und Krieg scharf verdammt. Über die Erlaubnis zu dieser Tagung in der schwäbischen Hauptstadt entrüstete sich der Kaiser in Berlin: Das sei die »Königliche Republik Württemberg«.
Als der Weltkrieg ausbrach, sagte Weizsäcker Anfang August 1914 inmitten der vaterländischen Begeisterung zu seinen Vertrauten: »Dieser Krieg endet mit einer Revolution.« Er, der in den ersten Wochen des Krieges seinen ältesten Sohn verlor, hatte kaum Einfluß auf die Ereignisse im Reich. Maßvoll bleiben, Friedensfühler ernst nehmen, keine Expansionspolitik betreiben, das waren seine ständigen Mahnungen. Mit Entrüstung widersetzte er sich dem ebenso hartnäckigen wie unsinnigen Streit der Bundesländer um die noch gar nicht eroberte, aber erhoffte Kriegsbeute fremder Territorien. Seine größte Erbitterung galt dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg, dessen dürftige Chancen und fatale Folgen er klar vorhersah. Hätte man in Württemberg mehr Geld, so sagte er, dann müßte man mehr Irrenhäuser bauen, um dort alle die vielen U-Boot-Narren unterzubringen.
Als dann die entscheidenden Weichen falsch gestellt wurden, wenig später Reichskanzler Bethmann Hollweg zurücktrat und die Vereinigten Staaten Deutschland den Krieg erklärten, ließ die Oberste Heeresleitung durch zwei Reichsminister bei Weizsäcker vorfühlen, ob er bereit sei, Reichskanzler zu werden. Er winkte sofort ab. Es war alles viel zu spät, zumal die Macht im Reich praktisch längst nicht mehr bei der Reichsregierung lag, sondern beim Militär.
Der Krieg ging zu Ende. Die Revolution kam. Der letzte königliche Ministerpräsident von Württemberg, der noch 1916 von seinem Monarchen in den erblichen Freiherrnstand erhoben worden war, trat zurück. Er tat es mit Gelassenheit. Von einem Tag auf den anderen räumte er seine Dienstwohnung für seinen sozialdemokratischen Nachfolger Blos in bestem persönlichen Einvernehmen, freilich ohne seine Freude an spitzen Kommentaren unterdrücken zu können. Die nachrückende Familie nannte er »die Blöße«.
Die Eltern in ihren Familien
Zum Durchbruch kam nun eine völlig veränderte Welt. Das Lebensglück unzähliger Familien war zerstört; ein Bruder meines Vaters, zwei Brüder meiner Mutter waren gefallen. Eine neue, fremde, schwer durchschaubare, unsichere Epoche begann.
Natürlich war der Sturz der Monarchie nicht allein die Folge des verlorenen Krieges. Unter der Decke hatte während der letzten Jahrzehnte der Kaiserzeit etwas gekeimt, was oft eine Revolution genannt wurde, in Wahrheit aber eine Übergangsphase war, in der gründlich Überlebtes künstlich am Leben gehalten worden war. Nicht nur einige der Monarchen und der privilegierten Geburtselite hatten durch ihr Verhalten dazu beigetragen. Auch die alte Leistungselite, vor allem also das Großbürgertum, hatte letzten Endes versagt. Es hatte die unaufhaltsamen Veränderungen in einer sich industrialisierenden Gesellschaft nur ungenügend verstanden und mitgestaltet. Es war zum Besitzbürgertum geworden. Das Ideal der freien und verantworteten Unabhängigkeit war mehr und mehr einer Verteidigungshaltung gewichen. Man hatte sich in wachsender Sorge um den eigenen Wohlstand eingeigelt. Die »Bürgerlichen« waren allmählich zum parteipolitischen Begriff geworden. Ohne ihr Verhalten hätte dem Kampfbegriff der Klassengesellschaft etwas Entscheidendes gefehlt, auch wenn es nicht eine bürgerliche Klasse gab, sondern, nach Max Weber, allenfalls bürgerliche Klassen. Nicht nur die Monarchie, auch das bürgerliche Zeitalter im herkömmlichen Verständnis war mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende. Bürger im sozialen Sinn begannen sich zu entwickeln.
Meine Familie zählte zu den Bildungsbürgern, nicht den Besitzbürgern. Doch gingen die Spannungen der Zeit natürlich auch an ihr nicht vorüber. Meine Mutter Marianne, 1889 geborene von Graevenitz, entstammte väterlicherseits dem seit Napoleons Zeiten bestehenden württembergischen Zweig einer mecklenburgischen Familie. Ihr Vater war vor dem Krieg württembergischer Militärbevollmächtigter in Berlin, wo meine Eltern 1911 in der Stülerschen Matthäikirche getraut wurden. Zuletzt war ihr Vater Generaladjutant des Königs von Württemberg, mit dem er am 9. November 1918 das königliche Schloß in Stuttgart in Richtung Bebenhausen verließ. Seinen Mitmenschen galt er als ein aufrechter Ritter. Ich habe ihn nicht mehr kennengelernt. Seine Frau, meine Großmutter mütterlicherseits, kam aus der schwäbischen Kaufmannsfamilie Klotz. Sie war eine schöne Frau, eine von allen Enkeln umworbene und geliebte, zu jedem Ernst und Spiel aufgeschlossene warmherzige Großmutter. Mit meinem ältesten Bruder führte sie eine über zehn Jahre währende Korrespondenz in Form von Versen.
Meiner Mutter war es in ihrer Jugend eher schwergefallen, sich den damaligen gesellschaftlichen Gepflogenheiten anzupassen. Lebenslang hatte sie ein waches soziales Empfinden, einen starken Willen und war streng vor allem mit sich selbst. Vergeblich war der warmherzige Seufzer ihrer geliebten und gemütstiefen Großmutter Klotz: »Willenlos und innig froh – ach, wär’ mein Mariannchen so!«
Dankbar und familienfroh war sie stets, aber gewiß niemals willenlos. Schon mit ihrem Konfirmationsspruch: »Habe deine Lust an dem Herrn. Er wird dir geben, was Dein Herz wünscht«, war sie nicht zufrieden. Es verlangte sie nach Herausforderungen, nicht nach Verheißungen. Bereits als Halbwüchsige suchte sie soziale Nebenbeschäftigungen, betreute Pflegekinder und gab in der Blindenanstalt zwei Mädchen Klavierunterricht. Bälle, zumal Hofbälle, empfand sie als anstößig und ertrotzte sich das in der Familie höchst ungewöhnliche Recht, die Teilnahme an solchen Veranstaltungen abzusagen. Beim Kartenspiel mit ihren Eltern hielt sie mehr oder weniger wahrnehmbar eine ernsthafte Lektüre unter dem Tisch auf den Knien. So las sie zum Beispiel Lily Brauns »Tagebücher einer Sozialistin«. Dieses damals berühmte, sehr persönliche, dramatische, auch heute noch faszinierende Werk stammte von der pazifistischen Tochter des preußischen Generals von Kretschmann, überdies einer Großtante meiner eigenen Frau.
In dem so übereilig und demonstrativ aufblühenden Reich der Vorkriegszeit empfand meine Mutter immer stärker die Diskrepanz zwischen dem ständig zunehmenden Reichtum und wachsender bitterer Armut. Schon in meiner Kindheit habe ich von ihr zum ersten Mal den allseits bekannten Spruch gehört: »Wer mit zwanzig kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer mit vierzig nicht konservativ ist, hat keinen Verstand.« Er kam ihrer Anschauung der Dinge ziemlich nahe, obwohl er mir später nie sehr eingeleuchtet hat. Denn einen Konservativen ohne ausgeprägtes soziales Empfinden habe ich immer für einen schlechten Konservativen gehalten, wie auch ein Sozialist, allem visionären Drang zur Veränderung der ungerechten Verhältnisse zum Trotz, doch nie schlecht dabei gefahren ist, wenn er prüfte, was es zu bewahren galt. Dem hätte meine Mutter aber gewiß nicht widersprochen.
Es waren die menschlichen und sozialen Impulse, die sie seit ihrer Kindheit leiteten, ohne daß sie deshalb die politischen Theorien studierte oder gar, wie Lily Braun, einen scharfen Bruch mit ihrer Welt auf sich nahm, um Revolutionärin zu werden. Sie konzentrierte sich auf das praktische Tun. Während des Krieges war sie Pflege- und Operationsschwester in Lazaretten. Als dann nach Kriegsende die Frauen erstmals ein Wahlrecht zur Weimarer Nationalversammlung bekamen, beteiligte meine Mutter sich gelegentlich auch einmal an revolutionären Kundgebungen. Sie wählte etwas links von den Konservativen. Auf die Frage an die Frauen, was sie mit ihrem neuen Wahlrecht denn nun konkret machen würden, ging damals freilich in der älteren Generation der Familie noch der Spruch um: »Wir wissen noch nicht, was der Großpapa wählt.«
Mein 1882 geborener Vater war im Jahr 1900 als Kadett zur Marine gegangen, in der er bis kurz nach dem Kriegsende blieb. Einerseits war sie ein Symbol der Reichseinheit, zu der er sich vorbehaltlos bekannte, ohne deshalb im geringsten an seinem Schwabentum irre zu werden. Andererseits war die problematische Tirpitzsche Flottenpolitik, von des Kaisers Begeisterung unterstützt und angetrieben, zum provokanten Ausdruck des Anspruchs auf einen größeren »Platz an der Sonne« geworden. Die menschliche Atmosphäre unter seinen Altersgenossen empfand mein Vater wohltuend. Zeitlebens besann er sich dankbar auf die Kameradschaft in seiner über zweihundert Kadetten zählenden Crew. Sie fühlten sich – entgegen der aufreizenden Wirkung der Flottenaufrüstung – besonders eng mit den britischen Seeleuten verbunden und unternahmen auf Schiffen aller Art weite Reisen bis nach Ostasien, von denen feine Aquarelle meines Vaters zeugen; in dieser Maltechnik war er zeitlebens ein Meister. Als junger Leutnant beobachtete er an der Tafel der legendären alten Kaiserin von China, wie die Diener, ehe der letzte Gast verschwunden war, die Weinreste aus den Gläsern in die Flaschen zurückgossen – auch das war offenbar ein Teil der dortigen Zucht und Ordnung.
Mit dem Einfluß Kaiser Wilhelms auf die Flotte kam er bald in nähere Berührung. In seiner Ausbildungszeit war er zum Crew-Ältesten geworden; als junger Leutnant wurde er selbst Ausbilder des Prinzen Adalbert, des einzigen der Kaisersöhne, der zur Marine ging. Später hatte er als sogenannter Flaggleutnant des Flottenchefs oft Gelegenheit, den Kaiser zu beobachten. Sein Urteil blieb deutlich genug, wenn auch diskret. Er empfand das theatralische Auftreten der Majestät als Ausdruck jenes übertriebenen Stolzes, der auf eine Mischung von Selbstüberschätzung und Unsicherheit deutete. Er erlebte die allzu leichte Beeinflußbarkeit des Kaisers, sobald es innerhalb der Marineführung zu Meinungsverschiedenheiten kam.
Über den Ausbruch des Krieges pflegte er Lloyd George zu zitieren: »Wir alle sind in den Krieg hineingestolpert.« An Bord des Flaggschiffs »Friedrich der Große« nahm er an der Skagerrak-Schlacht teil, dem einzigen großen Kräftemessen zwischen Großbritannien und Deutschland zur See. Nur nach Verlusten gemessen verlief sie günstig für die deutsche Seite, brach aber die britische Seeblockade nicht und blieb ohne Einfluß auf den Gang des Krieges. In der Debatte um den uneingeschränkten U-Boot-Krieg teilte mein Vater die schweren Sorgen seines Vaters gegenüber diesem unsinnigen Projekt, das den weiteren Kriegsverlauf entscheidend gefährdete. Gegen Ende des Krieges kam er als Verbindungsoffizier zum Marinestab bei Hindenburg und Ludendorff ins Große Hauptquartier. Er empfand Hindenburg als einen ruhigen, unkomplizierten Mann, der sich stets gleichblieb, Verantwortung nie auf andere schob und selbst keine politischen Interessen zeigte. Ganz anders Ludendorff, der sich im rastlosen Planen und Entscheiden verzehrte und die Führungskompetenz der Obersten Heeresleitung in allen wesentlichen Fragen der Innen- und Außenpolitik wahrnahm, oft ohne die Tragweite der Maßnahmen durchschauen und kontrollieren zu können. Mein Vater beteiligte sich aktiv, aber einflußlos an Diskussionen um Friedensbemühungen. Den 9. November 1918 erlebte er in Spa.
Von der Dolchstoßlegende hat er nie etwas gehalten. Während meine Mutter seit langem die tiefen sozialen Wurzeln der Revolution gespürt hatte, war es bei ihm die Außenpolitik des Reiches, die ihn mit Sorge erfüllt hatte: der parvenühafte Versuch des jungen Reichs, eine Weltrolle gegen England und ohne kontinentale Sicherung zu usurpieren, der fatale Mangel an klügerer Bescheidung im internationalen Auftreten. Das Grundmotiv seiner Denkweise und seines weiteren Wirkens hatte hier seine Ursprünge. Zu den Waffenstillstands- und Friedensbedingungen der Entente notierte er als seine sofortige erste Reaktion: »Daraus entsteht der nächste Krieg; die Kinder werden ihn ausfechten müssen.« Er sah damit seinen weiteren Lebensweg also voraus.
Frühe Jahre in Basel und Kopenhagen
Doch nun hieß es zuerst, sich inmitten des konfusen neuen Anfangs zurechtzufinden. Noch war die Sorge nicht ausgestanden, ob Deutschland in zwei Teile nach Norden und Süden auseinanderfallen würde. Unruhen waren an der Tagesordnung. Rechtsradikalen Mordanschlägen fielen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zum Opfer, später Matthias Erzberger und Walther Rathenau.
Seiner Neigung gemäß strebte mein Vater in den Auswärtigen Dienst. Die dortigen Offerten waren zunächst unklar und mager, und er hatte eine sechsköpfige Familie zu ernähren. Von dem Berliner Großindustriellen Klingenberg erhielt er ein überaus verlockendes Angebot. Sein Verstand, so schrieb er seinen Eltern, ziehe ihn mehr in die Wirtschaft, aber sein Herz ins Auswärtige Amt, und schließlich folgte er dieser inneren Stimme.
Der erste Auftrag führte ihn in die Ruhe und den Frieden des neutralen Auslands. Er wurde Konsul in Basel. Die Stadt war geprägt von ihrem wirtschaftlich-industriellen Aufschwung, vom traditionellen und gegenwärtigen Rang ihrer Universität mit den Namen Jacob Burckhardt, Friedrich Nietzsche, Karl Barth und Edgar Salin, vor allem aber von ihren Patrizierfamilien Vischer, wiederum Burckhardt, Sarasin und wie sie alle hießen. Der Zugang zu ihnen war schwer. Das Examen war erst bestanden, wenn einer von ihnen über einen Neuankömmling etwa sagte: »Enfin notre genre.«
Trotz zahlreicher Zwischenfälle, die einige der rund fünfundzwanzigtausend Reichsdeutschen verursachten, war mit den Baseler Behörden gut auszukommen. Ein durchweg freundlicher Ton beherrschte ihren Notenwechsel mit dem Konsulat. Als ich 1987 im Zuge eines Staatsbesuchs nach Basel kam, erhielt ich von den Vertretern des Kantons als Geschenk eine fotokopierte Sammlung dieser wohlverwahrten Noten; das hat mein Herz erwärmt.
In Basel begründeten meine Eltern zwei lebenslange Freundschaften. Die eine wurde mit Carl J. Burckhardt geschlossen, dem Neffen von Jacob, mit seiner Richelieu-Biographie selbst ein bedeutender Historiker, ein Schriftsteller hohen Ranges und naher Freund des Dichters Hugo von Hofmannsthal. Von Beruf war er eigentlich Diplomat. Er wurde später Hoher Kommissar des Völkerbundes in Danzig und Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf. Meinen Eltern blieb er in allen Wirrnissen und Krisen persönlich und politisch nahe verbunden. Ich lernte ihn erst nach dem Zweiten Weltkrieg kennen; er war eine skeptische geistige Persönlichkeit von unwiderstehlicher Ausstrahlung.
Die andere besonders nahe menschliche Beziehung entwickelte sich zu Robert und Margret Boehringer, ein Freundschaftsband, das die ganze Familie umschloß. Hier stoße ich auch auf die ersten Spuren meiner eigenen, frühkindlichen Erinnerung. Ich spüre noch meinen vertrauensvollen und gehorsamswilligen Respekt, den ich am 6. Dezember 1923 vor dem gütig richtenden, nie enttarnten Baseler Nikolaus hatte, eben vor Robert Boehringer. Bis in sein hohes und mein mittleres Alter hinein erlebte ich seine ruhige und wohlwollende Strenge. Er war neben meinen Eltern der für mich wichtigste Erwachsene, der mit seinem stets prüfenden Zuspruch prägenden Anteil an meiner Erziehung hatte. Freiberuflich und höchst erfolgreich war er bei der Baseler pharmazeutischen Industrie tätig, lebte vor allem aber als Privatgelehrter. Manchen Fachleuten galt er als der beinahe noch bessere Archäologe im Vergleich zu seinem Bruder Erich, der es immerhin bis zum Präsidenten des Deutschen Archäologischen Instituts gebracht hatte. Er war ein Dichter, ein naher, zuletzt der nächste Freund und Erbe von Stefan George. Als ich elf Jahre alt war, nahm er meine Geschwister und mich in Berlin einmal in eine atelierartige, feierlich hohe Mansardenwohnung mit. Dort setzte er mich neben einen alten Herrn, der seine starke Hand um meinen Nacken legte, so daß ich sie dort noch bis heute zu spüren vermeine. Es war Stefan George, wie ich erst viel später erfuhr.
Mit seiner jüdischen Frau, einer hochbegabten Juristin, wanderte Robert Boehringer, der Schwabe, schon 1932 aus Deutschland in die Schweiz aus, da er das Unheil kommen sah, und ließ sich in Genf nieder, arbeitete beim Internationalen Roten Kreuz und half, wo er konnte. Wie kein anderer stand er meinem Vater in den schweren beruflichen Konflikten der Nazizeit und später beim Nürnberger Gerichtsverfahren zur Seite, als kritischer Freund ebenso wie aus tiefem Vertrauen und Verständnis. Nach dem Krieg sorgte Theodor Heuss als Bundespräsident persönlich dafür, daß Boehringer die deutsche Staatsangehörigkeit ehrenhalber zurückerhielt.
Ende 1924 wurde mein Vater als zweiter Mann an die Gesandtschaft nach Kopenhagen versetzt. Das Hauptproblem für die Dänen waren die deutschen Nachbarn. Die Spannungen wurden aber mit Anstand und zumal bei den beiderseitigen Minderheiten auch mit ziemlichem Erfolg überwunden. Politisch erschien meinem Vater als das Wichtigste, dem für Deutschland so problematischen Ententekreis im Völkerbund einen stillen Verband der Neutralen gegenüberzustellen. Die menschlichen Qualitäten der Dänen taten der ganzen Familie wohl. Ihre Begabung zum Leben findet unter den europäischen Völkern kaum ihresgleichen.
Auf der deutschen Petri-Schule in Kopenhagen lernte ich Lesen und Schreiben. Freilich konnte ich es wohl schon weitgehend von zu Hause her, wie ich überhaupt in meiner Kindheit immer wieder große Ausbildungsvorteile durch die liebevolle und konsequente geistige Förderung in der Familie, vor allem durch meine Mutter empfing. Zwar wurde mir praktisch nie bei den Hausaufgaben geholfen -auch das als Prinzip -, aber meine Wettbewerbsvorteile unter den Sechsjährigen an der Kopenhagener Schule wurden offenkundig, als ich zum Einstand den »Handschuh« von Schiller hersagte. In den späteren pädagogisch-politischen Auseinandersetzungen ist es mir nie schwer geworden, die krassen Probleme der familiär- und milieubedingten Ungleichheit der Chancen zu begreifen.
In Kopenhagen hatte ich einen unbekannten Freund. Jeden Tag ritt ein älterer Herr die Straße entlang, auf der ich gerade spielte. Er machte mir hoch zu Roß einen gewaltigen Eindruck, ich grüßte ihn ehrerbietig, er grüßte mit warmer Geste zurück, je länger, desto vertrauter. Ein Wort wurde nie gesprochen, bis ich eines Tages erfuhr, wer es war: der König von Dänemark, der in der friedlichen Welt jener Zeit jeden Nachmittag ganz allein ausritt.
Ich hatte auch eine Freundin, die ich anbetete. Sie war die jüngste Tochter des damaligen deutschen Missionschefs und Vorgesetzten meines Vaters, Ulrich von Hassell, Schwiegersohn des Admirals von Tirpitz, später ein Mitverschwörer und Opfer der Tyrannei nach dem 20. Juli 1944. Mit ihr, seiner Tochter Fey, genannt Li, die damals wie ich zwischen sechs und sieben Jahre alt war, und mit unseren älteren Geschwistern wurden die schönsten Spiele gespielt, vor allem Scharaden. Li ist eine wunderbare Frau geworden, hat sich in Italien verheiratet und später ein eindrucksvolles persönliches Buch über die schwere Zeit des Widerstandes und ihrer Gestapohaft geschrieben. Ich bin noch immer stolz auf die Huld, die sie mir in unserem ABC-Schützenalter gewährte.
Schon bald wurde mein Vater nach Berlin zurückgerufen, um die Genfer Abrüstungskonferenz vorzubereiten und um kurz darauf die Leitung des Völkerbundreferats im Auswärtigen Amt zu übernehmen, der damals wichtigsten politischen Aufgabe für die deutsche Außenpolitik. Damit begann für ihn eine Dauerreisezeit mit ständigem Ortswechsel zwischen Berlin und Genf. Von der Notwendigkeit des Völkerbundes war er ebenso überzeugt, wie er von der nahezu unlösbaren Aufgabe für die deutschen Delegationen beeindruckt war. Der Generalsekretär der Weltorganisation, Sir Eric Drummond, sagte ihm über die deutsche Stellung: »You are in the league, you are not of the league.« Die europäischen Siegermächte des ersten Weltkrieges beherrschten die Konferenzszene. Fortschritte zu gleichberechtigter Sicherheit und Frieden blieben stecken. Die Hoffnungen, die Deutschland auf die Briten setzte, erfüllten sich selten; das Vereinigte Königreich hielt sich im allgemeinen gerade dort zurück, wo es am dringlichsten gebraucht worden wäre, nämlich zur Mäßigung Frankreichs. Das schlimmste aber war die Abstinenz der isolationistischen Amerikaner.
In der deutschen Delegation arbeitete mein Vater während der Jahre 1927 bis 1932 an Modellen zur Kriegsverhütung und Abrüstung. Er verfaßte Memoranden für eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Die Matadore der großen Genfer Konferenzen waren freilich nicht die Diplomaten, sondern die parlamentarisch verantwortlichen Minister. Das Zusammenspiel der beiden so unterschiedlichen Denkweisen führte immer wieder zu Reibereien.
Stets ist es die Aufgabe der Diplomatie, sorgfältig und öffentlich unbeobachtet die Fäden so lange zu knüpfen, bis ein Ergebnis in greifbare Nähe rückt. Doch immer wieder kommen den Diplomaten gewählte Politiker in die Quere, indem sie unreife Früchte pflücken. Auch die Stars auf der Genfer Bühne suchten ungeduldig nach innenpolitisch verwendbaren Pluspunkten. »Sie dachten in Reden«, wie mein Vater die strukturelle Verwandtschaft zwischen seinem Chef Stresemann und dem französischen Außenminister Briand schilderte, obwohl er die immense Anstrengung Stresemanns, Deutschland aus der internationalen Isolierung herauszuführen, stets hoch respektierte. Damals hat er wohl den immer unerträglicheren Druck unterschätzt, unter dem Stresemann nicht nur generell im Reichstag, sondern vor allem in der eigenen Partei zu leiden hatte und unter dessen Last der kranke Mann allzu früh zusammenbrach.
Außenpolitik ist und bleibt nun einmal innenpolitisch eingebettet und motiviert. Diplomaten mögen noch so oft Anlaß haben, die parlamentarisch-publizistische Tonart zu Hause als eine dilettantische Behinderung ihrer sachverständigen Arbeit zu empfinden. Schlimm für die Diplomatie und für das Ganze ist es, wenn sie den real existierenden und entscheidenden Einfluß der Innenpolitik auf das Äußere unterschätzt. In Genf spielte dieser Mangel eine wohl erkennbare, aber noch keine maßgebliche Rolle. Um so schwerer wog er später, als die Innenpolitik in die Hand der Nationalsozialisten geraten war.
Vater, Mutter und Geschwister; Kindheit und Schuljahre in Berlin; jüdische Mitschüler in Wilmersdorf
Mit dem Umzug aus Kopenhagen nach Berlin im Jahr 1927 begannen für das private Leben und zumal für meine eigene Kindheit sechs prägende, glückerfüllte Jahre in der Familie. Wir wohnten in Berlin-Wilmersdorf, Fasanenstraße Ecke Pariser Straße, ziemlich weit weg vom vornehmen Kurfürstendamm, in der Etagenwohnung eines normalen Berliner Mietshauses. Im Nachbarhaus wohnten unter anderem ein Konzertpianist und der sozialdemokratische Politiker Breitscheid.
Der Vater war viel unterwegs, aber als die hochgeachtete Autorität präsent, sobald er am allgemeinen Familienleben teilnahm. Er war von ausgeprägten ethischen Grundsätzen und warmen Empfindungen geleitet. Doch wie es sich für einen ordentlichen Schwaben gehört, quoll ihm der Mund nicht von Gefühlsäußerungen über. Man konnte an ihm beobachten, was die ganze Familie ein wenig kennzeichnete: Wir müssen offenbar erst innere Barrieren überwinden, bis wir zu glauben bereit sind, daß Gefühle bleiben, was sie sind, sobald wir sie vernehmbar aussprechen. Diese Scheu oder Zurückhaltung mag verständlich sein. Aber sie ist auch eine Schwäche; denn die meisten Menschen wollen doch die Wärme und Anteilnahme spüren und hören, statt sie erraten zu müssen. Gleichviel, mein Vater äußerte sich lieber in Kategorien des Verstandes. Hielt er jemandes Betragen für verwerflich, so nannte er ihn nur dumm. Es war ihm ein Greuel, über sich selbst zu reden. Dagegen offenbarte sich seine verborgene Seele in seinen schon erwähnten Aquarellen.
Familienleben 1929 auf dem Balkon unserer Etagenwohnung in Berlin-Wilmersdorf. Meine Mutter mit ihren vier Kindern (von rechts) Carl Friedrich, Adelheid, Heinrich, Richard.
Er war ein guter Mathematiker. Ihm verdanke ich das Interesse für Geschichte und Geographie. Den engagierten Schiller zog er dem sich immer wieder entrückenden Goethe vor, obwohl er die halbe Iphigenie auswendig hersagen konnte. Gern zitierte er zum Beispiel das Lob des Orestes für seinen Freund Pylades: »Mit seltener Kunst fügst Du der Götter Rat und Deine Wünsche klug in eins zusammen.« Ihn erfreute die sprachliche Schönheit ebenso wie die gelungene Beschreibung der diplomatischen Aufgabe.
Mittelpunkt und Herz der Familie war die Mutter. Sie trug die ganze Last der Arbeit. In ihrer Hand lag die alltägliche Erziehung. Sie begleitete die Entfaltung eines jeden ihrer Kinder mit der tiefen Kraft ihrer Liebe. Ihre immer wache selbstlose Teilnahme am Weg und Schicksal des anderen war ihr zur eigenen Existenz geworden, von willensstarker Selbstbeherrschung geprägt und durch keine nervöse Aufgeregtheit verwirrt. Ein lautes Wort habe ich zeitlebens nicht von ihr gehört. Strenge an den Tag zu legen lag ihr nicht und erübrigte sich auch angesichts ihrer viel wirkungsvolleren und unausweichlicheren Konsequenz, die sie den Kompromissen spürbar vorzog.
Natürlich halfen bei der Durchsetzung lästiger Pflichten auch höchst durchschaubare Euphemismen. Das harte »Müssen« wurde in eine gütige Erlaubnis umgedeutet. Wenn also ich armes Kind als Jüngster Abend für Abend zuerst ins Bett gehen mußte, dann hieß es: »Heute darfst Du einmal den Reigen eröffnen.« Alles, was wir mußten, »durften« wir.
Gemäß den Stärken und Schwächen eines jeden Kindes und dem Altersunterschied von acht Jahren zwischen dem Ältesten und dem Jüngsten förderte die Mutter jeden nach seiner Weise und hielt doch die Familie eng zusammen. Der 1912 geborene Älteste, Carl Friedrich, ging in diesen Berliner Jahren alsbald aufs Abitur zu. An seiner hohen und frühen Begabung hatte es nie einen Zweifel gegeben. Schon als Elfjähriger hatte er astronomische Privatstudien unternommen und der anteilnehmenden Mutter bedeutet: »Wenn Du etwas nicht verstehst, kannst Du mich ruhig fragen.« Nicht nur um seines Altersvorsprungs willen war er eine Klasse für sich, von den Geschwistern neidlos bewundert, von mir freilich auch oft nachhaltig in seinen Kreisen gestört, weil ich legitimerweise das Spielen dem Philosophieren deutlich vorzog. Aber er war und blieb eine maßgebliche geistige Antriebskraft für uns alle.
Zusammen mit meinem acht Jahre älteren Bruder Carl Friedrich im Berliner Johannesstift Anfang der achtziger Jahre. Zwischen uns der Berliner Bischof Martin Kruse.
Meine Schwester Adelheid, vier Jahre älter als ich, hatte den Namen »Vernunftquelle«. Nie habe ich ihre Beteiligung an einem Streit erlebt. Vielmehr tröstete sie jeden, der dessen bedurfte, und half auf stille und unbeobachtete Weise. Aus meiner damaligen Perspektive las freilich auch sie schon zu früh hingebungsvoll Hölderlin, Mörike und dergleichen, statt etwas Lustigeres zu unternehmen. Wenn ich wieder einmal lautstark gegen die lästige Geistigkeit der Älteren aufbegehrte, begütigte sie mich mit einem freundlichen Entgegenkommen und erklärte den anderen, das Haus habe Frieden, wenn es mir gutginge: Wie wahr! Mit ihrer feinen, vom Vater geerbten Zeichen- und Aquarellierkunst fand sie einen Ausdruck ihres Wesens und Empfindens, der sie durch das schwere Leben, das auf sie wartete, immer begleitete und beschützte. Das Aquarellieren wurde ihr zur zweiten Natur. Argumentiert sie im Gespräch, dann geschieht es nicht mit den scharfen Instrumenten des Holzschnittes, sondern mit dem Zauber zarter Wasserfarben, die aus tiefen Quellen entspringen. Eine Wohltat ist ihre Gabe, die Schwächen eines jeden Menschen zu übersehen und dafür seine guten Seiten als die maßgeblichen zu behandeln und zu entfalten, ihn dadurch zu verwandeln.
Der mir im Alter nächste war mein Bruder Heinrich, 1917 geboren. Allen unterschiedlichen Anlagen zum Trotz war er meinem Herzen in der Kindheit am nächsten. Rasch wuchs er heran und wurde ein schmaler Hüne, furchtlos und voller Ideale. Auch wenn er sich bald lieber mit seinen Geschichtshelden befaßte als mit meinen Spielen, teilte er doch stets selbstlos einiges von seiner Zeit mit mir und ließ mich seine überlegenen Kräfte nicht spüren. In der bündischen Jugend fand er unter gleichgesinnten Jungen einen Kreis, dem er sich mit seiner Gabe zur Freundschaft und Treue und mit seinem ritterlichen Wesen voller Hingabe zuwandte. Als später die Überführung der Gruppe in die Hitlerjugend erzwungen werden sollte, löste sie sich auf.
Als Jüngster mußte ich diesem gewichtigen Geschwisterkreis nun hinterherwachsen. Das weltweit verbreitete Gerücht, die Jüngsten hätten es »natürlich« am leichtesten, erfüllte mich stets mit der gebührenden Entrüstung. Ihnen fiele in den Schoß, wofür die Älteren noch kämpfen mußten? Nein, sie durften nur die abgetragenen Sachen der Älteren tragen, und wenn der Vater am Sonntag der Reihe nach fragte, wer sich aus freien Stücken seinem Spaziergang in den Grunewald anschließen wolle, hieß es, beim Jüngsten angelangt, der hätte selbstverständlich mitzugehen.
Meine vier Jahre ältere Schwester Adelheid zu Eulenburg hatte vor dem Krieg nach Ostpreußen geheiratet. Wenige Jahre später verlor sie im Krieg sowohl ihren Mann als auch ihre Heimat. Zu Hause galt sie von Jugend auf als die »Vernunftquelle«, weil sie jedem auf stille Weise half, sich frei zu entfalten. Sie hat einen unbeugsamen Geist und ein fühlendes Herz.
Also mußte man lernen, sich so energisch wie möglich zu behaupten. Die Mittel, die ich dazu ersann, veranlaßten meinen Vater, in mir das größte »Lümple« unter den vieren zu sehen. Ich fürchte in der Tat, die Geschwister hatten dann doch unter meinen ungebetenen Wortmeldungen mehr zu leiden als ich unter der Sorge, mit meinen Wünschen unbemerkt zu bleiben. Am liebsten postierte ich mich an der verkehrsreichsten Stelle der Wohnung, um von dort aus meine Kommentare und Urteilssprüche des Beifalls oder Tadels allseits zu verkünden. Als ich erst sieben Jahre alt war, nannte mich der seherische Carl Friedrich bereits einen werdenden Parlamentsredner. Eine spitzzüngige Freundin meiner Eltern bezeichnete mich gar rundheraus als »Kikeriki« – natürlich ohne dabei an Volksvertreter zu denken.
Nur mit einer Fähigkeit erwarb ich mir ein Monopol in der Familie. Ich war der einzige, der es lernte, anständig berlinerisch zu sprechen. Frühzeitig erzog uns der Älteste dazu, mit den Mitteln der Sprache das Gemeinte möglichst exakt auszudrücken. Das war ein ergiebiges Feld der Beschäftigung, der auch ich mich gern hingab. Einmal wurde beim Mittagessen berichtet, die Frau des Tiefseeforschers Piccard habe ihrem fünften Kind das Leben geschenkt. Dazu fragte ich ganz arglos: »Also hat sie vielleicht fünf Kinder gehabt, die ersten vier umgebracht und dann dem nächsten das Leben geschenkt?«
Im Ernst machte es mir niemand schwer in der Familie. Ich hatte eine glückliche Gabe, mir im Angesicht drohender Niederlagen rechtzeitig ein rettendes Ufer zu suchen und das ganze Haus mit meiner Freude anzustecken, wenn ich eine Beschäftigung gefunden hatte, die mich begeisterte. Wollte ich einen Termin wirklich nicht versäumen, dann entwickelte ich starke Kräfte. Meine Mutter erzählte mir später, ich hätte mich, damals bettlägerig, angesichts eines bevorstehenden Geburtstagsfestes einmal geradezu gesundhypnotisiert. Und die liebevolle Schwester meinte, die Freude am Jüngsten habe die Last mit seiner Erziehung ganz in den Schatten gestellt.
Höhepunkte der Kinderzeit waren die Reisen, die Spiele, die Weihnachtsfeste und die Musik in der Familie. Man reiste zu einem alpinen Bauern nach Hindelang im Allgäu oder Mösern in Tirol, zu einem Fischer nach Spiekeroog oder einem Pfarrer in die Mark Brandenburg. Im Möserner See gab es angeblich Blutegel. Meinen Respekt vor ihnen nutzte mein Vater, um mir sehr früh das Schwimmen beizubringen. Er nahm mich ein paar Meter mit ins Tiefe, dann ließ er mich auf einmal mit dem Zuruf los, ich solle mich vor dem Gewürm ans Ufer in Sicherheit bringen.
Zu Weihnachten durften wir den Eltern keine Geschenke kaufen -wovon auch? Vielmehr schrieb jedes Kind seine Ferienerlebnisse auf. Zu später Stunde am Heiligabend bildete die Familie einen Kreis, ein Kind nach dem anderen setzte sich in die Mitte auf den Boden und verlas sein Opus magnum, seine »Sommerferien«. Dies wurde zur oft anstrengenden und doch erfüllenden Tradition über die Kindheitsjahre hinaus.
Es gab bestimmte Spielsachen, die nur zur Weihnachtszeit erschienen, darunter eine uralte zauberhafte Puppenstube für die Schwester. Der Älteste erhielt ein kleines Theater mit veritablem Vorhang, Kulissen und mit Figuren, die zum großen Teil von künstlerisch begabten Erwachsenen der Familie angefertigt worden waren. Man klebte die bemalte und ausgeschnittene Figur auf Pappe, befestigte sie unten mit einem Holzklotz, so daß sie stand, konnte sie an Drähten bewegen und auf der Bühne herumspringen lassen. Da führten dann zuweilen meine Eltern am Weihnachtsabend ein bekanntes Märchen auf, zum Beispiel den Gestiefelten Kater, aber mit selbstverfaßten Texten, gespickt mit ziemlich unverblümten Charakterisierungen der Kinder und ihrer Unarten, voller erzieherischer, individuell zugeschnittener Pointen. Es war ein unbeschreiblich köstliches und unübertrefflich wirksames Vergnügen.
Die Sonntagnachmittage standen zumeist im Zeichen des Wettbewerbs zwischen Vorlesen und Spielen. Zur Übung, aber auch zur allseitigen Freude lasen wir klassische Dramen mit verteilten Rollen. Wurden dagegen lyrische Sonette von Platen oder Rückert zu Gehör gebracht, dann suchte ich nach Fluchtwegen. Ganz anders die Schillerschen Balladen: Sie erregten das jugendliche Gemüt zutiefst, allen voran die Bürgschaft, und daran hat sich mit dem Älterwerden nie etwas geändert.
Ein weiteres Feld war die Hausmusik. Wiederum war die Mutter die Seele des Unternehmens. Sie musizierte und inspirierte uns alle. Ein Klaviertrio der drei jüngeren Kinder entstand. Leider habe ich aber meine Schwester am Klavier und meinen Bruder Heinrich am Cello durch mangelnden Fortschritt an meiner Geige oft behindert. Meine nie erlahmende Musikliebe war größer als mein allzu rasch nachlassender Fleiß. Es dauert eben Jahre, bis man auf der Violine einen wirklich guten Ton hervorbringt. Dabei hatte ich eine für meine Maßstäbe viel zu gute und zugleich ganz zauberhafte Lehrerin, Beatrice Bentz, eine Schweizerin, die das damals in Berlin renommierteste Damenstreichquartett leitete, das Bentz-Quartett. Oft gab es denkwürdige Quartettabende in der Wohnung. Der äußere Rahmen war bescheiden, aber der Kreis der Zuhörer würdig genug; Werner Heisenberg, Ricarda Huch, Hans J. Moser und Ina Seidel zählten dazu. Später, im Schulorchester, wo es zu viele durchschnittliche Geiger wie mich gab, wurde ich dann noch auf Trompete und Posaune umgeschult. Eine Zeitlang wollte ich sogar Sänger werden. Doch am Ende reichten weder das Talent noch die Lerngeduld, um beim so freudig erhofften Ziel zu landen.
Mit Leidenschaft, mit Ehrgeiz und mit großem Talent beteiligte sich meine Mutter auch an Spielen aller Art. Jahrelang war das chinesische Mah-Jongg-Spiel der Favorit. Ein beliebtes Kartenspiel hieß racing-devil, eine Art Zankpatience, zu mehreren gespielt, bei der es auf Geschwindigkeit ankam. Erst einigen Enkeln gelang es ziemlich spät, die Vorherrschaft der schon hochbetagten, aber nach wie vor siegenden Großmutter zu gefährden. Das populärste Ratespiel war das Vergleichsraten: Eine persönlich oder aus der Geschichte bekannte Gestalt mußte geraten werden, indem man auszusagen hatte, welche Blume, Sportart, Käsesorte, Malerei oder ähnliches ihr vergleichbar wäre.
Beim Schreibspiel bevorzugten wir das Wörterzerlegen. Aus den Buchstaben eines Wortes galt es, andere Wörter zu bilden. Zerlegten wir zum Beispiel das Wort Stresemann, dann gab es einen Punkt für einsilbige Wörter wie Rest, zwei Punkte für zweisilbige wie Messe, Sesam oder Narses, schließlich sechs Punkte für dreisilbige wie Manesse. Zu merkwürdigen Ergebnissen führte das Spiel, wenn sich mehrere Generationen daran beteiligten. Einmal spielte unsere Großmama mit und gewann beim Zerlegen des Wortes Veranda. Warum? Weil sie im Gegensatz zu uns noch ein h zur Verfügung hatte. In ihrer Jugendzeit schrieb man das Wort Verandah.
Schach gehörte auch zum Repertoire. Natürlich war Carl Friedrich der unerreichte Spitzenreiter. Mit seinem um zehn Jahre älteren Lehrer und Freund Werner Heisenberg pflegte er stundenlange Blindpartien im dunklen Schlafzimmer auszufechten.
Später kam das Bridge-Spiel hinzu. Es war und blieb stets Familien-Bridge. Man mußte schon in die Familie hineinheiraten, um mitspielen zu dürfen, natürlich nicht, weil wir so bedeutende Könner gewesen wären, sondern im Grunde, weil alle diese schönen Spiele letzten Endes nicht um ihrer selbst, sondern um der Familie willen gespielt wurden.
In diesen Jahren hatten wir Kinder das durch nichts zu überbietende Glück, uns ganz in der Familie entfalten zu können. War es Familienstolz, der uns zusammenhielt? Andere mochten es zuweilen so verstehen. Es war aber ein Geflecht von abgekürzter Sprache und Anspielung auf gemeinsam Erlebtes, das anderen schwer zu vermitteln war. Freilich sorgten nicht nur die Vertrautheit mit den Gewohnheiten der Eltern und Geschwister und das wechselseitige Vertrauen, sondern auch die Erfahrung dafür, daß es mir in der Familie interessanter vorkam als anderswo, wenn Verstand und Gemüt auf Entdeckungsreisen gingen. Immer wieder bin ich mir im Verlauf der Zeit bewußt geworden, daß das Schicksal mir mit der eigenen Familie einen Vorzug von unschätzbarem Wert geschenkt hatte. Sie war und blieb für mich der entscheidende Rückhalt und Segen im Leben. Zugleich bot sie die Grundlage für den anderen lebensbestimmenden Kreis von Menschen, für die Freunde. In manchen Fällen entstand die Beziehung zu ihnen auf dem Weg über familiäre Kooptation.
Dabei spielte sich alles unter vergleichsweise bescheidenen äußeren Bedingungen ab. Die Wohnung war geräumig genug, aber anspruchslos und ziemlich dunkel. Kaum je drang von der Hof- oder Straßenseite her ein Sonnenstrahl durch die Fenster. Es begann die Zeit der staatlichen Notverordnungen, die sich vor allem im öffentlichen Dienst auswirkten. Butter gab es in der Familie nur zum Sonntagsfrühstück. Als ich mir im Alter von zehn Jahren den Arm brach und eine relativ komplizierte aufwendige Behandlung nötig wurde, brachte dies meine Eltern in die Nähe des Ruins -staatliche Beihilfe sprang nicht ein. Die soziale Not trat einem überall in Berlin entgegen. Täglich kamen die Hofsänger und Leierkastenmänner auf die Hinterhöfe der Mietshäuser und bettelten um Unterstützung und auch um Brot. Meine Mutter nahm mich gelegentlich in den Stadtteil Neukölln mit, wo sie sich als Hilfsvormund um uneheliche Kinder kümmerte.
Durch solche Eindrücke von wachsender Armut und einer Not, die den Anstand, die Gesundheit und das Leben bedrohte, öffneten sich mir die ersten bewußten Blicke über den Horizont der Familie hinweg in die allgemeinen Verhältnisse. Die Folgen der Arbeitslosigkeit ohne materielle Versorgung waren verheerend. Auch für mich im Kindesalter war erkennbar, daß es kein gedeihliches Zusammenleben mehr geben kann, wenn der Abstand zu groß wird zwischen dem, was die einen Menschen brauchen, aber entbehren müssen, und dem, was andere ganz selbstverständlich zur Verfügung haben. So kam es bei mir zu einer Anteilnahme an politischen Problemen primär im sozialen Bereich. Erst später traten die bewußt wahrgenommenen auswärtigen Beziehungen anhand des Diplomatenlebens meines Vaters hinzu. Beides unterscheidet sich nicht so scharf, wie es auf Anhieb scheint. Denn die Voraussetzungen des Zusammenlebens sind sich zumeist gar nicht so unähnlich.
Auf der Berliner Grundschule wurde mir das dritte Schuljahr geschenkt; ich durfte es überspringen. Mit neun Jahren kam ich auf das humanistische Bismarck-Gymnasium in Berlin-Wilmersdorf. Latein und Mathematik lagen mir weniger als Griechisch und Geschichte, Sport und Musik. Aber man lebte auf der Schule in keiner abgeschlossenen Welt. Wir begannen, als Kinder Zeitungen zu lesen und über die Schlagzeilen, die wir aufgeschnappt hatten, in den Unterrichtspausen zu diskutieren. Natürlich übertraf die Neugier bei weitem das Verständnis. Wir registrierten, daß die Arbeitslosenzahl auf sieben Millionen stieg, daß im Herbst 1930 107 Nationalsozialisten und 80 Kommunisten in den Reichstag gewählt wurden. Ich besinne mich deutlich unserer ebenso unreifen wie erregten Debatten über die Zeitläufte.
Den führenden Anteil daran hatten die jüdischen Mitschüler, fast die Hälfte der Klasse. Es waren zumeist Kinder von Ärzten und Anwälten, von Kaufleuten und Wissenschaftlern. In dieser Endphase der Weimarer Republik diskutierten wir nun gemeinsam eifrig über die beinahe täglichen Berliner Straßenkämpfe zwischen rechts und links – wir waren zumeist gegen beide -, über die unablässigen Reichstagswahlen und mit naiver Leidenschaft selbst über neue Kabinettslisten für die Regierungen. Ganz gewiß waren wir unmündig genug, aber eine Ahnung von der wachsenden Brisanz der Zeiten hatten wir durchaus. Dennoch nahm uns dies nicht die kindliche Fröhlichkeit und vor allem auch nicht die gänzliche Unbefangenheit untereinander.
Von dem tradierten, nicht nur in Deutschland weitverbreiteten Antisemitismus ahnte ich als Berliner Schulkind in der späten Weimarer Zeit kaum etwas. Dennoch mußte ich mich später fragen: Was hatte ich trotz dieses engen täglichen Zusammenlebens von jüdischer Religion, Geschichte und Identität schon gewußt oder wenigstens dabei gelernt? Fast nichts. Man spürte, daß es Unterschiede gab. Aber man schloß sich gegenseitig nicht aus. Wir besuchten uns ungezählte Male in den Familien und diskutierten sogar gelegentlich untereinander, ob es ratsam sei, später die Schwester eines Mitschülers aus dem anderen Umfeld zu heiraten. Auch lernte ich natürlich die Namen bedeutender jüdischer Persönlichkeiten kennen, die die Kultur, die Wissenschaft und Wirtschaft in Deutschland und das Ansehen unseres Landes in der ganzen Welt maßgeblich prägten. Als ich Anfang der siebziger Jahre zum ersten Mal das Treppenhaus des Leo-Baeck-Institutes in New York hinaufstieg und dort der Porträtgalerie dieser großen Menschen begegnete, da war der Eindruck für mich nur um so tiefer und erschütternder, als ich die meisten Namen von meiner Kindheit her kannte.
Und dennoch wußte ich allzu wenig von inneren Spannungen und Spaltungen, von Schwierigkeiten jüdischer Selbstbehauptung und von Gefahren einer Selbstaufgabe.
Wer meiner jüdischen Mitschüler war einer Zerreißprobe zwischen dem Leben in der eigenen Familie und Religion und der täglichen Gegenwart in der Schule und ihrer Kultur ausgesetzt? Oder gab es andere, bei denen zu Hause Konflikte mit der Assimilation vorherrschten, jenem so lange als akzeptiert erscheinenden Postulat? Welche bedeutungsschweren Folgen mochte es haben, daß von den sich assimilierenden Juden erwartet wurde, sich den Werten und Zielen, den Gewohnheiten und dem Erscheinungsbild ihrer Umwelt gänzlich anzupassen? Daß, mit anderen Worten, Juden aufhören sollten, Juden zu sein, um dadurch die Probleme ihrer Lage als Minderheit zu lösen? Und war eine Angleichung an eine mehr oder weniger christlich geprägte Welt überhaupt möglich und wurde sie von dieser akzeptiert? Blieben nicht die Juden, selbst in dem liberalen Berlin-Wilmersdorf meiner Kindheit, zwar Freunde, aber doch eben andere? Ja, wirkte denn nicht die Assimilation oft beinahe aufreizender als die Andersartigkeit? Wir kennen die Worte von Theodor Herzl: »Ich versuche einzugehen in die Gesellschaft und nur den Glauben der Väter zu bewahren: Man läßt es nicht zu.« Seine damalige Erfahrung war die Vergeblichkeit der Bereitschaft, ein treuer Patriot zu sein.