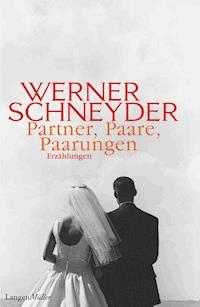9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Einer der letzten großen Kabarettisten: Werner Schneyder Werner Schneyder, der Mann zwischen Buch, Bühne und Medien, war und ist vor allem als Kabarettist und satirischer Essayist durch seine Fähigkeit, Theorie und Analyse in Pointen zu verwandeln, eine erste Marke geworden. Er, der als seinen Hauptberuf einmal scherzhaft "Meinungsträger" angab, berichtet nun, wie seine Meinungen entstanden sind. Vom Erlebnis des ersten Bombenangriffes als Kind über das Kriegsende, die Schulzeit, das Studium, den Journalismus, das Fernsehen bis zum Schritt auf die Bühne. Das fesselnde, unterhaltsame und provozierende Spektrum eines politischen Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
WESTEND
Ebook Edition
WERNER SCHNEYDER
Von einem,der auszog,politischzu werden
WESTEND
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-554-8© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2014Satz: Publikations Atelier, DreieichDruck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, LeckPrinted in Germany
Inhalt
Das Ende des Krieges
Schule, Lehrzeit, Studium
Das Kabarett-Duo
Talk täglich
Lametta & Co.
Wie abgerissen
Keine Fragen mehr
Ende der Spielzeit (1)
Dieter Hildebrandt
Ende der Spielzeit (2)
Die Soloprogramme (1)
Solo mit Quartett
Satz für Satz
Die DDR, das Duo-Gastspiel
Zwischentöne
Die Solo-Programme (2)
Doppelt besetzt
Schon wieder nüchtern
Bruno Kreisky
Absage
Jörg Haider
Abschiedsabend
Der Bodensatz
Politik und Kabarett
Sozialdemokratie
Wiedervereinigung
Krieg
Das Comeback
Ich bin konservativ
Personenregister
Das Ende des Krieges
Satire ist artistische Kritik.
Diese Kritik gespielt, ist Kabarett.
Es war einmal ein Zweiter Weltkrieg. Ich erwähne es, weil man nicht sicher sein kann, ob jüngere Menschen das noch hinreichend oder überhaupt wissen. Da saß ein etwa Fünfjähriger in der Nähe seiner Eltern, unweit eines Radios, oder, wie man damals zu sagen gehabt hätte, Rundfunkgeräts. In einer sehr nationalen Ausführung hießen diese Geräte auch »Volksempfänger«. Den hatten wir nicht. Unser Radio war noch Vorkriegsqualität und hieß »Minerva«. Das habe ich mir gut gemerkt, weil mein Vater noch nach dem Kriegsende, also als es schon ordentliche Radios zu kaufen gab, erklärte, eines mit so einem guten Klang würde man heutzutage gar nicht mehr produzieren.
Ich schweife ab. Das Volk, so auch meine Eltern und ich, empfingen an diesem Nachmittag Nachrichten. Da war von der V2 die Rede. Meine Mutter äußerte die Hoffnung, diese Waffe könnte dem Kriegsverlauf noch eine Wendung geben. Beide Eltern zweifelten. Wahrscheinlich, weil die der V2 logischerweise vorangegangene V1 die Feinde Großdeutschlands (das war ein Zusammenschluss, ein gemeinsames Reich von Deutschland und Österreich, das in dieser Verbindung Ostmark hieß) auch nicht zur Aufgabe hatte zwingen können. Ob ich damals schon wusste, dass das V für Vergeltungswaffe stand, kann ich nicht beschwören, glaube aber eher ja. Ich war ein sehr informiertes Kind. Ich hatte mir von der Mutter sagen lassen, ein General Paulus hätte unser Hitlerdeutschland an die Russen »verraten«, als er vor, in oder rund um Stalingrad eine entscheidende Schlacht verloren gab. Auch war mir das Versagen des Generals (oder Admirals?) Rommel im Afrikakrieg nicht verborgen geblieben.
Ich hatte für meine Beteiligung am Endsieg die handliche Panzerfaust in Betracht gezogen. Ich wusste nicht genau, wie die aussah, aber mir war klar, dass ich sie tragen und wehrlose Panzer abknallen konnte. Der Krieg und das Darübergerede hatten das gesamte Potenzial eines Buben, Indianer zu spielen, parallel verschoben. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinen Tagträumereien Familien und vor allem deren Töchter aus brennenden Häusern gerettet habe. Ganz naiv war ich nicht mehr. Denn ungefähr ein Jahr davor war ich eines Morgens durch schrilles Weibergekreisch geweckt worden. Dieses hielt einen ganzen Tag lang an. Es waren die Großmutter und die Mutter, die um Sohn und Bruder trauerten. Ein Vordruck hatte sie informiert, dass mein Onkel im Kampfe für das Vaterland den »Heldentod« gestorben war. Ich hatte ihn gekannt, weil ich ihn einmal im heimatlichen Lazarett besuchen konnte, wo er wegen schwerer Erfrierungen an den Füßen lag, bevor er dann wieder an die Front geholt wurde.
Ich muss noch einfügen, dass die Mutter erzählte, er wäre beinahe vor das Kriegsgericht gekommen und erschossen worden, weil er wegen der Erfrierungen eine Wache verlassen hatte. Sie war sogar mit dem Zug von Klagenfurt nach Berlin gefahren und hatte irgendeine Stelle gefunden, die zur Kenntnis nahm, dass mit ihrem Bruder nicht so zu verfahren war. Das klingt unglaubwürdig, war aber so. Wer meine Mutter sehr gut kannte, konnte es auch glauben.
Ein anderes Ereignis, das im Unterbewusstsein meinen vaterländischen Heroismus ganz sicher irritierte, war der erste Bombenabwurf über Klagenfurt, der Stadt meiner Kindheit und Jugend. Meine fünfeinhalb Jahre ältere Schwester hatte mich in das Kino, also in die Lichtspiele mitgenommen. Kurz nach Beginn eines Kulturfilms – ich meine, es war später Vormittag – gab es Fliegeralarm. Man musste aus dem Kino raus. Nichts wie nach Hause, so rasch wie möglich. Während wir dahinhasteten, stießen wir auf einen Mann mit Armbinde, der uns in den nächsten Luftschutzkeller der Polizei einwies. Meine Schwester tat, als würde sie gehorchen, nahm mich aber dann an der Hand und zog mich weiter. Als es dann krachte, flohen wir in den Luftschutzkeller der Ursulinen. Die spätere Information, alle Insassen des ersten verschmähten Luftschutzkellers hätten nicht überlebt, muss mir zu denken gegeben haben. Sicherlich nicht zu genau. Denn es zählt zu den lebenslänglichen Infantilismen der Spezies Mensch, dass die Dramaturgie des Wildwestfilms, nach der die Guten von den Bösen nie oder jedenfalls nie folgenreich getroffen werden, ohne Kotzen hingenommen wird.
Ich habe noch so Bilder im Kopf, eine nach Ende des Bombardements heimeilende Schwester, da und dort ein rauchendes Haus und einen kleinen, sich über so viel Abenteuerliches beinahe freuenden Bruder.
Wir wurden von in Tränen aufgelöster Mutter und Großmutter empfangen. Sehr bald war das Hauptgesprächsthema deren ausgestandene Angst.
Diese Angst sollte bald nicht mehr nötig sein. In zwei Tagen packten Mutter, Großmutter und Hausgehilfin unsere Sachen. In alte Koffer und Pappschachteln. In Duppau, nahe Karlsbad – heute Karlovy Vary –, gab es die Schwester der Großmutter. Auch deren Mann, einen Militär i.R. Mag sein, ein Oberst. Die waren bereit, uns aufzunehmen. Dort gab es keine Bomben, folglich keinen Krieg. Die Sudetendeutschen, so hießen sie, waren sich sicher, ihnen könne nichts passieren. Das machte sie stolz. Uns – gleichsam Heimatvertriebenen – gegenüber.
Bevor ich erzähle, welche Prägungen ich durch die Begegnung mit dem Sudetendeutschland erfuhr, habe ich das Gefühl, eine Frage beantworten zu müssen: Waren die Eltern des Buben Werner Schneyder Nazis? Meine Mutter nicht, mein Vater nach Bedarf.
Wenn ich sage, meine Mutter nicht, mag das nach den vorhergegangenen Informationen verwundern. Aber es stimmt. Keineswegs aus politischen oder ethischen Motiven, sondern aus Hass auf Uniformen. Dieser Hass wiederum gründete sich nicht auf der politischen Bedeutung der Uniform, sondern auf der Tatsache, dass sie Symbol der Männlichkeit, des Mannestums, war. Das machte die Nazis in den Augen meiner Mutter verächtlich. Sie hatte wohl einen Mann, meinen Vater, aber sie »liebte« ihn in der Weise, in der man Besitz liebt und fanatisch verteidigt und dies aus einem einzigen Grund: Besitz. Männer, im Sinne der Nazis begriffen, hasste sie.
Nun, so ein Mann war mein Vater nicht. Er besaß eine Uniform, denn er war beim NSKK. Wofür NS steht, wissen die Lesenden, das erste K steht für Kraftfahr – das zweite kann ich nicht sicher erklären. Vielleicht bedeutete es Kompagnie oder Kraftfahrkorps. Kurz: Mein Vater, wegen eines Meniskusschadens nicht sonderlich tauglich, war in der Kaserne des Hinterlandes für Lkw zuständig.
Ging das Gespräch um Gesinnungstreue, verwies mein Vater mit Stolz auf diese Mitgliedschaft und die dazugehörende Uniform, ging das Gespräch – in der Nähe des Kriegsendes immer häufiger – in die Kritik am Nationalsozialismus über, verwies mein Vater stolz auf seine vorsätzlich unpolitische Tätigkeit und seine schon immer bestehende Antihaltung. Ich schicke voraus: Das war ein Leben lang die Haltung eines unemanzipierten, also keiner Haltung außer einem kontrollierten Opportunismus fähigen Mannes. Drehte sich das Gespräch in einer Erwachsenenrunde von Antisemiten um das Fehlverhalten der Juden, um deren Selbstverschuldung ihres Schicksals bis zur rassistischen Totaldiskriminierung, nickte mein Vater gedankenvoll bejahend. Kamen die Naziverbrechen zur Sprache, konnte er sich flammend darüber empören, was man diesem so bedeutenden Volk der Juden Unverzeihliches angetan hatte.
Um die Sache abzurunden: Es lag nach dem Krieg in der Wohnung ein Bildband Oh Buchenwald herum. Ich konnte darin lesen. Es gab auch lobende Worte für Bücher oder Filme, die mit der Vergangenheit abrechneten. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass je der Einwand »tendenziös« gefehlt hätte. Subkutan war er allzeit da. Es schmerzt eigentlich immer wieder, wenn man dieses Paradoxon zur Kenntnis nehmen muss: Man ist erlebter Charakterlosigkeit auch bei den sogenannten Nächsten dankbar. Sie haben einen das Sehen und Begreifen gelehrt. Später aber doch wurde mir klar, wie politisches Fehlverhalten auf sexuellem Chaos beruhen kann.
Noch einmal: Meine Mutter hasste nicht die Nazis, sondern den Mann im Nazi. Die Überlegenheit der weißen Rasse und die rassische Fragwürdigkeit der Slawen, ganz abgesehen von der »Degeneration« der Franzosen, waren aber Teil ihrer Bildung.
Wenn ich mich jetzt an eine Episode erinnere, vermute ich, Enkel könnten es schwer haben, sie zu glauben. Dennoch, sie stimmt. Eines Tages war meinen Eltern ein Buch in die Hände gekommen, in dem die Rassen beschrieben und bewertet waren. Zeichnungen der Schädelformen mit Zentimeterangaben sollten da eine nützliche Stütze sein. So setzten also Vater und Mutter den etwa fünfjährigen Sohn vor den großen Spiegel und vermaßen mit dem Messband aus dem Nähkästchen dessen Kopf. Breite, Höhe, Ohrengröße, Augenstellung, Kurvenverlauf.
Die Untersuchung ergab: Mein Schädel war zum Glück überwiegend, zum Bedauern aber nicht ganz ideal, der dinarischen Rasse zuzuordnen. Es muss wohl, denke ich mir heute, etwas Hinterkopf gefehlt haben.
Meinen Eltern war aber in zyklischen Abständen auch das Deutschtum der jeweiligen Vorfahren ein Thema. Hatte sich mein Vater gegen das Faktum zu verteidigen, dass seine Mutter eine geborene Maly war, also fraglos tschechenstämmig, musste meine Mutter immer versichern, der Name eines Urururahnen Blumauer, hätte nichts zu besagen. Es ist vorstellbar, dass diese Spielarten des Irrsinns für jüngere Leser nicht mehr fassbar sind. Ich meine, deshalb muss ich sie notieren.
Also Duppau, etwa ein Jahr bei den Verwandten. Die Bilder, die ich noch habe, sind nicht sehr präzise. Aber ich meine, das Sudetendeutschtum nicht falsch zu beurteilen, wenn ich sage, sie hielten sich für was Besseres. Nicht nur den Tschechen gegenüber, die es in dieser sehr heilen Spießerwelt so gut wie nicht gab. Nicht geben durfte. Die nicht einmal Gesprächsgegenstand waren. Sie waren zu verachtet, um überhaupt in gesellschaftliche Überlegungen einbezogen zu werden. Eine Mesalliance in dieser Richtung hatte den Stellenwert einer Kinderschändung.
Es flossen Mich, Honig und dunkles Bier. »Unser Führer« war keine wichtige Figur. Es war eine sich selbst genügende, an nichts zweifelnde Welt. Hier erfuhr ich, woher die Großmutter und die Mutter den meist verwendeten Satz ihres Lebens hatten: »Was werden die Leute sagen?« Das war das Wichtigste, das Entscheidende.
Um nicht unangenehm aufzufallen, besuchten wir sogar einmal die Sonntagsmesse.
Der Ort war richtig schön. Das muss gesagt werden, weil es ihn nicht mehr gibt. Gleich nach Kriegsende erfuhr meine Mutter brieflich, er sei für Manöverzwecke der tschechoslowakischen Armee völlig platt gewalzt worden. Ein Großteil der Verwandten wurde liquidiert, Großonkel und Großtante konnten sich auf Pferdewagen in die spätere DDR retten. Der Schuldirektor des Gymnasiums, in dem meine Schwester wohl schon die zweite Stufe erreicht haben dürfte, sei lebend eingemauert worden, wurde auch erzählt.
Die Frage, wie dieser Hass entstehen konnte, hat mich lange beschäftigt. Sie beantwortet sich am ehesten durch eine Episode, die meine Mutter – wohl versehentlich – einmal von sich gab. Sie hatte in der Bürgerschule, so hieß die den vier Klassen Volksschule folgende, den Freigegenstand Tschechisch belegen wollen, weil sie in kindlicher Naivität gemeint hatte, das wäre zur Verständigung zweckmäßig. Als ihr Vater das erfuhr, ohrfeigte er sie.
Ich weiß noch genau, dass in diesem Sudeten-Winter der Schnee sehr hoch lag und ich – allein herumstreunend – hinter hohen Schneemauern den Sichtschutz erkannte, der es mir ermöglichte, mit meiner geträumten Panzerfaust die russischen Panzer zum Stehen zu bringen.
Ein Kind erlebt Geschichte praktisch. Der Vater meldete sich aus Klagenfurt mit der Aufforderung, sofort nach Hause zurückzukehren, die Front käme unserer Bleibe immer näher. Die Verwandten erklärten meinen Vater für verrückt. Bis er gezwungen war, uns mit Gewalt zu holen. Wie die Sache für die Ansässigen ausgegangen ist, habe ich schon erwähnt.
Noch war des Fliehens kein Ende. Wegen der Gefahr der neuerlichen Bombardierung der Stadt Klagenfurt wurden die Schulen evakuiert. So auch das von meiner Schwester besuchte Mädchenrealgymnasium. Ort der Verlagerung war ein Paradies, der Badekurort Millstatt am See. Der Schulunterricht wurde in zur Zeit sinnlosen Hotels und Pensionen abgehalten, die Schülerinnen und Schüler in Heime gesteckt. Das war nach Ansicht meiner Mutter für ihr weibliches Kind zu gefährlich. Daher musste die Familie unter abermaliger Zurücklassung des Vaters übersiedeln. Wir fanden ein Quartier über der Hauptstraße. Was nicht unwichtig ist, denn dort spielten sich die für den Verstand eines Sieben- oder Achtjährigen entscheidenden Dinge ab.
Zunächst war generell der Eindruck der Verlassenheit da. Denn die paar Menschen, die noch Zeit und Lust hatten, das große Strandbad zu nützen, machten nur dessen Sinnlosigkeit sichtbar. Ähnliches galt für den Bootsverleih. Und die Terrassen und Gastgärten. Noch war Krieg.
Wir waren arm. Ich konnte das nicht als Nachteil empfinden. Denn die Nahrungsbeschaffung, z.B. Angeln oder mit der Schwester Löwenzahnsalat ausstechen, machte großen Spaß. Im Herbst 1944 begann für mich die 3. Klasse der Volksschule, in der noch mit hellem »Heil Hitler!« gegrüßt wurde.
Zwischenbemerkung: Es wird mir bis zu meinem Ableben unerklärbar sein, wie man ein Volk, also so gut wie alle, dazu bringen kann, so einen Gruß zu akzeptieren und zu verwenden. War das Fehlen des Widerstandes durch die Zweisilbigkeit und den guten Klang dieses Namens verschuldet? Was hätte man gemacht, wäre der Führer doch »Schicklgruber« gewesen? Diese Gefahr bestand ja, wenn man den Biografien glauben darf. Diese Schande ist unauslöschlich.
Noch wurde das Vaterland verteidigt. Ein Mitschüler zeigte einen handbeschriebenen Zettel mit einem mächtigen Stempel her und behauptete, vom Gauleiter mit der Verteidigung Millstatts betraut worden zu sein. Ich neidete ihm den Zettel und wollte auch so eine wichtige Aufgabe haben.
Im Frühjahr 1945 wurde die Schule geschlossen. Meine Mutter sagte zu mir, ich solle mir langsam wieder angewöhnen »Grüß Gott!« zu sagen. Der Erste, den ich mit »Grüß Gott!« grüßte, war ein den Endsieg nicht anzweifelnder Obernazi. Er wurde bei meiner Mutter vorstellig.
Schule und Hotels wurden Lazarette. Gegenüber von unserem Quartier war ein Hotel namens »Lindenhof«. Aus dem kamen gellende Hilfeschreie. Unaufhörlich. Unerträglich. Tag und Nacht. »Sani! Sani!« Ein Bauchsteckschuss, erklärte mir ein Mann. Aber es gäbe keine Narkosemittel.
Immer wieder einmal rannten wir bei Fliegeralarm in den Luftschutzkeller im Kloster. Ich hatte keine Angst. Einmal erzählte mir einer, in der Schule läge ein erschossener Deserteur. Den könne man sich ansehen. Ich ging in Richtung Schule und drehte auf halber Strecke um. Ich wollte ihn nicht sehen.
Ein anderes Mal, ich hatte mit der selbstgefertigten Angel gerade einen kleinen Barsch gefangen, tauchte hinter mir ein Soldat in abgerissener Uniform auf. Ob ich ihm den Barsch schenken würde. Er hätte so einen wahnsinnigen Hunger. Später erzählte ich, er hätte ihn roh gegessen. Das war natürlich gelogen. Aber ich wollte beweisen, wie elend es ihm gegangen war.
Dann kamen die Flüchtlingstrecks. Stundenlang starrte ich aus dem Fenster auf die Hauptstraße, weil ich dachte, irgendwann einmal müsste diese Karawane doch zu Ende sein. Pferdewagen, Menschen mit leeren Gesichtern, schlafende Kinder, Kisten, Hausrat, Decken. Irgendwoher aus dem Osten kämen die alle, wurde mir gesagt. Der Anblick der Flüchtlinge pflanzte sich wie die Schreie der Verwundeten in die Seele, oder wo auch immer, eines Buben ein. Und mit ihnen die nicht mehr beantwortbare Frage nach dem Sinn eines Krieges. Aber die Bewusstseinsspaltung war noch wirksam. Immerhin war ich ein groß gewachsener, blonder, deutscher Junge. Einmal empfand ich das noch. Als es hieß, die Hitlerjungen und die Pimpfe (das waren deren Nachwuchs) und überhaupt alle Jugendlichen sollten in den Klosterhof kommen. Der Führer sei im heldenhaften Kampf um Berlin gefallen.
Da kam ich nun drauf, dass viele der mir bekannten Buben Pimpfenuniformen hatten und Seitengewehre. Ich hatte nicht einmal eine Anstecknadel mit Hakenkreuz. Die wurde mir noch besorgt, damit ich mich an Ort und Stelle nicht schämen musste. Der Redner erklärte uns das Heldenhafte am Tod des Führers und versicherte, ein Admiral Dönitz würde im Sinne des Führers den Endsieg herbeiführen. Danach hatten wir das Deutschlandlied zu singen. Das konnte ich. Ich reagierte auch auf die Aufforderung, es mit ausgestrecktem Arm zu singen. Nicht begriff ich aber, warum ein mir gegenüber stehender Mann während des Gesanges ununterbrochen gestisch bedeutete, dass ich etwas falsch machte. Ich war verlegen, weil ich nicht begriff, was. Im Nachhinein wurde ich belehrt. Ich hatte den falschen Arm ausgestreckt.
Der Krieg sei aus, wurde mir gesagt. Es sei Frieden. Die Engländer würden kommen und uns »besetzen«. Da wurde ich Augenzeuge einer Aktion, von der ich heute weiß, sie hat mich geprägt wie Weniges. Die Großmutter trennte die Hakenkreuzfahne auf und nähte sie zur rotweiß-roten österreichischen zusammen. Durch die geschossene Farbe und die nicht geschossene, wo das Weiß und Schwarz, also die Fläche des Hakenkreuzes, das Rot abgedeckt hatten, war das ehemalige Rund des Hakenkreuzes noch wahrnehmbar. Ich nahm die neue Fahne, hielt sie aus dem Fenster und wackelte wie verrückt. »Die können es wohl nicht mehr erwarten«, soll eine Nachbarin angemerkt haben.
Dann waren die Engländer da. Hinter dem alten Holzbad war deren tägliche Essensausgabe. Ich sah, wie die Soldaten vom gekochten Rindfleisch immer den Fettrand wegschnitten und in den See warfen. Ich ging nach Hause, holte mir eine große Schüssel und bedeutete den Soldaten, ich hätte an diesen Fetträndern großes Interesse. Das begriffen die und gaben mir reichlich. Auch ein paar trockene alte Weißbrotscheiben. Ich wurde von der Großmutter sehr gelobt.
Großen Unterhaltungswert hatte für mich dann noch die Sorge des Vaters, ob die Entnazifizierung folgenlos zu erledigen sei, seine Einschätzung des zuständigen englischen und natürlich jüdischen Offiziers. Da der keine Schwierigkeiten machte, war er ein »feiner Mann«.
Mit genau neuneinhalb Jahren trat der Schüler Schneyder – wieder in Klagenfurt – in das Realgymnasium ein. So früh, weil er von einer halben ersten Klasse in Klagenfurt in die zweite Hälfte der zweiten Klasse in Duppau gehievt worden war. Ich war ein sehr nervöses Kind, auf österreichisch: ziemlich spinnert – nach meinen heutigen Kriterien »nicht ganz dicht«. Was mich aber angesichts meiner ersten weltpolitischen Teilhabe nicht wundert.
Ich ahnte damals: Diese sich selbst so gerne »bürgerlich« nennende Gesellschaft ist eine sehr anzuzweifelnde. Da stehen Fassade und Realität in – für ein Kind mit Beobachtungsgabe – geradezu groteskem Widerspruch. Das ist der Grund, warum ich Jahrzehnte danach die Frage: »Wie wird man Satiriker?« immer mit »In der Familie« beantwortet habe.
Ich wusste damals: Krieg ist Scheiße, Waffen sind Scheiße, Nazis sind Scheiße.
Ich wusste nicht, dass ich es wusste. Aber ich wusste es.
Schule, Lehrzeit, Studium
Da sich dieses Wissen im Laufe der acht Jahre am Realgymnasium immer häufiger artikulierte, stand sehr bald fest: Ich war ein »Linker«.
Im Rahmen der trostlosen Vermittlung des überwiegend unsinnigen Lehrstoffes gab es drei Punkte, die für meine politische Entwicklung von Bedeutung waren. Der erste ist nichts als eine kleine Anekdote, aber von außerordentlicher Sprengkraft. Wir hatten einen Professor in Geschichte und Geografie, der einen gewissen Hang zum Zynismus gegenüber Autoritäten durchschimmern ließ. Er verhöhnte zum Beispiel die Hervorbringungen der lokalen Presse und forderte uns auf, die Süddeutsche Zeitung zu lesen, wenn wir über Österreich etwas Sinnvolles erfahren wollten. Gleichzeitig ermahnte er uns, keinesfalls weiterzuerzählen, was er da eben gesagt hatte.
Es könnte in der 3. Klasse gewesen sein, als er lustlos von den Kriegen zwischen Persern und Griechen vortrug. Als er zu einer sehr bedeutenden Schlacht kam, sagte er: »Laut Geschichtsbuch sind in dieser Schlacht soundso viele Perser und soundso viele Griechen gefallen.« (Anm.: Er nannte natürlich die Schlacht beim Namen und die Zahl der Opfer.) Dann aber bemerkte er nach einer kleinen Pause: »Meiner Meinung nach haben so viele gar nicht gekämpft.« Dieser Satz drang in mich ein wie ein feuriges Schwert. Zum ersten Mal erfuhr ich, was mein Leben mitprägen sollte: Man muss es nicht glauben! Die Geschichtsschreibung hatte ihre Autorität verloren, war verdächtig, angreif- und auslachbar geworden. Welch eine Befreiung! Bei einer Jahre späteren Zufallsbegegnung in der Stadt meiner Jugend sah ich den längst pensionierten Mann. Ich schoss auf ihn zu und sagte: »Herr Professor, Sie ahnen nicht, was ich Ihnen verdanke.« Er ließ es sich erklären und blieb sichtlich geschmeichelt zurück.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!