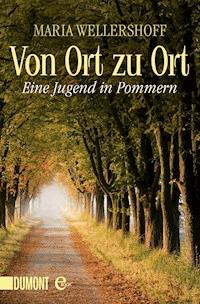
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Pommern, das ›Land am Meer‹, gibt es seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dort wuchs Maria Wellershoff als Maria von Thadden auf, auf den Landgütern Trieglaff und Vahnerow, die seit Generationen der Familie von Thadden gehörten. Mit leichter Hand und einer wundervoll eindringlichen Sprache bringt die Autorin uns ihre Kindheit und Jugend nahe. Maria Wellershoff erzählt von den Dörfern und Gutshäusern, von Eltern, Geschwistern, Verwandten und Freunden, von den Tieren, von Festen und Jagden, von der pommerschen Landschaft und den Ferien an der Ostsee. Eine große Rolle spielen dabei auch Naziherrschaft und Krieg. So beschreibt sie, wie Elisabeth, ihre Halbschwester, 1944 von den Nazis hingerichtet wird. Zu diesem Zeitpunkt studiert Maria bereits Kunstgeschichte in Prag. Kurz vor Kriegsende kehrt sie ins ›Reich‹ zurück. Zusammen mit ihrem Bruder Ado wird sie von den Amerikanern gefangen genommen und gelangt auf abenteuerlichen Wegen nach Göttingen, wo sie endlich ihr Studium fortsetzen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Maria Wellershoff
Von Ort zu Ort
Stationen einer Jugend
Die abgebildeten Fotos sind aus dem Privatbesitz der Autorin.
Der Rechteinhaber der Karte »Das Land der Familie von
Thadden« konnte trotz Bemühen von Seiten des Verlages
leider nicht ermittelt werden.
eBook 2010
© 2010 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Zero, München
Vorsatzkarte: Ernst R. Döring, Verlagshaus Würzburg
Satz: Angelika Kudella, Köln
ISBN eBook: 978-3-8321-8503-9
ISBN App: 978-3-8321-8522-0
www.dumont-buchverlag.de
VORWORT
»Was eure Generation erlebt hat – da können wir nur staunen«, sagte einmal eine jüngere, nach dem Zweiten Weltkrieg geborene Freundin zu mir. Es könne gar nicht genug persönliche Aufzeichnungen geben, ergänzend zu den Publikationen der Historiker, meinte sie. Das ermutigte mich, meine Erinnerungen aufzuschreiben und dem großen Mosaik der deutschen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einige Steine hinzuzufügen.
Aufgewachsen in einem protestantischen, deutsch-nationalen Elternhaus, wurden wir sechs Geschwister nach dem frühen Tod unseres Vaters (1932) erzogen und geprägt von einer liberalen, politisch hellsichtigen und sehr mutigen Mutter, die den Nationalsozialismus von Anfang an ablehnte und uns lehrte, hinzusehen statt wegzuschauen.
Die politisch und wirtschaftlich schwierigen Zwanzigerjahre habe ich als Kind auf einem pommerschen Gut verbracht, in den Dreißigerjahren als Gymnasiastin und Internatsschülerin die allmähliche Politisierung des Alltags erfahren, als Studentin den Krieg und das katastrophale Ende erlebt und den endgültigen Verlust der ostdeutschen Heimat begreifen müssen.
Die wichtigste Quelle für meine ganz persönliche Geschichte in der Weltgeschichte sind Briefe, die ich an Irmgard Meyer, genannt Inga, ab 1931/32 geschrieben habe. Sie war Freundin und Vertraute unserer Familie, und kurz vor ihrem Tod 1995 hat sie mir alle Briefe und Postkarten, in einem Ordner gesammelt, zurückgeschickt. Ohne sie hätte ich dieses Buch nicht schreiben können. In zwei kleine Taschenkalender habe ich von Januar 1944 bis Ende September 1945 Kurzinformationen – ohne kritische Kommentare – notiert, die die Chronologie von wichtigen Stationen und Ereignissen sichern. Die Eintragungen aus den Sommermonaten 1945 in Göttingen sind leider mit Bleistift geschrieben und zum größten Teil kaum noch lesbar. Meine Erinnerungen habe ich in Geschichts- und Fachbüchern überprüft; einige Titel sind im Text zitiert. Nach der Ermordung unseres Bruders Gerhard am 2.Oktober 1945 im Wald bei Hannoversch-Münden und dem allmählichen Begreifen, dass die pommersche Heimat endgültig verloren war, habe ich nichts mehr notiert, nie wieder einen Taschenkalender besessen.
Mit meiner Immatrikulation an der Göttinger Universität Anfang September 1945 endet dieser Bericht. Mit der Fortsetzung des über ein Jahr unterbrochenen Studiums fing ein neuer Lebensabschnitt im Frieden an.
Im Anhang habe ich drei Briefe unserer Mutter abgedruckt; vermutlich die beiden letzten, die sie im Februar 1945 kurz vor dem Einmarsch der Sowjetarmee geschrieben hat, und einen vom 3.Juni 1945, in dem sie das Elend des Lebens unter russischer Besatzung schildert und hofft, durch ihr und unserer Schwester Barbaras Ausharren die Heimat für ihre Kinder retten zu können: »Es scheint zu gelingen.« Es konnte nicht gelingen, denn die Alliierten hatten über das Schicksal Ostdeutschlands und der Deutschen längst anders entschieden. Im März 1946 wurden Mutter und Tochter ausgewiesen.
Ein Personenverzeichnis über drei Generationen und eine Ahnentafel können dem Leser hoffentlich helfen, sich in den schwierigen Verwandtschaftsverhältnissen zurechtzufinden. Was die Namen betrifft, so habe ich für meine Geschwister die Rufnamen gewählt, Abkürzungen der Taufnamen.
Meine Aufzeichnungen sollen nicht nur ein kleiner persönlicher Beitrag sein, in dem ich mich bemüht habe, das eigene Schicksal mit der Zeit- und Kriegsgeschichte zu vernetzen, sondern sie sind auch eine Liebeserklärung an die verlorene pommersche Heimat, an Trieglaff und Vahnerow.
Ich danke allen, Verwandten und Freunden, die mich während meiner Arbeit durch kritische Lektüre, Ergänzungen und Richtigstellungen unterstützt und zum Weiterschreiben ermutigt haben. Besonders danke ich Dr. Theda Krohm-Linke für ihre einfühlsame und verständnisvolle Hilfe bei der letzten Überarbeitung dieses Buches.
Köln, August 2009Maria Wellershoff
TRIEGLAFF
Das Dorf
Auf der Luftaufnahme von Trieglaff ist gut zu erkennen, dass das Dorf eigentlich aus zwei Dörfern besteht: dem um einen Teich angelegten typisch slawischen Runddorf mit großen Bauernhöfen (im mitteldeutsch-fränkischen Stil), deren Gebäude um einen geschlossenen Hof gruppiert sind, und dem Straßendorf, das zum Gutshof, zum »Rittergut«, gehört. Die selbstständigen, recht wohlhabenden Bauern hatten mit dem Gutsbetrieb nichts zu tun. Im Bauerndorf lagen die kleine alt-lutherische Kirche und das zugehörige Pfarrhaus. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Bauernhof betreten zu haben, als wir in Trieglaff wohnten.
Außerhalb des Dorfes, auf dem Luftbild nicht zu sehen, erhebt sich in einer Koppel, die einem Bauern gehörte, ein kleiner Hügel, auf dem einmal eine Ritterburg gestanden hat, eine »Raubritterburg«, wie wir Kinder glaubten, weil das aufregender klang. Jedenfalls hieß der Hügel »der Schlossberg«. Flur- und Ortsnamen haben immer einen historischen Hintergrund. Die Burg soll erst im Dreißigjährigen Krieg von schwedischen oder kaiserlichen Truppen zerstört worden sein. Das Schlafliedchen mit dem traurigen Vers »Pommerland ist abgebrannt« stammt aus dem Dreißigjährigen Krieg. Irgendwann soll ein Fuchs aus seinem Bau einen silbernen Löffel und eine Münze herausgescharrt haben. Archäologische Grabungen hätten vielleicht zur Klärung der Vergangenheit des »Schlossbergs« beitragen können. Daran war jedoch niemand interessiert.
Ungefähr in der Mitte des Dorfes befand sich ein Kaufladen, ein »Kramladen«. Der Kaufmann betrieb auch die zum selben Haus gehörende Gaststätte mit einem großen Festsaal. Hier trafen sich abends und vor allem am Wochenende die Männer aus dem ganzen Dorf bei Bier und Schnaps. Im Saal wurden Feste gefeiert, am Wochenende wurde dort getanzt.
Am Rande des alten Dorfes, an der Grenze zum Rittergut, stand eine alte, fast hohle Linde, die sogenannte Götzenlinde. Bevor die christlichen Missionare die slawische Siedlung erreichten, sollen die Bewohner des Dorfes das Kultbild ihres Gottes Triglav hier vergraben und diese Linde gepflanzt haben. Beim Einmarsch der Russen im März 1945 ist die Linde zusammengebrochen.
Mit dem Straßendorf beginnt das Rittergut, das im Laufe der Jahrhunderte mehrfach die Besitzer gewechselt hat. An die Familie von Thadden kamen die ziemlich heruntergewirtschafteten Dörfer Trieglaff, Gruchow und Vahnerow 1820 durch die Heirat Adolfs von Thadden mit der Erbin Henriette von Oertzen. Ihr ältester Sohn Reinhold erbte Trieglaff und Gruchow, der Sohn Gerhard das kleinere Vahnerow.
An der langen Dorfstraße, die vom Bauerndorf zum Gutshof führt, stehen die niedrigen Häuser der Landarbeiter oder auch Tagelöhner, unserer »Leute«, wie wir sie nannten. Die Häuser hatte unser Vater Anfang des 20. Jahrhunderts nach und nach, wie es finanziell möglich war, anstelle der strohgedeckten Lehmfachwerkhäuser bauen lassen. Jeweils zwei Familien lebten in einem Haus, das unterkellert war und einen Dachboden hatte. Die Wohnungen hatten zwei oder drei Stuben, eine Kammer, Küche und Vorratsraum und eine kleine Waschküche. Alle Familien legten vor ihren Häusern Blumenbeete an, die von weiß gestrichenen Staketenzäunen eingefasst waren. Ein großer Obst- und Gemüsegarten und Ställe für Geflügel, Kaninchen und eine Kuh befanden sich hinter den Häusern.
Wenn ich mich nicht täusche, bin ich nur einmal in einem Arbeiterhaus gewesen, und zwar zu einer Hochzeits- oder großen Geburtstagsfeier, in Vertretung unserer Mutter, die entweder krank oder hochschwanger war oder im Wochenbett lag. Ich war sieben Jahre alt, als mir diese erste offizielle Aufgabe, Stellvertreterin der »Gnädigen Frau« zu sein, anvertraut wurde.
Als ich beim großen Familienfest ankam, war die Stube schon voller Gäste, sie saßen auf Bänken dicht zusammengedrängt. Ich wurde meiner Rolle entsprechend zu den Erwachsenen gesetzt, nicht zu den Kindern. Auf der langen Tafel standen dampfende Schüsseln, denn das Gelage fing mit dem Mittagessen an. So bescheiden und sparsam die Arbeiter gewöhnlich auch aßen – Pellkartoffeln mit Heringen, Pellkartoffeln mit Specksoße, »Kartoffelsupp’, Kartoffelsupp’, die ganze Woch’ Kartoffelsupp’«, hieß es in einem Lied –, bei festlichen Anlässen wurde nie gespart. Also zunächst Mittagessen mit verschiedenen Braten, Gemüsen und Kartoffeln, nach einer kurzen Pause folgte das Kaffeetrinken mit Cremetorten und Blechkuchen. Dauernd wurde mir was angeboten, und obwohl ich längst satt war, wagte ich nicht, »Nein, danke« zu sagen, weil ich damit die Gastgeber beleidigt hätte. Sie hätten sofort misstrauisch gefragt, ob es mir denn nicht schmecke. Also aß ich tapfer weiter, sah aus dem Fenster und hoffte das Kindermädchen zu sehen, das mich abholen sollte. In der Stube wurde es immer lauter, die Männer rauchten, tranken Bier und Schnaps. Erst nachdem ich noch belegte Brote in mich hineingestopft hatte, wurde ich endlich abgeholt. Wahrscheinlich war mir furchtbar übel.
In allen großen Dörfern mit einem Gutsbetrieb – nicht in den reinen Bauerndörfern – gab es eine sogenannte Schnitterkaserne, in der während der Erntezeit die polnischen Saisonarbeiter einquartiert waren. Sie kamen zur Getreideernte und blieben, bis die letzten Rüben geerntet waren, weil die eigenen Leute für die zusätzlichen Arbeiten nicht ausreichten. Das Wort »Schnitter« weist darauf hin, dass die Polen bereits auf die Güter kamen, als das Korn noch mit der Sense gemäht, also geschnitten wurde. Die Saisonarbeiter wurden vom Gutsbetrieb mit Essen versorgt, denn sie durften ihre Frauen nicht mitbringen. Und sie wohnten zwar in der Kaserne, waren aber natürlich nicht kaserniert, sondern konnten sich frei bewegen.
Im Zweiten Weltkrieg wurden Kriegsgefangene oder ukrainische Zwangsarbeiter in diesen Häusern untergebracht.
Der eigentliche Wirtschaftshof des Guts liegt immer noch im Winkel zwischen zwei aus dem Dorf herausführenden Straßen. Bevor ich zur Schule ging, habe ich den Hof allein wohl nie verlassen. Für ein kleines Kind gab es hier ja genug zu sehen: die Ställe der Kühe, Schweine, Schafe und Ackerpferde, die Scheunen, die Schmiede und die Stellmacherei. Den Stellmacher und seine Gehilfen störte es nicht, wenn ich ihnen zuschaute, wie sie mit der Kreissäge große Bretter zerschnitten, wie sie hobelten, feilten, schmirgelten und mit selbst gekochtem, scharf riechendem gelbem Leim Holzteile verklebten. So viel wie möglich wurde in der Stellmacherei selbst hergestellt und repariert: Ackerwagen, Leitern, Schubkarren, Tröge und vieles mehr. Die Kutschwagen wurden gekauft.
Neben der Stellmacherei lag die Schmiede, denn Schmied und Stellmacher arbeiteten viel zusammen, ergänzten sich in ihren Tätigkeiten, besonders beim Bau und der Reparatur von Ackerwagen und -geräten. Mich interessierte beim Schmied nur das Beschlagen der Pferde, sonst keine seiner Arbeiten. Mit seinem vom Ruß geschwärzten Gesicht war er mir immer etwas unheimlich.
Der Stellmacher war auch der Herrenfriseur des Dorfes. Die Haarschnitte waren einfach: Die Männer hatten kurz geschnittene Haare mit Seitenscheitel, die Jungen wurden fast kahl geschoren, es blieben einige Stoppeln auf dem Kopf. Die Frisur war praktisch, pflegeleicht, und Läuse waren gut sichtbar. Die Frauen brauchten keinen Friseur: Sie kämmten ihre langen Haare straff nach hinten und drehten sie in einem Knoten zusammen. Darüber trugen die meisten Frauen kleine, unter dem Kinn geknotete Kopftücher.
Mein Bruder Adolf (Ado) hatte hellblonde Locken, die bis über die Ohren fielen – der Stolz der Mutter, aber nicht der des ältesten Sohnes, denn eines Tages erschien er mit ganz kurz geschorenen Haaren. Der Grund: Er wollte aussehen wie die Dorfjungen, die ihn wegen seiner mädchenhaften Frisur verspottet hatten. So hat er es jedenfalls später erzählt. Dem misstrauischen und zögernden Stellmacher-Friseur hatte er versichert, die Eltern seien einverstanden mit dem Kurzhaarschnitt. Zum Bedauern unserer Mutter wuchsen nie wieder Locken.
Zur Landwirtschaft gehörten außer der Feldbestellung vor allem auch die Aufzucht von Nutztieren und ihre Verwertung, also das Schlachten. Doch bis die Tiere getötet wurden, hatten sie es damals gut auf dem Land. Sie lebten länger als die Tiere heutzutage, weil sie nicht im Schnellverfahren gemästet wurden, sie waren nicht auf engstem Raum zusammengepfercht, und im Sommer hatten sie alle genügend Bewegung im Freien: die Kühe auf den Koppeln, die Schafe auf den Wiesen und im Herbst auf den Stoppelfeldern, die Schweine in ihrer großen Suhle vor dem Stall. Die Hühner liefen überall auf dem Hof herum. Nur im Winter mussten sie im Stall bleiben, legten dann auch weniger Eier. Frische Eier waren im Winter knapp.
Die Kälber blieben bei ihren Müttern, tranken aus ihren Eutern, wurden nicht – wie heute – in enge Käfige gesperrt und mit »Milchaustausch« gefüttert. Wir hielten den noch zahnlosen Kälbchen unsere Hände hin, an denen sie gierig saugten. Uns entzückte das Kitzeln der rauhen Zungen an den Fingern immer wieder. Überhaupt gingen wir am liebsten in die Ställe, wenn Junge geboren waren: Lämmchen auf unsicheren staksigen Beinchen, rosa Ferkelchen, die sich um die Zitzen der dicken Sau balgten, blinde kleine Kätzchen und natürlich die Fohlen.
Ob es jetzt in den sterilen Schweineställen überhaupt noch Ratten gibt? Sie waren, als die Schweine noch viel Stroh in ihren Koben hatten, eine große Plage und gefährlich für die Ferkel, weil die Nagetiere an ihren Ohren und Schwänzen knabberten.
Katzen liefen in allen Ställen herum. Blechteller mit Milch standen für sie bereit, ernähren mussten sie sich selbst vom Mäusefang und leider auch vom Vogelfang. Kaum jemand kümmerte sich um sie. Sie bekamen oft Junge, von denen die meisten gleich nach der Geburt in einen Sack gesteckt und ertränkt wurden. Die Katzen waren scheu und vorsichtig und ließen sich nicht streicheln. Auf einen Kampf mit ausgewachsenen Ratten ließen sie sich nicht ein.
Warum hieß das große Schlachten im Spätherbst »Schlachtfest«? Was war daran festlich? Ich fand es traurig, dass die Tiere getötet werden mussten. Trotzdem war ich kein Vegetarier, sondern aß gerne Fleisch und die gut gewürzte pommersche Wurst. Überall auf den Dörfern wurden ungefähr zur gleichen Zeit Schweine und Kühe geschlachtet. Immer auf dem eigenen Hof. Ein amtlich zugelassener, geprüfter Fleischbeschauer untersuchte die Tiere vor und nach der Schlachtung. War das Fleisch in Ordnung, wurde es nach dem Schlachten gestempelt.
Wenn ich das gellende Schreien der Schweine hörte, die sehr grob von den Knechten behandelt wurden, bin ich ins Kinderzimmer gelaufen, habe mich in die hinterste Ecke gehockt und mir die Ohren zugehalten. Für ein kleines Kind ist das Landleben nicht immer idyllisch.
Die geschlachteten Tiere wurden zur Weiterverarbeitung in die Küche gebracht. Auf vielen Gutshöfen waren bei dem Hochbetrieb nicht nur Köchin und Küchenmädchen mit den verschiedenen Arbeiten beschäftigt, sondern auch die Hausfrauen. Unsere Mutter hat sich in Trieglaff nie daran beteiligt; sie verstand zunächst auch nichts von pommerscher Wurst- und Schinkenherstellung. Vielleicht ekelten sie, die die »feinste Nase« hatte, wie sie oft betonte, die widerlich süßlichen Gerüche in der Küche.
Als unser Vater den Gutshof Anfang des 20. Jahrhunderts neu gestaltete, die alten Ställe abreißen und neue bauen ließ, mit schöner Ziegelornamentik, hat er auch Bäume anpflanzen lassen. Bäume und Büsche trennten den Hof vom Park, sodass im Sommer die Stallungen vom Schloss aus kaum zu sehen waren. Bäume waren wichtig für die Vögel, und sie spendeten Schatten.
Nur eine Familie litt unter der Dendrophilie, der »Baumfreundschaft« des Gutsherrn: die des Inspektors Karl Pierau. Die breite Südfront des lang gestreckten Hauses hätte im hellsten Sonnenlicht liegen können, wenn nicht eine Reihe großer Bäume zu dicht vor dem Haus gestanden hätte. Selbst im Hochsommer waren die Zimmer dunkel. Trotz wiederholter Bitten des Inspektors, mit dem unseren Vater eine echte Freundschaft verband, durften die Bäume nicht gefällt werden. Sie waren wichtiger als helle Räume.
Unser Vater war auf den Tag genau zehn Jahre älter als Karl Pierau. Beide Männer waren tüchtige Landwirte, und sie haben in den schwierigen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg die wirtschaftliche Situation des Guts allmählich verbessern können.
Einem klugen Rat seines Freundes ist unser Vater leider nicht gefolgt. Nach dem Ersten Weltkrieg war der Mann unserer Schwester Marie-Agnes (Anza), Martin Braune, berufslos, denn Marineoffiziere wurden nicht mehr gebraucht. Um ein kleines Gut an der Oder kaufen zu können, bestand er – trotz der beginnenden Inflation und der prekären Wirtschaftslage – auf der Auszahlung des Erbanteils seiner Frau. Karl Pierau beschwor den Vater, den Hof für seine Tochter zu kaufen, als Sicherheit für sie und ihre Kinder. Er glaubte nicht an die Zuverlässigkeit des Schwiegersohns, der ihm auch unsympathisch war. Für den sehr konservativen Landrat aber war es undenkbar, den Landbesitz einer Frau, nicht einmal seiner Tochter, zu überschreiben. Leider, denn die Ehe zerbrach, Martin Braune heiratete ein zweites Mal, und Anza hatte deshalb nach dem Zweiten Weltkrieg keinen Anspruch auf Entschädigung. Den »Lastenausgleich« für den verlorenen Besitz erhielten der geschiedene Mann und seine zweite Frau, die sich dafür einen Hof in Westdeutschland kaufen konnten.
Wegen der rasanten Geldentwertung in der Inflationszeit musste der Betrag für den Kauf des Hofs innerhalb von vierundzwanzig Stunden von einer Sparkasse zur anderen gebracht werden. Damit wurde Fritz Schmitz, der jüngere Bruder unserer Mutter, beauftragt. Morgens, als die Sparkasse in Greifenberg geöffnet wurde, packte er die Geldscheinbündel, viele Millionen Mark, in einen großen Koffer, eilte zum Bahnhof, fuhr mit dem nächsten Zug nach Stettin, stieg dort um und konnte gerade noch vor Kassenschluss das Geld in der Sparkasse von Greifenhagen abliefern. Am nächsten Tag hätten die Millionen schon nicht mehr gereicht.
Sind unsere Eltern jeden Sonntag zum Gottesdienst in die Kirche gegangen? Der Gutsherr war als Patron der Kirche vielleicht dazu verpflichtet. Seine Frau auch? An den großen Festtagen ist sie wohl auch in die Kirche gegangen, das wurde sicher erwartet. Später, als wir in Vahnerow wohnten, ist sie nur selten nach Batzwitz zum Gottesdienst gefahren.
Die Kirche in Trieglaff war ein sehr schöner einschiffiger Bau, aus großen behauenen, weiß verputzten Findlingen aufgemauert, mit einem geraden Chorabschluss. Der gedrungene Holzturm an der Westseite hatte eine auffällig hohe, dünne Spitze, die man auf dem Luftbild gerade noch zwischen den Baumkronen erkennen kann. Holztürme gab es in Hinterpommern nur bei Dorfkirchen, sie waren viel billiger als die in Städten üblichen Steintürme. Das hölzerne Innengerüst aus kräftigen Balken war sehr stabil, weil es der Belastung durch die schwingende Glocke standhalten musste. Außen war die Konstruktion mit schmalen Brettern verkleidet, in Trieglaff waren sie in einem Fischgrätmuster angeordnet.
Die Kirche ist im 13. Jahrhundert auf dem Platz erbaut worden, auf dem sich die heidnische Opferstätte für den Gott Triglav befunden hatte. Sie wurde der heiligen Elisabeth geweiht. Das Kultbild ihres Gottes hatten die Slawen angeblich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Alte knorrige Eichen umgaben die Kirche: Eine von ihnen, aus einem bestimmten Winkel betrachtet, hatte das Profil Friedrichs des Großen, des Alten Fritz. Verwitterte Grabsteine erinnerten an den ehemaligen, längst aufgelassenen Friedhof.
Von all dem ist nichts mehr zu sehen: Die Kirche ist allmählich verfallen und schließlich abgerissen worden (1948).
Wir, die Patronatsfamilie, betraten die Kirche erst, wenn sich die Gemeinde zum Gottesdienst versammelt hatte. Links vom Gang saßen die Frauen, rechts die Männer. Wir gingen bis zum Chor und stiegen dann auf einer kurzen, steilen Treppe zur Empore hinauf. Hinter einer brusthohen Bretterwand auf unbequemen Stühlen sitzend, sahen wir Kinder außer der Kanzel und dem Baldachin nichts vom Kirchenraum, wir guckten nur auf die braunen Bretter. Standen wir mit der Gemeinde zur Verlesung von Bibeltexten oder zum Gebet auf, konnten wir den Pastor vor dem Altar sehen. Ich wagte kaum, den Kopf zur Gemeinde zu wenden, man hätte mich für neugierig oder gar für herablassend halten können. Also schaute ich nur auf den Pastor in seinem schwarzen Talar und langweilte mich bei seiner Predigt, die er von der Kanzel hielt. Kirchenlieder, vom Orgelspiel begleitet, habe ich immer sehr gerne gesungen.
Ob im Großen Kirchengebet noch für den Patron gebetet werden musste? Im 20. Jahrhundert hatte er zwar noch den Titel, doch kirchenrechtliche Befugnisse wie im 19. Jahrhundert hatte er nicht mehr. Damals hatte er noch das Recht gehabt, einen Pastor zu berufen. Jetzt konnte er einer Ernennung nur noch zustimmen. Gegen seinen ausdrücklichen Widerstand wäre allerdings auch kein Pastor eingesetzt worden.
In jedem Jahr gab es ein Missionsfest zugunsten der Missionsstationen in fernen Erdteilen. Dann wurde ein bunt bemalter, wohl eineinhalb Meter großer Neger aus Holz neben die Kirchentür gestellt. Er trug einen farbigen Turban auf dem Kopf, zeigte lächelnd seine weißen Zähne, sah aus wie ein Sarotti-Mohr auf den Schokoladentafeln. In den Händen hielt er eine Blechbüchse. Wenn eine Münze durch den Schlitz gesteckt wurde, nickte er dankbar mit dem Kopf.
Unsere Mutter fand Missionsfeste überflüssig. Sie war der Meinung, die Kirche solle sich um die Mission im eigenen Land kümmern, da sei genug zu tun. Es gab überall, vor allem in den großen Städten, soziales Elend. Dies zu lindern war wichtiger, als in fernen Ländern den Chinesen oder den »armen Negerkindern« das Christentum zu predigen. Das hat sie uns unmissverständlich gesagt, trotzdem mussten Ado und ich an den Festen im Garten des Pastors als Vertretung der Patronatsfamilie teilnehmen. Auf der Wiese unter den Obstbäumen waren Tische und Bänke aufgestellt, es gab Blechkuchen, Kaffee und Obstsaft, ein Missionar berichtete über seine Arbeit in einem fernen Land, es wurde gebetet und gesungen. Der dünne Gesang verwehte im Sommerwind. Die schmalen Bänke waren hart. Vielleicht stammt aus jener fernen Zeit mein Widerwillen gegen lange Bänke an langen Tischen. Ado und ich waren immer froh, wenn wir endlich nach Hause laufen durften.
Doch die »armen Negerkinder« spielten in unserer geschwisterlichen Pädagogik eine Rolle. Wenn jemand etwas nicht aufessen wollte, weil es ihm nicht schmeckte, hieß es vorwurfsvoll: »Aber die armen Negerkinder würden sich freuen, wenn sie so etwas Gutes essen könnten!«
Gesellschaftlichen Kontakt zwischen dem Kirchenpatron und dem Pastor hat es wohl nicht gegeben. In meiner Erinnerung kam der Pastor nur ins Schloss, wenn wieder ein Kind getauft werden musste, denn wir wurden nicht in der Dorfkirche getauft. Mit den zahlreichen Kindern des Pastors, die in unserem Alter waren, haben wir nie gespielt.
Zum Familienfriedhof führt eine Kastanienallee, erst leicht abfallend, dann sanft aufsteigend zu dem großen Eingangstor aus grauem Stein. In den Bogen ist ein Vers aus dem Johannesevangelium, Kap. 11, eingraviert: »Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe.«
Dahinter lag wie in einem heiligen Hain, feierlich und immer etwas dämmrig, das Thaddensche Erbbegräbnis mit einem weiten Blick über den Bauernsee. Die Grabhügel waren von dichtem Efeu bedeckt, die eisernen Grabkreuze hatten alle dieselbe Gestalt. In leicht erhabenem und bronziertem Relief waren die Namen, Daten und ein Bibelspruch geschrieben. Neben all den adligen Toten, in geziemendem Abstand, lag das Grab einer bürgerlichen Toten. Uns wurde erzählt, es sei das Grab eines Hausmädchens, das von der Gutsherrin Sophie von Mellin mit einem Schlüssel erschlagen worden sei. Es wurde auch erzählt, Sophie von Mellin habe zur Strafe lebenslang einen eisernen Ring um den Hals tragen müssen. Ins Gefängnis ist sie jedenfalls nicht gekommen. Sie lebte um 1830 »noch mit ihrem Ring um den Hals in Greifenberg am Markt, betreute hier zur Schule gehende Abkömmlinge, beobachtete durch einen Spion, wer die Straße passierte, und sah ihre Nachkommenschaft über Pommern sich ausbreiten«, wie Udo von Alvensleben 1934 in seinem Tagebuch geschrieben hat (In: Alvensleben/Koenigsfeld, Besuche vor dem Untergang, Berlin 1968, S. 64).
Vor meinem ersten Pommernbesuch (1976) mit meiner jüngsten Schwester Astrid (Atti) und zwei befreundeten Galeristen aus Köln hatte ich erwartet, den von Efeu, Unkraut und Gestrüpp überwucherten alten Familienfriedhof mit inzwischen verrosteten Eisenkreuzen vorzufinden, um den sich nach dem Krieg niemand gekümmert hatte. Auf den Anblick des total verwüsteten Friedhofs war ich nicht vorbereitet, obwohl es Raubgräber und Friedhofschänder zu allen Zeiten gegeben hat. Einige Gräber waren aufgegraben, Kreuze waren umgeworfen, zum Teil zerbrochen. Das Kreuz unseres Vaters stand noch aufrecht. Wir richteten einige Kreuze auf oder lehnten sie an Baumstämme. Wahrscheinlich sind ortsfremde Plünderer für die Aufgrabungen verantwortlich gewesen, nicht die Bewohner von Trieglaff. Der katholische Pfarrer war nicht zuständig für diesen Friedhof, weil er Privatbesitz der Thadden-Familie war, also niemals kirchliches Eigentum. Irgendwann sind die Eisenkreuze in den nahen See geworfen worden. Der Bürgermeister hat einige herausziehen und auf den Friedhof bringen lassen, darunter das Grabkreuz unseres Vaters.
Dann haben Trieglaffer Bürger unter großem Aufwand den Friedhof allmählich entrümpelt und von Gestrüpp befreit, was vor allem dem Verwalter, Herrn Momot, und seiner Familie, dem Bürgermeister und dem Schuldirektor zu danken ist. Die Aktion wurde ständig von Rudolf von Thadden als Vertreter der Familie unterstützt. Den Toten wurde in der Mitte des Platzes ein großes Denkmal gesetzt, in dessen Zentrum eine Gedenktafel mit zweisprachiger Inschrift steht. Der neu gestaltete Friedhof wurde 2004 mit einem protestantischen Gottesdienst eingeweiht, zu dem auch viele Nachkommen der Familie von Thadden gekommen waren. Ein großes Fest mit Musik und Tanz wurde zum Abschluss im Schulhaus gefeiert.
Der sogenannte Bauernfriedhof, auf dem auch die Gutsarbeiter und ihre Familien beerdigt wurden, war total überwuchert von Gestrüpp, als ich ihn 1976 sah. Er war bis zum Kriegsende hell und freundlich mit den unterschiedlichsten, manchmal recht kitschigen Grabsteinen und Kreuzen, betenden Engeln, aufgeschlagenen Porzellanbüchern, auf deren Seiten die Namen der Toten in goldenen Buchstaben geschrieben waren, mit bunten Papier- und Wachsblumen und frischen Sträußen. Er gefiel mir besser als unser stilvoller feierlicher Familienfriedhof.
Auf dem Weg zu beiden Friedhöfen überquerte man die Gleise band. Seit 1896 beteiligte sich unser Vater als Landrat an der Gründung einer Zuckerfabrik in Greifenberg, förderte den Zuckerrübenanbau im ganzen Kreis. Zur besseren Anbindung an die Fabrik ließ er für den Rübentransport eine feste Feldbahn von siebzig Zentimeter Spurbreite verlegen, deren Endstation Trieglaff war. Hierher wurden von einigen Gütern und Bauernhöfen im Herbst mit schweren Ackerwagen Zucker- und Futterrüben und Kartoffeln gebracht und in die offenen Waggons verladen. Von Vahnerow zu dieser Kleinbahn war ein schmaler Schienenstrang für die von Pferden gezogenen Kipploren verlegt worden.
Der Gang durchs Dorf endet schließlich vor dem Schloss. Auf der gepflasterten Rampe, die leicht ansteigend zum Portal führt, wurde im Winter, nach Beendigung der Treibjagd, die sogenannte Strecke ausgelegt: das von den Jägern zur Strecke gebrachte Wild lag, nach Gattungen geordnet, in mehreren Reihen dicht nebeneinander: Hasen, Kaninchen, Fasanen, Füchse, auch Rebhühner. Die Jäger, Gutsherren aus der Nachbarschaft, und unser Förster Zastrow, die Flinten noch über die Schulter gehängt, standen stolz davor. Wir Kinder sahen uns die toten Tiere mit gemischten Gefühlen an, denn wir hatten Mitleid mit den niedlichen Hasen und Kaninchen, deren Fell blutig befleckt war, denen Blut an Maul und Nase klebte, mit den bunten Fasanen hähnen, auch mit den schönen Füchsen, andererseits gehörte die jährliche Treibjagd zu unserem Leben auf dem Land wie das Schlachten der Haustiere. Es wurde natürlich gezählt, welcher Jäger wie viele Tiere geschossen hatte, und wenn unser Vater zu den erfolgreichen Schützen gehörte, waren wir stolz auf ihn.
Das Schloss
Das Gutshaus in Trieglaff, allgemein »das Schloss« genannt (viele Gutshäuser wurden so bezeichnet, auch wenn sie den Namen nicht verdienten), ist ein seltsam unharmonisches Bauwerk, das Kriegs- und Nachkriegszeit fast unbeschadet überstanden hat. Von dem ehemaligen Inventar des Hauses ist nichts erhalten; im Laufe der Jahre haben es die Russen, die seit 1945 dort den Sitz ihrer Kommandantur hatten, restlos ausgeplündert. Später übernahmen Polen den Gutsbetrieb.
Das Schloss sieht so aus, als wären zwei Häuser, die überhaupt nicht zusammenpassten, aneinandergeschoben oder -geklebt worden. Das alte, lang gestreckte Haus in bescheidenem hinterpommerschen Landhausstil mit zwei niedrigen Stockwerken und einem hohen Dach stammt aus der ersten Hälfte des 17.Jahrhunderts, ein leichter, ursprünglich strohgedeckter Fachwerkbau, in dem die Familie von Mellin lebte. Im 18. Jahrhundert wurde es mit dem Geld der Ehefrau Christiane Henriette von Kauderbach erneuert, umgebaut, erweitert und bekam einen breiten vorgebauten Eingang zur Hofseite. 1903, drei Jahre nach dem Tod seines Vaters Reinhold, zog unser Vater, der vorübergehend mit seiner Familie in Greifenberg gewohnt hatte, nach Trieglaff, um das Gut zu übernehmen. Für seine große Familie – fünf Kinder – war das alte Haus zu klein und auch nicht repräsentativ genug für den Landrat. Außerdem stand wieder Geld einer Ehefrau, Ehrengard von Gerlach, zur Verfügung.
Der Architekt des neuen Baus hat bei seinem Bauplan auf den Charakter des alten Hauses keine Rücksicht genommen, sondern ein imposantes Schloss im damals modischen historisierenden Stil entworfen. Mit barocken Stilelementen, in die sich Jugendstilformen mischten, und einem romanischen Erker, entsprach es dem Geschmack der Auftraggeber.
Natürlich habe ich als Kind das Haus niemals mit kritischem Blick betrachtet. Es war unser Haus, es kam mir riesig vor und herrschaftlich, es war viel größer als die größten Häuser im Dorf: das des Inspektors, das Schulhaus, in dem der Lehrer mit seiner Familie wohnte und die Häuser der beiden Pastoren von der altlutherischen und von der unierten Kirche. Auch in der nächsten Nachbarschaft gab es kein vergleichbares Gutshaus. Die meisten ähnelten dem schlichten alten einstöckigen Haus. Später lernte ich wesentlich größere Schlösser in der weiteren Umgebung kennen.
Immer noch geht oder fährt man zum Eingang über eine leicht ansteigende Auffahrt, die von einer steinernen Balustrade begrenzt ist. Auf ihr standen in meiner Kindheit vier große Steinvasen, die im Sommer mit Geranien bepflanzt waren. Man betritt das Schloss durch ein doppelflügeliges Portal, das plastisch hervorgehoben und von einem Schmuckgiebel gekrönt ist, auf dem die Wappen der Familien der Erbauer, von Thadden und von Gerlach, angebracht sind. Weder die Russen noch die Polen haben sie zerschlagen. Man geht einige Schritte durch den Windfang und kommt dann in die große Halle. Zu beiden Seiten des Durchgangs liegen die Damen- und die Herrengarderobe (»Damen- und Herrenablege«, wie man auch sagte), denn Damen und Herren zogen sich nicht im selben Raum aus und an. Auch Händewaschen und Frisieren im selben Raum wären unschicklich gewesen. Natürlich hatte jede Garderobe ihre eigene Toilette. Die Schuhe mussten gewechselt werden vor dem Betreten der Wohnräume. Bei Regenwetter wurden die Lederschuhe durch aufknöpfbare Überschuhe aus Gummi vor Nässe und Schmutz geschützt.
Auf der rechten Seite der hohen Halle führt eine breite Eichentreppe in den ersten Stock; in die linke Wand ist ein Kamin eingebaut, der niemals benutzt wurde, wenn ich mich recht erinnere. Er war wohl nur ein Statussymbol, das zur Ausstattung einer Halle gehört, kein notwendiger Wärmespender an kalten Winterabenden. Eine für die damalige Zeit moderne Zentralheizung versorgte das ganze Haus mehr schlecht als recht.
Das Licht fällt aus der Höhe durch ein großes Fenster in reinster Jugendstilornamentik in die Halle. Die Glasmalerei in bräunlichen Farben zeigt unter einem runden Medaillon den dreiköpfigen Gott Triglav, umgeben von verschlungenem Ranken- und Bänderwerk. Dieser wendische Gott hat dem Dorf seinen Namen gegeben.
Unser Vater war ein sehr geselliger und leutseliger Mann, der gerne Gäste einlud: Verwandte, Freunde, Nachbarn, Ratsuchende, Hilfsbedürftige. Der Bruder seiner Mutter, Leopold Witte, schrieb im September 1918 an seinen Sohn Karl: »… jetzt in Trieglaff ist es und war es wunderschön. Hier wimmelt es nur allzu sehr von ganzen Familien und einzelnen Herren und Frauen. Jetzt wird es nach der Abreise der meisten endlich stiller.«
Das Land der Familie von Thadden
Adolf von Thadden (um 1922)
Barbara von Thadden, geb. Blank (1920)
Reinhold von Thadden und seine Frau Marie, geb. Witte, beim Schachspiel im Park (um 1900)
Es blieb nicht lange still, denn zwei Jahre später, im September 1920, heiratete unser verwitweter Vater die fünfundzwanzigjährige Barbara Blank, Lehrerin für Deutsch und Englisch in dem von seiner Schwester Hildegard geleiteten Altenburger Magdalenenstift. Sie hatte die junge Lehrerin zur Erholung nach Trieglaff geschickt, nicht ahnend, welche Folgen dieser Besuch für die ganze Familie haben würde. Ihr Bruder verliebte sich auf der Stelle in die hübsche junge Frau und verlobte sich mit ihr. Der Schock über diese unerwartete Verbindung muss bei den längst erwachsenen Kindern aus der ersten Ehe groß gewesen sein. Die Großmutter Marie (geb. Witte) bemühte sich in einem Brief an Berliner Freunde um Verständnis: »Die junge Frau neben dem so viel älteren Mann. Das richtig zu empfinden ist nicht einfach.« Der jungen Barbara wird aber guter Willen und Takt bescheinigt. Im nächsten Brief heißt es schon: »Barbara ist verblüffend Herrin der Situation – beherrscht ihre Aufgaben. Das englische Blut ihrer Mutter hat ihrer Mischung gutgetan.« Ein erstaunliches Lob, denn die junge Schwiegertochter hatte von der Organisation und Leitung eines großen Haushalts keine Ahnung. »Ich konnte nur Tee und Eier kochen«, behauptete sie später. Wichtigste Ratgeberin wurde Lena von Woedtke, die Schwester der ersten Frau unseres Vaters und Frau seines besten Freundes Fritz von Woedtke. Zwar wusste der erfahrene Diener Wilhelm, wie eine festliche Tafel für die Diners gedeckt wurde, doch die Speisekarte musste die Hausfrau bestimmen, und dabei wurde sie so lange von Lena von Woedtke beraten, bis sie keinen Rat mehr brauchte. Auch sonst stand Lena für alle Fragen der Haushaltsführung und der Etikette zur Verfügung. Um von den Angestellten anerkannt zu werden, musste die junge Hausfrau sehr schnell lernen, selbstsicher und bestimmt aufzutreten.
Nachdem sich also die Gäste in den beiden Garderoben umgezogen hatten, wurden sie in der Halle empfangen. Sie war nur sparsam möbliert, denn sie war eigentlich kein Aufenthaltsraum. Hier versammelten sich die Jäger, die zu Jagden gekommen waren, oder die Ehepaare von den Nachbargütern, die zu Musik- und Leseabenden eingeladen waren. Die Damen in modisch kurzen Hängekleidern, aber besonders elegant war sicher keine, denn es war nicht üblich, für Kleidung viel Geld auszugeben. Die Herren waren in dunklen Anzügen immer passend angezogen. Und wir Kinder, frisch gewaschen und in Sonntagskleidern, mussten natürlich Guten Tag sagen. Die Mädchen begrüßten die Damen mit tiefem Knicks und Handkuss, die Jungen verbeugten sich beim Handkuss. Die Erwachsenen waren so groß, dass ich nicht immer zu ihnen aufsah, sondern einfach von einer herunterhängenden Hand zur nächsten ging, sie ergriff und einen Kuss darauf drückte – manchmal war das auch eine etwas haarige Männerhand. Und stets hörten wir dieselben Bemerkungen der Erwachsenen, die sich zu uns herunterneigten, um uns genauer betrachten zu können: »Nein, wie bist du groß geworden!« »Du bist aber gewachsen, seit ich dich zuletzt gesehen habe!« »Ach, wie siehst du deinem Vater (oder deiner Mutter) ähnlich!« oder »Ist es nicht erstaunlich, wie sie der Großmutter (oder der Tante XY) ähnlich sieht?« Wir waren froh, wenn die lästige Zeremonie vorbei war und wir, vom Kinderfräulein oder Kindermädchen begleitet, nach oben in unsere Schlafzimmer laufen durften, wo uns noch vorgelesen wurde.
Die Gäste der Leseabende begaben sich in den Blauen Salon, in dem die Stühle in Reihen aufgestellt waren. In einer Ecke stand der Blüthner-Flügel. Der Raum hat ein großes Fenster mit dem schönsten Blick über den See auf das bewaldete Ufer und abends auf herrliche Sonnenuntergänge.
Lese- und Musikabende gab es in den Zwanzigerjahren wohl nur noch in Trieglaff. Unser Vater führte damit eine Tradition fort, die im 19. Jahrhundert auch auf anderen Gütern beliebt war, es gab, wie Bismarck einmal spöttisch bemerkte, »ästhetische Tees mit Lektüre, Gebet und Ananasbowle«. Beliebt war das Lesen mit verteilten Rollen. Die Thaddens galten als besonders »gebildet und intellektuell«, und das Trieglaffer Haus wurde in den Zwanzigerjahren »zum kulturellen Mittelpunkt des Kreises Greifenberg und über den Kreis hinaus«, wie unsere Mutter einmal geschrieben hat. Bei den Leseabenden, zu denen unsere Eltern einluden, wurden vor allem zeitgenössische Theaterstücke vorgetragen. Meistens las unser Vater die Texte allein vor; war aber die Schauspielerin und Jugendfreundin Ruth von der Ohe zu Besuch, dann übernahm sie die weiblichen Rollen. Die modernen Theaterstücke befremdeten die konservativen Gäste, und nach der Lesung wurde beim kalten Abendbrot lebhaft über das Vorgetragene diskutiert. An den Musikabenden sang unsere Mutter, die als Sängerin ausgebildet war und eine gute Alt- oder Mezzosopranstimme hatte, begleitet von Karl Kratz, dem Musiklehrer aus Greifenberg, der im Einwohnerbuch der Stadt Greifenberg als »Tonkünstler« eingetragen ist. Er war nicht nur als überdurchschnittlich guter Pianist geschätzt – er hatte eigentlich Konzertpianist werden wollen –, sondern er war auch gesellschaftlich anerkannt, weil er eine adlige Mutter hatte.
Wahrscheinlich gab es auch mal »gemischte Abende« mit Literatur und Musik.
An einen Gesellschaftsabend kann ich mich noch gut erinnern. Die Gäste standen im Blauen Salon, unterhielten sich, bewunderten wie üblich das Panorama, und ich stand zwischen ihnen. Plötzlich drängten alle zum Fenster, denn der Hausherr hatte einen ungewöhnlichen Großvogel auf der Wiese gesehen, eine Trappe, und machte die Gäste darauf aufmerksam. Anstatt sich nur an dem Anblick des schönen Tieres zu freuen, eilte er zum Gewehrschrank, nahm eine Flinte, lud sie, öffnete das Fenster und schoss. Ich war empört. Was die Gäste dachten, weiß ich nicht. Ich fragte sie, ob mein Vater etwa eine Vogelmutter erschossen hätte, deren Kinder nun keine Mutter mehr hätten und verhungern müssten. Nein, nein, wurde ich getröstet, es sei ein Vogelmann. Und ich sagte erleichtert – zum Vergnügen der Damen und Herren: »Ach – nur so ein alter Vater, wie ich auch einen habe!« Immerhin hatte der alte Vater so viel Humor, dass er die Geschichte an die Redaktion der Zeitschrift Wild und Hund sandte. Das Geld für den Abdruck zahlte er auf mein Sparbuch ein. Mein erstes Honorar. Trappen, schon lange vom Aussterben bedroht, stehen heute unter strengstem Naturschutz. Ob sie allerdings damals schon geschützt waren, kann ich nicht sagen.
Im Gelben Salon, dessen hellgelbe Tapete mit stilisierten, palmenähnlichen Bäumchen gemustert war, sehe ich weiße Möbel mit goldenen Verzierungen, einen Tisch, eine Bank und Stühle auf schlanken Beinen. Wenn Gäste zum Nachmittagstee kamen, es waren meistens Damen aus der Nachbarschaft oder Feriengäste, dann saßen sie an diesem Tisch.
Zu Vaters siebzigstem Geburtstag wurde hier ein Gruppenfoto aufgenommen: die allzu rundliche Mutter mit Monika (Mona) auf dem Schoß, in dünnem weißem Voilekleid (dazu trägt sie dicke dunkle Strümpfe und schwarze Schnürschuhe – weder sie noch ihr Mann haben diese Zusammenstellung als Stilbruch gesehen). Neben ihr sind die vier älteren Kinder aufgestellt, alle weiß gekleidet. Ich habe offene, leicht gewellte Haare, eine große weiße Satinschleife auf dem Kopf und sehe, wie immer, sehr ernst aus.
Der schönste Platz in diesem Raum war der halbrunde Altan in einer Ecke, zu dem man einige Stufen hinaufstieg. Das Licht fiel vom späten Vormittag bis zum Abend durch drei hohe Sprossenfenster. Wenn unsere Mutter nicht in ihrem eigenen sehr schmalen Zimmer saß, dann saß sie oft hier, entweder stickend, stopfend oder strickend, und wenn sie ein Strickzeug in der Hand hatte, las sie nebenbei in einem Buch, das vor ihr auf dem Tischchen lag. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals untätig war. Auch wir Töchter mussten es frühzeitig lernen, beim Lesen zu stricken. Denn: Nur stricken war geistlos, nur lesen war Zeitverschwendung.
Vaters Zimmer, das Herrenzimmer, war grün tapeziert, an den Wänden hingen Gehörne, zu Gruppen geordnet, dazwischen Bilder mit Jagdszenen. Die Brandmalerei eines röhrenden Hirschs über dem Sofa war ein Werk des Hausherrn. In dieser Technik, die kaum noch bekannt ist, war Vater ein Meister. Das Motiv wird zunächst auf eine helle Holzplatte gezeichnet und dann mit einer glühenden Stahl- oder Platinnadel in die Platte eingebrannt. Ich war nicht gerne in diesem Zimmer, weil es immer nach Tabak roch, denn Vater war ein Zigarren- und Pfeifenraucher. Wenn Fritz von Woedtke uns besuchte, saßen die beiden alten Freunde nach dem Mittagessen an dem Schachtisch, an dem schon die Großeltern gesessen hatten. Neben ihnen auf einem silbernen Tablett ein Mokkaservice. Ich wunderte mich, dass man so lange, unbeweglich vorgebeugt und schweigend, auf ein Brett mit schwarzen und weißen Figuren starren konnte, bevor eine Figur von einem Quadrat zu einem anderen geschoben wurde.
Niemals war die Eingangshalle so voller Menschen wie zum siebzigsten Geburtstag unseres Vaters am 3. Juni 1928. Die Halle war mit Rotdorn geschmückt Es kamen Männer in Uniformen von Krieger- und Jägervereinen, Abordnungen der Kreisverwaltung, Vertreterinnen des Landfrauenvereins, Gutsherren mit ihren Frauen aus der Nachbarschaft, die fünf uns sehr fremden Halbgeschwister, Leute aus dem Dorf, Männer mit Schärpen und Orden. Vier kleine Kinder aus der zweiten Ehe, artig und still, standen neben der Mutter, die vermutlich die erst zehn Monate alte Mona auf dem Arm trug. Langweilige Reden wurden selbstverständlich auch gehalten. Ich war beeindruckt von so vielen Gratulanten, und auch stolz auf unseren Vater.
Nur noch einmal, ein Jahr später, kamen die Halbgeschwister nach Trieglaff, diesmal zu unangenehmen Erbauseinandersetzungen. Auf die Regelung des Erbes hatten vor allem die vier Schwestern gedrängt, weil sie fürchteten, der Vater würde Trieglaff, das größere Gut, uns Kindern aus der zweiten Ehe vermachen und Vahnerow, das kleinere und sehr verschuldete Gut, den Kindern aus der ersten Ehe. Das Ergebnis der Verhandlungen: Vater und Sohn tauschten die Güter. Reinold übernahm außerdem die hohen Schulden von Vahnerow. Die Schwestern verzichteten auf ihren Erbanteil zugunsten ihres Bruders. Der Ortswechsel wurde auf den Sommer 1930 festgelegt.
Unsere Mutter freute sich auf das kleinere, bequemere und vor allem besser beheizbare Vahnerower Gutshaus, das sie auch innenarchitektonisch nach ihrem Geschmack verändern konnte.
Die Zimmer des neuen Schlosses waren hoch und groß, im Blauen und Gelben Salon hielt sich selten jemand auf. Die steifen und unbequemen Möbel luden nicht zum Sitzen ein. Wir hätten es auch niemals gewagt, uns zum Lesen oder Spielen hier aufzuhalten. Ich habe mich in den Salons immer klein und verloren gefühlt.
Alle repräsentativen Räume in Trieglaff waren mit Parkett im Fischgrätmuster ausgelegt. Das Holz war nicht versiegelt, sondern offenporig und deshalb empfindlich. Die Pflege war aufwendig: Auf flachen Kissen knieten die Hausmädchen und rieben mit feiner Stahlwolle jede einzelne Diele in der Richtung der Maserung ab. Anschließend wurde der Boden mit Bohnerwachs eingefettet und blank gebohnert. Ich fand es selbstverständlich, dass ein Herrenhaus Parkettböden hat und war später enttäuscht, dass es im Vahnerower Haus nur Dielen aus Buchenholz gab.
Vom Blauen Salon stieg man einige Treppenstufen hinunter in die Bibliothek, die bereits zum alten Haus gehörte. Die eingebauten Regale waren voller Bücher, viele mit alten Lederrücken. Vor dem Essen haben wir Kinder hier manchmal wartend gesessen. Weil die Bibliothek eigentlich ein Durchgangsraum war, eignete sie sich nicht recht zum stillen Lesen. In meiner Erinnerung war sie nur der Raum für die täglichen Morgenandachten, denn hier stand ein kleines Harmonium. Alle Hausangestellten mussten an den Andachten teilnehmen. Der Hausherr las die Tageslosung vor – ein Text aus der Bibel mit kurzer Interpretation –, es wurde gemeinsam gebetet und gesungen. Die Gesänge begleitete die Hausfrau auf dem Harmonium.
Ich ging gerne in das alte Haus, in dem die Wirtschaftsräume untergebracht waren und einige Hausangestellte wohnten, auch die Köchin und ihre Schwester Meta, die den seltsamen Namen Rux trugen. Meta war unsere Hausschneiderin. Sie stopfte Strümpfe, nähte Knöpfe an, verlängerte Kleider, flickte Hosen und Bettwäsche, sogar Aufnehmer wurden gestopft – so sparsam war man früher! Wer flickt heute noch seine Laken und Bettbezüge?
Ich besuchte Meta oft in ihrem Zimmer, das sie mit ihrer Schwester teilte. Ich setzte mich auf ein niedriges Bänkchen und sah ihr bei der Arbeit zu. Wenn ein Faden zu Ende war, gab sie mir die Nähnadel und einen neuen Faden und bat mich, für sie einzufädeln, weil sie das Nadelöhr nicht erkennen konnte. Und ich wunderte mich darüber, denn für mich war das ganz einfach.
In der Mitte des Zimmers stand ein großer Tisch, über ihm hing eine Metalllampe mit grünen Perlschnüren, und in dem messingfarbenen Schirm funkelten Glassteine in Facettenschliff, grüne, gelbe, rote, blaue. Ich liebte diese Lampe. Der Lichtschein mit den bunten Flecken reichte zwar nicht weit, der größte Teil des Zimmers lag im Dunkeln, das fand ich aber besonders gemütlich. Und wenn ich jetzt in einem Geschäft mit alten Möbeln eine solche Lampe entdecke, erinnert sie mich an Meta und ihr Zimmer.
Auf einem Foto aus den Zwanzigerjahren stehen sechs Hausmädchen nebeneinander: die Köchin und ihre Schwester, das Kindermädchen Gerda, zwei Stubenmädchen und ein Küchenmädchen. An diese kann ich mich nicht mehr erinnern, denn sie wechselten häufig. Alle tragen eine Art Tracht, basierend auf einer alten pommerschen Tracht: Trägerröcke und darunter weiße Blusen. Die Trägerröcke waren blau mit bunten Borten über dem Rocksaum. Den Stoff webte meine Mutter. Sie selbst trug diese Haustracht gerne, aus Solidarität mit den Hausmädchen, obwohl sie ihr nicht gut stand.
Auch das Esszimmer, verhältnismäßig niedrig und schmal, befand sich im alten Haus. Die Wände waren mit dunklem Holz getäfelt. Ich erinnere mich nur noch an das schwere Eichenbuffet mit einem von dicken gedrechselten Säulen getragenen Aufsatz, denn an diesem Buffet stand unser Diener immer und erzählte uns Geschichten, wenn die Eltern abends eingeladen waren. Der Diener wurde Wilhelm genannt, und er sah auch ein wenig aus wie Kaiser Wilhelm II. mit seinem Bart, dessen Enden nach oben gezwirbelt waren. Getauft war er auf den Namen August, doch bei Thaddens wurde er Wilhelm genannt. Alltags trug er eine leichte blau-weiß gestreifte Jacke, zum Empfang der Gäste und zum Servieren bei Diners musste er eine dunkelblaue Livree anziehen. Sie hatte goldglänzende Wappenknöpfe. Der immer freundliche Wilhelm, den wir sehr liebten, wollte später nicht mit uns nach Vahnerow umziehen, er gehörte zum Schloss in Trieglaff. Außerdem konnten wir uns keinen Diener mehr leisten.
Wir Kinder aßen, bevor wir nicht perfekte Tischmanieren hatten, niemals mit den Erwachsenen zusammen. Der Tisch war mit einem weißen, zart gemusterten Damasttischtuch bedeckt, das jeden Sonntag gewechselt wurde. Die beim Frühstück und Abendessen verstreuten Krümelchen wurden mit einer kleinen polierten Metallschaufel und einer weichen Bürste entfernt. Erst wer sechs Jahre alt war und mit Messer und Gabel umgehen konnte, durfte am allgemeinen Mittagessen teilnehmen. Auf der Kinderseite musste aber noch lange ein weißes Wachstuch liegen – sonst hätte das Damasttuch schon Anfang der Woche gewechselt werden müssen. Wir frohlockten immer, wenn einer der Erwachsenen den ersten Fleck machte. Kinder mussten beim Essen schweigen, nur wer gefragt wurde, durfte sprechen. Eine strenge Regel, die bei den wenigsten Gutsfamilien in der Nachbarschaft üblich war.
Wann wir zum Abendessen mit den Erwachsenen zugelassen wurden, weiß ich nicht mehr. Normalerweise mussten wir vor- oder nachessen und am hinteren Ende des Tisches sitzen. Das war das dem Eingang gegenüberliegende Ende. Um halb acht sollten wir im Bett sein. Unser Vater war zu alt, um noch die kleinen Kinder der »zweiten Serie« bei Tisch ertragen zu können. Uns war es recht so.
Waren unsere Eltern abends nicht zu Hause, konnten wir etwas trödeln, und dann baten wir Wilhelm, »von früher« zu erzählen, von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, aber noch lieber vom Krieg. Und er erzählte von den Schützengräben, in denen der Dreck spritzte, wenn die feindlichen Granaten einschlugen, von den Angriffen der deutschen Soldaten und den Gegenangriffen der französischen, von Geschützdonner, Verwundeten und Toten. Die Dramatik von Wilhelms Schilderungen und unser gebanntes Zuhören sind mir deutlich in Erinnerung geblieben.
An der Südseite des Hauses hatten wir Kinder zwei große helle Spielzimmer, durch eine breite Türöffnung miteinander verbunden. Ein Gang und ein schmales Treppenhaus trennten sie von den Wohnräumen, sodass kein störender Lärm zu den Erwachsenen dringen konnte. In der Mitte des vorderen Zimmers stand ein runder Eichentisch auf einem dicken Mittelfuß, an den ich lange eine unangenehme Erinnerung hatte, weil er in einem mehrmals wiederkehrenden Traum eine Rolle spielte: Aus dem Mittelfuß wuchs ein gewaltiger Arm, und eine fleischige Hand griff nach mir. Anstatt aus dem Zimmer zu fliehen, lief ich um den Tisch herum, die Hand näherte sich bedrohlich, um mich zu packen – doch ehe sie mich erreichte, wachte ich entsetzt auf. Manchmal hatte ich Angst vor dem Einschlafen, weil ich mich vor diesem Traum fürchtete. Irgendwann träumte ich ihn nicht mehr.
Warum dieser Tisch nachts so bedrohlich werden konnte, verstehe ich bis heute nicht, denn wir saßen immer an ihm, wenn wir malten, spielten, bastelten, Bilderbücher ansahen. Unsere Spielzimmer waren bei Weitem nicht so voll, so überfüllt wie heutige Kinderzimmer – gefehlt hat uns aber nichts. Wir sahen niemals Spielzeuggeschäfte mit vollen Schaufenstern und Regalen, deren Angebote uns hätten verlocken können. Zu den Geburtstagen und zu Weihnachten bekamen wir die Geschenke, die von den Eltern (wahrscheinlich nur von unserer Mutter) ausgesucht worden waren. Erst in Vahnerow durften wir uns aus dem Katalog eines Stettiner oder Berliner Kaufhauses (Wertheim?) selbst etwas auswählen. Mona passte genau auf, dass wir nur billige und keine teuren Spielsachen ankreuzten und auf unsere Wunschlisten schrieben. Sie prüfte die Endsummen.
Meine Schwester Barbara (Baba) und ich besaßen viele Puppen. Eine begeisterte Puppenmutter wie Baba war ich jedoch nie. Ich ritt lieber auf meinem schwarz-weißen Schaukelpferd. Einige Puppen hatten Porzellanköpfe mit Glasaugen und beweglichen »Klimper«-Lidern, mit Kugelgelenken an Armen und Beinen, mit Stoff- oder Lederkörpern, andere waren aus Zelluloid. Natürlich gab es Bettchen und kleine Wagen, mit denen wir die Puppen im Park spazieren fahren konnten. Die kostbarsten Puppen, mit denen wir besonders achtsam umgingen, waren die Käthe-Kruse-Puppen. Schon damals, Ende der Zwanzigerjahre, waren sie so teuer, dass wir nur Puppen mit angemalten Haaren bekamen, keine mit Echthaarperücken. Mein liebster Puppenjunge hieß Pauli. So oft habe ich mit ihm gespielt, dass nach einigen Jahren trotz aller Vorsicht die hellbraune Farbe der Haare fast abgerieben war.
Ado hatte eine Dampfmaschine, an die über Treibriemen verschiedene Geräte angeschlossen werden konnten, unter anderem ein Hammerwerk, eine kleine Kreissäge, mit der wir Papierstückchen schnitten, ein Schaufelrad, das Wasser in kleine Eimer goss. Ein recht lärmendes, klapperndes, zischendes Spielzeug, faszinierend, wenn alle Maschinen in Betrieb waren. Und selbstverständlich hatte Ado einen Eisenbahnzug. Keinen elektrischen, sondern einen, dessen Lokomotive mit einem Schlüssel aufgezogen werden musste. Die Schienen waren in weiten Kurven auf dem Fußboden durchs Zimmer gelegt. Einmal habe ich nicht aufgepasst, bin gestolpert und so heftig mit dem linken Knie auf ein senkrecht stehendes Rädchen gefallen, das sich von einem Waggon gelöst hatte, dass die dünne Haut aufriss und die blanke Kniescheibe zu sehen war. Vor lauter Schreck habe ich nicht geweint und keinen Schmerz gespürt. Dr.Riebe, unser Hausarzt, musste aus Greifenberg kommen, um die klaffende Wunde zu nähen. Die Narbe ist noch heute auf meinem Knie zu sehen.
In der Türöffnung zwischen den Spielzimmern war eine Schaukel befestigt mit zwei Ringen, in die man ein Brett legen konnte. Ein beliebtes, aber gefährliches Spiel war es, sich die Seile mit den Ringen zuzuwerfen. Das spielten wir mit Vergnügen, bis mich eines Tages ein von Ado geworfener Ring am rechten Augenlid traf. Die Platzwunde blutete heftig, brauchte aber nicht genäht zu werden, ein Pflaster genügte. Nach diesem Unfall wurde die Schaukel abgeschraubt. Ein Wunder, dass man die Kindheit einigermaßen heil überlebt.
In einer Ecke stand ein kleines Pult für Ado und mich, an dem wir unsere Schularbeiten machten. Malen und zeichnen ließ sich auf der schrägen Platte besser als auf dem flachen Tisch. Ich malte gerne und habe dort oft gesessen. Am liebsten zeichnete ich natürlich Pferde, und meistens war ich zufrieden mit den Ergebnissen. Einmal hatte ich mir ganz besondere Mühe gegeben, weil ich das Bild verschenken wollte. Einen galoppierenden Rappen hatte ich gezeichnet und mit dicker Ölkreide das Fell schwarz gemalt. Vor dem Schlafengehen war ich gerade noch fertig geworden und ließ den Zeichenblock auf dem Pult liegen. Am nächsten Morgen im hellen Sonnenlicht sah ich, dass das Pferd lila und nicht schwarz war – bei der schlechten Beleuchtung hatte ich abends die Farben verwechselt. Ich habe das Blatt sofort in kleine Fetzen gerissen und in den Papierkorb geworfen, niemand sollte mein lila Pferd sehen und mich auslachen.
Waren wir jemals allein, uns selbst überlassen, in den Spielzimmern? Ich glaube nicht. Entweder beaufsichtigte uns das Kindermädchen oder das Kinderfräulein, beide waren zu unserer Betreuung da, hatten aber verschiedene Aufgaben. Sie hatten wohl genug zu tun, denn in achteinhalb Jahren wurden sechs Kinder geboren, von denen immer einige gewaschen, angezogen, auf den Topf gesetzt und gefüttert werden mussten.
Die Kindermädchen kamen aus dem Dorf und waren nach dem Schulabschluss vierzehn bis sechzehn Jahre alt. Sie waren vor allem für unsere Sauberkeit zuständig, beaufsichtigten uns, wenn wir im Park spielten, machten mit uns den langen und auf die Dauer langweiligen Spaziergang »um den See rum«. Das einzige Mädchen, an das ich mich undeutlich erinnere, war die blonde, rundgesichtige Gerda. Sie war gleichzeitig mit Inga, unserem ersten Kinderfräulein, bei uns.
Inga (Irmgard Meyer), achtzehn Jahre alt, hatte gerade ihre Ausbildung in Hannover als Kindergärtnerin abgeschlossen, als sie zu uns kam. Das war 1928. Sie wurde engagiert, weil die drei ältesten Kinder mehr brauchten als nur Betreuung und Aufsicht. Wir sollten lernen, was Kinder in der Stadt im Kindergarten lernen: kreatives Spielen, die Fantasie sollte angeregt werden beim Basteln und Malen. Tätigkeiten, zu denen unsere Mutter weder Talent noch Zeit hatte. Es sollte uns viel vorgelesen werden, akzentfrei und nicht im hinterpommerschen Platt, das die Hausmädchen sprachen. Niemand konnte uns so lebendig und dramatisch Geschichten erzählen und die Illustrationen in den Bilderbüchern so eindringlich beschreiben wie Inga. Hänschen im Blaubeerwald, Die Häschenschule, Die frohen Blumenkinder.
Von dem kleinen Gang vor den Kinderzimmern führte der eine Treppenlauf nach unten zum Nebeneingang für Lieferanten und dann ins Souterrain, der andere nach oben in den ersten Stock. Das ganze Haus war unterkellert. Die mächtigen Gewölbekeller aus Granit unter dem alten Haus stammten wahrscheinlich aus dem späten Mittelalter. Oft war ich nicht im Keller, was sollte ich da auch? In der Erinnerung sehe ich vor mir nur den dunklen Gang unter dem Neubau, der zur Küche führt. Hier saßen viele Frauen aus dem Dorf in einer langen Reihe auf Schemeln, hielten zwischen ihren Oberschenkeln die Gänse, die sie gerade abgestochen hatten, das Blut tropfte noch aus den Köpfen. Dann wurden die Gänse gerupft, die Frauen warfen die Federn je nach Größe in verschiedene Eimer. Später trafen sich die Frauen an Winterabenden zum Zerschleißen der großen Federn, nachdem sie den unbrauchbaren Federkiel herausgeschnitten haben. Dabei wurde geschwatzt und gesungen. Die groben Federn wurden zur Füllung von Polstermöbeln und festen Kissen verwendet; die feinen für Steppdecken, Kopfkissen und Plumeaus. Die meisten Federn wurden verkauft.
Alle oder fast alle Arbeiterfamilien besaßen Gänse, die an den Wegrändern, auf den gemähten Wiesen und auf den Stoppelfeldern fressen durften. Als Entgelt für diese freie Weide musste im Herbst, wenn die Gänse sich fett gefressen hatten, jedes siebente Tier »an die Herrschaft« abgegeben werden. Das qualvolle Stopfen der Gänse war offiziell verboten; ich vermute aber, dass es heimlich gemacht wurde. Die vielen Gänse wurden nicht nur im großen Gutshaushalt verbraucht. Ein Teil wurde an den Kaufmann Knoll in Greifenberg geliefert zum Verkaufen. Was nicht bald als Braten auf den Tisch kam, wurde eingepökelt. Eine besondere Delikatesse waren geräucherte Gänsebrust und geräucherter Magen, der fein gerieben aufs Butterbrot gestreut wurde. Ein Lieblingsgericht nicht nur unseres Vaters, sondern vieler Pommern, die auf dem Land wohnten, war das sogenannte Schwarzsauer, das aus den Innereien der Gänse, Hals, Beinen, Speck, Rosinen und anderen Zutaten bestand, die in einer schwarzen dicken Blutsauce schwammen, süß-sauer abgeschmeckt. Schon den Anblick dieses Gerichts fand ich ekelhaft. Eigentlich mussten wir Kinder »alles schweigend essen, was auf den Tisch kam«. Bei Schwarzsauer wurde jedoch eine Ausnahme gemacht, weil unsere Mutter diese pommersche Spezialität auch nicht mochte.
Noch eine Szene, die sich im Flur des Kellers abspielte, steht mir recht deutlich vor Augen: Ado, der mit dem Luftgewehr Zigeunerinnen verjagt.
Weil Ado auch einmal ein guter Jäger und Schütze werden sollte, bekam er spätestens mit fünf Jahren ein Luftgewehr, dazu eine Schachtel mit kleinen, bunt gefiederten Bolzen. Zum Üben eine Zielscheibe. Auf lebende Ziele durfte er mit diesem Gewehr natürlich nicht schießen.
Zigeunerfamilien zogen im Sommer mit ihren bunt bemalten, von kleinen Pferden gezogenen Wagen von einem Dorf zum anderen. Die Männer verdienten Geld als Scheren- und Messerschleifer und als Kesselflicker. Die Frauen verkauften Nähzubehör und lasen die Zukunft aus den Handlinien. Dunkelhäutig, schwarzhaarig und exotisch farbenfroh gekleidet, wirkten sie sehr fremd. Noch befremdlicher als ihr Aussehen war das, was von ihnen erzählt wurde: Sie würden Igel braten und essen, diese niedlichen und nützlichen Tiere, sie wären die geschicktesten Diebe, nichts wäre sicher vor ihnen und – sie würden Kinder stehlen! Und das, obwohl sie selbst zu viele hätten.
Wieder einmal waren sie in Trieglaff. Einige Frauen waren bis zum Nebeneingang des Schlosses gekommen und die Kellertreppe hinabgestiegen. Vergeblich hatte die Köchin versucht, sie zu vertreiben. Hatte sie Ado zu Hilfe rufen lassen? Hatte sie mich geschickt, ihn zu holen? War er zufällig in der Nähe? Jedenfalls war er da mit seinem Luftgewehr, hob es an seine Schulter und lief drohend auf die Zigeunerinnen zu, die schreiend flüchteten, ein kleines Stück noch von Ado verfolgt.
Hinter den Türen des Kellerflurs befanden sich die Vorratsräume, die Zentralheizungskessel und die Koksvorräte, die Küche, der Raum, in dem die Wäsche geplättet und gemangelt wurde. Ich sah den Mädchen gerne beim Plätten zu, ich mochte den feuchten Geruch, der von der frisch duftenden Wäsche aufstieg. Mit einer großen Kastenmangel wurde die über zwei Rollen gewickelte Bett- und Tischwäsche geglättet. Die Rollen wurden mit einem großen Schwungrad bewegt. Dieses drehten wir auch gerne, wenn die Mangel nicht benutzt wurde. Und schon wieder gab es einen Unfall, an dem Ado und ich beteiligt waren. Wir waren allein im Plättraum. Ich stand hinter der Mangel, hatte die Finger meiner linken Hand auf das untere Brett gelegt, Ado drehte das Rad, ich zog die Finger nicht rechtzeitig zurück, die Rolle walzte die Knochen platt. »Wie Löschpapier«, sagte unsere Mutter später. Dr. Riebe tröstete, die Knochen seien so weich, sie würden sich allmählich wieder runden. Das taten sie auch. Nur die Spitze des Zeigefingers blieb etwas schief.
Im Keller gab es keine Waschküche, obwohl Platz genug gewesen wäre. Ob der penetrante Seifengeruch die Hausherrin gestört hätte? Von der ersten Frau unseres Vaters hieß es, sie sei sensibel und zart gewesen. Jedenfalls wurde die Haushalts- und Leibwäsche nicht im Schloss gewaschen, sondern in einem eigenen Waschhaus außerhalb des Parks am nördlichen Ufer des Sees. Bei mindestens zwölf ständig im Haus lebenden oder tagsüber beschäftigten Personen kam im Laufe von zwei bis drei Wochen – öfter wurde nicht gewaschen – eine Menge schmutziger Wäsche zusammen. Sie wurde einen Tag lang eingeweicht, um die Stärke aus der Bett- und Tischwäsche, den Manschetten und Kragen der Herrenhemden zu lösen. Gewaschen wurde mit selbst gekochter und dann gehärteter Seife, für deren Zubereitung außer chemischen Zusätzen vor allem Fette benötigt wurden, unter anderem auch tote Ferkel. Die Waschfrauen – waren es vier oder mehr? – kamen aus dem Dorf. Vor dem Waschhaus führte ein Holzsteg zum See, in dem die Frauen die Wäsche spülten. Auf einer großen Wiese wurde sie dann zum Trocknen aufgehängt oder zum Bleichen aufs Gras gelegt. Schließlich wurde die trockene Wäsche in Körben auf Schubkarren zum Haus gefahren und in die Plättstube gebracht und dort schrankfertig gemangelt und geplättet. Vor und nach dem Waschen zählte die Hausfrau die Wäschestücke. Wo die Wäsche allerdings im Winter oder bei Regenwetter getrocknet wurde, weiß ich nicht.
Stieg man die hintere Treppe im Haus nach oben, kam man zu dem Korridor, an dem einige Gästezimmer, die Schlafzimmer der Kinder und des Kinderfräuleins lagen. In einem Zimmer standen die Betten der vier ältesten Kinder. Mona schlief vermutlich im Schlafzimmer der Eltern oder daneben im Ankleidezimmer.
Ich war, wie viele Kinder, eine Schlafwandlerin. Daran habe ich unangenehme, fröstelnde Erinnerungen. Mal lag ich auf dem kleinen Teppich neben dem Bett, mal zusammengekauert in einer Ecke auf dem Fußboden neben dem Wäschekorb. Ich wachte auf, wenn ich ganz durchfroren war und tastete mich in der Dunkelheit zurück zu meinem Bett.
Das Zubettgehen hatte immer denselben Ablauf: Baden – jeden Abend wurden wir gebadet, weil das in England üblich war –, Vorlesen, Nachtgebet. »Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm«. Ich habe keine besonderen Erinnerungen mehr daran.
Außer einer vielleicht: Wir waren an jenem Abend lauter als üblich, bewarfen uns vielleicht mit Kissen, als jemand hereinkam und uns zur Ruhe und Rücksicht ermahnte, weil unsere Mutter bald ein Baby bekommen würde. Da sah ich nun gar keinen Zusammenhang. Die Babys, hatte man uns immer erzählt, wurden von einem Engel gebracht (nicht vom Klapperstorch). Warum brauchte unsere Mutter Ruhe und Rücksichtnahme, sie brauchte das Baby doch nur vom Engel in Empfang zu nehmen? Außerdem, überlegte ich, von wem wusste sie überhaupt, dass ein Engel ihr ein Baby bringen würde? Welcher Bote hatte sie benachrichtigt? Ich habe aber nicht gewagt, einen Erwachsenen zu bitten, mir diese Fragen zu beantworten.
Am nächsten Morgen öffnete sich die Tür, und gegen das helle Licht stand eine Krankenschwester in gestreiftem Kleid und mit weißer Haube auf dem Kopf und zeigte uns das neue Baby. Besonders gefreut habe ich mich nicht. Wir waren doch schon fünf Kinder. Warum brachte der Engel denn schon wieder eines zu uns? Andere Familien hatten weniger Kinder und hätten vielleicht gerne eines mehr gehabt. Auf unseren Geburtsanzeigen stand immer die Formel: »Gottes Güte schenkte uns ei ne gesunde Tochter (einen gesunden Sohn)«.
Ich lebte in einer völlig abgeschirmten Welt. Die auf dem Land übliche sexuelle Aufklärung durch die Dorfkinder fand nicht statt, weil ich nie etwas mit Dorfkindern zu tun hatte. Am Sonntag verlas der Pastor von der Kanzel die Ereignisse der vergangenen Woche: Todesfälle, Krankheiten bei Gemeindemitgliedern, um deren Genesung gebetet wurde, und Geburten, und er dankte Gott, dass er der Mutter in ihrer schweren Stunde beigestanden hatte. »Die schwere Stunde« – warum schwer, wenn doch die Engel die Kinder brachten? Wer hätte mir die Wahrheit gesagt, wenn ich gefragt hätte? Nachdem ein Engel nun zum letzten Mal ein Baby zu uns gebracht hatte, habe ich über das Problem nicht weiter nachgedacht.
Wenn man das Schlafzimmer der Eltern betrat, in dem wir alle geboren worden sind, hatte man einen herrlichen Blick durch zwei große Rundbogenfenster über den See auf den bewaldeten Abhang am anderen Ufer und den Himmel. Das Zimmer war nicht groß. Die Ehebetten aus hellem Holz mit hohem Kopf- und Fußteil nahmen viel Platz ein; daneben standen die Nachttische. Die Nachttöpfe aus weißem Porzellan, tagsüber diskret hinter einem Türchen des Nachttisches versteckt, wurden abends vom Hausmädchen, das auch die Betten aufdeckte, unter die Betten gestellt. Es war ganz selbstverständlich, dass nicht die Benutzer, sondern die Hausmädchen die vollen Töpfe am Morgen leerten.





























