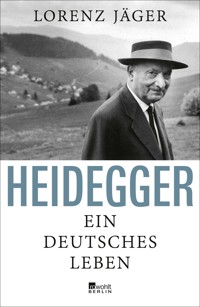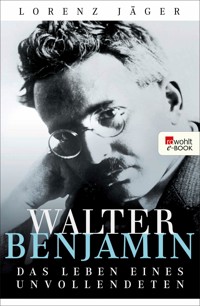
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Genie und Grenzgänger – Lorenz Jägers große Biographie Walter Benjamins Walter Benjamin wollte in keine Schublade oder philosophische Schule passen, sein Werk blieb unvollendet – und doch zählt er zu den einflussreichsten Denkern des 20. Jahrhunderts, Intellektuelle wie Adorno und Kracauer bewunderten ihn als Genie. Lorenz Jäger erzählt das Leben des außergewöhnlichen Literaten: Er schildert Benjamins Kindheit in der Familie eines jüdischen Kunsthändlers, die Studienjahre in Freiburg und Berlin, wo die so anregende Freundschaft mit Gershom Scholem begann, die wechselhafte Beziehung zur Frankfurter Schule. Benjamin reiste nach Moskau, wo er sich vorsichtig der kommunistischen Bewegung näherte; im Pariser Exil diskutierte er mit Hannah Arendt und arbeitete am großen «Passagen-Werk», das Fragment blieb. 1940 floh er vor der Gefahr, nach Deutschland ausgeliefert zu werden, in das spanische Portbou, wo er sich das Leben nahm – ein Ende, rätselhaft wie vieles in Benjamins Leben und Schreiben. Jäger vergegenwärtigt eindrucksvoll den Lebensweg Walter Benjamins – und zeichnet zugleich ein faszinierendes Zeitbild der ersten Jahrhunderthälfte, vom arrivierten Berliner Judentum über die Intellektuellenkreise der Weimarer Republik bis zu den Schrecken des Exils und der Verfolgung. Eine hochspannende Biographie, die Leben und Werk dieses großen Denkers neu erschließt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Lorenz Jäger
Walter Benjamin
Das Leben eines Unvollendeten
Über dieses Buch
Genie und Grenzgänger – Lorenz Jägers große Biographie Walter Benjamins
Walter Benjamin wollte in keine Schublade oder philosophische Schule passen, sein Werk blieb unvollendet – und doch zählt er zu den einflussreichsten Denkern des 20. Jahrhunderts, Intellektuelle wie Adorno und Kracauer bewunderten ihn als Genie. Lorenz Jäger erzählt das Leben des außergewöhnlichen Literaten: Er schildert Benjamins Kindheit in der Familie eines jüdischen Kunsthändlers, die Studienjahre in Freiburg und Berlin, wo die so anregende Freundschaft mit Gershom Scholem begann, die wechselhafte Beziehung zur Frankfurter Schule. Benjamin reiste nach Moskau, wo er sich vorsichtig der kommunistischen Bewegung näherte; im Pariser Exil diskutierte er mit Hannah Arendt und arbeitete am großen «Passagen-Werk», das Fragment blieb. 1940 floh er vor der Gefahr, nach Deutschland ausgeliefert zu werden, in das spanische Portbou, wo er sich das Leben nahm – ein Ende, rätselhaft wie vieles in Benjamins Leben und Schreiben.
Jäger vergegenwärtigt eindrucksvoll den Lebensweg Walter Benjamins – und zeichnet zugleich ein faszinierendes Zeitbild der ersten Jahrhunderthälfte, vom arrivierten Berliner Judentum über die Intellektuellenkreise der Weimarer Republik bis zu den Schrecken des Exils und der Verfolgung. Eine hochspannende Biographie, die Leben und Werk dieses großen Denkers neu erschließt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung akg-images
ISBN 978-3-644-12131-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Nora
Kapitel IDas verbotene Zimmer: Benjamins Herkunft
Mein guter Vater war in Paris gewesen.
Karl Gutzkow, Briefe aus Paris, 1842,
von Benjamin zitiert 1935
«In einer großen, alten Stadt lebte einmal ein Kaufmann. Sein Haus stand in einem der allerältesten Stadtteile, in einem engen schmutzigen Gässchen. Und in dieser Gasse, wo schon alle Häuser so alt waren, dass sie nicht mehr allein stehen konnten und sich alle an einander anlehnten war das Haus des Kaufmanns das älteste. Es war aber auch das größte. Mit seinem mächtigen gewölbten Türbogen und den hohen und bogigen Fenstern mit den halberblindeten Butzenscheiben, mit dem steilen Dach, in dem eine ganze Anzahl schmaler Fensterchen angebracht waren sah es recht seltsam aus – das Haus des Kaufmanns, das letzte Haus in der Mariengasse. Es war eine fromme Stadt und viele Häuser hatten in schönem Schnitzwerk das Bildnis der heiligen Jungfrau oder irgend eines Heiligen über der Haustür oder am Dache angebracht. Auch in der Mariengasse hatte jedes Haus seinen Heiligen – nur das des Kaufmanns stand kahl und grau, ohne Schmuck da.»[1]
So beginnt der früheste Text, der von Walter Benjamin überliefert ist, er wurde nicht vor 1906 geschrieben. Benjamin mag damals vierzehn Jahre alt gewesen sein. Ein Kaufmann in betont christlicher Umwelt, eine gewisse kulturelle Differenz sieht man akzentuiert. Der Kaufmann wird wohl ein Fremder dem Glauben nach sein, denn obwohl er in der frommen Mariengasse lebt, vermeidet sein Haus den Schmuck mit Heiligenfiguren. Das Haus fällt auf, es ist «seltsam». Und auch sein Eigentümer fällt aus dem gewohnten Kreis der Stadt heraus: «Der Kaufmann war kein gewöhnlicher Krämer, bei dem die Leute ihre Kleider und ihre Gewürze einkauften – nein! Er verkehrte nicht einmal mit den armen einfachen Bewohnern der Gasse. Tagaus tagein saß er in seiner großen Rechenstube mit den hohen Schränken und den langen Regalen und buchte und rechnete. Denn sein Handel erstreckte sich weit über das Meer, in ferne, entlegene Länder» – also womöglich in die Levante oder nach Spanien und Portugal. In einer Umwelt, die durch ihr Alter ausgezeichnet ist und in traditionellen Bahnen ihren Handel betreibt, vertritt dieser Kaufmann ein anderes Prinzip, das internationale, das des Fernhandels im großen Stil, durch den exotische Waren ins Land kommen. Damit wird das Jüdische angedeutet.[2]
Mit welchen Waren der Kaufmann handelt, erfahren wir nicht – nur dass er in seiner Tätigkeit ganz aufgeht, Kalkulation ist sein Leben. Abstrakt und monumental wird ein großer jüdischer Händler skizziert. Nun biegt die Geschichte ins Märchen- und Rätselhafte ab. In dem Haus nämlich lebt ein Mädchen: «Das Mädchen war nicht seine Tochter, aber es lebte bei ihm, er zog es auf und das Kind half in der Wirtschaft. Wie es aber in des Kaufmanns Haus gekommen war, das wusste niemand so recht.»
Die Herkunft des Mädchens ist nur der erste Teil des Rätsels. Der zweite weckt keine guten Ahnungen, er klingt nach dem bösen Ritter Blaubart und nimmt das alte Motiv des verbotenen Zimmers auf: «Eines Tages stand der Kaufherr wieder vor dem Mädchen und sagte ihr, er müsse wiederum auf einige Zeit die Heimat verlassen. ‹Ich weiß nicht, wann ich wieder zurückkehren werde sprach er. Sorge du wieder, wie früher für das Haus – aber, unterbrach er sich, ich sehe du bist jetzt groß genug, du kannst in meiner Abwesenheit nach deinem Willen im Hause walten. Hier nimm die Schlüssel.› Das Mädchen, das bisher schweigend vor ihm gestanden hatte und mit großen Augen die fremden bunten Blumen betrachtet hatte, die auf das Gewand des Kaufherrn gestickt waren, blickte empor und nahm die Schlüssel. Da plötzlich sah der Kaufherr sie streng an. Dann sprach er in scharfem Ton: ‹Du weißt wohl, dass du die Schlüssel nur für die Wirtschaftszimmer benutzen darfst. Lass dich nie versuchen, in das obere Stockwerk hinaufzusteigen. Verstehst du?› Schüchtern bejahte das Mädchen. Dann beugte der Kaufmann sich zu ihr nieder, küsste sie, blickte sie noch einmal durchdringend an, dann stieg er die Treppe hinunter und verließ das Haus. Hinter ihm fiel die Haustür dröhnend ins Schloss. – Immer noch stand das Mädchen träumend an der Treppe und betrachtete den großen Bund altertümlicher Schlüssel, den sie in der Hand hielt.»
Hier endet das Fragment. Der Kaufmann, eine bestimmende Macht, hinterlässt ein Rätsel. Das Mädchen kann das Rätsel nicht lösen, nur darüber nachgrübeln; es kann nur betrachten, und es betrachtet die Dinge mehr als den Menschen.
«Ich bin am 15. Juli 1892 in Berlin als Sohn des Kaufmanns Emil Benjamin und seiner Frau Pauline, geb. Schoenflies geboren. Beide Eltern sind am Leben. Ich bin mosaischer Konfession.»[3] Das Rätsel des Novellenfragments ist Benjamins eigenes. Emil Benjamin (1858 bis 1926) hatte ursprünglich eine Banklehre gemacht und war für einige Jahre in Paris in einer Bank tätig gewesen. Später wurde er Teilhaber von «Rudolph Lepke’s Kunst-Auctions-Haus», einer der maßgeblichen Adressen des Berliner Kunsthandels, begründet hatte die Kunsthandlung schon Rudolph Lepkes Großvater Nathan Levi Lepke. Nach 1900 – das genaue Datum ist nicht feststellbar – verkaufte Emil Benjamin seine Anteile. Der Großvater väterlicherseits, Bendix Benjamin, geboren 1818, gestorben 1885, war zuletzt «Rentier»[4], vorher als Kaufmann tätig; in welcher Branche, lässt sich nicht mehr ermitteln. Der Urgroßvater Elias (später Emil) Benjamin, geboren 1769, gestorben 1835, aus wohlhabender Kaufmannsfamilie stammend, war Detailtuchhändler.[5] Der Großvater mütterlicherseits, Georg Schoenflies, war Tabak- und Zigarrenfabrikant.
Die Tätigkeit von Emil Benjamin muss uns interessieren, insofern sie dem Kunsthandel galt, der Kaufmannsberuf aber war zu dieser Zeit für deutsche Juden typisch. So schildert es Gershom Scholem in seiner Analyse der jüdischen Berufsstatistik: «Im Jahre 1907 waren von 100 Erwerbstätigen etwas über 50 Prozent im Handel und 21 Prozent in der Industrie tätig, dagegen damals immer nur noch etwa 7 Prozent in den freien Berufen, 1,5 Prozent in der Landwirtschaft, Tierzucht und Gärtnerei; fast 20 Prozent erklärten sich als Rentiers oder machten kein Berufsangabe – ein erstaunlich hoher Prozentsatz, zu dem man wohl die mit Finanzgeschäften, lies: Wucher, sich Befassenden zählen muss, die sich scheuten, ihre Geschäfte klar zu bezeichnen.»[6]
Benjamin selbst hat von einem Rätsel des Vaters gesprochen. In den autobiographischen Aufzeichnungen der «Berliner Chronik» heißt es dazu: «Die ökonomische Basis auf der die Wirtschaft meiner Eltern beruhte, war lange über meine Kindheit und Jugend hinaus von tiefstem Geheimnis umgeben.» Sein Vater habe an sich «die unternehmende Natur des großen Kaufmanns» gehabt. «Ungünstige Einflüsse verschuldeten, dass er sich viel zu früh von einem Unternehmen zurückzog, das seinen Fähigkeiten wahrscheinlich gar nicht schlecht entsprochen hat: dem Kunstauktionshaus von Lepke, das damals noch in der Kochstraße lag und an dem er Teilhaber war.» Nachdem er seine Anteile an Lepkes Unternehmen abgegeben hatte, sei der Vater «mehr und mehr zu spekulativen Anlagen seiner Gelder gekommen». Bezeichnend ist, dass Benjamin seinem Vater die unternehmende Natur des «großen Kaufmanns» zuspricht, und fast mag man einen leisen Vorwurf heraushören, wenn dann von den spekulativen Geldanlagen die Rede ist, die eine weitere kaufmännische Aktivität nicht mehr zu erfordern schienen.[7]
Walter Benjamin mit seinem jüngeren Bruder Georg und den Eltern, Pauline und Emil Benjamin.
Wenn es stimmt, dass Söhne dazu neigen, einen Beruf zu wählen, der es ihnen erlaubt, in das Geheimnis des Vaters einzudringen – so deuten wir Freuds These vom Ödipuskomplex für unsere Zwecke um –, dann war die Lösung aller Rätsel des Kaufmannsberufes das, was Benjamins Lebenswerk ausmachte. Sein Freund, der Philosoph Ernst Bloch, hat Benjamins Buch «Einbahnstraße» so charakterisiert: «Hier war eine (…) Ladeneröffnung von Philosophie mit den neuesten Frühjahrsmoden der Metaphysik im Schaufenster.»[8] Und der Zusammenhang – oder der Kontrast – zwischen dem Kaufmannshaus der Erzählung und den «frommen» Nachbarn kehrt wieder in Benjamins Überlegungen zu «Kapitalismus als Religion»: «Vergleich zwischen den Heiligenbildern verschiedner Religionen einerseits und den Banknoten verschiedner Staaten andererseits. Der Geist, der aus der Ornamentik der Banknoten spricht. Kapitalismus und Recht.»[9] Das Thema zieht sich durch Benjamins Werk – bis hin zur spätesten Epoche, in der Charles Baudelaire als Dichter in der Warenwirtschaft dargestellt wird.
Emil Benjamin war aber nicht nur im Kunsthandel tätig und muss insofern ein kennerschaftliches Urteil besessen haben, sondern er hatte auch andere kulturelle Interessen, wie Scholem überliefert: «Schon früh scheint er eine größere Autographensammlung angelegt zu haben, von der mir Walter Benjamin mehrfach erzählte. Er besaß darunter als besondere Kostbarkeit einen großen Brief von Martin Luther.»[10] Emils Schwester wiederum, Benjamins Tante Friederike, war «eine der ersten Graphologinnen, die bei Crépieux-Jamin studiert hatte, und offenkundig war sie es, die Benjamins graphologisches Interesse angeregt und befördert hat».[11]
Wir können uns nun die Familienkommunikation vorstellen, soweit sie sich aus dem Beruf und der Lebensgeschichte des Vaters ergab: Dabei müssen einerseits kaufmännische Fragen, andererseits künstlerische und vielleicht schon kunsttheoretische das Thema gewesen sein – Fragen nach Original, Kopie, Fälschung und Reproduktion, ja nach der später sehr berühmten «Aura» des Werks, wie sie einem Auktionator nahe genug liegen. So jedenfalls sah es Benjamins Cousin, der Philosoph Günther Anders, der sich kritisch und etwas spöttisch über die Aura äußerte: «Der Gedanke kommt aus dem Auktionshaus Lepke, dessen Miteigentümer B.’s Vater war; denn er behauptet, dass ein Produkt keine Reproduktion sei, nein: dass ihm diese Nichtreproduzierbarkeit unmittelbar angesehen werden könne.»[12] Unausgesprochen mögen die Handschriftensammlung des Vaters und die graphologische Passion der Tante Fragen nach dem Verhältnis von Schrift und Bild, nach dem Vordringen der Schrift ins Bild und nach ihrem eigenen Bildcharakter im jungen Walter Benjamin aufgeworfen haben – in jedem Fall lagen die Elemente bereit, wenn auch noch isoliert, die später, in dem Buch «Ursprung des deutschen Trauerspiels», zu einer ganzen Theorie der Schrift im Barock wurden.
Schließlich mag die Sammlung des Vaters (und sein berufsbedingter Umgang mit Sammlern) der Ausgangspunkt gewesen sein nicht nur für Benjamins eigene Sammelleidenschaft, sondern auch für seine theoretische Beschäftigung mit der Figur des Sammlers, der im späten «Passagenwerk» ein ganzes Notizenkonvolut gewidmet ist. Adorno hatte etwas davon bemerkt, als er die äußere Erscheinung seines Freundes schilderte: «Sein Gesicht war eigentlich sehr ebenmäßig geschnitten. Er hatte aber zugleich etwas – wiederum ist es schwer, dafür ein richtiges Wort zu finden – von einem Tier, das in seinen Backen Vorräte sammelt.»[13]
In der Familie muss auch über Paris immer wieder gesprochen worden sein: die Stadt, in der der Vater seine ersten Berufserfahrungen gesammelt hatte. Sie wurde später mehr und mehr zu Benjamins Lebensthema: «Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts», «Paris, capitale du XIXe siècle» lauten die Exposétitel des unvollendet gebliebenen Buches, das wir als Fragmentensammlung des «Passagenwerks» kennen. Die Hauptstadt des neunzehnten Jahrhunderts ist die Stadt des Vaters.
Kehren wir noch einmal zu dem Erzählungsfragment zurück. Dem Mädchen wird vom Kaufmann zugestanden, im Hause zu «walten». «Walten» bedeutet nach dem Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm «Macht über etwas haben, regieren, besitzen, sich einer Sache annehmen». Das Wort stammt vom althochdeutschen «waltan» (herrschen) ab – und der es aufschreibt, heißt «Walter», der Name hat den gleichen Ursprung. Auch «Gewalt» führt auf diese Wurzel. Benjamin hatte zwei weitere Vornamen: Benedix und Schönflies. Der erste geht auf den Großvater väterlicherseits zurück, der zweite auf den Mädchennamen der Mutter – Pauline Schoenflies.
Walter Benjamin war der Älteste von drei Geschwistern. Sein Bruder Georg, geboren 1895, und seine Schwester Dora, geboren 1901, wählten später ebenfalls eine akademische Karriere, Georg als Mediziner (promoviert mit der Arbeit «Über Ledigenheime»), Dora als Wirtschaftswissenschaftlerin (promoviert mit der Arbeit «Die soziale Lage der Berliner Konfektionsarbeiterinnen»), beide waren in der politischen Linken engagiert. Keines der Geschwister erreichte das fünfzigste Lebensjahr: Georg wurde 1942 im KZ Mauthausen ermordet, Dora starb 1946 in der Schweiz an Krebs.
Auffällig ist, dass die Geschwister in Benjamins autobiographischer «Berliner Kindheit» keine Rolle spielen. Nur in einem Angsttraum taucht die Schwester auf, und auch hier nur als Abwesende. Das Stück handelt vom Mond: «Hoch überm Horizont, groß, aber blass, stand er am Himmel (…) über den Straßen von Berlin. Es war noch hell. Die meinigen umgaben mich, ein wenig starr, wie auf einer Daguerreotypie. Nur meine Schwester fehlte. ‹Wo ist Dora?› hörte ich meine Mutter rufen. Der Mond, der voll am Himmel gestanden hatte, war plötzlich immer schneller angewachsen. Näher und näher kommend, riss er den Planeten auseinander.»[14] Wir müssen uns schon den jungen Walter Benjamin als einen innerlich einsamen Menschen vorstellen.
Während der namenlose Kaufmann der einleitenden Erzählung Abstand zu den christlichen Heiligenfiguren der Nachbarschaft hält, war Benjamins Familie assimiliert. Man feierte Weihnachten, obwohl Christi Geburt an sich für Juden kein Fest sein kann. Vielfach erwähnt die «Berliner Kindheit» das Weihnachtsglück des Beschenkten, und dabei treffen wir ein erstes Mal auf einen Engel. Engel haben Benjamin sein Leben hindurch begleitet, vor allem in Gestalt von Paul Klees kolorierter Zeichnung «Angelus Novus». «Dann fiel mir wieder die Bescherung ein, die meine Eltern eben rüsteten. Kaum aber hatte ich so schweren Herzens, wie nur die Nähe eines sichern Glücks es macht, mich von dem Fenster abgewandt, so spürte ich eine fremde Gegenwart im Raum. Es war nichts als ein Wind, so dass die Worte, die sich auf meinen Lippen bildeten, wie Falten waren, die ein träges Segel plötzlich vor einer frischen Brise wirft: ‹Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind› – mit diesen Worten hatte sich der Engel, der in ihnen begonnen hatte, sich zu bilden, auch verflüchtigt. Doch nicht mehr lange blieb ich im leeren Zimmer. Man rief mich in das gegenüberliegende, in dem der Baum nun in die Glorie eingegangen war, welche ihn mir entfremdete, bis er, des Untersatzes beraubt, im Schnee verschüttet oder im Regen glänzend, das Fest da endete, wo es ein Leierkasten begonnen hatte.»[15]
In das Weihnachtsglück mischt sich ein Gefühl der Entfremdung und die Traurigkeit. So unproblematisch, wie die Generation der Eltern die Assimilation praktiziert hatte, konnte es nicht bleiben. Benjamins Generation stellte schärfere Fragen, und sie musste es tun. Denn was hieß es, 1892 geboren worden zu sein? In diesem Jahr kamen zur Welt: Martin Niemöller, der 1937 ins KZ kam, und Engelbert Dollfuß, der 1934 von österreichischen Nationalsozialisten ermordet wurde, nachdem er zuvor den alternativen «Austrofaschismus» begründet hatte. Es wurden geboren der antikommunistische spanische Generalissimus und Diktator Francisco Franco und der kommunistische jugoslawische Partisanenführer und Diktator Josip Broz Tito. Es wurden geboren Robert H. Jackson, Ankläger bei den Nürnberger Prozessen, und der von ihm zum Tode verurteilte Arthur Seyß-Inquart, «Reichskommissar» der besetzten Niederlande. Der Dichter Josef Weinheber, der sich am 8. April 1945 aus Verzweiflung über die deutsche Niederlage das Leben nahm, und der Dichter Richard Huelsenbeck, der die Dada-Bewegung mitbegründet hatte. Der polnische Schriftsteller Bruno Schulz, der 1942 von einem SS-Mann erschossen wurde, und Oswald Pohl, einer der Organisatoren des Holocaust. Der SA-Führer Gregor Strasser, den Hitler 1934 liquidieren ließ, und der Schriftsteller Theodor Plievier, der im sowjetischen Exil den Roman «Stalingrad» verfasste. Fügen wir noch jene hinzu, die Benjamin als geistige Peergroup betrachten konnte: Erich Auerbach, Adrienne Monnier, Erwin Panofsky und Helmuth Plessner.
Es war ein Jahrgang, der sich wie kaum je ein anderer spätestens mit dem Erreichen der lebensgeschichtlichen Reife, mit etwa vierzig Jahren, also mit vollem Bewusstsein und ausgebildeter Gestaltungsfähigkeit, vor den Zwang zur Entscheidung gestellt sah. Die Zwischenkriegszeit war in Mittel- und Westeuropa geprägt von wirtschaftlicher wie politischer Instabilität, von faschistischen (wie in Italien) oder mindestens autoritären Regimen, zudem von vielfachen ungelösten Grenzfragen. Von der Zeit zwischen 1914 und 1945 spricht die Geschichtswissenschaft häufig als von einem «zweiten Dreißigjährigen Krieg». Benjamins Entscheidungen in jeder Lebensepoche nachzuzeichnen – die religiösen, die philosophischen, die ästhetischen und die politischen – darum wird es auf diesen Seiten gehen.
Ein letztes Mal wollen wir auf das Mädchen und den Kaufmann unserer Geschichte schauen und auf das Blaubart-Motiv des verbotenen Zimmers. Im Märchen vom Blaubart bilden alle Beteiligten einen familiären Zusammenhang: Die junge Frau ist mit Blaubart verheiratet, sie hat Eltern, Schwestern und Brüder. In Benjamins Variante (wenn wir sie nun so nennen dürfen) ist alles Familiale gestrichen, das Verhältnis der Menschen zueinander bleibt rätselhaft. Obwohl zusammen, sind sie einsam.
In der Version von Ludwig Bechstein heißt es in dem Märchen: «Nach einer Zeit sagte der Ritter Blaubart zu seiner jungen Frau: ‹Ich muss verreisen, und übergebe dir die Obhut über das ganze Schloss, Haus und Hof, mit allem, was dazu gehört. Hier sind auch die Schlüssel zu allen Zimmern und Gemächern, in alle diese kannst du zu jeder Zeit eintreten. Aber dieser kleine goldne Schlüssel schließt das hinterste Kabinett am Ende der großen Zimmerreihe. In dieses, meine Teure, muss ich dir verbieten zu gehen, so lieb dir meine Liebe und dein Leben ist. Würdest du dieses Kabinett öffnen, so erwartet dich die schrecklichste Strafe der Neugier. Ich müsste dir dann mit eigner Hand das Haupt vom Rumpfe trennen!›» Blaubart reist ab, natürlich siegt die Neugier über das Verbot: «Und so wurde der Schlüssel mit einigem Zagen in das Schloss gesteckt, und da flog auch gleich mit dumpfem Geräusch die Türe auf, und in dem sparsam erhellten Zimmer zeigten sich – ein entsetzlicher Anblick! – die blutigen Häupter aller früheren Frauen Ritter Blaubarts, die ebensowenig, wie die jetzige, dem Drang der Neugier hatten widerstehen können, und die der böse Mann alle mit eigner Hand enthauptet hatte.»[16]
Das Wort, das in Benjamins Geschichte nicht fällt, obwohl es jedem Leser auf der Zunge liegen muss, der sich fragt, was es mit dem verbotenen Zimmer auf sich hat, heißt: Leiche. Es wird nicht ausgesprochen, es staut sich, und eines Tages wird es so stark, dass es den Damm bricht und ganze Textpassagen überschwemmt. Das ist der Augenblick, da Benjamin sich (Jahre später) den barocken Trauerspielen widmet, die «mit blassen Leichen prangen».[17]
Kapitel IIIWalter und der Zauberer: Fragen nach dem Judentum
Und er sagte: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker; damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht.
Jesaja 49,6
A