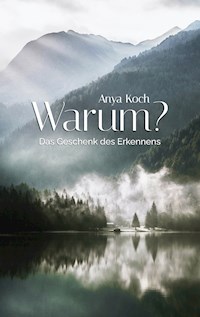
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Kriegskind geboren, lernte ich als kleines Mädchen mit Unterstützung einiger mir in Liebe zugetaner, lebenskluger Menschen, mich aus den Wirren der Kriegs- und Nachkriegszeit in eine Zuversicht versprechende, sich fundamental neu formierende deutsche Gesellschaftsordnung hinein zu orientieren. Während aller folgenden Lebensjahre übte ich mich in meiner damaligen fundamentalen Lernaufgabe: In Selbstvertrauen und entsprechendem Streben nach Selbstermächtigung meine persönlichen Lebensvorstellungen zu realisieren – für mein Kind zu sorgen. Meine erkenntnisfreudige Weltoffenheit führte mich unter anderem zu der mich beeindruckendsten Erkenntnis: Ich bin eine Indoeuropäerin! Im letzten Kapitel beschreibe ich daher diese vor Jahrtausenden beginnende kulturelle Völkervermischung zwischen Alteuropa und Vorderasien. Mich beschäftigt dabei die Frage: „Wie gehen wir als inzwischen global vernetzte Gesellschaften mit den zum Beispiel aktuellen weltweiten Problembereichen „ Erderwärmung“, „Anti-Atom-Bewegung“ und „Sozialgeschlecht“ um?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Vater evangelisch, Mutter katholisch
Maikäfer, flieg, dein Vater ist im Krieg …
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten …
Der schwarze Vorhang
Wohin führt mich die Melodie?
Junge, alleinstehende Frau mit Kind
Trotz alledem …
Das Geschenk des Erkennens nicht aus dem Auge verlieren
Vorwort
Soweit ich mich erinnern kann, hat meine Lebensneugierde mich bereits als kleines Mädchen in mentaler Wachheit meinem Lebensumfeld begegnen lassen.
Im Laufe meiner Entwicklung ins Erwachsensein (bis in mein derzeitiges Alter von 82 Jahren) hat mir diese Motivation eine gewisse geistige und körperliche Lebendigkeit bewahrt. Ebenso wurde mir in meinen Kinderjahren ein innerer behütender Rückzugsort geschenkt: mein Heimatgefühl. Ja, durch meine kindliche Einbindung in eine fürsorgliche, verständnisvolle Erziehung einiger naher, liebevoller Familienmitglieder. In Verbindung mit dem Wohnen in einem das Gefühl von Geborgenheit vermittelnden alten Fachwerkhaus, wo Menschen und Nutztiere jeweils ihren vertrauten Platz hatten. Eingegliedert in einer aufeinander bezogenen Dorfgemeinschaft. Umgeben von einer Mittelgebirgslandschaft mit tiefen Buchen- und Tannenwäldern. Mein Leben in Naturbezogenheit.
Wenn ich in meinen späteren Erwachsenenjahren Sehnsucht nach innerer Befriedung verspürte, trachtete ich danach, die Naturorte meiner Kindheit aufzusuchen. Dort würde ich die ursprünglichen Quellen meiner Lebenszuversicht wieder auffüllen können.
Im Laufe meiner zunehmend nach eigenverantwortlichem Handeln orientierten Erwachsenenjahre verstärkte sich in der Auseinandersetzung mit einigen kirchlichen Glaubensthesen (mit dem daraus oftmals erwachsenen kirchlichklerikalen Herrschaftsanspruch an mich) meine bewusstseinserweiternde Sensibilität für meine Teilhabe an der Vielgestaltigkeit des Universums.
Wir Menschen (und auch die Tiere) sind in ständige Wechselwirkungsprozesse des Universums eingebunden. Ich, als lediglich ein »Klick« in der seit Jahrtausenden sich vorwärtsentwickelnden menschlichen Generationskette, bin doch andererseits auch ein aktives Bindeglied in den durch steten Überlebenskampf und Daseinsgestaltungsdrang hervorgebrachten, sich immer wieder neugestaltenden unterschiedlichen Kulturräumen.
Aus diesem Bewusstsein der globalen Vielgestaltigkeit heraus habe ich auch im Umgang mit Menschen anderer Kulturzugehörigkeit souveräne Toleranz zu üben gelernt. Meine Achtung vor ihrem Wissenshorizont. So erweiterte sich durch mein Interesse an fremden Kulturen mein Verständnis für das »Fremde« – und meine eigene Lebensgestaltung wurde dadurch »farbiger«!
In der Begegnung mit Menschen generell sollte einem die innere Haltung von Offenheit und Einfühlsamkeit als »Urbedürfnis« jeder Menschseele bewusst werden: »Ich möchte nicht allein sein!« Aber: Ich habe auch mein inneres Universum vor der Übergriffigkeit anderer zu verteidigen und zu schützen.
Eugen Drewermann beschreibt in seinem Buch über den souveränen Dichter und Denker Giordano Bruno (G. Bruno wurde im Jahr 1600 in Rom als »Ketzer« verbrannt) dessen humanistisches Menschenbild: »Jeder Mensch hat so viel Freiheit, wie er in sich und um sich herum spürt.«
Im Hinblick auf meine Schreibmotivation hatte ich mit 11 Jahren einen besonderen Traum, welcher mir im Laufe meines Lebens immer wieder ins Bewusstsein trat:
Ein Mann mittleren Alters, ein schmales Gesicht mit durchgeistigt strengem Gesichtsausdruck – ähnlich wie das Gesicht vom »Geistkämpfer«, einer Bronzeplastik von Ernst Barlach – unter einem großen schwarzen Schlapphut, in einem vornehmen schwarzen Anzug, hält mir mit einem geradezu zwingenden Blick ein leeres Blatt Papier entgegen. Ich wachte auf und war zunächst ziemlich verwirrt über diese Botschaft. Weil aber schon des Öfteren aus den Tiefen meines Bewusstseins Gedanken aufstiegen, welche mich geradezu befeuerten, sie niederzuschreiben, erschien mir diese Empfehlung, das leere Blatt mit meinen Niederschriften zu füllen, letztlich nicht fremd.
Nach ereignisreichen, keineswegs geruhsamen – durch ambivalente Lebenssituationen oftmals auch bis an den Rand von Verzweiflung bzw. Erschöpfungszuständen – durchkämpften Lebensjahren werde ich nunmehr versuchen, mein Leben niederzuschreiben.
Schau in den Spiegel –
Sieh deinem inneren Kind in die Augen!
Erspüre dein Werden
Im lebenspulsierenden Sein des Ichs.
Glück und Schmerz –
Welche Botschaft hält deine innere Stimme bereit?
Vater evangelisch, Mutter katholisch
Das Leben meines Vaters (1906 geboren) war von seiner Kindheit an durch die Auswirkungen ideologischer Anpassungsimperative des Ersten und Zweiten Weltkrieges beeinflusst. In seinem persönlichen Umfeld prägte ihn natürlich während der Zeit seines Heranwachsens die Notwendigkeit materieller Bescheidenheit einer Handwerkerfamilie, die zudem in die Abhängigkeit der zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch patriarchal ausgerichteten dörflichen Wertegemeinschaft eingebunden war. Mein Großvater als selbständiger Schneidermeister erwartete von meinem Vater als seinem ältesten Sohn, dass er ebenfalls das Schneiderhandwerk erlernen würde, konnte ihn aber nicht dazu überreden. So folgte der jüngere Bruder meines Vaters der Familientradition.
Ich kann mich an meine Aufenthalte bei meinen Großeltern ab meinem dritten Lebensjahr erinnern. Mein Großvater saß mit meinem Onkel in der Schneiderstube im Schneidersitz auf dem Schneidertisch. Sie nähten Anzüge, Mäntel, Jacken. Oft hockte ich auf einem Schemel vor dem Tisch und versuchte unter Anleitung meines Großvaters, Kleider und Mäntel für meine Puppen zu entwerfen und zu nähen. So lernte ich ebenfalls Grundzüge der Schneiderei.
Meine Großeltern lebten in einer von evangelischem Reformgeist geprägten Gegend. Das vom Großvater erbaute geräumige Fachwerkhaus stand auf einem Berg über dem Dorf in Gemeinschaft mit zwei weiteren Häusern. Ich hielt mich dort oben gerne auf, weil mich hinter den Häusern die Feldmark mit ihrer spezifischen Tierwelt, das daran anschließende weitläufige Waldgebiet zu Erkundungsausflügen lockte. Diese kindlich-sinnliche Erfahrungswelt prägte mich: Im Wald, in der Einsamkeit der Natur, regeneriert sich immer noch meine innere Kraft und Lebenszuversicht. Wie bereits erwähnt, war das Familienleben wie auch der tägliche Arbeitsablauf in der Schneiderwerkstatt eingebunden in von Generation zu Generation weitervermittelten Umgangsformen der Dorfgemeinschaft und ihrer Traditionspflege. Mein Opa als Familienvorstand, die Alten, der Pastor, der Lehrer, der Bürgermeister – sie alle erwarteten als Respektpersonen das Sich-Unterordnen bzw. Sich-Einfügen. Männer, Frauen, Kinder hatten sich am patriarchalen Gesellschaftsbild zu orientieren. Bis weit in die Nachkriegszeit hinein war es in den Familien üblich, dass bei den gemeinsamen Mahlzeiten zunächst der Vater bedient wurde und das größte Stück Fleisch bekam. Ja, das Sich-Einfügen: »Das Leben ist so, wie es zu sein hat.« Individuelle »Ausfallschritte« im Sinne von Nichtbeachtung dörflicher Anstands- und Moralvorgaben würden mit nachbarschaftlicher Ausgrenzung beantwortet. Es sei denn, man wäre schlitzohrig genug, insgeheim Wünsche und Begierden durchzusetzen, ohne dass die lieben Nachbarn oder auch die Familienangehörigen etwas davon mitbekämen … Es ist doch allgemein bekannt: Je intensiver dogmatische Zwänge eine Lebensgemeinschaft einzuengen trachten, desto intensiver sucht der archaische Freiheitsdrang im Menschen nach Möglichkeiten der Unterwanderung. So auch auf die dörfliche Moral bezogen, gibt es nicht umsonst den Begriff der »Bauernschläue«. Insofern sorgte der nachbarschaftliche Blick auch im Dorf meiner väterlichen Familie dafür, dass sich jeder befleißigt sah, den »guten Ruf« einer »ehrbaren« Lebensführung zu wahren, sich ja nicht zu blamieren.
Soweit ich mich erinnern kann, zeigte mein Großvater schnell Verärgerung. Ich hörte von seiner Schwägerin, meiner geliebten Großtante, dass er nachtragend sein konnte und sich insgeheim mit gewisser Schlitzohrigkeit Vorteile zu verschaffen trachtete. Man sagte auch im Dorf der Familie meines Großvaters nach, »Ich«-Menschen zu sein. Übrigens: Ganz allgemein wurden und werden auch heute noch Familienverbänden in den Dorfgemeinschaften oft über Generationen hinweg bestimmte Verhaltenstendenzen oder Spitznamen zugeschrieben. Darauf komme ich später noch einmal zurück. Als kleines Kind achtete ich zwar darauf, meinen Großvater nicht zu sehr mit kindlicher Neckerei, wie zum Beispiel mit einem Reim aus einem Kinderlied »Schneider Meck, Meck, Meck – lass die Nadel sausen« ärgerlich zu machen, aber wenn ab und zu dann doch, blieb er letztlich ein liebevoller Großvater und erfreute sich auch an meiner Fröhlichkeit und Wissbegierde. So nahm er mich zu seinem Sonntagsfrühschoppen mit in das Wirtshaus im Dorf. Dort durfte ich den Schaum von seinem großen tönernen Bierkrug trinken – und bekam von der Wirtin eine Riesenschnitte mit Blutwurst.
Meine kleine, zierliche Großmutter erlebte ich als friedfertig ausgleichend im familiären Miteinander. Ich liebte und achtete sie wegen ihrer vornehmen Wesensart, weshalb sie bis heute bei einigen für mich wichtigen Grundwerten meiner Lebenssicht ein Vorbild geblieben ist.
Auch zu den nichtbäuerlichen Anwesen gehörte zwecks weitgehender Nahrungsselbstversorgung ein Bereich für Schlachtvieh- und Milchtierhaltung: ein Schwein, Hühner, Gänse oder vielleicht auch Enten, eine Kuh oder Ziegen. Zumindest verfügte die Familie über einen großen Gemüsegarten. Oftmals besaß man aber zusätzlich noch eine Wiese zur Heu- und Grummeternte und kleinere Feldparzellen für den Anbau von Kartoffeln, Getreide und Zuckerrüben. Die einfachen Leute verdingten sich nicht nur deshalb bei den Bauern mit einer bestimmten Stundenzahl als Tagelöhner. Dafür beackerte der Bauer in Gegenleistung mit seinen Landmaschinen, überwiegend von Pferden gezogen, die kleinen Felder, falls vorhanden. Meine väterlichen Großeltern waren Ziegenbauern. So kann ich mich daran erinnern, dass auch sie – überwiegend aber meine Großmutter – bei einem Bauern im Tagelohn standen.
Bei meinen Großeltern erreichte man über einen kleinen Hof neben dem Stallgebäude das sogenannte »Plumpsklo«. Ab und zu musste die Senkgrube geleert werden. Dann kam der Bauer mit seinem Zugpferd und einem Jauchefass auf dem Wagen – oder eine eigene Kuh zog in anderen Fällen das Gülle-, auch Jauchefass genannt. Mein Großvater beförderte mit einer Art großer Schöpfkelle die Jauche in das Fass. Das stank dann sehr, gehörte aber zum Hausversorgungsrhythmus dazu wie in allen anderen Haushalten auch. Die Jauche wurde dann auf die Felder oder im Garten als Düngemittel verteilt. In den Schlafzimmern standen dann »Pisspötte«. Morgens trug man sie zum Plumpsklo oder leerte sie auf der den Ställen beigeordneten Miste.
Wenn die Leute im Dorf damals Besorgungen außerhalb des Dorfes zu machen hatten, mussten sie zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren oder in besonderen Fällen die Pferde vor die Kutsche spannen. Autos gab es nur vereinzelt. Fußmärsche waren wir alle gewohnt. Deshalb befanden sich fast alle zur Grundversorgung der Leute notwendigen Einrichtungen im Ort: Schuster, Schneider, Schmied, Tischler, Stellmacher und Schlachter. Zumindest ein Kaufladen befand sich im Dorf – und eine Milchausgabestelle. Zur Traditionspflege bzw. zwecks geselligen Beisammenseins gab es ein Wirtshaus mit großem Saal. Wir Kinder konnten in den Dörfern unsere Grundschuljahre absolvieren. Da stand eine Schule nebst Lehrerwohnung oder -haus.
Im Gegensatz zu seinem jüngeren, eher introvertierten Bruder strebte mein Vater schon immer mehr aus der familiären Lebensgestaltungsvorstellung und dörflichen Enge heraus. Mein Großvater spielte Ziehharmonika, und die beiden Söhne lernten es auch. Mein Vater beherrschte wohl schon als Heranwachsender das Instrument so gut, dass er auf dörflichen Veranstaltungen, wie bei der jährlichen Kirmes, zum Tanz aufspielte. Dem Dorfschullehrer war nach Erzählungen meiner Tante Berta die Musikbegeisterung meines Vaters nicht verborgen geblieben, weshalb er zu meinen Großeltern ging, um sie zu ermuntern, ihren Sohn Musiker werden zu lassen. Die finanziellen Mittel konnte mein Großvater seinen Angaben zufolge wegen seiner verdienstunsicheren Selbständigkeit jedoch nicht aufbringen. Die Dörfler begannen inzwischen zunehmend damit, »von der Stange« zu kaufen (Das heißt, Bekleidung nicht mehr selbst zu nähen oder nähen zu lassen, sondern im Bekleidungsgeschäft zu kaufen). Außerdem sah er es im Interesse seiner eigenen Altersversorgung – mein Großvater war nicht rentenversichert –, ebenso natürlich in der Erwartung des Fortbestehens des Familienbetriebes, als notwendig an, dass mein Vater als ältester Sohn traditionsgemäß ebenfalls das Schneiderhandwerk erlerne. Weil nun aber mein Vater stur bei seinem Entschluss blieb, nicht das Handwerk seines Vaters zu übernehmen, trat, wie bereits erwähnt, der jüngere Bruder die Nachfolge an. Meine Großeltern schickten meinen aufmüpfigen Vater dann nach dem Volksschulabschluss in eine nahe gelegene Holzverarbeitungsfabrik (»Holschenbude«). Da erwiesen sie ihm aber einen Bärendienst, denn mein Vater hatte, wie ich später feststellte, kein handwerkliches Interesse. Er muss nachhaltig rebelliert haben, denn meine im Nachbardorf lebende Großtante und ihr Mann hatten Verständnis für sein Streben und kauften ihm eine Klarinette.
Als er siebenundachtzigjährig einem Herzschlag erlag, beerdigten wir ihn auf dem Dinkelhauser Friedhof. An der Trauerfeier nahmen noch zwei seiner Freunde aus der gemeinsamen Bollenser Jugendzeit teil. Sie berichteten mir aus dieser Zeit, dass mein Vater des Öfteren auf der Veranda seines väterlichen Hauses oben auf dem »Ortberg« Klarinette geübt habe. Sein Dackelhund »Waldmann«, den mein Vater wohl während der Übungszeit ins Haus sperrte, sei dann auf die Fensterbank des Flurfensters im ersten Stock gesprungen und habe das Klarinettenspiel mit Jaulen begleitet – für mich eine anrührende Geschichte aus der Jugendzeit meines »Papas« und somit auch ein tröstliches Nachspüren seiner jugendlichen Lebensvollzüge in seiner Heimat, in die er nun zurückgekehrt war.
Zunächst hatte er aber Musikunterricht in Uslar genommen. Sodann besuchte mein Vater drei Jahre (von Oktober 1926 bis April 1929) als Internatsschüler die Musikschule von Carl Ziege im Schloss »Gudensberg« bei Kassel. Die B-Klarinette war sein Haupt- und die Viola sein Nebeninstrument. Tante Berta und ihr Mann unterstützten meinen Vater bei seinen weiteren Berufsbildungsvorstellungen; auch finanziell! So trat er als weiteren Schritt der Reichswehr bei und wurde im Heeresmusikcorps aufgenommen. Er lernte noch das Saxophonspiel, besuchte zudem die Heeresfachschule mit dem Abschluss des Fachabiturs.
So wurde mein Vater Kapellmeister. Seinen Eltern, der Verwandtschaft, dem Heimatdorf, seinen Jugendfreunden imponierte das Streben meines Vaters. Er hatte sich erfolgreich durch Lernen und Fleiß gegen die dogmatische dörfliche Lebenssicht durchgesetzt. Nun galt er als »Vorzeigesohn« seines Heimatdorfes.
Vor mir liegt ein Foto aus dieser Zeit: Mein Vater in Paradeuniform seines Musikcorps, schon immer etwas schütteres dunkles Haar, feine Gesichtszüge, mit schlanker Taille. In seiner Haltung und seinem Lächeln wirkt er allerdings auf mich zurückhaltend. Trotz seiner beruflichen Traumerfüllung und der damit verbundenen Öffentlichkeitswirkung blieb mein Vater ein in seinem Auftreten zurückhaltender, seinen dörflichen Moral- und Wertewurzeln verbundener Mann. Er konnte zum Beispiel nicht verstehen und empfand es auch als dumm, dass Jugendfreunde von ihm, die wie er das Dorf gegen städtisches Leben eingetauscht hatten, behaupteten, kein Platt mehr sprechen zu können. Auch stellte er sich bis zu seinen Altersjahren mit gewohnter Lernbereitschaft neuen beruflichen Herausforderungen und allen Aspekten, die damit zu tun hatten – da kam ja im Zusammenhang mit dem sich ankündigenden Zweiten Weltkrieg einiges auf ihn zu.
Mein Vater dirigierte unter anderem Platzkonzerte in Münster. Da hat meine Mutter sich in den »schneidigen Mann», wie sie ihn im Zusammenhang mit diesen ersten Begegnungen immer beschrieb, verliebt. Das war wohl 1932. Meine Mutter schwärmte von dieser Zeit, in der sie von den Männern als »blondes Gift« (O-Ton meiner Mutter) umschwärmt wurde und mein Vater als jugendlicher Kapellmeister in Paradeuniform mit Degen ebenfalls bewundernde Blicke auf sich zog; und trauerte dieser Zeit bis zu ihrem Tod nach. Mein Eindruck ist, ein junges Paar im »Rausch« der aufgehenden Sonne des »Dritten Reiches«! Ich frage mich: Lenkte beide jedoch dieser »Rausch« eventuell davon ab, sich in ihrer Persönlichkeit besser kennenzulernen?)
Doch trotz der Euphorie, sich als ein besonderes Paar im Aufwind der Hitlerschen Visionen zu fühlen, standen einer Heirat zunächst die Dogmen des Katholizismus im Wege. Mein Vater hatte deshalb meine kleinbäuerlichen, unbeeinflussbar auf Anstand und Moral im katholischen Sinne achtenden Großeltern, auch den Gemeindepfarrer, von seiner Redlichkeit zu überzeugen. Mit seiner wesentlich liberaleren evangelischen Einstellung erklärte er sich damit einverstanden, zukünftige Kinder katholisch taufen zu lassen – und sich im vorgenannten Sinne um ihre Erziehung kümmern zu wollen. So heirateten beide 1935. Meine Mutter war 25, mein Vater 29 Jahre alt.
Ich möchte ein Foto aus der Zeit ihrer jungen Ehe beschreiben. Ein Gruppenbild – es sagt nach meinem Empfinden viel aus über die Selbstbilder der beiden:
Papa in der Paradeuniform des Kapellmeisters (in bekannter zurückgenommener Haltung, die Hände auf dem Rücken verschränkt, mit einem höflichen »Foto-Lächeln«), mit zwei weiteren Musikerkollegen, in ähnlicher Haltung, auf einer Wiese etwas voneinander entfernt, in einer Reihe stehend, schauen sich sozusagen als Kulissenabschluss die lockere Inszenierung »Gruppenbild mit Dame« vor sich an. Meine junge, schöne, im Gras hockende Mutter, ein Soldatenkäppi auf den blonden Locken, hält die Hand eines halb vor ihr hingestreckten, sich in ihren Schoss schmiegenden, das »blonde Gift« anhimmelnden Soldaten. Ihr zur Rechten kniet ein Soldat, sie umarmend und ebenfalls anschmachtend. Neben ihr zur Linken liegt ein weiterer Soldat bäuchlings im Gras, an sie gekuschelt. Meine Mutter umfasst seine Schultern. Neben diesem liegenden Soldaten sitzt ein Akkordeonspieler. Dann folgt eine weitere, auf dem Boden hockende Soldaten-Dreiergruppe. Auch sie schaut mit sichtlichem Vergnügen auf die Selbstdarstellung meiner Mutter als »Vamp«. Hinter dieser letzten Gruppe hockt noch eine lächelnde Ehefrau. Aber ihre Haltung signalisiert, dass ihr bewusst ist, dass sie an einem offiziellen Foto mit den Musikerkollegen ihres Mannes beteiligt ist.
Auch auf anderen Fotos meines Vaters aus seiner Jugendzeit, zum Beispiel mit Freunden aus dem Heimatdorf, sehe ich ihn immer in der gleichen kontrollierten Haltung. Übrigens habe ich die vorstehend beschriebenen Fotos und noch weitere aus der Kapellmeisterglanzzeit meines Vaters bis zum Kriegsausbruch, zusammen mit Briefen meines Vaters bis zur Entlassung aus der Gefangenschaft, nach dem Tod meiner Mutter in einer Truhe im Keller gefunden. Darunter ein Hochzeitsbild meiner Eltern – das hatte ich nie vorher gesehen. Auch Fotos aus ihrer »Schlosszeit«. Unter anderem mit einem adelige Noblesse ausstrahlenden jungen Diener in Livree, sodann mit dem Schloss-Bibliothekar am Klavier. Von ihm schwärmte mir meine Mutter besonders gerne etwas vor. Des Weiteren das Foto von einem jungen, großbäuerlich wirkenden Jagdgenossen mit dem Käppi einer Studentenverbindung auf dem Kopf, einen erlegten Rehbock präsentierend. Den vertrauten Widmungen entnehme ich, dass meine Mutter offenbar bereits als junges Mädchen ihren Blick auf Männer mit aus ihrer Sicht glamouröser Aura richtete – und, wenn ich an das vorstehend beschriebene Gruppenfoto denke, ihre anziehende Wirkung auf sie auch sicherlich auszuspielen verstand.
Zeitlebens schätzte die Münsterländer Verwandtschaft meiner Mutter meinen Vater als verlässlichen, friedliebenden, fleißigen Mann. Bei meiner Mutter wussten allerdings alle, die mit ihr im Alltagsleben zu tun hatten, dass sie zwar hilfsbereit, charmant, freundlich und mitfühlend sein konnte, aber wegen ihrer Neigung zu gelegentlichen Hintertreibungen und Wutausbrüchen, in die sie sich ohne Rücksicht auf Ort, Zeit und enge zwischenmenschliche Bindung hineinsteigern konnte bis hin zu Verwünschungen, ein vorsichtiger Umgang mit ihr angeraten erschien. Aus welchen frustrierenden Erfahrungen in der Kindheit sich dieses irrlichternde Verhalten meiner Mutter tatsächlich entwickelt haben könnte, nahm sie als mögliches Geheimnis mit in den Tod. Auf jeden Fall bedauerten viele meinen Vater während der gesamten Ehezeit und hätten ihm eine verträglichere, für das Familienleben engagiertere Frau gewünscht! Jedoch – mein Vater konnte seine weniger einvernehmliche Seite durch seine kontrollierte Zurückgenommenheit besser kaschieren als meine Mutter.
Die Eltern meiner Mutter bewirtschafteten einen kleinen Bauernhof. Er lag inmitten der Felder, sie hatten ihn von einem Baron in Erbpacht übernommen. Dessen romantisches Wasserschloss lag in unmittelbarer Nähe. Auf dem Schlossareal befand sich die für die religiösen Belange der umliegenden Bauernhöfe zuständige Kirche. Meine Großmutter kam von einem gutsähnlichen großen Hof, einem sogenannten »Schultenhof«, im Münsterland, den ihr Vater aber laut Erzählungen meiner Mutter durch eine unglücklich verlaufene Bürgschaft verloren haben soll. Meine junge Großmutter brachte trotz dieses Unglücks plötzlicher Armut Selbstbewusstsein, notwendiges bäuerliches Bewirtschaftungswissen und eine immer noch beachtenswerte Aussteuer mit. Über die Herkunft meines Großvaters weiß ich wenig. Auf jeden Fall erlebte ich ihn in meinen Kinderjahren während gelegentlicher Besuche mit meiner Mutter noch als friedliebenden, gütigen Opa. Dagegen lernte ich meine Großmutter bewusst nicht mehr kennen. Sie starb, als ich drei Jahre alt war. Meine Großeltern bekamen acht Kinder. Großvater wurde im Ersten Weltkrieg zum Dienst an der Front eingezogen. Wie ich aus Erzählungen einer meiner mütterlichen Schwestern erfuhr, verschaffte sich meine Großmutter Respekt und Achtung aller, weil sie mit einem Knecht und einer Magd den Hof ohne Tadel weiterführte. Von meiner Mutter weiß ich auch, dass die Baronin meine Großmutter öfter besuchte. Sie schätzte offenbar die Gespräche mit meiner sicherlich lebensklugen Großmutter – wohl auch ihre gute Küche!
Im Zusammenhang mit diesen Besuchen erzählte mir die Schwester meiner Mutter, dass meine Großmutter sich des Öfteren bei der Baronin bitter über ihre heranwachsende Tochter, meine Mutter, beklagt habe. Im Gegensatz zu ihren restlichen sieben Kindern, mit denen es keine größeren Erziehungsprobleme gebe, werde sie mit dem Jähzorn und dem verqueren Wesen ihrer Tochter nicht fertig. Laut dieser Tante wurde meine Mutter in der Nachbarschaft oft »Prinzesschen« genannt. Meine Mutter hatte eine sehr gute Stimme. Oft sang sie ihren Angaben zufolge an christlichen Feiertagen in der Kirche. Wohl auch deshalb schlug die Baronin meiner Großmutter vor, ihr schwieriges Töchterchen nach dem Volksschulabschluss mit aufs Schloss nehmen zu wollen. Meine Mutter könne zum Bedienen und als Kindermädchen angelernt werden. Außerdem erzählte mir meine Mutter später, dass der Baron meiner Großmutter zugesagt habe, dem jungen verträumten Mädchen eine von ihr so sehnlichst erträumte Gesangsausbildung zu ermöglichen. Ob das nun wirklich so war, vermag ich nicht zu beantworten. Meine Mutter verbrachte auf jeden Fall einige Zeit auf dem Schloss. Ihre schwärmerischen Berichte von wertschätzenden Freundlichkeiten, die sie dort erfahren habe, ließen mich erkennen, wie prägend für ihren weiteren Lebensblick dieser aus dem bäuerlichen Alltagsleben herausgehobene, privilegierte Schlossaufenthalt für sie gewesen sein musste. Leider starb der Baron plötzlich; die Familienverhältnisse änderten sich. Meine Mutter musste in ihre kleinbäuerliche Welt zurückkehren. Sie setzte jedoch durch, in einem kirchlichen Internat für ein Jahr als Lehrköchin die bürgerliche Küche zu erlernen. Wie in den Zeugnissen meines Vaters werden auch meiner jungen Mutter untadeliges Verhalten und Lernwilligkeit bescheinigt. Zumindest bei einer Familie war meine Mutter danach für fünf Monate 1931 als »Stütze der Hausfrau« beschäftigt (ein entsprechendes Zeugnis liegt mir vor). Auf meine Nachfragen, welche weiteren Arbeitsstellen sie denn bis zur Hochzeit mit meinem Vater 1935 gehabt habe, antwortete sie stets mit ziemlich blumigen, letztendlich für mich wenig fassbaren Umschreibungen. Außerdem hat meine Mutter sich nach der geplatzten Gesangsausbildungs-Zusage des Barons selbst nie um eine entsprechende Ausbildung bemüht. Was die Beziehung zu Männern vor der Bekanntschaft mit meinem Vater betrifft, so mangelte es meiner Mutter offensichtlich nicht an sie umwerbenden Verehrern, die sie aber, wie sie mir gegenüber des Öfteren betonte, auf Distanz hielt; mit einer für mich nicht ganz nachvollziehbaren Erklärung, die sie dann noch mit einer entsprechenden Handbewegung unterstrich: »Ich stehe moralisch so hoch!«
Nun, das frisch getraute Paar glaubte, in eine vielversprechende gemeinsame Zukunft aufzubrechen. Frei von den Einschränkungen durch die Nachbeben des Ersten Weltkrieges, den Irrungen und Wirrungen der Inflationszeit (unter der besonders die »kleinen Leute« zu leiden hatten). Zudem versprachen bereits 1929 die »Braunhemden« mit wachsendem Zulauf: »Wer macht uns frei – die Hitlerpartei!« Meine Mutter sprach, enttäuscht über den für sie bitteren Ausgang dieser »Freiheitsbewegung«, öfter davon. Außerdem begannen sich viele Deutsche mit dem Hitler’schen Märchen einer arischen Herkunft zu identifizieren. Diese Überhöhung gefiel offensichtlich auch meiner Mutter als »blondes Gift«!
Die beiden zogen in der ersten Zeit ihrer Ehe, wegen der Versetzungen meines Vaters, in verschiedene Garnisonen des Öfteren um. Den Briefen meines Vaters aus dieser Zeit entströmt so viel liebevolle Fürsorge für seine junge schöne Frau. Nach ihrem Umzug nach Bonn wurde ich 1938 geboren. Ich, das Kind aus einer » Mischehe«, wurde katholisch getauft. Im städtischen Bereich spielte mein »Mischehen-Kind-Status« keine Rolle, aber im dörflichen katholischen oder evangelischen Miteinander in der Nachkriegszeit schon. Die beiden Konfessionen standen sich oftmals geradezu feindlich gegenüber. Ein latentes Unbehagen meiner eher liberal gesinnten evangelischen Verwandtschaft mir als Katholikin gegenüber spürte ich schon gelegentlich. Leidvoll wurde allerdings später meine Erfahrung mit den dogmatischen Zwängen des Katholischen in Münster nicht nur in meiner Eigenschaft als Mischehenkind, sondern auch als Geschiedene!
Aber zurück zu der jungen Ehe: Geradezu berauscht durch die Droge des »Arischen«, das entsprechend martialisch inszenierte Milieu der uniform- und waffenklirrenden Paraden, Aufmärsche, wechselnd mit aufregenden Bällen in degengeschmückten Paradeuniformen und glitzernden Abendkleidern, sonnten sich viele im elitären Glück eines »tausendjährigen Reiches«. So vor allem auch meine Mutter, die sich in das narzisstische Selbstbild einer arischen blonden Frau verrannt hatte. – Ein vielleicht psychologisch nachvollziehbares Kompensationsbestreben meiner Mutter: Sie empfand als »kleiner Leute Kind« zeitlebens ihr Ausgegrenztsein aus Bildungsmöglichkeiten der »Höhergestellten« als eine große, ihr widerfahrene Ungerechtigkeit! Ich erinnere mich an das von ihr stets abrufbereite Lebensthema, dass sie eine wunderschöne Stimme habe und deshalb zu Höherem berufen gewesen sei.
Ja, meine jungen Eltern fühlten sich, wie viele andere auch, durch den großen Führer Hitler aus der sozialen Bedeutungslosigkeit in den deutschtümelnden Olymp des Märchens vom Ariertum emporgehoben. Dass da Menschen durch diese Haltung ihrer Würde, ja ihres Lebens, ihrer Lebensleistungen, ihres Besitzes beraubt wurden, scheinen beide Elternteile bis zu ihrem Tod nicht wirklich kritisch reflektiert zu haben. Nein, meine Mutter ließ sich des Öfteren zu der Bemerkung hinreißen: »Unter Hitler gab es das nicht, da ging es uns gut!« Mein Vater hielt sich schlauerweise mehr zurück, beide waren sich jedoch offenbar in dieser Meinung weitgehend einig. Ich glaube, dass meine Eltern mit der Genugtuung »kleiner Leute«: »Jetzt sind wir dran«, ihr Verhalten nicht hinterfragten, weil die Mehrheit, staatlich abgesegnet, genau so dachte und handelte.
So nehme ich an, dass meine Eltern sich erst nach der Rückkehr meines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft, als die unglamouröse Nachkriegszeit der entbehrungsreichen »Wiederauferstehung aus Ruinen« begann, wirklich kennengelernt haben. Denn von da an starteten sie ohne weitere längere Trennungen in eine lange Zeit des ehelichen Miteinanders. Mein Vater fiel, wie bereits erwähnt, im Gegensatz zu meiner Mutter nie unangenehm auf. Er drängte sich nicht in den Vordergrund; war hilfsbereit, wenn man ihn darum bat, hielt sich mit seiner Meinung zurück und verfolgte geradezu unauffällig, aber stetig sein Ziel beruflicher Qualifizierung und Wiedereingliederung nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft. Ja, mein Vater galt, anpassungsfähig wie er war, weiterhin als verlässlicher Staatsbürger, pflichtbewusster Ehemann, freundlicher Familienvater. Soweit ich dies in späteren Jahren – nach der Entlassung meines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft, als ich bereits acht Jahre alt war – mitbekommen habe, zog sich mein Vater resigniert in ein anderes Zimmer oder aber zumindest in betroffene Schweigsamkeit zurück, wenn seine Frau anfing, verbittert den Tagen von Glanz und Gloria nachzutrauern. An eine beherzt-autoritäre Widerrede meines Vaters kann ich mich nicht erinnern. Er wusste, wie aufbrausend meine Mutter reagierte; diese Inszenierung wollte er sich offenbar ersparen. Was beide, wenn sie alleine waren, miteinander beredeten, entzog sich meiner Kenntnis. Ich bekam aber gelegentlich mit, wie meine Mutter ihren Ehemann an seine Heirats-Versprechungen und ihre moralische Leistung als stets treue Ehefrau gemahnte, wenn er doch mal versuchte, sie zu kritisieren. Meine Mutter wusste offensichtlich, wie sie trotz ihrer unberechenbaren Gemütslage und frustrierenden Unzufriedenheit meinen Vater doch immer wieder für sich einnehmen konnte. Was ihre Tagesorganisation betraf, so begann meine Mutter in ihrer nervösen, angespannten Grundhaltung oftmals erst abends mit irgendwelchen Putzarbeiten. Eines ihrer Lieblingsargumente: »Als Hausfrau hat man immer zu tun!« Mein Vater saß derweil im Wohnzimmer vor dem Fernseher!
Insgesamt war ich bei dem, was ich bereits während meiner frühen Kindheit an sich widersprechenden mütterlichen Verhaltensweisen mir gegenüber erlebte, im Hinblick auf unseren weiteren Umgang miteinander vorgewarnt. Sie konnte einerseits lieb, nett mit mir umgehen, sich auch für mich einsetzen; mich aber auch andererseits mit ihrem nicht zu zügelnden Jähzorn in Angst und Schrecken versetzen. Ich habe aber als Gegenpol zu ihr Trost und gleichmäßige liebende Ermunterung vor allem bei meiner Oma und meiner Großtante gefunden. Auch machte ich mit meiner Mutter die betrübliche Erfahrung, dass sie sich dazu hinreißen lassen konnte, mein Vertrauen zu missbrauchen. So ermunterte sie mich zunächst in einer Haltung verständnisvoller, warmherziger Mütterlichkeit dazu, meine Zurückhaltung ihr gegenüber aufzugeben. Hatte ich dann mein Inneres preisgegeben, versuchte sie dies oftmals ohne Skrupel, in ihrem Interesse uminterpretiert, gegen mich zu verwenden! Daraus lernte ich und nahm es als Warnsignal, wenn ich mal wieder ihrem distanziert berechnenden Blick begegnete. Ich denke, dass ich besonders in den ersten Nachkriegsjahren, als mein Vater im Krieg bzw. danach in Gefangenschaft war, meiner Mutter als Projektionsfläche für ihr als große Ungerechtigkeit empfundenes, frustrierend ereignisloses Alltagsleben diente. So kann ich mich daran erinnern, dass sie einmal aus einem eigentlich nichtigen Anlass heraus hemmungslos auf mich einschlug. Als ich dann ins Erwachsenenalter startete und meine eigenen Wege zu gehen versuchte, konnte ich es eine lange Zeit nicht wirklich glauben, dass sie mich nunmehr als ihre Rivalin zu betrachten begann. Und aus dieser Haltung heraus trachtete sie oftmals danach, meine Vorhaben oder Angelegenheiten zu hintertreiben und/oder für ihre Interessen auszunutzen. Wenn ich es nicht mehr übersehen konnte, versuchte ich mit meiner Mutter darüber zu reden – zwecklos! Sofort schnellte ihre Erregungskurve von null auf hundert; sie beschimpfte mich, warf mir empört vor, was für einen schlechten Charakter ich doch habe, so etwas von ihr, meiner Mutter, anzunehmen! Gelegentlich meldete sich dann auch noch etwas später mein Vater bei mir, um mich mit den Worten: »Deine Mutter tut so etwas nicht« zu rügen. Diese »Rügen« meines Vaters veranlassten mich immer wieder zu stummer Resignation. Ich machte die Erfahrung, dass er sich nicht weiter äußerte, auch wenn es sich später doch herausstellte, dass meine Mutter ihn belogen hatte. Für mich eine bittere Erkenntnis: eine Mutter, der ich zu misstrauen hatte; ein Vater, von dem ich nicht wusste, was er eigentlich denkt. Musste ich ihm auch misstrauen?
Und wie war mein Vaterbild während seiner kriegsbedingten Abwesenheit? Bis zu meinem achten Lebensjahr erträumte ich mir aufgrund von Erzählungen meiner Mutter, vor allem der nahen Verwandten und Dorfgemeinschaft, in die ich mich eingebunden fühlte, das Bild eines liebevollen, verständigen, klugen, musikkundigen Vaters, der sich nach seiner Rückkehr aus der französischen Gefangenschaft sicherlich für seine Tochter einsetzen würde. Und dass, wenn die Familie endlich wieder zusammenlebte, vor allem mein sehnlichster Wunsch, Klavierunterricht, in Erfüllung ginge. Meine kindliche Glücksvision war der zurückgekehrte Vater! Wie bereits erwähnt, ein Traumvater! Und auch seine zärtlichen Briefe aus der französischen Gefangenschaft bekräftigten meine Hoffnungen. Und das wird vielen Kriegskindern in ähnlicher Weise so ergangen sein.
So würde ich mich in meiner Selbstfindung viele, viele Jahre vor allem auch mit meinem widersprüchlichen Vaterbild auseinanderzusetzen haben, denn es prägte verständlicherweise meine Beziehung zu anderen Männern.
Maikäfer, flieg, dein Vater ist im Krieg …
Köln
Den Briefen meines Vaters an meine Mutter aus den Anfängen der »Hitlerisierung«, als der Krieg noch nicht die deutschen Städte mit Bombenteppichen überzog, entnehme ich, dass er in verschiedenen Garnisonen der Wehrmacht in seiner Funktion als Kapellmeister (im Rang eines Stabsfeldwebels) stationiert war. 1938 wurde ich in Bonn/Rhein geboren, wo meine Eltern bis 1940 wohnten. An die anscheinend im Jahr 1940 in Köln-Buchheim angemietete Wohnung kann ich mich noch immer gut erinnern. Da war ich drei Jahre alt. Ein weiß gestrichenes, ich glaube dreistöckiges Mietshaus mit einem großen Garten nebst Gartenhaus. Ich sehe drei helle, große Zimmer (Wohnzimmer, Herrenzimmer und Elternschlafzimmer), eine geräumige Wohnküche mit Blick auf den Garten, ein Badezimmer und Toilette vor mir. Ich glaube, es gab auch eine Zentralheizung. Im Herrenzimmer hielt ich mich anscheinend am liebsten auf, denn mein Erinnern verbindet sich besonders intensiv mit diesem Raum. Wenn ich die Schubladen des mächtigen Schreibtisches auszog, strömte mir der Duft der Bücher entgegen. Sie zogen mich magisch an. Auch wenn ich noch nicht lesen konnte, nahm ich sie gerne in die Hand und erfreute mich am Rascheln des Papiers; schaute mir neugierig Fotos und Bilder an. Meine Mutter las mir des Öfteren aus den Kinderbüchern »Märchen der Brüder Grimm« und »Alice im Wunderland« vor. Beide Bücher besitze ich noch. Ich konnte inzwischen fast jedes Märchen auswendig nacherzählen. So legte ich mich am liebsten, wie Papa vermutlich auch, im Herrenzimmer mit einem dieser Lieblingsbücher auf die Chaiselongue und tat so, als ob ich die Märchen wirklich ablesen würde. Sodann gab es im Zimmer Stapel von Noten und die Instrumente, Saxofon und Klarinetten, meines Vaters. Auch besuchten meine Mutter und ich eine liebenswerte alte Dame im Nachbarhaus. An diese Dame kann ich mich erinnern, weil sie eine wunderschöne Biedermeierpuppenstube mit kleinen Puppen aus Porzellan, in entsprechender Kleidung, besaß. Ich durfte damit spielen – und welch eine Freude für mich: Am nächsten Weihnachtsfest stand die Puppenstube unter dem Weihnachtsbaum in unserer Wohnung. Leider hat meine Mutter die von mir gehegte und gepflegte Puppenstube trotz meiner Bekundung, dass ich sie behalten wolle, irgendwann, als ich schon erwachsen war, wohl verschenkt. Mir aber sagte sie jedes Mal, wenn ich die Puppenstube mit in meine Wohnung nehmen wollte, in äußerst abwehrendem Ton, da müsse zunächst die voll bepackte Truhe im Keller leer geräumt werden, denn die Puppenstube befinde sich zuunterst. Ich gab dann immer wieder nach, weil ich es in Anbetracht der kurzen Besuchszeiten bei meinen Eltern nicht auf einen Streit ankommen lassen wollte. Erst, als meine Mutter tot war und der Haushalt aufgelöst wurde, schaute ich in der Truhe nach – fand aber keine Puppenstube.
Der Krieg begann inzwischen voll auszubrechen – mein Vater war in Frankreich stationiert. Aus dieser Zeit fand ich einen Kartengruß von ihm! Einige Zeilen möchte ich wiedergeben, weil sie zeigen, wie liebevoll sorgend er an seine Frau und kleine Tochter dachte:
»Liebes Frauchen und Töchterchen!
Ich bin so gespannt, wie es meiner Kleinen wohl geht! Leider habe ich heute auch keine Post bekommen. Ich will aber hoffen, dass es Euch beiden doch gut geht. Liebes Frauchen! Habt Ihr beide eigentlich schon Gasmasken? Du wolltest doch mal welche kaufen. Nehmt Euch ja immer in Acht, damit Ihr nicht krank werdet! Nun nochmals viele Grüße und Küsse von Eurem Paps.«
Das Schriftbild meines Vaters passt aus meiner Sicht zu seinem stets zurückhaltenden, freundlich-verbindlichen Erscheinungsbild, wie ich ihn in Erinnerung habe: Die Buchstaben gleichmäßig flüssig aneinandergereiht, in eine Richtung nach rechts strebend. Ohne Schnörkel, ohne eigenwillige Schriftzeichen.
Ja … die Zeit in Köln. In der Erinnerung spüre ich immer noch die beruhigende Wärme, die von meinem Vater ausging, wenn er denn mal einen seiner immer seltener werdenden Heimatkurzurlaube mit uns zusammen verbringen durfte. Ab und zu spielte Papa auf seinen Instrumenten. Er begleitete auch wohl meine Mutter, wenn sie die Ballade »Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir …« sang. Später erzählte sie mir, dass während ihrer »Schlosszeit« der Bibliothekar des Öfteren diese Ballade gesungen habe, sich dabei auf dem Klavier begleitend. Für mein kindliches Gemüt erschloss sich jedes Mal so etwas wie die wunderbare poetische Fortsetzung meiner ohnehin sehr intensiv erlebten Märchenwelten.
Wenn der Urlaub vorbei war, nahm mein Vater auch diese liebevolle, lebendige Stimmung im Zusammenleben mit ihm wieder mit. So kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich einmal verzweifelt weinend meinen Papa in der ganzen Wohnung suchte, auch immer wieder an die Toilettentür klopfte … Er war ohne Verabschiedung wohl heimlich aus der Wohnung gegangen.. Vielleicht hatte meine Mutter mit meinem abreisenden Vater zusammen ebenfalls kurz die Wohnung verlassen? Es dauerte auf jeden Fall eine Weile, vermutlich zusätzlich durch ihren eigenen Abschiedsschmerz, bis sie meine Verzweiflung mitbekam und dann auch versuchte, mich zu trösten. Sie erklärte mir, Papa müsse immer wieder von uns Abschied nehmen und in den Krieg ziehen, um uns vor unseren Feinden zu beschützen. Trotz meines Entsetzens, dass Papa auf einmal verschwunden war, schien mich doch auch der Grund seiner Abwesenheit mit meiner Liebe zu ihm zu versöhnen. So legte ich ein Paar von Omas handgestrickten Socken für Papa – mir steigt noch heute in der Erinnerung ein imaginärer Mottenpulvergeruch in die Nase – neben mein Püppchen in den Puppenwagen und erträumte mir durch den Aufenthalt im Herrenzimmer und die zurückgelassenen Socken die tröstliche Nähe zu Papa. Papa würde ja wiederkommen, also nahm mir vor, immer brav zu sein, damit er stolz auf mich sein könne; wie ich es auf meinen tapferen »Beschützer-Papa« war.
Der Samen für eine meiner Verhaltenstendenzen, oftmals viel zu lange verständnisvolle Geduld vor allem für einen





























