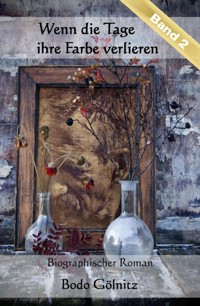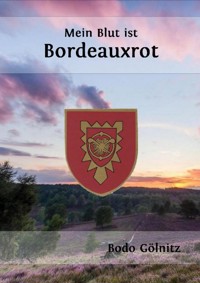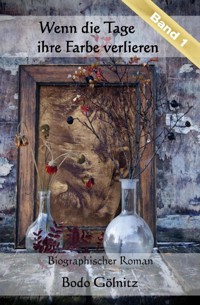
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
An einem kalten verschneiten Wintertag des Jahres 1955 wird Bodo als sechstes Kind einer Flüchtlingsfamilie geboren. Seine Mutter hatte sich aus einem kleinen ostpreußischen Dorf mit fünf kleinen Kindern und zu Fuß auf den Weg gemacht, während ihr Mann irgendwo in einem Schützengraben an der Ostfront steckte. Nach Kriegsende soll es noch acht lange, harte und entbehrungsreiche Jahre dauern, bis die Familie wieder zusammenfindet. Deutschland versucht, wieder in die Normalität zurückzufinden, und der kleine Bodo lernt, was es heißt Flüchtlingskind zu sein und in ärmlichen Verhältnissen aufzuwachsen. Und noch etwas lernt er - durchzuhalten. Getrieben von dem Vorsatz, eines Tages Wohlstand und Glück zu erreichen, macht er sich auf den Weg. Er verlässt früh sein Elternhaus, findet seine erste Liebe, aber auch erste große Enttäuschungen. Doch eines Tages meint er nah am Ziel zu sein. Aber die Pfade des Lebens sind steinig und schmerzhaft. [...]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bodo Gölnitz
Wenn die Tage
ihre Farbe verlieren
Dieses Buch ist den Menschen gewidmet
denen meine ganze Liebe gilt:
Ina, Bastian und Marisa
Impressum
© 2017 Bodo Gölnitz
Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN (eBook-Ausgabe - Band 1) 978-3-7450-3777-7
ISBN (eBook-Ausgabe - Band 2) 978-3-7450-3778-4
ISBN (Print-Ausgabe - Band 1) 978-3-7450-3773-9
ISBN (Print-Ausgabe - Band 2) 978-3-7450-3774-6
Printed in Germany
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Wer vor der Vergangenheit
die Augen verschließt,
ist blind
für die Gegenwart.
(Richard von Weizäcker)
Kapitel 1: Untergang und Aufbruch
Irgendwo in Ostpreußen. In einem kleinen Dorf nahe der masurischen Seenplatte. Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges - als Adolf Hitler Kanonenfutter für seine wahnwitzigen Ideen brauchte und am 1. September 1939 den Selbstmord des alten Deutschlands einfädelte.
Mein Vater Ernst gehörte zu der Generation der vielen jungen Männer, die in dieser Zeit zufällig erwachsen wurden. Gerade 26 Jahre alt, hatte er mit meiner Mutter bereits fünf Kinder gezeugt. Zur damaligen Zeit war das allemal nichts Ungewöhnliches. Außerdem kam meine Mutter dadurch in den Genuss, vom Führer das Mutterkreuz« zu erhalten – und eine kostenlose Ausgabe von »Mein Kampf«.
Nun zog Vater also an die Front. Und meine Mutter musste die Kinder alleine versorgen - in Kriegszeiten wahrlich kein leichter Job.
Hitlers Soldaten bekamen, wenn sie verwundet wurden, Fronturlaub. Auch mein Vater wurde im Kampf verletzt. Eine Schusswunde im Verlauf eines Sturmangriffs. Und so kam er für eine kurze Zeit der Genesung nach Hause. Mit dem Resultat, dass im Jahre 1940 mein Bruder Wolf-Rüdiger das Licht dieser, von Raketen und Granatwerfern erhellten Welt erblickte.
Zu dem Zeitpunkt war Vati allerdings wieder bei seiner Einheit, irgendwo an der Ostfront. Seinen neugeborenen Sohn sollte er dadurch niemals kennenlernen, denn Wolf Rüdiger erlebte leider nicht seinen ersten Geburtstag. Unterernährung, Vergiftung durch verdorbene Milch. Das war der Grund für den frühen Kindstod.
Gegen Ende des Krieges nahm meine Mutter ihre Kinder, sowie nur wenige Habseligkeiten, und flüchtete aus Angst vor dem Einmarsch russischer Soldaten, von Ostpreußen in Richtung Schleswig-Holstein.
Geplant war, mit der »MS Wilhelm Gustloff« über die Ostsee in sicherere Gefilde zu schippern. Die war jedoch von den Massen an flüchtenden Menschen völlig überfüllt. Und so gings dann zu Fuß in Richtung Westen.
Am 30. Januar 1945 wurde die Wilhelm Gustloff vor der Küste Pommerns von feindlichen Torpedos getroffen und versenkt. An Bord befanden sich fast 9.000 Flüchtlinge und Besatzungsmitglieder.
Glück? Schicksal? Meta hatte jedenfalls überlebt.
Nach Kriegsende fand sie mit ihren fünf Kindern eine in einem kleinen Dorf in der Nähe des Nord-Ostsee-Kanals. Was aus Ernst Gölnitz geworden war? Niemand wusste es.
Meine Mutter machte nun das, was alle Frauen zu der Zeit taten - sie ließ meinen Vater über Vermisstenlisten suchen. Doch es tat sich nichts. Aber Meta Gölnitz übte sich in Geduld. Was blieb ihr auch anderes übrig. Sie versorgte mehr schlecht als recht ihre Kinder und wartete beharrlich auf ein Lebenszeichen ihres Mannes.
Regelmäßig suchte sie das »Deutsche Rote Kreuz« auf. Nur um zu erfahren, dass es in Sachen Ernst Gölnitz nichts Neues geben würde. Aber sie gab nicht auf. Es war jetzt bereits 1953.
Da bekam sie völlig unerwartet die Nachricht, dass es in Nortorf - einem Dorf, nicht weit entfernt - einen Ernst Gölnitz geben würde. Seit seiner Entlassung 1945, aus amerikanischer Gefangenschaft, würde er dort wohnen, und hätte eine Arbeitsstelle bei einem Bauern als Melker.
Und tatsächlich - dieser Mann war: mein Vater! Acht Jahre hatten er und meine Mutter, getrennt durch lächerliche 20 km, praktisch in der Nachbarschaft gelebt und nichts voneinander gewusst.
Trotz aller Freude - die anschließenden Monate waren alles andere als einfach. Immerhin waren Vaters Kinder zu Beginn des Krieges noch sehr klein gewesen. Es lagen 15 lange Jahre dazwischen. Und nun waren die damals Kleinen bereits im pubertären Alter, teilweise sogar schon erwachsen. Für sie war er fast ein Fremder. Und die Erlebnisse an der Front hatten ihn roh, streng, und schnell aufbrausend gemacht.
Um seine Stellung und Autorität in der Familie wiederzuerlangen, brauchte es noch eine geraume Zeit. Aber die Familie war jedenfalls wieder vollständig.
Kapitel 2: Die ersten Jahre
Am 7. Januar, einem verschneiten und eisigkaltem Wintertag des Jahres 1955, erblickte ich das Licht der Welt. Ich war, so sagte mein Vater spaßeshalber immer, ein sogenanntes »Heimkehrer-Paket«.
Zu jener Zeit lebten meine Eltern in einem Holzbarackenlager am Ortsrand. Das hatte man notdürftig erstellt, um den Scharen von ostpreußischen Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu bieten. Unsere zugeteilte Baracke bestand aus einem mittelgroßen Raum mit Kochecke - tja, sonst war da nichts. Und hatte jemand das Bedürfnis seine Notdurft zu verrichten, musste er nach draußen, und nahm auf bereitgestellten Plumps-Klos Platz.
Damals herrschten noch Winter mit Kälte und viel Schnee, in denen der Toilettengang nicht besonders komfortabel und gemütlich war. Toilettenpapier gab es zwar. Aber um dieses zu kaufen, musste man etwas besitzen von dem meine Eltern äußerst wenig besaßen - nämlich Geld. Und so wurden, aus Spargründen, ersatzweise alte Zeitungen in passende Stücke gerissen und neben dem Plumps-Klo deponiert. Diese Tätigkeit und das Drehen von Zigaretten, mit Tabak der Marke »Holland-Shag«, füllte einen Teil der wenigen Freizeit meines Vaters aus, wenn er spät abends, kaputt von der Arbeit, nach Hause kam.
Vater hatte seinen Job als »Zitzen-Massierer« in der heimischen Landwirtschaft aufgegeben und war als Quereinsteiger - so würde man das heute wohl nennen - zum Straßenbau gewechselt. Diese Anstellung brachte etwas mehr Geld ein, und Vati nutzte die Möglichkeit, das karge Einkommen mit massenhaft anfallenden Überstunden aufzubessern. So arbeitete er oft vom frühen Morgen bis in die späten Abendstunden.
Manchmal, wenn die Baustelle im Stadtgebiet lag, machte sich meine Mutter mit mir auf den Weg, und wir brachten ihm abends sein warmes Essen zur Baustelle. Während mein hungriger Vater im mitgebrachten Henkelmann löffelte, saßen wir noch eine Weile bei ihm. Und dann erklärte er mir die gewaltigen Baumaschinen, die um uns herumstanden.
Meine Geschwister waren mittlerweile ins Rheinland umgesiedelt. Dort gab es weitaus mehr Möglichkeiten, eine gute Anstellung zu finden. In unserer Einraum-Baracke wäre auch gar kein Platz für die komplette Familie gewesen. Meine jüngste Schwester Ursel war zu meiner Geburt immerhin schon 17 Jahre alt. Waltraud war 18, Edith 19, Heinz 20 - und Ernst, der Erstgeborene, zählte bereits 21 Lenze. Dieser Altersunterschied war wohl auch der Grund, weshalb ich eigentlich immer mehr ein Tante- bzw. Onkelverhältnis zu meinen älteren Geschwistern hatte.
Etwa drei Jahre nach meiner Geburt wies man uns dann endlich eine richtige Wohnung zu. Fließend Wasser gab’s im ganzen Dorf zwar immer noch nicht, doch im Hof war eine Schwengelpumpe vorhanden. Mit der konnte man per Muskelkraft frisches Wasser aus einem Brunnen holen. Aber das gewohnte Plumpsklo war immer noch allgegenwärtig.
Mutter übernahm in dem Wohngebäude, in der mehrere Familien wohnten, die Stelle des Hausmeisters. Dadurch konnte die Höhe der Miete etwas gesenkt werden. Und was nicht zu verachten war - wir hatten sogar etwas Gartenland, das meine Eltern zum ökologischen Kartoffel- und Gemüseanbau nutzen konnten. Der benötigte Naturdünger kostete nichts. Den produzierte unser Plumpsklo in ausreichender Menge.
Einen richtigen Draht zu der Mietergemeinschaft fanden meine Eltern allerdings nie - Ostflüchtlinge waren nicht besonders beliebt. Und von der späteren so oft zitierten Spaßgesellschaft waren wir ebenfalls Lichtjahre entfernt.
Doch gefühlt ging es nun langsam aufwärts.
Ja, ich erinnere mich noch erstaunlich gut an die damalige Zeit. Sogar bis weit in meine frühe Kindheit.
Als ich zum Beispiel ungefähr drei Jahre alt war, besaß ich einen Plüschbären. Er hatte keinen besonderen Namen. Er hieß einfach nur »Teddy«. Teddy war mein liebster Freund. Ihm erzählte ich alles, was mich kleinen Knirps beschäftigte. Und wenn ich in seine braunen aufgenähten Knopfaugen blickte, war ich überzeugt davon, dass er mich verstehen würde. So schleppte ich ihn in meiner kleinen Armbeuge immer mit mir herum und nachts schlief er bei mir in meinem Bett. Allmählich wurde er jedoch immer abgewetzter. Doch ich liebte ihn trotz der vielen Stellen, an denen sein kurzes Fell bereits abgerubbelt war. Schon damals waren in meinen Augen Äußerlichkeiten nur zweitrangig. Denn das Wichtigste, die Liebe, kommt immer nur von innen.
Doch dann verlor Teddy eines Tages einen Arm. Und aus der Öffnung, dort wo der Arm gewesen war, ragte die Strohfüllung heraus.
Meine Mutter nähte ihn wieder an. Aber von Dauer war dieser Zustand leider nicht. Ein paar Wochen später - und der Arm war wieder ab. Mutti meinte, wir sollten ihn nun endlich in den Müll tun. Ich konnte und mochte mich allerdings nicht von ihm trennen, weinte, und wollte ihn nicht hergeben.
Dann war er eines Tages plötzlich verschwunden. Ich suchte nach ihm, aber er war nicht mehr da. Mutti hatte ihn einfach entsorgt.
»Der war doch kaputt. Ich schenk Dir einen Neuen«, tröstete sie mich. Ich aber wollte keinen Neuen. Ich wollte MEINEN Teddy wiederhaben.
Teddy war wohl so ziemlich das Erste in meinem Leben, das ich liebte, niemals hergeben wollte, und trotzdem verlor.
Damals ahnte ich nicht, dass ich in meinem späteren Leben noch vieles, was ich liebte und was mir wichtig war, verlieren sollte.
**********
Irgendwann in dieser ärmlichen Zeit, leistete sich mein Vater einen unvorstellbaren Luxus. Einen Fotoapparat mit der Markenbezeichnung »Agfa-Klack«. Ein klobiges rundliches Ding. Der Apparat musste, wenn der Auslöser betätigt wurde, extrem ruhig gehalten werden. Andernfalls waren die Fotos dermaßen verwackelt, dass kaum noch etwas zu erkennen war. Wenn man ihn jedoch ruhig hielt und dann der Knopf gedrückt wurde, machte es unüberhörbar »Klack!«
Ich wurde in allen erdenklichen Situationen fotografiert. Was bewies, dass meine Eltern eine gewisse Begeisterung für mich entwickelt hatten. Ich war eben der Nachzügler. Und, das behauptete meine Mutter jedenfalls, ein aufgewecktes Kerlchen.
Trotz permanenter Knappheit in der Haushaltskasse wurde für mich in die aktuellsten Outfits investiert. So wurde ich mal in einen Matrosenanzug, oder auch in eine Lederhose mit passender Jacke und Filzhütchen gesteckt. Diese Montur nannte man Ende der 50er Jahre »Seppl-Anzug«. Damals der neueste Chic!
Für Spielzeug blieb dann allerdings nicht viel übrig. Ich erinnere mich aber, dass ich irgendwann später - zu Weihnachten - ein Gewehr bekam, mit dem man Korken abschießen konnte. Und einen Cowboyhut nebst Weste, mit passendem Pistolenhalfter. Der Hit zu der Zeit war es nämlich, in der umliegenden Wildnis Höhlen zu bauen und sich dem »Cowboy-und-Indianer-Spiel« hinzugeben. Heute nennt sich sowas »Ego-Shooter« und wird am Computer gespielt.
Nun hatte ich also die passende Ausrüstung und konnte wenigstens in diesem Fall mit meinen Altersgenossen aus unserem Dorf mithalten.
Wir Kinder hielten uns größtenteils draußen auf. Es war egal, ob die Sonne schien, ob es schneite oder regnete. Wir waren immer an der frischen Luft. Und auf alles waren wir neugierig. Das Leben war ungemein spannend! Und am interessantesten waren natürlich alle Dinge, die nicht erlaubt waren. Einer der wenigen Zustände, die sich auch bis heute kaum geändert haben.
Damals hatten die Bauern ihre Höfe noch direkt im Dorf. Erst Jahre später - im Rahmen der Flurbereinigung - wurden sie in die Nähe ihrer Felder umgesiedelt.
Daher ergab sich natürlich für uns Kinder die Möglichkeit, in den Scheunen der Landwirte auszukundschaften, was es doch für interessante Landmaschinen gab. Trecker, Mähdrescher, Viehanhänger und sonstige Geräte. Und die eigneten sich hervorragend zum Spielen. Dass man sich nicht erwischen lassen durfte, gab uns noch den zusätzlichen Kick. Wenn der Bauer uns allerdings doch manchmal auf frischer Tat ertappte, gab’s vor Ort direkt die erste Ohrfeige und anschließend zuhause die Zweite von den Eltern.
Besonderen Spaß machte es, in den Heuhaufen auf den Koppeln herumzutoben. Sie waren so herrlich weich und man konnte sich prima darin verstecken. Dazu kam noch dieser einzigartige, unbeschreibliche Duft des warmen Strohs.
Eines Tages nahmen zwei Freunde und ich wieder mal so einen Haufen in die Mangel. Wir kletterten nach ganz oben in die Spitze und sprangen umher.
Was wir jedoch nicht sehen konnten, war der Stacheldraht auf der Zaunbegrenzung. Denn durch unsere Herumbalgerei hatten wir den Heuberg schon ziemlich auseinandergewühlt. Und große Teile vom Stroh hatten sich bis über den Weidezaun verteilt.
Wir hüpften hin und her und ich sprang vom oberen Punkt des Heubergs, hinunter in den durchwühlten unteren Bereich. Immer wieder und wieder.
Ein stechender Schmerz zog durch meinen rechten Oberschenkel.
Ich war mitten in den Stacheldraht gesprungen - alles war voller Blut. Als ich dort hinsah, von wo der Schmerz kam, durchfuhr mich ein riesiger Schreck. Der Draht hat mein rechtes Bein zwischen Oberschenkelhals und Knie aufgeschlitzt. Kleine Fleischfetzen hingen aus dem Spalt an meinem Bein. Ich stand völlig unter Schock! Und meine Kumpels schleppten mich weinend und blutend nach Hause.
Mutter war entsetzt. Aber anstatt tröstender Worte gab’s eine schallende Ohrfeige. »Was fällt Dir ein, den Bauern das Heu zu zertrampeln!« Dann holte sie den Verbandskasten aus einer Schublade, nestelte eine Binde und Pflaster heraus und versorgte meine Wunde. Ich heulte immer noch, denn es tat fürchterlich weh. Normalerweise hätte die Verletzung an meinem Bein sofort genäht werden müssen, aber Mutti benötigte nur einen großen Pflasterstreifen. Zum Arzt brachte sie mich nicht.
**********
Ich war fast fünf Jahre alt, als mein Bruder Axel geboren wurde – Kind Nummer Sieben.
In der Hoffnung einen Spielkameraden zu bekommen, konnte ich es gar nicht erwarten, dass der »Klapperstorch« endlich mit dem ersehnten Geschwisterkind zur Landung ansetzt. Leider kann ich mich nicht mehr entsinnen, ob ich tatsächlich an diesen fliegenden Baby-Transporteur geglaubt habe.
Aber dann war er da! So ein kleiner Kopf. Und auch der Rest - so winzig. Die Erwartung jetzt einen Kumpel zu haben, wurde vorerst leider durch den permanenten Zustand von Babygeschrei und vollgekackten Windeln zunichtegemacht. Pampers gab’s zu der Zeit nicht, so dass diese gut gefüllten Stoffwickel das ohnehin zahlreiche Schmutzwäscheaufkommen immens steigerten.
Aber Brüderchen wuchs. Und das ließ mich dann irgendwie wieder hoffen.
Der nächste Höhepunkt meines jungen Lebens ereilte mich an meinem sechsten Geburtstag. Nachdem ich die üblichen Geschenke in Form von Socken, Hemden und sonstiger Grundbekleidung überreicht bekam, sagte mein Vater: »So, jetzt gehen wir in die Stadt zum Kaufhaus Grimme - und kaufen Dir ein Fahrrad.«
Ich glaube, dass ich später in meinem Leben dieses entstehende Glücksgefühl nur hatte, als ich mit meiner Frau vor dem Traualtar stand. Oder als meine Kinder geboren wurden. Einfach unbeschreiblich!
Wir kauften den Drahtesel. Ein Jungenfahrrad mit Stange - in Silber und Rot. Und ich durfte die ca. 5 km Wegstrecke nach Hause schon mal fahren üben. War garnicht so einfach. Aber durch mein Gefühl der Glückseligkeit wurde ich trotz einiger, wenn auch schmerzhafter, Stürze immer sicherer.
Jetzt verbrachte ich meine Zeit nur mit einer Sache – Fahrrad fahren!
Als ich drei Monate später eingeschult wurde, bekamen alle Schulanfänger zur Begrüßung ein Kärtchen mit ihren Namen zugesteckt. Auf diesem Kärtchen war zusätzlich ein kleines gezeichnetes Bild, welches etwas über die Eigenarten des Kindes aussagen sollte. Und auf meinem Kärtchen war ein Junge auf einem Fahrrad!
Ja, die Lehrer kannten ihre neu ankommenden Schüler bereits. Auch das war eine der Besonderheiten des dörflichen Lebens - am Anfang der 60er Jahre.
Ich wurde Ostern 1961 in die Volksschule Osterrönfeld eingeschult. »Volksschule« heißt heute Grund- und Hauptschule. Als weiterführende Schulen gab es die »Mittelschule« sowie die »Oberschule«.
Unsere Lehranstalt war eine kleine Dorfschule mit acht Klassen. Allerdings war diese in der Regel mit maximal 15 Schülern pro Klasse gefüllt und der Unterricht fand noch an sechs Tagen, also auch Samstags, statt.
Die damaligen Lehrer waren ausnahmslos sehr streng, und des Öfteren gab’s Ohrfeigen. Oder schmerzhafte Züchtigungen mit dem Zeigestock.
Die bunten modischen Schultaschen der heutigen Grundschüler gab es ebenfalls noch nicht. Unsere Taschen hießen »Ranzen« oder »Tornister« und waren aus echtem Leder, also sehr haltbar. Gefüllt nur mit dem Nötigsten - Schiefertafel, Kreidegriffel, Lesebuch, Rechenbuch. Dass ich im Alter Rückenprobleme bekommen sollte, kann also nicht an der Schwere unserer Schultaschen gelegen haben.
Später kamen noch Buntstifte, Lineale und Füllfederhalter dazu.
Auch achteten die Lehrer extrem auf Sauberkeit und Ordnung. Und so mussten die, von der Schule zur Verfügung gestellten Bücher, akkurat in Packpapier eingeschlagen sein. Mutti konnte das besonders gut. Liegt wohl in der weiblichen Natur, denn Frauen können auch Geschenke immer besser verpacken. Männer tun sich in dieser Beziehung oft sehr schwer.
Fräulein Szutnakowski war meine erste Klassenlehrerin. Eine resolute männerlose Endvierzigerin von kleiner drahtiger Statur, mit festem hochgestecktem Haarknoten und Nickelbrille. Eine, für uns Kinder, absolute Respektsperson. Und das war sie nicht nur für die Schulanfänger, sondern auch für die Schüler der oberen Klassen.
Und weil ich gerade von Respektspersonen rede - bei uns im Dorf war das ganz klar geregelt. Die Personen, die am meisten zu sagen hatten, waren der Rektor der Schule und seine Lehrer, der Bürgermeister, der Dorfpolizist und nicht zu guter Letzt - der Wirt des Dorfkrugs.
Vor diesen Honorigkeiten hatten wir Schüler einen mächtigen Respekt. So war auch die Redewendung gang und gäbe, wenn wir gegenüber Erwachsenen Missfallen erregten: »Das sag ich Deinem Lehrer!« Und dann setzte es tatsächlich am nächsten Tag in der Schule Prügel.
Einen Vorteil gegenüber der heutigen Schülergeneration hatten wir dadurch allerdings. Wir wussten zwischen Anständigkeit, Unanständigkeit, und anderen Verhaltensregeln sehr gut zu unterscheiden.
Dabei fällt mir ein - während der Schulzeit meiner Tochter, entdeckte ich an ihrer Schultasche einmal einen Aufnäher, den sie dort selbst angeheftet hatte. Er trug die Aufschrift »Lernen durch Schmerz«. Der Erfinder dieses Spruches muss wahrscheinlich meine damalige Klassenlehrerin gewesen sein!
Ich denke ich war ein braver, ordentlicher Schüler. Doch auch an mir ging der Kelch der körperlichen Züchtigung nicht vorüber. Hinzu kam, dass es auch zuhause wegen niederer Vergehen zusätzlich mächtig Prügel setzte.
Mein Vater ging dabei äußerst rabiat vor. Er hatte noch aus Wehrmachtszeiten einen Ledergürtel, den er als Erziehungshilfe für meinen Bruder und mich regelmäßig nutzte. Und das Besondere daran war das Koppelschloss. Darauf stand nämlich in altdeutschen Lettern »Gott mit uns«. Die Schmerzen, die dieser Riemen verursachte, sorgten dafür, dass ich schon in früher Kindheit ein etwas zwiespältiges Verhältnis zu Gott entwickelte.
Mutter bevorzugte übrigens für Bestrafungen den Kochlöffel.
Kapitel 3: Waschtag und ein Schwein
Mein Bruder Axel entwickelte sich für meine Eltern zu einem anstrengenden Bürschchen. Denn er war relativ resistent gegen elterliche Vorschriften. Und obwohl er vor den häuslichen Prügeln fürchterliche Angst hatte, nahm er sie doch immer wieder in Kauf.
Es gab zu jener Zeit absolut klare Bekleidungsregeln. Sonntags wurden wir zum Beispiel mit unseren »Guten Sachen« rausgeputzt. Diese Art von Uniform war, um sie zu schonen, nur dem Sonntag vorbehalten. Und auch - damit nachkommende Generationen diese dann eventuell weitertragen konnten.
Sie bestand aus weißen Hemden, gestärkt und gebügelt, am besten in Verbindung mit einer Fliege. Und Stoffhosen mit solch scharfen Bügelfalten, dass man sich daran fast Schnittwunden holen konnte. Dazu trugen wir weiße Söckchen, und nicht zu guter Letzt – schwarze hochglanzpolierte Lackschuhe.
Eines Sonntagmorgens waren wir mal wieder hübsch gemacht worden, weil die Familie bei Sonnenschein einen Spaziergang machen wollte. Axel war fertig gestylt und ging schon mal nach draußen. Unsere Eltern wollten uns ja nicht zu Stubenhockern erziehen. Deshalb jagten sie uns, unabhängig vom Wetter, immer nach draußen. Angeblich wegen der frischen Landluft. Und nebenbei konnten sie dadurch auch ohne Störung ihren häuslichen Arbeiten und Pflichten nachgehen.
Am Tage zuvor hatte es den ganzen Tag geregnet, so dass im sandigen Hofbereich noch mehrere größere Regenpfützen sichtbar waren.
Als meine Mutter aber zufällig durchs Wohnzimmerfenster nach draußen blickte, sah sie, dass Axel an einer dieser trüben Wasseransammlungen großen Gefallen gefunden hatte. Das drückte sich dadurch aus, dass er mitten in derselbigen stand und durch intensive Hüpfbewegungen dafür sorgte, dass ansehnliche Matsch-Fontänen entstanden. Und so hatte seine strahlendweiße Montur, durch die aufwirbelnde nasse Erde, in kürzester Zeit das Aussehen eines Tarnfleck-Anzuges angenommen.
Völlig ausser sich, riss sie das Fenster auf: »Axel! Sofort reinkommen! Das kann doch nicht wahr sein! Na, Dir werde ich helfen- Freundchen!«
Kurze Zeit später bekam Axel eine dermaßene Tracht Prügel, dass man daraus schließen musste, in Zukunft grundsätzlich ein auf äußerste Reinlichkeit achtendes Kind in seinem Hause zu haben. Doch weit gefehlt, wie sich später herausstellte.
Auf jeden Fall wurde es an diesem Tage nichts mehr mit einem Familienausflug und dem darin enthaltenen Genuss einer Portion Speiseeis.
Ein anderes Mal kam es zu folgender Anekdote.
Etwa 100 Meter von unserem Haus entfernt, hatte ein örtlicher Bauer seinen Hof. Daran angrenzend war ein kleines Feld, welches mit einem niedrigen Bretterzaun umgeben war. Auf diesem Feld suhlte sich die ansehnliche Schweinezucht des erwähnten Landwirtes. Und wie Schweine nun mal so sind, hatten sie dafür gesorgt, dass große Teile des Ackers schön durchgewühlt und moderig waren.
Der 4-jährige Axel hegte, aus welchem Grund auch immer, eine große Zuneigung zu diesen Tieren. Oft, auf dem Zaun sitzend, beobachtete er die Schweinchen. Und manchmal lockte er sie mit altem Brot oder Karotten, um dann großen Spaß daran zu haben, ihnen beim Fressen und Scheißen zuzusehen.
Es war wieder Sonntag und Zeit unseren adretten Feiertags-Dress anzulegen. Und so fein herausgeputzt, zog es Axel mal wieder auf das Schweinegatter. Eines der dicken, größeren Säue schubberte just seine Schwarte am Selbigen.
Brüderchen, in kindliche Gedanken versunken, kam in diesem Moment auf die Idee, doch einmal auszuprobieren, ob es sich auf so einem possierlichen Tierchen auch reiten ließe. Gesagt, getan - hangelte er sich vom Zaun herab auf das Borstenvieh.
Besagtes Schwein, irritiert von der unnatürlichen Last auf seinem Rücken, setzte sich sofort in Bewegung, um den Parasiten abzuschütteln. Doch der verfügte über einen erstaunlichen Gleichgewichtssinn. Das Schweinchen rannte los. Und durch unablässige Bocksprünge schaffte das Tier es dann doch, seinen Reiter abzuwerfen. Mein Bruder landete in hohem Bogen, direkt in der Mischung aus Matsch, Wasser und Exkrementen. Das Sonntags-Outfit war nun völlig außer Form geraten, und hatte dazu noch diesen eigenartigen Geruch angenommen. Einen Geruch, von dem man meint - wenn man ihn erst einmal in der Nase hat - dass man ihn nie wieder los wird. Jeder, der einmal die Düfte eines viehhaltenden Bauernhofes erschnüffeln konnte, kann sicherlich nachvollziehen, was ich meine.
Was anschließend zu Hause passierte, erspar ich mir zu schildern. Viel später habe ich dann aber verstanden, was es damals für eine Wahnsinnsarbeit war, die Familie zu versorgen und im Besonderen derer Wäsche sauber zu halten.
Es fiel immer ein Berg von Wäsche an, die es zu reinigen galt. Denn Mutter war sehr daran gelegen, dass wir sauber und adrett rumliefen. Auch die Arbeitsklamotten meines Vaters wurden nicht, wie heute oft üblich, vom Arbeitgeber gereinigt. Nein, die wurden ebenfalls zuhause gewaschen und natürlich auch gebügelt. An eine dieser neumodischen sehr teuren Waschmaschinen war nicht zu denken und die Trocknung der gewaschenen Bekleidung übernahm der Wind, der ja bekanntermaßen im Norden heftig weht.
Im Keller unseres Hauses gab es eine Waschküche, die abwechselnd nach festem Plan von den Mietern genutzt wurde. Diese Waschküche bestand aus einem riesigen Waschtrog, der fest auf einer mit Kohle zu befeuernden Feuerstelle stand. Und das Wasser im Trog musste morgens - an dem Tag, an dem man die Waschküche nutzen durfte - erst einmal mit Holz, Koks und Briketts aufgeheizt werden.
Wenn der Waschofen befeuert und das Wasser heiß war, hatte Mutter die Berge an Schmutzwäsche schon körbeweise runtergeschleppt und im Waschkübel die Seifenlauge angesetzt.
So stand sie dann, mit Kittel und Kopftuch bekleidet, über jenem Kübel und walkte die Wäsche durch. Mithilfe eines riesigen Paddels, wie man sie an Ruderbooten nutzt. Ein enormer Kraftaufwand!
Wenn dann eine Fuhre durchgewaschen war, kam die nächste dran. Da musste eine Frau schon kräftig gebaut sein, um das zu schaffen.
Anschließend wurde die Wäsche von Hand ausgewrungen und zum Trocknen nach draußen an die vorhandenen Wäscheleinen gehängt, bzw. auf dem Trockenboden unterm Dach.
Meistens dauerte es länger als einen Tag, bis die Wäsche durchgetrocknet war. Und im Winter waren die Handtücher manchmal steif wie Bretter – zu Eis gefroren.
Für mich war der Waschtag immer ein Horrorszenario. Wenn ich aus der Schule kam, standen überall Körbe mit Bergen von Wäsche herum, und die ganze Wohnung roch nach Seifenlauge.
Mutter hatte aus Zeitknappheit schnell ein dünnes Süppchen gekocht (eigentlich waren unsere Suppen immer dünn), und war arg im Stress. Ungemütlicher ging’s kaum. Damals habe ich mir vorgenommen, wenn ich mal erwachsen bin, als Erstes eine dieser neuen modernen Waschmaschinen für meinen eigenen Haushalt anzuschaffen.
Am Abend des Waschtages ging’s dann munter weiter. Die ganze Familie war im Wohnzimmer versammelt, um die getrocknete Bettwäsche zu recken. Das hieß, die Laken und Bettbezüge wurden über die Ecken mit Ruck in ihre ursprüngliche Form gezogen. Ich hasste diese Prozedur! Und ich meinte zu erkennen, dass es Vater ähnlich ging.
Fast den ganzen nächsten Tag stand meine Mutter dann hinter dem Bügelbrett. Und während Mutti das Plätteisen schwang, saß ich nach dem Abarbeiten meiner Hausaufgaben am Küchenfenster, sah hinaus und wünschte, dass ich eines Tages reich sein würde, und Mutti nie mehr Wäsche waschen müsste.
Ein schrilles Quieken drang in meine Ohren und riss mich aus meinen Träumen von elektrischen Waschmaschinen und Bergen von Banknoten. Mein Blick auf den Innenhof zeigte mir, dass dort gerade der mobile Schlachtermeister des Ortes, dem Schwein eines Nachbarn die Vorder- und Hinterbeine zusammengebunden hatte. Dann setzte er sein Bolzenschussgerät hinter dem Ohr des Tieres an. Ein dumpfes Klacken; und das Schwein brach zusammen.
Ein Gehilfe hielt derweil einen Eimer bereit. Und als der Metzger die Klinge eines großen Messers in den Hals des Tieres rammte, schoss das warme dunkelrote Blut stoßweise in den Behälter.
Neugierig beobachtete ich, wie einige Männer die aufgeschlitzte tote Sau auf eine Holzleiter banden. Dann wurde der dampfende Leib mit schnellen, jedoch langen Schnitten, geöffnet.
Da es bereits Herbst war, ließ die Wärme des offenen Schweinekörpers die kalte Novemberluft dampfen.
Einige Frauen schleppten eimerweise kochendes Wasser heran und übergossen damit das hängende Vieh. Die Männer begannen sofort die Borsten von der Schweineschwarte zu kratzen, während eine andere Nachbarin unermüdlich das warme Blut im Eimer rührte, damit es nicht gerinnen konnte. Denn sonst wäre es mit der Blutwurst, die daraus fabriziert werden sollte, wohl nichts geworden.
Das Schauspiel der Hausschlachtung dauerte den gesamten Nachmittag. Der Veterinär kam, begutachtete das Fleisch des toten Tieres, drückte violette Stempel auf die entborstete Schwarte; und dann wurde das Fleisch mit scharfen Messern durch flinke geübte Hände zerteilt.
Am nächsten Tag war das Thema Schmutzwäsche erledigt und auch bei uns stand Grützwurst mit Bratkartoffeln auf dem Speiseplan.
Mutti achtete sehr auf geregelte Mahlzeiten, und deshalb gab es zeitlich einen klar abgesteckten Rahmen. Frühstück war um 8, Mittagessen um 12, Abendbrot um 18 Uhr. Nur an den Wochenenden gab es um Punkt 15 Uhr zusätzlich noch Kaffee und Kuchen.
Auch meinem Vater war dieser Zeitplan sehr wichtig, denn das Ganze hatte natürlich seine Berechtigung. Bei Nichteinhaltung konnte meine Mutter die häuslichen Arbeiten nämlich terminmäßig nicht auf die Reihe kriegen. Denn wenn Vati von der Arbeit heimkam, hatte sein Essen auf dem Tisch zu stehen. Ansonsten hätte es mächtig eheliche Reibereien gegeben.
Nur an den Sonntagen sorgte er selbst manchmal dafür, dass es zu Störungen dieses Routinezeitplans kam. Denn dann gönnte er sich, nach dem Frühstück, einen Besuch in seiner örtlichen Stammkneipe, dem »Fährstübchen«.
Das Ritual des dortigen Frühschoppens ließ er sich nie nehmen. Er genoss ein paar Gläser Bier der Holsten-Brauerei und drosch mit anderen Männern des Dorfes einen zünftigen Skat.
Schon damals existierte der Spruch: »Holsten knallt am Dollsten!«
Das eine oder andere Mal wurden aus wenigen Gläsern Holsten, mehrere. Und während des Skatspielens vergaß Vater die Zeit, und seine Prinzipien einer geregelten Mahlzeiteinnahme.
Wenn an diesen Sonntagen die Kartoffeln bereits gar, aber mein Vater noch nicht in Sichtweite war, schickte mich meine Mutter in besagte Kneipe. Um meinen Vater daran zu erinnern, dass das Mittagessen auf dem Tisch stand.
Mein Vater war bereits mächtig angesäuselt, winkte ab und sagte mir, dass er gleich kommen würde. Wir sollten schon mal ohne ihn anfangen.
Also lief ich wieder zurück zu Muttern und gab die väterliche Information weiter. Mutti schäumte natürlich vor Wut!
Nach etwa einer Stunde tauchte mein Vater dann endlich bierselig auf, gestützt von seinen Skatbrüdern.
Mutti explodierte beim Anblick des Zustandes meines Vaters und warf ihm diverse Schimpfwörter an den Hals. Mein Vater winkte jedoch abermals ab, nuschelte irgendetwas das sich anhörte wie »Lass mich in Ruhe«, und steuerte das elterliche Schlafzimmer an, um seinen Rausch auszuschlafen. Meine Mutter war stinksauer, und den Rest des Tages herrschte bei uns dicke Luft.
Auch andere Männer waren in der damaligen Zeit dem Biertrinken sehr zugetan. Und den Frauen war das natürlich zuwider. Zum Einen mussten sie das Gelalle ihrer besoffenen Kerle ertragen, und zum Anderen schmälerte die Sauferei die ohnehin karge Haushaltskasse.
Da der ausstehende Arbeitslohn am Ersten des Monats direkt an die Arbeiter ausgezahlt wurde, holten die sich am Ende des Arbeitstages ihr sauer verdientes Entgelt im Firmenbüro ab. Und der erste Weg führte sie dann oft in die nächste Kneipe, um gutgelaunt den Erhalt ihrer Lohntüten zu feiern.
Den Ehefrauen war das natürlich ein Dorn im Auge. Und so beschlossen einige von ihnen, zu Feierabend vor den Arbeitsstellen ihrer Göttergatten aufzutauchen. Dort nahmen sie ihre Kerle mitsamt den Lohntüten in Empfang und geleiteten sie auf direktem Wege nach Hause – in großem Bogen an der Stammkneipe vorbei.
Aus der Not heraus hatten diese Frauen wahrscheinlich maßgeblichen Anteil an der Erfindung des Girokontos.
Kapitel 4: Schock und Enttäuschung
Nach der Schule traf ich mich immer mit meinen Kumpels. Wir streiften durchs Dorf und vertrieben uns die Zeit mit manchem Schabernack. Irgendetwas fiel uns immer ein. Ich kann mich erinnern, dass selten Langeweile aufkam. Trotz des Fehlens von Playstation und Handys!
Manches Mal spielten wir aber einfach nur Verstecken. Einer von uns stellte sich mit dem Gesicht zu einem Baum, verschloss seine Augen mit den Händen - und zählte langsam bis zwanzig. Solange hatten dann die anderen Zeit, sich ein Versteck zu suchen. Anschließend machte sich der »Baumsteher« auf die Suche. Wenn er dann das Versteck eines Spielkameraden entdeckt hatte, hieß es loszuspurten und vor dem Entdeckten an den »Zählbaum« zu klatschen. Wenn man dann alle Verstecke nach und nach entdeckt hatte, war der Erstgefundene an der Reihe zu zählen und zu suchen. Dieses Spiel zog sich oft über den ganzen Nachmittag hin.
Eines Tages vergnügten wir uns mit dem »Versteckspiel« in der Nähe der Dorfkirche, im Obstgarten des Gemeindepastors. Der Sucher zählte an einem Baum, und die restlichen Kinder rannten los, um sich schnell ein möglichst gutes Versteck zu suchen. Ich spurtete hinter die Kirche und sah mich nach einem geeigneten Platz um. Aus den Augenwinkeln bekam ich noch mit, wie sich einige von uns in die Büsche schlugen.
Am Anbau der Dorfkirche entdecke ich eine kleine versteckte Treppe, die wohl in den Keller des Gemeindehauses führte. Dort unten, vor dem Kellereingang, konnte man sich sicherlich eine Zeitlang ungesehen aufhalten. Also die Treppe hinunter und dann mit dem Rücken an die Kellertür. Dabei stellte ich fest, dass sich der Türgriff bewegen ließ! Die genannte Tür schien also nicht verschlossen zu sein. Und wenn ich in den Keller hineingehen würde, überlegte ich mir, konnte man mich bestimmt nicht so schnell entdecken.
Vorsichtig öffnete ich die Tür und trat ein. Der Raum war dunkel und nur durch den Spalt in der Tür, deren Griff ich noch in der Hand hatte, drang spärlich Licht ein. Hastig sah ich mich um. Und erschrak!
Im diffusen Lichtkegel, der durch die angelehnte Tür eindrang, erkannte ich Särge. Und einige waren geöffnet. Mir wurde schlagartig bewusst, dass dies wohl die Leichenhalle mit den aufgebahrten, jüngst Verstorbenen des Dorfes war. Der Anblick der Toten in den offenen Särgen jagte mir einen unbeschreiblichen Schrecken ein. In Panik machte ich auf dem Absatz kehrt und rannte hinaus. Ob ich die Tür hinter mir schloss, weiß ich nicht mehr. Nur schnell weg von hier! Ich stolperte die Treppe hinauf. Raus aus diesem Grusel-Szenario!
Von nun an versuchte ich, besonders wenn die Dunkelheit anbrach, dem Kirchengebäude aus dem Weg zu gehen. Auch die Nähe des Friedhofs mied ich bei Einsetzen der Dämmerung.
**********
Unter meinen Altersgenossen gab es einige Familien, die finanziell weitaus besser als wir gestellt waren. Es gehörte leider auch nicht viel dazu. Und so erfuhr ich schon früh, was den Unterschied zwischen Arm und Reich ausmacht. Da war z.B. ein Klassenkamerad. Er war der Sohn des gutverdienenden Dorfarztes und hatte dadurch eine besondere Stellung in unserer Klasse und auch bei den Lehrern.
Andere Familien waren sogar Besitzer eines kleinen Häuschens. Das müssten Millionäre sein, kam es mir in den Sinn.
Wenn einige dieser Kinder Afri-Cola tranken, gab’s bei uns ein Glas Brunnenwasser, mit einem Teelöffel essigsaurem Natron und Zucker. Nur am Monats-Ersten manchmal etwas Brausepulver von »Frigo«. Erstaunlicherweise kann man das heute noch kaufen.
Was modische Kleidung anging, waren weiße Hemden aus Nylon stark angesagt. Viele hatten so ein Hemd, aber diese schicken Teile waren teuer. Aus diesem Grund besaß ich so etwas auch nicht. Und Jeans, damals ein aufkommender Trend aus den USA, waren bei meinen Eltern verpönt. »Nietenhosen« wären etwas für die Arbeit, sagten sie. So schaute ich immer neidisch auf meine Altersgenossen, die etwas Derartiges trugen.
Beim »Vogelschießen« - eine Art jährliches Schulfest - machte ich einmal innerhalb meiner Klasse den 2. Platz. Dem Ersten stand als Preis ein Nyltest-Hemd zu. Ich hatte nun das unfassbare Glück, dass der »König« schon ein solches besaß und lieber den Preis für den 2. Platz einsackte. Und durch diesen glücklichen Zufall bekam ich dann doch dieses heißersehnte, top-modische, Kleidungsteil.
Auch meine Geburtstage konnte ich nicht mit Freunden feiern, denn das waren zusätzliche Ausgaben für meine Eltern.
Ich habe mich immer fürchterlich dafür geschämt, dass ich niemanden einladen durfte. Und wenn mich die Klassenkameraden am Tage meines Wiegenfestes danach fragten, was ich denn für tolle Sachen geschenkt bekommen hätte, log ich das Blaue vom Himmel. Denn in Wirklichkeit gab es irgendwelche Sachen zum Anziehen und dann nur noch ein kleineres Spielzeug. Hätte ich die Wahrheit gesagt, wäre ich deswegen gehänselt worden. Und da ich auch körperlich einer der Schwächeren war - dünn und klein - bot ich für solche Dinge nunmal eine prima Angriffsfläche.
Meine Familie war nicht nur arm, sondern an uns haftete auch der Makel der »Flüchtlingsfamilie«. Ich habe das als kleiner Junge mit etwa acht Jahren aber nie richtig begriffen. Erst nach und nach fing ich an, mir darüber Gedanken zu machen.
Das einschneidenste Erlebnis hierzu hatte ich, als ich die 4. Klasse der Grundschule besuchte.
Zu Beginn des Schuljahres bekamen wir eine Klassenlehrerin, die neu in der Schule angestellt war und nicht im Dorf, sondern in der Stadt wohnte. Frau Schlüter war eine ältere Dame - jedenfalls aus der Sicht eines Zehnjährigen. Für mich waren Menschen, im Alter über 20 Jahre, schon allesamt richtige Erwachsene. Diese Meinung teile ich heute nicht mehr so ganz. Und über 50-Jährige - waren Omas und Opas. Auch hierzu hat sich meine Einstellung geändert.
Jedenfalls war Frau Schlüter eine sehr einfühlsame Lehrerin, die versuchte, für jeden Schüler Verständnis - in Bezug auf seine Stärken und auch Schwächen - aufzubringen. Um ihn, dank ihrer Einschätzung, auf die richtigen Bahnen zu lenken. Ihr Ziel war es, das Optimale aus jedem Einzelnen herauszuholen.
Vor der Bekanntschaft mit dieser Lehrerin hatte ich oft das Gefühl, von den Lehrkräften nachteilig behandelt zu werden. Denn obwohl ich eigentlich immer zu den 3 bis 4 leistungsmäßig besseren Schülern meiner Klasse gehörte, bekam ich seltener Belobigungen als andere.
Bei Frau Schlüter hatte ich plötzlich das Gefühl, dass sie meine Fähigkeiten erkannte und ihr es völlig egal war, welche gesellschaftliche Stellung meine Eltern hatten. Oder wieviel Geld wir besaßen. Ich verspürte einen enormen Motivationsschub. Und das verdankte ich ihr.
Auch meine zwei besten Freunde, Klaus und »Wippi«, waren begeistert von der neuen Lehrerin. Allerdings auch der Großteil unserer Klasse.
Als sie eines Tages Geburtstag haben sollte, sind wir losgegangen und haben an einen Nachmittag, auf den Wiesen unseres Dorfes, einen riesigen Feldblumenstrauß für sie gepflückt. Frau Schlüter war, als wir ihr am nächsten Tag den Strauß überreichten, sichtlich gerührt.
Sie bekam an dem Tag noch mehrere Sträuße und Geschenke, so dass sie Probleme hatte, diese vielen Präsente nach Hause zu bringen. Sie wohnte ja in der Stadt und pendelte mit dem Bus zwischen Heim- und Arbeitsstätte.
Deshalb boten wir drei Freunde uns an, ihr zu helfen. Wir wollten die Sachen gemeinsam zu ihr nach Hause tragen. Frau Schlüter willigte ein, und als wir in ihrer Wohnung angekommen waren, gab’s zur Belohnung heißen Kakao, Kekse und Kuchen.
Zu dieser Zeit waren die Beatles sehr populär und wir Jungs konnten die Texte derer Songs in- und auswendig.
»She loves you, yeah yeah yeah...« oder »I want to hold your hand...«
Meine Eltern sprachen zwar mit Abscheu von diesen »Langhaarigen« und ihrem »Hottentotten-Radau«, aber wir liebten die sogenannte Beatmusik.
Frau Schlüter war völlig anders. Mit ihr konnten wir über John, Paul, George und Ringo reden und fühlten uns von ihr verstanden.
Da sie im Allgemeinen der Musik sehr verbunden war, stand in ihrer Wohnung ein Klavier, und an der Wand hing eine wunderschöne Laute. Ich fand Musikinstrumente immer schon faszinierend und konnte meinen Blick garnicht von diesen tollen Dingen abwenden.
Nach Kuchen und Kakao spielte sie uns dann etwas auf dem Klavier vor. Da wir wie gesagt die Texte der Beatles auswendig, aber den englischen Inhalt nicht verstehen konnten, versprach sie uns, die Worte ins Deutsche zu übersetzen. Damals gab’s Englischunterricht erst ab der Klasse 7.
Ein paar Tage später übergab sie meinen Freunden und mir die von ihr handschriftlich übersetzten Texte unserer Idole.
Frau Schlüter war es auch, die meine Liebe zum Zeichnen förderte. Einmal durfte ich in einer Pause eine Seitentafel, mithilfe bunter Kreide, bemalen. Eine Dschungel-Landschaft mit Palmen, Lianen, Tigern, Löwen und Elefanten. Aus heutiger Sicht für einen 10-jährigen Knirps ein tolles Bild. Und meine neue Lehrerin sagte mir, sie wäre überzeugt davon, dass ich später einmal irgendetwas Künstlerisches machen werde.
Das Ende der Grundschule näherte sich und ich hatte den Wunsch, anschließend eine weiterbildende Schule in der Stadt zu besuchen. Der Sohn des Arztes gehörte zwar zu den nur mittelmäßigen Schülern. Jedoch aus beiläufigen Bemerkungen meiner vorherigen Lehrerin war für mich ersichtlich: »Der hat schon einen Platz auf der Oberschule« (der damalige Name für das Gymnasium).
Ich meinerseits wäre schon zufrieden gewesen, für die Realschule (damals Mittelschule) vorgeschlagen zu werden. Denn ich träumte davon, eines Tages durch eine bessere Bildung einen Beruf erlernen zu können, der mich zu Ansehen und gutem Auskommen bringen würde. Sicher würde ich dann ein Fernsehgerät haben und ein Auto fahren - also ein Leben führen, das völlig anders als das meiner Eltern wäre.
Die Zeit der Zeugnisvergabe rückte näher und Frau Schlüter teilte uns, bereits einige Tage zuvor, schon einmal unsere zu erwartenden Zeugnisnoten mit. Ich hatte meine ohnehin ganz ordentlichen Zensuren in den meisten Fächern um eine Note verbessert und sah mich bereits als Mittelschüler. Doch zu meiner Verwunderung war ich bei der Vergabe der Zeugnisse wieder auf dem alten Stand.
Unser Rektor, Herr Weiß, war nämlich nicht mit der Zensurenvergabe von Frau Schlüter einverstanden und ordnete an, mein Zeugnis zu überarbeiten.
Etwa 6 oder 7 Jahre später - ich war bereits in der Lehre - begegnete ich Frau Schlüter in der Einkaufsstrasse unserer Stadt. Wir freuten uns beide, und sie lud mich in ein Café ein. Ich erzählte von mir, und sie von sich.
Sie hatte nach drei Jahren auf eigenen Wunsch die Schule gewechselt. Und während des Gesprächs verriet sie mir auch die Umstände meiner Zeugnisänderung aus der 4. Klasse. Damals hatte sie einen mittelschweren Anschiss von Rektor Weiß bekommen, da sie mich seiner Meinung nach zu vorteilhaft bewertet hätte. Dabei hatte ich während meiner gesamten Grundschulzeit kaum eine Unterrichtsstunde mit Herrn Weiß verbracht. Wieder hatte ich das Gefühl, dass das Leben unfair zu mir sei.
Egal - ich hätte trotzdem zur Realschule wechseln können. Doch da spielten meine Eltern nicht mit. Sie befürchteten nämlich, dass dann Kosten für Schule, Bücher und eventuelle Klassenfahrten (welche den Geldaufwand eines Wandertages weit überschreiten würden) auf sie zukommen könnten. Und so hörte ich immer wieder den Spruch: »Ein guter Volksschüler ist besser als ein schlechter Mittelschüler!« Und das war’s dann.
Ich jammerte und bettelte, aber nichts war zu machen.
So ergab ich mich letztendlich meinem Schicksal. Und zu Beginn des neuen Schuljahres wurde auch mein Bruder eingeschult.
Kapitel 6: Der erste Fernsehapparat
Im Jahr 1966 sollte in England, dem Mutterland des Fußballs, die Weltmeisterschaft stattfinden. Mein Vater, der in jungen Jahren selbst aktiv spielte, fieberte diesem Ereignis entgegen. Daher empfand ich es immer als äußerst merkwürdig, dass ich nicht die Erlaubnis bekam, der Fußballsparte unseres Stadtvereins beizutreten. Die Begründung meiner Eltern bestand nur aus einem Satz: »Du kommst uns nicht mit gebrochenen Knochen nach Hause.« Ich hegte allerdings die Vermutung, dass sich meine Eltern mehr um die dabei entstehenden Kosten für die Fußballausrüstung Sorgen machten, als um meine zerbrechlichen Kinderbeine. Dabei gab’s auch damals schon Schienbeinschützer. Auch kannte ich keinen meiner balltretenden Kumpels, denen Ähnliches passiert war - außer einigen blauen Flecken, aufgeschrammten Knien, etc. Obwohl zu der Zeit mit Fußballstiefeln der Marke »Adidas Schuss« gespielt wurde.
Dieses Modell gab es tatsächlich! Und die Bezeichnung Stiefel war auch zutreffend. Die Ähnlichkeit mit den heutigen Sicherheitsarbeitsschuhen war verblüffend. Denn diese Fußballtreter waren ebenfalls mit einer runden Stahlkappe im Zehenbereich ausgestattet. Ein Franz Beckenbauer hatte natürlich viel weichere. Aber für den Normalverbraucher waren solche Wohlfühl-Modelle unbezahlbar.
Mit unserem »Sondermodell Stahlkappe« konnte man allerdings kaum Ballgefühl erlangen. Aber der Ball erlangte mit dieser runden und harten Schuhspitze einen unnachahmbaren Drall, der den beteiligten Torhütern arg zu schaffen machte. Und wenn ich genau darüber nachdenke, könnte wahrscheinlich auch der Schienbeinschützer wegen dieser klobigen Treter erfunden worden sein.
Doch so weit so gut. Das Jahresereignis Fußballweltmeisterschaft stand nun bevor. Bei uns war zwar noch immer Ebbe in der Kasse, aber mein Vater schaffte es trotzdem, Mutter zu überreden, einen Fernsehapparat anzuschaffen. Keine Ahnung, wie er das bewerkstelligt hatte. Axel und ich waren jedenfalls wahnsinnig aufgeregt, obwohl die Programmvielfalt seinerzeit nur aus zwei Programmen bestand. Wir sollten endlich einen Fernseher bekommen!
Die Sendezeit ging damals nur von 14:30 Uhr bis 23:00 Uhr, aber am Nachmittag wurden eine Stunde lang Kinderfilme gesendet.
Die Helden unserer Lieblingssendungen hießen Jess Harper, in der Wildwest-Serie »Am Fuß der blauen Berge«, »Lassie« und »RinTinTin«. »Flipper« gesellte sich später auch noch dazu.
Dann war es endlich soweit.
Es gab da einen Radio- und Fernsehfritzen, der mit gebrauchten Geräten handelte - in einer kleinen Holzhütte am Stadtrand. Sein Geschäft mit Gebrauchtfernsehern war scheinbar sehr lukrativ, denn Jahre später wurde dieser Händler zum größten und erfolgreichsten Elektronik-Kaufhaus-Besitzer der Stadt.
Wir probierten verschiedene Apparate aus und Vati entschied sich für ein etwa zwei Jahre altes Gerät der Marke »Nordmende«. Natürlich war es ein Schwarz-Weiß-Fernseher, denn das »Buntfernsehen« gab es erst Jahre später.
Der Händler versprach, den Fernsehapparat nochmals zu überprüfen und ihn am folgenden Samstag zu uns nach Hause zu bringen. Dort würde er das Gerät noch persönlich auf- und einstellen. Da dieses Prachtstück 400 Deutsche Mark kostete, was etwa einem halben Monatslohn meines Vaters entsprach, schloss Vati mit ihm einen Ratenzahlungsvertrag ab.
Die Zeit bis zur Lieferung wollte nicht vergehen. Doch dann kam das gute Stück endlich. Die zusätzlich benötigte Antenne schraubten der Händler und sein Helfer auf das Hausdach, verlegten ein Kabel, und stellten die beiden Sender ein. Besonders scharf war das Empfangsbild nicht, aber für die damalige Zeit durchaus erträglich.
Die ersten Sendungen, die wir dann aufgeregt im Kreise der Familie ansahen, waren ein 30-minütiger Englischkurs und eine Folge mit irgendeinem dicken Fernsehkoch.
Einige Wochen später fand dann die Fußballweltmeisterschaft in England statt. Und wir waren live dabei!
Ich erinnere mich noch, dass es bei einer Übertragung draußen regnete und das Bild immer schlechter wurde - bis irgendwann nichts mehr zu sehen war. Nur noch Rauschen und Grieseln. Mein Vater tobte!
Mein Vater tobte auch, als es im Endspiel zu jenem legendären Tor der Engländer gegen Deutschland kam, das letztendlich unsere Mannschaft nur zum Vizeweltmeister machte. Kaum ein anderes Thema hat die Deutschen für viele Jahre so beschäftigt, wie dieses irregulär gegebene Endspieltor.