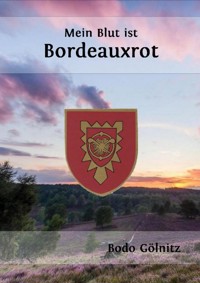Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der erste gemeinsame Urlaub lässt die Strapazen der vergangenen Monate vergessen. Die Restarbeiten am neuen Haus werden in Angriff genommen. Jetzt können sich Ina und Bodo mit der Familienplanung beschäftigen. Alles läuft nach Plan - und in Erwartung des ersten Kindes kann das Glück nicht vollkommener sein. Doch dann wird Ina krank - schleichend und unerwartet. Und an diesem Schicksalsschlag scheint plötzlich alles zu zerbrechen [...]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bodo Gölnitz
Wenn die Tage
ihre Farbe verlieren
Dieses Buch ist den Menschen gewidmet
denen meine ganze Liebe gilt:
Ina, Bastian und Marisa
Impressum
© 2017 Bodo Gölnitz
Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN (eBook-Ausgabe - Band 1) 978-3-7450-3777-7
ISBN (eBook-Ausgabe - Band 2) 978-3-7450-3778-4
ISBN (Print-Ausgabe - Band 1) 978-3-7450-3773-9
ISBN (Print-Ausgabe - Band 2) 978-3-7450-3774-6
Printed in Germany
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Wir alle müssen uns gelegentlich fragen,
was geworden wäre,
wenn Dinge völlig anders gelaufen wären.
Ein willkürlich eingeschlagener Weg,
ein überblättertes Kapitel
oder eine flüchtige Begegnung.
Alles hätte sich völlig anders entwickelt.
Kapitel 43: Das Einstiegspaket
Wir waren wieder zuhause und knackig braun. Gerade in den letzen Tagen des Urlaubs hatten wir uns alles gegeben. Um unsere Körperbräune ans Limit zu bringen, hatten wir uns sogar mit Olivenöl ohne Sonnenschutzfaktor eingerieben. Leider hielt die Farbe im norddeutschen Klima nur drei Wochen, obwohl nun auch hier die Sonne schien und wir uns viel draußen aufhielten. Das Grundstück sollte schließlich fertig werden.
Vor unserem Tunesien-Urlaub waren wir in unser neues Haus eingezogen. Ein aufregendes halbes Jahr harter Arbeit lag hinter uns. Nun hatte ich inmitten der Rasenfläche den versprochenen Baum gepflanzt. Eine bereits relativ großgewachsene Linde.
**********
Es dauert keine sechs Wochen, als mir Ina eines Abends freudig mitteilte, dass sie annahm, schwanger zu sein. In der letzten Urlaubswoche hatte sie mit der Pille ausgesetzt und nun war ihre Regel bereits überfällig.
»Wie bitte?«, fragte ich. »So schnell?« Ich war verblüfft.
»Ich hab mir bereits einen Termin beim Frauenarzt geholt«, entgegnete sie. Und ihre Augen hatten diesen besonderen Glanz.
Einige Tage später fuhr ich Ina nach Feierabend zu ihrem Arzt. Ich setzte sie vor der Praxis ab und ging noch in die Einkaufspassage, um irgendetwas zu besorgen.
»Wenn Du hier fertig bist, komm in die Stadt. Wir treffen uns am alten Rathaus«, hatte ich zu ihr gesagt.
»Okay. Länger als eine Stunde wird es wohl nicht dauern«, meinte sie.
Ich erledigte meine Besorgungen und setzte mich dann am Altstädter Markt auf eine Bank, beobachtete das geschäftige Treiben, und wartete darauf, dass Ina kommt. Aber es wurde bereits dunkel, als sie mit einer Einkaufstüte in der Hand am ausgemachten Treffpunkt erschien. »Tut mir leid, ich war noch kurz in dem Kosmetikladen«, entschuldigte sie die Verspätung.
»Na, und - was ist?«, fragte ich sofort.
»Fehlalarm«, sagte Ina mit traurigem Blick.
Ich nahm sie in die Arme. »Komm, davon geht die Welt nicht unter. Irgendwann klappt es schon.«
Für mich war es nicht besonders tragisch, obwohl ich nicht bestreiten will, dass ich mich tief in meinem Inneren doch ein wenig gefreut hätte. Nur Ina tat mir sehr leid. Ich wusste doch, wie sehr sie sich wünschte schwanger zu sein. Dabei war sie davon bereits so überzeugt gewesen. Wie mies musste sie sich wohl jetzt fühlen.
»Ist schon okay. Aber ich hatte mich nun mal so gefreut.« Ina nahm meine Hand und wir gingen zum Parkdeck, auf dem unser Wagen abgestellt war. Ich überlegte krampfhaft, wie ich sie aufmuntern könnte. Doch es fiel mir nichts auf die Schnelle ein. »Und jetzt?«, fragte ich.
»Jetzt fahren wir noch schnell zu ALDI. Es sind noch einige Lebensmittel zu besorgen«, antwortete sie.
Wir bezahlten am Parkautomaten und fuhren auf die Westtangente - eine größere Umgehungsstraße in unserer Heimatstadt.
An der ersten Ampel sprang das Lichtzeichen auf Rot. Ich bremste den Wagen ab und hielt. Ina kramte in der Einkaufstüte, die sie auf ihren Knien abgestellt hatte. »Hier. Ich hab Dir was mitgebracht«, sagte sie und legte mir etwas auf den Schoß. Ich lenkte meinen Blick von der Ampel zu dem Päckchen, welches Ina mir auf die Beine gelegt hatte. Irritiert sah ich sie an. Sollte das jetzt ein Scherz sein? Wenn ja, dann war der aber ziemlich makaber. Auf meinen Beinen lag ein Paket mit der Aufschrift: »Für die jungen Eltern«. Ein Grundausstattungs-Set mit Einweg-Windeln und Trockenmilch für Säuglinge.
Hinter mir hupten Autos, ... die Ampel stand auf Grün. Erschrocken fuhr ich an. »Was soll das denn?«, fragte ich verwirrt.
Ina grinste. »Herzlichen Glückwunsch. Du wirst Papa. Ich bin in der achten Woche.«
Völlig planlos fuhr ich bei der nächsten Möglichkeit rechts ran. Irgendjemand hupte wieder.
»Was hast Du gesagt?«, ich war völlig konfus.
»Du hast richtig gehört, Du wirst Papa«, lachte Ina, schlang die Arme um mich und gab mir einen Kuss. Ich war sprachlos. Da hatte ich mir noch vor Minuten das Gehirn zermartert, wie ich sie gefühlsmäßig wieder in die Spur bekommen könnte. Und Sie? Sie machte sich einen Spaß mit mir!
Aber jetzt kribbelte es in mir. Ja, ich fühlte mich beschwingt. Ach Blödsinn, beschwingt ist der falsche Ausdruck - ich fühlte mich sensationell!! Wir sind schwanger! Ich werde Papa!!!
Ich erinnere mich, dass ich feuchte Augen bekam. Und das mir, … wo ich doch eigentlich garnicht besonders scharf auf Nachwuchs gewesen war. Ich war unglaublich glücklich!!
Wir fuhren Feinkost-Albrecht an und luden den Einkaufswagen voll. Was wir einkauften, bekam ich garnicht mit. Meine Miene hatte irgendwie einen Krampf. Ich denke, jeder der mich ansah, musste denken: »Was grinst dieser Kerl eigentlich die ganze Zeit so dämlich.«
Und ich dachte unentwegt daran, wie es sich wohl anhören muss, … wenn so ein kleiner Knirps »Papa« zu mir sagt.
Schnell legte ich noch zwei Gläser saure Gurken in den Einkaufswagen.
**********
Ohne uns dessen im Moment bewusst zu sein - an diesem Tag änderte sich unser Leben schlagartig. Alles, was wir machten oder planten, hatte nun indirekt mit der freudigen Erwartung auf unser erstes Kind zu tun.
Wie damals, als wir vorhatten zu heiraten, riefen wir Inas Eltern und meine Mutter an und luden sie am Wochenende zu Kaffee und Kuchen ein. Nur diesmal machten wir keine Andeutungen.
Als wir gemütlich im Wohnzimmer zusammensaßen und erzählten, dass Ina schwanger sei, war die Freude natürlich groß. Schwiegermutter bemerkte jedoch: »So etwas hatten wir uns schon gedacht.« Und Mutti sagte freudig bewegt: »Wenn Dein Vater das noch erleben könnte.«
Das war auch mein Gedanke als Ina mir mitgeteilt hatte, dass ich selbst Vater werden würde. Und es schmerzte. In solchen Momenten fehlte Vati mir sehr.
Am liebsten hätten wir es der ganzen Welt mitgeteilt. Auch unsere Freunde und Bekannten erfuhren natürlich sehr schnell von unserem Glück. Als ich Axel in seiner Wohnung informierte, sagte er mit breitem Grinsen: »Da hast Du ja Glück gehabt, dass Du mal gerade so an der »Ochsen-Hochzeit« vorbeigeschlittert bist.«
Die Ochsen-Hochzeit ist der 5. Hochzeitstag. Jedoch nur, wenn man an dem Tage noch kinderlos war. Dann hängten die Freunde einen Kranz mit der Zahl 5 an die Tür und als Dekoration dienten hohle Hühnereier, manchmal sogar einen Rinderkopf.
Nächstes Jahr im August hätte man mir wahrscheinlich so ein Teil an die Tür gebaumelt - da war ich mir sicher, aber unser Kind sollte nun ja bereits zwischen Ende April und Anfang Mai geboren sein.
»Dann lass uns mal auf die Leistungsfähigkeit Deiner Lenden anstoßen!« Axel holte irgendetwas Hochprozentiges aus dem Schrank. »Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken.«
Ina machte genauso weiter wie vor der Schwangerschaft, obwohl ich sie immer wieder auf ihren Zustand hinwies. Zum Beispiel nicht mehr so schwer zu heben, wenn wir auf dem Grundstück Steine schleppten. Oder das Brennholz, welches wir für unseren Wintervorrat spalteten.
»Schwangerschaft ist doch keine Krankheit«, wimmelte sie meine Bedenken locker ab.
Ich begann mir Gedanken über die Gestaltung und Einrichtung des Kinderzimmers zu machen. Am liebsten hätte ich bereits Möbel gekauft. Doch Ina sagte immer, es wäre noch zu früh. Und dass es Unglück bringen würde ein Kinderzimmer einzurichten, wenn das Kind noch nicht da war.
Aber an den Wochenenden sahen wir uns in den Geschäften schon mal um, was man so brauchen würde, wenn der Nachwuchs kommt. Wir hatten dann immer ein kleines Notizbuch dabei, in das wir eintrugen, was man gerne hätte - oder haben müsste.
Kinderbetten, Wickelkommoden, Kinderwagen. Wir schrieben die Preise dahinter und stellten fest, dass alle diese Dinge enorme Summen verschlingen würden. Uns blieb nichts anderes übrig als einiges zu streichen, oder uns preisgünstigere Alternativen auszudenken. Alleine die Säuglingsbekleidung war sauteuer. Natürlich würden wir vieles von Freunden und Bekannten bekommen - einige hatten noch Babysachen zuhause liegen, aus denen ihre Kinder herausgewachsen waren. Aber Ina und ich hatten auch unseren eigenen Geschmack und gewisse Vorstellungen. Die Babyabteilungen in den Kaufhäusern hatten so viele schöne Dinge im Angebot. Wir konnten uns manchmal nicht sattsehen an Stramplern, Jäckchen, Mützchen und Söckchen.
Den ersten Kinderwagen wollte Mutti uns spendieren. Und eine Bekannte hatte ein wenig benutztes Kinderbettchen für uns aufgehoben. Aber eine Wickelkommode und einen Schrank würden wir uns noch kaufen müssen.
»Weißt du was, ich hab da eine Idee«, sagte ich eines Abends zu Ina, als ich mal wieder überlegte, wie ich das Kinderzimmer optimal und kostengünstig einrichten könnte, »Den Schrank bau ich selbst. Den montiere ich in der schrägen Wand. Da passt sowieso kein gekaufter rein. Und den Wickeltisch integriere ich gleich in meine Konstruktion. Das bekomm ich hin.«
Ich zeichnete meine Vorstellung auf ein Blatt Papier und überschlug die Kosten für das benötigte Holz.
Es war jetzt Anfang Dezember 1988 und Inas Bauch wölbte sich bereits. Doch ihr ging es gut. Schwangerschaftsbeschwerden hatte sie keine. Auch Heißhunger auf die sauren Gurken verspürte sie nicht. Nur auf Eiscreme war sie des Öfteren scharf.
Der Winter hatte relativ früh eingesetzt und Ina tobte mit unserem Hund draußen im Schnee. Sie lief voraus und Nora jagte hinterher. Ina war voller Lebensfreude. Unsere Nachbarin Lisbeth schimpfte mit ihr, als sie aus dem Küchenfenster sah, wie Ina im Schnee ausrutschte. »Ina, um Gotteswillen! Du bist schwanger. Das kannst Du doch nicht machen!«
Aber Ina lachte nur und brachte wieder den Spruch, dass Schwangerschaft doch keine Krankheit sei.
So allmählich konnte ich es einfach nicht abwarten. Während Ina Tapeten für das Kinderzimmer aussuchte, besorgte ich Holz und fing an, meinen Plan von dem Schrank in die Tat umzusetzen. Es funktionierte. Der Schrank mit integriertem Wickelplatz wurde genau so, wie ich es auf Papier gezeichnet hatte.
In einigen Monaten sollte es soweit sein. Also begannen wir nun doch zu tapezieren und zu streichen. Dort wo das Bett stehen sollte, malte ich, mit Liebe und bunten Wandfarben, ein großes Bild - einen Babysaurier, der aus seinem Ei schlüpfte. Vor einem zerklüfteten Berg, umgeben von Schlingpflanzen. Diese Szene hatte ich in einem der Kinderbücher gesehen, von denen bereits einige im Regal standen.
Wir hielten das Zimmer größtenteils in Blau. Komischerweise waren wir überzeugt, dass es ein Junge werden würde.
Am Anfang der Schwangerschaft war ich einmal mit beim Frauenarzt gewesen, als er eine Ultraschalluntersuchung durchführte. Damals hatten wir gesagt, dass es uns egal sei, ob es ein Junge oder ein Mädchen wäre. Hauptsache gesund!
Der Arzt hatte daher keine Aussage zu dem Geschlecht des Embryos gemacht. Es interessierte uns auch wirklich nicht. Aber es gab unweigerlich Momente, in denen wir gewisse Ängste spürten - ob mit dem Kind alles in Ordnung sei.
»Ein ganz natürlicher Vorgang«, meinte der Frauenarzt. Aber er könne uns beruhigen. Das Baby würde sich völlig komplikationsfrei entwickeln.
Als Inas Bauch bereits ordentliche Ausmaße annahm, rief sie mich oft zu sich. »Komm schnell! Es boxt wieder!«
Ich legte meine Hände auf ihren Bauch. Und wenn ich die Bewegungen spürte, durchfuhr mich ein Gefühl von Wärme und es kribbelte in meinem Nacken.
Manchmal legte ich mein Gesicht dorthin, wo ich Bewegungen ertastete, … dann sagte ich: »Hallo, hörst Du mich? Hier ist Dein Papa.« Und manchmal sang ich mit meinem Kopf auf Inas Bauch:
»La Le Lu, nur der Mann im Mond schaut zu.
Wenn die kleinen Kinder schlafen, dann schlaf auch Du.«
Und wenn ich sang, bildete ich mir oft ein, die Bewegungen würden kurz aufhören. »Ich glaube, mein Sohn hört mich« sagte ich dann zu Ina.
Natürlich fingen wir auch an, uns Gedanken um den zukünftigen Namen unseres Kindes zu machen. Das war garnicht so einfach. Wir legten Listen an, konnten uns aber trotzdem nicht festlegen. Irgendwie erzielten wir keine Einigung.
Bis zu dem Tag, als ich sagte: »Was hältst Du von Bastian?«
Vor Jahren lief mal eine Serie im Fernsehen, die »Unser Bastian« hieß. Ina kannte die Folgen ebenfalls und hatte sich als Kind immer auf jede Fortsetzung gefreut. Endlich waren wir uns einig!
Bei den Mädchennamen konnten wir uns recht schnell festlegen. Katharina sollte sie heißen. Aber es würde ja sowieso ein Junge werden, davon waren wir immer noch überzeugt.
Kapitel 44: Die Überwindung der Angst
Mitte Dezember bekam ich urplötzlich und ohne besonderen Auslöser wieder heftige Rückenschmerzen. Sie waren nicht auszuhalten. Selbst meine Voltaren halfen nicht. Ich konnte weder liegen, sitzen, noch gehen. Ich lag im Bett und weinte vor Schmerzen!
Ina fuhr mich zum Orthopäden. Die Schmerzspritzen, welche mir sonst Linderung verschafften, schlugen auch nicht mehr an.
Zwei Tage vor Weihnachten bekam ich endlich einen Termin für die Computer-Tomografie. Das Ergebnis war erschreckend. Eine Bandscheibe im Lendenwirbelbereich war so kaputt, dass sie die Nerven in der Wirbelsäule quetschten. Es war ein Wunder, dass noch keine Lähmungserscheinungen in meinen Beinen aufgetreten waren.
»Sie müssen sofort operiert werden. Ein falscher Schritt, und Sie landen im Rollstuhl«, war die dramatische Aussage meines Orthopäden. Er wollte mich sofort in die orthopädische Klinik, im Ostseebad Damp, überweisen. Aber ich weigerte mich. »Übermorgen ist Heiligabend. Da will ich zuhause sein.«
»Gut«, sagte der Arzt, »ich kann Sie in gewissem Maße verstehen. Dann müssen Sie jedoch das Risiko selbst tragen. Ich besorge Ihnen aber einen Termin für den 2. Januar.«
Ich war einverstanden. Aber noch nie war ich operiert worden. Ich hatte fürchterliche Ängste.
Die Weihnachtstage vergingen und die Schmerzen waren immer noch da. Obwohl ich massenhaft Tabletten schluckte, hatte ich nur ganz kurze Phasen, in denen sie erträglich waren. Den ganzen Tag lag ich auf dem Sofa und quälte mich. Ich dachte daran, dass in einigen Monaten unser Kind zur Welt kommen würde. Wenn mein Zustand andauern sollte, könnte ich das Baby noch nicht einmal auf dem Arm halten. Dieser Gedanke machte mich zunehmend depressiv. Nein, das war kein Leben mehr!
**********
Am Morgen des 2. Januar 1989 hatte Ina meine Reisetasche gepackt. Während der einstündigen Fahrt zur Klinik sprach ich kaum ein Wort. Die Angst vor der Operation hatte mich regelrecht gelähmt. Was wäre, wenn die OP schief gehen würde. Ich hatte so viele negative Dinge gehört.
Ina versuchte mir Mut zu machen. »Die Ärzte machen solche Operationen mehrmals täglich. Die haben mittlerweile Erfahrung und Routine bei Bandscheiben-Operationen. Es wird schon alles gutgehn.«
Doch meine Angst konnte sie mir nicht nehmen.
Im Krankenhaus wurden die Eingangsuntersuchungen durchgeführt. Merkwürdigerweise waren die Schmerzen etwas geringer geworden. Und der aufnehmende Arzt gab mir wieder etwas Hoffnung.
»Wir werden Sie ersteinmal eine Woche beobachten. Auch wenn die CT-Aufnahmen nicht gut aussehen, heißt das noch lange nicht, dass wir Sie operieren müssen. Sie haben ja Gott sei Dank noch keine Ausfallerscheinungen in den Beinen. Wir warten noch etwas. Am Ende der Woche werden wir dann Belastungstests durchführen.«
Ich atmete durch, denn ich war davon ausgegangen, dass ich bereits morgen unters Messer müsste. Nun hatte ich also Aufschub.
»Und wie sehen solche Tests aus?«, fragte ich.
»Wir hängen kleine Gewichte an Ihre Beine. Die werden Sie dann anheben müssen«, beantwortete der Arzt meine Frage.
Tatsächlich gingen die Schmerzen phasenweise etwas zurück. Am Montag war ich eingeliefert worden und ich hatte Hoffnung geschöpft. Doch am Mittwoch ging die Quälerei wieder los. Nie würde ich die angekündigten Belastungstests durchhalten!
Im mittleren Bereich der Etage, auf der sich meine Krankenstation befand, war eine Raucherecke eingerichtet. Immer wenn es mir möglich war, ging ich dort hin.
Da saßen sie alle. Operierte Patienten und solche bei denen es sich noch herausstellen sollte, ob ein Eingriff vorgenommen werden musste. Ich war nicht der Einzige, der große Angst vor einer Operation hatte.
Die vor zwei oder drei Tagen frisch Operierten waren sofort zu erkennen. Sie standen kerzengrade an der Wand oder mit dem Rücken an den vorhandenen Steinsäulen. Sitzen durften und konnten sie nicht, das würde noch einige Zeit dauern.
Natürlich war ich an allem interessiert, was die Geschädigten zu erzählen hatten. So schlimm würde es nicht sein, berichteten mir die meisten. Hauptsache, die Schmerzen wären weg. Einer sagte: »Du gehst mit wahnsinnigen Schmerzen in den OP - und ein oder zwei Stunden später, wenn Du wieder aufwachst, bist Du vollkommen schmerzfrei.«
Auch wurde bildhaft beschrieben, wie so eine Bandscheiben-OP durchgeführt wird. Wie man auf eine Art Bock gelegt wird, damit die Chirurgen schön sauber schneiden könnten. Dann würde man wieder zugenäht, denn der nächste Patient wartete bereits in der OP-Schleuse.
»Die operieren hier von früh morgens bis spät abends. Pro Tag etwa zehn Operationen - Lendenwirbel und Halswirbel. Wie am Fließband.«
Mir wurde mulmig. Trotzdem war mir klar, dass ich früher oder später auch rankommen würde.
Ein elender Feigling war ich! Was würde mein Sohn zu so einem Weichei von Vater sagen. Ich rang mit mir. Mit meiner Angst, meinem Stolz und meiner Achtung vor mir selbst.
Am Abend wurden die Patienten, die am nächsten Tag unters Messer sollten, von den jeweiligen Chirurgen aufgesucht. Die Ärzte sammelten dann immer die Unterschriften ein, mit der die armen Schweine ihre Zustimmung gaben, nachdem sie auf die Risiken des Eingriffs hingewiesen worden waren.
Ich hatte mich wieder in die Raucherecke geschleppt und steckte mir vor lauter Nervosität eine Zigarette nach der anderen an. Mein Herz klopfte, als ich Doktor Sievers, meinen zuständigen Arzt, über den Flur huschen sah. Wenn er wieder zurückkommt, würde ich ihn ansprechen. Ich hatte mich entschlossen. Aber mir ging’s nicht gut dabei.
»Doktor Sievers - kann ich Sie kurz sprechen?«
Er blieb stehen. »Ja, was kann ich für Sie tun?«
»Ich, ... ich habe mich entschieden. Ich möchte doch operiert werden. Die Schmerzen werden nicht weniger.«
Ich legte ihm meine Gründe dar. Dass meine Frau schwanger sei und ich für mein Kind gesund sein wollte. Vergaß aber nicht zu erwähnen, welche fürchterliche Angst in mir war. »Können Sie dafür sorgen, dass ich dann aber gleich als Erster rankomme?«
»Gut, ich werde es versuchen. Aber Notfälle gehen vor. Ich verspreche aber, dass Sie so früh wie möglich dran sind.« Er verabschiedete sich. »Morgen besprechen wir die Einzelheiten.«
Mir war ein Stein vom Herzen gefallen. Über meinen Mut war ich sogar etwas stolz. Und einige der anwesenden Raucher klopften mir auf die Schulter. »Gut hast Du das gemacht. Bald hast Du es hinter Dir. Wirst sehen, bald wird es Dir gutgehn.«
Ich ging auf mein Zimmer und rief Ina an. »Stell Dir vor, ich hab allen Mut zusammengenommen. Wahrscheinlich werde ich Freitag operiert. Aber Du weißt ja, ich habe eine wahnsinnige Angst!«
Ina freute sich. »Ich bin stolz auf Dich. Du brauchst keine Angst zu haben. Du merkst doch nichts davon. Glaub mir.«
Wir telefonierten noch einige Minuten, in denen sie versuchte mir Mut zu machen. »Morgen besuche ich Dich«, sagte sie zum Abschied.
Ich dachte an den Film »The Green Mile« mit Tom Hanks. An die Szene, in der ein zum Tode Verurteilter den Flur entlang geführt wurde. Hinter der Tür am Ende des Gangs war die Todeszelle mit dem elektrischen Stuhl. In meinen Gedanken verwandelte sich der Stuhl in einen OP-Tisch.
Während der Visite am nächsten Morgen wurden die Einzelheiten besprochen. Ich wurde auf die Risiken hingewiesen, die bei dem Eingriff immer vorhanden sind. Natürlich könnte so ein Eingriff dazu führen, dass der Patient anschließend querschnittgelähmt sei - schließlich gehen durch das Rückenmark die ganzen Nervenstränge. Aber ihm wäre noch nie etwas Derartiges untergekommen, beruhigte mich Dr. Sievers. »Spätestens nach der OP werden Sie froh sein, dass Sie sich dafür entschieden haben.«
Doktor Sievers versicherte mir, dass ich für den ersten Termin um 07:00 Uhr vorgemerkt wäre. Er übergab mir das Formular, auf dem ich unterschreiben sollte. Dass ich über die Operation aufgeklärt wurde, und dieser zustimmte. Bis zum Nachmittag würde die Schwester das unterschriebene Formular abholen. Zusätzlich würde sich der Anästhesist noch bei mir melden, um mit mir über die Narkose zu sprechen.
Ich unterschrieb. Jetzt gab es kein zurück!
Der Narkosearzt kam und machte sich Notizen. Ob und wieviel ich rauchen würde - ob ich regelmäßig Alkohol trinken würde, usw.
Bevor er das Zimmer verließ, wies er mich noch darauf hin, dass ich nach 22 Uhr weder rauchen noch etwas essen dürfte. Meine Gedanken fuhren wieder Achterbahn!
Zum Abendessen bekam ich nur etwas Toastbrot, Käse und Tee - also ganz leichte Kost. Und zur Einstimmung brachte mir die Schwester gleich das OP-Hemd, Anti-Thrombosestrümpfe und etwas Netzartiges mit. Das sollte ich morgen früh nach dem Wecken gleich anziehen. Frühstück würde es für mich nicht geben, sagte sie und legte mir eine Tablette hin.
»Die schlucken Sie bitte vor dem Einschlafen. Das ist ein Beruhigungsmittel und wird Ihnen helfen Ihre Ängste zu nehmen.«
Wie versprochen besuchte mich Ina an diesem Abend, und wir redeten. »Wie geht es Deinem Bauch?«, fragte ich.
Es war soweit alles in Ordnung. Nur hatte sich das Baby so gedreht, dass es sich in Steißlage befand. Und nicht, wie normal, mit dem Kopf nach unten lag. »Der Arzt sagt aber, das wäre kein Problem. Es wird sich mit Sicherheit noch drehen. Bis zur Geburt ist ja noch Zeit«, beruhigte sie mich. Andernfalls müsste eben ein Kaiserschnitt gemacht werden.
»Pass auf Dich auf und überanstreng Dich nicht.« Ich umarmte sie beim Abschied.
»Ich drück Dir für Morgen die Daumen. Hab keine Angst«, sagte Ina und gab mir einen Kuss.
Der Abschied fiel mir an diesem Abend besonders schwer. Ich begleitete sie hinaus und ging anschließend in die Raucherecke. Bis 22:00 Uhr war ja noch eine Stunde Zeit. Und ich suchte Gesellschaft, die mich vom Grübeln über die anstehende Operation ablenken sollte.
Anschließend ging ich aufs Zimmer, schluckte die »Leck-mich-am-Arsch-Pille« und legte mich ins Bett. Ich wollte schnell einschlafen aber es gelang mir nicht. Tausend Dinge schwirrten mir durch den Kopf.
**********
»Aufstehen!« Die Schwester drückte den Lichtschalter und trat in das nun hell erleuchtete Krankenzimmer. »Machen Sie sich bitte fertig«, sagte sie und legte mir das gestern empfangene OP-Hemd aufs Bett.
Wenig später wurde meinem Bettnachbarn das Frühstück serviert. Ich ging natürlich leer aus.
Warum duftete der Morgenkaffee heute so besonders gut?!
Das Hemd hatte ich angelegt und auch die weißen Anti-Trombosestrümpfe übergezogen. Das netzartige Teil sollte bestimmt eine Kopfhaube sein, doch irgendwas stimmte damit nicht! Ich sah mir das Ding genauer an und musste unwillkürlich grinsen. Das war kein Haarnetz, sondern eine Art Unterhose. Als mir die Schwester etwas später das OP-Hemd auf dem Rücken zuband, erzählte ich ihr davon. Sie lachte.
Nun lag ich auf meinem Bett und wartete. Die Angst war immer noch da und ich spürte, wie mein Herz klopfte. Die Beruhigungspille zeigte absolut keine Wirkung. Und die Zeit schien mir unendlich.
Wenig später dann betrat ein Pfleger das Krankenzimmer und löste die Feststellbremsen meines Bettes. »Na dann wollen wir mal«, sagte er und schob mich mitsamt meinem Bett auf den Flur. Wir fuhren in den Aufzug und anschließend durch eine Vielzahl von Fluren und Gängen. Meine ganz persönliche »Green Mile«.
»Operationssäle« las ich auf einem Schild. Wir waren angekommen. Eine OP-Schwester in grüner Montur und Haube auf dem Kopf nahm mich in Empfang.
»Guten Morgen, wie geht es Ihnen«, begrüßte sie mich freundlich.
»Nicht so besonders«, entgegnete ich. »Ich hab eine Schweineangst!« Und das war absolut nicht gelogen.
»Brauchen Sie nicht zu haben. Sie bekommen gleich eine schöne Vollnarkose und dann werden Sie schlafen wie ein Baby«, sagte sie, während mir eine dicke Kanüle in die Oberseite meiner rechten Hand geschoben wurde. Dann rollte sie mich von meinem Bett auf eine bereitstehende fahrbare Trage. »Haben Sie Schmerzen?« Ja, die hatte ich.
»Wenn Sie nachher aufwachen, werden die weg sein und sie werden sich toll fühlen«, sagte die Schwester beruhigend. Und trotz des Mundschutzes, den sie nun trug, spürte ich, dass sie lächelte. Dann schob sie mich in den OP.
Auf der Trage liegend sah ich mich um. »Wie im Fernsehen«, dachte ich, als der Anästhesist neben mich trat. »Guten Morgen.« Er hielt mir eine Art Sauerstoffmaske vors Gesicht, aus der es etwas zischte. »Ich gebe ihnen jetzt mal was Gutes zum Schlafen.«
Jetzt traten drei oder vier grün gekleidete Personen mit Mundschutz und Haube von der anderen Seite an mich heran. »So, dann wollen wir mal anfangen«, sagte einer von ihnen. Das schien Doktor Sievers zu sein.
»Moment«, warf ich erschrocken ein. »Ich bin doch noch hellwach!!«
Und im selben Moment drückte Sievers wohl den Knopf, der in meinem Gehirn das Licht ausschaltete. Auf jeden Fall war es das Letzte, an das ich mich erinnern kann.
**********
»Herr Gölnitz. Aufwachen!« Irgendjemand tätschelte mein Gesicht. Ich hatte Probleme meine Augen ganz zu öffnen. »Wach werden«, sagte die freundliche Stimme nochmals. Verschwommen sah ich eine Person im weißen Kittel, die sich über mich beugte.
»Schon fertig?«, nuschelte ich ungläubig und benommen.
»Ja, die Operation ist gut verlaufen. Haben Sie Schmerzen?«
Ich hatte absolut keine Schmerzen, stellte ich überrascht fest. Nur ein leichter Druck im Rückenbereich.
Keine Schmerzen! Wie lange war das her, dass ich keine Schmerzen hatte! Eine besondere Art von Glückseligkeit durchströmte mich. Ich hatte die Operation anscheinend hinter mir und absolut nichts davon mitbekommen. Am liebsten hätte ich die Schwester gedrückt und abgeküsst!! Nur bewegen konnte ich mich nicht. Ich lag da, wie angenagelt.
So eine Vollnarkose hat was. Man schläft, wacht kurz auf, schläft. Zwischendurch kommt eine Krankenschwester und wechselt den Beutel für den Tropf, damit man keine Schmerzen hat. Und man schläft weiter. Irgendwie ist das angenehm.
Am Nachmittag wachte ich kurz auf. Ina war gekommen. »Wie geht’s Dir«, fragte sie mich und streichelte meine Wange.
»Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie toll das ist«, antwortete ich. »Ungewohnt ist es nur für mich, auf dem Rücken zu schlafen. Manchmal wache ich von meinem eigenen Schnarchen auf.«
»Morgen hast Du ja Geburtstag«, sagte Ina. »Ist zwar blöd, dass Du ihn im Krankenbett verbringen musst, aber ich denke, Besuch wirst Du trotzdem bekommen.«
»Ach, Geburtstage sind mir nicht mehr so wichtig. Ist ja dann mein 34-ter. Also nichts Besonderes mehr«, erwiderte ich.
Ina blieb eine ganze Zeit an meinem Bett und ich schlief immer wieder kurz ein.»Morgen komme ich wieder«, sagte sie, »schlaf Dich aus.«
Ich bekam vom Rest des Tages kaum etwas mit. Erst gegen Abend wurde ich wieder wach. Die Schwester kam mit den Thrombosespritzen. Von den Dingern würde ich die nächste Zeit mehr als genug bekommen.
»Ich hab soviel geschlafen. Hoffentlich liege ich nicht die ganze Nacht wach«, sagte ich zu ihr. Doch die Nacht verlief normal.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!« Die Stationsschwester kam an mein Bett. »Jetzt werden wir Sie ersteinmal waschen und hübsch machen. Sie sollen doch gut aussehen, wenn Ihr Besuch kommt«, scherzte sie.
Ich konnte absolut nichts alleine machen, noch nicht einmal meine Zähne putzen. Ich lag flach auf dem Rücken. Mich nur einen Zentimeter aufzurichten war schier unmöglich. Und obwohl ich Hunger hatte, war es äußerst schwierig mein Frühstück einzunehmen. Die Schwestern schmierten mir ein Brötchen und meinen Kaffee trank ich aus einer Schnabeltasse.
»Morgen wird es besser. Dann zeigen wir Ihnen wie Sie aufstehen können.«
»Morgen aufstehen? Das wird nix«, sagte ich ungläubig.
»Doch«, sagte die Schwester lachend, »das wird was. Sie können ja nicht ewig hier rumliegen und sich von uns betütern lassen.«
Am Nachmittag gab sich der Geburtstagsbesuch die Klinke in die Hand. Ina war die Erste. Sie hatte eine Torte und Kaffee dabei. Auch Mutti hatte sie aus ihrer Wohnung abgeholt und mitgebracht. Dann erschienen meine Schwiegereltern und auch Axel mit Anja.
Und obwohl ich flach im Bett lag, wurde es ein schöner Nachmittag. Ina hatte sogar den Kopfteil meines Bettes etwas erhöhen können. Mir ging es schon richtig gut.
**********
In der Nacht wachte ich auf. Ich hatte urplötzlich starke Schmerzen. Anfangs dachte ich, sie würden von der OP herrühren. Die Schmerzen verlagerten sich bis unter die Arme.
»Das sind festgesetzte Blähungen. Manchmal haben Patienten das nach einem operativen Eingriff. Das hat mit der Vollnarkose zu tun. Die natürlichen Bewegungen des Darms setzen dann aus«, meinte die Nachtschwester und gab mir ein Mittel dagegen. »Legen Sie sich auf die linke Seite, das entlastet.«
Doch wie sollte das gehen?
Die Schwester half, und drehte mich leicht auf die Seite. Ich hatte das Gefühl, als würde ich in der Mitte durchzubrechen. Es war so, als wenn der Schnitt am Rücken auseinanderreißen würde.
Aber die Bauchschmerzen wurden nun leicht weniger und ich schlief etwas.
Am Morgen waren sie jedoch wieder so stark, dass ich keinen Bedarf auf das Frühstück hatte. Meiner Bitte, mir einen Einlauf zu verpassen, kam man nicht nach. Ich bekam nur wieder dieses bescheuerte Mittel, das den Stuhlgang aufweichen sollte, aber keine Wirkung zeigte. Und mir ging es jetzt richtig schlecht! Dabei hatte ich damit gerechnet, dass es an diesem Morgen allmählich aufwärts mit mir gehen würde. Gestern Nachmittag war ich noch guter Dinge.
Die Krankengymnastin kam und sollte mir helfen mich aufzurichten. Zuerst ganz langsam im Bett auf die linke Körperseite rollen. Dann das linke Bein aus dem Bett und den Oberkörper mit Hilfe eines Griffs, der über meinem Bett baumelte, langsam in Sitzhaltung - dann aufstehen. Wenn ich das schaffen würde, könnte ich bald alleine auf die Toilette gehen.
»Ich schaff das nicht«, sagte ich ängstlich. Doch die junge Frau bestand darauf und half mir, indem sie meinen Oberkörper stützte.
Irgendwann hatte ich es dann doch geschafft. Aber mit dem Gefühl, als würde ich in der Mitte durchknicken. Erschwerend waren zudem diese irren Bauchschmerzen.
Als ich das erste Mal aufrecht neben meinem Bett stand, wurde mir schwarz vor Augen. Mein Kreislauf brach regelrecht zusammen.
Langsam half mir die Krankengymnastin mich wieder hinzulegen.
»Das ist normal nach so einer Operation«, bemerkte sie. »Ich komme morgen früh wieder. Dann wird es schon bessergehen.«
Als Ina mich am Nachmittag besuchte, klagte ich ihr mein Leid - worauf sie in das Stationszimmer ging und mit dem Arzt sprach. Sie war verärgert und verlangte, dass man mir sofort ein Klistier verabreichen solle. Klistier ist der medizinische Ausdruck für einen Einlauf.
Wenig später kam der Pfleger, etwas genervt durch Inas Auftritt im Stationszimmer, mit einer Schüssel und einem Schlauch.
»Ich werde Ihnen jetzt den Einlauf verpassen. Klemmen Sie anschließend die Pobacken zusammen, solange es geht. Können Sie zur Not alleine auf den Toilettenstuhl? Ich stelle ihn direkt neben Ihr Bett.«
Und dann führte er den Schlauch ein. Ein merkwürdiges Gefühl, als die etwas kühle Lösung in meine Gedärme floss. Aber ich war froh. Jetzt wurde endlich etwas gegen meine irren Bauchschmerzen unternommen. In mir gluckerte und rumorte es.
Nicht lange und ich merkte, wie sich etwas tat. Ina half mir schnell auf den »Kack-Stuhl« - und dann ging die Post ab!
Hier breche ich jetzt eine genauere Beschreibung ab. Es war schon schlimm genug, was mein Zimmernachbar aushalten musste. Und was das Krankenpflegepersonal anschließend zu tun hatte, um die Sauerei zu beseitigen. Aber in solchen Momenten hat man absolut kein Schamgefühl.
Ich fühlte mich wie neugeboren! Und ich war Ina unendlich dankbar dafür, dass sie sich so resolut beim Personal und dem Arzt durchgesetzt hatte.
Die Schmerzen waren fast ganz verflogen. Und von nun an ging es endlich rapide aufwärts mit mir. Noch am Abend rief ich eine Schwester und übte mit ihr das seitliche Aufstehen. Richtig verbissen war ich nun bei der Sache. Und es klappte ganz allmählich immer besser.
Voller Stolz zeigte ich am nächsten Morgen der Krankengymnastin meine Fortschritte. Wir gingen sogar schon ein paar Schritte auf dem Flur. Zwar hielt sie mich fest und stützte mich, aber es sollte den Tag darauf schon weitaus besser gehen. Ich ging so kerzengerade, wie noch nie zuvor.
»Wenn Du die Treppe hochgehen willst, zieh den Besenstil aus dem Arsch. Sonst kommst Du nicht hoch«, lästerte mein Bettnachbar und lachte.
Drei Tage nach der Operation versuchte ich, so oft wie möglich aufzustehen. Ich wollte unbedingt wieder beweglich sein - und ich wollte Rauchen!
Ich steckte die Schachtel Zigaretten, die in meinem Nachtisch lag und ein Feuerzeug ein. Mit langsamen, kurzen und äußerst vorsichtigen Schritten verließ ich das Zimmer und begab mich Richtung Raucherecke. Weit war sie ja nicht entfernt. Im Lendenbereich war ich allerdings immer noch wackelig. Als wenn dort keine Muskulatur mehr vorhanden war. Aber ich schaffte es!
Eine der tragenden Rundsäulen war frei.
Ich glaube, nie zuvor hatte ich mich dermaßen aufrecht und gerade gehalten. Es ging auch garnicht anders. Der Spalt in der Wirbelsäule, in dem die kaputte Bandscheibe nun fehlte, wurde durch das Wundfleisch ausgefüllt. Und wenn dort neuerlicher Druck entstand, würden die Nerven wieder gequetscht werden. Dann wäre alles umsonst gewesen. Das war auch der Grund, weshalb ich auf keinen Fall sitzen durfte.
»Erst in etwa vier Wochen werden Sie lernen müssen, ganz vorsichtig zu sitzen«, hatte Doktor Sievers gesagt. »Bis dahin dürfen Sie nur Sachen mit »L« machen - Laufen und Liegen.«
Ich lehnte an der Säule, den Blick geradeaus, und kramte in der Tasche meines Bademantels. Dann zündete ich mir meine erste Zigarette seit Tagen an. Ich nahm drei oder vier tiefe Züge.
Urplötzlich wurde mir schlecht. Kalter Schweiß trat auf meine Stirn. Ich legte die angerauchte Zigarette in den nächsten Aschenbecher, ohne sie auszudrücken. Mir war übel - und ich wollte schnell in mein Bett zurück. Doch schnell ging nunmal überhaupt nicht!
Mit einer Hand an der Flurwand bewegte ich mich in Richtung Krankenzimmer. »Hoffentlich fall ich nicht um!«
Ich spürte, wie mir der Schweiß aus den Achseln trat und von der Stirn lief. Wahrscheinlich sah ich in diesem Moment aus wie der »Tod auf Latschen«.
Nach einer gefühlten Ewigkeit lag ich wieder in meinem Bett und mir war immer noch speiübel. Ich schloss die Augen. Nur jetzt nicht übergeben!
Ganz allmählich wich die Übelkeit und ich versuchte zu schlafen. Es mochten ein oder zwei Stunden vergangen sein, als ich wieder erwachte. »Nie wieder werde ich rauchen«, sagte ich mir.
Am Nachmittag besuchte mich Ina. Neben den Mahlzeiten war ihr Besuch für mich immer das Highlight des Tages. Aber es war für sie ein langer Weg, den sie täglich auf sich nahm. Eine Stunde Fahrt hin und eine Stunde wieder zurück. Und das in ihrem Zustand!
»Du musst mich nicht jeden Tag besuchen«, hatte ich zu ihr gesagt. Aber Ina lies sich nicht davon abbringen.
Ihr Bauch war nicht mehr zu übersehen, aber ihr ging’s immer noch gut. Sie war nun bereits im 6. Monat schwanger. Und wenn sie bei mir auf der Bettkante saß und wir redeten, legte ich meine Hand auf ihre Kugel. »Hat das Kind sich denn jetzt gedreht?«, fragte ich besorgt.
Ina verneinte. »Das wird mal ein sturer Bock sein. Genau wie der Vater!«
Kurz vorm Abendbrot verabschiedete ich sie. »Ich bring Dich bis zum Fahrstuhl. Das schaffe ich jetzt schon«, sagte ich ganz stolz. Die Geschichte mit der Zigarette hatte ich ihr aber verheimlicht, weil sie mir erst am Tag zuvor gesagt hatte, dass ich die Möglichkeit nutzen sollte, um endlich mit dem Rauchen aufzuhören. »Das werde ich nicht schaffen«, hatte ich ihr geantwortet.
Schon mehrmals hatte ich in den vergangenen Jahren den Versuch unternommen, Nichtraucher zu werden - immer ohne Erfolg. Zwei, vielleicht auch drei Wochen hielt ich den Entzug durch - um am Ende doch wieder anzufangen. Und während der nikotinfreien Zeit war ich immer unausstehlich gewesen.
Nach dem Abschied am Fahrstuhl ging ich wieder langsam auf die Station. Ich kam an der Raucherecke vorbei. Heute Morgen war mir noch sauschlecht gewesen.
»Ich könnte es doch nochmal probieren - nur einen Zug!«
Ich stand wieder an der Säule und meine Zigarette glimmte. Vorsichtig zog ich den Rauch ein. Ein zweiter Zug - nichts passierte. Kein Schwindelgefühl, keine Übelkeit.
Als ich die Zigarette zur Hälfte geraucht hatte, drückte ich sie vorsichtshalber dann doch aus und ging auf mein Zimmer. Mir ging’s gut.
Von da an war ich wieder mehrmals am Tage zum Rauchen unterwegs. Und ich wurde auch immer beweglicher.
»Die Raucher sind immer die Ersten, die wieder auf die Beine kommen. Es ist nicht zu fassen«, sagte die Stationsschwester, wenn ich ihr über den Weg lief.
Kapitel 45: Bastian
Nach vier Wochen war ich endlich wieder zuhause. Aber meiner Arbeit in der Firma konnte ich noch immer nicht nachgehen. Sechs weitere Wochen wurde ich anschließend krankgeschrieben.
Bei den Mahlzeiten saß ich nun ganz vorsichtig auf dem vorderen Drittel des Stuhls. Es stellte jedoch mittlerweile kein großes Problem mehr dar. Reine Gewohnheitssache. Und Autofahren war natürlich auch tabu. Doch es ging mir so gut wie schon lange nicht mehr. Absolut keine Schmerzen. Und Ina hatte vorsorglich neue Matratzen gekauft.
Ihre Babykugel hatte nun auch schon enorme Ausmaße angenommen. Zwar fielen ihr jetzt manche Tätigkeiten schwerer, aber ihr ging es ansonsten blendend. Demnächst sollte sie auch in den Mutterschutz gehen.
Das einzige Problemchen war, dass das Baby immer noch verkehrt herum lag. Manchmal, wenn Sie beim Frauenarzt war, stellte er fest, dass das Kind sich in die richtige Lage gedreht hatte. Nach einigen Tagen war es jedoch wieder in der Steißlage. Ihr schien es aber offensichtlich nichts mehr auszumachen. Sie war agil wie immer.
Wenn sie mit dem Hund unterwegs war, nahm sie oft noch das Fahrrad. Eine Nachbarin sagte immer besorgt: »Ina, Du solltest in Deinem Zustand nicht mehr Fahrrad fahren.«
Ina jedoch kümmerte sich nicht darum. Aber beim nächsten Arzttermin fragte sie dann doch nach, bis zu welchem Zeitpunkt sie denn noch radeln dürfte. Der Arzt schmunzelte und sagte: »Wenn sich die Nabelschnur in die Speichen wickelt, sollten Sie damit aufhören.«
Wie gesagt, Ina steckte die Beschwerlichkeiten der Schwangerschaft gut weg. Ihre Hosen hatte sie im Bauchbereich erweitert, indem sie Teile herausschnitt und größere Stoffdreiecke einnähte. Neue BHs hatte sie sich zulegen müssen, denn auch die Brüste hatten an Größe zugenommen.
»Kein schlechter Nebeneffekt.« Ich lachte und Ina tippte sich an die Stirn: »Männer!!«
Einige Wochen waren wir gemeinsam regelmäßig zur Schwangerschaftsgymnastik gegangen. Ich hatte das Wickeln gelernt und was man sonst noch als werdender Vater beherrschen sollte. Auf den Knien, wie andere junge Väter auch, war ich hinter meiner Frau gesessen. Hatte sie gestützt und gesagt: »Pressen Ina, schön pressen. Ruhig atmen!»
Eigentlich waren diese Abende recht lustig gewesen. Und manchmal lachten unsere Frauen darüber, wie schusselig wir Männer uns manchmal anstellten.
Das Kinderzimmer, gegenüber von unserem Schlafzimmer, war auch fertig. Aber noch mussten wir uns in Geduld üben. Doch im Großen und Ganzen fühlten wir uns fit für die Elternschaft.
Der April beglückte uns nun bereits mit ein paar sonnigen Tagen. Lange konnte es jetzt nicht mehr dauern.
Der Mai kam und wir warteten. Doch unser Familienzuwachs ließ sich Zeit. Nun war Ina bereits über den errechneten Geburtstermin hinaus. Das Baby boxte in kürzeren Abständen, lag jedoch noch immer verkehrt. »Langsam glaub ich nicht mehr daran, dass es sich noch drehen wird«, sagte Ina etwas enttäuscht.
Dann, mitten in der Nacht weckte Ina mich plötzlich. »Bodo, ich glaub es geht los! Mein Bettlaken ist nass!«
Im selben Moment war ich hellwach! Ich sprang aus dem Bett. Völlig planlos. Sollte ich zuerst in meine Jeans schlüpfen? Nein, vielleicht zuerst Inas bereits gepackte Reisetasche holen. Oder doch zuerst schnell im Krankenhaus anrufen? In meinem Kopf herrschte Chaos pur!
»Was soll ich nur zuerst machen?« Ich sah Ina fragend an.
»Am Besten ganz ruhig bleiben«, sagte Ina völlig cool und entspannt, während sie sich anzog. »Das Baby kommt nie sofort. Du hast also genug Zeit.« Trotzdem war ich völlig flatterig.
Ganz behutsam half ich Ina ins Auto und fuhr los. Es war mitten in der Nacht - dunkel und die Straßen menschenleer. Niemand war unterwegs zu sehen. Rendsburg schlief.
Endlich waren wir im Krankenhaus. Wir marschierten schnurstracks zur Entbindungsstation. Die Schwester brachte uns in ein Zimmer und Ina legte sich ins Bett. Kurz darauf betrat die Hebamme den Raum. Auf einem Fragebogen wurde alles Relevante notiert. Für welches Datum war der Stichtag der Geburt errechnet worden? Wann waren die letzten Wehen? Wann hatten Sie Ihre Masern? Und so weiter. Ich saß währenddessen auf einem Stuhl daneben und meine Nerven rotierten. Warum fragte mich die Hebamme nicht, wie es MIR ging?
Ein Arzt kam dazu. Es würde alles für den Kaiserschnitt vorbereitet werden, denn das Baby weigerte sich beharrlich, die richtige Lage für eine normale Geburt einzunehmen. Ina tat mir unsäglich leid. Doch sie war relativ locker. Ich meinte sogar wieder dieses Glänzen in ihren Augen gesehen zu haben.
Es wird unter Umständen noch etwas dauern, hatte der Arzt zu uns gesagt. Ich jedenfalls hatte mein Zeitgefühl völlig verloren.
Ich blickte aus dem Fenster. Draußen wurde es langsam heller.
»Geh ruhig eine rauchen«, bemerkte Ina, »Und beruhige Dich. Du bist ja völlig von der Rolle!« Sie lachte. »Es dauert noch etwas, bis es losgeht.«
Wie konnte Ina bloß so entspannt sein, fragte ich mich. Denn die Abstände der Wehen waren nun immer kürzer geworden.
Ich hastete vor die Tür der Klinik, rauchte meine Zigarette in schnellen Zügen. Dann beeilte ich mich, schnell wieder zu Ina zu kommen.
Gegen 09:00 Uhr wurde sie in den OP geschoben.
»Sie können nicht mitkommen. Bitte warten Sie hier«, sagte die Hebamme zu mir.
Ich hatte absolut keine Einwände. Darauf war ich nun wirklich nicht scharf.
Von irgendwoher hörte ich Babygeschrei. Das würde auch bei uns demnächst zum Alltag gehören, dachte ich.
Sekunden später ging die Tür auf. Eine Schwester, mit einem kleinen weißen Bündel im Arm, betrat das Zimmer. »Herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge«, lächelte sie und legte mir dieses kleine schreiende Etwas in die Armbeuge.
»So schnell? Meine Frau ist doch gerade erst aus dem Zimmer geschoben worden. Ist das denn wirklich unser Kind?« Ich konnte es kaum glauben. »Wie geht es ihr?«
»Sie hat den Kaiserschnitt gut überstanden. Etwas müde ist sie jetzt, aber Sie können bald zu ihr«, sagte sie und verließ das Zimmer.
Da saß ich nun mit meinem kleinen Sohn im Arm. Ganz allein. Scheiße, ich war so unglaublich glücklich! Das musste irgendwie ein Traum sein. Der Knirps plärrte und ich wusste, dass ich mich in der Wirklichkeit befand. Zum Schreien hatte er ja auch allen Grund. Raus aus dem warmen Mama-Bauch in diese chaotische Welt. Rein in die Armbeuge eines völlig abgedrehten Kerls, der ganz heiß darauf war »Papa« genannt zu werden.
»Bastian! Ich bin’s. Dein Papa«, sagte ich leise und küsste ganz zart die Stirn meines Stammhalters. Dann sang ich fast flüsternd das Lied, welches ich oft mit dem Kopf auf Inas Bauch gesungen hatte: »La Le Lu …»
Sofort hörte Bastian auf zu schreien. Ganz ruhig war er auf einmal. Als wenn er sagen wollte: »Das kenn ich doch. Das hab ich doch schon mal gehört.«
Eine kleine Träne lief aus meinem Augenwinkel.
So saß ich am 13. Mai 1989 um 09:09 Uhr, mit meinem neugeborenen Sohn in einem Zimmer des Rendsburger Krankenhauses - und schwebte auf Wolken. Und obwohl ich einmal zu Ina gesagt hatte, dass Neugeborene überhaupt nicht süß seien mit ihrer zerknautschten aufgeweichten Haut, lag nun das allerhübscheste Baby in meinem Arm.
»Hast Deine Mama aber lange warten lassen«, flüsterte ich.
Einige Zeit verging, bis die Hebamme kam und mir mitteilte, dass ich jetzt zu der frischgebackenen Mama könnte.
Ina lag in einem Krankenbett und konnte die Augen kaum aufhalten. Behutsam legte ich ihr unseren Sohn in den Arm. Ich gab ihr einen Kuss. »Du bist die tollste Frau der Welt. Ich liebe Dich so sehr!«
Ich streichelte ihre Wange »Ist das nicht ein Prachtkerl?«
Doch ich merkte, dass sie das alles nicht so richtig mitbekam. Die Narkose steckte ihr scheinbar noch tief in den Knochen.
»Am Besten Sie gehen jetzt erst einmal nach Hause. Ihre Frau braucht jetzt Ruhe.« Die Hebamme begleitete mich aus dem Kreißsaal. »Heute Nachmittag können Sie Ihre Frau besuchen. Dann wird sie wach sein.«
Auf der Fahrt nach Hause bekam ich von der Wegstrecke nichts mit. Wieder saß ich auf Wolke 7 - sie schien nur für mich reserviert zu sein! Am liebsten hätte ich an jeder Haustür angehalten, geklingelt und jedem mitgeteilt: »Seht her, ich bin Papa!!«
Obwohl ich die vergangene Nacht kaum geschlafen hatte, war ich immer noch hellwach. Bis zur Halskrause vollgepumpt mit meinem Adrenalin! Ich war völlig überdreht und versuchte mich irgendwie zu beschäftigen, um wieder klar denken zu können. Als Erstes rief ich Mutti, meine Schwiegereltern und Axel an. Dann - Betten machen, Staub saugen, Abwaschen. Doch was ich auch machte, meine Gedanken kreisten nur um Ina und den kleinen Bastian.
Nora musste ja auch noch Gassi geführt werden. Ich hatte sie bei meiner Ankunft nur kurz pinkeln gelassen und gefüttert. Den armen Hund hatte ich fast vergessen. Also Leine vom Haken und los.
Unterwegs traf ich Lisbeth aus der Nachbarschaft. »Lisbeth, Ina hat entbunden«, strahlte ich.
Sie drückte mich. »Das freut mich für Euch. Was ist es denn?«
»Ein Junge!«, antwortete ich voller Stolz. »Ich fahr nachher gleich wieder hin.«
Was für ein herrlicher Tag! Die Frühlingssonne strahlte vom Himmel. Und plötzlich dachte ich wieder an meinen verstorbenen Vater. Und in Gedanken hielt ich ein Zwiegespräch mit ihm. »Warum kannst Du das nicht mehr erleben. Ich hätte Dir so gern meinen kleinen Sohn gezeigt. Wenn er etwas größer ist, werde ich ihm von Dir erzählen. Vati, Du fehlst mir so!«
Wieder zuhause spürte ich jetzt doch einen Anflug von Müdigkeit. Bevor ich wieder zu Ina ins Krankenhaus fuhr, würde ich mich etwas hinlegen müssen. Und um nicht den Nachmittag zu verschlafen, stellte ich den Wecker auf den Wohnzimmertisch. Dann legte ich mich auf die Couch.
Rrrriiing!! Der Wecker holte mich in die Gegenwart zurück. Ich rieb mir die Augen und schaute auf meine Uhr. Nora lag vor dem Sofa und döste friedlich. Etwas Zeit war ja noch. Ich beschloss unter die Dusche zu gehen. Anschließend würde ich mich auf den Weg machen.
Doch bevor ich ins Badezimmer ging, öffnete ich noch kurz die Tür zum Kinderzimmer. Hier würde bald mein kleiner Fratz in seinem Bettchen liegen. Alles war für seine Ankunft vorbereitet. Ich stellte die Spieluhr an, die über dem Kinderbettchen baumelte. Ein kleines Glockenspiel ertönte: »Der Mond ist aufgegangen. Die kleinen Sterne prangen, am Himmel hell und klar … «
Schade, dass es noch eine Woche dauern wird, kam mir in den Sinn. Doch in der Zwischenzeit, so oft es möglich wäre, würde ich meine beiden im Krankenhaus besuchen.
**********
Auf dem Weg zur Klinik fuhr ich noch schnell zu einem Floristen und besorgte für Ina einen großen Blumenstrauß. Wahrscheinlich würde sie schon auf mich warten.
Immer noch aufgeregt betrat ich endlich die Entbindungsstation.
Ich öffnete vorsichtig die Tür zum Zimmer. Ina lag munter in ihrem Bett und hatte Bastian auf dem Arm. Sie strahlte mich an.
»Wie geht’s Dir«, fragte sie lächelnd.
»Das wollte ich DICH fragen. Ich fühl mich einfach großartig!«, antwortete ich. »Ganz liebe Grüße von den Nachbarn.«
»Mir geht’s auch gut«, sagte Ina. »Mama und Papa waren bereits da. Sie sind vor einigen Minuten gegangen.«
Ina und Bastian gaben ein tolles Bild ab. Mein Sohn hatte allerdings die Augen geschlossen und schlief.
»Und? Was sagst Du zu unserem Sohn. Ist er nicht süß? Er ist gerade eingeschlafen.« Ina blickte liebevoll auf Bastian.
»Ich finde er ist - zuckersüß!«, sagte ich.
»Ach? Und ich dachte Du findest alle Neugeborenen hässlich«, grinste Ina.
»Stimmt. Aber unser Baby ist eben `ne Ausnahme. Mit Liebe gemacht!«, sagte ich augenzwinkernd.
»Nur stur ist er. Genau wie sein Vater. Er will einfach nicht an die Brust. Die Schwester musste mir helfen, bis er endlich gesaugt hat«, bemerkte Ina. Ich lachte und sagte: »Männer lernen aber doch ganz schnell, mit den Dingern umzugehen.«
Wieder sagte Ina: »Männer!!«
»Dabei hab ich so einen starken Milcheinschuss, das tut richtig weh.« Ina zeigte mir ihre Brust. Und ich stellte fest, dass sie noch mehr an Volumen zugenommen hatte.
Ich sah nochmal in das kleine entspannte Gesicht des Winzlings. Am liebsten hätte ich ihn hochgehoben und an mein Herz gedrückt.
Ina ahnte wohl meine Gedanken. »Ja, es ist schade, dass er gerade jetzt schläft. Aber vielleicht wird er ja bald wieder wach.«
Jetzt bemerkte ich, dass ich immer noch die Blumen in der Hand hielt. »Oh«, sagte ich, »die sind für Dich.«
»Ein wunderschöner Strauß. Danke mein Schatz. Geh am besten zum Stationszimmer und frag nach, ob die dort eine große Vase haben. Die verdursten sonst noch.«
Ich saß bestimmt schon eine Stunde an Inas Bett, als Bastian die Äuglein öffnete. Er wimmerte kurz und Ina knöpfte sofort ihr Nachthemd auf. Tatsächlich fing der Kleine zu suchen an. Ina führte das winzige Köpfchen zu ihrer Brustwarze und er nuckelte etwas.
»Siehst Du«, Ina blickte mich an. »Das muss er noch lernen. So richtig kann er noch nichts damit anzufangen.« Nochmals führte sie den kleinen Kopf. Und diesmal saugte Söhnchen etwas länger.
Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Mich durchströmte wieder diese merkwürdige Wärme und ich empfand etwas sehr Tiefes für beide. Ich war unsagbar stolz! Mein Leben hätte ich für diesen kleinen Wurm gegeben. »Ist das nicht seltsam«, dachte ich bei mir. »Da kenn ich diesen Winzling gerade mal ein paar Stunden - und ich würde alles für ihn tun.«
Endlich konnte ich jetzt meinen Sohn auf den Arm nehmen. Aber er war vom Trinken wieder völlig geschafft und seine Augen fielen vor Erschöpfung zu. Ich küsste sein kleines pausbäckiges Gesicht.
Wie gut er roch. Und diese winzigen Fäustchen.
Eine Schwester betrat das Zimmer. »Wollen Sie Ihren Sohn in sein Bett bringen? Ich denke, dass er jetzt etwas länger schlafen wird.«
Ina stieg vorsichtig aus ihrem Bett und ich legte ihr unseren Bastian in den Arm.
»Du kannst schon aufstehen?«, fragte ich verwundert.
»Natürlich. Und schau mal, wie schlank ich wieder bin.«
Tja, von einem dicken Bauch war jetzt nichts mehr zu sehen.
Wir gingen gemeinsam zu dem Zimmer, in dem die Bettchen der Neugeborenen standen. Ich wartete vor der Tür und konnte durch die Glasscheiben zusehen, wie Ina unseren Bastian in ein kleines rollbares Bett legte und zudeckte.
Es wurde jetzt Zeit für mich nach Hause zu fahren. Das Abendbrot sollte ausgegeben werden und Ina bräuchte sicherlich auch etwas Ruhe. Sie begleitete mich noch zum Fahrstuhl.
»Heute Abend kommen Axel und einige Nachbarn vorbei. Wir werden auf Euch beide anstoßen«, sagte ich und gab ihr einen Abschiedskuss. »Bis Morgen.«
»Ja bis Morgen. Ich liebe Dich.« Die Fahrstuhlstür schloss sich.
Auf dem Rückweg machte ich noch einen Zwischenstopp an einem Supermarkt und besorgte Getränke für den Abend.
Irgendwie war das komisch. Ich war bereits 34 Jahre alt, … aber zum ersten Mal fühlte ich mich richtig erwachsen.
**********
Eine Woche später war es soweit. Ich durfte meine Familie nach Hause holen. Alles war so neu und aufregend. Nun war Bastian der Mittelpunkt unseres Daseins. Die Beziehung zwischen Ina und mir war immer noch toll. Nur eben anders. Vorher waren wir aufeinander fixiert. Und jetzt fixierten wir uns auf unseren kleinen Sohn, stellten uns selbst in die zweite Reihe. Wie hatte Ina doch einmal gesagt: »Erst mit einem Kind sind wir eine richtige Familie.« Wie recht sie doch hatte.
Wenn ich auf der Arbeit war, freute ich mich morgens bereits darauf, am Abend nach Hause zu kommen. Dann erwartete Ina mich mit Bastian auf dem Arm. Und jeden Tag entdeckten wir Neues an dem Kleinen. Mir machte es sogar Spaß die vollgekackten Windeln zu wechseln. Ina stand dann dabei und achtete darauf, dass ich auch alles richtig machte. Wenn ich ihn anschließend eingecremt hatte, fand ich es wunderschön, meine Nase an Bastians weichem runden Babybauch zu reiben. Ihm schien es auch zu gefallen, er gluckste dann immer.
Wie gut so eine Babyhaut duftet! Ich küsste die knuddeligen Babyfüße und die Händchen, die langsam anfingen, sich zu bewegen. Händchen, die irgendwann versuchen würden, nach Dingen zu greifen. Ich freute mich über das erste Lachen, den suchenden Blickkontakt der kleinen klaren Äuglein nach der Mama oder dem Papa. Kleinigkeiten, die Eltern so unsagbar glücklich machen.
Aber mir war auch bewusst, welchen Anstrengungen und Belastungen Ina ausgesetzt war. Alle zwei Stunden - man konnte praktisch die Uhr danach stellen - stand unserem Knirps der Sinn nach Mamas Brust. Er wachte dann auf, krakeelte rum und gab erst Ruhe, wenn er den Nippel gefunden hatte. Anschließend war er so abgefüllt, dass er gleich wieder einschlief.
So ging es dann die erste Zeit auch jede Nacht. Dabei konnte ich ihr leider keine große Hilfe sein, denn meine Nippel waren zur Fütterung nicht geeignet. Zudem hatte ich einen ziemlich festen Schlaf.
Die ersten Wochen schlief unser Sohn noch in einer kleinen Wiege, bei uns im Schlafzimmer. Wenn das Babyschreien mich dann weckte, hatte Ina ihn bereits aus der Wiege gehoben und angelegt. Manchmal kam es mir vor, als wenn sie nur mit einem geschlossenen Auge schlief. Das musste das »Mutter-Gen« sein. Und dieses Gen war wohl dafür verantwortlich, dass es ihr scheinbar nichts ausmachte, selbst nachts nie richtig zur Ruhe zu kommen.
Auch die Routine, die Art und Weise, wie sie mit Bastian umging und ihn umsorgte, erweckte bei mir den Eindruck, als hätte sie ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht. Sie ging in ihrer Mutterrolle vollends auf.
Am Wochenende unternahmen wir mit Kinderwagen und Hund lange Spaziergänge. Im Fernsehen lief zu der Zeit die Werbung eines bekannten Margarineherstellers. In den Spots war ebenfalls grundsätzlich wunderschönes sonniges Wetter. Und eine junge Familie (Vater, Mutter, Kind, Hund) tollte über grüne Wiesen. Anschließend saßen alle am Frühstückstisch, hatten fröhliche Gesichter und die Mutter schmierte Brotscheiben mit besagter »RAMA«-Margarine. Wenn wir spazierengingen, sagte Ina einmal: »Irgendwie sind wir wie die RAMA-Familie.«
Es war mittlerweile so warm geworden, dass wir uns einen hölzernen Bollerwagen zugelegt hatten und unserem Bastian nur einen leichten Strampler anzogen. Er lag dann auf weichen Kissen in diesem Holzwagen und wir deckten ihn noch nicht einmal zu - so heizte die Sonne die Luft auf.
Bastian war vielleicht gerade sieben Wochen alt, als wir uns mit ihm und dem Bollerwagen durch die Menschenmassen der Kieler Woche zwängten - einem jährlich stattfindendem Volksfest in unserer Landeshauptstadt.
Natürlich sahen wir zu, dass etwa alle zwei Stunden Grünanlagen in der Nähe waren. Denn Bastian hatte noch immer sein exaktes Timing zur Mutterbrust. Dann suchten wir ein ruhiges Plätzchen, Ina stillte ihn, und ich schirmte beide vor den Blicken der Öffentlichkeit ab.
Die Zeit verging und Bastian wuchs. Irgendwann war Schluss mit der Mutterbrust und er wurde an Milchfläschchen gewöhnt. Nun konnte er auch in meinem Arm trinken. Wenn er die Flasche leergenuckelt hatte, war er jedesmal fix und fertig. Sein kleines rundes Gesicht war gerötet und er spielte sich am Ohr. Das war immer das Zeichen von Müdigkeit.
Ein richtiger Wonneproppen war er geworden. Natürlich konnte er jetzt schon mit seinen kleinen Händen greifen und gab mittlerweile auch schon richtige Laute von sich. Die ganze Zeit plapperte er vor sich hin. Ich liebte diese Laute und es war eine Freude ihm dabei zuzusehen, wie er sich entwickelte.
Bekannterweise haben Säuglinge ja dauernd die Windeln voll. Der »Senf« in seinen Pampers roch zwar, aber von Stinken konnte noch nicht so richtig die Rede sein. Das änderte sich aber schlagartig, als er Nahrung aus diesen Gläsern zugefüttert bekam, welche die Firma HIPP herstellte. Dort war ja bereits alles drin, was er später in fester Form zu sich nehmen würde - Karotten, Erbsen und Kartoffelbrei.
Wenn Ina, oder auch ich, ihn wickelte, sagte sie manchmal: »Bastian, Du stinkst wie ein Iltis!«
Doch Bastian interessierte das nicht die Bohne.
»Wenn er sprechen könnte«, sagte ich lachend zu Ina, »würde er sicher sagen: Da scheiß ich drauf!«
Er lag rücklings auf seiner Kommode, griff zu dem Spielzeug, welches über ihm baumelte, und plapperte vor sich hin. Anscheinend bekam er garnicht mit, wie seine Mutter ihm die Kacke von seinem kleinen Babyarsch entfernte.
Die Wiege brauchten wir nun nicht mehr. Nach den ersten Wochen schlief Bastian jetzt im Kinderzimmer. Wenn Ina ihn abends in sein Bettchen brachte, kam es mittlerweile vor, dass Bastian noch putzmunter war. Dann war meine Aufgabe, ihn irgendwie in den Schlaf zu bekommen. Ich sang ihm dann etwas vor, oder alberte mit ihm an seinem Bettchen herum und machte mich zum Affen. Bastian schien das zu gefallen und er wurde erst recht munter. Manchesmal war er schon richtig anstrengend. Aber eingeschlafen ist er irgendwann doch noch.
Als ich - es mag bereits Ende des Jahres gewesen sein - eines Abends nach Hause kam, empfing mich Ina lachend an der Tür.
»Guck Dir das mal an!« Sie zog mich hastig in die Küche.
Bastian saß in seinem Hochstuhl - dieses Teil, in das man die Knirpse steckt, wenn sie gelernt haben alleine zu sitzen.
Ein Bild für die Götter! Irgendetwas Braunes, Matschiges in der Hand, das ganze Gesicht verschmiert, strahlte er über alle Backen!
»Sein erster Keks!«, lachte Ina glücklich.
Wieder hatte Bastian einen großen Sprung in seiner Entwicklung getan. Er war ein prächtiges Bürschlein, kerngesund und immer vergnügt. Seit Mitte November hatte Ina ihren Mutterschutz beendet, und ging wieder zum Arbeiten ins Krankenhaus. Am Tage hatten wir unsere Nachbarin, Janke Clausen, als Tagesmutter engagiert. Und abends, wenn Ina Spät- oder Nachtdienst hatte, war ich mit Bastian allein.
Ich fütterte ihn, wechselte seine Windeln, spielte mit ihm und brachte Sohnemann ins Bett. Dadurch entstand eine noch festere Bindung zwischen Basti und mir.
Wenn er endlich schlief, war ich aber auch ziemlich abgeschlafft. Meistens saß ich dann im Wohnzimmer vor der Glotze. Und nicht selten schlief ich nach einer Stunde vor dem Fernseher ein.
Wie war das noch? »Vater werden ist nicht schwer - Vater sein dagegen sehr.«
**********
Am Abend des 9. November 1989 - Ina hatte Nachtwache - saß ich wieder vor dem Fernseher. Bastian schlief in seinem Bettchen und ich schaute mir einen Krimi an. Der Film war gerade angefangen, als am unteren Bildschirmrand eine Laufschrift erschien:
»Eilmeldung! Grenze zur DDR geöffnet. Minister Schabowski erklärt Reisefreiheit für die Bürger der DDR!«
Ich war völlig irritiert und las nochmals. Tatsächlich, das stand da wirklich! Ich schaltete zwischen den Programmen hin und her - überall die gleiche Meldung. Auf einem Sender war das Programm sogar unterbrochen worden. Ich sah Bilder von jubelnden Menschen, die auf der Berliner Mauer tanzten und deutsche Flaggen schwenkten. Trabbis überquerten die Zonengrenze und DDR-Grenzbeamte winkten sie einfach durch. In Berlin spielte alles verrückt. Nicht zu fassen!!
Dann ein Ausschnitt aus dem DDR-Parlament - der Volkskammer. Günther Schabowski, damals Mitglied des Zentralkomitees der SED, saß vor mehreren Pressemikrofonen und gab eine Erklärung ab. Ich konnte es kaum glauben, aber es schien wahr zu sein. »Das ist das Ende der DDR«, sagte ich zu mir. Das Unmögliche war möglich geworden!
Ich nahm unser Telefon und wählte die Nummer der Station auf der Ina arbeitete. Ina meldete sich direkt. »Ina, die Grenzen zur DDR sind offen! Schalte mal das Fernsehgerät ein!«, erzählte ich aufgeregt. »Ich weiß«, antwortete Ina, »hier herrscht auch totale Aufregung!«
In den kommenden Wochen war ganz Deutschland im Freudentaumel. Jeden Tag gingen neue Meldungen durch die Medien. Auch Ina und ich freuten uns über die kommende Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten.
Zwei Wochenenden später luden wir den Kinderwagen, den Hund und Bastian in unser Auto, und fuhren zusammen über die geöffnete Zonengrenze in die DDR. Es war ein merkwürdiges und mulmiges Gefühl, als wir an den Wachtürmen vorbeifuhren.
Obwohl bereits November, war es ein sonniger Tag. Die Welt schien verändert.
Wir besichtigten das Schweriner Schloss und gingen, den Kinderwagen mit Bastian vor uns herschiebend, durch den Schlosspark spazieren. Es herrschte Volksfeststimmung und eine Menge provisorischer Imbissbuden und Bierstände waren aufgestellt worden. Der Übergang zur freien Marktwirtschaft wurde von den DDR-Bürgern geprobt und stand nun am Anfang.
An einer Fischbude machten wir halt und genehmigten uns eine Portion.
Als ich mir den ersten Bissen Bratfisch mit einer Gabel vom Pappteller in den Mund schob, rebellierten meine Zahnplomben. Die Gabeln waren im DDR-Retro-Style, aus Aluminium!! Auch Ina hatte das zu spät bemerkt und verzog das Gesicht.
Ja, so war das in den ersten Wochen nach der Grenzöffnung. Aber bereits ein Jahr später hatte sich vieles am westlichen Vorbild orientiert.
**********
Wieder war ein Jahr vergangen und ein neues begann. Wir hatten den Eindruck, dass auf einmal alles rasend schnell ging, seit unser Bastian das Licht der Welt erblickt hatte.
1990 wurde ein relativ ruhiges Jahr. Mit einer unrühmlichen Ausnahme. Nora gaben wir an eine Familie in einem nahegelegenen Dorf ab. Andauernd hatte Basti Hundehaare im Mund und an seinen besabberten Händen, wenn er über den Fußboden krabbelte. Ich hatte darauf bestanden, obwohl es mir nicht leichtfiel, mich von ihr zu trennen. Ina gab zwar nach, war aber todtraurig. Sie weinte bittere Tränen, als ich Nora wegbrachte. In dem Moment habe ich mich sehr schlecht gefühlt und mich plagten lange schlimme Schuldgefühle.
Unser Finanzrahmen war jetzt enger geworden. Wir waren ja nun mehr als nur zwei Personen, und das spürten wir auch im Portemonnaie. Eine größere Urlaubsreise lag nicht mehr drin. Das Einzige was wir uns gönnten, war eine 3-tägige Schiffsreise nach Göteborg in Schweden. Einen Tag auf See, einen Tag Aufenthalt an Land, und dann wieder zurück.
Doch es genügte uns, ein paar Tage etwas anderes zu sehen. Natürlich war auch Basti dabei. Damals ahnte ich noch nicht, dass unser Junge einmal ein ganz besonderes Verhältnis zur See haben würde.
Es war aufregend, die Entwicklung des eigenen Kindes in allen Facetten zu erleben. Was waren wir glücklich, als er das erste Mal »Mama« und »Papa« sagte!
Später behauptete ich immer, er hätte zuerst »Papa« gesagt. Doch Ina war überzeugt, dass »Mama« das erste Wort unseres Sohnes war!
Und gegen Ende des Jahres machte unser Schatz seine ersten Schritte!
An einem Samstagmorgen war ich alleine mit ihm, denn Ina hatte an dem Wochenende Frühdienst. Wie so oft, versuchte ich Bastian zu animieren. »Guck mal, was hab ich hier!«
Bastian war in die Küche gekrabbelt und hatte sich am Türrahmen hochgezogen. Ich kniete mit einem Spielzeug in der Hand am Ende des Eingangsflures, vielleicht zwei Meter entfernt.
Das Spielzeug muss in diesem Moment wohl unglaublich reizvoll für ihn gewesen sein, denn er machte vom Türrahmen aus zwei Schritte auf mich zu, … bevor er in den Beinen einknickte und zu mir krabbelte.
Meine Herren - war ich aufgeregt. Ich konnte es nicht erwarten, dass Ina nach Hause kommen würde. Also übten wir weiter. Und als Ina am Nachmittag die Tür öffnete, zeigten Bastian und ich ihr, dass Sohnemann schon fast vier Schritte schaffte. Ina war aufgeregt und überglücklich!
**********
Weihnachten war jetzt plötzlich viel wichtiger als die Jahre zuvor. Ina bastelte für Bastian einen gewaltigen Adventskalender. Einen Heißluftballon, an dessen Passagierkorb 24 kleine, mit Glitzerpapier beklebte Zündholzschachteln hingen. Die Schachteln hatte sie mit diversen Kleinigkeiten gefüllt und jeden Tag durfte Bastian eines öffnen. Er war natürlich jeden Morgen aufgeregt, was wohl heute drin war.
Und dann die leuchtenden Augen, als der Weihnachtsbaum geschmückt war und die Lichter brannten. Denn in diesem Jahr hatten wir einen besonders großen besorgt. Nie zuvor hatten wir den Heiligabend so genossen!
Kapitel 46: ALDI hat einfach alles
Im Sommer 1991 packten wir unsere Koffer und fuhren Richtung Belgien. Obwohl Ina und ich nur jeder eine Reisetasche für uns benötigten, war der Kofferraum unseres Opel Kadett proppevoll. Denn Bastian war jetzt schon über zwei Jahre alt und sein »Rundum-Sorglos-Paket« brauchte eine Menge Platz. Sportkarre, Windeln, Pflegemittel, Spielzeug, Kleidung für jedes Wetter. Es war erstaunlich, was wir alles einpacken mussten, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es ihm an nichts fehlte.
Damit er auf der langen Fahrt nicht quengelig werden würde, fuhren wir am Abend gegen 20 Uhr los. Er würde nachts schlafen, wenig von der Fahrt mitbekommen und am kommenden Vormittag würden wir in Belgien ankommen. Dort wollten wir ein befreundetes junges Ehepaar besuchen - Doris und Carsten. Doris war die Friseurin, die Ina und mir am Tage unserer Hochzeit die Haare gemacht hatte.
Fast zur gleichen Zeit wie Ina, hatte auch Doris einen Jungen zur Welt gebracht. Sie hatte ihren Carsten ebenfalls geheiratet. Und weil er Zeitsoldat war, wurde er für drei Jahre zur NATO nach Belgien versetzt. Nun wohnten sie in der Nähe von Brüssel.
Wir hatten seit unserer Hochzeit regelmäßigen Kontakt und die beiden meinten, dass es doch schön wäre, wenn wir ein paar Tage zusammen verbringen könnten. Das Haus, welches sie von der Bundeswehr zur Verfügung gestellt bekommen hatten, bot genug Platz für uns alle, und ihr kleiner Sven hätte in Bastian einen Spielkameraden.
Ich hatte Bastian erzählt, dass wir ganz weit wegfahren würden. In ein Land, dass hinter den großen Bergen läge. Dort würden die Menschen in einer anderen Sprache sprechen - keiner würde sie verstehen können. Und wir würden auf einer Straße fahren, die so lang wäre, dass man denken müsste, sie hätte kein Ende.
Er lag in seinem Bett, hatte sein Lieblingsstofftier im Arm und hörte mir gespannt zu. Irgendwann spielte er wieder an seinem linken Ohr. Und ganz langsam fielen ihm dann seine kleinen Äuglein zu und er schlief ein.