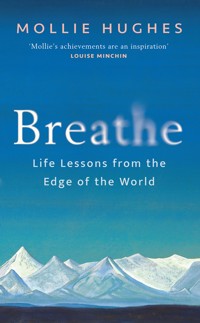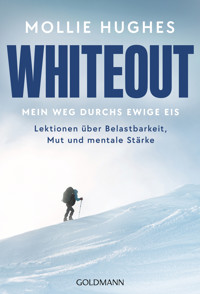
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Stärke beginnt im Kopf! Herausforderungen meistern, Ängste überwinden, Kräfte freisetzen – von der Polarforscherin und Extrembergsteigerin fürs Leben lernen
Die Guinness-Weltrekord-Abenteurerin Mollie Hughes hat einige der wildesten und herausforderndsten Orte der Welt erkundet, vom Gipfel des Mount Everest bis zu den gefrorenen Weiten der Antarktis, wo sie auf einer Reise von über 700 Meilen durch stürmische Winde, 8-tägige Whiteouts und Temperaturen von bis zu -45 °C auf Skiern ganz alleine bis zum Südpol gefahren ist.
Diese extremen Erfahrungen schildert sie in ihren Geschichten über Mut, Risiko und Belastungssituationen und verwandelt sie, unterstützt durch psychologische Forschung, in wertvolle Lektionen, die uns dabei helfen, unsere täglichen Herausforderungen zu meistern.
Sie zeigen uns, wie wir unser Potenzial freisetzen, Emotionen kontrollieren, Ängste überwinden, mit psychischem Druck umgehen und die große Bedeutung von Stille und geistigem Freiraum erfahren können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Die Guinness-Weltrekord-Abenteurerin Mollie Hughes hat einige der wildesten und herausforderndsten Orte der Welt erkundet, vom Gipfel des Mount Everest bis zu den gefrorenen Weiten der Antarktis. Diese extremen Erfahrungen schildert sie in ihren Geschichten über Mut, Risiko und Belastungssituationen und verwandelt sie, unterstützt durch psychologische Forschung, in wertvolle Lektionen, die uns dabei helfen, unsere täglichen Herausforderungen zu meistern.
Autorin
Mollie Hughes ist Weltrekord-Abenteuersportlerin, Bergsteigerin, Polarforscherin und internationale Motivationsrednerin. Im Jahr 2017 brach sie den Weltrekord als jüngste Frau, die den Mount Everest sowohl über die Süd- als auch über die Nordroute bestiegen hat, und wurde 2020 die jüngste Frau, die alleine auf Skiern von der Antarktisküste zum Südpol gelangt ist.
MOLLIE HUGHES
WHITEOUT
MEIN WEG DURCHS EWIGE EIS
Lektionen über Belastbarkeit, Mut und mentale Stärke
Aus dem britischen Englischvon Jutta Schiborr
Die englische Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »Breathe« bei Birlinn Limited, Edinburgh.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstausgabe Dezember 2025
Copyright © 2025 der Originalausgabe: Mollie Hughes
Copyright © 2025 by Birlinn Limited
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Angelika Lieke
Fotos: © Mollie Hughes
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack, Hamburg.
Umschlag: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv Cover: FinePic®, München; Fotos Innenklappen: © Mollie Hughes
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
CH ∙ cb
ISBN 978-3-641-33631-8V001
www.goldmann-verlag.de
»Technik und Können allein reichen nicht aus, um dich an die Spitze zu bringen; es ist der Wille, der am wichtigsten ist. Dieser Wille entspringt deinem Herzen.«
Junko Tabei – japanische Bergsteigerin, die als erste Frau den Mount Everest bestiegen hat
Inhalt
Einleitung
1 Die Angst unter Kontrolle halten
Der Weg über den Abgrund: Everest, 2012
Das tiefe Ende: Ayo Akinwolere
2 Selbstvertrauen finden
Das Tal des Schweigens: Everest, 2012
Eine perfekte Fallstudie: Jasmine Harrison
3 Den psychischen Druck ausgleichen
Sieben Wochen in Tibet: Everest, 2017
Der Sprung: Tim Howell
4 Sich dem Trauma stellen
Der erfrorene Mann: Everest, 2017
Als die Berge bebten: Jo Bradshaw
5 Resilienter werden
Der Kampf: Antarktis, 2019
Weisheiten zur Resilienz: Ann Daniels
6 Die Kraft des positiven Denkens entdecken
Hinter meinen Augen: Antarktis, 2019
Sich auf das Positive besinnen: Andrew Donaldson
7 Geistigen Freiraum suchen
Stille: Antarktis, 2019
Der ultimative Freiraum: Cal Major
Nachwort
Quellenangaben
Dank
Einleitung
Unser Leben beginnt mit dem ersten und endet mit dem letzten Atemzug. Die Zeit dazwischen füllen wir ganz, wie es uns beliebt, eine Konstante dabei ist und bleibt jedoch unsere Atmung. Im Großen und Ganzen ist sie ein unbewusster Vorgang. Wir denken nicht darüber nach, wir kontrollieren sie nicht; sie findet statt und hält uns am Leben. Wenn unser Körper jedoch physischem Stress ausgesetzt ist und Angst oder andere intensive Emotionen verspürt, werden wir uns unseres Atems bewusst. Wir spüren das schnelle Ein- und Ausatmen, das Heben und Senken unseres Brustkorbs, die trockene Kehle.
Unser Atem ist ein mächtiges Instrument, ein eingebauter Schalter, um die Ruhe zu bewahren. Er hat einen starken Einfluss auf unseren Körper und Geist. Indem wir unseren Atem kontrollieren – durch langsameres Ein- und Ausatmen –, können wir präsenter im Hier und Jetzt sein, unsere Gefühle steuern und Situationen mit größerer Klarheit betrachten. Die Kraft unseres Atems wirkt sich auch auf körperliche Prozesse aus. Techniken wie die Zwerchfell- beziehungsweise Bauchatmung stimulieren den Vagusnerv, der das Gehirn mit dem Darm verbindet. Wenn diese Form der Atmung regelmäßig angewandt wird, kann sie das Stressniveau spürbar senken und die Darmgesundheit verbessern. Unsere Atmung ist ein Mittel, das uns allen zur Verfügung steht und dabei hilft, unser Leben besser im Griff zu haben. In extremen Umgebungen oder Stresssituationen kann es jedoch manchmal schwierig sein, unsere Atmung unter Kontrolle zu halten.
Wenn man in großen Höhen von über 8000 Metern klettert – ein Bereich, der als Todeszone bekannt ist –, stehen dem Körper zwei Drittel weniger Sauerstoff in der Luft zur Verfügung. Jedes Ein- und Ausatmen wird zu einem bewussten Vorgang, der volle Aufmerksamkeit erfordert.
Ich war 21 Jahre alt, als ich mich zum ersten Mal in die Todeszone begeben habe. Mein Ziel war, den Gipfel des Mount Everest über die Südroute von Nepal aus zu erklimmen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, aber das frühe Morgenlicht begann bereits, das Himalaja-Gebirge unter mir zu erhellen. So weit mein Auge reichte, tauchten Berge aus der Dunkelheit auf. Ich machte einen Schritt nach vorn, dann blieb ich stehen und holte tief Luft, bevor ich den nächsten Schritt machte und wieder zum Luftholen anhielt. Die extreme Höhe setzte mir zu und zerrte an meinem Körper. Ich zwang meine Beine, sich schneller zu bewegen und zwei Schritte auf einmal zu machen, ehe ich zum Luftholen anhalten musste. Doch an jenem Tag, hoch oben in der Todeszone, war mein Körper nur noch zu Bewegungen im Schneckentempo fähig.
Je länger ich mich in dieser Höhe aufhielt, desto schwächer wurde mein Körper. Meine Psyche war jedoch immer noch stark; sie war widerstandsfähig. Und sie war überzeugt davon, dass ich es auf den Gipfel schaffen konnte.
Durch meine erste Mount-Everest-Expedition habe ich sehr viel gelernt. Die wichtigste Lektion war, wie stark unsere Psyche ist. Auf dem Heimflug aus Nepal stellte ich daher eine These auf: Der Erfolg bei extremen Expeditionen hängt zu 75 Prozent von der mentalen Einstellung ab.
In den darauffolgenden acht Jahren habe ich diese These durch weitere Expeditionen rund um den Globus auf den Prüfstand gestellt. Mit 26 bin ich noch einmal zum Mount Everest zurückgekehrt, um den Berg über die zweifellos härtere, kältere und windigere Nordroute von Tibet aus zu besteigen. Danach, mit 29 Jahren, habe ich meine bisher größte Herausforderung in Angriff genommen: eine Solo-Skitour vom Rand des antarktischen Kontinents zum geografischen Südpol. Nach 58 Tagen voller Einsamkeit, Stürme und endlosem Auf-Skiern-Stehen erreichte ich schließlich mein Ziel und erkannte, dass die laienpsychologische These, die ich mit 21 Jahren aufgestellt hatte, äußerst unzutreffend war. Denn es spielte sich nahezualles in meinem Kopf ab. Deshalb lautete meine These nun: Der Erfolg bei extremen Expeditionen hängt zu 95 Prozent von der mentalen Einstellung ab.
Wie jede gute These musste sie überprüft und getestet werden. Ich musste draußen in der Welt Beweise finden, die sie untermauerten oder widerlegten. Meine persönlichen Erlebnisse und Gedanken zu dieser Thematik würden schon eine gute Story ergeben, doch ich wollte noch tiefer graben, um meine Erfahrungen wirklich genau verstehen zu können. Ich wollte die Forschung und die Fakten hinter dieser These studieren, mit anderen Abenteuersportlerinnen und -sportlern sprechen und von Leuten lernen, die sich schon in ähnlichen Situationen befunden hatten. Ich machte mich an die Arbeit und fing mit dem Schreiben von Whiteout an.
Einatmen, ausatmen und loslegen …
*
Das Schreiben dieses Buches hat es mir ermöglicht, über meine bisherigen Erfahrungen im Leben nachzudenken. Auf diesen Seiten habe ich Verständnis für meine Ängste und mein Trauma entwickelt, und ich habe erkannt, dass meine Widerstandsfähigkeit gewachsen ist, dass ich nun besser mit Druck umgehen kann … und dass ich mitten in einem antarktischen Sturm gelernt habe, mir die Kraft meiner Psyche zunutze zu machen, um mich vor dem Abgrund zu retten.
Ursprünglich war geplant, in Whiteout meine eigenen inneren Kämpfe zu ergründen. Doch dann entwickelte sich das Buch schon bald zu einem Ratgeber, wie sich jeder von uns die Kraft seines Geistes zunutze machen kann – um die eigenen Erfolgschancen und das Wohlbefinden zu steigern und ein glückliches und erfülltes Leben zu führen.
Im Anschluss an jedes Kapitel folgt ein Interview mit einem Abenteuersportler oder einer Abenteuersportlerin, die sich extremen Herausforderungen gestellt, Widrigkeiten überwunden und ihre mentale Kraft genutzt haben, um das scheinbar Unmögliche zu erreichen. In diesem Buch wollte ich mich nicht allein auf meine eigene Psyche beschränken. Es geht mir darum, Muster, Einsichten und Lektionen aufzuzeigen, die wir von anderen lernen können. Ich spreche mit einem Basejumper, der es schafft, den Druck auszugleichen, bevor er den Schritt über die Kante wagt, einer Bergsteigerin, die ein unvorstellbares Trauma erlitten hat und daran gewachsen ist, einer Stand-up-Paddlerin, die auf einer Expedition geistigen Freiraum und Ruhe erfahren hat, und noch einigen anderen. Diese verschiedenen Perspektiven, die von Leuten mit unterschiedlichen Hintergründen und Lebenserfahrungen stammen, ermöglichen es uns, das unglaubliche Potenzial der menschlichen Psyche besser zu verstehen.
Vielleicht lesen Sie dies hier ja in einem Bus, während Sie durch das hektische Treiben einer Großstadt fahren, oder in einem verschlafenen Dorf auf dem Land, mit zwitschernden Vögeln im Himmel über Ihnen. Vielleicht sitzen Sie aber auch gerade ganz gemütlich zu Hause, während die Welt vor Ihrer Tür sich weiterdreht. In Whiteout habe ich sieben Lektionen zusammengetragen, die ich während meiner Expeditionen am Ende der Welt gelernt habe – sie lassen sich aber auch problemlos auf das alltägliche Leben übertragen. Ich hoffe, dass Sie Kraft daraus ziehen können, dass Sie einiges über die Funktionsweise Ihrer Psyche erfahren, indem Sie mich auf meiner Reise begleiten, und dass Sie lernen, wie Sie die Macht Ihres Geistes nutzen können, um ein positives, erfülltes und glückliches Leben zu führen.
1Die Angst unter Kontrolle halten
Der Weg über den Abgrund: Everest, 2012
Als ich mich dem Rand des Abgrunds nähere, spüre ich, wie die mir inzwischen sehr vertraute Reaktion meines Körpers einsetzt. Mein Herz beginnt heftig in der Brust zu hämmern. Ich bekomme weiche Knie. Meine Hände in den dicken Bergsteigerhandschuhen werden ganz heiß.
Während der vorangegangenen Wochen am Mount Everest hatte ich diese Gletscherspalten schon viele Male überquert. Gerade erst an diesem Morgen, als ich mir im frühen Dämmerlicht einen Weg durch das Labyrinth des Khumbu-Eisbruchs gebahnt hatte, musste ich zahlreiche von ihnen bewältigen. Jedes Mal, wenn ich mich dem Rand näherte, spürte ich, wie mein Körper darauf reagierte. Diese spezielle Spalte hier war jedoch irgendwie anders. Nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was mich dort erwartete.
Ich klinke mich in die nicht sehr vertrauenerweckende Sicherheitsleine ein und betrete nur zögerlich die erste Sprosse der Leiter, die über den klaffenden Abgrund führt. Als das Metall meiner Steigeisen auf das kalte Aluminium trifft, spüre ich die Leere unter meinen Füßen. Am liebsten würde ich überhaupt nicht nach unten blicken und so überdeutlich daran erinnert werden, was alles passieren könnte, wenn ich abrutsche. Aber ich muss hinschauen, wo ich meine Füße platziere. Als ich schließlich nach unten blicke, stockt mir der Atem – die eine Seite der Gletscherspalte ist mit einer langen Blutspur überzogen, tief unten im Eis. Ein leuchtendes Rot inmitten des frischen weißen Schnees.
Ich drücke die Beine durch, doch sie fühlen sich schwach und unkoordiniert an. Ich erinnere mich daran zu atmen. Die dünne Sicherheitsleine mit meinen dicken Handschuhen fest umklammert, nehme ich die letzten beiden Sprossen der Leiter in einem einzigen großen Schritt, um so schnell wie möglich von dieser Eisspalte wegzukommen – und vom Tod, der hier überall lauert. Ich mache mich von der Leine los, und meine Beine laufen einfach weiter, sie tragen mich weg von der tiefen Spalte und der gefrorenen roten Lache neben der Leiter.
*
Während der Saison 2012, als ich das erste Mal den Everest bestiegen habe, sind zehn Kletterer am Berg gestorben. Der erste war der Sherpa-Führer Namgyal Tshering. Am 21. April stieg er frühmorgens vom Base Camp durch den Khumbu-Eisbruch zum Camp 1 auf. Als er eine der zahlreichen Gletscherspalten überqueren wollte, rutschte er von der Leiter ab und fiel 50 Meter in die Tiefe, was der Höhe eines 15-stöckigen Gebäudes entspricht. Eine großangelegte Rettungsaktion seiner Teamkollegen schloss sich an, doch er überlebte nicht. Sein zerschmetterter Körper wurde aus der Eisspalte geborgen und nach Hause zu seiner Familie geflogen, wo er seinem buddhistischen Glauben entsprechend bestattet wurde. Bei der Bergung von Namgyals Leichnam wurde sein Körper auf der einen Seite der Gletscherspalte hochgezogen und hatte dort eine kräftige Blutspur hinterlassen. Das war das leuchtende Rot, das ich auf dem eisigen weißen Untergrund ausgemacht hatte.
Genau diese Gletscherspalte musste ich auf dem Weg zum Camp 1 überqueren. Als ich die Stelle erreichte, an der Namgyal nur Stunden zuvor in den Tod gestürzt war, und auf den grauenvollen Anblick hinunterschaute, befanden sich alle meine Sinne in Alarmbereitschaft.
*
Ich leide unter Höhenangst – und zwar jener Art, die mit Herzrasen, zittrigen Beinen und feuchten Händen einhergeht. Diese Furcht vor dem Blick in die Tiefe kenne ich schon sehr lange – nicht erst seit jenem Tag im Khumbu-Eisfall auf der Südseite des Mount Everest –, und ich denke, sie wird mich mein Leben lang begleiten. Sie ist einfach ein zusätzlicher Stressfaktor, eine Last, die ich mit mir herumtrage und hoch auf die Berge und quer über die Kontinente schleppen muss.
Der Fachverband American Psychological Association definiert das Wort Furcht als »ein elementares, intensives Gefühl, das durch das Erkennen einer akuten Bedrohung hervorgerufen wird«. Furcht ist eine Alarmreaktion; durch Veränderungen in unserem Körper bringt sie uns dazu zu handeln: Wir können bleiben und uns gegen die Bedrohung zur Wehr setzen oder vor der Gefahr davonlaufen. Wir haben alle schon einmal eine Antwort unseres Körpers auf eine beängstigende Situation erlebt: eine unwillkürliche, heftige Reaktion auf etwas, das uns Angst einjagt, ganz gleich, ob es sich dabei um große Höhen, Spinnen oder einen Horrorfilm handelt.
Eine unmittelbare Antwort kann etwa sein, dass unser Herz wild in der Brust zu hämmern beginnt. Oder dass wir weiche Knie bekommen und »Wackelpuddingbeine« haben, weil das Blut zu unseren großen Beinmuskeln gelenkt wird – was uns auf die Flucht vorbereitet. Manchmal spüren wir die Angst aber auch in der Magengegend; wenn es zu dieser Reaktion kommt, wird unsere Verdauung zurückgefahren, da das Blut aus dem Magen-Darm-Trakt in wichtigere Körperregionen fließt. Dadurch wird dieses flaue Gefühl verursacht. Es kann aber auch sein, dass wir uns hyperwachsam fühlen; der Glukosegehalt unseres Blutes kann plötzlich in die Höhe schießen, was leicht verfügbare Energiereserven bereitstellt, auf die der Körper bei Bedarf zurückgreifen kann. Manchmal bekommen wir auch Gänsehaut auf den Armen, weil das Blut aus der Haut abfließt. Die winzigen Haarbalgmuskeln an der Haarwurzel ziehen sich zusammen, wodurch sich die Haare aufstellen. Bei uns Menschen haben die aufgerichteten Härchen meist keinen Einfluss darauf, wie Furcht einflößend wir auf andere wirken. Bei vielen anderen Säugetieren kann dieser Gänsehaut-Reflex jedoch dafür sorgen, dass die Tiere größer und um einiges bedrohlicher aussehen.
Angst ist ein Schutzmechanismus. Sie ist eine unterschwellige, ziemlich heftige Reaktion unseres Körpers, die uns vor einer Bedrohung schützen soll. Sie ist uralt, instinktiv und nach Ansicht einiger Psychologen auch angeboren. Manch einer denkt vielleicht, dass Angst eine negative Erfahrung darstellt – etwas, das man meiden und umgehen muss –, dabei sollte diese unbewusste Reaktion eigentlich als Schlüssel der Menschheit zum Erfolg gefeiert werden. Im Laufe der menschlichen Evolution war sie es, die zum Erfolg unserer Spezies geführt hat. Wer nicht vor einem Raubtier weggerannt ist oder sich versteckt hat, wer am Rand einer steilen Klippe nicht vorsichtig war oder sich nicht vor reißenden Gewässern gehütet hat, der konnte auch nichts zum menschlichen Genpool beitragen.
Bestimmte Ängste, die wir heute verspüren, haben wir vermutlich von unseren Urahnen geerbt. Jagen und gejagt werden gehörten zum Alltag unserer Vorfahren. Vermutlich sind ihnen zwar nicht täglich Säbelzahntiger begegnet, doch damals gab es auch noch eine Menge anderer Kreaturen auf der Suche nach einer leckeren Mahlzeit. Dies hat unsere Angst vor Raubtieren zu einer starken, generationsübergreifenden Reaktion werden lassen. Gleichzeitig haben wir aber auch Ängste vor unbelebten Dingen entwickelt, die uns dabei helfen, bestimmten Situationen aus dem Weg zu gehen. Nehmen wir beispielsweise unsere zutiefst menschliche Angst vor der Dunkelheit; man geht davon aus, dass auch sie von den frühen Menschen herrührt. Immer wenn die Sonne unterging, war einer der wichtigsten Sinne unserer Vorfahren beeinträchtigt, wodurch sie nachtaktiven Raubtieren gegenüber im Nachteil waren. Sich in der Nacht zu verstecken und Angst vor der Dunkelheit zu haben, war der Schlüssel zu unserem Überleben, und dieser Reflex begleitet uns bis zum heutigen Tag.
Ich hatte schon immer Höhenangst. In meinem Leben war sie mal mehr und mal weniger präsent (je nachdem, was ich gerade erlebte), aber unterschwellig hat sie mich immer begleitet. Mein Hauptziel war daher, mich durch diese uralte, biologische Angstreaktion nicht vom Erreichen meiner Träume abhalten zu lassen, so schwierig sich das manchmal auch anfühlen mag.
Die Anziehungskraft des Everest
Genau ein Jahr vor jenem schrecklichen Tag im Khumbu-Eisbruch war ich in meinem Studentenwohnheim in Bristol noch spätabends auf, um in Vorbereitung meiner allerletzten Prüfung noch ein paar Dinge durchzugehen. Ich konnte es kaum erwarten, mein Studium zu beenden und endlich den Unibetrieb hinter mir zu lassen. Am meisten aber freute ich mich auf die kommenden Wochen, in denen ich mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen ausgiebig feiern wollte.
Ich hatte die letzten 16 Jahre in der Schule und an der Uni verbracht und befand mich jetzt mit 20 an einem ziemlich beängstigenden, verwirrenden Wendepunkt. Ich wusste nicht genau, was ich aus meinem Leben machen sollte, und hatte auch keine Ahnung, was das Leben selbst mir bieten konnte. Von der Uni, meinen Kommilitonen und der Gesellschaft ging enorm viel Druck aus, einen Akademikerjob zu finden, ein anständiges Gehalt zu beziehen und die Studienschulden zu begleichen. Und was kam danach? Ein Haus kaufen und eine Hypothek aufnehmen? Die Vorstellung von diesem linearen, praktischen und »normalen« Leben machte mir mehr Angst als alles andere.
Dennoch war ich guter Dinge. Seit Kurzem gab es nämlich eine neue Perspektive, wie es in meinem postuniversitären Leben weitergehen könnte. Ich war inspiriert worden.
Inspiration kann man als einen Prozess definieren, der uns geistig und emotional anregt und auf ein hohes Aktivitätsniveau bringt. Wahre Inspiration ist für mich aber noch mehr als das; sie ist ein Ereignis, das einen Schalter in deinem Kopf umlegt, ein Feuer entzündet und dich verändert. Sie sorgt dafür, dass sich neue Möglichkeiten auftun und du dir mehr als vorher zutraust.
Ich hatte die letzten drei Monate mit dem Schreiben meiner Abschlussarbeit verbracht – ein Prozess, der bei mir dieses »Feuerwerk der Möglichkeiten« entfacht hatte. Es machte mir Mut, all die inneren, selbst errichteten Barrieren beiseitezuschieben und mir neue Ziele zu stecken.
Als ich mich entscheiden musste, über welches Thema ich in meiner Abschlussarbeit an der Uni schreiben würde, hatte ich freie Wahl – solange ich innerhalb des Bereichs »Sportpsychologie« blieb. Eines wurde mir dabei jedoch ziemlich schnell klar: Wenn ich mehr als 10 000 Wörter zu einem einzigen Thema schreiben wollte, dann musste es etwas wirklich Interessantes sein, sonst würde ich nicht bis zum Ende dabeibleiben.
Bergsteigen hatte sich schon früh zu meiner Leidenschaft entwickelt. Daher kam für mich auch nur ein Thema für meine Arbeit infrage: Ich wollte mich darin mit der Psychologie des Bergsteigens befassen. Aber wie genau sollte ich das Ganze angehen? Welche Einschluss- und Ausschlusskriterien sollte ich auswählen? Es gibt so viele verschiedene Berge und Kletterstile und so viele verschiedene Erfahrungen von Bergsteigern.
Über diese Fragen dachte ich nach, während ich mich in einem Buchladen in der Abteilung »Bergsteigerliteratur« befand. Ich griff zu einem großen gebundenen Buch mit einer schönen Gebirgslandschaft auf dem Cover – ein perfekter blauer Himmel, strahlend weißer Schnee und flauschige Wolken. Bei diesem Buch handelte es sich um Higher Than the Eagle Soars (»Höher, als der Adler kreist«) von Stephen Venables. Etwas trieb mich dazu, es zu kaufen. Ich ging zur Kasse und wurde von einem fröhlichen Typen Ende 20 bedient, dessen Namensschild mich in Großbuchstaben wissen ließ, dass er DAN hieß. Dan drehte das Buch um und starrte ein paar Sekunden zu lange auf das Coverfoto. Ich sah das Staunen in seinen Augen; auch er spürte die Anziehungskraft.
»Wow«, sagte er leise. »Stell dir mal vor, du könntest so was besteigen!«
Ich bezahlte, nahm mein neues Buch entgegen und trat aus dem Laden auf die geschäftige High Street, während seine Worte in meinem Kopf nachhallten. Aber warum denn, Dan? Warum sollten wir es uns nur vorstellen? Ich will es mir nicht bloß vorstellen, ich will es fühlen, sehen, am eigenen Leib erfahren.
In den darauffolgenden Tagen verschlang ich Stephen Venables’ Buch. Er schildert darin sein Leben, seine Kindheit, seine Anfänge als Bergsteiger, seine vielen tollen Expeditionen in entlegenen Gebirgen rund um den Globus und auf den Berghängen des Mount Everest als Höhepunkt. Er beschreibt eine Expedition, bei der er zusammen mit zwei US-Amerikanern und einem Kanadier die berüchtigte Kangshung-Wand des Everest in Angriff nahm. Das schiere Ausmaß ihres Abenteuers war faszinierend: Venables schaffte es als erster Brite, den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff zu bezwingen. Anschließend berichtet er auch noch von seinem heldenhaften Abstieg, bei dem er dem Tod quälend nah war und seinen Körper an die Grenzen des menschlichen Leistungsvermögens brachte. Als ich die letzte Seite des Buches umblätterte, wusste ich: Ich hatte das Thema meiner Abschlussarbeit gefunden. Ich würde die psychologischen Erfahrungen bei der Besteigung des Mount Everest analysieren. Von diesem Moment an spürte ich, wie sich etwas in mir regte. Ich wusste, dies war der Beginn von etwas Großem – von etwas 8848 Meter Großem.
*
Ich wuchs sehr weit von den Bergen entfernt auf – fast so weit, wie es auf dem britischen Festland nur möglich ist: an der Südküste der Grafschaft Devon, in der am Ärmelkanal gelegenen Ferienregion Torbay. Mit dieser Höhenlage war ich ziemlich glücklich. Wenn man am Meer aufwächst, gibt es viel zu erleben: von der Erkundung der Strände bis hin zum Surfen und Kajakfahren. Meine Höhenangst wurde hier nur selten auf den Prüfstand gestellt – abgesehen von den Malen, als ich auf einer Brücke gestanden oder von einem hohen Gebäude nach unten geschaut habe, oder von dem Schulausflug, bei dem wir uns abseilen mussten.
Doch als ich älter wurde, wurde mir das sonnige Fleckchen Erde in Devon bald zu klein. Ich wusste, da draußen war der Rest der Welt, und Reisen übte schon damals eine große Faszination auf mich aus. Als ich 17 war, bekam ich die Gelegenheit, an einer Fahrt nach Ostafrika teilzunehmen. In meiner damaligen Schule gab es sonst nicht allzu viele Möglichkeiten. Es war eine große, laute und häufig chaotische Gesamtschule mit weit über 2000 Schülerinnen und Schülern, von denen viele aus einigen der ärmsten Gebiete Süddevons kamen. Afrika schien Millionen von Meilen entfernt zu sein – ich hatte keine klare Vorstellung davon, wie es dort sein würde, aber ich wusste, dass ich dort hinwollte. Meine Freundin Cheryl und ich brachten ein ganzes Jahr damit zu, Geld für die Reise aufzutreiben: Wir halfen in Supermärkten beim Einpacken der Einkäufe, wir verkauften fast all unsere weltlichen Besitztümer (und auch einige unserer Eltern) auf Flohmärkten und schrieben Briefe an Prominente, Vereine und Stiftungen, die wir um Unterstützung baten. Unsere harte Arbeit zahlte sich aus. Im Sommer zwischen der 12. und 13. Jahrgangsstufe befanden wir uns schließlich an Bord eines Flugzeugs in Richtung Nairobi. Die Lebendigkeit und Weite Kenias sollte uns Teenies aus der Kleinstadt regelrecht umhauen.
Auf dieser Reise waren einige Aufgaben in den Schulen vor Ort und eine fantastische Safari vorgesehen. Außerdem bot sich mir hier die Gelegenheit zu meiner ersten Höhenerfahrung. Im Mount-Kenya-Massiv bestiegen wir den 4985 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Gipfel Point Lenana, der höher ist als alle Berge in Westeuropa. Als ich auf dieser imposanten Bergspitze stand, wirbelten zwar Wolken um mich herum, zwischendurch taten sich jedoch immer wieder Lücken auf, und ich konnte einen wunderbaren Blick auf die unter mir liegende Savanne erhaschen. Ich war hellauf begeistert – die Berge hatten meine Vorstellungswelt erobert.
Meine restliche Schulzeit hindurch und während meines anschließenden Studiums versuchte ich, mit Nebenjobs so viel Geld wie möglich zu verdienen, um in den Sommermonaten alles für Expeditionen auszugeben. Ich bereiste und erkletterte die indische Himalaja-Region, die Vulkane der Anden, das Hohe-Atlas-Gebirge in Nordafrika und die Alpen. Ein paar Jahre später kehrte ich auch noch einmal nach Ostafrika zurück, um zusammen mit Freunden den Kilimandscharo zu erklimmen. Je mehr ich herumkam und je mehr Berge ich bestieg, desto mehr wollte ich davon noch erleben.
Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, als ich meine fertig gebundene Abschlussarbeit in den Händen hielt. Diese 54 Seiten, die aus 294 Absätzen, 12 682 Wörtern und 65 292 Zeichen bestehen, sind die reinste Inspiration für mich gewesen. Ich hatte sieben männliche Bergsteiger interviewt, die alle in den Jahren zwischen 2000 und 2010 den Mount Everest bezwungen hatten. Ich hatte sie zu ihrer Motivation befragt, zu ihrem Selbstvertrauen, zu ihrem Umgang mit Anspannung und Angst, zu ihren Teamerfahrungen sowie zu den Faktoren, von denen sie glaubten, dass sie zu ihrem Erfolg beigetragen hatten. Anschließend analysierte ich die Interviews, arbeitete Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus und zog Schlussfolgerungen daraus. In diesen Monaten des Recherchierens und Schreibens hatte ich mich auf einer inneren Reise befunden. Sie war voller erhellender Momente gewesen, alles schien sich auf einmal miteinander zu verbinden. Alle Männer, die ich interviewte, hatten wunderbar spannende Geschichten zu erzählen. Sie hatten ganz unterschiedliche menschliche Erfahrungen gemacht, während sie alle die gleiche Herausforderung bewältigt hatten: den höchsten Berg der Welt zu besteigen.
Als der Tag der Abgabe kam, hatte der Everest mich schon ganz in seinen Bann geschlagen. Ich spürte seine Anziehungskraft. Ich musste unbedingt selbst dorthin. Ich wollte durch das Western Cwm laufen, die Lhotse-Wand erklimmen, den Hillary Step hinaufklettern … doch vor allem wollte ich auf dem Gipfel des Mount Everest stehen und meinen Blick über das gesamte Himalaja-Gebirge schweifen lassen.
Das Tattoo
Ich setzte mir ein Ziel: Zwölf Monate nach der Abgabe meiner Abschlussarbeit würde ich aus Großbritannien in Richtung Himalaja aufbrechen, um meine eigene Everest-Expedition zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade mal 20 Jahre alt und hatte soeben mein letztes Jahr an der Uni abgeschlossen, mit eher mittelmäßigen Noten. Ich war nicht besonders wohlhabend und hatte hohe Studienschulden. Der Tag in der Woche, den ich am meisten herbeisehnte, war der Mittwoch; nachmittags spielte ich immer Netball für mein Uni-Team, und abends ging ich aus und machte Party. Ich hatte Spaß am Leben, aber gleichzeitig war ich schüchtern und hatte wenig Selbstvertrauen; in Lehrveranstaltungen gehörte ich nie zu denjenigen, die sich bei Fragen meldeten, aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Mir war es viel zu wichtig, was die Leute von mir dachten. Ich wusste nicht, wer ich war, und ich wusste nicht, woran ich glaubte oder was ich vom Leben erwartete. Der höchste Berggipfel, den ich bis dahin bestiegen hatte, befindet sich 5895 Meter über dem Meeresspiegel, und das Ganze hatte sich mehr wie ein langer Spaziergang als wie eine Klettertour angefühlt. Aber ich war inspiriert worden: Das Feuer in mir brannte, und ich war wild entschlossen, den höchsten Berg der Welt zu erklimmen. Ich hatte also eine Menge Arbeit vor mir.
Mir wurde sehr schnell klar, dass ich drei große Herausforderungen meistern musste, bevor man mich überhaupt für die Teilnahme an einer Everest-Expedition in Betracht ziehen würde. Zuallererst musste ich trainieren. Ich musste fitter werden, als ich es jemals in meinem Leben gewesen war, musste meinen Körper auf die Strapazen vorbereiten, die eine Everest-Besteigung mit sich bringt. Die kommenden zwölf Monate würde ich unzählige Stunden im Fitnessstudio verbringen, zahlreiche Hügel hoch- und runterlaufen, steile Küstenpfade entlangwandern und so viel Zeit wie möglich in den Bergen des Vereinigten Königreichs verbringen.
Zweitens musste ich einen sehr großen Geldbetrag auftreiben, denn eine Mount-Everest-Besteigung ist unheimlich teuer. Eine 70-Tage-Tour auf der nepalesischen Seite des Berges kann einen Kletterer zwischen 35 000 und 100 000 Pfund (40 000 bis 120 000 Euro) kosten. Für eine Studentin, die sich in den vorangegangenen drei Jahren hauptsächlich von Baked Beans ernährt hatte, waren das unvorstellbare Summen. Mir wurde gesagt, man könne dieses Geld nur aufbringen, wenn man Unternehmen als Sponsoren gewinne. Ich musste also eine oder besser noch mehrere Firmen an Bord holen, die etwas zu meiner Expedition beisteuern würden. Im Gegenzug würde ich ihr Logo auf das Dach der Welt tragen. Dies war kein leichtes Unterfangen. Es würde bedeuten, dass ich monatelang Sponsoringanfragen verschicken, Unternehmensvertreter treffen, vergeblichen Hinweisen nachgehen und mit permanenter Zurückweisung fertigwerden musste.
Die dritte Herausforderung, die ich innerhalb von zwölf Monaten zu bewältigen hatte, war, noch mehr Erfahrung im Bergsteigen zu sammeln. In den letzten vier Jahren hatte ich zwar Berge auf der ganzen Welt erklommen, doch etwas so Anspruchsvolles wie den Everest hatte ich noch nicht einmal ansatzweise in Angriff genommen. An meinem 21. Geburtstag, nur wenige Wochen nach Beendigung meines Studiums, flog ich in die Französischen Alpen und arbeitete mit einem britischen Bergführer daran, in diesem schönen und zugleich herausfordernden Hochgebirge meine Fähigkeiten zu vervollkommnen und ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, wie es wohl sein würde, den Everest zu besteigen. Dennoch war mir natürlich klar, dass die Alpen nicht ausreichen würden. Ich musste noch höher hinaus.
Ich war zuvor schon einmal im Himalaja gewesen, als ich mit 18 Jahren an einer Expedition nach Ladakh in Indien teilgenommen hatte. Ich erinnerte mich noch gut daran, wie beeindruckend allein die schiere Größe dieses Gebirges gewesen war. Der Himalaja erstreckt sich von Afghanistan bis nach China. Auf einer Länge von rund 2500 Kilometern umfasst er die höchsten Berge und die tiefsten Täler der Erde und weist eine weltweit einzigartige Artenvielfalt auf. Dies würde der bestmögliche Ort sein, um mich auf die Mount-Everest-Besteigung vorzubereiten. Daher wollte ich Anfang November 2011, vier Monate bevor ich zum Mount Everest zu reisen hoffte, nach Nepal fliegen und dort an einer Expedition auf den Gipfel der Ama Dablam teilnehmen – ein wunderschöner, anspruchsvoller Berg im Khumbu-Tal, der eine ausgezeichnete Vorbereitung auf den Everest ist.
Anfang Oktober 2011 war ich allerdings noch meilenweit davon entfernt, einen Fuß auf die Ama Dablam zu setzen, vom Mount Everest ganz zu schweigen. Ich hatte zwar schon eine unglaubliche Anzahl von Sponsoringanfragen verschickt, war aber immer noch bei der Gesamtsumme null. Wenn ich weiterhin an der Trainingsexpedition teilnehmen wollte, musste ich bis zum Beginn des Folgemonats noch auf die Schnelle 4000 Pfund auftreiben.
Ich beschloss, in meiner Heimatstadt Torquay ein Spendenevent zu veranstalten. Tickets zu einem Preis von zehn Pfund zu verkaufen und 200 Leute einzuladen, schien mir eine einfache Art, um an etwas Geld zu kommen. Doch leider musste ich feststellen, dass Eventplanung ganz schön tough ist! Während der darauffolgenden drei Wochen war ich im Panikmodus und versuchte hektisch, eine Location zu finden, die Eintrittskarten zu entwerfen und drucken zu lassen, ein Unterhaltungsprogramm auf die Beine zu stellen und vor allem die Leute dazu zu bewegen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Wenn ich es schaffen sollte, alle Tickets zu verkaufen, würde ich 2000 Pfund einnehmen – eine Menge Geld. Trotzdem würde ich, wenn ich nach Nepal fliegen wollte, das Doppelte zusammenbekommen müssen.
Ich beschloss, während der Veranstaltung eine Spendenauktion abzuhalten. Ich klapperte alle Betriebe in der Umgebung ab und versuchte, ein paar Preise zu ergattern. Ich erhielt einen Gutschein für ein Essen im Restaurant, ein Gemälde mit einer streng blickenden Eule, eine Stunde Flugunterricht und etwas, das bei meinen Freunden sehr gut ankam: 40 Jägerbomb-Cocktails von einer Kneipe im Ort. Diese Preise würden mir jedoch niemals genug Geld einbringen. Ich musste handeln.
Ich brauchte einen unwiderstehlichen Preis, der die Massen begeistern und Geld herbeischaffen würde – und ich fand ihn … direkt hinter mir. Schon dieses eine Auktionslos brachte mir 1000 Pfund ein und ermöglichte es mir, im Monat darauf nach Nepal zu fliegen. Der besagte Auktionspreis ist allerdings etwas, das ich nie wieder vergessen werde, denn er ist jetzt ein fester Bestandteil meiner rechten Pobacke. Ich hatte mich nämlich entschieden, auf der Auktion mein Hinterteil zu versteigern – als Tattoo-Zone für einen willigen Käufer. Wer auch immer meinen Po bei dieser Auktion erstehen würde, konnte darauf alles tätowieren lassen, was er oder sie wollte – absolut alles.
Die Versteigerung begann. Ich war wie gelähmt. Die Gebote stiegen schnell auf 200 Pfund, 300 Pfund, 400 Pfund … Zu meinem Glück – und Unglück – hatte ich auch ein paar Soldaten der Royal Marines, die ich kannte, eingeladen, und es stellte sich heraus, dass sie in Geberlaune waren und auch schon einige Drinks intus hatten. Mein Vater nahm ebenfalls an der Auktion teil und bot gegen die Marinesoldaten, um sicherzustellen, dass ich mir kein Tattoo stechen lassen musste. Als das Gebot bei 500 Pfund stand, stieg er jedoch aus, und ich war auf mich allein gestellt. 550 Pfund, 650 Pfund … Ein Bieterwettstreit war im Gange – der Traum eines jeden Auktionators. 850 Pfund, 950 Pfund … Der Preis blieb schließlich bei 1000 Pfund stehen, und meine rechte Pobacke war jetzt im Besitz von Sam und Andrew, zwei leicht beschwipsten und nun um einiges ärmeren Marinesoldaten.
Anschließend zogen sie mich damit auf, was sie alles auf meine Pobacke tätowieren lassen würden – einen Stempel mit der Aufschrift »100 % British Beef«, ein Tattoo mit ihren Gesichtern und Ähnliches. … Doch als die beiden wieder nüchtern waren und ein paar Tage Zeit gehabt hatten, ihre Ideen zu sortieren, kam ich schließlich mit einem blauen Auge davon. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich meinen Kindern und Enkelkindern erklären muss, warum zwei sich küssende Hühner auf meine rechte Pobacke tätowiert sind!
Ein paar Wochen später machte ich mich dann aus Großbritannien zu meiner ersten Expedition in Nepal auf, um die Ama Dablam zu besteigen. Ich verbrachte drei Wochen auf diesem wunderschönen Berg und lernte dort einige der schwierigsten und wichtigsten Lektionen meines Lebens.
Nach meiner Rückkehr nach Großbritannien kurz vor Weihnachten wurde der Druck, Sponsoren zu finden, immer größer. Mir blieben nur noch drei Monate, um die gesamte Finanzierung zu stemmen, die mir die Teilnahme an einer Everest-Expedition im Frühjahr 2012 ermöglichen würde.
Ich blieb dran und verschickte weitere Anfragen, führte zahlreiche Telefonate, und so langsam begann Geld von verschiedenen Firmen und Organisationen einzutrudeln. Ich hatte von vielen Leuten gehört, dass Sponsorengelder oft erst in letzter Minute eintreffen und dass man bis zu dem Tag, an dem man im Flugzeug sitzen sollte, auf keinen Fall aufgeben darf. Bei mir stand die Finanzierung vier Wochen vor meinem erhofften Aufbruch zum Everest. Als die letzten Sponsorengelder eingingen, konnte ich endlich meine Flüge buchen, meine Ausrüstung kaufen und mich über die Tatsache freuen, dass ich bald auf den höchsten Berg der Welt steigen würde.
Der Himalaja
Am 31. März 2012 winkte ich meiner Familie am Flughafen London-Heathrow zum Abschied zu, ehe ich mit meinen 40 Kilo Gepäck ins Flugzeug nach Nepal stieg. In meinem Bauch mischten sich Vorfreude und Angst – ein Gefühlsmix, den ich schon bald mit dem Beginn eines großen Abenteuers assoziieren würde.
Nachdem ich in Nepals Hauptstadt Kathmandu angekommen war, traf ich mit meinem Team zusammen und lernte meine Teamkollegen kennen. Ich verbrachte ein paar Tage damit, in letzter Minute noch das eine oder andere Teil für meine Ausrüstung zu kaufen, und trank viel zu viel Kaffee in den diversen Cafés und Restaurants im Touristenviertel. Kathmandu ist eine pulsierende Stadt. Als einer der ältesten dauerhaft besiedelten Orte der Welt verfügt sie über einen enormen geschichtlichen und kulturellen Reichtum. Heutzutage beherbergt Kathmandu auf einer Fläche von 50 Quadratkilometern insgesamt 1,5 Millionen Menschen und ist ein quirliger Mix aus verschiedenen Religionen, Kulturen und Nationalitäten. Bei meinem ersten Besuch habe ich mich sofort in diese Stadt verliebt, mit ihrem organisierten Chaos auf den Straßen, den bunt zusammengewürfelten Häusern, den uralten Heiligtümern und der Großherzigkeit und Offenheit ihrer Bewohner.
Viel zu schnell wurde es Zeit, Kathmandu wieder zu verlassen und in Richtung Berge aufzubrechen. Wir gingen an Bord eines kleinen zweimotorigen Flugzeugs, das uns aus der nepalesischen Hauptstadt nach Lukla bringen sollte, einem auf 2845 Metern Höhe gelegenen Flughafen und dem Ausgangspunkt des Treks zum Everest Base Camp.
Fliegen ist noch nie mein Ding gewesen. Ich fühle mich dabei ähnlich, wie wenn ich aus dem Fenster eines Hochhauses schauen würde, wobei beim Flugzeug noch hinzukommt, dass man hier nicht mit dem Boden verbunden ist und die Kontrolle ganz in den Händen der Piloten und der Crew liegt. Diesen Flug fand ich wirklich nicht sehr angenehm. Der Flughafen Lukla ist als einer der gefährlichsten Flugplätze der Welt bekannt. Im Jahr 2008 stürzte eine Maschine der Yeti Airlines beim Landeanflug ab, wobei 18 Passagiere und Besatzungsmitglieder getötet wurden. 2010 zerschellte eine nach Kathmandu umgekehrte Maschine der Fluggesellschaft Agni Air an einem Berg, nachdem sie wegen schlechter Wetterbedingungen in Lukla nicht hatte landen können. Alle elf Passagiere und drei Crewmitglieder kamen dabei ums Leben. Doch nach 45 Minuten mit geschlossenen Augen und nervösen Schweißausbrüchen landeten wir schließlich wohlbehalten in Lukla. Als wir aus dem Flugzeug in die dünne Luft auf fast 3000 Metern Höhe hinaustraten, war ich sehr erleichtert, dass wir keinen Beitrag zum schrecklichen Ruf des Flughafens geleistet hatten und nicht in die Absturz-Statistik eingegangen waren.
Von Lukla aus wanderten wir neun Tage lang das schöne Khumbu-Tal hinauf. Die Nächte verbrachten wir in Teehäusern, die von Sherpa-Familien betrieben werden, und tagsüber kletterten wir steile Hügel hoch und runter, überquerten auf wackeligen Hängebrücken reißende Flüsse aus Gletscherschmelzwasser und durchkämmten tiefe Täler, Wälder und weite Ebenen. Wir legten weitere 2500 Höhenmeter zurück und erreichten das Everest Base Camp schließlich am 12. April 2012.
Jedes Jahr im Frühling wird das Basislager für zwei Monate zu einer großen, in Zelten untergebrachten Bergsteiger-Community. Teams aus der ganzen Welt schlagen hier ihr Lager Seite an Seite am Fuße des Everest auf. Während über ihren Köpfen bunte buddhistische Gebetsfahnen im Wind flattern, vereint sie das gemeinsame große Ziel: es auf den höchsten Gipfel der Welt zu schaffen.
Das Base Camp ist rundherum von riesigen schneebedeckten Bergen umgeben. Der Khumbu-Eisbruch, der sich direkt vor dem Camp erstreckt, ebnet den Weg zum Gipfel, welcher sich hinter der Westschulter versteckt. In einer Höhe von knapp 5500 Metern ist der Sauerstoffgehalt der Luft nur noch halb so hoch wie auf Meeresspiegelhöhe. Oben auf dem Gipfel des Everest mit seinen fast 8900 Metern sind es dann nur noch 33,3 Prozent. Dies hat enorme Auswirkungen auf alle Zellen des Körpers und schränkt seine physischen und mentalen Funktionen stark ein.
Wir müssen unseren Körper daher ganz langsam an den Sauerstoffmangel gewöhnen, um die negativen Effekte der Höhenkrankheit, auch akute Höhenkrankheit (AHK) oder akute Bergkrankheit genannt, zu vermeiden. Bei der leichten Form der AHK kann es zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Kurzatmigkeit kommen, doch diese Symptome bilden sich in der Regel durch einen Abstieg in sauerstoffreichere Luft oder nach ein paar Ruhetagen wieder zurück. Bei der schweren Form hingegen und in großer Höhe kann AHK zu lebensbedrohlichen Erkrankungen führen, die das Gehirn und die Lunge betreffen. Beim sogenannten Höhenhirnödem (abgekürzt HHO) handelt es sich um eine Schwellung im Gehirn, die durch Sauerstoffmangel verursacht wird. Das sogenannte Höhenlungenödem (HLO) ist eine Flüssigkeitsansammlung in der Lunge, die ebenfalls auf die niedrige Sauerstoffkonzentration in großen Höhen zurückzuführen ist. Beide Erkrankungen können sich schnell entwickeln und bei Nichtbehandlung zum Tod führen.
Den Everest zu besteigen, ist nicht so leicht, wie manche Menschen vielleicht glauben mögen. Man kann nicht einfach in einem Rutsch von unten bis hoch zum Gipfel klettern. Die folgenden vier, fünf Wochen würden wir damit verbringen, den Berg immer wieder hinauf- und anschließend wieder hinabzusteigen, um uns zu akklimatisieren. Meine ersten richtigen Schritte auf dem Everest würden aus einem kurzen Abstecher in den Khumbu-Eisfall bestehen, um ein wenig an Höhe zu gewinnen und meine erste Gletscherspalte am Berg zu überwinden.
Nach ein paar Ruhetagen würden wir dann mit schwerer Ausrüstung beladen vom Base Camp zum Camp 1 aufsteigen, um dort die Ausrüstung zu deponieren, bevor es wieder runter ins Base Camp ging, wo wir uns ein paar Tage ausruhen und erholen würden. Die nächste Tour am Berg hätte dann das Ziel, eine Nacht im Camp 1 zu verbringen, das sich am Fuß des Western Cwm befindet, ehe es wieder ins Base Camp zurückging. Anschließend würden wir vom Base Camp ins Camp 2 aufsteigen und unterwegs unsere in Camp 1 deponierte Ausrüstung einsammeln, um ein oder zwei Nächte im Camp 2 zu verbringen, bevor es erneut runter ins Base Camp ging, um dort nochmals ein paar Ruhe- und Erholungstage einzulegen. Danach würden wir vom Base Camp ins Camp 3 hinaufklettern, das sich auf halber Höhe der Lhotse-Wand auf 7100 Metern befindet. Dies würde die höchste Stelle sein, die wir vor dem Gipfelanstieg erreichen – unter anderem deshalb, weil man davon ausgeht, dass sich der menschliche Körper oberhalb von 7000 Metern nicht richtig akklimatisieren kann. Der Stress, den diese Höhe dem menschlichen Körper bereitet, kann auch die Erfolgschancen beim finalen Gipfelversuch verringern. Nach dem Abstecher zum Camp 3 würden wir dann noch einmal den ganzen Weg nach unten ins Base Camp zurücklegen, um dort zu regenerieren, Kraft zu tanken und auf ein Wetterfenster für unsere Gipfeloffensive zu warten.
An einem meiner ersten Tage auf dem Berg sagte mein Expeditionsführer Kenton zu mir, dass bei einer Everest-Besteigung alles davon abhänge, wie leidensfähig man sei. Wenn ich die Fähigkeit besäße, Tag für Tag Strapazen auszuhalten, meinen Körper zum Weitermachen zu zwingen, selbst wenn er nach Umkehr schreit, schwere Lasten zu tragen und meine Ängste unter Kontrolle zu halten, dann müsste ich es auf den Gipfel schaffen. Ich tat seine Worte mit einem kurzen Lachen ab, doch während der darauffolgenden sechs Wochen wurde ich frontal mit meiner Höhenangst konfrontiert und begriff, dass er recht hatte – beim Klettern litt ich jeden Tag und jede Minute; ich litt mehr, als ich mir je hätte vorstellen können, und hielt mehr aus, als ich mit 21 Jahren für möglich gehalten hätte.
Die Erforschung der Angst
Die Angst beginnt im Kopf. Die Stärke dieses Gefühls löst jedoch eine Kaskade von Prozessen in unserem Körper aus. Unbewusst und blitzschnell bereitet er sich physiologisch darauf vor, zu kämpfen oder zu flüchten. Diese sogenannte Kampf-oder-Flucht-Reaktion, die auch als »akute Stressreaktion« bezeichnet wird, wurde in den 1920er-Jahren zuerst von dem amerikanischen Physiologen Walter Cannon beschrieben und ist heutzutage allgemein anerkannt.
Eine Stressreaktion setzt ein, sobald die Sinne Alarm schlagen. Jedes Mal, wenn ich mich bei der Everest-Expedition 2012 mit einer Furcht einflößenden Situation konfrontiert sah – wie zum Beispiel dem Blick in eine Gletscherspalte unter mir –, schickten meine Augen die Information an meine Amygdala, jene Hirnregion, in der emotionale Funktionen angesiedelt sind. Sobald die Amygdala die Bedrohung – eine gigantische, klaffende, blutbedeckte Eisspalte – wahrnahm, alarmierte sie die Kommandozentrale meines Gehirns, auch unter dem Namen Hypothalamus bekannt. Der Hypothalamus drückte dann ganz schnell auf den roten Kopf und aktivierte den Sympathikus, indem er Signale an die Nebennieren sandte. Diese schütteten daraufhin das Hormon Epinephrin (auch Adrenalin genannt) in meine Blutbahn aus. Das Adrenalin wurde rasch durch meinen ganzen Körper gepumpt, und die Reaktionen, die wir alle kennen, setzten ein: weiche Knie, Gänsehaut und eine erhöhte Herzfrequenz. Die hocheffiziente Arbeit der Amygdala und des Hypothalamus geht oft so zügig vonstatten, dass die visuellen Zentren unseres Gehirns das Geschehen noch gar nicht richtig verarbeitet haben.
Unsere körperliche Reaktion auf Angst ist angeboren; wir entscheiden uns entweder, zu bleiben und zu kämpfen, oder der Situation zu entfliehen – oder wir versuchen, wie in meinem Fall, dieses fest verdrahtete System unter Kontrolle zu halten und einen Fuß auf die Metallleiter über der Gletscherspalte zu setzen.
Obwohl die Angstreaktion uralt und angeboren ist, erlebt sie nicht jeder von uns auf die gleiche Weise. Manchen Menschen ist es gelungen, sich so zu konditionieren, dass sie die unbewusste physiologische Reaktion unter Kontrolle haben. Alex Honnold ist ein amerikanischer Felskletterer, der durch den 2018 erschienenen Dokumentarfilm Free Solo berühmt wurde. Der Film begleitet Alex dabei, wie er die bekannte und ungeheuer anspruchsvolle Kletterroute »Freerider« am El Capitan im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien bezwingt. Bei El Capitan handelt es sich um eine gigantische senkrechte Felsformation mit einer rund 1000 Meter hohen Steilwand aus Granit. Für diese spezielle Route am El-Capitan-Felsen brauchen erfahrene Kletterer manchmal mehrere Tage, Alex bewältigte sie jedoch in weniger als vier Stunden. Dass er so schnell ist, verdankt er seiner Lieblings-Klettertechnik, dem sogenannten Free-Solo-Klettern. Dabei handelt es sich um eine ganz natürliche Form des Kletterns, ohne Seile oder andere Sicherungsmittel. Schon ein Abrutschen oder Sturz aus 20 Meter Höhe würde mit ziemlicher Sicherheit den Tod bedeuten, Alex indes kletterte Hunderte von Metern über dem Boden und verließ sich dabei einzig und allein auf seine körperlichen und mentalen Fähigkeiten, um mit dem Fels verbunden zu bleiben.
Die im Dokumentarfilm festgehaltenen Szenen sind schlicht atemberaubend. Alex hält sich mit den Fingerspitzen an kleinsten Felsvorsprüngen fest und stützt sich mit seinen Kletterschuhen auf winzigen Kanten ab, mit Hunderten von Metern Luft unter sich. Interessanterweise zeigt Alex den ganzen Film hindurch keinerlei Anzeichen von Angst.
Alex Honnold ist nicht nur für Felskletterer von Interesse, die seine Leistungen feiern, sondern auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die herausfinden wollen, wie sich sein Gehirn von anderen unterscheidet. Alex hat an einem Experiment teilgenommen, bei dem er an ein fMRT-Gerät angeschlossen wurde, um seine Gehirntätigkeit zu messen. Dabei zeigte man ihm eine Reihe von Bildern, die von unbelebten Objekten und Landschaften bis hin zu aufregenden und potenziell angstauslösenden, grausamen Szenen reichten. Bei den übrigen – »normalen« – Teilnehmenden dieses Experiments, unter denen sich noch ein anderer Felskletterer ähnlichen Alters und mit ähnlichem Background befand, zeigte der fMRT-Scan ein Aufleuchten der Amygdala, während sie auf die emotionalsten Szenen schauten. Diese Aktivität bewies, dass ihre Amygdala sich an die Arbeit machte und die Kampf-oder-Flucht-Reaktion auslöste.
Im Gegensatz zu den anderen Probanden zeigte Alex’ fMRT-Scan jedoch keinerlei Reaktion. Die besagten Bilder hatten keinen Effekt auf seine Amygdala, was bedeutete, dass die Kaskade der Kampf-oder-Flucht-Reaktion nicht in Gang gesetzt wurde. Man nimmt daher an (die Forscher können ihn ja leider nicht in 900 Meter Höhe an ein fMRT-Gerät anschließen!), dass seine Amygdala bei seinen Free-Solo-Klettertouren nicht reagiert und die Kampf-oder-Flucht-Reaktion somit bei ihm nicht angestoßen wird. Er verspürt keine Angst.
Die Amygdala wird oft auch als »primitives Gehirn« bezeichnet; sie half den frühen Menschen, zu überleben und sich vom Instinkt leiten zu lassen. In unserer modernen Welt jedoch, in der wir nicht mehr ständig lästige Säbelzahntiger abwehren müssen und Berge und Felswände vielleicht einfach nur zum Vergnügen erklimmen wollen, müssen wir lernen, die Reaktion der Amygdala unter Kontrolle zu halten. Durch Erfahrung, Training und Konditionierung ist es Alex Honnold gelungen, dieses primitive physiologische System abzuschalten und infolgedessen einige unglaubliche Meisterleistungen zu vollbringen. Er hat bewiesen, dass wir tatsächlich Kontrolle über unsere Emotionen und unsere psychologischen und physiologischen Reaktionen haben, ganz gleich, wie tief verankert sie in unserer Psyche sind.
Das Eislabyrinth
Die erste Etappe der Mount-Everest-Besteigung über die Südroute besteht darin, den berüchtigten Khumbu-Eisfall zu durchqueren. Kaum dass wir die Sicherheit des Base Camps hinter uns gelassen hatten, kletterten wir auch schon in diesem riesigen, instabilen gefrorenen Labyrinth herum. Der am Fuß des Khumbu-Gletschers befindliche Eisfall entsteht dadurch, dass der Gletscher abrupt über eine Steilstufe abbricht und zersplittert, wobei er ein Gewirr aus Eisblöcken hinterlässt, deren Größe vom Kleinwagen bis zum mehrstöckigen Haus reichen kann. Da es sich beim Khumbu-Eisbruch um einen Gletscher – also quasi um einen gefrorenen Fluss – handelt, ist er ständig in Bewegung und verlagert sich häufig bis zu einem Meter pro Tag. Als wir uns unseren Weg durch dieses Labyrinth bahnten, indem wir über die gewaltigen Eisblöcke kletterten (von denen einige abzubrechen drohten) oder unter und zwischen ihnen hindurchstiegen, hörten wir, wie es um uns herum knirschte und knackte.
Der Eisfall wird oft als das gefährlichste Teilstück bei der Everest-Besteigung angesehen, und er ist leider der Ort, an dem jedes Jahr einige Todesfälle zu beklagen sind. Die bisher schlimmste Saison war die von 2014, als 16 Sherpa-Führer durch eine Lawine getötet wurden, die von den Gletschern entlang der Westschulter des Everest abgegangen war. Diese Gletscher hängen bedrohlich über der eigentlichen Eisfallroute und stellen eine Gefahr für all jene dar, die darunter klettern.
Dennoch waren es nicht die Instabilität des Gletschers und das Risiko, von einem haushohen Eisbrocken plattgemacht zu werden, die mir im Eisbruch am meisten Angst einjagten – es waren die Gletscherspalten. Diese riesigen, tiefen Risse in der Gletscheroberfläche – einige davon vier, fünf oder sechs Meter breit und furchterregende 50 Meter tief – werden bloß mit einfachen Metallleitern überbrückt, wie Sie sie vielleicht auch zu Hause in Ihrem Geräteschuppen stehen haben. Zwischen dem Base Camp und Camp 1 habe ich insgesamt 28 dieser Eisspalten gezählt. Während der zwei Monate an den Hängen des Mount Everest würden wir mehrere Vorstöße auf den Berg unternehmen, die uns jedes Mal ein Stück höher führten, ehe es zur Erholung zurück ins Base Camp ging. Ich würde den Khumbu-Eisbruch also nicht nur einmal, sondern vier- oder fünfmal passieren, was bedeutete, dass ich diese Abgründe mehr als hundertmal überqueren musste.
Die Route, der man durch den Khumbu-Eisbruch folgt, wird von einer Gruppe lokaler Elite-Sherpas, den sogenannten Eisfall-Doktoren (»Icefall Doctors«), angelegt und instand gehalten. Während der Klettersaison ist es ihre Aufgabe, den Weg mit Leitern zu sichern, Fixseile über die riesigen Eisblöcke zu verlegen und die schnellste Route durch dieses eisige Labyrinth auszuwählen. Diese Männer befinden sich Tag für Tag an vorderster Front, denn sie sind jedes Jahr im Frühling im Einsatz. Die Tätigkeit der Icefall Doctors gilt als einer der gefährlichsten Jobs der Welt. Ohne ihre harte Arbeit und ihren Mut würden nur wenige Menschen den Mount Everest über die Südroute von Nepal aus besteigen können.
Während meiner Expedition wurde mir schnell klar, dass ich mich bei der Überquerung dieser Gletscherspalten im Griff haben musste. Panikerfüllt und mit zittrigen Beinen hinüberzuwanken, war alles andere als sicher, und so wollte ich auf keinen Fall auf den Everest steigen. Eines Abends in meinem Zelt im Base Camp, mit der Aussicht auf eine weitere frühmorgendliche Tour durch den Khumbu-Eisfall am nächsten Tag, versuchte ich meine Angst genauer zu ergründen.
Angst ist einfach nur ein Gefühl. Sie hat sich aus einem Schutzmechanismus entwickelt – eine emotionale und oft auch physiologische Reaktion auf einen Stimulus. Ich musste anfangen, sie als etwas Positives zu betrachten. Sie war auf meiner Seite und meinte es manchmal einfach nur etwas zu gut mit mir, wenn sie auf mich aufpasste. Ich versuchte, mir meine Angst als einen überfürsorglichen Elternteil vorzustellen, der mich vor einer Gefahr beschützen wollte. Ich musste nur ein wenig ihren Griff lockern, damit ich mein Potenzial entfalten konnte.