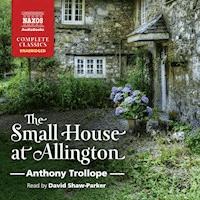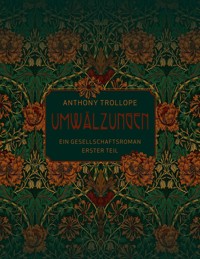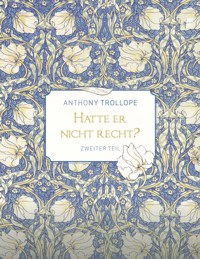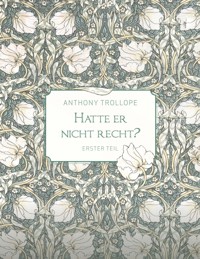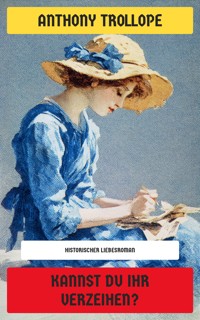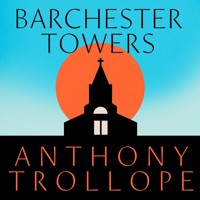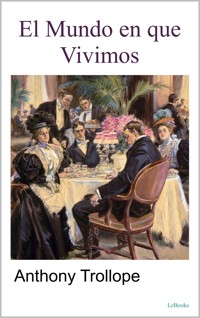1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Wie wir jetzt leben" kreiert Anthony Trollope ein fesselndes Panorama der britischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, in dem er den moralischen und sozialen Verfall der damaligen Zeit eindringlich thematisiert. Der Roman, der in einem klaren und präzisen Stil geschrieben ist, bietet einen scharfen Blick auf die Dynastie der Bourgeoisie und beleuchtet durch vielschichtige Charaktere die Spannungen zwischen Tradition und Fortschritt. Trollope nutzt eine Mischung aus satirischen Elementen und tiefgründigen psychologischen Beobachtungen, um den Leser zu fesseln und zum Nachdenken anzuregen über die Herausforderungen der modernen Zivilisation und die ethischen Dilemmata seiner Protagonisten. Anthony Trollope, ein einflussreicher englischer Romanautor des viktorianischen Zeitalters, war bekannt für seine realistische Darstellung des Lebens und vor allem für seine scharfsinnige Analyse von Politik und Gesellschaft. Er wuchs in relativ bescheidenen Verhältnissen auf, was ihm einen einzigartigen Blick auf die sozialen Strukturen und Probleme seiner Zeit verschaffte. Trollope war nicht nur ein leidenschaftlicher Schriftsteller, sondern auch ein erfolgreicher Verwaltungsbeamter der Post, was seine Einsichten in das bürokratische Leben prägte und seinen literarischen Scharfsinn hinterließ. Dieses bemerkenswerte Werk wird den Leser sowohl unterhalten als auch herausfordern, indem es typisch viktorianische Werte in Frage stellt und die komplexen Dynamiken menschlichen Verhaltens erkundet. Für alle, die sich für tiefgehende soziale Analysen und die Feinheiten der zwischenmenschlichen Beziehungen interessieren, ist "Wie wir jetzt leben" ein unverzichtbares Lesevergnügen, das die Relevanz seiner Themen bis in die heutige Zeit bewahrt. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wie wir jetzt leben
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I Drei Herausgeber
Der Leser soll Lady Carbury kennenlernen, von deren Charakter und Taten viel abhängen wird, was auch immer das Interesse dieser Seiten sein mag, während sie an ihrem Schreibtisch in ihrem eigenen Zimmer in ihrem eigenen Haus in der Welbeck Straße sitzt. Lady Carbury verbrachte viele Stunden an ihrem Schreibtisch und schrieb viele Briefe, aber auch vieles andere neben Briefen. Sie bezeichnete sich in diesen Tagen als eine Frau, die sich der Literatur verschrieben hatte, wobei sie das Wort immer mit einem großen L schrieb. Etwas über die Art ihrer Hingabe kann man erfahren, wenn man drei Briefe durchliest, die sie an diesem Morgen mit einer schnell laufenden Hand geschrieben hatte. Lady Carbury war in allem schnell, und in nichts schneller als im Schreiben von Briefen. Hier ist Brief Nr. 1; –
Donnerstag, Welbeck Straße. LIEBER FREUND, Ich habe dafür gesorgt, dass Sie die ersten Druckbögen meiner beiden neuen Bände morgen oder spätestens am Samstag erhalten, damit Sie, falls Sie geneigt sind, einer armen Kämpferin wie mir in Ihrer Zeitung der nächsten Woche ein wenig auf die Sprünge helfen können. Tun Sie es doch – helfen Sie einer armen Kämpferin! Sie und ich haben so viel gemeinsam, und ich habe mir erlaubt, mir einzubilden, dass wir wirklich Freunde sind! Ich schmeichle Ihnen nicht, wenn ich sage, dass mir Unterstützung von Ihnen mehr helfen würde als von jeder anderen Seite, und dass Lob von Ihnen meine Eitelkeit mehr befriedigen würde als jedes andere Lob. Ich glaube fast, dass Ihnen meine „Verbrecherköniginnen“ gefallen werden. Die Skizze von Semiramis ist jedenfalls lebhaft, auch wenn ich sie ein wenig zurechtbiegen musste, um sie schuldig erscheinen zu lassen. Kleopatra habe ich natürlich von Shakespeare übernommen. Was für ein Weib sie war! Julia konnte ich nicht ganz zur Königin machen, aber es war unmöglich, eine so pikante Figur zu übergehen. Sie werden in den zwei oder drei Damen des Imperiums erkennen, wie gewissenhaft ich meinen Gibbon studiert habe. Armer, lieber alter Belisar! Mit Johanna habe ich mein Bestes gegeben, aber ich konnte mich nicht dazu bringen, sie zu mögen. In unseren Tagen wäre sie einfach nach Broadmoor gekommen. Ich hoffe, Sie werden nicht denken, dass ich in meinen Darstellungen von Heinrich VIII. und seiner sündigen, aber unglücklichen Howard zu drastisch war. Um Anne Boleyn kümmere ich mich überhaupt nicht. Ich fürchte, ich habe mich bei der italienischen Katharina zu sehr in die Länge gezogen, aber in Wahrheit war sie meine Favoritin. Was für eine Frau! Was für ein Teufel! Schade, dass kein zweiter Dante für sie eine eigene Hölle erschaffen konnte. Wie deutlich man die Auswirkungen ihrer Erziehung im Leben unserer schottischen Maria erkennt! Ich hoffe, Sie werden meine Ansicht über die Königin von Schottland teilen. Schuldig! Immer schuldig! Ehebruch, Mord, Verrat und all das andere. Doch zur Gnade empfohlen, weil sie königlich war. Eine Königin von Geburt, Erziehung und Heirat – und mit solchen anderen Königinnen um sie herum, wie hätte sie da unschuldig bleiben können? Marie Antoinette habe ich nicht ganz freigesprochen. Das wäre uninteressant – vielleicht auch unwahr. Ich habe sie liebevoll angeklagt und sie geküsst, während ich sie geißelte. Ich hoffe, das britische Publikum wird nicht zornig sein, weil ich Caroline nicht reinwasche, zumal ich ihnen völlig darin beipflichte, ihren Gatten zu verurteilen. Aber ich darf Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen, indem ich Ihnen noch ein Buch schicke, auch wenn es mich erfreut zu denken, dass ich hier etwas schreibe, das niemand außer Ihnen lesen wird. Tun Sie es selbst, wie ein lieber Mann, und da Sie groß sind, seien Sie gnädig. Oder vielmehr, da Sie ein Freund sind, seien Sie liebevoll. Ihre dankbare und ergebene MATILDA CARBURY.
Schließlich gibt es nur wenige Frauen, die sich über den Sumpf dessen, was wir Liebe nennen, erheben und sich zu etwas anderem als Spielball für Männer machen können. Bei fast allen diesen königlichen und luxuriösen Sünderinnen bestand die Hauptsünde darin, dass sie in irgendeiner Phase ihres Lebens zustimmten, Spielball zu sein, ohne Ehefrauen zu sein. Ich habe mich so sehr bemüht, anständig zu sein; aber wenn Mädchen alles lesen, warum sollte dann eine alte Frau nicht alles schreiben dürfen?
Dieser Brief war an Nicholas Broune, Esq., den Herausgeber des „Morning Frühstückstisch“, einer angesehenen Tageszeitung, gerichtet; und da er der längste war, galt er auch als der wichtigste der drei. Herr Broune war ein Mann, der in seinem Beruf sehr erfolgreich war – und er war ein Frauenliebhaber. Lady Carbury hatte sich in ihrem Brief als alte Frau bezeichnet, aber sie tat dies in der Überzeugung, dass sie von niemand anderem in diesem Licht gesehen wurde. Ihr Alter soll für den Leser kein Geheimnis sein, obwohl es selbst ihren engsten Freunden, sogar Herrn Broune, nie verraten wurde. Sie war dreiundvierzig, aber sie hatte ihre Jahre so gut hinter sich gebracht und war von der Natur so reich beschenkt worden, dass es unmöglich war, zu leugnen, dass sie immer noch eine schöne Frau war. Und sie nutzte ihre Schönheit nicht nur, um ihren Einfluss zu vergrößern – wie es für Frauen mit gutem Aussehen selbstverständlich ist –, sondern auch mit dem wohlüberlegten Kalkül, dass sie materielle Unterstützung bei der Beschaffung von Brot und Käse erhalten könnte, was für sie sehr notwendig war, indem sie die guten Dinge, mit denen die Vorsehung sie ausgestattet hatte, umsichtig an ihre Zwecke anpasste. Sie verliebte sich nicht, sie flirtete nicht absichtlich, sie legte sich nicht fest; aber sie lächelte und flüsterte, vertraute sich an und blickte aus ihren eigenen Augen in die Augen der Männer, als ob es eine geheimnisvolle Verbindung zwischen ihr und ihnen geben könnte – wenn nur die geheimnisvollen Umstände dies zuließen. Aber das Ziel war es, jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun, das einen Verleger dazu veranlassen würde, ihr eine gute Bezahlung für mittelmäßige Schreibkunst zu geben, oder einen Redakteur dazu, nachsichtig zu sein, wenn er eigentlich streng sein sollte. Unter all ihren literarischen Freunden war Herr Broune derjenige, dem sie am meisten vertraute; und Herr Broune hatte eine Vorliebe für gutaussehende Frauen. Es mag sinnvoll sein, kurz eine Szene zu schildern, die sich etwa einen Monat vor dem Verfassen dieses Briefes zwischen Lady Carbury und ihrer Freundin zugetragen hatte. Sie hatte gewollt, dass er eine Reihe von Papieren für den „Morning Frühstückstisch“ mitnahm und sie nach Tarif Nr. 1 bezahlte, während sie vermutete, dass er an ihrem Wert zweifelte, und sie wusste, dass sie ohne besondere Gefälligkeit nicht auf eine Vergütung über Tarif Nr. 2 oder möglicherweise sogar Nr. 3 hoffen konnte. Also hatte sie ihm in die Augen geschaut und ihre weiche, pralle Hand für einen Moment in seiner gelassen. Ein Mann ist unter solchen Umständen oft unbeholfen und weiß nicht genau, wann er was tun soll! Herr Broune hatte in einem Moment der Begeisterung seinen Arm um Lady Carburys Taille gelegt und sie geküsst. Zu sagen, dass Lady Carbury wütend war, wie die meisten Frauen es bei einer solchen Behandlung wären, würde eine ungerechte Vorstellung von ihrem Charakter vermitteln. Es war ein kleiner Unfall, der wirklich keine Verletzung mit sich brachte, es sei denn, es sollte die Verletzung sein, die zu einem Bruch zwischen ihr und einem wertvollen Verbündeten führte. Kein Gefühl der Zartheit wurde verletzt. Was machte das schon? Es war keine unverzeihliche Beleidigung ausgesprochen worden; es war kein Schaden angerichtet worden, wenn nur der liebe, empfindsame alte Esel sofort verstehen würde, dass das nicht der richtige Weg war!
Ohne mit der Wimper zu zucken und ohne rot zu werden, entwand sie sich seinem Arm und hielt ihm dann eine ausgezeichnete kleine Rede. „Herr Broune, wie töricht, wie falsch, wie verkehrt! Ist es nicht so? Sie wollen doch nicht etwa die Freundschaft zwischen uns beenden!“
„Unsere Freundschaft beenden, Lady Carbury! Oh, das ganz gewiss nicht.“
„Warum es dann durch eine solche Tat riskieren? Denk an meinen Sohn und meine Tochter, die beide erwachsen sind. Denk an die vergangenen Probleme meines Lebens, so viel gelitten und so wenig verdient. Niemand kennt sie so gut wie du. Denk an meinen Namen, der so oft verleumdet wurde, aber nie in Ungnade gefallen ist! Sag, dass es dir leid tut, und es soll vergessen werden.“
Wenn ein Mann eine Frau geküsst hat, dann ist es für ihn schwer, im nächsten Moment zu sagen, dass es ihm leid tut, was er getan hat. Das wäre so, als würde man erklären, dass der Kuss nicht seinen Erwartungen entsprochen hat. Herr Broune konnte das nicht tun, und vielleicht hatte Lady Carbury das auch nicht ganz erwartet. „Du weißt, dass ich dich um nichts in der Welt beleidigen würde“, sagte er. Das genügte. Lady Carbury schaute ihm wieder in die Augen, und es wurde versprochen, dass die Artikel gedruckt werden sollten – und das gegen eine großzügige Vergütung.
Als das Interview vorbei war, betrachtete Lady Carbury es als recht erfolgreich. Natürlich kommt es zu kleinen Unfällen, wenn man sich durchkämpfen und harte Arbeit leisten muss. Die Dame, die ein Taxi auf der Straße benutzt, muss Schlamm und Staub ausgesetzt sein, dem ihr reicherer Nachbar, der eine private Kutsche hat, entgeht. Sie hätte es vorgezogen, nicht geküsst worden zu sein; aber was machte das schon? Bei Herrn Broune war die Angelegenheit ernster. „Zum Teufel mit ihnen allen“, sagte er sich, als er das Haus verließ; „kein noch so großer Erfahrungsschatz befähigt einen Mann, sie zu kennen.“ Als er wegging, dachte er fast, dass Lady Carbury beabsichtigt hatte, dass er sie wieder küsst, und er war fast wütend auf sich selbst, dass er es nicht getan hatte. Er hatte sie seitdem drei- oder viermal gesehen, aber das Vergehen nicht wiederholt.
Wir kommen nun zu den anderen Briefen, die beide an die Herausgeber anderer Zeitungen gerichtet waren. Der zweite war an Herrn Booker vom „Literarische Chronik“ gerichtet. Herr Booker war ein fleißiger Literaturprofessor, keineswegs ohne Talent, keineswegs ohne Einfluss und keineswegs ohne Gewissen. Aber aufgrund der Art der Kämpfe, in die er verwickelt war, aufgrund von Kompromissen, die ihm allmählich durch das Vordringen von Autorenbrüdern auf der einen Seite und durch die Forderungen der Arbeitgeber auf der anderen Seite, die nur auf ihre Gewinne schauten, aufgezwungen wurden, war er in eine Arbeitsroutine verfallen, in der es sehr schwierig war, gewissenhaft zu sein, und fast unmöglich, die Feinheiten eines literarischen Gewissens aufrechtzuerhalten. Er war jetzt ein glatzköpfiger alter Mann von sechzig Jahren mit einer großen Familie von Töchtern, von denen eine eine Witwe war, die von ihm abhängig war und zwei kleine Kinder hatte. Er verdiente 500 Pfund im Jahr für die Herausgabe der „Literarische Chronik“, die durch seine Energie zu einem wertvollen Gut geworden war. Er schrieb für Zeitschriften und brachte fast jährlich ein eigenes Buch heraus. Er hielt sich über Wasser und wurde von denen, die ihn kannten, ihn aber nicht persönlich kannten, als erfolgreicher Mann angesehen. Er behielt immer seinen Humor und konnte in literarischen Kreisen zeigen, dass er sich behaupten konnte. Aber er war durch den Stress der Umstände dazu getrieben, alles Gute anzunehmen, das ihm in den Weg kam, und konnte es sich kaum leisten, unabhängig zu sein. Man muss zugeben, dass er schon lange keine literarischen Skrupel mehr hatte. Brief Nr. 2 lautete wie folgt:
Welbeck Straße, 25. Februar 187-.
LIEBER HERR BOOKER ,
Ich habe Herrn Leadham [Herr Leadham war der Seniorpartner der unternehmungslustigen Verlagsfirma, die als Messrs. Leadham und Loiter bekannt war] angewiesen, Ihnen ein frühes Exemplar meiner „Verbrecherköniginnen“ zuzusenden. Mit meinem Freund Herrn Broune habe ich bereits vereinbart, dass ich Ihre „Neue Geschichte von einer Tonne“ im „Frühstückstisch“ bespreche. Tatsächlich bin ich gerade dabei und gebe mir große Mühe damit. Falls es etwas gibt, das Sie in Bezug auf Ihre Sicht des Protestantismus der Zeit besonders hervorgehoben wissen möchten, lassen Sie es mich wissen. Ich würde es begrüßen, wenn Sie ein Wort zur Genauigkeit meiner historischen Details sagen könnten, was Sie gewiss mit gutem Gewissen tun können. Schieben Sie es nicht auf, da der Verkauf so sehr von frühen Besprechungen abhängt. Ich erhalte lediglich eine Tantieme, die erst beginnt, wenn die ersten vierhundert Exemplare verkauft sind.
Mit freundlichen Grüßen MATILDA CARBURY. ALFRED BOOKER, ESQ., Büro von „Literarische Chronik“, Strand .
Für Herr Booker war daran nichts Schockierendes. Er lachte in sich hinein, mit einem angenehm zurückhaltenden Schmunzeln, als er sich vorstellte, wie Lady Carbury sich mit seinen Ansichten über den Protestantismus auseinandersetzte – ebenso wie er sich die zahlreichen historischen Fehler ausmalte, in die diese kluge Dame unvermeidlich verfallen musste, wenn sie über Dinge schrieb, von denen er überzeugt war, dass sie ihr völlig fremd waren. Doch war ihm vollkommen bewusst, dass eine wohlwollende Besprechung seines sehr durchdachten Werkes, betitelt „Die neue Geschichte eines Fasses“, im „Frühstückstisch“ ihm von Nutzen sein würde – selbst wenn sie aus der Feder einer literarischen Scharlatanin stammte. Und er hätte keinerlei Skrupel, diese Gefälligkeit mit überschwänglichem Lob im „Literarische Chronik“ zu vergelten. Wahrscheinlich würde er nicht behaupten, das Buch sei akkurat, doch er könnte erklären, dass es eine höchst vergnügliche Lektüre sei, dass die weiblichen Wesenszüge der Königinnen mit meisterhafter Hand gezeichnet worden seien und dass dieses Werk gewiss seinen Weg in alle Salons finden werde. Er war ein Meister in dieser Art von Arbeit und wusste genau, wie man ein Buch wie Lady Carburys „Verbrecherische Königinnen“ rezensierte, ohne sich allzu sehr mit der Lektüre zu plagen. Er hätte es beinahe tun können, ohne das Buch überhaupt aufzuschneiden, sodass sein Wert für einen späteren Weiterverkauf nicht gemindert würde. Und doch war Herr Booker ein ehrlicher Mann, der sich beharrlich gegen viele literarische Missstände gestellt hatte. Ausgedehnte Schriftarten, unzureichende Zeilenabstände und die französische Unsitte, mit wenigen Worten eine ganze Seite zu füllen, hatte er mit gewissenhafter Strenge getadelt. Man hielt ihn unter den Rezensenten für eine Art Aristides. Doch unter den gegebenen Umständen konnte er sich den Gepflogenheiten der Zeit nicht gänzlich widersetzen. „Schlecht; natürlich ist es schlecht“, sagte er zu einem jungen Freund, der mit ihm an seiner Zeitschrift arbeitete. „Wer zweifelt daran? Wie viele schlechte Dinge tun wir! Aber wenn wir versuchen würden, all unsere schlechten Gewohnheiten auf einmal zu reformieren, würden wir niemals etwas Gutes zustande bringen. Ich bin nicht stark genug, um die Welt in Ordnung zu bringen, und ich bezweifle, dass Sie es sind.“ So war Herr Booker.
Dann war da noch Brief Nr. 3 an Herrn Ferdinand Alf. Herr Alf leitete und besaß, wie man annahm, größtenteils die „Abendkanzel“, die in den letzten zwei Jahren, wie es unter Presseleuten hieß, „zu einer echten Institution“ geworden war. Die „Abendkanzel“ sollte ihren Lesern täglich alles berichten, was bis zwei Uhr nachmittags von den führenden Persönlichkeiten der Metropole gesagt und getan worden war, und mit erstaunlicher Treffsicherheit voraussagen, was in den folgenden zwölf Stunden gesagt und getan werden würde. Dies geschah mit einer Aura wunderbarer Allwissenheit – und nicht selten mit einer Unwissenheit, die kaum von ihrer Anmaßung übertroffen wurde. Doch die Artikel waren geschickt geschrieben. Die Fakten, wenn sie nicht wahr waren, waren zumindest gut erfunden; die Argumente, wenn sie nicht logisch waren, waren doch verführerisch. Der leitende Geist des Blattes besaß jedenfalls die Gabe, zu wissen, was die Leser, für die er schrieb, gerne lesen wollten, und wie er seine Themen so aufbereiten konnte, dass die Lektüre angenehm war. Herr Bookers „Literarische Chronik“ nahm für sich nicht in Anspruch, besondere politische Ansichten zu vertreten. Der „Frühstückstisch“ war entschieden liberal. Die „Abendkanzel“ hingegen beschäftigte sich intensiv mit Politik, hielt sich dabei jedoch streng an das Motto, das sie sich gegeben hatte: —
„Keinem Meister verpflichtet, auf dessen Worte zu schwören“
und hatte folglich zu jeder Zeit das unschätzbare Privileg, das zu missbilligen, was getan wurde, sei es von der einen oder der anderen Seite. Eine Zeitung, die ihr Glück machen will, sollte niemals ihre Spalten verschwenden und ihre Leser ermüden, indem sie irgendetwas lobt. Lobreden sind ausnahmslos langweilig – eine Tatsache, die Herr Alf entdeckt und genutzt hatte.
Herr Alf hatte außerdem noch eine andere Tatsache entdeckt. Beschimpfungen von denen, die gelegentlich loben, werden als persönliche Beleidigung empfunden, und wer persönlich beleidigt, macht sich die Welt manchmal zu heiß, um sie zu ertragen. Aber Tadel von denen, die immer etwas auszusetzen haben, wird als so selbstverständlich angesehen, dass er nicht mehr zu beanstanden ist. Der Karikaturist, der nur Karikaturen zeichnet, wird als gerechtfertigt angesehen, er möge sich mit dem Gesicht und der Person eines Menschen so viele Freiheiten herausnehmen, wie er möchte. Das ist sein Beruf, und sein Geschäft verlangt von ihm, alles, was er anfasst, zu verunglimpfen. Würde ein Künstler jedoch eine Reihe von Porträts veröffentlichen, bei denen zwei von einem Dutzend so hässlich gemacht wurden, würde er sich sicherlich zwei Feinde machen, wenn nicht mehr. Herr Alf hat sich nie Feinde gemacht, denn er hat niemanden gelobt und war, was den Ausdruck seiner Zeitung angeht, mit nichts zufrieden.
Herr Alf war ein bemerkenswerter Mann. Niemand wusste, woher er kam oder was er gewesen war. Er soll als deutscher Jude geboren worden sein, und einige Damen meinten, in seiner Sprache den geringstmöglichen ausländischen Akzent herauszuhören. Dennoch wurde ihm zugestanden, dass er England so gut kannte, wie es nur ein Engländer kann. In den letzten ein, zwei Jahren war er, wie man so schön sagt, „aufgestiegen“, und zwar sehr gründlich. Er war in drei oder vier Clubs abgelehnt worden, hatte aber in zwei oder drei anderen Clubs Aufnahme gefunden, und er hatte eine Art und Weise des Sprechens über diejenigen, die ihn abgelehnt hatten, gelernt, die darauf abzielte, bei den Zuhörern den Eindruck zu erwecken, dass die betreffenden Gesellschaften antiquiert, dumm und dem Untergang geweiht seien. Er wurde nicht müde zu betonen, dass man, wenn man Herrn Alf nicht kenne, nicht gut mit ihm befreundet sei und nicht verstehe, dass man Herrn Alf, wo auch immer und wie auch immer er geboren worden sein mag, immer als wünschenswerten Bekannten anerkennen sollte, völlig im Dunkeln tappe. Und was er so ständig behauptete oder andeutete, begannen die Männer und Frauen um ihn herum schließlich zu glauben – und Herr Alf wurde in den verschiedenen Welten der Politik, der Literatur und der Mode zu einer anerkannten Größe.
Er war ein gut aussehender Mann, etwa vierzig Jahre alt, aber er gab sich viel jünger, schlank, kleiner als mittelgroß, mit dunkelbraunem Haar, das ohne die Kunst des Färbens einen Hauch von Grau gezeigt hätte, mit gut geschnittenen Gesichtszügen, mit einem ständigen Lächeln auf den Lippen, dessen Angenehmheit immer durch die scharfe Strenge seiner Augen Lügen gestraft wurde. Er kleidete sich mit äußerster Schlichtheit, aber auch mit äußerster Sorgfalt. Er war unverheiratet, besaß ein kleines Haus in der Nähe des Berkeley Platz, in dem er bemerkenswerte Abendgesellschaften gab, hielt vier oder fünf Jäger in Northamptonshire und verdiente angeblich 6.000 Pfund pro Jahr mit der „Abendkanzel“ und gab etwa die Hälfte dieses Einkommens aus. Er hatte auch eine Art Intimbeziehung mit Lady Carbury, die sich unermüdlich um den Aufbau und die Pflege nützlicher Freundschaften bemühte. Ihr Brief an Herrn Alf lautete wie folgt:
LIEBER HERR ALF, Sag mir, wer die Rezension über Fitzgerald Barkers letztes Gedicht geschrieben hat. Nur ich weiß, dass du es nicht warst. Ich erinnere mich an nichts, was so gut gelungen ist. Ich denke, der arme Kerl wird sich vor dem Herbst kaum wieder aufrichten können. Aber er hat es voll und ganz verdient. Ich habe keine Geduld mit den Anmaßungen von Möchtegern-Dichtern, die sich durch Kriecherei und unterirdische Einflüsse dazu bringen, ihre Bände auf jeden Salontisch zu bringen. Ich kenne niemanden, dem die Welt auf diese Weise so wohlgesonnen war wie Fitzgerald Barker, aber ich habe von niemandem gehört, der diese Gutmütigkeit so weit ausgedehnt hat, dass er seine Gedichte gelesen hat. Ist es nicht seltsam, wie manche Männer weiterhin den Ruf eines beliebten Schriftstellers erlangen, ohne der Literatur ihres Landes ein bemerkenswertes Wort hinzuzufügen? Dies wird durch unermüdlichen Fleiß im System des Anpreisens erreicht. Anpreisen und sich selbst anpreisen sind zu verschiedenen Zweigen eines neuen Berufs geworden. Ach, ich! Ich wünschte, ich könnte einen Kurs finden, in dem ein so armer Anfänger wie ich Unterricht nehmen könnte. So sehr ich diese Sache auch von ganzem Herzen hasse und so sehr ich die Konsequenz bewundere, mit der sich die „Kanzel“ ihr widersetzt hat, so sehr brauche ich selbst Unterstützung für meine eigenen kleinen Bemühungen und so sehr darum kämpfe, mir eine einträgliche Karriere aufzubauen, dass ich denke, wenn sich mir die Gelegenheit böte, sollte ich meine Ehre in die Tasche stecken, das hohe Gefühl, das mir sagt, dass man sich Lob weder durch Geld noch durch Freundschaft erkaufen sollte, Beiseitesprechen und mich unter die niedrigen Dinge begeben, damit ich eines Tages stolz darauf sein könnte, dass es mir gelungen ist, durch meine eigene Arbeit für die Bedürfnisse meiner Kinder zu sorgen. Aber ich habe noch nicht mit dem Abstieg nach unten begonnen; und deshalb bin ich immer noch mutig genug, euch zu sagen, dass ich alles, was in der „Kanzel“ in Bezug auf meine „kriminellen Königinnen“ erscheint, nicht mit Besorgnis, sondern mit großem Interesse betrachten werde. Ich wage zu glauben, dass das Buch – obwohl ich es selbst geschrieben habe – eine eigene Bedeutung hat, die ihm Aufmerksamkeit sichern wird. Ich zweifle nicht im Geringsten daran, dass meine Ungenauigkeit aufgedeckt und meine Anmaßung gegeißelt werden, aber ich denke, dein Rezensent wird bestätigen können, dass die Skizzen lebensecht und die Porträts gut durchdacht sind. Du wirst mich jedenfalls nicht sagen hören, dass ich besser zu Hause bleiben und meine Strümpfe stopfen sollte, wie du neulich über die arme, unglückliche Frau Effington Stubbs gesagt hast. Ich habe dich seit drei Wochen nicht mehr gesehen. Ich habe jeden Dienstagabend ein paar Freunde; bitte komm nächste oder übernächste Woche. Und bitte glaube, dass mich keine noch so strenge redaktionelle oder kritische Haltung dazu bringen wird, dich anders als mit einem Lächeln zu empfangen. Mit freundlichen Grüßen, MATILDA CARBURY
Lady Carbury, die ihren dritten Brief beendet hatte, warf sich in ihren Sessel zurück und schloss für einen oder zwei Momente die Augen, als ob sie sich ausruhen wollte. Aber sie erinnerte sich bald daran, dass die Aktivität ihres Lebens eine solche Ruhe nicht zuließ. Sie ergriff daher ihre Feder und begann, weitere Notizen zu kritzeln.
Kapitel II Die Carbury-Familie
Über sich selbst und ihren Zustand hat Lady Carbury dem Leser in den Briefen im vorherigen Kapitel berichtet, aber es muss noch mehr hinzugefügt werden. Sie hat erklärt, dass sie grausam verleumdet worden sei; aber sie hat auch gezeigt, dass sie keine Frau war, deren Worte über sich selbst man mit großer Zuversicht nehmen konnte. Wenn der Leser nicht so viel aus ihren Briefen an die drei Herausgeber versteht, sind sie vergeblich geschrieben worden. Sie wurde dazu gebracht zu sagen, dass ihr Ziel in der Arbeit darin bestand, für die Bedürfnisse ihrer Kinder zu sorgen, und dass sie mit diesem edlen Ziel vor Augen darum kämpfte, sich eine Karriere in der Literatur zu erarbeiten. So verabscheuungswürdig falsch ihre Briefe an die Herausgeber auch gewesen waren, so abscheulich und widerwärtig das gesamte System war, mit dem sie versuchte, Erfolg zu haben, so weit entfernt von Ehre und Ehrlichkeit sie durch ihre bereitwillige Unterwürfigkeit gegenüber den schmutzigen Dingen, unter die sie kürzlich gefallen war, getragen worden war, so waren ihre Aussagen über sich selbst dennoch im Wesentlichen wahr. Sie war misshandelt worden. Sie war verleumdet worden. Sie war ihren Kindern treu ergeben – einem von ihnen besonders zugetan – und war bereit, sich die Nägel wund zu arbeiten, wenn sie dadurch ihre Interessen fördern konnte.
Sie war die Witwe eines Herrn Patrick Carbury, der vor vielen Jahren als Soldat in Indien Großes geleistet hatte und daraufhin zum Baronet ernannt worden war. Er hatte spät im Leben eine junge Frau geheiratet und, nachdem er zu spät herausgefunden hatte, dass er einen Fehler gemacht hatte, seinen Schatz gelegentlich verwöhnt und gelegentlich schlecht behandelt. In beiden Fällen hatte er es reichlich getan. Zu den Fehlern von Lady Carbury gehörte nie auch nur ansatzweise – nicht einmal aus Sentimentalität – Untreue gegenüber ihrem Ehemann. Als sie als hübsches und mittelloses Mädchen von achtzehn Jahren einwilligte, einen vierundvierzigjährigen Mann zu heiraten, der über ein hohes Einkommen verfügte, hatte sie sich entschlossen, alle Hoffnung auf diese Art von Liebe aufzugeben, die Dichter beschreiben und die junge Menschen im Allgemeinen erleben wollen. Herr Patrick war zum Zeitpunkt seiner Heirat rotgesichtig, dick, kahlköpfig, sehr cholerisch, großzügig mit Geld, misstrauisch im Temperament und intelligent. Er wusste, wie man Männer regiert. Er konnte ein Buch lesen und verstehen. Es war nichts Gemeines an ihm. Er hatte seine attraktiven Eigenschaften. Er war ein Mann, der geliebt werden könnte, – aber er war kaum ein Mann für die Liebe. Die junge Lady Carbury hatte ihre Position verstanden und war entschlossen, ihre Pflicht zu tun. Sie hatte sich vor dem Gang zum Altar geschworen, niemals zu flirten, und sie hatte nie geflirtet. Fünfzehn Jahre lang war alles einigermaßen gut gelaufen, was heißen soll, dass sie es so gut hatte laufen lassen, dass sie es ertragen konnte. Drei oder vier Jahre lang waren sie in England zu Hause gewesen, dann war Herr Patrick mit einem neuen und höheren Amt zurückgekehrt. Fünfzehn Jahre lang war er leidenschaftlich, herrisch und oft grausam gewesen, aber nie eifersüchtig. Ihnen waren ein Junge und ein Mädchen geboren worden, denen Vater und Mutter übermäßig nachsichtig gegenüber gewesen waren – aber die Mutter hatte sich bemüht, ihre Pflicht ihnen gegenüber zu erfüllen. Aber von Anfang an war sie in der Täuschung erzogen worden, und ihr Eheleben schien es ihr notwendig zu machen, zu täuschen. Ihre Mutter war vor ihrem Vater davongelaufen, und sie war zwischen diesem und jenem Beschützer hin- und hergeschoben worden, wobei sie manchmal in Gefahr war, sich nach jemandem zu sehnen, der sich um sie kümmerte, bis sie durch die Schwierigkeiten ihrer Lage scharfsinnig, ungläubig und nicht vertrauenswürdig geworden war. Aber sie war klug und hatte sich inmitten der Schwierigkeiten ihrer Kindheit eine Ausbildung und gute Manieren angeeignet – und war schön anzusehen gewesen.
Zu heiraten und über Geld zu verfügen, ihre Pflicht richtig zu erfüllen, in einem großen Haus zu leben und respektiert zu werden, war ihr Ziel gewesen – und während der ersten fünfzehn Jahre ihres Ehelebens war sie trotz großer Schwierigkeiten erfolgreich. Nach fünf Minuten heftiger Misshandlung lächelte sie. Ihr Mann schlug sie sogar – und ihr erster Gedanke war, diese Tatsache vor der ganzen Welt zu verbergen. In späteren Jahren trank er zu viel, und sie bemühte sich zunächst, das Übel zu verhindern, und dann, die negativen Auswirkungen des Übels zu verhindern und zu verbergen. Aber dabei intrigierte sie, log und führte ein Leben voller Manöver. Schließlich, als sie sich nicht mehr ganz jung fühlte, erlaubte sie sich, Freundschaften zu schließen, und unter ihren Freunden war auch einer des anderen Geschlechts. Wenn die Treue einer Ehefrau mit einer solchen Freundschaft vereinbar ist, wenn der Ehestand von einer Frau nicht verlangt, dass sie sich von jeglichem freundschaftlichen Umgang mit einem Mann außer ihrem Gatten ausschließt, dann war Lady Carbury nicht untreu. Aber Herr Carbury wurde eifersüchtig, sprach Worte, die selbst sie nicht ertragen konnte, tat Dinge, die selbst sie über die Grenzen ihrer Klugheit trieben – und sie verließ ihn. Aber selbst das tat sie auf so vorsichtige Weise, dass sie bei jedem Schritt, den sie unternahm, ihre Unschuld beweisen konnte. Ihr Leben in dieser Zeit ist für unsere Geschichte von geringer Bedeutung, außer dass es wichtig ist, dass der Leser weiß, worüber sie verleumdet wurde. Ein oder zwei Monate lang waren alle harten Worte von den Freunden ihres Mannes und sogar von Herrn Patrick selbst gegen sie gerichtet worden. Aber allmählich wurde die Wahrheit bekannt, und nach einem Jahr der Trennung kamen sie wieder zusammen, und sie blieb die Herrin seines Hauses, bis er starb. Sie brachte ihn nach England, aber während der kurzen Zeit, die ihm in seinem alten Land noch blieb, war er ein erschöpfter, sterbender Invalide gewesen. Aber der Skandal ihres großen Unglücks war ihr gefolgt, und einige Leute wurden nicht müde, andere daran zu erinnern, dass Lady Carbury im Laufe ihres Ehelebens vor ihrem Ehemann weggelaufen war und von dem gutherzigen alten Herrn wieder aufgenommen worden war.
Sir Patrick hatte ein bescheidenes Vermögen hinterlassen, wenn auch keineswegs großen Reichtum. Seinem Sohn, der nun Sir Felix Carbury hieß, hatte er 1.000 Pfund pro Jahr hinterlassen; und seiner Witwe ebenso viel, mit der Maßgabe, dass nach ihrem Tod die letztgenannte Summe zwischen seinem Sohn und seiner Tochter aufgeteilt werden sollte. So kam es, dass der junge Mann, der zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters bereits in die Armee eingetreten war, kein Haus unterhalten musste und tatsächlich nicht selten im Haus seiner Mutter lebte, ein Einkommen hatte, das dem entsprach, mit dem seine Mutter und seine Schwester ein Dach über dem Kopf erhalten mussten. Als Lady Carbury im Alter von vierzig Jahren aus ihrer Gefangenschaft entlassen wurde, hatte sie keinerlei Vorstellung davon, ihr zukünftiges Leben inmitten der gewöhnlichen Bußen des Witwenstandes zu verbringen. Sie hatte sich bisher bemüht, ihre Pflicht zu tun, in dem Wissen, dass sie mit der Annahme ihrer Position das Gute und das Schlechte zusammen annehmen musste. Sie hatte bisher sicherlich viel Schlechtes erlebt. Von einem cholerischen alten Mann beschimpft, beobachtet, geschlagen und beschimpft zu werden, bis sie schließlich durch die Gewalt seiner Misshandlungen aus ihrem Haus vertrieben wurde; als Gefallen zurückgenommen zu werden, mit der Zusicherung, dass ihr Name für den Rest ihres Lebens zu Unrecht befleckt sein würde; sich ständig ihre Flucht vor Augen halten zu müssen; und dann schließlich für ein oder zwei Jahre die Krankenschwester eines sterbenden Wüstlings zu werden, war ein hoher Preis für all die guten Dinge, die sie bisher genossen hatte. Nun war endlich eine Zeit der Entspannung für sie gekommen – ihr Lohn, ihre Freiheit, ihre Chance auf Glück. Sie dachte viel über sich selbst nach und fasste den Entschluss, sich in ein oder zwei Dingen zu ändern. Die Zeit der Liebe war vorbei, und sie wollte nichts damit zu tun haben. Sie würde auch nicht wieder aus Bequemlichkeit heiraten. Aber sie würde Freunde haben – echte Freunde; Freunde, die ihr helfen könnten – und denen sie möglicherweise helfen könnte. Sie würde auch eine Karriere für sich selbst machen, damit das Leben für sie nicht uninteressant wäre. Sie würde in London leben und in jedem Fall in irgendeinem Kreis jemand werden. Der Zufall hatte sie eher in die literarischen Kreise verschlagen als ihre Wahl, aber dieser Zufall war in den letzten zwei Jahren durch den Wunsch, Geld zu verdienen, unterstützt und bestätigt worden. Sie hatte von Anfang an gewusst, dass sie sparen musste – nicht hauptsächlich oder vielleicht gar nicht aus dem Gefühl heraus, dass sie und ihre Tochter nicht mit einem Jahreseinkommen von tausend Pfund bequem zusammenleben könnten –, sondern für ihren Sohn. Sie wollte keinen Luxus, sondern ein Haus, das so gelegen war, dass die Leute denken könnten, sie lebe in einem angemessenen Teil der Stadt. Von der Klugheit ihrer Tochter war sie ebenso überzeugt wie von ihrer eigenen. Sie konnte Henrietta in allem vertrauen. Aber ihr Sohn, Sir Felix, war nicht sehr vertrauenswürdig. Und doch war Sir Felix der Liebling ihres Herzens.
Zum Zeitpunkt des Schreibens der drei Briefe, mit denen unsere Geschichte beginnen soll, war sie sehr knapp bei Kasse. Herr Felix war damals fünfundzwanzig, hatte vier Jahre lang in einem Moderegiment gedient, war bereits ausverkauft und hatte, um die Wahrheit gleich zu sagen, das Vermögen, das sein Vater ihm hinterlassen hatte, völlig verschwendet. So viel wusste die Mutter – und wusste daher, dass sie mit ihrem begrenzten Einkommen nicht nur sich selbst und ihre Tochter, sondern auch den Baronet ernähren musste. Sie wusste jedoch nicht, wie hoch die Verpflichtungen des Baronets waren; und das wusste er selbst auch nicht, ebenso wenig wie sonst jemand. Ein Baronet, der einen Dienstposten bei den Gardisten innehat und von dem bekannt ist, dass er ein Vermögen von seinem Vater geerbt hat, kann sich sehr hoch verschulden; und Herr Felix hatte von all seinen Privilegien vollen Gebrauch gemacht. Sein Leben war in jeder Hinsicht schlecht gewesen. Er war seiner Mutter und auch seiner Schwester eine so schwere Last geworden, dass ihr Leben zu einer unvermeidlichen Belastung geworden war. Aber nicht einen Augenblick lang hatte sich einer von ihnen jemals mit ihm gestritten. Henrietta hatte durch das Verhalten von Vater und Mutter gelernt, dass jedes Laster bei einem Mann und einem Sohn vergeben werden könnte, während von einer Frau und insbesondere von einer Tochter jede Tugend erwartet wurde. Diese Lektion hatte sie so früh im Leben gelernt, dass sie sie ohne das Gefühl eines Grolls gelernt hatte. Sie beklagte das schlechte Benehmen ihres Bruders, da es ihn selbst betraf, aber sie verzieh es ihm völlig, da es sie selbst betraf. Dass all ihre Interessen im Leben ihm untergeordnet werden sollten, war für sie selbstverständlich; und als sie feststellte, dass ihre kleinen Annehmlichkeiten eingestellt und ihre moderaten Ausgaben gekürzt wurden, weil er, nachdem er alles aufgebraucht hatte, was ihm gehörte, nun auch alles aufbrauchte, was seiner Mutter gehörte, beschwerte sie sich nie. Henrietta war gelehrt worden zu denken, dass Männer in der Lebenslage, in der sie geboren wurde, immer alles aufbrauchen.
Die Gefühle der Mutter waren weniger edel – oder vielleicht könnte man besser sagen, sie waren kritikwürdiger. Der Junge, der schön wie ein Stern gewesen war, war schon immer der Mittelpunkt ihrer Augen gewesen, das Einzige, woran ihr Herz hing. Selbst während seiner Karriere der Torheit hatte sie kaum gewagt, ein Wort zu ihm zu sagen, um ihn auf seinem Weg ins Verderben aufzuhalten. Als Junge hatte sie ihn in allem verwöhnt, und als Mann verwöhnte sie ihn immer noch in allem. Sie war fast stolz auf seine Laster und hatte Freude daran, von Taten zu hören, die, wenn nicht an sich schon lasterhaft, so doch aufgrund ihrer Extravaganz ruinös waren. Sie hatte ihn so verwöhnt, dass er sich selbst in ihrer Gegenwart nie für seine Selbstsucht schämte oder sich anscheinend der Ungerechtigkeit bewusst war, die er anderen antat.
Aus all dem war es dazu gekommen, dass das Herumprobieren in der Literatur, das teilweise vielleicht aus Freude an der Arbeit, teilweise als Passierschein in die Gesellschaft begonnen hatte, in harte Arbeit umgewandelt worden war, mit der man, wenn möglich, Geld verdienen könnte. Lady Carbury sprach also die Wahrheit, als sie ihren Freunden, den Verlegern, von ihren Kämpfen schrieb. Sie hatte die Nachricht von dem Erfolg dieses und des anderen Mannes erhalten und – als er ihr näher kam – von dem Verdienst dieser und jener anderen Frau in der Literatur. Und es schien ihr, dass sie ihren Hoffnungen in bescheidenem Rahmen freien Lauf lassen könnte. Warum sollte sie nicht tausend Pfund pro Jahr zu ihrem Einkommen hinzufügen, damit Felix wieder wie ein Gentleman leben und die Erbin heiraten konnte, die in Lady Carburys Blick in die Zukunft dazu bestimmt war, alles in Ordnung zu bringen! Wer war so gutaussehend wie ihr Sohn? Wer konnte sich angenehmer machen? Wer hatte mehr von dieser Kühnheit, die das Wichtigste ist, um Erbin zu gewinnen?
Und dann könnte er seine Frau zu Lady Carbury machen. Wenn nur genug Geld verdient werden könnte, um die gegenwärtige Notlage zu überbrücken, könnte alles gut werden.
Das größte Hindernis für den Erfolg bei all dem war wahrscheinlich Lady Carburys Überzeugung, dass ihr Ziel nicht darin bestand, gute Bücher zu schreiben, sondern bestimmte Leute dazu zu bringen, ihre Bücher für gut zu befinden. Sie arbeitete hart an dem, was sie schrieb – hart genug, um ihre Seiten schnell zu füllen; und sie war von Natur aus eine kluge Frau. Sie konnte auf eine flotte, alltägliche, lebhafte Art schreiben und hatte bereits die Fähigkeit erworben, alles, was sie wusste, sehr dünn zu verteilen, so dass es eine große Fläche bedecken konnte. Sie hatte nicht den Ehrgeiz, ein gutes Buch zu schreiben, sondern war schmerzlich darauf bedacht, ein Buch zu schreiben, das die Kritiker für gut befinden sollten. Hätte Herr Broune ihr in seinem Arbeitszimmer gesagt, dass ihr Buch absoluter Schund sei, sich aber gleichzeitig verpflichtet, es im „Frühstückstisch“ heftig zu loben, wäre es zweifelhaft, ob die Meinung des Kritikers ihre Eitelkeit überhaupt verletzt hätte. Die Frau war von Kopf bis Fuß falsch, aber sie hatte auch viel Gutes an sich, so falsch sie auch war.
Ob Herr Felix, ihr Sohn, nur durch schlechte Erziehung zu dem geworden war, was er war, oder ob er von Natur aus schlecht war, wer kann das sagen? Es ist kaum möglich, dass er nicht besser gewesen wäre, wenn er als Kind weggebracht und von moralischen Lehrern moralisch erzogen worden wäre. Und doch ist es wiederum kaum möglich, dass irgendeine Ausbildung oder mangelnde Ausbildung ein Herz hervorgebracht haben sollte, das so völlig unfähig war, für andere zu empfinden, wie es seines war. Er konnte nicht einmal sein eigenes Unglück spüren, es sei denn, es berührte den äußeren Komfort des Augenblicks. Es schien, als fehle ihm die Vorstellungskraft, um zukünftiges Elend zu erkennen, obwohl die zu berücksichtigende Zukunft nur durch einen einzigen Monat, eine einzige Woche – aber durch eine einzige Nacht – von der Gegenwart getrennt war. Er mochte es, freundlich behandelt zu werden, gelobt und gestreichelt zu werden, gut gefüttert und liebkost zu werden; und diejenigen, die ihn so behandelten, waren seine auserwählten Freunde. Er hatte darin die Instinkte eines Pferdes, näherte sich aber nicht den höheren Sympathien eines Hundes. Aber man kann nicht sagen, dass er jemals jemanden so sehr geliebt hat, dass er sich selbst einen Moment lang der Befriedigung für diesen geliebten Menschen versagt hätte. Sein Herz war aus Stein. Aber es war schön, ihn anzusehen, er war schlagfertig und intelligent. Er war sehr dunkelhäutig, mit diesem weichen olivfarbenen Teint, der jungen Männern im Allgemeinen ein aristokratisches Aussehen verleiht. Sein Haar, das nie lang werden durfte, war fast schwarz und weich und seidig, ohne den Fettfilm, der bei seidenhaarigen Lieblingen so häufig ist. Seine Augen waren lang, von brauner Farbe und wurden durch den perfekten Bogen der perfekten Augenbraue verschönert. Aber vielleicht lag der Glanz des Gesichts mehr in der vollendeten Form und der feinen Symmetrie von Nase und Mund als in seinen anderen Gesichtszügen. Auf seiner kurzen Oberlippe trug er einen Schnurrbart, der ebenso geformt war wie seine Augenbrauen, aber er trug keinen anderen Bart. Auch die Form seines Kinns war perfekt, aber es fehlte ihm die Süße und Weichheit des Ausdrucks, die auf ein weiches Herz hindeutet, was ein Grübchen vermittelt. Er war etwa fünf Fuß neun groß und hatte eine ebenso hervorragende Figur wie ein ebenso hervorragendes Gesicht. Männer gaben zu und Frauen behaupteten lautstark, dass kein Mann jemals schöner gewesen sei als Felix Carbury, und es wurde auch zugegeben, dass er sich seiner Schönheit nie bewusst war. Er hatte sich in vielerlei Hinsicht wichtig getan – in Bezug auf sein Geld, armer Narr, solange es reichte; in Bezug auf seinen Titel; in Bezug auf seine Stellung in der Armee, bis er sie verlor; und vor allem in Bezug auf seine Überlegenheit in Bezug auf seinen modischen Intellekt. Aber er war klug genug gewesen, sich immer schlicht zu kleiden und den Anschein zu vermeiden, über sein Äußeres nachzudenken. Bis dahin hatte die kleine Welt seiner Gefährten kaum herausgefunden, wie gefühllos seine Zuneigung war – oder vielmehr, wie frei er von Zuneigung war. Seine Allüren und sein Auftreten, gepaart mit einer gewissen Klugheit, hatten ihn selbst durch die Schlechtigkeit seines Lebens getragen. In einer Angelegenheit hatte er seinen Namen getrübt und durch einen Moment der Schwäche seinen Charakter bei seinen Freunden mehr verletzt als durch die Torheit von drei Jahren. Es hatte einen Streit zwischen ihm und einem Offizierskollegen gegeben, bei dem er der Aggressor gewesen war; und als der Moment kam, in dem das Herz eines Mannes männliches Verhalten hätte zeigen sollen, hatte er zuerst gedroht und dann die weiße Fahne gezeigt. Das war nun ein Jahr her, und er hatte das Böse teilweise überlebt; – aber einige Männer erinnerten sich noch daran, dass Felix Carbury eingeschüchtert worden war und gekauert hatte.
Es war nun seine Aufgabe, eine Erbin zu heiraten. Er war sich dessen wohl bewusst und bereit, sich seinem Schicksal zu stellen. Aber es fehlte ihm etwas in der Kunst, Liebe zu machen. Er war schön, hatte die Manieren eines Gentlemans, konnte gut reden, es fehlte ihm an Kühnheit nicht und er hatte kein Gefühl des Widerwillens, eine Leidenschaft zu erklären, die er nicht empfand. Aber er wusste so wenig über die Leidenschaft, dass er kaum ein junges Mädchen glauben machen konnte, dass er sie empfand. Wenn er über Liebe sprach, dachte er nicht nur, dass er Unsinn redete, sondern zeigte auch, dass er das dachte. Aufgrund dieses Fehlers hatte er bereits bei einer jungen Dame versagt, die angeblich über 40.000 Pfund verfügte und ihn ablehnte, weil sie, wie sie naiv sagte, wusste, dass es ihm „nicht wirklich wichtig war“. „Wie kann ich zeigen, dass ich mich mehr um dich kümmere, als indem ich dich zu meiner Frau machen möchte?“, hatte er gefragt. „Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber dir ist es sowieso egal“, sagte sie. Und so entging diese junge Dame der Falle. Nun gab es eine andere junge Dame, die dem Leser noch vorgestellt werden sollte, und um die sich Herr Felix mit unermüdlichem Eifer bemühte. Ihr Vermögen war nicht definiert, wie es die 40.000 Pfund ihrer Vorgängerin gewesen waren, aber es war bekannt, dass es sehr viel größer war. Es wurde in der Tat allgemein als unergründlich, bodenlos und endlos angesehen. Es wurde gesagt, dass in Bezug auf Geld für gewöhnliche Ausgaben, Geld für Häuser, Bedienstete, Pferde, Juwelen und dergleichen eine Summe für den Vater dieser jungen Dame der anderen gleichkam. Er hatte große Sorgen; – Sorgen, die so groß waren, dass die Zahlung von zehn- oder zwanzigtausend Pfund für jede Kleinigkeit für ihn dasselbe war – denn für Männer, die sich in ihren Verhältnissen wohlfühlen, spielt es kaum eine Rolle, ob sie sechs oder neun Pence für ihre Koteletts bezahlen. Ein solcher Mann kann jederzeit ruiniert sein; aber es bestand kein Zweifel, dass er jedem, der seine Tochter in der gegenwärtigen Zeit seines unverschämten Wohlstands heiratete, ein sehr großes Vermögen mitgeben konnte. Lady Carbury, die den Felsen kannte, an dem ihr Sohn einst zerschellt war, war sehr darauf bedacht, dass Herr Felix die Intimität, die er im Hause dieses Krösus von heute hergestellt hatte, sofort richtig nutzte.
Und nun muss noch etwas über Henrietta Carbury gesagt werden. Natürlich war sie unendlich weniger wichtig als ihr Bruder, der ein Baron war, das Oberhaupt dieses Zweigs der Carburys und der Liebling ihrer Mutter; und daher sollten ein paar Worte genügen. Sie war auch sehr schön, wie ihr Bruder; aber etwas weniger dunkel und mit weniger absolut regelmäßigen Gesichtszügen. Aber sie hatte in ihrem Gesichtsausdruck ein volles Maß jener Süße des Ausdrucks, die zu implizieren scheint, dass die Rücksicht auf sich selbst der Rücksicht auf andere untergeordnet ist. Diese Liebenswürdigkeit fehlte ihrem Bruder völlig. Und ihr Gesicht war ein wahrer Index ihres Charakters. Wieder, wer soll sagen, warum der Bruder und die Schwester so gegensätzlich geworden waren; ob sie so unterschiedlich gewesen wären, wenn beide als Kinder der Erziehung ihres Vaters und ihrer Mutter entzogen worden wären, oder ob die Tugenden des Mädchens ausschließlich auf den niedrigeren Platz zurückzuführen waren, den sie im Herzen ihrer Eltern eingenommen hatte? Sie war jedenfalls nicht durch einen Titel, durch den Zugriff auf Geld und durch die Versuchungen einer zu frühen Bekanntschaft mit der Welt verdorben worden. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade einmal einundzwanzig Jahre alt und hatte noch nicht viel von der Londoner Gesellschaft gesehen. Ihre Mutter besuchte keine Bälle, und in den letzten zwei Jahren war bei ihnen ein Sparzwang entstanden, der vielen Handschuhen und teuren Kleidern abträglich war. Herr Felix ging nicht mehr aus, aber Hetta Carbury verbrachte die meiste Zeit zu Hause bei ihrer Mutter in der Welbeck Straße. Gelegentlich sah die Welt sie, und wenn die Welt sie sah, erklärte die Welt, dass sie ein charmantes Mädchen sei. Damit hatte die Welt so weit recht.
Aber für Henrietta Carbury hatte die Romanze des Lebens bereits ernsthaft begonnen. Es gab einen weiteren Zweig der Carburys, den Hauptzweig, der nun von einem Roger Carbury aus Carbury Hall vertreten wurde. Roger Carbury war ein Gentleman, über den noch viel zu sagen sein wird, aber an dieser Stelle muss nur gesagt werden, dass er leidenschaftlich in seine Cousine Henrietta verliebt war. Er war jedoch fast vierzig Jahre alt, und es gab einen gewissen Paul Montague, den Henrietta gesehen hatte.
Kapitel III Der Bärengarten
Lady Carburys Haus in der Welbeck Straße war ein bescheidenes Haus – es hatte nicht den Anspruch, ein Herrenhaus zu sein, und es war kaum als Wohnsitz geeignet; aber da sie etwas Geld zur Verfügung hatte, als sie es bezog, hatte sie es hübsch und angenehm gestaltet, und sie war immer noch stolz darauf, dass sie trotz ihrer schwierigen Lage ein gemütliches Zuhause hatte, wenn ihre literarischen Freunde sie an ihren Dienstagabenden besuchten. Hier lebte sie nun mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Der hintere Salon war durch Türen, die ständig geschlossen waren, vom vorderen abgetrennt, und hier setzte sie ihr großes Werk fort. Hier schrieb sie ihre Bücher und ersann ihr System, um Verleger und Kritiker zu umgarnen. Hier wurde sie selten von ihrer Tochter gestört und ließ keine Besucher außer Verlegern und Kritikern herein. Aber ihr Sohn unterlag keinen Haushaltsregeln und brach ohne Gewissensbisse in ihre Privatsphäre ein. Sie hatte kaum zwei hastige Notizen nach dem Schreiben ihres Briefes an Herrn Ferdinand Alf beendet, als Felix mit einer Zigarre im Mund den Raum betrat und sich auf das Sofa warf.
„Mein lieber Junge“, sagte sie, „bitte lass deinen Tabak unten, wenn du hier reinkommst.“
„Was für eine Affektiertheit, Mutter“, sagte er und warf die halb gerauchte Zigarre jedoch in den Kamin. „Manche Frauen schwören, dass sie Rauch mögen, andere sagen, dass sie ihn wie der Teufel hassen. Es hängt ganz davon ab, ob sie einem Mann schmeicheln oder ihn brüskieren wollen.“
„Du glaubst doch nicht, dass ich dich brüskieren will?“
„Ich weiß es beim besten Willen nicht. Ich frage mich, ob du mir zwanzig Pfund geben kannst?“
„Mein lieber Felix!“
„Genau so, Mutter; – aber was ist mit den zwanzig Pfund?“
„Wofür brauchst du das, Felix?“
„Nun, um ehrlich zu sein, um das Spiel für eine Weile weiterzuspielen, bis sich etwas geklärt hat. Ein Mann kann nicht ohne etwas Geld in der Tasche leben. Ich komme mit so wenig aus wie die meisten anderen. Ich bezahle nichts, wenn ich es vermeiden kann. Ich lasse mir sogar die Haare auf Kredit schneiden, und solange es möglich war, hatte ich eine Kutsche, um Taxifahrten zu sparen.“
„Was soll das alles, Felix?“
„Ich konnte noch nie das Ende von irgendetwas sehen, Mutter. Ich konnte noch nie ein Pferd pflegen, wenn die Hunde gut liefen, um beim Zieleinlauf dabei zu sein. Ich konnte noch nie ein Gericht, das mir schmeckte, zugunsten der folgenden auslassen. Was nützt das schon?“ Der junge Mann sagte nicht „carpe diem“, aber das war die Philosophie, die er predigen wollte.
„Warst du heute bei den Melmottes?“ Es war jetzt fünf Uhr an einem Winternachmittag, die Stunde, zu der Damen Tee trinken und müßige Männer in den Clubs Whist spielen, zu der junge müßige Männer manchmal flirten dürfen und zu der, wie Lady Carbury dachte, ihr Sohn Marie Melmotte, der großen Erbin, den Hof machen könnte.
„Ich komme gerade von dort.“
„Und was hältst du von ihr?“
„Um ehrlich zu sein, Mutter, habe ich sehr wenig über sie nachgedacht. Sie ist nicht hübsch, sie ist nicht hässlich; sie ist nicht klug, sie ist nicht dumm; sie ist weder Heilige noch Sünderin.“
„Eher eine gute Ehefrau.“
„Vielleicht. Ich bin jedenfalls durchaus bereit zu glauben, dass sie als Ehefrau “gut genug für mich„ wäre.“
„Was sagt die Mutter dazu?“
„Die Mutter ist vorsichtig. Ich kann nicht umhin, darüber zu spekulieren, ob ich jemals herausfinden werde, woher die Mutter kommt, wenn ich die Tochter heirate. Dolly Longestaffe sagt, dass jemand gesagt hat, sie sei eine böhmische Jüdin gewesen; aber ich denke, dafür ist sie zu dick.“
„Was macht das schon, Felix?“
„Überhaupt nicht.“
„Ist sie höflich zu dir?“
„Ja, höflich genug.“
„Und der Vater?“
„Nun, er weist mich nicht ab oder so etwas in der Art. Natürlich gibt es ein halbes Dutzend andere, die hinter ihr her sind, und ich glaube, der alte Mann ist von all dem verwirrt. Er denkt mehr daran, Herzöge zum Essen einzuladen, als an die Liebhaber seiner Tochter. Jeder, der ihr gefällt, könnte sie abholen.“
„Und warum nicht du?“
„Warum nicht, Mutter? Ich gebe mein Bestes, und man soll kein gesundes Pferd schlagen. Kannst du mir das Geld geben?“
„Oh Felix, ich glaube, du weißt kaum, wie arm wir sind. Du hast immer noch deine Jäger unten am Ort!“
"Ich habe zwei Pferde, wenn du das meinst; und ich habe seit Beginn der Saison keinen Schilling für ihren Unterhalt bezahlt. Sieh mal, Mutter, ich gebe zu, dass das ein riskantes Spiel ist, aber ich spiele es auf deinen Rat hin. Wenn ich Fräulein Melmotte heiraten kann, wird wohl alles gut. Aber ich glaube nicht, dass der Weg, sie zu bekommen, darin besteht, alles hinzuwerfen und die ganze Welt wissen zu lassen, dass ich keinen Pfennig habe. Um so etwas zu tun, muss ein Mann ein wenig über dem Durchschnitt leben. Ich habe meine Jagd auf ein Minimum reduziert, aber wenn ich sie ganz aufgeben würde, gäbe es viele Leute am Grosvenor Platz, denen ich sagen könnte, warum ich das getan habe.
In diesem Argument lag eine offensichtliche Wahrheit, auf die die arme Frau keine Antwort wusste. Bevor das Interview zu Ende war, wurde das geforderte Geld bereitgestellt, obwohl es zu diesem Zeitpunkt nur schwer aufzubringen war, und der junge Mann ging scheinbar mit leichtem Herzen davon, ohne auf die Bitten seiner Mutter zu hören, die Angelegenheit mit Marie Melmotte möglichst schnell zu einem Abschluss zu bringen.
Als Felix seine Mutter verließ, ging er in den einzigen Club, dem er jetzt angehörte. Clubs sind in jeder Hinsicht angenehme Orte, aber in einer Hinsicht nicht. Sie verlangen sofortiges Geld oder noch schlimmer, jährliche Zahlungen – Geld im Voraus; und der junge Baron war absolut gezwungen, sich einzuschränken. Wie selbstverständlich wählte er aus den Clubs, zu denen er das Recht auf Zutritt besaß, den schlechtesten aus. Es hieß „Bärengarten“ und war kürzlich mit dem ausdrücklichen Ziel eröffnet worden, Sparsamkeit mit Verschwendung zu verbinden. Clubs wurden ruiniert, so sagten bestimmte junge, sparsame Verschwender, indem sie alten Knackern, die wenig oder nichts außer ihren Beiträgen zahlten und durch ihre bloße Anwesenheit dreimal so viel herausholten, als sie gaben, Komfort boten. Dieser Club sollte erst um drei Uhr nachmittags geöffnet werden, vor dieser Stunde hielten es die Förderer des Bärengarten für unwahrscheinlich, dass sie und ihre Mitstreiter einen Club wollten. Es sollte keine Morgenzeitungen geben, keine Bibliothek, keinen Frühstücksraum. Speisesäle, Billardzimmer und Kartenzimmer würden für den Bärengarten ausreichen. Alles sollte von einem Lieferanten bereitgestellt werden, damit der Club nur von einem Mann betrogen werden sollte. Alles sollte luxuriös sein, aber der Luxus sollte zum Selbstkostenpreis erreicht werden. Es war ein glücklicher Gedanke gewesen, und der Club sollte florieren. Herr Vossner, der Lieferant, war ein Juwel und führte die Geschäfte so, dass es keine Probleme gab. Er half sogar bei der Beilegung kleinerer Schwierigkeiten bei der Begleichung von Kartenkonten und verhielt sich gegenüber den Scheckausstellern, deren Banken ihnen unwirsch die „Nichtigkeit“ ihrer Schecks erklärt hatten, äußerst behutsam. Herr Vossner war ein Juwel, und der Bärengarten war ein Erfolg. Vielleicht genoss kein junger Mann in der Stadt den Bärengarten mehr als Herr Felix Carbury. Der Club befand sich in unmittelbarer Nähe anderer Clubs in einer kleinen Straße, die von der St. James's Straße abging, und zeichnete sich durch äußerliche Ruhe und Nüchternheit aus. Warum für Steinmetzarbeiten bezahlen, die andere Leute nur anschauen können? Warum Geld für Marmorsäulen und Gesimse ausgeben, wenn man solche Dinge weder essen noch trinken noch damit spielen kann? Aber der Bärengarten hatte die besten Weine – oder dachte, dass er sie hatte – und die bequemsten Stühle und zwei Billardtische, die perfekter nicht auf Beinen stehen konnten. Hierhin begab sich Sir Felix an jenem Januarnachmittag, sobald er den Scheck seiner Mutter über 20 Pfund in der Tasche hatte.
Er fand seine besondere Freundin Dolly Longestaffe auf der Treppe vor, mit einer Zigarre im Mundwinkel und mit leerem Blick auf das gegenüberliegende, trübe Backsteinhaus. „Wirst du hier zu Abend essen, Dolly?“, fragte Sir Felix.
„Ich nehme an, ja, weil es so viel Mühe macht, woanders hinzugehen. Ich bin zwar irgendwo verabredet, aber ich habe keine Lust, nach Hause zu gehen und mich umzuziehen. Bei Gott! Ich weiß nicht, wie andere Männer das machen. Ich kann es jedenfalls nicht.“
„Gehst du morgen auf die Jagd?“
„Nun ja, schon, aber ich glaube nicht, dass ich das tun werde. Letzte Woche wollte ich jeden Tag auf die Jagd gehen, aber mein Kumpel hat mich nie rechtzeitig geweckt. Ich weiß nicht, warum die Dinge immer so verdammt kompliziert gemacht werden. Warum sollten die Jungs nicht um zwei oder drei Uhr morgens mit der Jagd beginnen, damit man nicht mitten in der Nacht aufstehen muss?“
„Weil man bei Mondlicht nicht reiten kann, Dolly.“
„Um drei Uhr ist es nicht hell. Jedenfalls schaffe ich es nicht, bis neun Uhr am Euston Platz zu sein. Ich glaube nicht, dass mein Kumpel gerne aufsteht. Er sagt, er kommt herein und weckt mich, aber ich erinnere mich nie daran.“
„Wie viele Pferde hast du in Leighton, Dolly?“
„Wie viele? Es waren fünf, aber ich glaube, der Mann da unten hat eines verkauft; aber dann glaube ich, hat er ein anderes gekauft. Ich weiß, dass er etwas getan hat.“
„Wer reitet sie?“
„Ich nehme an, er. Das heißt, ich reite sie natürlich selbst, aber ich steige nur so selten ab. Jemand hat mir erzählt, dass Grasslough letzte Woche zwei von ihnen geritten hat. Ich glaube nicht, dass ich ihm jemals gesagt habe, dass er das könnte. Ich glaube, er hat meinem Burschen einen Tipp gegeben; und das nenne ich eine niederträchtige Art, so etwas zu tun. Ich würde ihn fragen, aber ich weiß, dass er sagen würde, dass ich sie ihm geliehen hätte. Vielleicht habe ich das, als ich betrunken war, weißt du.“
„Du und Grasslough wart nie Freunde.“
„Ich kann ihn nicht ausstehen. Er spielt sich auf, weil er ein Lord ist, und ist teuflisch schlecht gelaunt. Ich weiß nicht, warum er auf meinen Pferden reiten will.“
„Um seine eigenen zu retten.“
„Er ist nicht in Not. Warum hat er keine eigenen Pferde? Ich sage dir was, Carbury, ich habe mich zu einer Sache entschlossen, und, bei Gott, ich werde dabei bleiben. Ich werde nie wieder jemandem ein Pferd leihen. Wenn die Leute Pferde wollen, sollen sie sie kaufen.“
„Aber einige Kerle haben kein Geld, Dolly.“
„Dann sollten sie sich verpissen. Ich glaube nicht, dass ich für eines meiner Pferde bezahlt habe, die ich in dieser Saison gekauft habe. Gestern war jemand hier – “
„Was! Hier im Club?“
„Ja; er ist mir hierher gefolgt, um zu sagen, dass er für etwas bezahlt werden wollte! Es ging um Pferde, ich glaube wegen der Hose des Kerls.“
„Was hast du gesagt?“
„Ich! Oh, ich habe nichts gesagt.“
„Und wie ging es aus?“
„Nachdem er fertig geredet hatte, bot ich ihm eine Zigarre an und während er abbiss, ging ich nach oben. Ich nehme an, er ging weg, als er des Wartens müde war.“
„Ich sag dir was, Dolly; ich wünschte, du würdest mich ein paar Tage auf zwei deiner Pferde reiten lassen – natürlich nur, wenn du sie nicht selbst brauchst. Du bist jedenfalls nicht mehr so geizig.“
„Nein, ich bin nicht knapp bei Kasse“, sagte Dolly mit melancholischer Zustimmung.
„Ich meine, dass ich mir deine Pferde nicht ausleihen möchte, ohne dass du dich daran erinnerst. Niemand weiß so gut wie du, wie schrecklich fertig ich bin. Ich werde es endlich überstehen, aber in der Zwischenzeit ist es eine schreckliche Belastung. Es gibt niemanden, den ich um einen solchen Gefallen bitten würde, außer dir.“
„Nun, du kannst sie haben – für zwei Tage. Ich weiß nicht, ob mein Mann dir glauben wird. Er würde Grasslough nicht glauben und hat es ihm auch gesagt. Aber Grasslough hat sie aus dem Stall geholt. Das hat mir jemand erzählt.“
„Du könntest deinem Stallburschen eine Nachricht schreiben.“