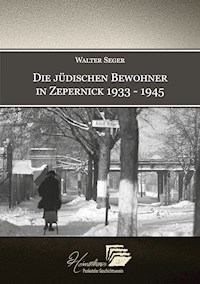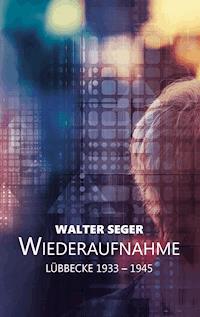
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Warum gibt es in der kleinen Stadt Lübbecke in Westfalen eine Karl-Haddewig-Straße, aber keine Von-Borries-Straße und keine Ernst-Meiring-Straße? Was sagt uns eine Reihe von ehemaligen Fabrikgebäuden und Fabrikantenvillen im Stadtbild? Was geschah mit den einst florierenden Kleiderfabriken Nathan Ruben K. G. und A. Hecht K. G. mit ihren über 200 Mitarbeitern? Wer gehörte der einst vitalen jüdisch gläubigen Gemeinde in Lübbecke an und was widerfuhr den einzelnen Menschen? Dieses Buch möchte erinnern an die Entrechtung, Verfolgung, Vertreibung und Verschleppung Andersdenkender, Andersgläubiger und der Menschen, die im Altkreis Lübbecke den Mut hatten, 1933 - 1945 gegen den Strom zu schwimmen. Anhand von Quellen wird nachgezeichnet, wie der rücksichtslos agierende ehemalige Kreisleiter der NSDAP und der seine preußischen Tugenden in den Vordergrund stellende ehemalige Landrat im Kreis Lübbecke die nationalsozialistischen Vorhaben mit großem Engagement und unnachgiebig in die Tat umsetzten. Auch wird die Frage beantwortet, wo sich der ehemalige Kreisleiter der NSDAP von März 1945 bis Anfang 1950 versteckt hielt. Nur wenigen Menschen sind die in diesem Buch geschilderten Sachverhalte bekannt. Der Verfasser möchte dazu beitragen, dass Vergangenes nicht vergessen wird - auch indem er Parallelen zu aktuellen Ereignissen aufzeigt und analysiert. Die oft unzulängliche juristische Aufarbeitung des Unrechts und die zur Farce geratenen Entnazifizierungsverfahren im Nachkriegsdeutschland sind ein weiteres umfassendes Thema dieses Buches. Schlussstrich! Vergessen! Nicht wieder aufrühren! Doch ist das eine Lösung? Nur lebendige Erinnerung schützt vor Wiederholung!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Karl Haddewig
Anzeige gegen Haddewig
Die Ermittlungen beginnen
Immerwährende Suche nach einem Arbeitsplatz
Anzeige der NSDAP-Kreisleitung gegen Haddewig
Verhaftung
Exkurs
Kurt von Borries
Fragwürdige Amtsführung des Landrats von Borries vor 1933
Beeinflussung von Abstimmungsergebnissen
Empfehlung eines Volkskalenders mit integriertem staatsfeindlichem Jahresbericht
Die Amtsführung des Landrats von Borries nach 1933
Die dem Landrat unterstellten Landjäger in Lübbecke – eine sonderbare Truppe
Landgerichtliche Voruntersuchung wegen der Amtsführung des Landrats von Borries 1933 – 1945
Zigarrendiebstahl in Hüllhorst
Ansehen von Meiring angeblich in der Öffentlichkeit erheblich herabgesetzt
Widerstand gegen den Terror gegenüber der jüdisch gläubigen Bevölkerung
Ein falsches Wort
Vergewaltigung
Nötigung des Rechtsanwaltes
M[…]
zur Niederlegung eines Mandates
Weiteres Ausstellen von Schutzhaftbefehlen durch den ehemaligen Landrat von Borries
Beschluss der II. Strafkammer des Landgerichts Bielefeld
Entnazifizierung
Allgemeines
Entnazifizierung von Borries
Überprüfungsbegehren des Innenministers von Nordrhein-Westfalen wegen der Einstufung im Entnazifizierungsverfahren des ehemaligen Landrats von Borries
Lübbecker Lagerhaus
Minna
O[…]
Wiederaufnahme des Entnazifizierungsverfahrens scheitert
Ernst Meiring
Die Anfänge der NSDAP im Kreis Lübbecke
Der Zufall begünstigt Meiring
Exkurs
Meiring wird hauptamtlicher Kreisleiter und gibt das Amt des Bürgermeisters auf
Meiring nach 1940
Meiring taucht unter
Meiring nach 1950
Strafverfahren gegen Meiring 1950 Teil I
Der Fall Schl
[…]
aus Isenstedt
Der Fall Pfarrer Ha
[…]
aus Börninghausen
Der Fall Wilhelm Wi
[…]
aus Pr. Oldendorf
Der Fall des Kaufmanns W
[…]
aus Lübbecke
Strafverfahren gegen Meiring 1950 Teil II
Menschen jüdischen Glaubens in Lübbecke und Praktiken des Regimes Teil I
Das Lübbecker Kreisblatt
Prophezeiungen und Drohungen gegen die jüdisch gläubige Bevölkerung
Menschen jüdischen Glaubens in Lübbecke und Praktiken des Regimes Teil II
Erzwungener Verkauf des Manufakturwarengeschäftes M.B. Weinberg, Lübbecke, Lange Straße 42
Erzwungener Verkauf der Firma Kleiderfabrik Nathan Ruben K. G., Lübbecke, Ostertorstraße 6
Erzwungener Verkauf der Firma A. Hecht K. G. Kleiderfabrik und Webwarengroßhandlung, Lübbecke, Ostertorstraße 5 und 7
Sperrkonten
Lebensläufe Lübbecker mit jüdischem Glauben ab 1933
Bloch, Leopold
Bloch, Eva Emma
Bloch, Helmut
Friedländer, Else
Grüneberg, Regine
Hecht, Salomon
Hecht, Clara
Hecht, Käthe
Hecht, Lotte
Hecht, Hermann
Hecht, Hedwig
Hecht, Annemarie
Hecht, Anna Elisabeth
Hecht, Max
Hurwitz, Feodor
Hurwitz, Bertha Ottilie
Hurwitz, Ernst
Hurwitz, Johanna
Hurwitz, Frieda
Hurwitz, Friedrich (Fritz)
Hurwitz, Ilse
Hurwitz, Margarete
Hurwitz, Sophie
Lazarus, Moritz (Moies)
Lazarus, Philippine
Lazarus, Johanna
Lazarus, Joseph W.
Lazarus, Max
Lazarus, Julie
Lazarus, Franziska
Lazarus, Ilse
Lazarus, Lothar, Dr
Levy, Hermann
Levy, Johanne
Levy, Kurt, Dr.
Löwenstein, Alfred
Löwenstein, Fanny
Löwenstein, Trude (Gertrud)
Löwenstein, Anni
Mansbach, Rosalie
Mergentheim, Martha
Neustädter, Bernhardt
Neustädter, Margarethe
Neustädter, Ernst, Dr.
Rose, Sophie
Rosenberg, Max
Rosenberg, Margarete
Rosenberg, Trude (Gertrud)
Ruben, Albert Joseph
Ruben, Dr. Hildegard (Hilde)
Ruben, Marianne
Ruben, Thomas
Schöndelen, Martha
Schöndelen, Thekla
Schöndelen, Thekla Gertrud
Schöneberg, Max
Schöneberg, Paul
Schöneberg, Meta
Speier, Grete
Steinberg, Feodor
Steinberg, Else
Weinberg, Hilde
Weinberg, Lore
Wolf, Adolf
Wolf, Anna
Wolf, Margarete
Lebensläufe der verantwortlichen Nationalsozialisten
Ehemalige Kreisleiter der NSDAP im Kreis Lübbecke 1932 – 1945
Watermann, Fritz
Meiring, Ernst
Klöpper, Gustav
Böhnert, Gotthilf
Gembris, Berthold
Ehemalige Landräte im Kreis Lübbecke 1918 – 1945
von Borries, Kurt
Hüter, Friedrich
Abkürzungen
Geschlechterbezeichnung
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Vorwort
Angeregt von Erzählungen meiner Eltern, älteren Arbeitskollegen und Verwandten aus der Zeit der Hitlerdiktatur, fand ich nach dem Ende meiner aktiven Berufstätigkeit die Zeit, diesen Erzählungen auf den Grund zu gehen, die einzelnen Puzzlestücke zusammenzutragen und wieder zusammenzusetzen.
Aufgewachsen in Lübbecke habe ich viele Jahre auch dort gelebt. Als junger Mensch erlebte ich einige Zeitzeugen, die mir aus eigenem Erleben erzählten, wie sie die Zeit der Diktatur durchlebt haben.
Die Recherchen in zahlreichen Archiven dauerten mehrere Jahre. Entdeckte ich nur eine Spur zu einem Detail der Erzählungen, ergaben sich oftmals weitere Spuren, deren konsequente Verfolgung nicht immer einfach war. Ich suchte und fand Belege für vieles, das nur als Gerücht zu existieren schien.
Zunächst hatte ich die vorliegende Arbeit als Vermächtnis nur für meine Kinder geplant. Doch im Laufe des Schreibens entstand der Gedanke, dass die Ergebnisse der Recherche möglicherweise ein größeres Publikum interessieren könnten.
Dank
Zu danken habe ich postum meinen Eltern (Jahrgänge 1908 und 1909), die mein Interesse an den Geschehnissen in Lübbecke während der Hitlerdiktatur geweckt und durch ihre ausführlichen, lebendigen Schilderungen den Grundstein für meine Untersuchung gelegt hatten.
Ein für mich wichtiger Zeitzeuge war der bereits verstorbene ehemalige Arbeitskollege Wilhelm Pohlmann (Jahrgang 1928). Er hat mich auf wesentliche Lübbecker Details aus der Zeit 1933 – 1945 aufmerksam gemacht und dazu beigetragen, mein Bewusstsein zu erweitern und zu schärfen.
Nicht zuletzt danke ich meiner lieben Frau Carmen, die unendliche Geduld aufbrachte, wenn ich in Archiven „abtauchte“ und darüber hinaus zeitweilig auch geistig abwesend war.
Einleitung
Angesichts der derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland, die oftmals geprägt sind von der unbegründeten Angst vor Fremden und Fremdem, empfand der Verfasser das Bedürfnis, einen bestimmten Zeitabschnitt in der Vergangenheit anzuschauen. Die Epoche 1933 – 1945 und die in dieser Zeit provozierten Verfolgungen brachten vielen Menschen mit jüdischem Glauben in Lübbecke den Tod. Andere, wenn sie fliehen mussten, um ihr Leben zu retten, erlebten eine erzwungene einschneidende Wende in ihrem Leben.
Der Verfasser möchte mit der vorliegenden Arbeit daran erinnern, dass es unter der Diktatur des Nationalsozialismus sowohl im Kreis Minden-Lübbecke als auch in der Stadt Lübbecke Menschen wie Karl Haddewig gab, die ihrer Überzeugung nach 1933 treu geblieben sind und dafür mit dem Tod bezahlen mussten. Nicht allein bei der Verfolgung Haddewigs trat der bereits in der Weimarer Republik von den Nationalsozialisten geschürte Hass gegen die Gewerkschaften, die Sozialdemokratische Partei und die Kommunistische Partei offen hervor.
Es gab in Lübbecke vor dem Holocaust eine überaus vitale jüdische Gemeinde, die über Jahrhunderte ein fester Bestandteil des städtischen Lebens gewesen war und eine maßgebende Bereicherung der regionalen Kultur darstellte. Die meist hervorragend gebildeten Bürgerinnen und Bürger mit jüdischem Glauben1 waren in Politik, im Gewerbe und in der medizinischen Versorgung des Kreises Lübbecke integriert. Die Firmen A. Hecht K. G. und Nathan Ruben K. G. beispielsweise beschäftigten eine Vielzahl von Arbeitnehmern vieler unterschiedlicher Glaubensrichtungen und waren bereits in den 1920er und 1930er Jahren in Lübbecke führend in Bezug auf Sozialleistungen. Zahlreiche weitere Gewerbebetriebe und Geschäfte wurden von Inhabern jüdischen Glaubens geleitet. Sie sollten ab 1933 Unvergleichliches erleiden und unsagbares Unrecht hinzunehmen haben.
Der Verfasser hat den Menschen jüdischen Glaubens, die einst in Lübbecke lebten, nachgespürt und ihren Lebensund Leidensweg, soweit dies möglich war, nachgezeichnet. Stellvertretend für die von den Nationalsozialisten erzwungenen Verkäufe von Firmen, deren Inhaber jüdischen Glaubens waren, wurden die Zwangsverkäufe der Firmen M. B. Weinberg, A. Hecht K. G. und Nathan Ruben K. G. aufgearbeitet.
Auch die Bibelforscherbewegung in Lübbecke wurde von den Nationalsozialisten konsequent verfolgt, weil deren Anhänger beispielsweise den Hitlergruß und den Kriegsdienst verweigerten und ihren Mitbürgern jüdischen Glaubens aus christlicher Nächstenliebe halfen. Neben „Juden, Sinti und Roma, Sozialisten, Kommunisten und Homosexuellen“ wurden sie unter der Bezeichnung „Bibelforscher“ als eigene „Kategorie“ der Verfolgten und Häftlinge behandelt.2 In Lübbecke wurde unter anderen Heinrich Grabenkamp verfolgt, weil er sich zu den „Ernsten Bibelforschern“ bekannte. Das von ihm gegründete „Lübbecker Lagerhaus“ mußte er zwangsweise weit unter Wert an einen Parteigenossen der NSDAP übereignen. Diese Geschichte hat der Verfasser anhand von Belegen aus dem Privatbesitz der Nachkommen Grabenkamps und umfangreichen Dokumenten in nordrhein-westfälischen Archiven nachgezeichnet.
Wenn keine rechtsstaatlichen Schranken errichtet und respektiert werden, regieren Willkür und Gewalt vor allem gegen Minderheiten und Oppositionelle. So arbeitete der Kreisleiter der NSDAP des Kreises Lübbecke und Bürgermeister von Lübbecke Ernst Meiring mit dem damaligen Landrat für den Kreis Lübbecke Kurt von Borries zusammen. Sie spielten beide eine führende Rolle bei der Verfolgung von Minderheiten und Andersdenkenden. Sie ergänzten sich regelrecht, wenn es darum ging, Willkür anzuwenden oder aus einem Verdacht eine Beschuldigung zu machen, die vielfache Folgen bis hin zur Einweisung in ein Konzentrationslager haben konnte − in den meisten Fällen ohne Gerichtsverfahren. Von Borries konnte von 1933 bis weit in das Jahr 1934 aus eigenem Antrieb und kraft seines Amtes Einweisungen in ein Konzentrationslager veranlassen.
In jeder Gesellschaft finden sich Menschen ohne nennenswerte Empathie, die sofort bereit sind, andere Menschen seelisch und körperlich zu unterdrücken, wenn man ihnen in Aussicht stellt, ihre eigenen Vergehen strafrechtlich nicht zu verfolgen. Es gab in den Jahren nach 1945 den Versuch, die nationalsozialistischen Verbrechen in rechtsstaatlichen Prozessen zu sühnen. In den Nürnberger Prozessen sind nur die Hauptkriegsverbrechen verhandelt und einige Angeklagte verurteilt worden. Allzu viele konnten in den Nachkriegswirren untertauchen, andere Namen annehmen oder bis nach Übersee fliehen und so für lange Zeit unbehelligt weiterleben. Für Meiring und von Borries gab es zwar ein gerichtliches Nachspiel, allerdings endete es damit, dass keiner der beiden ernstzunehmende rechtliche Konsequenzen zu tragen hatte. Kein Wunder: Die Gerichte waren durchweg mit Personal besetzt, das auch schon den Nationalsozialisten treu gedient hatte. Nur so ist es wohl zu erklären, dass die Urteile über Vergehen auf Kreisebene derartig milde ausfielen.
Mehrfach angestrengte Wiederaufnahmeverfahren wurden, trotz erdrückender Beweislast, nicht zugelassen. Sicherlich wurden solche Ablehnungen von der Prozessordnung gedeckt – trotzdem war es aus Sicht der Opfer eine weitere Erniedrigung und Demütigung.
Zudem ist auch an dieser Stelle ein Versagen der westlichen Alliierten festzustellen. Sie überließen beispielsweise die Entnazifizierung weitestgehend den Deutschen selbst. Nur so kann erklärt werden, dass kaum ein Antragsteller aufrichtig Auskunft über seine Ämter und Tätigkeiten in der Zeit 1933 – 1945 gab und die überwiegende Mehrheit der belasteten und schwerstbelasteten Täter als „Mitläufer“ oder als „unbelastet“ eingestuft wurden.
1 Der Verfasser verwendet die Begriffe „Juden“ oder „jüdisch“ nicht. Sie sind nach seiner Ansicht in der Zeit des Nationalsozialismus zu sehr als Schimpfworte in diskriminierender Weise verwendet worden, um eine Minderheit zu stigmatisieren. In den nachfolgenden Kapiteln wird die Formulierung „jüdischen Glaubens“ verwendet, soweit es sich nicht um wörtliche Zitate handelt.
2 Vgl.Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Bibelforscherbewegung (abgerufen 18.07.2016)
Karl Haddewig
„Rot Front“ – diese Begrüßungsformel soll Karl Haddewig (42 J.) am Freitag, den 13. Oktober 1933 gegen 18:00 Uhr einigen Freunden zugerufen haben. Eine darauf erfolgte polizeiliche Anzeige einer Lübbecker Bürgerin löste eine jahrelange Verfolgung und Beobachtung seitens der örtlichen Parteiführung, der Ortspolizei, der Kreisverwaltung (Landrat), der „GESTAPO“ und der Staatsanwaltschaft Bielefeld aus.
„Rot Front“ war der Schlachtruf des Roten Frontkämpferbundes (RFB), der paramilitärischen Schutztruppe der KPD in der Weimarer Republik.
Haddewig stand zu dem Zeitpunkt in Lübbecke in der Langen Straße, Ecke Gerichtsstraße, genau vor dem Geschäft W[…]. Er begegnete vor dem Geschäft seinen Gesinnungsgenossen, dem Schlosser Heinrich N[…] (24 J), dessen Bruder, dem Bäcker Wilhelm N[…] (23 J), dem Arbeiter Heinrich Sch[…] (26 J), dem Bekleber Friedrich T[…] (23 J) und dem Arbeiter Alois K[…] (19 J).
Man führte eine allgemeine Unterhaltung in gemäßigter Lautstärke über alltägliche Dinge, flachste herum und machte Scherze über dies und jenes. Möglicherweise wurde auch regimekritisch geredet. Kritik am Regime wurde, nachdem die Nationalsozialisten ca. 10 Monate an den Schalthebeln der Macht saßen, mit äußerster Härte unterdrückt und bestraft. Haddewig und seine Freunde waren, da sie vor 1933 der SPD angehörten oder dieser gedanklich nahestanden, dem damaligen System und den Nationalsozialisten gegenüber ablehnend eingestellt. Die gleich nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 einsetzenden Hausdurchsuchungen bei SPD-Mitgliedern und -Sympathisanten mit Verhören bei der örtlichen Polizeibehörde und in den Räumen der SA, hatten die SPD-Szene bereits völlig verunsichert.
Haddewigs ablehnende Haltung der NSDAP und dem seit 1933 gültigen Staatswesen gegenüber geht aus der Schilderung seines Lebens3 hervor. Demnach waren er und seine Ehefrau Anna vor 1933 Mitglieder der SPD. Haddewig war Hauptkassierer auf Stadtebene in dieser Partei. Bereits am 29. April 1933 kündigte ihm sein bisheriger Arbeitgeber und er wurde zur Kreisleitung der NSDAP bestellt. Der damalige Kreisleiter der NSDAP, Meiring, verlangte von ihm, die Namen der in der SPD tätigen Genossen anzugeben. Als Haddewig sich weigerte die Namen zu verraten, wurde er von Meiring in den folgenden Jahren systematisch verfolgt. 1935 musste er deswegen auf Betreiben von Meiring die Lübbecker Turnerschaft verlassen, im selben Jahr löste ein weiterer Arbeitgeber, Pflastermeister Meier, das Arbeitsverhältnis mit ihm, danach wurde Haddewig auch das nächste Arbeitsverhältnis bei dem Bauunternehmer Bünemann gekündigt. Nach Aussage von Haddewigs Ehefrau soll dies alles Kreisleiter Meiring betrieben haben. Die heimischen Bauunternehmer waren in hohem Maße von Meiring abhängig, da er als Kreisleiter der NSDAP und Bürgermeister eine Fülle von Bauvorhaben (Wasserleitung, Straßen, „Führerschule“ an der Schützenstraße, Schule an der Bohlenstraße usw.) vorantrieb und die Bauunternehmer bei der Auftragsvergabe berücksichtigt werden wollten. Da erscheint es nicht abwegig, dass Kreisleiter Meiring bestimmte Hinweise hinsichtlich politischer Unzuverlässigkeit gegeben hat, was dann mehrfach eine Entlassung von Haddewig aus einem Arbeitsverhältnis nach sich zog.
Nach dem Berliner Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 wurde die SA im gesamten Reich als Hilfspolizei eingesetzt. Die SA nahm diesen Auftrag freudig an und bekam auf diese Weise zunächst „freie Hand“ im Umgang mit den Andersdenkenden, weil nach Meinung der neuen Machthaber grundsätzlich einmal gezeigt werden musste, wer „Herr im Hause“ war. Es kam in der Folge in ganz Deutschland zu Übergriffen der SA gegenüber SPD-Mitgliedern, anderen politischen Gegnern und Menschen mit jüdischem Glauben. Als Grundlage hierfür musste die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933“ dienen.4
Karl und Anna Haddewig (ca. 1936)5
Beispielhaft sei hier die „Köpenicker Blutwoche“ im Juni 1933 genannt.6 Am 22. Juni 1933 wurde im ganzen Reich die SPD verboten. Führende Mitglieder der SPD flüchteten in den Untergrund, zunächst nach Prag und dann weiter nach Paris. In Paris wurden die „Deutschland-Berichte der Sopade“ (Exilorganisation der SPD) von tausenden im deutschen Untergrund wirkenden Genossen gesammelt, zusammengestellt und publiziert.
Aber wieder zurück zum Geschehen. Die Freunde hatten in ihrer spontanen Euphorie vergessen, dass bereits seit der Machtverschiebung7 eine gegenteilige Meinung oder Gesinnung gefährlich werden konnte. Gerade in den ersten Monaten nach dem 30. Januar 1933 war das Denunziantentum besonders verbreitet.
Die in dem Geschäft W[…] arbeitende Ehefrau des Ladeninhabers, K[…]W[…], hatte durch das geöffnete Oberlicht des Schaufensters angeblich die Begrüßungsformel „Rot Front“ aus dem Munde von Haddewig gehört.
K[…] W[…] will sich über das vermeintlich Gehörte sehr erregt haben. Gerade in den Anfängen des sog. „Dritten Reiches“ wollten viele überzeugte Nationalsozialisten „reinen Tisch machen“. Also identifizierten und denunzierten sie viele Andersdenkende. Jedenfalls hatte K[…] W[…] angeblich hinter ihrem Schaufenster den Schlachtruf der verhassten Kommunisten gehört.
Anzeige gegen Haddewig
Nach einigen Tagen der Recherche hatte K[…] W[…] die Namen der gesamten Gruppe ermittelt, wobei sie Haddewig noch aus der gemeinsamen Schulzeit kannte. Mit diesen Informationen begab sie sich zum zuständigen Polizeiposten und erstattete am 25. Oktober 1933 folgende Anzeige:
„[…] Anzeige des Landjägermeisters V[…] in Lübbecke gegen den Arbeiter Karl Haddewig, geb. am 28.3.1891, wohnhaft in Lübbecke, Kapitelstraße 7.
Am 13.ds.Mts. gegen 18 Uhr hatten sich vor dem Hause des Kaufmanns W[…], Langestrasse folgende Personen aufgestellt:
Heinrich N[…], wohnhaft Lübbecke,
Wilh. N[…], wohnhaft Lübbecke,
Hch. Sch[…], wohnhaft Lübbecke,
Friedrich T[…], wohnhaft Lübbecke,
Alois K[…], wohnhaft Lübbecke.
Zur selben Zeit kam der Arbeiter Karl Haddewig in Begleitung noch eines Herrn dortselbst vorbei und soll den vorgenannten Personen ‚Rot-Front‘ zugerufen haben. Die Ehefrau K[…] W[…], welche diesen Zuruf deutlich gehört haben will, hat sich über diesen Vorfall sehr aufgeregt und erstattete hierüber Anzeige.
Von den unter 1-5 genannten Personen ist anzunehmen, dass sie der SPD. und KPD. angehört haben und zum Teil noch angehören.
Bei meiner Abhörung gaben dieselben an, dass Haddewig mit ‚Guten Abend‘ gegrüsst haben soll. […]“8
Bürgermeister Meiring, Ortspolizeibehörde und ehrenamtlicher Kreisleiter der NSDAP in Personalunion, übernahm den in der Anzeige des Landjägermeisters V[…] vom 13. Oktober 1933 geäußerten Verdacht auf Zugehörigkeit zur SPD und zur KPD und gab am 31. Oktober 1933 unter der Tgb.-Nr. 2222/II die Anweisung:
„[…] Die Zeugen und der Beschuldigte sind zu laden und zur Sache zu vernehmen.
Wv. zum Termin […]“
9
Es war weit vor dem Wechsel Deutschlands in die Diktatur erklärtes Ziel der Nationalsozialisten, die Mitglieder der SPD und der KPD aufzuspüren und zu vernichten. Über die nationalsozialistische Verfolgung gibt es eine Vielzahl von zeitgenössischen Zeugnissen. Beispielhaft seien hier die Deutschland-Berichte der Sopade genannt.10
Am 09. und 10. November 1933 wurden die Zeugen und der Beschuldigte zur polizeilichen Vernehmung einbestellt. Der Verwaltungs-Sekretär V[…] und der Verwaltungsgehilfe L[…] waren die vernehmenden Beamten.
Die Zeugen Wilh. und Hch. N[…] und Hch. Sch[…] gaben übereinstimmend an, dass sie am fraglichen Abend vor dem Hause W[…] standen und Haddewig vorbeigegangen sei. Er habe mit „Guten Abend“ gegrüßt. Der Ausdruck „Rot Front“ sei nicht gefallen. Der Zeuge Friedr. T[…] gab an, er habe mit dem Rücken zum Geschehen gestanden und nichts gehört. Der Zeuge Alois K[…] sagte aus, dass er zu der Zeit im Nachbargeschäft etwas besorgt habe, deshalb könne er zu den Vorgängen auf der Straße nichts aussagen.11
Die zentrale Aussage der Zeugin W[…], die Haddewig schwer belastete, soll an dieser Stelle zitiert werden:
„[…] Auf Vorladung erscheint die Ehefrau K[…] W[…], […] Lübbecke […] und erklärt:
An dem in der Anzeige genannten Abend war ich im Schaufenster tätig. Die Oberlichter waren geöffnet. Ich konnte hören, was auf der Straße vor unserem Schaufenster gesprochen wurde. Es standen dort die Brüder N[…], die Arbeiter Sch[…], T[…] und K[…]. Ich habe gehört, dass Haddewig mit ‚Rot Front‘ grüsste. Einige der Anwesenden erwiderten diesen Gruss gleichfalls mit ‚Rot Front‘. […] Es kommt nicht in Frage, dass ich mich verhört habe. Mir ist erklärlich, dass es bestritten wird, dass der Ausdruck ‚Rot Front‘ gefallen ist. Die angegebenen Personen sind, soweit ich unterrichtet bin, politisch links eingestellt. Die Personen werden sich auch darin einig sein, dass sie nichts verraten. Ihnen war genug Gelegenheit gegeben, sich in dieser Hinsicht zu verständigen. Zum Schluss betone ich nochmals, dass ich mich nicht verhört habe. Bemerken will ich noch, dass sich in Begleitung des Haddewig eine Person befand, die ich nicht gekannt habe. Es besteht auch die Möglichkeit, dass beide Personen mit ‚Rot Front‘ gegrüsst haben. […]“12
Auch der Beschuldigte hatte vom „kommissarischen Bürgermeister als Ortspolizeibehörde“ eine Vorladung bekommen und wurde am 10. November 1933 von den beiden Vernehmungsbeamten V[…] und L[…] zur Sache verhört. Er gab zu Protokoll:
„[…] Ich muß ganz entschieden bestreiten, dass ich den Ausdruck ‚Rot Front‘ gebraucht habe. Es liegt mir vollkommen fern, mit ‚Rot Front‘ zu grüßen. Ich habe nie der KPD. oder einer ihrer Organisationen angehört. 20 Jahre lang bin ich Mitglied der SPD. gewesen. Weiter bin ich Mitglied des Reichsbanners gewesen und war in der ‚Schufo‘ Gruppenführer. Mit der KPD. habe ich nie sympathisiert, so dass es mir vollkommen fernliegen muss, den Gruss einer verbotenen Organisation der KPD. andern Personen zu entbieten. Wenn Frau W[…] behauptet, ich habe mit ‚Rot Front‘ gegrüsst, und von den anderen Personen sei dieser Gruss in der gleichen Art u. Weise erwidert worden, so muss sie sich verhört haben und muss sich irren, oder sie sagt unbewusst die Unwahrheit. Ich versichere, dass ich die volle Wahrheit gesagt habe. Bemerken will ich noch, dass ich mich nur dadurch auf den Vorfall besinne, weil mir am folgenden Tag vorgehalten wurde, ich habe die angeführte Äusserung getan. […]“13
Meiring ließ sich die Protokolle vorlegen und schrieb unter der Tgb.-Nr. 2222/II am 16. November 1933 an den Oberamtsanwalt in Minden mit Kopie an den Landrat von Borries in Lübbecke:
„[…] Die unter Ziffer 1 bis 5 benannten Zeugen sind ehemalige Kommunisten und Sozialdemokraten. Ihre Angaben erscheinen mir wenig glaubwürdig. Der beschuldigte Haddewig ist mir persönlich als eingefleischter und fanatischer Marxist bekannt, dem ich schon zutraue, dass er seine Gesinnungsgenossen mit dem Ruf ‚Rot Front‘ begrüsst hat. Eine vorübergehende Inschutzhaftnahme des Haddewig halte ich für zweckmässig.
Meiring […]“14
Mit anderen Worten, Meiring hatte sein Urteil bereits gefällt. Die Nationalsozialisten wollten in solchen Fällen keine langwierigen Untersuchungen führen, die möglicherweise ein anderes Ergebnis brachten als gewünscht. Es waren die einfachen Lösungen, die man wollte. Die Lösungen, die der Bevölkerung zeigen sollten, es tut sich etwas. Ob diese Lösungen etwas mit Recht und Gerechtigkeit zu tun hatten, war in der Regel Nebensache. Häufig wurde auf den Begleitpapieren der in die Konzentrationslager Eingewiesenen von Parteigrößen oder der „GESTAPO“ vermerkt: „Rückkehr unerwünscht“. Dieser Vermerk war dann ein sicheres Todesurteil für den Betroffenen. Auf diese Weise konnten die Parteikader und die „GESTAPO“ auf einfache Weise die vernichten, die dem Regime oder persönlich im Wege standen.
Erst weit nach Ende der Diktatur war es möglich, systematisch zu forschen, und es dauerte viele Jahre, bis die Zusammenhänge vieler Vorgänge klar hervortraten.
Insofern war es den damals Lebenden nicht so ohne weiteres möglich, Vorgänge im Ganzen und wahrhaftig zu erfassen, da von den Nationalsozialisten die Informationen zum großen Teil nur zensiert an die Öffentlichkeit gelangten. Jedenfalls dokumentiert die strikte Aufforderung von Meiring, Haddewig in Schutzhaft zu nehmen, wie besessen er Andersdenkende verfolgte.
Auffallend ist, dass gerade gegen wärtig für Her aus fordeningen, die Europa und Deutschland in der Flüchtlingsfrage betreffen, vom „rechten Rand“ die einfachen Antworten herausgebrüllt werden. Leider wiederholt sich an dieser Stelle die Geschichte, denn es gibt auch im Augenblick wieder viele Menschen, die diesen widerlichen menschenverachtenden Parolen der Rechten zuhören und ihnen nachlaufen.
Unsere unter so großen Opfern geborene und mit hohem Einsatz errichtete Demokratie muß sich wehrhaft erweisen, damit diese Angriffe von Undemokraten abgewehrt werden. Es lohnt sich, für die Demokratie und den Erhalt von Europa einzutreten und zu ringen. Ein Zerfall von Europa und der Niedergang von Demokratien in diesem Europa würde bis dahin lange vergessene Feindschaften wieder aufleben lassen und die Willkür mit allen bekannten Grausamkeiten gewänne die Oberhand.
Der Landrat machte am 24. November 1933 eine Aktennotiz anlässlich des Briefes von Bürgermeister Meiring:
„[…] Gesehen und weitergesandt. Ich bitte, mir über den Erfolg der Anzeige Nachricht zu geben.
von Borries […]“15
Die Ermittlungen beginnen
Die Anzeige gegen Haddewig wurde auf dem Amtswege vom Landrat von Borries an den Oberamtsanwalt in Minden gesandt. Dieser fühlte sich nicht zuständig, wollte sich zu den erhobenen Vorwürfen auch nicht positionieren und leitete die Anzeige am 27. November 1933 an den Oberstaatsanwalt in Bielefeld mit den Worten weiter:
„[…] zuständigkeitshalber vorgelegt, da die Sache von politischem Einschlage ist.
Oberamtsanwalt […]“16
Der Oberstaatsanwalt Bielefeld ordnete unter dem Az: 5 J Pol. 1096/33 an, einen Strafbefehl auszustellen. Er merkte noch an, dass im Fall des Einspruchs oder richterlicher Bedenken die Sache zur Hauptverhandlung vor den Einzelrichter gebracht werden solle. Der Empfänger dieser Nachricht, das Amtsgericht Lübbecke, schickte daraufhin folgende Antwort am 16. Dezember 1933 an die Staatsanwaltschaft Bielefeld:
„[…] zurückgesandt mit dem Ersuchen, zunächst noch Ermittlungen darüber anstellen zu lassen, ob ausser der Zeugin W[…] noch andere Personen vorhanden gewesen sind, welche die Äusserungen des Angeklagten wahrnehmen konnten. S.Entsch. d.Reichsger. Bd. 34, Seite 364.
Das Amtsgericht Welschof […]“17
Am 23. Dezember 1933 schrieb der Oberstaatsanwalt zurück an das Amtsgericht Lübbecke, dass eine beeidete Aussage für eine öffentliche Anklage notwendig erscheine.
Nach weiteren Recherchen ließ sich allerdings kein weiterer Zeuge ermitteln, der die Aussage der Frau W[…] bestätigen konnte. Über das Ergebnis der Ermittlungen war der kommissarische Bürgermeister Meiring als Ortspolizeibehörde ständig informiert worden. Da die Sache „im Sande“ zu verlaufen schien, intervenierte Meiring umgehend am 17. Januar 1934 unter der Tgb.-Nr. 48/II an den Oberstaatsanwalt in Bielefeld:
„[…] Wenn sich auch weitere Zeugen, die die Äußerungen des Haddewig gehört haben, nicht haben ermitteln lassen, so bitte ich dennoch gegen H. [Haddewig, d. Verf.] mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln einzuschreiten, da es sich um einen verbissenen unbelehrbaren Marxisten handelt, der auch heute noch marxistisch eingestellt ist.
Die Angaben der Ehefrau W[…] sind durchaus glaubwürdig.
Meiring […]“18
Zur Untermauerung der Anschuldigungen gegen Haddewig waren Meiring und seine Helfer in der Sache unentwegt tätig und versuchten weitere Denunzianten zu finden, mit dem Ziel, die Glaubwürdigkeit des Beschuldigten zu erschüttern. Am 26. Januar 1934 erschien der Arbeiter Paul B[…] (23J) bei der Polizei und machte gegenüber den Vernehmungsbeamten V[…] und L[…] folgende Angaben:
„[…] Aus eigener Veranlassung erscheint der Arbeiter Paul B[…], Lübbecke und gibt folgendes zu Protokoll:
Am 24. ds. Mts. (Januar 1934, d. Verf.) arbeitete ich zusammen mit dem Arbeiter Karl Haddewig aus Lübbecke, Kapitelstraße beim Verlegen der Wasserleitungsrohre. Wir arbeiteten etwas abseits. Andere Arbeiter konnten daher nicht verstehen, worüber wir uns unterhalten. Haddewig war mir als verhasster, fanatischer und berüchtigter Marxist bekannt. Auch Haddewig wusste, dass ich ein überzeugter Nationalsozialist bin. Im Laufe des Gesprächs drückte nun mein Mitarbeiter aus, dass es dem gewöhnlichen Arbeiter schlechter ginge als zuvor. Früher hätte sich ein Arbeiter noch etwas erlauben können, heute, seit dem [sic!] Hitler am Ruder sei, wäre dieses überhaupt nicht mehr möglich. Am wenigsten habe er es selbst vernommen, dass es besser geworden sei. Seine Ersparnisse von früher habe er heute längst verbraucht. Früher hätte er schon eingesehen, wie es heute gekommen wäre. Er habe aber einsehen müssen, dass nichts mehr zu retten sei. Er brauche zum Glück nicht mehr fort (gemeint war wahrscheinlich Militärdienst). Wenn wir zurückkämen, dann hätten wir unseren Jesus Christus erkannt. Wir müssten ordentlich gedrillt und gezwiebelt werden (Kasernenhof). Nach unserer Dienstzeit würden wir wohl nicht mehr ‚Heil Hitler‘ sagen. Die einzigen Personen, die es heute besser hätten, dass [sic!] seien die Führer der Bewegung bezw. [sic!] der Unterorganisationen. Diese führten heute ein angenehmes Leben. Haddewig sagte dann weiter, dass ein Brigadeführer, den Namen kann ich nicht mehr angeben, der früher Wohlfahrtsunterstützung bezogen habe, heute Auto fahre und in Hotels übernachten könne. Diesen Leuten ginge es merklich besser, bloss mir, dem Arbeiter nicht. Früher sei eine Person, wenn sie verhaftet worden wäre, innerhalb von 24 Stunden vor den Richter geführt worden. Heute sei dies alles anders. Die Leute würden verhaftet und erst nach 8 Tagen würden sie vernommen usw. Der NSBO.-Leiter des Kreises Lübbecke, V[…], habe sich sein Gehalt auch höher vorgestellt. Das Gehalt von 160,-- RM sei nicht ausreichend; denn er habe angenommen, dass er noch mehr verdienen würde. Dann stellte Haddewig noch die Frage, ob ich wisse, was Notstandsarbeiten bedeuten. Das Gespräch wurde aber abgebrochen, da der Meister rief, dass ich sein Mittagessen holen sollte. Aus allen Äusserungen ist zu ersehen, dass Haddewig an der gegenwärtigen Regierung bezw. den Massnahmen üble Kritik geübt hat. Ich versichere hiermit, dass ich die volle Wahrheit gesagt habe. Sämtliche Äusserungen hat Haddewig in dem Sinne getan, wie ich sie hier zu Protokoll gegeben habe. […]“19
Am 05. Februar 1934 wurden die Zeugen T[…], Wilh. N[…], Hch. N[…], Sch[…] und K[…] noch einmal, jetzt richterlich, vor dem Amtsgericht Lübbecke vernommen.20 Die Vernehmung erbrachte keine neuen Erkenntnisse. Die Zeugen blieben bei ihrer Aussage, dass Haddewig an dem fraglichen Tag mit „Guten Abend“ gegrüßt habe.
Der Bäcker Wilh. N[…] ergänzt:
„[…] Ich will noch bemerken, dass 3-4 Schritt von uns einige SS.-Leute standen. Ich habe einen davon gekannt, nämlich R[…], der meines Wissens auf dem Kreishause beschäftigt ist. Die SS.-Leute würden wohl eingeschritten sein, wenn Haddewig ‚Rot Front‘ gerufen hätte. […]“21
Diese möglicherweise entlastende Spur wird von der Polizei und der Staatsanwaltschaft nicht weiter verfolgt. Danach schreibt der Oberstaatsanwalt in Bielefeld am 10. Februar 1934 an die Polizeiverwaltung in Lübbecke, also an Meiring:
„[…] Mit Rücksicht auf die Stellungnahme des Amtsgerichts Bl. 9 und das durchaus negative Ergebnis der richterlichen Vernehmung der Zeugen Bl. 12 ff. dürfte es wahrscheinlich sein, dass das Amtsgericht den von mir beantragten Strafbefehl nicht erlässt.
Ich beabsichtige daher, Einstellung aus § 153 St.P.O. und stelle anheim, den Beschuldigten scharf überwachen zu lassen, sodass gegebenenfalls in einem neuen Verfahren zur Überführung des Beschuldigten auch dem Gericht ausreichende Beweise zu erbringen sind. […]“22
Wegen der unermüdlichen Verächtlichmachung von politischen Gegnern durch die NSDAP-Kreisleitung, gelang es, aufgestachelt durch Versprechungen der Partei, immer mehr Menschen zu verführen, andere Mitbürger zu denunzieren. Schließlich meldete sich ein weiterer Denunziant bei der Polizei, wurde vorgeladen und gab am 12. Februar 1934 zu Protokoll:
„[…] Herbestellt erscheint der Verwaltungsanwärter Otto L[…] (25 J), […] Lübbecke […] und erklärt:
Etwa Mitte Januar ds.Js. stand ich zusammen mit Pg. St[…] vorm Rathause und unterhielten uns. Als der bekannte Marxist Haddewig vorbeikam, grüsste ich mit ‚Heil Hitler‘. Haddewig erwiderte mit ‚Guten Tag‘ und stierte mich an, als ob er mich auffressen wollte. Ich habe dann zu St[…]gesagt: ‚Der lernt’s auch noch einmal.‘ Haddewig blieb erneut stehen und sah mich erbost an. Er wandte sich dann und ging ins Rathaus. Haddewig besitzt die grösste Abneigung gegen den deutschen Gruss. Auch nachträglich habe ich feststellen müssen, dass er den deutschen Gruss regelmässig nicht in der gleichen Form erwidert. […]“23
Der denunzierende Charakter dieser Aussage wird überdeutlich. Unterstellungen und Vorurteile wurden damals gern von den Anklägern übernommen, um Freiheitsstrafen oder Schlimmeres zu verhängen. Später machte man sich nicht mehr solche Mühe, wenigstens den Anschein von Recht zu wahren. Da wurden Verhaftungen vom Fleck weg üblich.
Drei Tage später, am 15. Februar 1934, erscheint nochmals auf Vorladung Paul B[…] und macht die folgende Angabe:
„[…] Ende Januar 1934 hat Karl Haddewig noch weiter erklärt, dass er vom Winterhilfswerk 2 Gutscheine zu 25 und 30 RM erhalten habe.
Den Schein zu 30 RM habe er verbrannt, weil er den Staat nicht habe schädigen wollen. Weitere Äusserungen hat Haddewig an diesem Tage nicht gemacht. […]“24
Diese nach heutigem Empfinden harmlos wirkende Aussage sollte auf jeden Fall Haddewig zusätzlich verdächtigen. Was bewegte Paul B[…] dazu, Haddewigs ablehnende Haltung gegenüber dem Regime mitzuteilen. Paul B[…] hätte keine Nachteile gehabt, wenn er die vorgenannten Lappalien nicht erwähnt hätte.
Am 20. Februar 1934 bestätigte der von Otto L[…] benannte Zeuge St[…] die Aussage des L[…].25
Am gleichen Tage beantragte der kommissarische Bürgermeister Meiring als Ortspolizeibehörde unter der Tgb.-Nr. 323 II. in einem Schreiben beim Landrat von Borries:
„[…] Abschrift der anliegenden Akten und dieses Vorganges sind in 2facher Ausfertigung zu fertigen und dem Herrn Landrat in Lübbecke mit der Bitte vorzulegen, zu beantragen, dass Haddewig in einem Konzentrationslager untergebracht wird.
Wv. nach 2 Wochen. […]“
26
Entgegen allen späteren Behauptungen von Meiring geht aus dieser Direktive klar hervor, dass er als kommissarischer Bürgermeister, Ortspolizeibehörde und Repräsentant der NSDAP berechtigt war, Menschen ohne ein Gerichtsurteil in ein Konzentrationslager einweisen zu lassen. Die Verhafteten sollten, nach den höhnischen Grundsätzen der Partei, durch sogenannte „Schutzhaft“ vor dem „gerechten Volkszorn“ geschützt werden. Für die karge Kost und das Logis, Misshandlungen eingeschlossen, mussten sie obendrein noch die Kosten aus eigener Tasche bestreiten.
Am 08. März schreibt Landrat von Borries an den Bürgermeister von Lübbecke, also Meiring:
„[…] Auf den Randbericht vom 20.02.1934 -Nr. 323 II- betr. den Arbeiter Karl Haddewig aus Lübbecke, Kapitelstr. 7.
Ich habe Haftanordnung erlassen und Ueberführung in ein Konzentrationslager beantragt. Mangels eines geeigneten Polizeigewahrsams besteht leider keine Möglichkeit, die Haftanordnung sofort zu vollziehen. H. muß daher bis zum Eingang der Genehmigung zur Ueberführung in ein Konzentrationslager auf freiem Fuße bleiben. Haftanordnung folgt, sobald die Genehmigung zur Aufnahme in ein Konzentrationslager eingeht.
von Borries (eigenhändige Unterschrift) […]“27
und weiter:
„[…] Ich ersuche H. weiter unauffällig beobachten zu lassen. […]“28
Die in den einzelnen Provinzen des Reiches unterschiedliche und zugleich sehr willkürliche „Schutzhaftpraxis“ wurde erst im April 1934 durch zwei Erlasse des Reichsinnenministers Frick vereinheitlicht. In diesen „Schutzhaft“-Erlassen, die bis 1938 in Kraft blieben, wurde erstmals allgemein verbindlich angeordnet, dass neben Ober- und Regierungspräsidenten in Preußen, dem Berliner Polizeipräsidenten sowie den Landesregierungen bzw. Reichsstatthaltern nur noch die „GESTAPO“ und nicht mehr einzelne Repräsentanten und Institutionen der Partei berechtigt waren, Personen in „Schutzhaft“ nehmen zu lassen, die angeblich die „öffentliche Sicherheit und Ordnung“ gefährdeten. Ab Januar 1938 war für die Anordnung der „Schutzhaft“ und die damit automatisch verbundene Aufnahme in ein Konzentrationslager nur noch die „GESTAPO“, Hitlers schärfste Waffe in der Gegnerbekämpfung, zuständig.29
Am 08. Mai 1934 schreibt Bürgermeister Meiring als Ortspolizeibehörde unter der Tgb.-Nr. 323 II:
1.) „[…] Nach der Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten in Minden vom 03. Mai 1934 kann die Schutzhaft gegen Haddewig nicht mehr durchgeführt werden, weil die neuen Bestimmungen des Erlasses des Herrn Preussischen Ministerpräsidenten vom 11. März 1934 betreffend Schutzhaftanordnung und ihre Anwendung eine ganz erhebliche Einschränkung des bisherigen Verfahrens gebracht haben.
2.) z.d.A. (Pol. Polizei) […]“30
Meiring brachte mit diesem Schreiben seine Enttäuschung zum Ausdruck, dass er nicht mehr wie bisher verfahren konnte.
Die richterliche Anordnung eines Strafbefehls gegen Haddewig kam 1934 nicht zustande. Meiring und von Borries war das Instrument der eigenmächtigen Einweisung in ein Konzentrationslager durch den Erlass vom Mai 1934 „aus der Hand geschlagen“ worden. Man legte im Rathaus und im Kreishaus die Sache „auf Eis“. Unterdessen ging die Bespitzelung Haddewigs und seiner Familie ungemindert weiter.
Von Borries behauptete nach Kriegsende, er habe keine Person in ein Konzentrationslager einweisen lassen oder etwas unternommen, das zu einer Einweisung in ein Konzentrationslager geführt hätte.
Die Tatsache, dass Haddewig später ermordet wurde, ist sicherlich als Folge der am 08. März 1934 von Borries erlassenen Haftanordnung zu werten. Dass die Behauptung von Borries’ -er habe keine Einweisung in ein Konzentrationslager veranlasst nicht der Wahrheit entspricht, legt ein weiteres Ereignis in Harlinghausen nahe. Dort galt der Schuhmacher G[…] im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung als Querulant. In diesem Fall soll von Borries bei der „GESTAPO“ in Bielefeld um die Vollmacht zur Ausstellung von Schutzhaftbefehlen gebeten haben.31
Immerwährende Suche nach einem Arbeitsplatz
Wegen seiner Einstellung zur NSDAP und seiner Überzeugung, dass die Nationalsozialisten großes Unglück mit sich bringen würden, verlor Haddewig zwischen 1933 und 1944 mehrfach seinen Arbeitsplatz. Das erste Mal 1933, nachdem er sich gegenüber Kreisleiter Meiring geweigert hatte, die Namen derer preiszugeben, die mit ihm aktiv in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands tätig gewesen waren.
1935 wurde Haddewig auf Betreiben von Meiring aus der Turnerschaft gewiesen. Der Männerturnverein Germania von 1865 schreibt am 30. September 1935 an Haddewig:
„[…] Auf Antrag der Kreisleitung der NSDAP. müssen wir Sie wegen der von Ihnen gezeigten antinationalsozialistischen Einstellung aus dem Vereinsverband ausschliessen. […]“32
Nachdem Meiring die Abwesenheit von Haddewig bei der Übertragung einer „Führerrede“ gerügt hatte,
„[…] wollen Sie (Haddewig, d. Verf.) mir mitteilen, weshalb Sie nicht an dem Gemeinschaftsempfang während der Führerrede in den Krupp’schen Werken, zu dem von Herrn Pflastermeister Meier eingeladen war, teilgenommen haben.
Der Bürgermeister, Lübbecke, den 04. April 1936 […]“33
verlor er seinen Arbeitsplatz bei Pflastermeister Meier. Es ist davon auszugehen, dass Kreisleiter Meiring die Kündigung durchsetzte. Auch die folgende Arbeitsstelle beim Bauunternehmer Bünemann wurde Haddewig auf Betreiben von Meiring gekündigt.
Wie bereits beschrieben, waren die Lübbecker Bauunternehmer daran interessiert, Aufträge bezüglich der von Meiring vorangetriebenen Bauvorhaben zu erhalten. Die Unternehmer verhielten sich gegenüber der Kreisleitung kooperativ, um keine wirtschaftlichen Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.
Insgesamt lässt sich erkennen, dass Meiring alles daransetzte, Haddewig zu vernichten, ihm die Existenzgrundlage zu entziehen und ihn einer permanenten Beobachtung auszusetzen. Offensichtlich war der Hass Meirings auf Andersdenkende derartig groß, dass er fanatisch nach fadenscheinigen Begründungen suchte, politische Gegner auszuschalten.
Nach Beginn des Krieges, der damals noch keine fortlaufende Nummer trug, wurde Haddewig dienstverpflichtet. Es ist dem Verfasser nicht bekannt, an welche Orte ihn die Dienstverpflichtung führte. Allerdings ist allgemein bekannt, dass ab etwa 1938 vor allem wehrtechnische Anlagen vom „Reichsarbeitsdienst (RAD)“ errichtet wurden.
Nach Ableisten der Dienstverpflichtung konnte Haddewig eine Arbeitsstelle als Heizer bei der Kammgarnspinnerei in Lübbecke antreten. Die Kammgarnspinnerei befand sich in der heutigen Strubbergstraße in Lübbecke, auf dem Gelände des jetzt dort ansässigen „Aldi-Marktes“.
Aufgrund der im Laufe des Krieges bereits eingetretenen Verknappung der heimischen Arbeitskräfte duldete die Kreisleitung Haddewig zunächst an diesem Arbeitsplatz. Zudem war Meiring bereits 1939 zur Wehrmacht einberufen worden und im Westen eingesetzt. Nur an den von der Wehrmacht genehmigten Urlaubstagen, die recht zahlreich gewesen sein sollen, konnte er der Parteiarbeit in Lübbecke nachgehen.
Im Übrigen wurde die Situation der Arbeitnehmer in den Jahren 1933 – 1945 von Jahr zu Jahr schwieriger. Im Laufe der Zeit wurden ihre Rechte immer mehr beschnitten. So konnte beispielsweise ein Arbeitsplatzwechsel im sogenannten „3. Reich“ nicht ohne weiteres vom Einzelnen vollzogen werden. Die Machthaber hatten sofort nach Errichten der zentralistischen Diktatur Eingriffe in den Arbeitsmarkt vorgenommen, um eine den Tatsachen nicht entsprechende „Vollbeschäftigung“ vorzutäuschen.
Eine wichtige Rolle spielten dabei die Arbeitsdienste. Vor dem 26. Juni 1935 gab es den Freiwilligen Arbeitsdienst. 1935 waren dort 250 000 Menschen beschäftigt. Vornehmlich handelte es sich um Wegebauten und das Anlegen von Sportplätzen. Mit dem Gesetz vom Juni 1935 wurde der Freiwillige Arbeitsdienst Reichssache und Pflicht für jeden Deutschen, Reichsarbeitsdienst (RAD) nannte er sich von nun an.
Das Jahr 1937 markierte einen Wendepunkt. Die Arbeitsämter grenzten nun nicht mehr allein widerspenstige Personen und Gruppen aus, die nicht der normalen Arbeitsfähigkeit entsprachen, sondern sie beteiligten sich unter dem Titel „Mobilisierung der Arbeitskraftreserven“ an der direkten arbeitspolizeilichen Verfolgung. Die Praktiken der zwangsweisen Verschickung in Arbeitsdienstlager, in die Landhilfe, in Notstandsarbeiten und die Vermittlung in unterwertige Arbeitsverhältnisse, die unter dem Schlagwort „Arbeitsschlacht“ erzwungen wurden, ermöglichten in der Regel lediglich Einkommen knapp über oder unter dem Unterstützungsniveau. Dennoch wurden diejenigen, die sich der Arbeitspflicht nicht unterwarfen, zu „asozialen Elementen“ erklärt. Spätestens seit 1938 wurden polizeiliche Verfolgung, Inhaftierung und KZ-Haft zu einem Bestandteil der Arbeitsamtspraxis. Der „Wohlfahrtsstaat“ des Nationalsozialismus war nicht Instrument der Integration der Schwachen und Benachteiligten, sondern der Verschärfung rassistischer Ungleichheit. Der „Asoziale“ und „Arbeitsscheue“ wurde dem „schaffenden Volksgenossen“ entgegengestellt. „Asozialität“ wurde biologisiert und zum rassistischen Persönlichkeitsmerkmal des „Gemeinschaftsfremden“ umdefiniert. Nach 1933 entwickelten sich aus dem Begriff „Arbeitslosigkeit“ allmählich die Begriffe „arbeitsscheu“ und „Asozialität“. Danach gab es sozial unauffällige, angepasste Fürsorgeempfänger, denen sozialpolitische Vergünstigungen erteilt wurden, wie Ehestandsdarlehen, Beihilfen für Kinderreiche etc. Und es gab unbequeme Fürsorgeempfänger. Sie wurden mit Leistungskürzungen und -verschlechterungen belegt. Das waren die kurzfristig wirkenden Erziehungsmittel. Zur langfristigen Abschreckung wurden sie zur Pflichtarbeit ins Arbeitshaus oder ins Konzentrationslager geschickt.
Die Nationalsozialisten verfolgten damit 4 Ziele: 1. Die Zuverlässigkeit und Loyalität der staatlichen Behörden sollten getestet werden. 2. Das Widerstandspotential in der Bevölkerung wurde ausgelotet. 3. Durch die Stigmatisierung von Armen, insbesondere von Wohlfahrtserwerbslosen, die nicht ins Bild passten, wurden die Ausgrenzung von Armen und die Unsichtbarmachung von Armut vorangetrieben. 4. Durch die Einsparungen im Bereich der Fürsorgepflicht wurden dringend benötigte Finanzmittel zur Umschichtung für die ABM-Maßnahmen frei.34
Ab 1933 stellten die Nationalsozialisten endgültig den Vorrang der Beschäftigung vor der Unterstützung her. Das war der Übergang zu einer autoritär und repressiv durchgesetzten Vollbeschäftigungspolitik.
Es folgten Eingriffsmöglichkeiten in bestehende Arbeitsverträge zwecks Umschichtung der Arbeitslosen- und Belegschaftsstrukturen. Am 15. Mai 1934 wurde das „Gesetz zur Regelung des Arbeitseinsatzes“35 und am 10. August 1934 die „Verordnung über die Verteilung von Arbeitskräften“36 eingeführt.
Am 26. Februar 1935 wurde ein „Gesetz über die Einführung eines Arbeitsbuches“37 gültig und damit die Kontrolle über alle Beschäftigten-Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt erlangt. Ohne Vorlage des Arbeitsbuches konnte kein Arbeitnehmer beschäftigt werden. Staat und Wirtschaft waren über jeden Beschäftigten informiert. Damit war auch die Kontrolle über die gezahlten Löhne möglich. Ein Arbeitnehmer konnte den neuen Arbeitgeber nicht darüber im Unklaren lassen, wie hoch seine Entlohnung bei dem vorherigen Arbeitgeber gewesen war. Auch konnte niemand willkürlich entlassen werden. Das Arbeitsamt musste der Entlassung zustimmen. Von bestimmten Fehlzeiten an, die das Arbeitsbuch durch fehlende Eintragungen erkennen ließ, galt man als „Arbeitsscheuer“, der einer besonderen Behandlung unterzogen werden konnte. Die Verordnung über die Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels vom 01. September 1939 brachte die Zustimmungspflicht der Ämter bei allen Kündigungen ohne gegenseitiges Einvernehmen und bei allen Neueinstellungen mit Ausnahme des Bergbaus, der Landwirtschaft und privater Haushalte.
Anzeige der NSDAP-Kreisleitung gegen Haddewig
Nachdem Haddewig einige Zeit als Heizer gearbeitet hatte, kam es wiederum zu Denunziationen. Dieses Mal wegen „Umgang mit Fremdarbeitern“. Haddewig hatte während des 1. Weltkrieges in russischer Kriegsgefangenschaft die russische Sprache kennengelernt. Er konnte die Sprache leidlich sprechen und gut verstehen. Die Schriftform hatte er nicht erlernt.
Die Kammgarnspinnerei beschäftigte nach dem Überfall des Deutschen Reiches auf Polen und Russland, 1939 und 1941, Zwangsarbeiter aus den Ostgebieten, die nach Deutschland verschleppt worden waren, um die deutschen Arbeitskräfte zu ersetzen, die an allen Fronten zu Kriegsdiensten herangezogen worden waren. Haddewig machte sich bei den Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern nützlich, indem er alltägliche Dinge in deren Landessprache übersetzte und so versuchte, den Menschen das Leben etwas erträglicher zu gestalten. Es ging dabei um Einkaufsmöglichkeiten in der örtlichen Umgebung und das Wesentliche im Umgang mit der einheimischen Bevölkerung.
Der Kontakt zu Zwangsarbeitern, Fremdarbeitern oder Ostarbeitern, wie man sie damals auch nannte, war vom Regime streng verboten worden und wurde in vielen Fällen mit schweren Strafen, bis hin zur Todesstrafe, geahndet.
Der bisherige Verfolger von Haddewig, Meiring war im Sommer 1943 zum zweiten Mal zur Wehrmacht eingezogen worden. Die dadurch vakant gewordene Stelle des Kreisleiters wurde durch Berthold Gembris besetzt. Gembris war ein alter Bekannter von Meiring und wie er ebenso ein fanatischer Nationalsozialist. Insofern wurde die Bespitzelung und Verfolgung im Kreis Lübbecke lückenlos fortgesetzt.
Die Kreisleitung der NSDAP hatte durch ihre Überwachungstätigkeit und durch Denunzianten von den Aktivitäten Haddewigs bezüglich der Zwangsarbeiter erfahren. Der Kreisleiter (Oberbereichsleiter Gembris in seiner Funktion als Kreisleiter) „verwarnte“ mehrfach die Leitung der Kammgarnspinnerei und verlangte, dass die Kontakte von Haddewig zu den Fremdarbeitern unverzüglich zu unterbinden seien.
Es war für Haddewig schicksalhaft, dass sechs russische Kriegsgefangene aus einem Gefangenenlager im Kreis Lübbecke flohen. Dieses Ereignis teilte Gembris am 03. Mai 1944 der Geheimen Staatspolizei in Bielefeld mit. Er berichtete weiter, dass die polizeilichen Ermittlungen ergeben hätten, dass eine Fremdarbeiterin, die bei dem Gastwirt und Bauern G[…] in Schnathorst Zwangsarbeit leisten musste, „irgendwie“ Verbindung zu den Kriegsgefangenen hatte. Im Ergebnis einer Hausdurchsuchung bei G[…] wurden bei der Zwangsarbeiterin Tatjana K[…] Briefe gefunden, die offensichtlich von Karl und Anna Haddewig an Tatjana K[…] geschickt worden waren.
Die Zwangsarbeiterin Tatjana K[…] war ehemals in der Kammgarnspinnerei, also dem Betrieb, in dem auch Haddewig als Heizer tätig war, beschäftigt gewesen. Da sie eine Sehschwäche hatte, konnte sie alsbald nicht mehr an den Spinnmaschinen der Kammgarnspinnerei eingesetzt werden und war deshalb zur Arbeit bei dem Bauern und Gastwirt G[…] in Schnathorst verpflichtet worden.
Haddewig, der durch seine Tätigkeit bei der Kammgarnspinnerei Tatjana K[…] kannte, und seine Frau Anna machten sich Sorgen um das Wohlergehen der Zwangsarbeiterin. Haddewigs machten sich mehrmals auf den Weg nach Schnathorst und besuchten Tatjana K[…] an ihrer neuen Arbeitsstelle, um sich ein Bild von der Unterbringung und menschlichen Behandlung zu machen.
Die dafür notwendige Kommunikation lief üblicherweise über Briefe, die man hin- und herschickte. Tatjana K[…] schrieb folglich an Haddewigs und umgekehrt. Der Schriftwechsel betraf naturgemäß nicht nur unverfängliche Mitteilungen über belanglose Dinge. Es ging auch um persönliche Empfindungen und Gefühle der Betroffenen. Jemand, der, wie Haddewig, das verbrecherische nationalsozialistische System von Anfang an durchschaut hatte, war sicherlich ein Mensch, der viel über sich und die anderen nachgedacht hatte. Insofern war es nicht verwunderlich, dass er auch in der Lage war, eigene Sinneseindrücke und Auffassungen niederzuschreiben. Sicherlich interessierte ihn bei dem Briefwechsel zudem, wie Menschen aus einem anderen Kulturkreis das Leben empfanden und darüber dachten – aus einem Kulturkreis, der damals noch viel unterschiedlicher gewesen sein dürfte als heute. Diese Briefe der Haddewigs wurden nach der Flucht der russischen Kriegsgefangenen bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung der Tatjana K[…] gefunden.
Insofern war Haddewig ein willkommenes Opfer, dem man im Zusammenhang mit der Flucht von Kriegsgefangenen eine Schuld zuweisen konnte. Der Kreisleiter der NSDAP Gembris schrieb wörtlich in seiner Mitteilung vom 03. Mai 1944 an die „GESTAPO“ und vergaß nicht zu erwähnen:
„[…] H.[Haddewig, d. Verf.] ist politisch unzuverlässig. Er war früher Sozialdemokrat und einer der übelsten Vertreter. Er hat sich in den Jahren nach 1933 vollkommen zurückgehalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Volksgenossen, die früher im roten Lager standen und die sich dann im Laufe der Jahre restlos umgestellt haben und heute wirklich wertvolle Mitglieder in unserer Volksgemeinschaft geworden sind, kann man von H. das nicht behaupten. […]Es besteht der Verdacht, daß H. mit den Ostarbeitern Durchstechereien macht. Es ist hier ein staatspolitisches Eingreifen m.E. geboten. Vielleicht steht H. auch mit dem Verschwinden der kriegsgefangenen Russen in Verbindung.
Heil Hitler
gez. Gembris
Oberbereichsleiter […]“38
Wieder einmal wurde Haddewig von der NSDAP-Kreisleitung auf Grund von Behauptungen und Verdächtigungen bei der „GESTAPO“ denunziert. Es darf unterstellt werden, dass die Kreisleitung genau wusste, welche Konsequenzen sich aus diesen Verdächtigungen für den Beschuldigten ergeben würden. Es ist anzunehmen, dass Gembris die Absicht hatte, Haddewig kompromisslos eliminieren zu lassen.
Die „GESTAPO“ Bielefeld ordnet erwartungsgemäß am 31. Mai 1944 eine Vernehmung der Zwangsarbeiter und von Karl und Anna Haddewig an.
Aus den Vernehmungen ging hervor, dass Haddewig zusammen mit seiner Frau den Zwangsarbeitern bei ganz gewöhnlichen Dingen geholfen hatte.
So wurde beispielsweise abgelegte Kleidung in der Verwandtschaft gesammelt und an die Zwangsarbeiter ohne Gegenleistung weitergegeben. Anna Haddewig hatte Kleider, die nicht passten, umgenäht. Die Eheleute Haddewig hatten auch einmal Zwangsarbeiter, die auf einem sonntäglichen Spaziergang an ihrer Wohnung vorbeigingen, hereingerufen und mit einer Tasse Kaffee bewirtet. Eine Zwangsarbeiterin hatte sich einmal bei den Haddewigs eingefunden und als Dank für geschenkte Kleidung in ihrer spärlichen Freizeit bei der Kartoffelernte geholfen.
Den ermittelten Aktivitäten der Eheleute Haddewig haftete nichts Aufrührerisches oder Staatsgefährdendes an. Außerdem wurden keine „Durchstechereien“ (im Sinne von Täuschung, Betrug,) festgestellt.
Die „GESTAPO“, angefeuert vom Kreisleiter der NSDAP, wollte, denn dafür war sie geschaffen worden, jede Zuwiderhandlung gegen die nationalsozialistische Ideologie im Keim ersticken. Dass dabei die Willkürhandlungen bestimmend waren, daran besteht nach heutigem Kenntnisstand kein Zweifel mehr. Der Haddewig zur Last gelegte allgemeine Vorwurf „Verbotener Umgang mit Ostarbeitern“ bot vielfältige Möglichkeiten, Regimegegner und solche Menschen, die man dafür hielt, auf unbestimmte Zeit ohne jegliche gerichtliche Anhörung in Konzentrationslager einzusperren und sie dort einem ungewissen Schicksal zu überlassen. Wer sich in dieser Zeit nur etwas menschlich gegenüber den Gefangenen und Verschleppten verhielt, ihnen etwas Nahrung oder Kleidung zusteckte, stand bereits mit einem Bein im Kerker oder Konzentrationslager. Und doch haben es einige Menschen vermocht, ohne an sich zu denken, etwas Menschlichkeit weiterzugeben.
Verhaftung
Im Ergebnis der Verhöre wurde Haddewig am 19. Juni 1944 wegen „verbotenen Umgangs mit Ostarbeitern“ verhaftet und im Polizeigefängnis Lübbecke eingesperrt.
Am 20. Juni 1944 bestätigte die Schutzpolizei Lübbecke an den Bürgermeister als Ortspolizeibehörde die Einlieferung Haddewigs in das örtliche Polizeigefängnis. Weiterhin berichtete die Schutzpolizei, dass Haddewigs Wohnung durchsucht, aber kein belastendes Material gefunden wurde. Die Ehefrau Anna Haddewig und die vernommenen Ostarbeiter wurden nach dem Verhör auf „freien Fuß“ gesetzt. Der Polizei war noch wichtig zu erwähnen, dass Anna Haddewig ihren Ehemann während des Aufenthaltes im Polizeigefängnis verpflegen wollte. Ansonsten wäre von der Polizei für die Verpflegung von Haddewig eine Rechnung aufgestellt und an Anna Haddewig geschickt worden.39
Der 1944 amtierende Bürgermeister von Lübbecke Dr. Becker meldet am 23. Juni 1944 an die „GESTAPO“ Bielefeld, dass Haddewig im Gefängnis in Lübbecke einsitze und bat im Weiteren um Anweisung, wohin er überführt werden solle. Eine Abschrift erhielt der Landrat in Lübbecke zur Kenntnisnahme.
Am 28. Juni 1944 versuchte Anna Haddewig in einem verzweifelten Brief an den Bürgermeister der Stadt Lübbecke ihren Ehemann freizubekommen. Sie schilderte, dass ihre zwei Söhne als Wehrmachtsangehörige am Krieg teilnahmen und mehrfach ausgezeichnet worden waren. Weiterhin berichtete sie von der systematischen Ausgrenzung ihres Mannes und ihrer selbst seit 1933 durch die Parteiführung der NSDAP. Dann wörtlich:
„[…] Ich möchte hier ausdrücklich betonen, daß wir nie mit Kommunismus irgend etwas [sic!] zu tun gehabt haben. Wenn uns heute der Vorwurf gemacht wird keiner politischen Formation anzugehören, darf man nicht vergessen, daß man uns seitens der Kreisleitung von vornherein von der Volksgemeinschaft ausgeschlossen hat.[…] Im Nov. 1934 fand seitens der Stadt (Lübbecke, d. Verf.) eine feierliche Überreichung des Frontehrenkreuzes statt, zu dieser auch mein Mann geladen war. An diesem fraglichen Tage wurde meinem Mann dieses durch die Polizei per Einschreiben in unserer Wohnung überreicht. Die geplante Feier fand denselben Tag abends in der ev. Volksschule statt. Hierüber erkundigte sich mein Mann und mußte erfahren, daß dem Juden Neustetter und ihm dieses zugestellt war. Er wird dieses zeit seines Lebens als eine große Beleidigung ansehen […]. Als Turner gehörte mein Mann dem Männerturnv. an. Auch hiervon wurde er am 30.9.1935 auf Antrag der Kreisleitung ausgeschlossen. Auf Grund der Vorkommnisse verbittert, haben wir uns zurückgezogen. […]“40
Der Bürgermeister von Lübbecke sandte das Original des von Anna Haddewig geschriebenen Briefes unverzüglich zur „GESTAPO“ nach Bielefeld. Eine Abschrift davon erhielt wiederum der Landrat in Lübbecke.
Am 29. Juni 1944 wurde Haddewig aus der Polizeihaft in Lübbecke mit der Auflage entlassen, dass er sich täglich um 17:15 Uhr auf der Polizeiwache zu melden habe.
Bereits am 08. Juli 1944 erteilte die „GESTAPO“ Bielefeld (Kriminalsekretär Feige) fernmündlich dem Bürgermeister von Lübbecke den Befehl, Haddewig zu verhaften und dem Arbeitserziehungslager zuzuführen. Es wurde noch erwähnt dass keine schriftliche Einweisungsverfügung mehr folgen würde.41
Mit anderen Worten, ein Leben wird durch einen Telefonanruf beendet! Anna Haddewig sagte am 07. November 1950 im Prozess gegen Meiring vor dem Spruchgericht:
„[…]Am 19. Juni 1944 wurde er (Haddewig, d. Verf.) wegen Verkehr mit Fremdarbeiterinnen verhaftet, aber und zwar am 29. Juni 1944 nach kurzer Zeit wieder entlassen. Als der Angeklagte (Meiring, d. Verf.) hörte, dass mein Mann wieder entlassen sei, soll er geäußert haben: ‚Ja, aber nicht für lange‘. […]“42
Meiring be hauptete im vorgenannten Spruchge richts verfahren, dass er von Sommer 1943 bis Kriegsende Soldat war und von den Ereignissen in Lübbecke keine Kenntnis hatte. Er wurde allerdings in der Zeit des Öfteren in Lübbecke gesehen und hat nachweislich seine Funktion in der Partei ausgeübt. Ein weiterer Zeuge, Heinrich H[…], Gewerkschaftssekretär, sagte im vorgenannten Sprachgerichts verfahren am 07. November 1950: