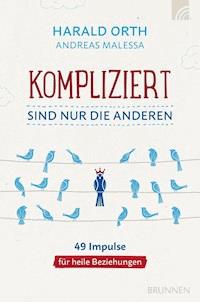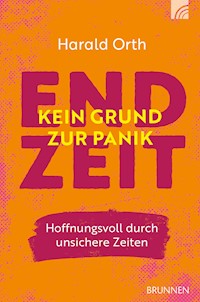Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte beginnt friedlich am Rhein und endet dramatisch in der Nähe des Bug in Ostpolen. Es ist die Geschichte einer jüdischen deutschen Familie mit zwei Söhnen und dem »Nesthäkchen« Hannelore. Sie beginnt wie die vieler Menschen in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und erzählt von schweren Tagen, Fortschritt und gesicherter Existenz, von der Freude am Leben. »Wir lachten oft und gern«, erinnert sich Kurt, der jüngere der beiden Brüder. Seine geliebte Schwester sieht er heranwachsen als »hübsches und kluges« Mädchen. Alles hätte sich so gut entwickeln können: »Masel tov« für die Hermanns und ihre Freunde! Aber es ist anders gekommen. Das liegt an einem Phänomen, das zu Recht als »Geißel der Menschheit« bezeichnet worden ist: dem Antisemitismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2022 – e-book-AusgabeRHEIN-MOSEL-VERLAGZell/MoselBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel 06542/5151 Fax 06542/61158Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-931-6Ausstattung: Stefanie ThurTitelfoto: Lachende Hannelore (StAK N 174,1 Nr. 54)
Harald Orth
»Wir lachten oft und gern«
Hannelore Hermann
Geschichte eines jüdischen Koblenzer Mädchens und seiner Familie
Rhein-Mosel-Verlag
Meinen Kindern und Enkelkindern.
Vorwort
Die Geschichte beginnt friedlich am Rhein und endet dramatisch in der Nähe des Bug in Ostpolen. Es ist die Geschichte einer jüdischen deutschen Familie mit zwei Söhnen und dem »Nesthäkchen« Hannelore. Sie beginnt wie die vieler Menschen in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und erzählt von schweren Tagen, Fortschritt und gesicherter Existenz, von der Freude am Leben. »Wir lachten oft und gern«, erinnert sich Kurt, der jüngere der beiden Brüder. Seine geliebte Schwester sieht er heranwachsen als »hübsches und kluges« Mädchen. Alles hätte sich so gut entwickeln können: »Masel tov« für die Hermanns und ihre Freunde!
Aber es ist anders gekommen. Das liegt an einem Phänomen, das zu Recht als »Geißel der Menschheit« bezeichnet worden ist: dem Antisemitismus. Seine grässlichen Folgen hat die Filmdokumentation »Nacht und Nebel« von 1955 eindringlich vor Augen geführt. Mit sparsamen, einprägsamen Worten von Albert Camus versucht sie das Grauen des Holocaust und die Banalität des Bösen darzustellen: Die Krematorien laufen auf Hochtouren, und die Frau des KZ-Kommandanten lädt zur Hausmusik. Ausgemergelte Menschen schleppen sich zur Arbeit, und die Lagerleitung trifft sich zum Schachspiel. Immer neue Züge rollen an die berüchtigte Rampe von Auschwitz-Birkenau. Es könnte auch in Belzec, Treblinka oder Sobibor sein. Aussteigen! Hundegebell und Uniformierte, die Männer, Frauen und Kinder erwarten. Aussortieren! Die einen zur Arbeit, die anderen direkt in die Gaskammern. Am Ende dieser Dokumentation sind Ruinen zu sehen, geborstener Stahlbeton neben den Straßen von Auschwitz, und eine Stimme fragt: »Wer wacht mit uns?«
Die Frage hat nichts von ihrer Aktualität verloren. Als der Rabbiner Dr. Joachim Prinz gefragt wurde, was für ihn das Charakteristischste an der Nazi-Herrschaft gewesen sei, gab er eine, auf den ersten Blick, überraschende Antwort, als er sagte: »Die Stille.«
Gemeint hat er wohl das Schweigen der Mehrheit, als die Nazis Juden diffamierten, entrechteten und ausplünderten, schließlich Millionen Menschen, Juden, Sinti und Roma, allein Andersdenkende ermordeten.
Eine von ihnen ist Hannelore Hermann. Sie ist am gleichen Tag geboren wie Anne Frank, nur ein Jahr vorher. Ihr Weg und der ihrer Familie hat uns unmittelbar getroffen, als meine Frau und ich erfuhren, dass die Hermanns mehrere Jahre in unserer Wohnung gelebt haben. Durch dieselben Türen gegangen sind und dort glückliche Jahre verbrachten.
Ich habe mich bemüht Stationen ihres Lebens nachzuzeichnen und stütze mich dabei auf Erinnerungen ihres Bruders Kurt und Auszüge aus Briefen, die ihre Familie nach Palästina-Erez Israel geschrieben hat. Akten im Landeshauptarchiv und im Stadtarchiv Koblenz haben einzelne, wichtige Fundstücke zu Tage gefördert, die helfen den tragischen Lebensweg auszuleuchten.
Die Tragik ist menschengemacht, beginnend mit einer totalitären Ideologie, die den Gleichschritt fordert und zugleich ausgrenzt und entwürdigt. Deshalb habe ich den Versuch unternommen, wichtige politische Ereignisse und Entscheidungen exemplarisch darzustellen; sie sollen gleichsam neben der Familiengeschichte herlaufen und diese verständlicher machen. Am Anfang scheinen sie weit weg zu sein im Leben der Hermanns; aber von Jahr zu Jahr greifen sie tiefer in ihren Alltag ein, bis sie ihn schließlich ganz beherrschen und es kein Entrinnen mehr gibt. Trotz aller verzweifelten Bemühungen Hannelore zu retten. Ein Mädchen, auf das ein Lied (»Girl of Mauthausen«) von Mikis Theodorakis zutrifft, in dem es heißt: Sie sei »Verwöhnt von der Mutter und den Küssen der Brüder«.
Ich möchte hinzufügen: geliebt vom Vater und fast allen, die sie kennengelernt haben.
1. Die frühen Jahre
Das Rheintal liegt herrlich in der Morgensonne, als Leopold Hermann mit seinen beiden Söhnen zum »Rittersturz« aufbricht, einem beliebten Ausflugsziel der Koblenzer. Hans und Kurt sind elf und zehn Jahre alt. Etwas ist anders dieses Mal. Johanna fehlt, ihre Mutter, und das hat einen Grund. Die beiden Jungen haben eine Idee, verraten aber nichts. Sie sind gespannt, was ihr Vater sagen wird. Vielleicht auch: wie er es sagt. Der Anstieg in den Stadtwald ist für die Hermanns ein Kinderspiel. Sie kennen den Weg und lieben die Aussicht. Neuerdings führt sogar eine Seilbahn hinauf zu dem Hotel mit seiner Panorama-Terrasse. Hier werden 20 Jahre später die Väter und Mütter des Grundgesetzes zusammenkommen. Bis dahin wird noch ›viel Wasser den Rhein hinunterlaufen‹ – niemand kann ahnen, was die Familie erwartet. Die Hermanns sind Juden. Deutsche mit jüdischen Wurzeln.
Die »liebe Mutti«, wie sie vom Vater und den Söhnen genannt wird, ist zu Hause geblieben. Warum eigentlich? Leo, wie ihn seine Verwandten und Freunde nennen, hat eine wohl überlegte Antwort parat. »Wir erwarten Besuch«, erklärt er. Ein Fabrikant aus Krefeld mit dem er zusammenarbeite, komme heute vorbei. Daher sei Johanna in der Küche beschäftigt. Leo malt das Ganze mit dem Hinweis auf die von allen geschätzte gefüllte Kalbsbrust aus. Trotzdem befindet Kurt im Nachhinein kurz und bündig: »Es war eine Ausrede.«1
Denn ihm und seinem Bruder ist längst aufgefallen, dass ihre Mutter in den letzten Wochen etwas »rundlicher« geworden ist. Auf dem Spaziergang zeigt der Vater plötzlich ein ganz außergewöhnliches Interesse an den Vorgängen in der Natur. »Er machte uns auf das Treiben der Insekten und Schmetterlinge aufmerksam, und wie die Blüten von ihnen auf der Suche nach Honig besucht, und wie der Blütenstaub auf die Stempel kommt und so Fruchtbarkeit erzeugt wird. Ganz langsam kam dann die Schwangerschaft unserer Mutter zur Sprache.« Mir kommt dabei in den Sinn, wie zaghaft die Bemühungen um sexuelle Aufklärung gewesen sind: Noch Jahrzehnte nach diesem Spaziergang hat sich unser Religionslehrer im Gymnasium an das Thema herangetastet, indem er zu unsrer Überraschung schlicht eine Schallplatte von Bienen und Schmetterlingen erzählen lässt … Für Hans und Kurt ist schon lange klar, dass nicht der »Klapperstorch« die Kinder bringt; »es war wirklich rührend, wie unser Herr Papa sich bemühte es uns schonend beizubringen.« Der Rückweg geht schneller vonstatten; Leo mit seiner dunklen Hornbrille und den runden Gläsern, einem schwarzen, etwas spärlichen »Schnäuzer«, erhöht das Tempo – ein vielversprechendes Mittagessen und den Gast wollen sie nicht warten lassen. Schließlich sind alle voll des Lobes über Johannas Kochkunst.
Anfang Juni begleitet Leo seine Frau, zum »Kaiserin-Augusta-Wöchnerinnen-Heim am Koblenzer Moselring.2 Johanna, ist vor der Geburt ihres dritten Kindes 38 Jahre alt. Fotos zeigen sie mit leicht gewellten dunklen Haaren und einem dezenten, freundlichen Lächeln. Die Tage im Wöchnerinnen-Heim vergehen langsam. Die ganze Familie wartet gespannt auf das freudige Ereignis. Am 12. Juni 1928, einem Dienstag, ist es so weit: Ein gesundes Mädchen erblickt das Licht der Welt. Vater und Mutter sind stolz und erleichtert, ihr Kind in den Armen zu halten. Die Eltern geben ihrer Kleinen den Namen Hannelore, und die Jungen brennen regelrecht darauf, das »Nesthäkchen« endlich daheim begrüßen zu können. Kurt denkt noch nach vielen Jahren an dieses Ereignis und die folgende Zeit zurück: »Bald drehte sich der ganze Haushalt um das neue Familienmitglied. Wir stritten uns um das Recht mit dem neuen Kinderwagen spazieren zu gehen und beim Babybaden mussten wir natürlich auch dabei sein.«
Für die Familie ist die Geburt der kleinen Hannelore 1928 das große Ereignis. Einige andere, subjektiv ausgewählt, zeigen uns, was damals Schlagzeilen gemacht hat:
– Mit der »Europa« und der »Bremen« laufen die größten jemals in Deutschland gebauten Passagierschiffe vom Stapel;
– In den USA wird das Penicillin entdeckt;
– Brechts »Dreigroschenoper« hat ihre Uraufführung in Berlin;
– Erste Rede Hitlers im voll besetzten Berliner Sportpalast: »Die allgemeine Enttäuschung konnte fast Mitleid erregen«, kommentiert die liberale Frankfurter Zeitung.3
– Ein Ereignis, wie ein fernes Wetterleuchten, weit entfernt vom Alltag und Leben der Hermanns.
*
»Wurzeln« der Familie
Leo nennt seine Heimat liebevoll »unser Ländchen«. Es ist die hügelige, grüne Landschaft zu beiden Seiten des Limes im Rheinland, genauer im Taunus. Dort lebt seine Familie im Dörfchen Obertiefenbach. Seit mehreren Generationen betreiben die Hermanns Landwirtschaft, während nahe Verwandte ihren Lebensunterhalt als Viehhändler oder Kleinkaufleute verdienen. Leo hat sechs Brüder die, seit früher Jugend gewöhnt sind kräftig anzupacken, wenn es nötig gewesen ist. Das war es auf dem Land in christlichen wie in jüdischen Familien fast immer.
Als Deutsche in den 30er Jahren vermehrt anfangen »Ahnenforschung« zu betreiben, tut Leo das auch und findet heraus, dass seine Vorfahren bereits mit den Römern ins Rheinland gekommen sein können. Als jüdische »mercatores«, Kaufleute, hätten sie sich dann um die Bedürfnisse der römischen Soldaten gekümmert, als »Heer-männer«. Kurt meint, der Name »war jedenfalls älterer deutscher Herkunft, so wie mein Klassen- und Geschichtslehrer in der Tertia sagte, als der meines Klassenkameraden und Nazi Przsevlocka. Das half aber nichts. Jud ist Jud.4 Die jüdische Familie ist im »Ländchen« fest verwurzelt. Sie arbeitet wie ihre christlichen Nachbarn auf dem Land hart für das tägliche Brot. Besonders eng sind die Beziehungen der Koblenzer Hermanns zu einer Schwester von Großmutter Regina, Amalie, geborene Ackermann, in Ruppertshofen. Dort, bei den Blumenthals, sind Hans und Kurt von Kindheit an oft und gerne. Sie lieben das Herumtollen in der freien Natur und schätzen die herzliche Art ihrer Verwandten. Noch nach vielen Jahren erinnert sich Kurt an die »gute Stube« bei den Großeltern. An den Wänden hängen Bilder von gefallenen Söhnen, »komplett mit Pickelhaube und Eisernem Kreuz.« Von den sechs Brüdern Leos haben zwei ihr Leben verloren für »Kaiser und Vaterland«. Allzu bald wird der Tod von 10.000 jüdischen Soldaten auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs für Deutschland verdrängt und vergessen sein.
Leos jüngerer Bruder Hugo überlebt als Unteroffizier die Schrecken der Front; ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz kehrt er nach Hause zurück. Geholfen haben ihm weder der Einsatz für sein Heimatland noch der Tapferkeitsorden.
Nach dem Krieg arbeitet einer von Leos Brüdern auf dem Hof in Obertiefenbach als Landwirt. Davor hat er einige Zeit in Singhofen verbracht, an der »Bäderstraße«, die Bad Ems und Wiesbaden verbindet. Alfred, der jüngste der Hermann-Brüder, gilt in der Zeit als Hans und Kurt ihn kennen- und schätzen lernen, den einen als »Lausbub«, den anderen als »Don Juan« …
Mütterlicherseits stammen die Hermanns aus Siegburg. Johannas Vater besitzt in der Siegburger Luisenstraße Nr. 28 eine gut gehende Metzgerei und Wurstfabrik. Auch ihre Mutter stammt aus einem wohlsituierten Haus. Johanna hat eine Schwester, Jenny, und einen jüngeren Bruder, Ludwig.
Den Kontakt zu den Großeltern im Taunus und in Siegburg pflegen die Koblenzer Hermanns intensiv. Die Kinder halten sich oft bei Großeltern, Onkeln und Tanten, den Cousins und Cousinen, auf. In Siegburg erinnert sich Kurt besonders gern an den Mann von Tante Jenny. Er ist kein Jude und arbeitet als Gefängniswärter. Er nimmt sich, wenn sie zu Besuch kommen, viel Zeit für die Jungen. In besonders lebhafter Erinnerung bleiben Kurt die Fahrten auf dem Motorrad. Meistens aber geht es mit der Familie »in de Bösch, bei de Böm,« wie der Onkel zu sagen pflegt. Spazierengehen mit ihm und seiner Familie ist für Kurt in Ordnung; aber die Jugendlichen wollen dennoch viel lieber zum Schwimmen an die Sieg oder zur Agger, immer begleitet von dem sorgenvollen Hinweis der Großmutter: »Denkt daran, Wasser hat keine Balken!« Die Jungens nehmen es gelassen und haben jede Menge Spaß.
Abgesehen von Ausflügen nach Bad Münster am Stein oder dem idyllischen Miltenberg am Main – »ich erinnere mich bis heute an die Schönheit des Städtchens«5 zieht es die Hermann-Jungen in den Ferien vor allem zu den Großeltern im Taunus. Unvergessen sind die Fahrten mit der Kutsche, der »Kalosche«, über Land, zu den Dörfern in der Umgebung von Obertiefenbach. Dort gibt es zur Erntezeit immer etwas zu tun. Hans und Kurt packen gern mit an. Aber es gilt erst einmal zu den Großeltern hinzukommen! Das ist jedes Mal ein kleines Abenteuer: mit der Bahn in den Taunus fahren. Vor allem Kurt hat es genossen, wie aus seinen anschaulichen Zeilen von diesem kleinen Abenteuer heraus zu lesen ist: »Da fuhr man zuerst nach St. Goar, dann mit der Fähre über den Rhein nach St. Goarshausen und dann mit der Kleinbahn (Bimmelbahn genannt wegen der Glocke an der Lokomotive), die nach Nastätten fährt, bis Bogel … Komischerweise erinnerte ich mich an die Bimmelbahn Jahre später auf der Hedschasbahn auf dem Weg nach Damaskus und Bagdad. Das war auch eine Schmalspurbahn von Haifa durch die Yesreel-Ebene und das Jordantal bis Zemach und von dort durch das Yarmuk-Tal hinauf in die Syrische Hochebene. Aber die Lokomotive bimmelte nicht und konnte nicht sprechen, wie die auf der Steigung hinauf in den Taunus: ›wir packens nit, wir packens nit‹, bis das ›Stöhnen‹ die Steigung hinauf dem erleichterten ›Mir ham’s gepackt, mir ham’s gepackt‹ gewichen ist. Selbst die Personenwagen haben es buchstäblich in sich. Durch die losen Bretter ihrer Fußböden konnte man die Schienen sehen, und zu beiden Seiten der Bänke standen die Körbe der Bauersleute, aus denen Kindern während der Fahrt mancherlei Leckerbissen angeboten wurde.«
Koblenz, Mainzerstraße 125
Ausgangspunkt aller Ausflüge und Reisen in den 20er Jahren ist für die Hermanns ein schmuckes, dreistöckiges Fachwerkhaus in der Südlichen Vorstadt von Koblenz. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts ist das Gelände vor den geschleiften Festungsanlagen weitgehend unbebaut. Etliche Fachwerkhäuser sind sogar »faltbar« konstruiert, um freies Schussfeld zu haben, wenn das nötig wäre. Die Hermanns wohnen in der Mainzerstraße 125 im Erdgeschoss; über ihnen die alleinstehende Frau Höbel, im zweiten Stock Familie Gercke, deren Söhne Hans’ und Kurts »Spielgenossen waren, bis sie Genossen woanders wurden.« Die Gerckes – der Vater ist Ingenieur bei der Stadt –haben bereits ein Radio, eine echte Attraktion.
Wenn immer möglich, geht es für Hans und Kurt nach draußen. »Der Spielplatz oder die Jagdgründe dieser Jahre waren die Schützenstraße bis zum Schützenhof, wo sich zwei Straßenbahnlinien vereinigten und zum Kaiserin-Augusta-Denkmal …und ganz besonders die Treppen von der Brücke zu den Rheinanlagen …« Äußerst präzise beschreibt Kurt noch nach Jahren das erste Zuhause: »Die elterliche Wohnung bestand aus Esszimmer und Wohnzimmer, die beide zur Straßenseite und dem Vorgärtchen lagen … Entlang einem langen Flur kam man dann zuerst zum sogenannten, warum weiß ich nicht, Fremdenzimmer, dann kam das Schlafzimmer der Eltern mit Veranda, von der ein Teil zum Badezimmer umgebaut war …«6
Am Hauseingang gibt es einen kleinen Anbau aus Wellblech mit der Hütte von »Rex«, »unserem ersten Hund«. Außerdem beherbergt der Anbau die Waschküche. Waschen bedeutet Schwerstarbeit. Dabei ist vor allem Käthe gefragt, die junge, blonde Haushaltshilfe der Hermanns. Durch eine zweite Tür des Anbaus ist man schnell auf dem Hinterhof, »der in unserer Kindheit eine große Rolle gespielt hat.« Dort befindet sich die Gartenlaube, an der Grenze zum Nachbarhaus 123. »Bei schönem Wetter und entsprechender Laune« haben die Hermanns in der Laube ihre Mahlzeiten eingenommen. Noch Jahrzehnte später wird Kurt seinen Bruder an das fröhliche Zusammensein der Familie dort erinnern.7 Interessant ist der Hof auch deswegen, weil man von hier aus die weiter unten gelegenen Rheinanlagen mit ihren Kastanienbäumen und den Schwanenteich auf kurzem Weg erreichen kann. Der Teich, »wo im Sommer gerudert und im Winter Schlittschuh gelaufen, das ganze Jahr hindurch aber geliebt wurde.«
»Was Wunder«, erinnert sich Kurt weiter, »dass unserer Käthe des Öfteren das Mittagessen anbrannte, weil das Leben dort unten doch viel interessanter war als die Kochtöpfe.«
Käthe hat einen Verehrer. Er ist Straßenbahnführer und er »trampelte wie wild auf der ,›Bimmel‹ herum«, wenn er vorbeifuhr, »und dann wussten wir, dass er es war …«
Ja, damals fährt sie noch die Straßenbahn, die den Süden der Stadt mit dem Hauptbahnhof und dem Zentrum verbindet. Es ist die Zeit, in der Truppen der Siegermächte des Ersten Weltkriegs in Koblenz stationiert sind. »Amerikaner, Belgier und Franzosen ziehen mit viel Tschingderassa Bummderassa bei uns vorbei; wahrscheinlich«, vermutet Kurt, »haben sich die Militärkapellen beim Vorbeimarsch am Domizil des Generals »ganz besonders angestrengt …« Der hohe Offizier wohnt in einer Villa, schräg gegenüber von den Hermanns.
Inflation und Ruin
Gleich nach dem Krieg hat Leo zusammen mit seinen Brüdern Hugo und Sally eine Lebensmittel-Großhandlung in der Koblenzer Altstadt gegründet. Das Geschäft mit Sitz in der Gemüsegasse entwickelt sich gut. Immer mehr Aufträge kommen herein. Ein zweiter Lkw muss angeschafft werden. Daneben besitzt die Firma, die vor allem Mehl vertreibt, ein Auto, »mit Chauffeur«, wie Kurt eigens erwähnt. Die Aussichten Anfang der 20er Jahre sind rosig für die drei Brüder und ihre Familien. Der Großhandel steht auf solidem Fundament, und Lebensmittel werden gebraucht.
Aber der wirtschaftliche Aufschwung täuscht. Zwei Probleme machen der Regierung in Berlin zu schaffen: die immensen Staatsschulden und die ungelöste Reparationsfrage. Forderungen der Alliierten aus dem Ersten Weltkrieg sind 1921 in Paris auf 226 Milliarden Goldmark festgelegt worden, zahlbar in 42 Jahren.8 Nicht nur die radikale Rechte zetert daraufhin: »Versklavung noch der Enkel!« Nach heftigen Protesten senkt die alliierte Kommission die zu zahlende Summe auf 132 Milliarden Goldmark, droht aber zugleich mit der Besetzung des Ruhrgebietes, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden.
Die neue Regierung Wirth-Rathenau will auf diese Forderungen eingehen, zugleich deren drückende Last und letztlich Unerfüllbarkeit aufzeigen. Von den rechten Parteien wird das als »Erfüllungspolitik« gebrandmarkt. Den Gegnern der Republik spielt die tatsächliche Besetzung des Ruhrreviers durch 60.000 französische und belgische Soldaten Anfang 1923 in die Hände. Die Regierung gerät in arge Bedrängnis, da sie den passiven Widerstand der Bergleute unterstützt, zugleich aber auch den Lebensunterhalt der Kumpel und deren Familien sichern muss. Die Folge: Die Notenpressen werden angeworfen; Tag und Nacht wird zunehmend wertloseres Geld gedruckt und in Umlauf gebracht:
Im Juni 1923 kostet ein Pfund Brot bis zu 15.000 Mark, Weizenmehl zwischen 1.800 und 2.600 Mark, ein Kilo Rindfleisch 12.000 Mark. Löhne und Gehälter werden teilweise täglich ausgezahlt. So schnell wie möglich, oft noch am gleichen Tag wird es ausgegeben, bevor die nächste Preiserhöhung es wertlos macht.
Die Folgen für die Firma der Familie Hermann bringt Kurt sehr gut auf den Punkt: »Innerhalb kürzester Zeit hatte man keine Ware mehr, aber viel wertloses Geld.«9
Die verhängnisvolle Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Im Spätherbst 1923 erreicht der Wert eines Dollars die astronomische Summe von 4,2 Billionen Mark. In verschiedenen Städten versuchen die Kommunen mit »Notgeld« über die Runden zu kommen, bis schließlich Ende 1923 als neue Währung die »Rentenmark« eingeführt wird. Ihre Sicherheit beruht nicht mehr auf den wertlosen Geldscheinen, sondern vor allem auf dem Wert von Grund und Boden.
Für die Firma Hermann kommt die neue Mark zu spät. »Pleite war eines der ersten Worte, die ich kennenlernte«, schreibt Kurt in seinen Erinnerungen. »Mesumann«, das heißt Bargeld ist Mangelware, abgesehen von den »Milliarden«, mit denen der Vater die Wände der Toilette tapeziert. Er arbeitet jetzt wieder in seinem ursprünglichen Beruf als Dekorateur im Kaufhaus Leonhard Tietz (heute Kaufhof). Ihre Wochenlöhne tragen die Arbeiter und Angestellten während der Krise bisweilen in Körben nach Hause, oder sie haben – wie Leopold – das Geld gleich in Sachwerte eingetauscht. Für die Kinder mit dem erfreulichen Nebeneffekt, dass sie öfter mit Spielsachen überrascht werden. Darunter ist der »Fliegende Holländer«, ein lenkbares Gefährt, mit dem Hans und Kurt die Gegend unsicher machen …
Unvergessen ist ein Weihnachtsfest mit einem ganz besonderen Geschenk. Kurt erinnert sich ganz genau: Schon Tage vorher ist das Esszimmer abgesperrt, die Glastüren von innen verhängt. Als sie am Heiligen Abend geöffnet werden, verschlägt es den beiden Brüdern den Atem. Vor ihnen liegt »die herrlichste Winterlandschaft mit Bergen und Tälern, mit Hirschen und Rehen, und durch diese aus Papier und Pappmaché und viel Farbe gezauberte Landschaft fuhr die Eisenbahn durch Tunnels und über Brücken, Kreuzungen und Stellweichen …Wir waren sprachlos nicht nur vor Freude, sondern auch vor Stolz, dass unser Vater so ein Künstler war.«10
Erfahrungen in der Schule
Wie sein Bruder besucht Kurt zunächst die Hohenzollernschule. Unvergessen ist der erste Schultag mit einer großen Tüte voller Süßigkeiten und dem »nagelneuen Schulranzen«.
Zweimal hat der junge Kurt in der folgenden Zeit Bekanntschaft mit dem Rohrstock gemacht. »Mein Klassenlehrer war Lehrer Weihrich, ein typischer Lehrer des alten Schlags, bei dem Gehorsam du Rohrstock synonym waren …«11 Aber es gibt auch erfreuliche Erinnerungen. Zum Beispiel an das Nachbarmädchen Isolde Eysold. Ihr Vater arbeitet bei der Berufsfeuerwehr, und die Tochter ist bei den Jungs sehr begehrt. Leo, wie Kurt sagt, ein »begeisterter Wagnerianer«12, dichtet ihr rasch einen »Tristan« an, entsprechend der Wagner-Oper »Tristan und Isolde« …
»Aber im großen Ganzen gingen die Jahre in der Volksschule ohne große Ereignisse vorüber. Selbst die Schulausflüge waren blass gegenüber den schönen Ausflügen, die wir mit unseren Eltern machten«, findet Kurt.
Nach der vierten Klasse wechselt er wie ein Jahr zuvor Hans, zum Kaiser-Wilhelm-Realgymnasium. »Es ging damals noch recht kaiserlich zu während der Weimarer Republik bei uns in Koblenz. Also, was Straßennamen und so weiter betrifft, war die alte Kurfürstenstadt noch immer sehr fürstlich.«
Der erste Klassenlehrer ist Dr. Scherhag. Ihn wird Kurt später außerhalb der Schule kennenlernen. Für Studienrat Morziol, der den Schülern Erdkunde beibringt, erfinden sie den Spitznamen »Mordpistol«. »Er war auch der erste, der das Hakenkreuz in die Schule brachte.«13 Musiklehrer König erhält den Namen »Amanulla« (nach dem afghanischen König Aman Ullah), der abgesetzt worden ist. Von Musik und Chorleitung habe er etwas verstanden, meint Kurt noch nach Jahrzehnten. Unter dem Dirigenten »Amanulla« erlebt er einen Tag, der in der Rückschau nichts von seiner Tragik verliert. Wir haben bereits gehört, dass Koblenz zum Besatzungsgebiet alliierter Soldaten des Ersten Weltkriegs gehört. Bis zum Herbst 1929, als sich eine grundlegende Änderung abzeichnet. Die Verständigungspolitik zwischen Frankreich und Deutschland bietet dafür die Voraussetzung. Maßgeblich für ihren Erfolg ist das Engagement des französischen Außenministers Briand und seines deutschen Kollegen Stresemann. Die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund und der Abzug französischer Soldaten aus dem Rheinland sind sichtbare Zeichen dieser zukunftsweisenden Politik.
Zurück zu den Erfahrungen Kurts als Schüler: Er ist Mitglied des Schulchores, und der ist eingeladen bei den Feierlichkeiten zum »Befreiungstag« im Beisein des Reichspräsidenten Hindenburg aufzutreten. Schüler und Lehrer bewältigen die Aufgabe, das »Niederländische Dankgebet« zu präsentieren, sehr gekonnt. Aber der Tag endet mit einer Tragödie. Ein »Riesenfeuerwerk« von Ehrenbreitstein herunter soll den Höhepunkt und Abschluss der Feiern in Koblenz bilden. Tausende von Schaulustigen sind zum Teil mit Sonderzügen gekommen. Bengalische Feuer säumen die Ufer des Rheins. Gegen 23 Uhr strömen die ersten Zuschauer zurück zur Innenstadt. Viele nehmen eine Abkürzung über den Lützeler Moselhafen und eine hölzerne Behelfsbrücke. Die ist dem Ansturm nicht gewachsen. Sie löst sich vom Ufer und reißt viele in den Fluss. Als Erste eilen Schiffer, die mit ihren Schleppkähnen im Hafen liegen, zu Hilfe. In einem Augenzeugenbericht heißt es: »Es war ein furchtbarer und erschütternder Anblick, als beim Schein der Fackeln und im grellen Licht der Scheinwerfer die Leichen aus den trüben Fluten geborgen werden.«14
Etwa 200 Menschen sind verletzt, 38 finden den Tod. Einige Tage berichten Zeitungen in ganz Deutschland über den schwarzen Tag, einen der größten Unglücksfälle in der Geschichte der Stadt Koblenz.
»Goldene Zwanziger«
Leo, Hugo und Sally Hermann haben sich von der Pleite ihrer Firma einigermaßen erholt. Sie sind als Vertreter verschiedener Firmen aktiv: Sally arbeitet für die Firma Kleestadt, Bürozubehör und Kassenbücher. Hugo und Leo sind in der Bekleidungsbranche tätig. Manchmal für die gleiche Firma ohne sich jedoch ins Gehege zu kommen, da sie in verschiedenen Regionen unterwegs sind. Leo macht tagelang Besuche bis ins »Saargebiet« hinein.
Harte Arbeit, Kompetenz und Freundlichkeit im Umgang mit den Kunden machen sich bezahlt. Den Brüdern kommt zugute, dass sich die wirtschaftliche Situation in Deutschland entspannt. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt bis zum Beginn der 30er Jahre auf 1,3 Millionen. Berlin gehört mit London und Paris zu den boomenden Metropolen. Die Stadt an der Spree gilt für viele als heimliche Kulturhauptstadt Europas, vielleicht sogar weltweit. Wie dem auch sei, jedenfalls vermitteln Theater, Musicals, Literatur (Döblin, ›Berlin Alexanderplatz‹), nicht zuletzt Mode und Kino ein neues Lebensgefühl nach den Jahren der Inflation. 1928 ist in Berlin der UFA-Filmpalast eingeweiht worden mit 1.800 Sitzplätzen! Filmstars wie Hans Albers, Marlene Dietrich, Gustav Gründgens u. a. werden bald in aller Munde sein. Den ersten »Oscar« als beste Hauptdarsteller erhalten 1929 Emil Jannings und Janet Gaynor. Apropos Kino: Leo hat sich als gelernter Dekorateur und Maler von Filmplakaten für ein Koblenzer »Lichtspielhaus« ein hochwillkommenes Zubrot verdient.
Aber der wirtschaftliche Aufschwung hat auch Schattenseiten. Die soziale Situation vieler Familien bleibt problematisch. Kurt Tucholsky hat sie in der »Weltbühne« im Blick hinter die glitzernden Fassaden der »Kinderhölle Berlin« sehr anschaulich beschrieben: »Keiner hat ein Bett für sich allein. Sieben, zehn, dreizehn Menschen schlafen in einem Raum, in den kein Agrarier seine Schweine hineintreiben würde … Die glücklichen Kinder sterben. Die anderen tun so, als ob sie leben …«
Zu dieser Not gesellen sich ungeklärte politische Probleme: Die Reparationsfrage schwärt weiter. Verbunden mit der »Kriegsschuldfrage« bietet sie Rechten und Konservativen immer wieder Munition gegen die verhasste Republik. Dazu kommt die sogenannte »Dolchstoßlegende«. Sie propagiert vehement, dass die deutschen Armeen, »im Felde unbesiegt«, von hinten, das heißt von Linken und Gegnern der Monarchie in der Heimat, in die Niederlage gestoßen wurden seien (durch Streiks, vor allem die November-Revolution 1918). So wird alle Schuld an der Niederlage den Linken zugeschoben, gleichzeitig die Verantwortung der alten Eliten vertuscht. Das liegt wie eine schwere Hypothek auf der jungen Republik. Antidemokratisches Denken erhält immer neuen Nährboden – Ursachen und Wirkung der politischen Probleme werden bewusst und systematisch vertauscht.
Die bekannteste deutsche Satire-Zeitschrift, der »Simplicissimus« – schon in der Kaiserzeit eine kritische Institution – fragt in einer Karikatur mit Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten und Gruppen (Arbeitern, Soldaten, Geistlichen, Besitzbürgern, SA): »Sie tragen die Buchstaben der Firma – aber wer trägt den Geist?«15
Antidemokratisches Denken, durchsetzt mit antisemitischen Parolen auf der Rechten unterhöhlen die junge Republik. Wie Nationalsozialisten eingestellt sind, zeigt ein Beitrag von Joseph Goebbels, dem Berliner Gauleiter und Vertrauten Hitlers: »Ich bin kein Mitglied des Reichstags. Ich bin ein IdI. Ein IdF. Ein Inhaber der Immunität, ein Inhaber der Freifahrtkarte … Ein IdI hat freien Eintritt zum Reichstag ohne Vergnügungssteuer zahlen zu müssen …16 Der sogenannte »Legalitätskurs« Hitlers ist rein taktischer Natur. Die Nazis wollen die Herrschaft der Straße, aber auch die in den Parlamenten, im Reichstag und in den Landtagen. Die »nationale Revolution« soll forciert werden, ohne in die Illegalität zu geraten, sondern sich vielmehr die Gesetze zunutze machen.
Das Kalkül der Nazis im Blick auf die »nationale Revolution« geht aber zunächst nicht auf, im Gegenteil: Die NSDAP erreicht 1928 gerade einmal 2,6 Prozent der gültigen Stimmen. Das sind weniger als bei den Wahlen zum Reichstag 1924 (6,5 Prozent). Sie ist eine Splitterpartei mit gerade einmal zwölf Abgeordneten. Zum Vergleich: Die SPD als stärkste Partei hat bei diesen Wahlen 153 Mandate errungen. Eine unmittelbare Gefahr für die assimilierte jüdische Minderheit scheint in weiter Ferne zu sein.
In den Stimmen für die »Weimarer Koalition« (SPD, Zentrum und Liberale) spiegeln sich die wirtschaftliche Erholung und außenpolitische Erfolge. Vor allem die Verständigung mit Frankreich bietet neue Perspektiven, echte Lichtblicke nach Jahren der Konfrontation. Deutschland wird Mitglied im Völkerbund, und im Rheinland neigt sich, wie wir bereits gesehen haben, die ungeliebte Besatzungszeit ihrem Ende entgegen.
In den Jubel national-konservativer Blätter zum »Befreiungstag« am 22. Juli 1930 stimmt die Zeitung des Central-Verbandes »Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens« auf ihrer Titelseite17 mit der überschwänglichen Schlagzeile ein:
»Frei ist der Rhein!«
Für die Hermanns hat der Truppenabzug unerwartete, praktische Folgen.
2. Ein neues Zuhause
Kurz nach den Feiern zur »Befreiung« trifft die Familie ein harter Schlag. Zunächst scheint es nur eine schwere Erkältung, ein Infekt, zu sein: Kurt hat hohes Fieber, seine Gelenke schmerzen. Aber nach einer Woche kann er sich kaum noch bewegen. Er versucht aufzustehen; ein erster Gang nach draußen endet bereits nach kurzer Zeit. Kurt stürzt, kann sich nicht mehr halten und fällt auf den Bürgersteig. Nachbarn tragen ihn ins Haus zurück. Sein Zustand bessert sich nicht. Im Gegenteil, er fühlt sich »wie ein Embryo mit angezogenen Armen und Beinen, unbeweglich, immer mehr abmagernd …«18 Ein »Nervenarzt« wird hinzugezogen, der »Muskel- und Gelenkrheumatismus« diagnostiziert. Aber Fangopackungen und Bestrahlungen bringen keine Linderung. Nach zwei Monaten ziehen die Eltern auswärtige Spezialisten hinzu. Leo lädt ein Ärzteteam nach Hause ein. Die Ärzte tauschen sich aus. Nach einiger Zeit hört Kurt im Nachbarzimmer die Stimme seines Vaters: »Meine Herrschaften, ich möchte bei aller Geduld nun doch reinen Wein eingeschenkt haben. Nach einer Weile versteht der junge Patient aus dem anderen Zimmer die Worte: »Es handelt sich um Polio, spinale Kinderlähmung … es muss mit teilweiser, wenn nicht totaler Lähmung gerechnet werden.« Eine niederschmetternde Diagnose, deren Tragweite nur schwer zu verstehen ist. Was soll jetzt geschehen? Die Ärzte empfehlen als ersten Schritt dringend einen Wohnungswechsel. Das Haus in der Mainzerstraße sei durch die direkte Nähe zum Rhein zu feucht, um den Heilungsprozess zu fördern.
Sofort machen sich die besorgten Eltern auf die Suche nach einer neuen, geeigneten Wohnung. Die Aussichten in der Südlichen Vorstadt bleiben zu können sind nicht schlecht. Denn durch den Abzug der Franzosen werden eine ganze Reihe gerade fertig gestellter Wohnungen frei, ganz in der Nähe des Evangelischen Stifts, eines Krankenhauses. Direkt gegenüber des Hospitals gibt es mehrere Häuser mit Hochparterre, schmucken Balkonen und Eingangsportalen. Ursprünglich gebaut für französische Offiziersfamilien, sind die Wohnungen nun frei. Die Hermanns sind unter denen, die dort ein neues Zuhause finden. Im Dezember 1929 ziehen sie in der Johannes-Müller-Straße 6 ein.
Hannelore mit ihren beiden Brüdern in der Johannes-Müller-Straße. Aus dem Fenster links unten schaut Johanna auf ihre Kinder.
Das mehrstöckige, helle Haus in dem die Hermanns jetzt leben, hat einen Vorgarten, umgeben von einer jungen, immergrünen Liguster-Hecke. Zwei Säulen flankieren den Treppenaufgang. Die acht großen Wohnungen verfügen über jeweils etwa 160 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf, Küche, Bad, ein Gäste-WC und vier bzw. fünf geräumige Zimmer. Ein einladender, breiter Flur führt in die Wohnung der Hermanns im Erdgeschoss. Sie bietet genügend Platz für die Familie und Käthe, die den Umzug von der Mainzerstraße noch mitgemacht hat. Aber es ist abzusehen, dass sie nicht mehr sehr lange bleiben wird, weil ihre Heirat fest geplant ist. Hannelore ahnt davon natürlich noch nichts. »Detta«, »Detta« hört man sie rufen, bevor sie Käthe in die Arme läuft.
Will man in den Garten, muss man den Weg durch den Keller nehmen. Unbequem, aber zugleich praktisch, denn Hannelore findet hier einen sicheren und schönen Spielplatz, abseits von der Straße.
Es ist nicht weit zu den Rheinanlagen, die den Hermanns ans Herz gewachsen sind; aber auch zum Hauptbahnhof ist es nur ein »Katzensprung«. Das Koblenzer Zentrum ist leicht zu erreichen, sei es am Rhein entlang oder durch die Kaiser-Friedrich-Allee (Südallee) über den Kaiser-Wilhelm-Ring in die Straßen und Gassen der Altstadt. In Kurts Erinnerung ist mit dem Umzug nicht nur eine »geographische, sondern auch eine gesellschaftliche Änderung verbunden, »selbst wenn wir uns dessen nicht so bewusst waren«. In der gleichen Straße hat Harald Schloss mit seiner Mutter gelebt. Der allerdings sieht die »gesellschaftliche Änderung« keineswegs so positiv. Der Grund liegt darin, dass seine Familie ihr Haus in der Adamstraße verlassen und eine Mietwohnung beziehen muss. Haralds Vater »war in der Leitung von Tietz (heute Kaufhof in der Löhrstraße) und sein Großvater war Mitbegründer« des Kaufhauskonzerns, wie Kurt vermerkt. Als weiteres Beispiel neuer Nachbarn aus angesehenen jüdischen Familien der Stadt erinnert er sich an Ossi Gottschalk, dessen Eltern ein Bekleidungshaus in der Altstadt haben. Ossi wohnt gleich um die Ecke, im Markenbildchenweg.19
Wenn es stimmt, dass Kinder ein Haus erst richtig kennen, wenn sie seine Ecken und Winkel durchstöbert und überall Spielmöglichkeiten gefunden haben, dann hat Kurt das mit Georg Gahr, seinem Freund aus der zweiten Etage, ausgiebig getan. Er erzählt von einem ganz besonderen Streich: »Ein Spiel, das damals sehr in Mode war, war das Weitspucken mit allen möglichen Finessen. Von unserem Hochparterre führten sechs Stufen hinab zur Haustür und von dieser weitere fünf Stufen zum Bürgersteig, an dessen Rand eine Laterne stand, die bald das Ziel unseres ›Spuck-Wettbewerbes‹ war. Als das zu langweilig wurde, kam eine weitere ›Feinheit‹ dazu. Der Spucker hatte auf der untersten Stufe zu stehen, die ›Munition schussbereit‹, das heißt spuckbereit. Der andere machte dann blitzschnell die Haustür auf und zu, und in der Zeit musste das Ziel, die Laterne, getroffen werden. Jeder hatte drei Versuche, dann wurde getauscht. Eines Tages war ich gerade ›am Schuss‹. Georg riss die Türe auf, der Schuss löste sich und traf genau den für Vereinsabzeichen rechten Punkt an der Jacke des Studienrates …« Pech, dass dieser der Klassenlehrer Dr. Scherhag von den beiden »Schützen« gewesen ist. »Ich weiß bis heute nicht,« meint Kurt, »wer mehr verdutzt war. Jedenfalls fand der Studienrat als Erster die Sprache wieder und brüllte: ›Abwischen, ihr Lümmel‹ …was den Flecken aber nur vergrößerte.«20
Die kleine Episode führt schon über die ersten Monate nach dem Umzug der Hermanns hinaus. Sie sind geprägt vom hartnäckigen Kampf Kurts endlich wieder seine Gesundheit und Beweglichkeit zu gewinnen. Sogar die kleine Schwester leistet dazu in Kurts Erinnerung unbewusst einen Beitrag: »Ich kam bald dahinter, dass ich mit dem Kinderwagen ohne Stock gehen konnte, und diesen Umstand ausnützend, immer weitere und längere Spaziergänge mit Hannelore machte. Meine Eltern unterstützen diese ausgebreiteten Spaziergänge, die uns beiden wohltaten.«21
Die Familie hat mittlerweile einen neuen Hausarzt und den Vorteil, dass der seine Praxis näher zur Wohnung hat. Der Weg in die Kurfürstenstraße verlangt dem Zwölfjährigen alles ab. Nur auf Krücken kann er sich allmählich alleine fortbewegen zur Elektromassage, einer neuen Therapie. Mehrmals in der Woche humpelt er zu Dr. Than und seiner »bildhübschen, schwarzhaarigen Assistentin«. Deren regelmäßige Muskelübungen bleiben noch nach Jahrzehnten in guter Erinnerung. Und langsam, Schritt für Schritt geht es dem Patienten besser. Insgesamt dauert der Heilungsprozess, getragen vom starken Willen gesund zu werden, nicht weniger als neun Monate! Danach kann an eine Rückkehr in die Schule gedacht werden. Trotz erheblicher Rückstände, vor allem in Latein und Mathematik, wagt Kurt zusammen mit seinen Lehrern den Versuch in seiner Klasse zu beginnen. »Gummi-Mann« nennen ihn seine Mitschüler in der sechsten Klasse und behalten diesen Spitznamen bei, als er sich längst wieder ohne Gehhilfen bewegen kann. Gefördert wird er dabei insbesondere von seinem Sportlehrer Gerstung. Kleine Fortschritte des vorher guten Turners und Leichtathleten Kurt werden aufmerksam wahrgenommen und in das Aufbauprogramm integriert. Selbstverständlich gehört der Junge wieder zur Fußball- und Handballmannschaft in seiner Schule, sobald das möglich ist.
Im Sommer 1930 verlässt Käthe die Familie, um einen eigenen Hausstand zu gründen. Sie hat ihren Straßenbahnführer aus der Mainzerstraße geheiratet. Wer soll ihre Nachfolgerin werden? Eine Frau mit Kenntnissen in Haushaltsführung und Empathie, vor allem für die Kleine, die mit ihrem fröhlichen Wesen ein richtiger »Sonnenschein« ist. Selbst »im grauen Alltag«, wie Kurt in einem Gedicht für seine Schwester schreibt. Dort heißt es weiter:
»Am Abend sie ins Bett zu bringen, was konnte da schöner sein; ihr schöne Lieder vorzusingen, wie oft schlief ich selber dabei ein …«22
Das folgende Bild zeigt Hannelore bei einem Spaziergang im Alter von vier Jahren, fröhlich lächelnd mit einem modischen weißen »Berri«. Wer wird sie künftig bei den kleinen Ausflügen begleiten und Johanna bei der Arbeit zu Hause tatkräftig unterstützen? Es ist ganz schön schwer, Käthe zu ersetzen, die allen in der Familie vertraut geworden ist.
Hannelore bei einem Spaziergang.
Die Eltern entscheiden sich für eine junge Frau aus der Vulkaneifel als Käthes Nachfolgerin. Die aparte, schwarzhaarige Irma Lohr kommt aus Obermendig und beginnt am 1. September 1930 ihren Dienst in der Johannes-Müller-Straße. Bald zeigt sich, dass Leo und Johanna eine gute Wahl getroffen haben. »Irma war nicht nur eine sehr gute Schülerin meiner Mutter in der Kochkunst. Die vielfachen Arbeiten des Haushalts gingen ihr leicht von der Hand und stets war Gesang und gute Laune in ihrer Umgebung«, schwärmt Kurt von der jungen Frau, die jetzt mit der Familie zusammen lebt. Wenn Hannelore ihr etwas zeigen möchte, hört man im großen Flur oder aus einer anderen Ecke der Wohnung wie vorher bei Käthe ein lautes, frohes »Detta!«
Schon nach wenigen Monaten stellt sich heraus, dass die Mutter mehr Zeit hat, freie Zeit, die sie nutzen möchte. Gemeinsam kommen Hanna und Leo zu dem Schluss: Wir eröffnen ein eigenes Geschäft!
Johannas »Strumpfecke«
Ein »Spezialladen für Damen und Herren« soll es werden, in dem Waren geführt werden, die Leo als Vertreter schon seit einigen Jahren anbietet, unterwegs zu Kunden im Rheinland und darüber hinaus. Nach einigem Suchen finden Leo und seine Frau etwas Passendes in der Innenstadt um das Geschäft zu eröffnen. Es liegt direkt gegenüber dem Warenhaus Tietz (heute Kaufhof). Für die Hermanns ist diese Platzwahl ziemlich mutig. Denn da ist nicht nur die Konkurrenz eines gut eingeführten Hauses mit seinem großen Sortiment. Schwierigkeiten kommen noch von ganz anders her. Die Weltwirtschaftskrise hinterlässt bereits ihre verhängnisvollen Spuren: Die Arbeitslosigkeit steigt, die Kaufkraft sinkt. Auf der Habenseite können die Hermanns immerhin verbuchen, dass keine Vertreterprovisionen anfallen. Außerdem kann Leo seine Fähigkeiten als Dekorateur entfalten. Beide machen sich mit Eifer an die Sache. Regale werden frisch gestrichen, die Verkaufstische auf Vordermann gebracht, schließlich die Beleuchtung erneuert. Aber dann ist es soweit: Über dem Eingang des Geschäfts hängt zur Eröffnung ein akkurat beschriebenes Glas-Schild: »Strumpfecke – Inhaberin Johanna Hermann«.
Der Laden mit einem großen Schaufenster zur Löhr- und zwei kleineren zur Fischelstraße hin fordert von den Eltern, erklärt Kurt, vollen Einsatz: »Es gab Nächte, wo stundenlang um Pfennige gerechnet wurde …«23 Die Idee der Hermanns ist, gute Ware möglichst günstig anzubieten. Der »Schlager«, so stellt sich bald heraus, »sind Damenstrümpfe für 99 Pfennige das Paar. Da bestätigte sich das Lieblingssprichwort meines Vaters: ›Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert!‹«