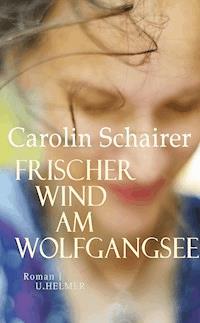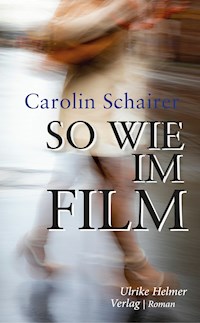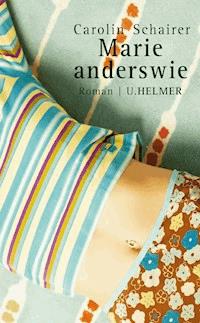12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein alter Bauernhof im Bayerischen Wald birgt düstere Geheimnisse. Als die Bäuerin stirbt, kommen sie ans Licht. — Isabella und Jan, die Enkel der Bäuerin, leben längst in der Stadt. Mit dem Sommer, den sie als Jugendliche auf dem Hof verbracht haben, verbinden sie dunkelste Erinnerungen. Als sie zur Beerdigung der Großmutter zurückkehren, beginnt für sie eine harte Reise in die Vergangenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
CAROLIN SCHAIRER
Wir werden niemals darüber reden
Kriminalroman
ISBN eBook 978-3-89741-966-7ISBN Print 978-3-89741-347-4
© 2017 eBook nach der Originalausgabe in CRiMiNA.CRiMiNA ist ein Imprint des Ulrike Helmer Verlags, Sulzbach/Taunus© Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach/Taunus 2013Alle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Atelier KatarinaS unter Verwendung des Fotos»Kätzchen auf dem Arm« © Viktor Isaak – Fotolia.com
E-Mail: [email protected]
Inhalt
Ingolstadt, Juni 1990
Nizza, April 2011
Köln, April 2011
Berlin, April 2011
Köln, April 2011
Fichtenwinkel, Landkreis Freyung-Grafenau, Juli 1990
Fichtenwinkel, April 2011
Köln, April 2011
Berlin, April 2011
Köln, April 2011
Fichtenwinkel, August 1990
Köln, April 2011
Fichtenwinkel, April 2011
Fichtenwinkel, Anfang September 1990
Fichtenwinkel, April 2011
Fichtenwinkel, Anfang September 1990
Fichtenwinkel, April 2011
Über den Autor
Ingolstadt, Juni 1990
Zum dritten Mal betätigte Isabell die Haustürglocke und lauschte dem melodischen Kling-Klong, bis es im Nichts verhallte wie die beiden Male davor.
Seufzend stellte sie die Schultasche zu Boden und hockte sich auf die kleine Treppe vor dem Hauseingang. Die sonnenheißen Fliesen brannten ihr unter den Oberschenkeln. Schnell rutschte sie ganz nach links, um etwas von dem Schatten zu erhaschen, den das Garagendach abwarf, und verfluchte sich selbst.
Warum hatte sie Jan nicht um den Hausschlüssel gebeten, ehe sie an der Bushaltestelle auseinandergegangen waren? – Sie gab sich die Antwort selbst: Weil sie fest damit gerechnet hatte, dass Mama zu Hause war.
Isabell stützte ihre Ellbogen auf die nackten Knie und schob das Kinn in die Handflächen, während ihr Blick die Straße entlang glitt. Vor ihren Augen rührte sich nichts. Die kleinen Vorgärten wirkten in der Mittagshitze wie ausgestorben.
Ich verabschiede mich nur noch von Lisa, dann komme ich sowieso heim, hatte Jan erklärt. Du kannst ja schon voraus gehen, damit sich Mama keine Sorgen macht.
Loswerden hatte er sie wollen. Klar. Sie war zwar fünf Jahre jünger als er, aber das hieß nun wirklich nicht, dass Dreizehnjährige dumm wären! Seit sechs Wochen hing er jede freie Minute mit dieser Lisa aus der 9b herum. Früher war es kein Problem gewesen, wenn sie sich mit ihren Freundinnen zu ihm und seiner Clique im Freibad gesellt hatte. Seit sechs Wochen trennten sich ihre Wege am Einlass.
Stell nichts an, hatte er neulich zu allem Überdruss zu ihr gesagt. Isabell fasste sich an die Stirn und schnaubte halb vor Empörung, halb weil ihr so heiß war. Die Sonne brannte inzwischen unbarmherzig auf den gesamten Eingang herab.
Ihre Kehle war staubtrocken.
Sie erhob sich und ging hinüber zur Garage, wo das Vordach noch einen letzten kleinen Schatten warf.
Unterwegs versetzte sie der Mülltonne einen wütenden Tritt. Blöde Lisa! Es war im Grunde deren Schuld, dass sie hier vor der Haustüre warten musste.
Während sie sich mit dem Rücken an die schattige Garagenmauer sinken ließ, erfüllte sie eine plötzliche Genugtuung: Bald waren Sommerferien. Dann würden sie erst einmal für drei Wochen nach Italien fahren. Mit dem Campingbus von Papas Kollegen. Und sie würde Jan in diesen drei Wochen wieder ganz für sich haben.
Warum um alles in der Welt hörte Mama ihr Klingeln denn nicht? Oder war sie ausgegangen?
Isabell reckte sich zu dem kleinen Fenster in der Seitenwand der Garage, um einen Blick ins Innere zu werfen. Der Wagen ihrer Mutter stand da, wo er immer stand.
Ein letztes Mal lief sie hinüber zur Haustür, klingelte stürmisch, wartete, ohne dass sich drinnen etwas regte, und rannte zurück in den Schatten. Sie verstand das nicht. Wieso ließ Mama sie heute so lange vor der Tür stehen? Wann kam Jan endlich?
Isabell spürte, wie ihr die Zunge am Gaumen klebte. Ihr wurde schwindelig, wenn sie an die Getränke im Kühlschrank dachte. Wie konnte sie ins Haus gelangen? Oder wenigstens auf die Terrasse, zu dem Wasserhahn, an dem ihr Vater den Schlauch befestigte, mit dem er abends die Blumenbeete goss? Sicher hatte Papa am Abend wieder vergessen, die Liegestühle in das neue Gartenhäuschen zu räumen – ein Glücksfall für sie. Bald würde sie ihren Durst am Hahn stillen und auf der schattigen Terrasse liegen können. Beflügelt von der Idee, kletterte sie zum ersten Mal in ihrem Leben über den Gartenzaun.
Hinter dem Haus erwartete sie ein Bild des Friedens. Die Jalousie war ausgefahren, die beiden Liegestühle standen bereit. An der Wäschespinne trockneten Leintücher in der Sonne. Die rote Plastikwanne, mit der Mama frische Wäsche nach draußen trug, leuchtete wie ein farbiges Osterei auf dem grünen, gepflegten Rasen. Ein rotes Osterei mit einem weißen Klecks in der Mitte. Der weiße Klecks war ein einzelner Kissenbezug.
Isabell bückte sich. Der Kissenbezug war noch feucht. Er duftete nach Weichspüler.
Den Rosenduft noch in der Nase, näherte sie sich der Terrasse, öffnete den Wasserhahn, hielt den Mund direkt in den Strahl und trank in gierigen Schlucken, als ihr Blick auf die Glastüre zum Wohnzimmer fiel.
Sie stand offen.
»Mama?«
Eilig durchquerte Isabell das Wohnzimmer. Ihre Sandalen klapperten auf den weißen Fliesen.
Im Flur verharrte sie. Es war still im Haus, ungewöhnlich still.
Aufgeregt setzte sie sich auf die Couch, während ihr Verstand auf Hochtouren arbeitete.
Die offene Terrassentüre, der Kissenbezug in der Plastikwanne … Mama konnte nicht einfach weggegangen sein. Sie musste hier irgendwo im Haus stecken.
Eine kurze Szene huschte durch ihr Gedächtnis: Ihre Mutter, tränenüberströmt. Ihr Vater, der auf sie einredete mit dem Blick eines verängstigten Tieres.
Wann war das gewesen? Gestern oder vorgestern? Gestern und vorgestern? Vergangene Woche?
Obwohl ihr Durst gestillt war, brannte ihre Kehle nun stärker als zuvor. Zwei Stufen auf einmal nehmend, hastete sie die Treppe hinauf ins Obergeschoß.
»Mama?«
Ein Miauen war die Antwort. Gleichzeitig spürte Isabell weiches Fell an ihren nackten Beinen.
Automatisch bückte sie sich.
»Tabby!« Sie fuhr mit den Fingern durch das schwarz-weiß gefleckte Fell. Die Katze begann zu schnurren.
»Weißt du, wo Mama steckt? Hmm?«
Die Katze sah sie mit ihren grünen Augen fragend an und schnurrte noch lauter.
Isabell kauerte sich neben das Tier auf den gefliesten Boden. Sein gleichmäßiges Schnurren beruhigte sie.
Tabby setzte sich vor sie hin und begann ausgiebig, ihre Pfoten zu lecken.
Seufzend stand Isabell auf. Sie wollte ihre Suche gerade fortsetzen, als sie die Abdrücke auf den hellen Fliesen sah: eine braune Spur von Katzenpfoten.
Die Spur führte zum Badezimmer. Je näher sie ihm kam, desto mehr änderte sich die Farbe der Abdrücke. An der Schwelle hatten sie bereits ein sattes Rot.
Isabell stieß die halb angelehnte Türe zum Bad auf.
Erst Minuten später löste sich der Schrei, mit dem auch die Lähmung von ihr abfiel. Schreiend lief sie die Treppe hinunter, schreiend riss sie die Haustür auf und rannte hinaus auf die Straße, wo sie direkt in Jans Arme sank.
»Eindeutig Selbstmord. Wir können Fremdverschulden ausschließen. Herr Ulbrich, gab es irgendwelche Vorzeichen für die Tat?«
»Nein … ich … Es gibt keinen Abschiedsbrief. Sie war … es ging ihr gut!«
»Es war doch nicht das erste Mal, oder? Wir haben die Narben an ihren Armen gesehen.«
»Das … ist … ist etwas anderes. Sie wollte sich nicht umbringen, sie hat nur … Es ging ihr gut, verdammt!«
»War ihre Frau in psychologischer Betreuung?«
»Nein … nein, früher … es gab da eine Zeit … aber seit wir in diesem Haus wohnen, seit dem Umzug war alles gut. Heute Morgen … wir haben uns voneinander verabschiedet, es war alles gut.«
Jan stand im Hausgang, reglos hielt er den Kopf gegen die Wand gepresst. Seit einer Viertelstunde sprachen die beiden Polizisten mit seinem Vater und suchten nach einer Erklärung dafür, weshalb sich seine Mutter das Leben genommen hatte.
Wäre es nach Jan gegangen, säße er drinnen neben dem Vater auf dem Sofa, doch diese Wahl hatten ihm die Polizisten nicht gelassen. Mit Ihnen werden wir später Kontakt aufnehmen, hatten sie ihm gesagt. Ruhen Sie sich etwas aus. Sie haben für heute genug gesehen.
Genug gesehen, das traf es wohl. Jan dachte an den Anblick, der sich ihm geboten hatte: Blut, überall Blut, und seine Mutter mittendrin, blass, leblos, wunderschön, neben sich das Küchenmesser, ihr dunkles Haar rahmte das schmale Gesicht.
Ihm hatte ein Kloß in der Kehle gesessen und Tränen in den Augen, aber er war seltsam ruhig geblieben. Kein Ton war ihm über die Lippen gekommen. Noch ehe er nach ihrem Puls getastet hatte, wusste er, dass es zwecklos war. In seinem Kopf wiederholte eine monotone Stimme einen Lehrbuchsatz aus dem Erste-Hilfe-Kurs, den er einmal absolviert hatte. Ein Mensch, der sich die Pulsadern längs durchtrennt, verblutet, sofern er nicht rechtzeitig verarztet wird.
Er hatte als Erstes die Polizei verständigt und dann seinen Vater, beides mit ruhiger Stimme. Dann hatte er sich um Isabell gekümmert. Gemeinsam hatten sie gewartet.
Jan hörte seinen Vater nebenan schluchzen. Sein Magen zog sich zusammen. Noch nie hatte er ihn weinen sehen, und er wollte es auch jetzt nicht erleben.
Langsam stieg er die Treppe nach oben, die Treppe, auf der sie die Leiche seiner Mutter vor rund einer Stunde hinabgetragen hatten. Oben warf er einen Blick vom Gang hinaus auf die Straße, bedacht darauf, sich nicht zu lange am Fenster zu zeigen. Die Menschenansammlung vor ihrem Haus hatte sich inzwischen wieder aufgelöst. Streifenwagen, Rettungsdienst, schließlich gar noch der Leichenwagen hatten die Nachbarn angezogen wie Magneten. Eine Frau, die kurz nach der Polizei eingetroffen war, hatte die Leute mit einer kurzen Erklärung weggeschickt. Jan wusste, dass sie den Nachbarn die Wahrheit gesagt hatte; er hatte auch gehört, dass sein Vater damit einverstanden gewesen war. Tun Sie, was Sie für richtig halten, hatte der ihr knapp beschieden. Es lässt sich ohnehin nicht verheimlichen.
Die Frau war Psychologin, was Jan befürchten ließ, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis sich zudringliche Fürsorglichkeit über ihn ergoss. Was war anderes zu erwarten von einer, die von der Polizei losgeschickt wurde, um Opfer oder deren Angehörige zu betreuen, wenn sich irgendwo Naturkatastrophen ereigneten, Bomben hochgingen, Geiseln genommen wurden oder eben, wenn jemand seinem Leben ein Ende setzte? Zu seiner Erleichterung trat die Frau ihm gegenüber nüchtern und sachlich auf. Mit Mitleidsbekundungen hätte er im Moment nicht umgehen können.
Mit Isabell war sie emotionaler gewesen, hatte besänftigend auf sie eingeredet. Doch Isabell hatte überhaupt nicht auf sie reagiert, sondern war schluchzend unter ihren Schreibtisch gekrochen. Die Psychologin wollte sie schließlich in eine Klinik einweisen lassen – »nur über Nacht, damit sie unter psychologischer Betreuung ist«, doch daraufhin hatte Isabell sich an ein Bein ihres Tisches geklammert und so sehr zu zittern begonnen, dass die Frau einen Arzt rief.
Mit vereinten Kräften hatten ihr Vater, der Arzt und die Psychologin Isabell schließlich unter dem Schreibtisch hervorgezerrt. Jan war aus dem Zimmer gerannt, weil er den Anblick seiner zitternden, wild kreischenden und strampelnden Schwester, die von drei Erwachsenen gewaltsam auf den Boden niedergedrückt wurde, nicht ertragen konnte.
Jetzt lag sie im Bett und schlief, betäubt von einer Beruhigungsspritze. Sie trug noch immer die kurze Hose und das bunte Trägerhemd, in denen sie aus der Schule gekommen war; lediglich die Sandalen hatten sie ihr ausgezogen. Lange Haarsträhnen klebten auf ihrem verschwitzten Gesicht.
Jan öffnete das Zimmerfenster. Heiße Luft schlug ihm entgegen, aber alles war besser als die drückende Schwüle, die über dem Raum lastete.
Von Isabells Fenster aus fiel sein Blick auf den Garten und das angrenzende Grundstück. Marlies Rieder, die Nachbarin, saß auf ihrer Terrasse und sprach aufgeregt auf eine andere Frau ein. Beide starrten dabei immer wieder zu ihnen herüber. Schnell trat Jan einen Schritt zurück.
Es würde über Wochen das Nachbarschaftsthema Nummer eins sein.
In diesem Moment wünschte er sich, wieder in jenem Betonblock zu wohnen, in dem er die ersten dreizehn Jahre seines Lebens verbracht hatte. Die Wohnung war klein gewesen und er hatte sich mit Isabell ein Zimmer teilen müssen, aber immerhin kümmerten sich die Nachbarn meist nur um ihre eigenen Probleme, denn davon hatten sie selbst genug.
Es war die Idee seiner Mutter gewesen, umzuziehen. Sie könne hier nicht mehr glücklich sein, hatte sie immer wieder beteuert. Die Enge und der Lärm der Nachbarn machten sie krank. Sie wolle ein eigenes Haus haben, mit einem Garten, in dem sie Blumen anpflanzen konnte.
Die Eltern hatten in dieser Zeit viel diskutiert: über Finanzierung, über Ersparnisse, über Sicherheiten. Darüber, dass ein Haus viel Arbeit machte, und über die Frage, ob die Mutter alldem überhaupt gewachsen war.
Sein Vater war von Anfang an skeptisch gewesen, und Jan konnte das gut verstehen. Seine Mutter war nicht stabil. Den Ausdruck hatte er von Ärzten aufgeschnappt, damals im Krankenhaus, als sie sich endlich zu einer stationären Therapie hatte überreden lassen, die sie nach zwei Wochen dann doch wieder abbrach. Jedes Mal, wenn er in den Wochen danach den Badezimmerboden und das Waschbecken von ihrem Blut säuberte und die blutigen Rasierklingen im Abfalleimer entsorgte, hallte der Satz in ihm wider. Jedes Mal, wenn er anschließend seinen Vater in der Arbeit anrief und über das Geschehene in Kenntnis setzte, hatte er sich dieser Worte bedient.
Mama ist nicht stabil.
Das klang besser als: Mama hat sich wieder geritzt.
Letztendlich hatte sich seine Mutter mit ihrem Wunsch nach einem eigenen Zuhause dennoch durchgesetzt. Vielleicht war sein Vater auch voller Hoffnung gewesen, alles würde aufhören, wenn er ihr hier entgegenkam? Jan wusste es nicht.
Irgendwann hatten sie jedenfalls das Grundstück gekauft. Während der Bauphase war alles noch schlimmer geworden. Dauerregen, der die Arbeiten verzögerte, ein Handwerker, der den Termin nicht einhielt, eine undichte Rohrleitung – auf dem Bau traten immer wieder neue Pannen auf. Mutter war in dieser Zeit sehr oft nicht stabil gewesen, derweil sich der Vater zwischen seinem Arbeitsplatz, der Baustelle und dem Krankenhaus zerriss. Schlecht hatte er ausgesehen, mit eingefallenen Wangen und Tränensäcken unter den Augen.
Irgendwann war Jan die ganze verdammte Idee mit dem eigenen Haus gründlich zuwider und er hielt sich nur noch an das, was er mit seinen dreizehn Jahren hatte tun können: sich um seine kleine Schwester kümmern. Je weniger Isabell von der Situation mitbekam, desto besser. Für eine Achtjährige hatte sie damals sowieso schon genug mitbekommen.
Aber das lag nun ganze fünf Jahre zurück. Inzwischen hatte sich alles eingespielt: keine Baustelle mehr, keine Handwerker, dafür das Haus mit Garten, den die Mutter liebevoll pflegte. Wenn sein Vater vorhin davon gesprochen hatte, dass alles gut war, dann war das an sich keine Lüge.
»Jan?« Gregor Ulbrich streckte den Kopf zur Türe hinein. Seine Augen waren gerötet, er wirkte älter denn je. »Hier steckst du. – Die Polizei hat noch eine Frage.«
Er flüsterte, obwohl es nicht nötig war. Das Beruhigungsmittel, das der Arzt Isabell verabreicht hatte, würde sie noch mindestens weitere acht Stunden im Tiefschlaf halten.
Die Beamten standen noch immer im Wohnzimmer. Als Jan eintrat, studierte einer von ihnen die Titel der Buchrücken im Bücherregal, der andere war über die Familienfotos auf dem Klavier gebeugt. Als er sich aufrichtete und ihm zuwandte, fühlte sich Jan merkwürdig nackt. So, als wüsste der Mann alles über ihn.
»Kurz bevor Ihre Mutter … nun, Sie wissen schon … äh … aus dem Leben geschieden ist, hat sie einen Anruf von einer anonymen Rufnummer empfangen«, teilte ihnen der junge Polizist nun mit und wich dabei Jans Blick aus. »Wir haben den Anruf zurückverfolgen können. Er kam aus einer Telefonzelle in Neumarkt. Haben Sie eine Ahnung, wer Ihre Mutter von dort angerufen haben könnte?«
»Christiane kannte niemanden aus Neumarkt«, sagte Jans Vater, noch ehe er selbst etwas erwidern konnte. »Sie kam aus der Nähe von Passau, das ist Kilometer weit davon entfernt. Sie war noch nie in Neumarkt.«
»Woher wollen Sie das so genau wissen?« Der andere Beamte, deutlich älter als sein Kollege, schaltete sich ein.
»Weil ich es weiß. Ich bin … ich war schließlich ihr Mann.«
Jans Vater schob seine dunkel gerahmte Brille nach oben, die ihm ins Gesicht gerutscht war.
»Sie werden sie wohl kaum vierundzwanzig Stunden am Tag überwacht haben«, brummte der jüngere Beamte. Der ältere machte eine beschwichtigende Geste und warf seinem Kollegen einen mahnenden Blick zu.
»Ich kann verstehen, wie es Ihnen geht, Herr Ulbrich. Es ist eine sehr schwierige Situation für Sie und … Ihre Kinder. Ich glaube aber, es ist auch in Ihrem Interesse, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, was die Umstände des Selbstmordes Ihrer Frau betrifft. Sie sagen uns seit einer Stunde, dass alles gut war; trotzdem nimmt sie sich das Leben. Und das, kurz nachdem sie einen Anruf aus Neumarkt erhalten hat.«
»Ich bin sicher, dass Christiane niemanden aus Neumarkt kannte.« Jans Vater starrte mit leerem Blick hinaus in den Garten. »Wir haben uns in der Nähe von Salzburg kennengelernt, in einem Hotel. Sie war dort an der Rezeption. Davor hat sie in Hotels in Frankfurt und Tirol gearbeitet.«
»Was ist mit Kollegen, Bekannten, Freunden?«
»Christiane ist eine Einzelgängerin.«
»Und Sie?« Der ältere Beamte wandte sich nun direkt an Jan. »Irgendeine Idee, wer angerufen haben könnte?«
»Nein.«
Der Polizist reichte Gregor Ulbrich eine Visitenkarte.
»Sollte Ihnen doch noch etwas einfallen, können Sie sich gerne melden.« Er musterte den Mann, der reglos vor ihm stand und die Karte steif zwischen seinen Fingern hielt. Dann fuhr er sich nachdenklich durchs Haar. »Wir werden die Kollegen in Neumarkt jedenfalls bitten, sich umzuhören, wer um die Mittagszeit von dieser Telefonzelle aus telefoniert hat. Angeblich liegt sie an einem belebten Platz; vielleicht ist den Inhabern der umliegenden Geschäfte irgendjemand aufgefallen.«
»Es war doch alles gut«, sagte Jans Vater. Seine Stimme klang brüchig, und er kämpfte wieder mit den Tränen. Jan wandte sich ab.
Als die Polizisten gegangen waren, warf Ulbrich die Karte in den Müllkorb.
Isabell kroch noch tiefer unter den Schreibtisch, bis ihr Rücken die weiße, kalte Wand berührte. Sie zog den Kopf ein und bedeckte ihre Ohren mit beiden Händen.
Jans unerbittliche Stimme drang dennoch zu ihr vor.
»Komm da raus, Bella!«
Seit einer halben Stunde kniete er vor dem Tisch und redete auf sie ein. In seinen anfangs so geduldigen Tonfall schlich sich allmählich das, was Isabell am wenigsten ertragen konnte: Enttäuschung.
Warum verstand er nicht, dass sie einfach keine Wahl hatte? Dass sie nicht herauskommen konnte? Sie musste sich verstecken, musste sich verkriechen vor all diesen Dingen, zu denen sie gezwungen werden sollte: Frühstücken. Zähne putzen. Sich anziehen. Mittag essen. Regelmäßig trinken …
Vor allem musste sie sich vor dieser Frau verstecken, die immerzu wollte, dass sie mit ihr über ihre Gefühle sprach. Dreimal war sie bisher bei ihnen gewesen in diesen zehn Tagen, die seit dem Tod ihrer Mutter vergangen waren, hatte mit dem Vater gesprochen und mit Jan, und sie hatte immer wieder versucht, auch mit ihr zu sprechen.
Doch Isabell war bisher kein Wort über die Lippen gekommen. Sie hatte still vor der Frau gesessen, durch sie hindurch gesehen und an die Elfen und Feen aus jenen Märchen gedacht, mit denen sie seit Jahren ein Blatt Papier nach dem anderen füllte – ihre Märchen, in denen es darum ging, Feen aus den Händen böser Magier zu befreien und Prinzessinnen zu retten, die mit einem Fluch belegt worden waren.
Die Welt ihrer Feen war zerstört worden. Sie musste ihnen ein neues Zuhause geben. Aber wo?
Mit ihrem Vater wollte sie reden, doch wenn sie morgens seine rot geweinten Augen sah, schnürte es ihr die Kehle zu, und sie spürte dieses drückende Gefühl im Magen, das ihr jeglichen Appetit raubte.
Sie wollte auch mit Jan sprechen. Aber ihr Kopf war leer und ihre Stimme weg.
»Bella, du musst dir die Zähne putzen. Du musst dich waschen. Du hast dich seit Tagen nicht mehr geduscht.«
Sie steckte die Finger in die Ohren.
»Hör mal, Bella.« Jan schob sich auf Knien über den Boden und rutschte unter die Schreibtischkante. Isabell presste sich noch enger gegen die Wand.
»Papa und ich hatten Mama genauso lieb wie du. Aber wir können sie nicht wieder lebendig machen; das geht einfach nicht.«
Isabell drehte ihr Gesicht von ihm weg.
»Du machst uns auch traurig, wenn du dich so verhältst.«
Er legte seine Hand auf ihren Arm. Sie schüttelte sie ab.
Jan seufzte. Er erhob sich.
»Papa!« Seine Stimme erfüllte das ganze Haus. »Kommst du? – Isabell will sich wieder nicht waschen.«
Isabell wusste, was nun folgen würde. Sie umklammerte das hinterste Tischbein. Ihr Vater kroch unter den Tisch, so weit es ihm möglich war, und zog an ihrem Arm.
»Puppi, komm, du musst dich waschen, du musst dich doch waschen …«
Sie stieß ihn weg. Durch ihren unerwarteten Stoß überrascht, setzte er sich auf – und stieß prompt mit seinem Kopf gegen die Schreibtischplatte.
»Verdammt! Komm jetzt raus, Bella! Ich habe keine Zeit für diese Faxen, ich muss zu einem Kunden!«
Fluchend packte er sie am Bein, dem einzigen Körperteil, dessen er habhaft werden konnte, und zog kräftig daran. Isabell spreizte sich, doch ihre Kraft reichte nicht aus. Als er sie schon fast vollständig herausgezogen hatte, umfasste sie in letzter Sekunde das rechte äußere Tischbein und hielt sich eisern daran fest. Ihr Vater zerrte ungeachtet ihres Widerstands weiter; der Schreibtisch wackelte bedrohlich.
Als Gregor Ulbrich bemerkte, dass der Tisch ins Kippen kam, ließ er abrupt los. In letzter Sekunde konnte sich Isabell zur Seite rollen, ehe der Tisch mit lautem Krachen auf dem Parkettboden aufschlug. Ihre Stifte, der Radiergummi, der Locher, die Schere und all die losen, dicht beschriebenen Blätter, die sie so sorgsam zu Stapeln sortiert hatte, verteilten sich im ganzen Zimmer.
Isabell schrie auf. Mit panischer Hast begann sie, die Blätter einzusammeln. Ihre Elfen! Er hatte ihre Elfen mit den Hexen vermischt!
»Hör auf damit, verdammt!« Die Hände des Vaters umfassten grob ihre Schultern. Er drehte sie gewaltsam zu sich und sah ihr in die Augen. Sie blickte starr durch ihn hindurch.
»Es ist schon schwer genug, du musst nicht alles noch schlimmer machen! – Wenn du so weitermachst, kommst du doch noch in die Klinik!«
In ihrem Inneren loderte eine tiefe, nie gekannte Angst auf, in der alles, was sie für ihn in ihrem Herzen empfand, in Bruchteilen von Sekunden verbrannte. Dieser Mann war nicht mehr ihr Vater! Er war der schwarze Magier, der die Prinzessinnen mit einem Fluch belegt hatte.
Sie spuckte ihn an, die Augen voller Hass.
Die Reaktion ihres Vaters kam ebenso spontan: Er schlug ihr mitten ins Gesicht.
Fassungslos starrte Isabell ihn an. Es war das erste Mal in ihrem ganzen Leben, dass sie geschlagen worden war, und der Schock lähmte ihre Glieder. Sie sank in sich zusammen und verbarg das Gesicht in den Händen, während ihr die Tränen herabliefen.
»Bella … Bella … Puppi …!« Ihr Vater kniete sich zu ihr auf den Boden und legte seine Hand um ihre Schultern. Seine Stimme bebte. »Es tut mir leid! Verzeih mir! Es tut mir leid … ich wollte das nicht. Es tut mir leid.«
Sie weinte noch mehr.
Irgendwann spürte sie Jans Hand auf ihrem Haar.
»Bella, komm, wir gehen jetzt ins Badezimmer.«
Sie ließ sich von ihm hochziehen wie eine Puppe. Ihr Widerstand war gebrochen.
Jan musste ihr die Zahnpasta auf die Bürste drücken, ihr den Schlafanzug ausziehen, sie unter die Dusche stellen, sie abtrocknen und anschließend wieder anziehen. Sie hielt die ganze Zeit die Augen geschlossen.
Nur so sah sie das Blut nicht mehr, das auf immer und ewig auf den Fliesen des Badezimmers haftete.
Lisas Haar roch nach Jasminblüten. Er hatte sein Gesicht darin vergraben, während zarte Hände über seinen Rücken streichelten. Seit einer Viertelstunde lagen sie so nebeneinander auf ihrem Bett. Jan versuchte, sich zu entspannen und sich einzig und allein darauf zu konzentrieren, dass er jetzt bei Lisa lag, dem Mädchen, auf das all seine Mitschüler ein Auge geworfen hatten und das sich schließlich wegen ihm von diesem Marco aus der K 13 getrennt hatte. Seither hatte er sich gefühlt, als gehörte ihm die ganze Welt.
Jetzt fühlte er gar nichts. Ihren Kuss hatte er über sich ergehen lassen wie lästiges Händeschütteln.
Lisas Finger glitten unter sein T-Shirt. Er erstarrte, solange, bis sie ihr Streicheln aufgab, dann setzte er sich auf.
Lisa sah ihn fragend an.
»Mir ist jetzt nicht danach«, erwiderte er, weil er glaubte, ihr zumindest eine Erklärung schuldig zu sein, und rutschte zur Bettkante.
»Ich wollte gar keinen Sex, wenn du das meinst. Ich verstehe doch … in Anbetracht der Umstände …« Sie klang beleidigt.
Dabei hatte er noch maßlos untertrieben. In Wahrheit konnte er sich überhaupt nicht vorstellen, dass ihm je wieder danach sein würde. Sie hatten erst einmal richtig miteinander geschlafen, und zwar vor drei Wochen in eben diesem Bett, auf dem sie jetzt saßen. Für ihn war es das allererste Mal gewesen. Für Lisa dagegen nicht. Dass sie im Vergleich zu ihm so erfahren und routiniert vorging, hatte ihn verunsichert und seine Sehnsucht nach baldiger Wiederholung etwas gebremst. Er, Star des Schulbasketballteams, Schulsprecher und Spitzenschüler, hatte nicht nur zum ersten Mal Sex, sondern sich auch erstmals in seinem Leben unterlegen gefühlt.
»Mensch, Jan, Schatz …« Sie umschlang ihn von hinten und presste ihre Wange an die seine. »Es tut mir so unendlich leid. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie du dich fühlst.«
Er wusste nur zu gut, dass das eine Lüge war. Sie hatte nicht die leiseste Ahnung, wie er sich fühlte. Wie man sich fühlte, wenn sich die eigene Mutter die Pulsadern geöffnet hatte.
»Du solltest mit uns nach Mallorca fliegen. Wirklich. Das bringt dich auf andere Gedanken. Ich habe das noch mal mit meinen Eltern besprochen; sie glauben auch, dass es ganz gut für dich wäre, wenn …«
»Ich will aber nicht. Das habe ich dir doch schon gestern am Telefon gesagt!« Seine Stimme hörte sich sogar in seinen eigenen Ohren unwirscher an, als er beabsichtigt hatte.
»Aber warum nicht?« Sie drückte ihm einen sanften Kuss auf die Wange. Ihr langes blondes Haar kitzelte an seinem Hals. »Stört es dich, dass meine Eltern dabei sind? – Wir hätten doch sowieso ein eigenes Appartement, und wir können uns am Strand ganz weit weg von ihnen legen.«
Er schüttelte wortlos den Kopf.
»Aber wieso denn?« Sie ließ ihn los. Auf ihrer Stirn bildeten sich zwei steile Falten. »Du wärst doch auch mit deinen Eltern nach Italien gefahren!«
Auch das hatte er nicht gewollt. Die Vorstellung, drei Wochen in einem Campingbus mit den eigenen Eltern auf engstem Raum leben zu müssen, hatte ihm von Anfang an nicht gefallen. Mit seinen achtzehn Jahren war er einem Familienurlaub, der sich zwischen Strand, Pizzeria und Eisdiele abspielte, mit Sicherheit entwachsen. Freunde von ihm würden in diesem Sommer mit Rucksack und einem InterRail-Ticket quer durch Frankreich ziehen. Ihnen hatte er sich anschließen wollen, doch seine Eltern hatten die Idee abgelehnt.
Dieses eine Jahr wirst du wohl ein letztes Mal mit uns in den Urlaub fahren können, war sein Vater aus der Haut gefahren. Nächstes Jahr nach dem Abitur machst du dann sowieso, was du willst!
Das könne er auch jetzt schon, schließlich sei er volljährig, hatte er zurückgegeben, als sich seine Mutter einschaltete.
Bitte, Jan, sagte sie.
Mehr nicht.
Da hatte er bloß genickt und seinen Freunden abgesagt mit der Begründung, dass ihm das Geld für die Reise fehlte. Was im Grunde auch der Wahrheit entsprach. Das, was er nach der Rückkehr aus dem Familienurlaub als Hilfsbademeister im Freibad verdienen würde, wollte er schließlich fürs Studium sparen.
»Jan, bitte! Du wirst sehen, wenn du erst einmal am Meer bist, wirst du dich gleich besser fühlen.« Lisas Stimme drang unnachgiebig an sein Ohr. »Deine Mutter hätte doch bestimmt nicht gewollt, dass du jetzt so herumhängst.«
Er sprang auf.
»Lass gefälligst meine Mutter aus dem Spiel!«
Wütend ging er zur Türe. Er wollte einfach nur weg, weg von ihr, weg von dieser Stimme, die ihn so bedrängte.
Doch Lisa sprang auf und stellte sich ihm in den Weg.
»Sorry, aber was soll das? – Rede doch mit mir darüber! Ich verstehe ja, dass es dir schlecht geht, ist doch klar! Aber bitte mach nicht so … zu. Ich will doch mit dir reden und für dich da sein! Aber du … du sagst ja überhaupt nichts. Du bist total anders geworden. Sitzt nur noch da und sagst einfach nichts! Ich meine … das ist echt total schlimm, was deine Mutter sich da angetan hat! Du kannst aber doch mit mir über sie reden! Wie sie so war … warum sie das getan hat …«
»Das weiß ich selbst nicht«, erwiderte er nüchtern. »Ich weiß auch ehrlich gesagt im Moment gar nicht, was ich mit dir reden soll, Lisa! Mir geht die ganze Welt auf den Wecker!«
»Ich gehe dir auf den Wecker?« Sie sah ihn an, ein ungläubiges Flackern in den Augen. Ihre Unterlippe zitterte. »Und du kannst mit mir nicht reden? – Wie willst du denn ein Leben mit mir verbringen, wenn du nicht einmal jetzt mit mir über deine Gefühle sprechen kannst?«
Von was redet sie, ging es ihm durch den Kopf. Ihm war plötzlich übel, sein Körper verlangte nach frischer Luft. Gleichzeitig wusste er, was er zu tun hatte.
»Lisa, wir lassen das besser«, sagte er sachlich. »Ich will dir nicht wehtun. Aber ich habe nicht das Bedürfnis, mit dir zu reden. Wir beide sollten das akzeptieren.«
»Was heißt das?«
Ihre Stimme zitterte.
»Es ist aus, Lisa.«
Er drängte sich an ihr vorbei. An der Eingangstüre stieß er beinahe mit Peter Arnold zusammen, der gerade von der Arbeit nach Hause kam und nach dem Desinfektionsmittel roch, das er in seiner Tierarztpraxis verwendete.
Arnold klopfte ihm auf die Schulter.
»Na, Junge, du willst schon gehen? Bleib doch noch etwas. Setzen wir uns zusammen und trinken ein Bier, das kann nie schaden.«
Jan brachte mühsam ein »Nein danke, auf Wiedersehen« hervor, dann huschte er hinaus in die Dämmerung, schwang sich auf sein Fahrrad und trat so kräftig in die Pedale, wie er nur konnte.
Eine Querstraße weiter hielt er erschöpft inne. Schwer atmend lehnte er sich gegen einen Laternenpfosten. Erneut überkam ihn Übelkeit, diesmal mit ungeahnter Vehemenz. Im letzten Moment riss er sich hoch, fuhr herum und erbrach sich in eine Hecke.
Danach fühlte er sich etwas besser.
Erschöpft stieg er auf sein Fahrrad und fuhr mit zitternden Knien nach Hause.
»Verstehst du denn meine Situation nicht? – Ich muss mich um so vieles kümmern … mit dem Haus und den Versicherungen … ich weiß im Moment nicht, wo mir der Kopf steht. – Natürlich ist es notwendig, wir können hier nicht wohnen bleiben und so tun, als wäre das alles nicht passiert! Jedes Mal, wenn ich in dieses verdammte Badezimmer gehe … und wie es den Kindern erst dabei geht … Es ist jedes Mal ein Kampf, bis Bella überhaupt den Fuß über die Schwelle setzt. – Nein, Unsinn, das ist nicht wahr! Sie ist sensibel, ja … aber in dieser speziellen Situation …«
Isabell kauerte auf der obersten Treppenstufe und drehte ein Glas Wasser in den Händen. Eigentlich hatte sie nur kurz in der Küche etwas zu trinken holen wollen, doch die aufgebrachte Stimme ihres Vaters hatte sie auf dem Rückweg in ihr Zimmer innehalten lassen. Seit zehn Minuten hörte sie ihn nun schon bei offener Wohnzimmertüre telefonieren. Seine Stimme wurde im Laufe des Gesprächs immer wieder laut und ungehalten. Sie wusste aus Erfahrung, dass es nur einen Menschen gab, der ihn innerhalb nur weniger Minuten dazu brachte, die Beherrschung zu verlieren: Dagmar Ulbrich. Ihre Großmutter, die so gar nichts Großmütterliches an sich hatte.
Ihr jüngstes Zusammentreffen lag rund zwei Jahre zurück. Damals war Dagmar Ulbrich im Allgäu auf Kur gewesen und hatte sie im Café des Hotels empfangen. Isabell, die ihre Oma damals schon mehrere Jahre nicht gesehen hatte, hätte die hochgewachsene Frau mit dem auftoupierten Haar und dem vielen Make-up beinahe nicht erkannt. Lediglich die schrille Stimme weckte ihre Erinnerung an frühere Zusammentreffen.
Michael, muss das Kind mit dem Löffel gegen die Teetasse schlagen? Das Geräusch nervt allmählich. – Michael, kann eure Tochter nicht einmal fünf Minuten stillsitzen?
Isabell hatte bei diesem Besuch konsequent alles Essen verweigert und kein einziges Wort gesprochen.
Michael, stimmt etwas mit eurer Tochter nicht? Ist sie ein Kind … wie sagt man das heutzutage … mit besonderen Bedürfnissen?
»Hör mir doch mal zu!« Ihr Vater schrie nun regelrecht in den Hörer. »Ich verlange doch wirklich nicht viel! Wenn du maximal drei Wochen hier wärst, das würde mir schon helfen! – Natürlich bin ich im Moment zu Hause. Ich bin seit Christianes Tod … – Aber ich kann keinen Umzug in die Wege leiten, wenn ich gleichzeitig auf Isabell aufpassen muss, das ist doch wohl klar! – Ja. Ja, Mutter. Jan tut sein Bestes, um mich zu unterstützen. Aber ich kann ihm nicht alles aufbürden, der Junge ist erst achtzehn! – Nein, er ist nicht erwachsen! Er ist genauso ein Kind, das gerade seine Mutter verloren hat, wie es Isabell ist!« Pause. Dann ein großer Seufzer. »Komm mir doch etwas entgegen; nur dieses eine Mal. Ich muss wohl akzeptieren, dass die Kinder nicht zu dir kommen können, weil dein Lebensgefährte Angst um seine chinesischen Vasen und seine gottverdammte teure Einrichtung hat, aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass du deine jährliche Mittelmeer-Kreuzfahrt nicht ein einziges Mal um ein paar Wochen verschieben kannst. Ich bin dein Sohn. Es ist eigentlich üblich, dass Mütter in so einer Situation helfen.«
Ihr Vater hörte sich müde an.
Dann, nach einer neuerlichen Pause, ein lauter Schlag und ein Klirren. Isabell zuckte zusammen.
»Nein, ich habe mich nicht gegen dich entschieden, Mutter!« Die Stimme ihres Vaters war voller Wut. »Ich habe mich verliebt und geheiratet, das ist passiert! – Du konntest Christiane doch von Anfang an nicht leiden! Du hast auch vorher keine Frau akzeptiert, die mir etwas bedeutet hat. Weil du eifersüchtig bist, das ist die Wahrheit! Und ich bin verdammt froh, dass ich es endlich schaffe, dir das ins Gesicht zu sagen!«
Es knackte – ein Zeichen, dass ihr Vater aufgelegt hatte.
»Wer braucht diese Zicke schon? – Das hat sich zum Glück wohl erledigt. Wir schaffen das auch allein.«
Isabell hob den Kopf.
Jan stand hinter ihr. Offenbar hatte auch er das Telefongespräch mitverfolgt.
Er setzte sich zu ihr auf die Treppenstufe. Isabell stellte das Wasserglas neben sich ab.
»Werden wir wirklich umziehen?«
»Willst du denn hier wohnen bleiben, Bella?«
Sie hob die Schultern und ließ sie wieder sinken. Er deutete ihre Reaktion auf seine Weise.
»Na also. Das Haus hat durch Mama gelebt, das weißt du. Wir fühlen uns hier doch alle nicht mehr wohl.« Er legte ihr den Arm um die Schultern und drückte sie an sich. »Wir werden ein schönes neues Zuhause finden mit einem Badezimmer, in dem du keine Angst mehr haben musst.«
»Packt die Koffer, wir werden in spätestens einer Stunde abfahren!« Ihr Vater stand nun vor ihnen im Hausflur, die Hände in die Hüften gestemmt und mit kleinen Schweißperlen auf der Stirn. Er blickte hektisch von Jan zu Isabell.
Jan runzelte die Stirn.
»Wohin?«
»Weg.«
Einen Moment hatte Isabell den Eindruck, ihr Vater wollte es bei dieser rudimentären Auskunft belassen, doch er schien sich plötzlich anders zu besinnen.
»Ich bringe euch zu euren Großeltern. Es hat keinen Sinn, wenn wir hier so weitermachen. Bella wird immer dünner und du immer blasser.«
Isabells Magen zog sich zusammen. Sie sah ihre blondierte Großmutter vor sich, die nicht Oma genannt werden wollte, weil sie sich dafür mit ihren fünfundsechzig Jahren zu jung fühlte. Sie war noch nie in ihrem Haus in der Nähe von Hamburg gewesen, aber die Vorstellung, dort mit ihr und ihrem Lebensgefährten, der ganz sicher auch nicht Opa genannt werden wollte, für eine Weile zu leben, behagte ihr ganz und gar nicht.
»Was? – Das kommt wohl überhaupt nicht in Frage!« Jan schien ähnlich zu denken wie sie. »Ich fahre überhaupt nirgendwohin, ich bin doch kein Kind mehr!«
»Jan, bitte keine Diskussion, mein Entschluss steht fest.«
»Was heißt überhaupt Großeltern? – Diesen Lackaffen als unseren Großvater zu bezeichnen, nur weil deine Mutter zufällig seit ein paar Jahren mit ihm zusammen ist!«
»Ich rede nicht von diesen Großeltern.«
Isabell starrte ihren Vater mit weit aufgerissenen Augen an. Sie konnte nicht glauben, was sie da eben gehört hatte.
»Zu diesen Leuten? – Das ist nicht dein Ernst!«, brach es aus Jan hervor. »Wir kennen die überhaupt nicht! Und ich will die auch überhaupt nicht kennenlernen, nach dem, wie sie Mama fallen gelassen haben!«
Seitdem sie das erste Mal nach ihren Großeltern mütterlicherseits gefragt hatten, kannten sie diese Geschichte, die mit wenigen Sätzen erzählt war: Die Eltern ihrer Mutter waren nicht einverstanden gewesen, dass ihre Tochter mit sechzehn von zu Hause ausziehen wollte, um in einem Hotel in Frankfurt zu arbeiten. Sie tat es trotzdem, und seither gab es keinen Kontakt mehr. Ihre Eltern hatten ihr ihre Entscheidung anscheinend nie verziehen.
Je älter Isabell wurde, desto mehr hatte sie sich über ihre Großeltern und das, was ihre Mutter erlebt hatte, den Kopf zerbrochen.
Wenn ich einmal etwas mache, was du nicht willst, wirst du dann auch nie wieder mit mir reden?, hatte sie ihre Mutter erst vor einigen Wochen gefragt.
Niemals würde ich das tun, hatte ihre Mutter ohne zu zögern geantwortet und sie in den Arm genommen.
Wenn Isabell seitdem an ihren Hexengeschichten schrieb, sah sie in der grausamsten Hexe, die sie in ihrer Phantasie schuf, stets ihre unbekannte Großmutter.
»Ich habe darüber nachgedacht, Jan. Es ist besser so.« Ihr Vater strich sich durch sein volles, dunkles Haar. »Sie wohnen hinter Passau, mitten auf dem Land. Es wird euch beiden gut tun, etwas anderes zu sehen als das hier. Und wenn ihr nach den Sommerferien wiederkommt, wohnen wir bereits in einem anderen Stadtteil, in einer anderen Wohnung oder einem anderen Haus, in dem keine schlimmen Erinnerungen herumspuken.«
»Ich muss in den Sommerferien meine Facharbeit schreiben«, begehrte Jan auf. »Ich brauche eine Bibliothek. Ich lasse mich nicht ins Nirgendwo verfrachten, ich bin erwachsen! – Mama hätte das sicher nicht gewollt!«
»Deine Mutter hätte so einiges nicht gewollt!« Auch ihr Vater hatte nun die Stimme erhoben. »Sie hätte auch nicht gewollt, dass hier alles im Chaos versinkt, dass deine Schwester immer magerer wird und sich immer mehr zurückzieht! Sie hätte auch nicht gewollt, dass uns ständig die mitleidsvollen Blicke aller Nachbarn begleiten, sobald wir nur einen Schritt aus der Haustür machen! Und sie hätte schon gar nicht gewollt, dass andere Leute für uns entscheiden, was gut und richtig für uns ist!«
Er schüttelte den Kopf. Isabell fiel auf, dass seine Schläfen leicht grau waren. Wann war ihr Vater so alt geworden?
Er sah nur Jan an, als er fortfuhr.
»Diese Psychologin, sie meint, dass Bella derzeit … anderswo besser aufgehoben wäre. Sie hat an dieses Zentrum gedacht, für traumatisierte Kinder, irgendwo im Berchtesgadener Land. Sie sind spezialisiert auf Kinder, die … Schlimmes erlebt haben.«
Isabells Herz begann zu flattern. Zentrum. Das klang wie Krankenhaus. Sie wollte nicht mehr ins Krankenhaus, niemals!
»Nur Bella?«, fragte Jan vorsichtig.
»Du bist, wie du selbst gesagt hast, erwachsen. Sie zahlen dir Therapie, wenn du es weiterhin willst, aber das Zentrum ist nur für Kinder.«
»Nein!« Isabell sprang auf. Dabei stieß sie gegen das abgestellte Glas, das über die Kante auf die nächste Treppenstufe fiel und in zahllose kleine Stücke zersprang. Sie begann zu weinen. Ihr Vater stieß einen Fluch aus.
»Nicht bewegen!«, rief Jan, doch seine Worte erreichten sie nicht. Sie wollte weg, die Treppe hinunter, sie wollte nicht in dieses Zentrum, sie wollte nicht …
Ein stechender Schmerz schoss durch ihren Körper. In ihrer Fußsohle steckte ein spitzer Glassplitter. Als sie das Blut sah, dass seitlich aus der Wunde tropfte, wurde ihr schwindlig. Ihre Beine knickten ein.
Sie fühlte die Arme ihres Vaters, die sie umschlangen. Er trug sie die restlichen Stufen hinunter ins Wohnzimmer und bettete sie auf die Couch.
»Ich hole Jod«, sagte er.
Jan setzte sich zu ihr auf das Sofa und griff nach ihrer Hand. Sie umklammerte sie wie einen Rettungsring, während ihr Tränen der Verzweiflung über das Gesicht liefen.
»Lass mich nicht allein«, schluchzte sie. »Bitte, Jan. Bitte!«
Ihr Vater zog mit einer Pinzette den Glassplitter aus der Wunde. Als er sie mit Jod betupfte, brannte es höllisch. Isabell weinte noch mehr.
»Komm, das kann doch nicht so weh tun, Puppi.«
Ihr Vater strich ihr tröstend über das offene Haar.
»Bella wird nicht in dieses Zentrum gehen«, sagte Jan, der Einzige, der sie in diesem Moment zu verstehen schien. »Das würde alles bloß noch schlimmer machen!«
»Natürlich wird sie das nicht.« Die Bestimmtheit in den Worten ihres Vaters brachte Isabells Tränen zum Versiegen. »Aber der Psychologische Dienst besteht darauf, dass sie nicht hier bleibt. Sie glauben, dass sie eher über alles hinwegkommt, wenn sie eine Zeitlang in ein anderes Umfeld gebracht wird. Und ich glaube das auch. Aber Bella wird nicht alleine bei Fremden bleiben, das wissen wir beide. Sie braucht dich, Jan. Ich habe der Psychologin versprochen, euch wegzubringen zu euren Großeltern. Sie war mit diesem Kompromiss vorerst zufrieden. – Nur für die ersten Wochen, Jan! Wenn Bella sich eingewöhnt und es ihr besser geht, kannst du zurückkehren.«
Isabell hielt die Hand ihres Bruders noch immer umklammert. Sie ließ sie erst los, als Jan die erlösenden Worte sprach.
»Okay. Ich werde mitgehen.«
Nizza, April 2011
Das brummende Geräusch der Motoren war selbst im siebten Stock noch zu hören. Jan stand in Unterhose und T-Shirt auf dem Balkon des Hotels und betrachtete stirnrunzelnd die Blechlawine, die sich im Schritttempo in Richtung Innenstadt schob. Wie alle Referenten des Kongresses hatte auch er ein Zimmer mit Meeresblick bekommen. Das Wasser schimmerte im Licht der Morgensonne an manchen Stellen bereits so türkis wie auf der Postkarte, die dem Begrüßungsbrief mit seinem Eintrittsband zum Kongressgelände beigelegt gewesen war.
Wer war nur auf die Idee gekommen, zwischen Strand und Hotelzeile eine sechsspurige Zufahrtsstraße zuzulassen! Eine wunderbare Bucht, eine schöne Stadt, ein Hotel, in dem es sich leben ließ, aber die Straße und der Lärm zerstörten alles. Nicht einmal die doppelt verglaste Balkontüre hatte er über Nacht offen lassen können. Es war einfach zu laut.
Nun gut, er war hier schließlich nicht auf Urlaub. Auf den Dienstreisen der vergangenen Jahre hatte er schon weit schlechtere Orte besucht als Nizza.
»Hej, was machst du so lange da draußen? – Komm doch zurück ins Bett …«
Er mochte den drängenden Unterton in dieser Stimme nicht. Als er ins Zimmer zurückkam, hatte die Frau, zu der sie gehörte, die Bettdecke zurückgeschlagen und präsentierte sich ihm splitternackt, in aufreizender Pose. Sie lächelte ihn an.
Er lächelte zurück, obgleich ihm nicht danach zumute war.
Die Frau in seinem Bett war überhaupt nicht sein Typ, wie er jetzt feststellte. Sie hatte einen tollen Körper, trainiert, mit gerade so viel an Muskeln, um zwar sportlich, aber dennoch feminin zu wirken. Ihr Busen war fest und kompakt, wie er wusste, seit er ihn in der Nacht in seinen Händen geknetet hatte. Gestern, auf der Pressekonferenz, auf der sie ihm zum ersten Mal aufgefallen war, und später am Abend dann an der Bar hatte er sie durchaus attraktiv gefunden. Jetzt aber, im hellen Licht der Morgensonne, entdeckte er Falten in ihrem Gesicht. Mit ihren schmalen Lippen wirkte sie fast etwas verhärmt und Anspannung lag um ihre Mundwinkel, die bei jedem Lächeln bereitwillig nach oben zuckten. In einem Stadium, als ihr Flirt schon so weit fortgeschritten war, dass beide sich über den weiteren Verlauf der Nacht im Klaren waren, hatte sie ihm ihr Alter verraten. Sie war achtundvierzig – zehn Jahre älter als er selbst.
Er fragte sich, wie er das nur eine Sekunde lang für einen Scherz hatte halten können.
Außerdem, das wurde ihm jetzt erst richtig bewusst, war sie bei Tageslicht bei Weitem nicht so blond, wie es ihm gestern im Konferenzraum und dann in der Bar erschienen war. Mit gutem Willen konnte man sie allenfalls als dunkelblond bezeichnen. Kurzum, sie war nicht sein Typ.
»Komm schon«, schnurrte sie und reckte ihm ihren Busen entgegen. Seine Festigkeit schien ihm plötzlich unwirklich. Er begann sich dunkel daran zu erinnern, dass sie am Vorabend nach dem ersten gemeinsamen Cocktail ihr ganzes deutschsprachiges Umfeld mit detaillierten Schilderungen von Schönheitsoperationen unterhalten hatte. Sie hatte diesen boomenden Bereich der plastischen Chirurgie empört kritisiert und eine Reportage darüber geschrieben, die vor rund einem Jahr im FOCUS erschienen und mit einem hohen Journalistenpreis ausgezeichnet worden war.
Außerdem hatte sie unglaublich viel von sich erzählt, den ganzen Abend lang. Ihr Humor und ihre Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, hatten ihn gestern Nacht durchaus angesprochen.
Jetzt aber war helllichter Tag. In zwei Stunden musste er den zweiten Vortrag dieser Dienstreise halten, zu der er von einem internationalen Pharmakonzern geladen worden war. Nachdem er gestern Journalisten seine Erfahrungen als Prüfarzt mit dem neuen oralen Thrombosehemmer zur Vorbeugung von Schlaganfällen vorgestellt hatte, waren nun seine Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa an der Reihe.
Er wollte in Ruhe frühstücken, er wollte den Vortrag nochmals durchgehen. Er wollte sie loswerden – dies allerdings, ohne sie zu verletzen. Als Redakteurin im Gesundheitsressort eines auflagenstarken Nachrichtenmagazins konnte sie ihm möglicherweise noch nutzen. Er war schon häufig in den Medien zitiert worden, bisher aber hauptsächlich in Fachmedien. Der Sprung in die Laienmedien würde ihm zusätzliche Patienten bringen, wenn er erst einmal seine Privatpraxis eröffnet hätte.
Er suchte gerade nach passenden Worten, als sein Handy klingelte.
Es war vor acht, daher zweifelte er keine Sekunde, dass es Anja war. Nur sie konnte so früh anrufen. War etwas mit den Kindern? Er nahm den Anruf an, ohne vorher einen Blick auf das Display zu werfen.
»Ja?«
»Jan?«
Die Stimme, die sich am Ende der Leitung hörbar verunsichert meldete, gehörte einer Frau, aber nicht seiner Frau. Dennoch kam sie ihm seltsam vertraut vor.
»Wer spricht da, bitte?«
Das tiefe Aufatmen – oder Durchatmen – am anderen Ende der Leitung hörte sich fast an wie Donnergrollen. Automatisch hielt er das Handy ein paar Zentimeter von seinem Ohr entfernt.
»Ich bin es. Barbara.«
Wie in einer Dia-Show zogen Gesichter vor seinem inneren Auge vorbei: all die verschiedenen Frauen, die er in den letzten Jahren näher kennengelernt hatte – näher, als es seine Frau jemals erfahren durfte. Keine davon hatte Barbara geheißen. Und keiner einzigen hatte er seine Nummer gegeben.
»Deine Handynummer habe ich von Anja«, kam es prompt, als hätte die Frau am anderen Ende der Leitung seine Gedanken lesen können. Der starke süddeutsche Akzent trat in ihrer Aussage nun so stark hervor, dass ihm mit einem Schlag klar wurde, mit wem er hier telefonierte.
»Barbara!«, sagte er und bemühte sich, seiner Stimme einen einigermaßen aufgeschlossenen Beiklang zu geben. »Welche Überraschung!«
Das war untertrieben. Ihr Anruf nach all diesen Jahren, in denen er, abgesehen von ihrem Hochzeitsfoto, lediglich die Geburtsanzeigen ihrer vier Kinder erhalten hatte, war wie aus einer anderen Welt.
»Ja …« Sie klang unschlüssig; eine Eigenschaft, die er früher nie an ihr bemerkt hatte. »Es ist so … also, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ist ja alles schon lange her.« Sie lachte. Es hörte sich falsch und künstlich an. Kein Zweifel, sie war nervös.
Er spürte, dass seine Handflächen feucht wurden.
»Also, vielleicht interessiert es dich ja nicht«, begann sie von Neuem. »Aber ich wollte es dir … ich meine, eigentlich euch, trotzdem sagen.«
Als sie den Grund ihres Anrufs endlich aussprach, fühlte er eine Welle der Erleichterung durch seinen Körper rollen. Die Anspannung fiel von ihm ab wie ein lästiger Mantel. Er beendete das Gespräch professionell und souverän, so, wie er es auch bei seinen Patienten zu tun pflegte.
Es war vorbei, endgültig vorbei. Ein Kapitel in seinem Leben war abgeschlossen. Für immer.
Fast hätte er laut aufgelacht, so befreit fühlte er sich in diesem Moment. Doch da gab es noch immer diese Frau in seinem Bett, an deren Namen er sich im Augenblick beim besten Willen nicht erinnern konnte. Hieß sie Franka? Oder Frauke? Er wusste, danach konnte er nach dieser Nacht nicht mehr fragen, ohne sie zutiefst zu beleidigen.
»Wer war das? Deine Frau?«, wollte sie zu allem Überfluss auch noch wissen.
»Nein, meine Cousine«, erwiderte er wahrheitsgemäß. Er wollte es dabei belassen – was ging sie schon seine Familiengeschichte an –, bis er ihr erwartungsvolles Gesicht bemerkte und schlagartig erkannte, dass ihre Neugier das Trittbrett war, um sie galant aus seinem Hotelzimmer zu befördern. »Meine Großmutter ist gestorben«, sagte er, um einen bedeutungsschweren Tonfall bemüht.
Sie setzte sich abrupt auf.
»Oh mein Gott. Das tut mir leid! – Habt ihr euch sehr nahe gestanden?«
»Ja«, sagte er und seufzte.
Er brauchte nicht mehr zu tun. Sie begriff. Fünf Minuten später hatte sie sein Zimmer verlassen, nicht ohne ihm noch ihr Beileid ausgesprochen und ihre Visitenkarte hinterlegt zu haben.
Während er ihre Visitenkarte zwischen die anderen Karten in das dafür vorgesehene Etui schob, wurde ihm klar, dass er zumindest bei seiner letzten Aussage nicht gelogen hatte: Sie waren sich tatsächlich eine Zeit lang sehr nahe gestanden, seine Großmutter und er.
Köln, April 2011
Der Bus kam eine Minute zu früh. Das war noch nie vorgekommen. Isabell hastete los, als sie ihn um die Kurve biegen sah, doch als sie schließlich atemlos an der Haltestelle ankam, scherte er bereits wieder links auf die Fahrbahn aus.
Während sie auf den nächsten wartete, ahnte sie bereits, dass es kein guter Tag werden würde.
Als sie wegen des verpassten Busses zehn Minuten zu spät im Büro eintraf, fand sie ihre Kolleginnen bereits in der Mitte des Raums versammelt. Sie hatten sich um den Schreibtisch von Ariane gescharrt, der schlanken rothaarigen Kollegin, die erst vor sechs Wochen zu ihnen gestoßen war. Arianes kräftige, aber angenehme Stimme durchdrang das gesamte Großraumbüro.
»… und im Sommer koche ich nun einmal gerne Marmelade, und zwar aus Himbeeren und Brombeeren, das kann man übrigens auch mischen. Deshalb habe ich mir Ihren Entsafter KENDO 4 NB in grün-weiß zugelegt, weil es auch zu meiner Einrichtung und der Kaffeemaschine passt. Ich muss Ihnen sagen: Ich bin von Ihrem Gerät nur enttäuscht. Ich habe so viel dafür bezahlt, und jetzt kommen die Himbeeren nicht zerquetscht, sondern als flüssiger Saft aus dem Gerät heraus. Da war ja mein fünfzehn Jahre altes Gerät von Philips besser! Ich will den KENDO 4 NB nur wieder loswerden und fordere daher von Ihnen einen vollständigen Schadensersatz und zudem eine finanzielle Entschädigung für die rund zehn Gläser Marmelade, die mir im vergangenen Jahr durch Ihr Gerät entgangen sind und die ich nun über die Monate hinweg im Supermarkt einkaufen musste. Sie finden meine Rechnungen als Beleg zur Kostenerstattung anbei.«
Isabell musste unwillkürlich schmunzeln, während sie ihren schwarzen Mantel zu den anderen Jacken an den Garderobenständer hängte. In den sieben Jahren, die sie nun schon für GREEN ORANGE SERVICES arbeitete, hatte sie so manches originelle Reklamationsschreiben unzufriedener Kunden erhalten. Dies gehörte eindeutig dazu.
»Gib her, gib her! Das legen wir in den blauen Ordner ab!« Gabriele, eine kurzhaarige Wasserstoff-Blondine in eng anliegenden Leggins und einem Oberteil mit Tigerfell-Muster, die bisher nur in zweiter Reihe gestanden hatte, drängte sich durch die kleine Versammlung nach vorne. Sie nahm der Vorleserin das Schreiben aus der Hand und hastete damit zum Kopierer, der am anderen Ende des Raums stand.
Die Kolleginnen machten bereitwillig in ihrer Runde Platz, als sie Isabells Anwesenheit bemerkten. Einige wünschten ihr einen guten Morgen, andere kicherten noch über den Brief.
»Welcher blaue Ordner eigentlich?«, fragte Ariane.
Natürlich, sie weiß das noch gar nicht, schoss es Isabell durch den Kopf. Sie hatte es schlichtweg vergessen. Es war ihr nicht wichtig genug gewesen.
»Wir haben einen Ordner, in dem wir Briefe wie diese ablegen. Für dunkle Tage, um unsere Laune aufzuhellen.«
»Oh.« Ariane nickte. »Verstehe.«
Sie sandte ihr eines dieser Lächeln entgegen, die Isabell noch immer nicht einordnen konnte. Ariane lachte gerne und oft, das hatte sie schnell erkannt, doch dieses Lächeln war sehr speziell. In ihren Augen tanzten kleine, sprühende Funken und sie blickte ihr direkt ins Gesicht. Isabell wandte sich ab.
»Was den Leuten wohl durch den Kopf geht, wenn sie uns derartige Briefe schreiben?«, fragte Ursula, mit ihren zweiundfünfzig Jahren die älteste aus der Kolleginnen-Runde. »Ich käme nie auf die Idee, andere mit einem so dummen Brief zu belästigen!«
»Erstens wollen diese Leute wahrscheinlich auch niemanden belästigen, wie du es nennst, zweitens schreiben sie ihre Briefe nicht an mich, dich oder Isabell, sondern an dieses ach so böse Elektro-Unternehmen, das ihnen ein unbrauchbares Ding für teures Geld verkauft hat«, erwiderte Gudrun, eine hagere Brünette mit Pferdeschwanz. »Die wissen ja nicht, dass die ihre Reklamationsbearbeitung seit Jahren an ein Subunternehmen ausgelagert haben, in dem wir uns kreative Antworten aus den Fingern saugen, um sie zu beruhigen.«
Die Frauen lachten, denn ungerechtfertige Reklamationen, auf die tatsächlich individuell geantwortet wurde, waren die Ausnahme. Für die meisten Kundenschreiben gab es standardisierte Vorlagen, die lediglich am PC personalisiert wurden. Meistens handelte es sich um Briefe, die die Technikabteilung jenen Kunden beilegte, die ihre reparierte Küchenmaschine, ihren wieder funktionierenden Toaster oder ihr Bügeleisen zurückerhielten.
»So, hier hast du das Original.« Gabriele überreichte Ariane das in krakeliger Handschrift verfasste Schreiben.
»In welcher Einöde haust denn diese Verrückte, die sich wundert, dass ihr Entsafter Beeren wirklich zu Saft macht?«, erkundigte sich Ursula und brachte die Runde damit erneut zum Lachen.
Arianes Augen wanderten über den Papierbogen.
»Aus Neumarkt, wie ich sehe. Außerdem handelt es sich um einen Marmelade einkochenden Mann.«
»Was für eine Rarität!«, entfuhr es Gudrun. »Ist der noch Single?«
»Wo um alles in der Welt liegt denn Neumarkt?«, fragte eine andere Kollegin. »Noch nie gehört.«
»Der Postleitzahl nach irgendwo in Bayern«, erwiderte Ariane. »Neun am Anfang ist doch Bayern, oder?«
»Klar doch, du sauerländisches Landei«, kam es prompt in neckendem Tonfall von einer weiteren Kollegin. »Keine Ahnung von Geographie? – Neumarkt in der Oberpfalz. So heißt das Städtchen. Da bin ich schon einmal durchgekommen, als ich vor ein paar Jahren mit meinem Chor auf Konzertreise war …«
»Was, du bist in einem Chor?«, fragte Ursula erstaunt und erhielt sogleich eine begeisterte Schilderung der Tournee, die Isabell und die anderen Kolleginnen nach und nach an ihre Schreibtische zurücktrieb.
Isabell schaltete ihren PC ein, doch anstatt sich auf die Schrift am Bildschirm zu konzentrieren, starrte sie aus dem Fenster. Ein paar Fährschiffe fuhren den Rhein entlang: zwei stromabwärts, drei in die entgegengesetzte Richtung. Auf der Zoobrücke ging der Verkehr nur zähfließend voran.
Sie hatte gewusst, dass es kein guter Tag werden würde.
Neumarkt. Neumarkt in der Oberpfalz.
Hatte sie gewusst, dass Neumarkt in der Oberpfalz lag? – Sie wusste es nicht, wusste so vieles nicht. Die Leere, die sie in ihrem Herzen fühlte, gab es auch in ihrem Kopf.
Was spielte es überhaupt für eine Rolle, dass dieses Neumarkt in der Oberpfalz lag? – Nun, es spielte irgendeine Rolle, entschied sie nach einigem Grübeln. Nur weshalb, das wusste sie nicht.
Ihr Telefon schrillte. Sie fuhr zusammen, hatte sich aber sogleich wieder im Griff und hob ab.
»Hast du kurz Zeit? Kannst du zu mir ins Büro kommen?«
Sie hatte keine Vorstellung, warum Klaus sie zu sich bat, doch zerbrach sich auch nicht den Kopf darüber. In dem Dreivierteljahr, in dem sie mit ihm arbeitete, hatte er seinen Mitarbeitern niemals Anlass dazu gegeben, vor einem Termin mit ihm Gänsehaut zu bekommen. Ein netter Typ. Wirkt ein bisschen wie ein Riesenbaby. Hat aber einiges auf dem Kasten. – So sprachen die Kolleginnen über den Chef.
Als Isabell an diesem Tag bei ihm eintrat, war Klaus nicht allein. Lars, der Gründer von GREEN ORANGE SERVICES, saß mit ihm am Besprechungstisch. Beide erhoben sich zur Begrüßung.
Lars’ Händedruck war so fest, dass sie kurzzeitig das Gefühl hatte, ihre Handknochen würden zerquetscht. Der ehemalige Spitzen-Marathon-Läufer, der sich mit einem Call-Center selbstständig gemacht hatte, brachte seine Bärenkräfte zum Einsatz, ohne sich dessen bewusst zu sein. Es gab Leute, die ihm zur Begrüßung lieber nur zunickten.
Lars kam zügig zur Sache.
»Du bist jetzt schon sieben Jahre hier und damit eine jener Mitarbeiterinnen, die am längsten dabei sind«, begann er, kaum dass sie Platz genommen hatte.