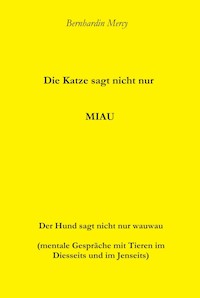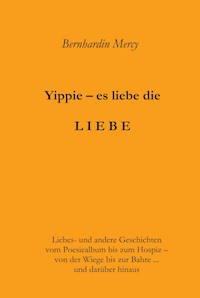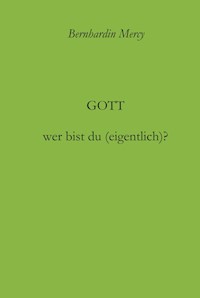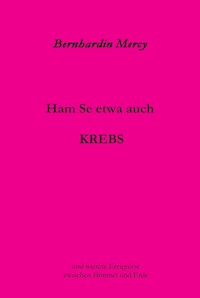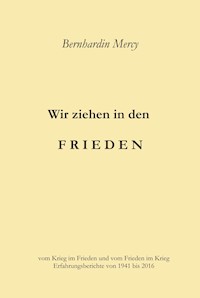
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine ältere Dame vertraute Bernhardin Mercy ihre Lebensgeschichte an. Es wurde eine persönliche Dokumentation über den Zeitraum 1941 bis 2016. Zeitgeschichte einmal anders. Viele Menschen, die im Zweiten Weltkrieg geboren wurden, scheuen sich, ihre Erinnerungen mitzuteilen. Sie fürchten, dass ihre Geschichte niemanden interessiert. Sie haben gelernt, zurückhaltend zu sein. Viele Menschen, die im Zweiten Weltkrieg geboren wurden, fürchten sich davor, Furchtbares in Worte zu fassen. Sie haben gelernt, "stark" zu sein. In diesem kleinen Buch findet sich in rascher Folge Schmerzliches und Herzliches, Politisches und Kritisches, Persönliches und Versöhnliches, Traditionelles, Aktuelles, Universelles etc. Wann in den vergangenen Jahrtausenden hat sich ein Wandel auf dieser Erde derart rasant vollzogen? Und die Zukunft? Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder "WIR ZIEHEN IN DEN FRIEDEN" oder "WIR ZIEHEN IN DEN KRIEG". Mit 18 farbigen Illustrationen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bernhardin Mercy
Wir ziehen in den
FRIEDEN
vom Krieg im Frieden und vom Frieden im Krieg Erfahrungsberichte von 1941 bis 2016
© 2017 Bernhardin Mercy
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7439-1452-0
Hardcover:
978-3-7439-1453-7
e-Book:
978-3-7439-1454-4
Alle Namen in „Wir ziehen in den FRIEDEN“ sind frei erfunden.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Mein Vater fährt mit dem Auto zur Beerdigung seines Vaters, also meines zukünftigen Opas. Dieser Mann ist Spökenkieker – so nennt man hier die Menschen, die Dinge sehen, die fernab geschehen oder erst in der Zukunft geschehen werden. Dieser einfache, bescheidene alte Mann wird heute beerdigt.
Als bei meiner Mutter die Wehen einsetzen, gibt es im ganzen Dorf kein einziges Fahrzeug, welches sie ins Kreiskrankenhaus bringen könnte oder dürfte. Es gibt Straßensperren und niemand hat ein Fahrzeug. Fast alle Autos sind beschlagnahmt vom Militär, und wer eines hat, besitzt keinen Passierschein. Darum muss Mutter die Wehen zurückhalten. Warum scheut sie eine Hausgeburt? Nur sie weiß es. Am nächsten Tag kommt Vater heim von der Beerdigung seines Vaters. Seinerzeit redeten die Kinder auf dem Lande in der Gegend ihre Eltern noch mit „Sie“ an. Vater kommt heim zu meiner Geburt. Er erzählt mir später, dass die russische Ärztin mich ihm auf dem Krankenhausflur zeigte, und sie sagte: „Seehr scheene Mädchen.“
Seehr scheene Mädchen – so recht geglaubt hab ich es nie, das mit dem scheen.
Ich öffne meine Augen und sehe in seine Augen. Diese grauen Augen. Ich kenne sie. Ich kenne sie aus einem früheren Leben. Schlagartig bin ich über dem Krankenhaus, sehe das rote Dach unter mir und dann viele Dächer des Städtchens von oben. Und dann alle Dächer – und dann noch das Grün drum herum. Ich liebe rote Dächer! Es ist ein klarer Morgen, und es ist schön, einfach nur wunderschön. Nun trifft mich ein elektrischer Schlag, ein Blitz durchzuckt mich – ich bin wieder unten, zurückgeworfen, zurückgeholt, und zittere lange. Ich will das nicht; nicht so, nicht hier. Es gibt kein Entrinnen. Seit jeher liebe ich Luftaufnahmen, und seit einigen Jahren, des Nachts im Fernsehen, die Weltraumausflüge.
Ich weiß nicht: Wann bringt die Nonne mich zu meiner Mutter? Es geht ihr schlecht, sie ist erschrocken, weil ich so blass bin, und fragt die Schwester. Die antwortet ihr: „Das Herz hat nicht richtig geschlagen. Wir haben dem Kind was gegeben, nun ist es in Ordnung.“
Wir müssen drei Wochen bleiben. Damals weiß ich noch nicht, was drei Wochen sind. Ich weiß noch nicht einmal, was ein Tag, was eine Stunde ist. Ich weiß nur: Es ist ewig und hört niemals auf. Ich will wieder fliegen! Wegfliegen!
Ich bekomme nur einen Rufnamen, denn mein Vater ist auch Standesbeamter. Er hasst es, wenn die Leute ihren Kindern mehrere Vornamen geben. Denn dann hat er so viel zu schreiben. Die Rufnamen muss er auch noch mit dem Lineal unterstreichen. Das kleckst meistens.
Später, wenn ich mal bei einer Kindesanmeldung zugegen bin, vor allem im Winter, wenn nur ein Raum mit Kohle beheizt wird, bekomme ich mit, wie er die Leute beeinflusst, damit sie dem Neugeborenen nur einen Namen geben. Vielleicht hat er auch einfach Namen unterschlagen. Aber das darf ich nicht behaupten. Vor dem Krieg und während des Krieges haben manche Kinder germanische Namen. Nach 45 nicht mehr. Heutzutage heißen die Mädchen Nicole, Jaqueline, Sara und Laura. Die Jungen heißen Kevin, Philipp, Noah und Elia. Nicht alle, aber die meisten. Adolf gibt es gar nicht mehr. Aber alle 60 bis 80 Jahre soll eine Mode ja wiederkehren.
In der Küche sitzen alle um den großen Tisch aus Holz herum. Der wird nach dem Essen mit einem nassen Lappen abgeputzt. Ich laufe gern unter dem Tisch durch. Unter dem Tisch sehe ich dann immer die Knie und die Füße von den anderen, manchmal mit Schuhen an, manchmal barfuß. Mutter und Vater haben immer Schuhe an. Es macht Spaß, unter dem Tisch durchzulaufen. Das kann sonst keiner! Eines Tages stoße ich mir den Kopf an der Tischplatte. Darüber bin ich zuerst erstaunt und dann wütend. Ich versuche es noch einige Male, aber das Unter-dem-Tisch-Durchlaufen gelingt nie wieder. Ich begreife es einfach nicht, weiß nicht, woher das kommt. Ich finde das gemein! Nichts ist mehr, wie es einmal war.
Gartenweg – Mutters Blumenbeete, eingefasst mit Wackersteinen. Fast vergessen … ich bin das Kind auf dem Foto, Gesicht lächelt zaghaft. Vertrauensvoll. Hoffnungsvoll. Weißes Kleidchen, Sonn- oder Feiertag … Weiße Söckchen.
Etwas mollig, das Kind. In Anlehnung an den Katechismusunterricht wird es gefragt: „Woraus besteht der Mensch?“ Die richtige Antwort wäre gewesen: „Der Mensch besteht aus Leib und Seele.“ Das Kind aber antwortet: „Fukker und Peck!“ Das bedeutet: Zucker und Speck. Alle lachen, alle freuen sich.
Puppe an sich, an mich gepresst … Füßchen nicht fest auf dem Boden, wie kurz vor dem Stolpern … blonde, seidige Haare … in all den Jahren nicht wirklich verändert.
Wir müssen unser Haus verlassen. Beladen mit ein paar Decken eilen wir in den nahegelegenen Wald. Dort sehe ich einen großen Hügel. Er hat eine Öffnung. Es ist ein Bunker. Darin ist es ganz duster. Wir sitzen dichtgedrängt auf Holzbrettern. Meine Schwester schreit die ganze Zeit. Die Frauen aus der Stadt schreien auch. Die Frauen aus dem Dorf schreien nicht, sie sind ganz still – ich bin auch ganz still. Eine Frau aus dem Dorf betet den Rosenkranz. Ich glaube, die Leute aus der Stadt kennen keinen Rosenkranz, sie beten gar nicht richtig mit. Nach langer Zeit wird es auf einmal hell. Wir sehen Licht in der Öffnung vor dem Bunker und dürfen raus. Es ist heller Tag. Jemand fasst mich an der Hand, wir gehen zurück ins Dorf. Einer sagt: „Der Krieg ist zu Ende.“ Über dem Dorf sehe ich Rauch aufsteigen. Ich weiß nicht, ob unser Haus getroffen ist. Wir kommen nach Hause. Unser Haus ist noch da, aber die Waschküche ist kaputt, es ist ein großes Loch in der Decke, alle Fensterscheiben sind zersplittert und der Spiegel vom Schrank im Elternschlafzimmer. Das ist am schlimmsten. Schmitz’ Haus schwelt noch lange. Schmitz’ Monika und Hans kommen zu Besuch. Frau Schmitz ist gestorben. Sie hatte sich in dem hölzernen Unterbau von der Nähmaschine versteckt. Sie hatte Hans mit ihrem Körper geschützt – Hans ist unverletzt. Monika hat Splitter im Gesicht und am Körper. Schmitz’ waren nicht im Bunker. Schmitz’ Tante versorgt nun die Kinder. Nach einem Jahr heiratet sie Schmitz’ Papa. Sie trägt immer Schwarz und einen Haarknoten im Nacken.
Alle verheirateten Frauen tragen Schwarz oder Dunkelblau, wenigstens zur Messe am Sonntag. Das gehört sich so. Mutter trägt gerne dunkelblaue Kleider mit einem weißen Einsatz, sie sieht dann richtig fein aus. Die unverheirateten Mädchen, also die, die noch Fräulein sind, tragen farbige Kleidung, bis sie heiraten, und Dauerwelle. Zu Hause haben alle ein Schürze um, wir auch. Wir haben Alltags- und Sonntagskleider und Alltags- und Sonntagsschürzen und Alltags- und Sonntagsschuhe. Im Sommer laufen wir alltags barfuß oder in Holzschuhen herum. Die Holzschuhe macht der Holzschuhmacher aus einem Stück Holz. Er hobelt es zurecht und höhlt es aus, sodass man hineintreten kann. Meistens drücken die Holzschuhe, bis man sich an sie gewöhnt hat.
Weil wir im Lehrerhaus wohnen, müssen wir raus aus dem Haus, es gehört nämlich der Gemeinde, und die kann das beschlagnahmen. Der Bürgermeister bestimmt das, zusammen mit der Militärregierung. In unserem Garten wird eine Baracke aufgestellt, da müssen wir reinziehen. Nachts werden wir Kinder auf die Nachbarhäuser verteilt. Nur meine beiden Brüder dürfen weiter in dem Haus schlafen. Für die ist das ja nicht so gefährlich, denn sie sind ja Jungen. Seinerzeit dürfen die Jungen viel mehr als die Mädchen.
Soldaten wohnen jetzt in unserem Haus. Sie werfen die leeren Marmeladendosen hinter das Haus in eine Tonne. Die Dosen sind aber nicht ganz leer. Ich habe Hunger auf Marmelade, aber es sind so viele Wespen da, die krabbeln in den Dosen. Wespenstiche tun weh. Die Soldaten tragen so komische braune Uniformen und Käppis. Manchmal geben sie uns Kindern Schokolade. Alles in allem sind sie nett. Sie tun uns nichts. Sie haben immer Frauen bei sich, die haben wilde Haare und rote Fingernägel. Als ich das zum ersten Mal sehe, denke ich, dass ihre Finger bluten. Aber das ist nur rote Farbe, das ist kein Blut. Diese Frauen haben sich die Lippen sehr rot angemalt, knallrot sagen wir dazu.
Erst Jahre später können sich die normalen deutschen Fräuleins auch Nagellack leisten. Ich habe in meinem ganzen Leben meine Fingernägel noch nie rot lackiert – höchstens mal durchsichtig perlmuttfarben. Die Frauen mit den wilden Haaren, den roten Fingernägeln und dem angemalten roten Mund rauchen, was das Zeug hält. Wir Kinder sammeln die weggeworfenen Kippen auf, kratzen die Tabakreste heraus und schenken den neugewonnenen Tabak unseren Vätern und großen Brüdern. Die sind dankbar und drehen neue Zigaretten daraus. Sie freuen sich, sie haben keine Zeit zum Kippensuchen. Darum machen wir Kinder das. Mein Vater und meine Brüder rauchen nicht, aber einige von meinen Schwestern stinken schon sehr früh nach Qualm, besonders zwei.
Die Soldaten fahren immer mit ihren Jeeps herum und gehen oft auf Jagd. Ihre Damen gehen dann mit. Sie tragen auch Hosen wie Männer. Mutter findet das nicht gut. Später ändert sie ihre Meinung etwas. Als ich fünfzehn Jahre alt bin, bekomme ich eine lange Hose für die Klassenfahrt nach Norderney – aber nur für die Klassenfahrt, weil es auf See so zugig ist! Eine dreiviertellange Hose ist nicht so schlimm wie ein hochgewehter Rock.
Nach der Jagd liegen die Hasen alle in einer Reihe hinter unserem Hause – manchmal auch ein Reh. Wenn sie lange dort liegen, bekommen sie alles voll Läuse.
Die Soldaten bringen mir einige englische Wörter bei: Hello, please, thank you, how are you, my name is. Das sind Grundkenntnisse in Englisch.
Von den vielen Panzern sind die Teerstraßen ganz kaputt. Überall sind Absperrungen mit Stacheldrahtrollen. Wenn die Soldaten tanken, gießen sie das Benzin aus dem Kanister in den Tank. Dabei geht immer etwas daneben. Wenn es regnet, entstehen ganz schöne Farben auf dem Boden, das ist das Schönste, das man sehen kann.
In der Nachkriegszeit bekommen wir manchmal von dem Bauern Korn, Kartoffeln oder Milch. Viele Leute kommen aus der Stadt zum Betteln. Sie haben noch viel mehr Hunger als wir. Wir haben nur Hunger, aber die, die aus der Stadt kommen, die hungern. Das sieht man denen am Gesicht an und an den Händen. Meine Mutter gibt jedem etwas ab, obwohl wir selber wenig haben. Im Gemeindesaal sind Kriegsgefangene untergebracht. Sie wohnen hinter einem großen Drahtverhau. Sie dürfen nie raus, sie reden nichts, sie gucken auch nicht. Alle haben Glatze. Wenn meine Mutter kann, stellt sie einen Topf mit gekochten Kartoffeln für sie ab.
Dann ziehen andere Soldaten in unser Haus, sie haben andere Uniformen. Warum das alles passiert, weiß ich nicht – es ist einfach so. Sie schlachten in unserer Wohnküche ein Schwein, aber das habe ich nicht selber gesehen. Ich habe das nur gehört. Mutter ist empört darüber! Sie kochen und braten das Schwein, aber wir bekommen nichts ab von dem Fleisch.
Einer von den Neuen im Hause steht manchmal oben am Fenster. Wenn ich unten im Garten spiele, winkt er mich hoch. Ich muss immer gehorchen. Darum gehe ich unsere Treppe hoch zu seinem Zimmer. Da nimmt er mich auf den Schoß. Ich finde das komisch. Es hängt ein Bild an der Wand. Ich frage, ob das Rotkäppchen ist, aber er versteht mich nicht. Dann tut er etwas zwischen meine Beine … aber das habe ich vergessen – und sage es auch keinem.
Er hat kein Holzbett, er hat ein Feldbett. Ein Feldbett ist eine Matratze auf Stangen. Ein paar Mal sehe ich das Bett von oben. Es ist, als ob ich an der Zimmerdecke klebe und runterschaue. Später lese ich in einem New-Age-Buch, dass es so was gibt. Es sind außerkörperliche Erfahrungen, im Englischen Out-of-the-body Experiences. Das passiert schon mal, wenn etwas ganz schlimm ist und man nicht dabei sein will. Manchmal erlebt man etwas und bekommt erst viele Jahre später eine Erklärung dafür. Das ist aber gut, denn dann erfährt man nachträglich, dass man nicht gesponnen hat.
Immer wenn der winkt, muss ich hochgehen, denn er ist der Erwachsene und ich bin das Kind. Kinder müssen gehorchen – unter allen Umständen. Erst vierzig Jahre später erfahre ich von meiner Schwester, dass sie auch bei ihm war. Weiter unterhalten wir uns nicht darüber; wir fragen uns gegenseitig nichts und erzählen auch nichts weiter.
Unsere Väter, Onkels und Großväter sind meist alle gestorben, ohne noch je über die Kriegszeit geredet zu haben. Und wir, die Kriegskinder, die Kinder des Krieges, beginnen erst jetzt damit.
Manchmal stehe ich an der Straße und gucke nur so rum. Da sehe ich einen Mann. Er hat keine Uniform, keinen Anzug an. Er hat nur einen Sack an und Lappen um seine Füße gewickelt. Er hat keine Zähne.
Männer aus dem Dorf stellen einen Tisch auf die Dorfstraße und einen Stuhl dahinter. Der Bürgermeister setzt sich darauf. Er hat Papiere vor sich liegen. Der Heimkehrer steht vor dem Tisch, und der Bürgermeister trägt ein, dass er zurückgekommen ist. Er muss unterschreiben, dann darf er das Dorf betreten. Er ist wieder zu Hause! Unsere mitleidigen Nachbarn geben dem Heimkehrer viel gutes Essen – er stirbt daran. Das Essen war zu fett, das war er nicht gewohnt.
Einmal frage ich beim Kartoffelschälen in der Waschküche – meine Mutter schält sie, und ich darf sie in den Eimer mit Wasser plumpsen lassen –, also, ich frage sie: „Wo kommen denn die kleinen Kinder her?“ Mutter zögert ziemlich lange. Dann antwortet sie: „Die wachsen unter dem Herzen der Mutter.“ Ich frage weiter: „Und wie kommen die denn dahin?" Bis auf den heutigen Tag warte ich auf Antwort … Na ja, nicht ganz. Zwischenzeitlich habe ich mich woanders schlaugemacht.