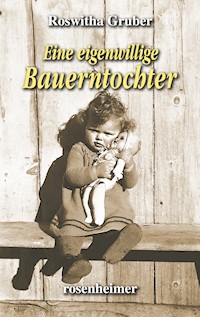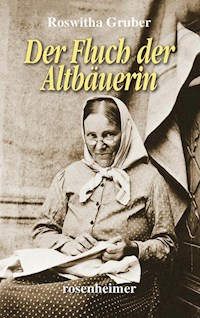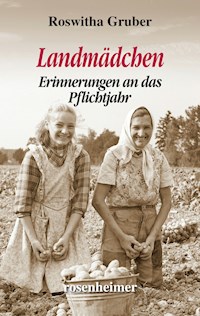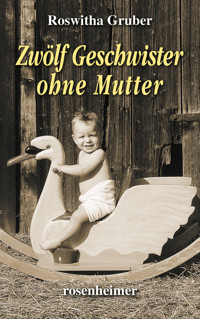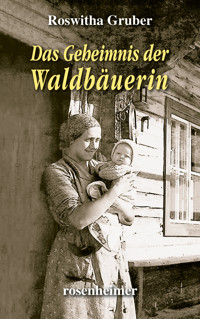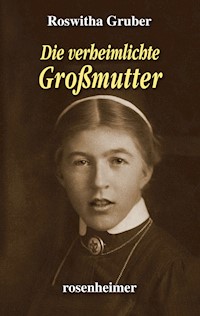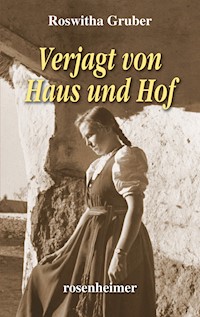16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Roswitha Gruber erzählt die bewegenden Geschichten und Schicksale einer Generation, die ohne technische Hilfsmittel und ohne viel Luxus groß geworden ist. Das persönliche Glück musste in dieser Zeit oftmals zugunsten wirtschaftlicher oder familiärer Interessen zurückstehen. Eine unbeschwerte Kindheit blieb den meisten verwehrt. Und dennoch blicken viele von ihnen mit Freude und Sehnsucht zurück in die Vergangenheit und erinnern sich gerne an den Zauber ihrer Kindertage. Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie dafür ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LESEPROBE zu
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2013
© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com
Titelfoto: © Bundesarchiv, Bild 183-27645-0028 / Fotograf: KleinLektorat: Ulrike Nikel, Herrsching am AmmerseeSatz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
eISBN 978-3-475-54342-5 (epub)
Worum geht es im Buch?
Roswitha Gruber
Wunderbare Kindertage
Großmütter erzählen
Roswitha Gruber erzählt die bewegenden Geschichten und Schicksale einer Generation, die ohne technische Hilfsmittel und ohne viel Luxus groß geworden ist. Das persönliche Glück musste in dieser Zeit oftmals zugunsten wirtschaftlicher oder familiärer Interessen zurückstehen. Eine unbeschwerte Kindheit blieb den meisten verwehrt. Und dennoch blicken viele von ihnen mit Freude und Sehnsucht zurück in die Vergangenheit und erinnern sich gerne an den Zauber ihrer Kindertage.
Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie dafür ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Schulzeit mit Hindernissen
Wintervorräte
Das Mädchen mit der Ziehharmonika
Frühe Verantwortung
Eine turbulente Kindheit
Bauerntöchter
Die Geschichte vom Storch
Jung gefreit …
Die Eselshochzeit
Die Motorradbraut
Leben und Liebe in der Backstube
Die Grenzgängerin
Aus der Kaiserzeit
Die Kindsmagd
Traummann oder Traumberuf
Vorwort
Seit ich denken kann, hat es mich interessiert, wie das Leben in einer Zeit aussah, die so ganz anders war als die selbst erlebte Gegenwart, und schon als Kind habe ich meine eigene Großmutter immer wieder gebeten: »Erzähl mir, wie es früher war.«
Diese Neugier habe ich niemals verloren, sondern zunehmend ältere Frauen, Großmütter eben, befragt, was ihnen an ihrer Kindheit bemerkenswert erschien und inwieweit sich ihre Beurteilung im Lauf der Jahre verändert hat.
Gemeinsam ist allen, dass sie ihre Kindheit und Jugend in einer wirtschaftlich und politisch sehr schwierigen Zeit verbrachten, in der persönliches Glück allzu oft aus Rücksicht auf die Familie zurückgestellt werden musste. Auch hatten die meisten Frauen noch unter der Benachteiligung der Mädchen zu leiden, durften bisweilen gar keinen Beruf erlernen oder mussten sich in ihrer Berufswahl familiären Zwängen fügen, und eine lange Ausbildung galt den Eltern in der Regel ohnehin als sinnlos und als verschwendetes Geld. Daneben gab es jedoch bereits einige wenige, die ihrer Zeit weit voraus und Vorreiter weiblicher Emanzipation waren. Selbst Aussteiger fanden sich damals schon, und so ist die Palette breit gefächert – angefangen vom einfachen, in bäuerlichen Traditionen verwurzelten Mädchen bis hin zur selbstbewussten Karrierefrau.
Denkbar unterschiedlich wie die Herkunft fällt auch der Rückblick auf das eigene Leben aus: Während die einen die eigene, wenngleich bescheidene Kindheit um nichts in der Welt eintauschen möchten gegen den heutigen Luxus, haben die anderen die Beschränkungen und den Mangel leidvoll empfunden und sich hinausgesehnt aus der häuslichen Enge. So sind die Erzählungen teils ernst und nachdenklich, teils heiter oder wehmütig – auf jeden Fall aber sind sie unschätzbare Zeugnisse aus einer Welt, die für die Jugend von heute teilweise Lichtjahre entfernt zu sein scheint.
Schulzeit mit Hindernissen
Doris, Jahrgang 1929, aus Jüchen bei Köln
Als meine Mutter merkte, dass es mit meiner Ankunft nicht mehr lange dauern würde, fuhr sie nach Köln. Sie hatte beschlossen, mich in einem Krankenhaus zur Welt zu bringen, was in der damaligen Zeit ganz und gar nicht selbstverständlich war, denn die meisten Frauen blieben zu Hause und holten die Hebamme des Ortes. Es war der Abend des 2. Oktober 1929, der Geburtstag des damaligen Reichspräsidenten Hindenburg.
Offenbar schien die ganze Nation mitzufeiern, denn im Radio wurden ohne Pause die Feierlichkeiten, die zu diesem Anlass in Berlin stattfanden, übertragen. Jede Frau, die ein Kind geboren hat, weiß, dass es ohnehin kein Vergnügen ist, stundenlang in den Wehen zu liegen, und was man in einer solchen Situation bestimmt nicht gebrauchen kann, ist eine permanente Geräuschkulisse. Nachdem meine Mutter die Berieselung eine ganze Weile stillschweigend erduldet hatte, bat sie die Hebamme schließlich zaghaft: »Könnten Sie das Radio bitte abstellen?«
Aber die gute Frau war offensichtlich in patriotischer Festtagsstimmung und fuhr meine Mutter unwirsch an: »Ach, nehmen Sie sich doch ein bisschen zusammen. Ich muss das jetzt hören.« So erblickte ich unter Geburtstagsreden und Marschmusik in den frühen Morgenstunden des 3. Oktober das Licht der Welt.
Eine meiner frühesten Erinnerungen hat mit meiner Großmutter väterlicherseits zu tun. Meine Mutter besaß in Jüchen ein kleines Landkaufhaus, in dem sich links die Lebensmittelabteilung befand und rechts eine Textilwarenabteilung, und über diesen Geschäftsräumen wohnte besagte Oma. Sie war eine kleine, zierliche, dabei aber robuste und zupackende Frau. Sie wurde neunzig Jahre alt, ohne jemals krank gewesen zu sein, abgesehen von den letzten vierzehn Tagen vor ihrem Tod. Immer, wenn ich sie besuchte, traf ich sie bei einer Arbeit an. Sie pflegte auf einem dreibeinigen Hocker zu sitzen, eine blau gestreifte Halbschürze umgebunden und einen Eimer zwischen den Knien. In der einen Hand hielt sie meist einen Hering, in der anderen ein Messer zum Abschuppen. Auf diese Weise bereitete sie Unmengen dieser Fische für den Verkauf in Mutters Geschäft vor.
Da meine Mutter den ganzen Tag im Laden stand, war sie froh, dass es in Jüchen einen Kindergarten gab. Dieser befand sich im Krankenhaus des Ortes und wurde von Ordensschwestern geleitet. Ich ging sehr gerne dorthin und fand es auch in Ordnung, dass ich, als ich längst ein Schulkind war, nach dem Unterricht noch eine Stunde im Kindergarten betreut wurde, bis ich zur Oma zum Essen ging, die jeden Tag eine Mahlzeit nur für uns beide zubereitete. Meistens war es etwas ganz Einfaches wie zerquetschte Pellkartoffeln mit Margarine, aber für mich war es eine Köstlichkeit, und ich denke noch heute oft daran, zumal mich dieses Essen immer an meine Großmutter erinnert.
Eigentlich wuchs ich auf wie ein Einzelkind, obwohl ich einen Bruder hatte, der jedoch neun Jahre älter war, aus der ersten Ehe meines Vaters stammte und bereits im Internat lebte, als ich anfing, meine Umwelt wahrzunehmen. Erst sehr viel später, nach dem Krieg, genoss ich die Tatsache, einen großen Bruder zu haben, der mich zu Festen, zu Tanzvergnügungen oder zu Ausflügen mitnehmen konnte, zu denen ich alleine noch nicht hätte gehen dürfen.
Eine frühe Erinnerung an meinen Bruder aber ist in meinem Gedächtnis hängen geblieben, weil sie auf mich einen nachhaltigen Eindruck gemacht hat. Es war an jenem Weihnachtsfest, als ich sieben oder acht war und er demnach sechzehn oder siebzehn. Wie immer am Heiligen Abend ging es bei meiner Mutter hektisch zu, denn, wie damals üblich, blieben die Läden selbst an diesem Tag bis zwanzig Uhr geöffnet, und selbst später klingelten bisweilen Kunden an der Hintertür, weil sie etwas vergessen hatten, und so konnte es spät werden, bis sie mit den Vorbereitungen für die Bescherung, die nicht wie heutzutage am Heiligen Abend, sondern am Weihnachtsmorgen nach dem Kirchgang stattfand, beginnen konnte. Es war üblich, dass mein Bruder ihr half. Gemeinsam schmückten sie den Baum, füllten die Teller mit Süßigkeiten, Nüssen und Obst, bauten die Krippe auf und richteten die Geschenke her – in diesem besagten Jahr gab es für mich einen Puppenwagen.
Um fünf Uhr am nächsten Morgen ging die ganze Familie, wie es Tradition war, in die Christmette, und wie immer war die Kirche so voll, dass nicht jeder einen Sitzplatz bekam. Meine Mutter und ich konnten uns gerade noch in eine Bank quetschen, doch mein Vater und mein Bruder mussten sich mit einem Stehplatz im Mittelgang, direkt neben uns, begnügen. Mein Bruder war damals hoch aufgeschossen, und ich weiß nicht, ob er zu schnell gewachsen und dazu übermüdet war oder ob die Luft bereits stickig zu werden begann – jedenfalls sah ich bei dem Lied: »Es ist ein Ros’ entsprungen«, wie er langsam nach vorne kippte und meinem Vater direkt ins Kreuz fiel. Es war noch sein Glück, dass er hinter dem Vater stand, denn sonst wäre er der Länge nach auf den Boden geschlagen oder einem fremden Menschen in den Rücken gefallen. Die kleine Ohnmacht war schnell überwunden, aber jedes Jahr an Weihnachten erinnerte uns mein Vater daran. Immer wenn das Lied »Es ist ein Ros’ entsprungen« erklang, pflegte mein Vater in seiner unverwechselbaren Kölner Mundart zu sagen: »Und he fiel mir up de Rück.«
Während meiner Zeit in der Volksschule wurden wir Kinder klassenweise auf die Felder zum Ernten geführt – Zuckerrüben, die in der fruchtbaren Kölner Tieflandsbucht bevorzugt angebaut wurden. Weil die Sonne auch im Frühsommer schon ganz schön brannte, verpasste meine Mutter mir einen Strohhut, was ich furchtbar fand, denn niemand außer mir arbeitete mit Hut, und die anderen lachten mich aus. Weil ich aber nicht wusste, wohin mit dem Hut, behielt ich ihn gewissenhaft auf, während ich auf Knien die unendlich langen Reihen entlangrutschte. Einige Wochen später war es unsere Aufgabe, Kartoffelkäfer zu sammeln – auch mit Hut. Heute erledigt man das mit Pestiziden, was sicherlich keine gesunde Alternative ist, doch ich glaube, damals wäre ich froh darüber gewesen, denn das Einsammeln der Käfer war eine ziemlich eklige Angelegenheit.
1939 brach der Zweite Weltkrieg aus und warf unsere Pläne über den Haufen. Eigentlich hätte ich aufs Gymnasium nach Köln gehen sollen, aber in so unsicheren Zeiten wollte meine Mutter mich nicht allein in die Stadt fahren lassen. Stattdessen hielt sie nach einer Schule abseits der Großstadt Ausschau und fand ein Internat in Euskirchen, von dem sie glaubte, dass ich dort in Sicherheit wäre.
Doch wieder kam alles anders als geplant. Die ursprünglich von Dominikanerinnen geleitete Schule wurde von der nationalsozialistischen Stadtverwaltung verstaatlicht und das Internat geschlossen. Mitten im Schuljahr stand ich ohne Bleibe da. Zwar gab es im Ort ein weiteres Internat, doch dort hätte ich erst zum nächsten Schuljahr aufgenommen werden können, wenn durch den Abgang der Abiturientinnen wieder Plätze für neue Bewohnerinnen vorhanden waren.
Um nicht das Gymnasium wechseln zu müssen, suchten meine besorgten Eltern nach einer Alternative: Mit einem anderen Elternpaar fanden sie für deren Tochter und mich eine Unterkunft bei einem alleinstehenden, älteren Fräulein, das uns nicht nur verpflegte und umsorgte, sondern auch streng darauf achtete, dass wir ein geregeltes Leben führten und pünktlich nach Hause kamen – eigentlich war es hier sogar strenger als im Internat. Aber im Grunde war das unserem Alter auch angemessen, denn um auf uns alleine gestellt zu sein, waren wir wirklich noch viel zu jung. Natürlich haben wir damals trotzdem bisweilen über unsere strenge Wirtin gestöhnt.
Dieses Arrangement war ebenfalls nicht von langer Dauer, denn nach einem Vierteljahr waren meine Eltern der Meinung, dass sie jetzt die optimale Lösung für mich gefunden hätten. Sie meldeten mich in der Euskirchener Schule ab und verfrachteten mich nach Ahrweiler, wo sie mich im Internat Kalvarienberg angemeldet hatten, das von Ursulinen geleitet wurde. Da diese Einrichtung zugleich das Mutterhaus des Ordens war, wo die Schwestern ihren Lebensabend verbrachten, war das Internat vom Zugriff der Nationalsozialisten verschont geblieben, während das dazugehörende Gymnasium bereits verstaatlicht worden war.
In den Jahren in Ahrweiler schloss ich Freundschaften, die ein ganzes Leben lang halten sollten. Leider konnten wir nur bis Ende 1944 auf dieser Schule bleiben, denn dann wurde im ganzen Reich der Schulunterricht eingestellt – sowohl wegen der ständigen Bombenangriffe als auch wegen der näher rückenden Front, denn Teile des linksrheinischen Gebiets, darunter Aachen, waren bereits von amerikanischen Verbänden eingenommen worden. Während meine Mutter und ich ins Sauerland, nach Nordenau in der Nähe von Winterberg, evakuiert wurden, musste mein Vater an der Heimatfront ausharren und dafür sorgen, dass keine Zweifel am siegreichen Ausgang des Krieges aufkamen. Er war nicht zu den Waffen gerufen worden, weil er bereits zu alt war, aber er wurde zur Produktion kriegswichtiger Güter verpflichtet. Sein Betrieb, der ursprünglich Herrenkonfektion hergestellt hatte, schneiderte jetzt Uniformen – bis zum bitteren Ende, als keine mehr gebraucht wurden.
In Nordenau hatte man uns auf einem Bauernhof ein Zimmer zugewiesen. Der Mann war im Krieg, und die junge Frau, die drei kleine Söhne hatte, betrieb mit dem Schwiegervater die Landwirtschaft, in der ich bald fleißig mithalf, um für meine Mutter und mich zusätzlich etwas Milch und Butter zu verdienen. So lernte ich bald, den Stall auszumisten, die Kühe zu melken und aus der Milch Butter zu machen.
Die Leute waren sehr nett zu uns, und wir gehörten praktisch zur Familie. Damit ich schulmäßig nicht zu sehr ins Hintertreffen geriet, organisierte meine Mutter mit anderen Müttern, die ebenfalls evakuiert worden waren, eine Art Privatunterricht beim Pfarrer, einem knorrigen alten Mann, der deftige Predigten liebte. Wir waren sechs Kinder, ungefähr gleichaltrig, die fortan täglich zum Unterricht ins Pfarrhaus marschierten, wo uns der geistliche Herr in Latein, Geschichte und natürlich Religion unterrichtete. Ein pensionierter Lehrer, der ebenfalls hierher geflüchtet war, übernahm den Unterricht in Mathematik, Deutsch und Erdkunde. Der alte Herr war froh, etwas zu tun zu haben, und wollte nicht einmal Geld für seine Bemühungen.
Unaufhaltsam rückten das Ende des Krieges und die siegreichen Amerikaner näher. Als wir das Trommelfeuer hörten, flüchteten wir uns in einen der zahlreichen Stollen, in denen Schiefer abgebaut wurde. Eigentlich hätten wir uns nach der Einnahme des Ortes unbehelligt in die Häuser zurückbegeben können, wären nicht auf unserem Hof in einem Schuppen drei deutsche Soldaten entdeckt worden, die sich dort versteckt hielten. Dadurch wurden die Amerikaner misstrauisch und bestanden darauf, die Bevölkerung vorerst weiter in den finsteren Stollen festzuhalten, bis klar war, ob sich noch andere Wehrmachtsangehörige in Nordenau befanden.
Meine Mutter und ich sowie die junge Bäuerin mit ihren Kindern allerdings hatten die Wahl, entweder mit den anderen Bewohnern des Ortes in den Stollen zu gehen oder in die fensterlose Milchküche unseres Hofes, die an eine Felswand angebaut war und sich hinter der normalen Küche befand. Zwar würden wir auch dort eingeschlossen werden, doch das schien uns allemal besser, als im Stollen festzusitzen. Wir befürchteten nämlich, die Soldaten könnten über Nacht weiterziehen und vergessen, den Stollen wieder aufzuschließen. Dann hätten wir alle in der Falle gesessen, weil niemand mehr im Ort war, der uns hätte befreien können. Wenn wir jedoch in der Milchküche blieben, würden wir im Ernstfall schon irgendwie herauskommen und konnten den Eingeschlossenen zu Hilfe eilen.
Zu unserer Erleichterung stellte sich bald heraus, dass ein einziger Mensch nicht eingeschlossen worden war, und das war der Großvater, weil er die amerikanischen Soldaten mit seinen Lebensmittelvorräten bewirten musste. Dummerweise entdeckten sie auch seine Schnapsvorräte, denen sie eifrig zusprachen und ziemlich schnell betrunken waren, was den Großvater in große Sorge versetzte. Während der ganzen Nacht bewachte er ängstlich die Tür zur Milchküche, denn damals war die Angst vor Racheaktionen groß, und die deutsche Propaganda hatte dieses Feindbild geschürt, nicht nur, was die Russen anging. Wir aber blieben verschont.
Als der Krieg zu Ende war, begann das Hungern, denn die Vorräte waren geplündert, und zu kaufen gab es fast nichts, vor allem kein Brot. Also lernten wir, uns von Wildkräutern zu ernähren: Brennnesseln wurden zu einer Art Spinat und Löwenzahn zu Salat verarbeitet. Einmal hieß es, in Westernberg gäbe es Brot, da habe ein Bäcker seinen Laden wieder geöffnet, doch bis wir nach zwei Stunden Fußmarsch dort ankamen, war alles ausverkauft.
Die Rettung für uns kam durch meinen Vater, der ebenfalls den Krieg heil überstanden hatte und nun energisch alles daransetzte, uns so schnell wie möglich nach Hause zu holen.
Wochenlang hatten wir nichts von ihm gehört, wussten nicht, ob er den Krieg überlebt hatte, denn schließlich war meine Heimatregion Schauplatz heftiger Kämpfe gewesen, und zudem hatten die gewissenlosen braunen Herren, die all das unermessliche Leid ausgelöst hatten, auch noch den Befehl ausgegeben, beim Rückzug alles zu zerstören, damit nichts den Siegern in die Hände fiel. »Verbrannte Erde« nannten sie das. Gott sei Dank wurde dieser Befehl nicht konsequent in die Tat umgesetzt, und mein Vater kam ebenfalls unbeschadet davon.
Wenige Wochen nach Kriegsende tauchte er plötzlich mit einem kleinen, von einer Plane überspannten Pritschenwagen bei uns auf. Er versprach uns, dass er uns jetzt in die Heimat und an die »Fleischtöpfe« zurückbringen würde, denn in der niederrheinischen Tiefebene gab es viele große und ertragreiche Bauernhöfe, zu denen er freundschaftliche Kontakte unterhielt. Dort würde immer etwas für seine Familie abfallen.
Nachdem einige Behördengänge erledigt waren, konnten wir endlich aufbrechen – es war fast ein kleiner Treck, der da in Nordenau aufbrach, denn mit uns zogen auch andere Familien, die wie wir aus dem Rheinland stammten und jetzt Richtung Heimat strebten, um zu sehen, was ihnen geblieben war.
Die Fahrt verlief völlig problemlos, bis wir den Rhein erreichten, denn jetzt stellte sich die Frage, wie wir den breiten Strom mit dem Wagen überqueren sollten. Rheinauf und rheinab waren nämlich alle Brücken beim Rückzug der Wehrmacht gesprengt worden, und die provisorischen Pontonbrücken, die man beim Vormarsch der Alliierten errichtet hatte, waren eigentlich den Besatzungssoldaten und ihren Fahrzeugen vorbehalten. Mein geschickter Vater brachte mit seinem Organisationstalent jedoch irgendwie das Kunststück fertig, dass wir die Pontonbrücke bei Bonn-Beuel benutzen durften.
Bis zum Oktober 1945 hatten sich die Verhältnisse so weit normalisiert, dass die Schulen wieder geöffnet wurden. Ich kehrte in mein Internat auf dem Kalvarienberg zurück und durfte sogar eine Klasse überspringen, weil ich aufgrund des Privatunterrichts wesentlich weiter war als meine Klassenkameradinnen.
Wenn ich gedacht hatte, dass nun, da der Krieg vorbei war, das Leben leichter werden würde, so sah ich mich gehörig getäuscht. Der erste Winter ging ja noch, weil er nur mäßig kalt war und wir noch Heizmaterial hatten. Aber dann kam der Winter 1946/47 mit klirrender Kälte und Unmengen von Schnee. Die Situation im Internat war kaum auszuhalten, denn es war nicht nur wahnsinnig kalt, es gab auch so gut wie kein Brennmaterial mehr auf dem Kalvarienberg.
Solange noch kein Schnee fiel, gingen wir Schülerinnen in die umliegenden Wälder, um Reisig und Zapfen zu sammeln und auf diese Weise Brennbares zusammenzutragen. Es gelang uns jedoch nicht, bis zum richtigen Wintereinbruch so viel herbeizuschaffen, um ausreichende Vorräte anzulegen, denn sobald der Schnee den Waldboden bedeckte, fanden wir nichts mehr – und es gab viel Schnee in diesem Jahr.
Deshalb wurde bald im ganzen Kloster nur noch ein einziger Raum beheizt, das sogenannte Studienzimmer. In der Mitte des Raumes bullerte ein Kanonenofen, in dem man die Glut tüchtig schürte, sodass diejenigen, die direkt um ihn herum saßen, vor Hitze fast platzten, und die Schülerinnen auf den entfernteren Plätzen bekamen kaum etwas von der Wärme ab, und an den Fenstern blühten die Eisblumen in voller Pracht. Es dauerte nicht lange, da hatten die meisten von uns Erfrierungen an Händen und Füßen, und wir konnten nichts anderes dagegen tun, als Salbenverbände anzulegen. Am schlimmsten schmerzten die Frostbeulen, wenn wir in die Wärme kamen, die wir andererseits doch so sehr vermissten.
Ein weiteres Problem stellten die Mahlzeiten dar. Wie überall im Nachkriegsdeutschland war auch bei uns die Ernährungslage denkbar schlecht. Zum Frühstücksbrot gab es Kürbismarmelade, die meist steinhart gefroren war, dazu Eichelkaffee, der zwar nicht schmeckte, aber wenigstens warm war. Mittags stand dann eine dünne Gemüsesuppe auf dem Tisch, denn obwohl die Schwestern ihren großen Garten eifrig bebauten, reichte das Gemüse bei so vielen Leuten bei Weitem nicht aus.
Vom Glück begünstigt waren nur jene Mädchen, die von großen Bauernhöfen stammten und regelmäßig mit den begehrten Fresspaketen bedacht wurden. Sie erhielten dann jeden Tag von der Küchenschwester eine zusätzliche Ration aus ihren Paketen zugeteilt. Für uns andere war es hart, dies mitanzusehen – vor allem für jene, die wie meine Freundin Marianne von ihren Eltern gar nichts erwarten konnten. Doch eines Abends fand sie auf ihrem Teller ein Schinkenbrot und am nächsten Abend wieder. So ging das einige Abende weiter, und Marianne verzehrte mit Genuss die unverhofften Köstlichkeiten, bis ihr endlich ein Licht aufging. Ihr gegenüber saßen nämlich zwei Schwestern, Bauerntöchter, und sie hörte, wie die eine klagte: »Ich weiß überhaupt nicht, wie das möglich ist. Wir haben doch erst vor kurzem das Paket mit dem Schinken bekommen, und jetzt ist er schon alle.«
Um Gottes willen, dachte Marianne, das war bestimmt der Schinken, den sie gegessen hatte. Das musste ein Irrtum in der Küche gewesen sein. Sie ging zu Schwester Marcella und sagte: »Ihnen ist ein Fehler unterlaufen. Versehentlich haben Sie von dem Schinken der beiden Schwestern etwas auf meinen Teller getan.«
»Das war kein Versehen«, schmunzelte die alte Schwester.
»Aber Schwester Marcella!«, entsetzte sich Marianne. »Das dürfen Sie doch nicht tun! Sie können doch anderen Kindern nicht etwas wegnehmen, um es mir zu geben. Das will ich nicht.«
Die Küchenschwester ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Kind, sei mal schön ruhig. Das macht die Schwester Marcella ganz allein mit dem Herrgott aus.«
Trotz Kälte und Hunger freuten wir uns auf Weihnachten, zumal wir endlich nach Hause fahren konnten. Meine Freundin Alice, die nicht weit von Jüchen zu Hause war, hatte nahezu den gleichen Heimweg wie ich. Ahrweiler lag in der französischen Besatzungszone, der Kölner Raum dagegen in der britischen Zone. In Remagen mussten wir die Grenze passieren, was normalerweise für Privatpersonen nicht schwierig war. Nun saßen wir aber in einem Zug, der mit Menschen überfüllt war, die ganz offensichtlich vom Hamstern kamen. Es handelte sich um Leute aus Düsseldorf, Köln und Bonn oder anderen großen Städten, die ins Ahrtal gefahren waren, um dort Wertgegenstände gegen Rotwein einzutauschen. Wein war zu jener Zeit neben Zigaretten zu einer Art Ersatzwährung geworden, mit der man auf dem Schwarzmarkt Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs erstehen konnte.
Weil die Franzosen jedoch verboten hatten, Wein auszuführen, fanden in den Zügen regelmäßig Kontrollen statt. Wenn die Schmuggler dabei auf einfache Soldaten stießen, war das kein Problem – die nahmen ihnen einfach die Flaschen ab und steckten sie heimlich ein. Waren aber Offiziere unter den Kontrolleuren, verlief die Sache anders, denn die Flaschen wurden zwar ebenfalls requiriert, dann jedoch Stück für Stück an der Bahnsteigkante zerschlagen.
Genau eine solche Szene spielte sich an dem Tag ab, als wir in die Weihnachtsferien fuhren. In Remagen wehte nicht nur über dem Bahnhofsgelände ein lieblicher Rotweinduft, sondern das ganze Bahngelände war mit roten Lachen und Scherben übersät, und die französischen Kontrollbehörden beschlossen, für diesen Tag keinen Zug mehr passieren zu lassen – weder in der einen noch in der anderen Richtung.
Außer Alice und mir gab es noch einige andere Kinder, die nach Norden wollten. Wir taten uns also zusammen und tippelten bis zur Straßensperre, wo es von einer Zone in die andere ging, und hofften, dass uns vielleicht ein Auto mitnehmen würde. Wir hatten Glück, denn bald sahen wir einen Personenwagen näher kommen. Die Grenzbeamten hielten ihn an, kontrollierten die Papiere und das Fahrzeug. Das war unsere Chance, und freundlich fragten wir bei dem Fahrer an, ob er uns mitnehmen könne. Kein Problem, meinte er, doch leider war nur Platz für zwei von uns. Da Alice und ich die Ältesten waren, beschlossen wir, den Jüngsten, zwei elfjährigen Mädchen, den Vortritt zu lassen. Wir schärften dem netten Autofahrer noch ein, dass er die beiden bis zu ihren Eltern bringen musste, was er auch versprach, und erklärten ihm genau, wo sie wohnten.
Wenig später tauchte ein Lastwagen mit Anhänger auf, der ebenfalls kontrolliert wurde. Der Fahrer war sofort bereit, die restlichen acht Mädchen mitzunehmen. Über die Anhängerkupplung kletterten wir in den mit einer Plane überspannten Pritschenwagen.
Plötzlich jedoch hatte es der Mann – aus uns unbekannten Gründen – sehr eilig, wegzukommen. »Rasch, rasch!«, rief er und fuhr los, ohne darauf zu achten, ob schon alle aufgestiegen waren. Irgendwie kam uns die Situation äußerst dramatisch vor – in diesen unsicheren Zeiten wusste man ja nie. Nicht alle aus der Gruppe schafften es, auf den Wagen zu steigen, und andere, die gerade dabei waren, über die Kupplung zu klettern, konnten wir nur mit Mühe festhalten und auf die sichere Pritsche ziehen, sonst wären sie womöglich unter die Räder des Anhängers gekommen. Der Schreck steckte uns allen noch lange in den Knochen, in die zusätzlich auf dem zugigen Wagen die bittere Kälte kroch, doch schließlich überwog das Glücksgefühl, endlich in Richtung Heimat unterwegs zu sein.
Nach und nach stiegen unsere Weggefährtinnen eine nach der anderen aus, bis schließlich nur noch Alice und ich übrig waren. Mittlerweile war es dunkel geworden, als plötzlich der Wagen mit einem Ruck anhielt und der Fahrer lapidar sagte: »Steigt aus. Von hier aus müsst ihr allein weiter.«
Irgendwo in der Finsternis erkannten wir, dass wir uns am äußersten Stadtrand von Köln befanden. Aber die Stadt gab es eigentlich nicht mehr, denn sie war eine einzige Trümmerwüste ohne Beleuchtung und Straßenschilder, die uns die Orientierung erleichtert hätten. Ziellos stolperten wir eine Zeit lang über Steine und Balken, bis wir endlich in weiter Ferne die Silhouette des Domes ausmachen konnten, der wie durch ein Wunder stehen geblieben war. Jetzt hatten wir endlich einen Anhaltspunkt, auf den wir zusteuern konnten, zumal sich unsere Augen nach und nach an die Dunkelheit gewöhnten.
Trotzdem war uns unheimlich zumute, als wir so mutterseelenallein durch diese scheinbar ausgestorbene Stadt stapften und gegen den Nachthimmel deutlich die Umrisse der Ruinen und Trümmerberge wahrnahmen. Meine Freundin jammerte ein ums andere Mal: »Ach, ich habe solche Angst!«
Angst hatte ich auch, aber was half es? Wir mussten schließlich weiter. Endlich hatten wir uns bis zum Hauptbahnhof durchgekämpft, der ja ganz nah am Dom liegt. Der einzige Zug, der überhaupt noch in unsere Richtung fuhr, ging erst gegen Mitternacht und endete schon in Pullheim, was noch nicht einmal ein Drittel der Strecke ausmachte. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Auf jeden Fall wollten wir vom Bahnhof weg, wo es nicht nur bitterkalt war, sondern auch von Schwarzhändlern nur so wimmelte.
Zunächst steuerten wir ein erleuchtetes Restaurant in der Nähe an und waren froh, wenigstens ein sogenanntes Heißgetränk zu bekommen – nichts anderes als heißes Wasser mit ein bisschen Farbe drin, aber so durchgefroren, wie wir waren, tat es uns gut. Dazu packten wir unsere Brote aus, die Schwester Marcella uns liebevoll hergerichtet hatte, inzwischen jedoch leider steinhart gefroren waren. Unsere Freude währte nicht lange, denn schon bald ersuchte man uns höflich, das Lokal zu verlassen, weil es geschlossen wurde. Also blieb uns nichts anderes übrig, als wieder zurück zum Bahnhof zu gehen und uns in den bereits wartenden Zug nach Pullheim zu setzen, in dem wir erbärmlich froren. Wir zählten die Minuten bis zur Abfahrt, doch wir mussten noch Stunden warten, denn die Tatsache, dass ein Zug bereitstand, bedeutete keineswegs auch seine baldige Abfahrt.
An der Endstation angekommen, standen wir erneut auf der Straße. Was nun? Bis zu uns nach Hause wandern, bei Nacht und Nebel, erschien uns unmöglich. Da kam uns Felicitas in den Sinn, eines der beiden kleinen Mädchen, die wir am Morgen dem wildfremden PKWFahrer anvertraut hatten. Wir wussten, dass ihr Vater in Pullheim eine Firma besaß, die Landmaschinen vertrieb – die musste doch zu finden sein.
Sollte man denken, doch da der Bahnhof sich außerhalb des Ortes befand, hatten wir nicht einmal eine vage Vorstellung davon, wo Pullheim überhaupt lag und in welche Richtung wir gehen mussten.
Der Zufall kam uns zu Hilfe in Gestalt des Bahnbeamten, der noch den letzten Zug abgewartet hatte und gerade aus dem Gebäude trat. Ihn fragten wir, bevor er sich auf sein Rad schwingen und davonfahren konnte, nach dem Weg, und nachdem sich unsere Augen erneut an die Dunkelheit gewöhnt hatten, schlugen wir tastend die angegebene Richtung ein und hofften inständig, bald bei Felicitas und in Sicherheit zu sein.
Weit nach Mitternacht standen wir dann endlich am Eingang des schlafenden, völlig dunklen Ortes, den auch nicht der geringste Lichtschein erhellte. Es schien, als ob sich alles gegen uns verschworen hätte, selbst Mond und Sterne, als wir plötzlich am anderen Ende des Dorfes – wie ein verirrtes Seelchen – ein winziges Licht entdeckten, auf das wir zusteuern und trotz der späten Stunde anklopfen und schüchtern nach dem Haus von Felicitas fragen konnten. Gottlob waren die Leute nett und erklärten uns den Weg.
Endlich, endlich schienen wir am Ziel zu sein, doch bei Felicitas öffnete niemand. Wie wir später erfuhren, hatten die Menschen Angst vor herumstreunenden Gruppen ehemaliger Zwangsarbeiter, die einst von den Deutschen in den besetzten Ländern aufgegriffen und nach Deutschland verschleppt worden waren. Nicht alle hatten wieder nach Hause gefunden, manche waren völlig entwurzelt und zogen auf der Suche umher nach Dingen, die sie zu Geld machen konnten. Deshalb hatten es sich die Bewohner einsam gelegener Häuser und Gehöfte auf dem Land angewöhnt, alles zu verrammeln und auf keinen Fall die Tür zu öffnen.
Wir zogen also wieder und wieder am Glockenseil. Aber es tat sich nichts. Erst als wir aus voller Kehle immer wieder nach Felicitas schrien, merkten die Hausbewohner wohl endlich, dass keine Gefahr drohte. Jetzt kam Leben in die Bude! Wir hörten Geräusche im Haus, sahen hin und her huschenden Kerzenschein, und Schritte näherten sich der Haustür.
In diesem Moment waren wir es, die es mit der Angst zu tun bekamen. Hoffentlich war Felicitas überhaupt heil zu Hause angekommen! Was, wenn die beiden kleinen Mädchen, die wir in gutem Glauben am Morgen einem wildfremden Menschen anvertraut hatten, nicht wohlbehalten zu Hause abgeliefert worden waren? Was, wenn sich jetzt die Tür öffnete und die Eltern uns nach dem Verbleib ihrer Tochter fragen würden? Was, wenn sie uns bittere Vorwürfe machten, denn wir wären schließlich nicht einmal in der Lage gewesen, ihnen zu sagen, wo sie sich überhaupt befand?
Als unsere im Flüsterton geäußerten Bedenken an diesem Punkt angelangt waren, hätten wir am liebsten die Beine in die Hand genommen und wären getürmt. Dazu jedoch war es zu spät, denn die Haustür öffnete sich, und uns fiel ein Riesenstein von der Seele, denn vor uns standen zwei freundliche Erwachsene und dahinter ein kleines Mädchen im Nachthemd, das uns in diesem Moment vorkam wie ein Weihnachtsengel.
Felicitas war bereits am frühen Abend wohlbehalten zu Hause angekommen, und zum Dank für unsere Fürsorge nahmen die Eltern uns jetzt bereitwillig auf. Wir waren gerettet, bekamen zu essen und zu trinken und ein warmes Bett, in dem wir wie die Murmeltiere schliefen.
Nur unsere armen Eltern, die fest mit unserer Ankunft gerechnet hatten, wussten nichts über unseren Verbleib, doch am anderen Morgen konnten wir problemlos weiterreisen und wurden von unseren Eltern glückstrahlend in die Arme geschlossen.
Meine Mutter erzählte mir, welch schreckliche Nacht sie verlebt hatte: Immer wieder habe sie die Hand aus dem Fenster gestreckt, um zu fühlen, wie kalt es sei, und voller Angst darüber nachgedacht, wie lange man wohl bei solcher Kälte überleben könne.
Nachdem dieses Abenteuer ein gutes Ende gefunden hatte, beschlossen meine Eltern, dass ich nicht mehr auf den Kalvarienberg zurückkehren sollte. Sie wollten weder sich noch mich jemals wieder in eine solche Situation bringen. Daher meldeten sie mich nach den Weihnachtsferien in Mönchengladbach in der Marienschule an, und so wurde ich doch noch für über zwei Jahre Fahrschülerin – übrigens gemeinsam mit Alice, die ebenfalls nicht mehr nach Ahrweiler zurückkehrte.
Von Jüchen nach Mönchengladbach sind es nur achtzehn Kilometer, was auch damals eigentlich kein Problem gewesen wäre, hätte es nicht mit dem Sieben-Uhr-Zug eine besondere Bewandtnis gehabt, denn um diese Uhrzeit fuhren nicht nur Schüler und Berufstätige, sondern auch all jene, die vom nächtlichen Kohlenklau zurückkamen. Obwohl wir mittlerweile das Jahr 1947 schrieben, herrschte noch immer Mangel an allen Dingen des täglichen Bedarfs, darunter auch an Heizmaterial. Deshalb strömten die Bewohner der ganzen Region nachts in das Braunkohlengebiet um Grevenbroich und Frimmersdorf, um sich zu bedienen, wenn beim Beladen der Güterwaggons etwas abfiel – oder auch, um nachzuhelfen, dass Briketts von den offenen Wagen fielen. Eigentlich war das Diebstahl, und man durfte sich nicht erwischen lassen, doch niemand hatte ein schlechtes Gewissen. Kein Geringerer als der Kölner Kardinal Frings hatte mit seinem Ausspruch: »Was man zur Existenzsicherung entwendet, ist kein Diebstahl, das ist ›Fringsen‹«, diese Beschaffungsmaßnahme kirchlicherseits legalisiert.
Jeden Morgen traf ich also im Zug auf die übermüdeten Menschen, die von ihrer nächtlichen »Fringstour« zurückkamen. Wenn sich beim Halt in Jüchen die Zugtüren öffneten, war der Zug bereits proppevoll, und meist bekamen wir nur noch einen Platz auf den prallen Kohlesäcken, die überall herumstanden.
Als ich endlich das Abitur in der Tasche hatte, begann ich ein Studium der Volkswirtschaft an der Universität Bonn. Genauer gesagt studierte ich in Bad Godesberg, denn an der teilweise im Krieg zerstörten Alma Mater waren noch nicht wieder alle Gebäude im bezugsfähigen Zustand, und dazu gehörte leider auch meine Fakultät, die aus diesem Grund ins beschauliche Godesberg ausgelagert worden war.
Wenn es nach meinen Wünschen gegangen wäre, hätte ich Chemie vorgezogen, doch mein Vater beharrte auf Volkswirtschaft, damit ich in der Lage wäre, später seine Kleiderfabrik zu leiten. Mein Bruder kam dafür nicht in Betracht, weil er die Kerzenfabrik aus der mütterlichen Familie übernehmen sollte. Also zeigte ich mich einsichtig und wählte das vom Vater vorgeschlagene Studium, wechselte jedoch nach zwei Semestern an die Universität Freiburg, weil ich dort mehr Gewicht auf Betriebswirtschaft legen konnte.
Ein Wechsel des Studienplatzes war damals kein Problem, wohl aber die Suche nach einem Studentenzimmer, denn in den vom Krieg zerstörten Städten war Wohnraum knapp. Der Zufall kam mir zu Hilfe, denn der Bruder einer Kommilitonin studierte in Freiburg und bekam jetzt den Auftrag, für mich eine Bude aufzutreiben.
Dieser Bruder wiederum hatte einen Freund, der für eine Bekannte aus Münster ein Zimmer beschaffen sollte, und die beiden Herren machten sich die Sache sehr leicht. Anstatt nach zwei einzelnen Räumen Ausschau zu halten, griffen sie gleich zu, als ihnen ein Doppelzimmer angeboten wurde. Als ich davon erfuhr, ergriff mich Entsetzen. Mit einer wildfremden Person sollte ich ein Zimmer teilen? Was, wenn sie komische Marotten hatte? Was, wenn sie eine unausstehliche Person war?
Wohl oder übel musste ich jedoch in den sauren Apfel beißen und fuhr mit zwiespältigen Gefühlen nach Freiburg. Mein ganzes Gepäck bestand aus einem Koffer und einer Aktentasche voller Bücher, die ich durch die halbe Stadt bis zur angegebenen Adresse schleppte, einer Hauswirtschaftsschule, in deren Hauptgebäude neben dem Schülerwohnheim noch ein kleines Altenheim untergebracht war. Die Zimmer für die Studentinnen lagen dagegen in einem Hintergebäude, wo vormals, als das Anwesen ein Gut gewesen war, vermutlich Knechte und Mägde gehaust hatten.
Die Einrichtung war mehr als spartanisch: Rechts und links vom Fenster befand sich je ein Eisenbett, und in der Mitte des Raumes stand ein Tisch mit zwei Stühlen. An der Wand neben der Tür gab es eine Kommode mit Waschschüssel und einem Krug darauf, mit dem man sich das Wasser von der Zapfstelle im Gang holen konnte. Die Toilette für alle sechs Studentinnen dieser Wohneinheit befand sich ebenfalls auf dem Flur.
Da ich vor meiner Mitbewohnerin, von der ich nicht einmal den Namen wusste, angekommen war, belegte ich das linke Bett und richtete mich, so weit es ging, häuslich ein. Obwohl es für das Abendessen noch ein bisschen zu früh war, ging ich nach dem Auspacken in den Speisesaal der Hauswirtschaftsschule. An den langen Tischen saßen bereits einige Mädchen, die sich gedämpft unterhielten. Ich nahm an einem der Tische Platz und betrachtete die Mädchen forschend. Ob wohl eine von ihnen meine Zimmergenossin war?
In diesem Moment betrat ein anderes junges Mädchen den Raum, und ich dachte, dass ich so eine wie sie gerne als Mitbewohnerin hätte. Obwohl noch viele Plätze frei waren, setzte sie sich genau neben mich und stellte sich vor. Schnell fanden wir heraus, dass wir wirklich künftig das Zimmer teilen würden.
Erleichtert atmeten wir beide auf, denn auch sie hatte ähnliche Befürchtungen gehegt wie ich. Grundlos, denn zwischen uns entstand auf den ersten Blick eine tiefe Sympathie, die nicht nur die ganze Studienzeit über anhielt, sondern sich zu einer Freundschaft fürs Leben entwickelte, in die später auch unsere Ehemänner miteinbezogen wurden.
Wintervorräte
Nanni, Jahrgang 1928, aus Kössen/Tirol
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, so habe ich den Eindruck, dass unser Leben nur daraus bestand, Vorräte für den Winter anzulegen.
Im Frühjahr fing das mit Rübensetzen und Rübenziehen an, und mit Heumachen ging es weiter. Schon als kleines Mädchen, noch bevor ich in die Schule kam, wurde ich für solche Tätigkeiten eingespannt. Für mich und meine um ein Jahr ältere Schwester gab es extra kleine Rechen, mit denen wir erst das Heu wenden und es später zu Haufen zusammenharken mussten. Schön fand ich es, wenn das Heu aufgeladen wurde, denn dann war es meine Aufgabe, das Pferd am Zügel von Heuhaufen zu Heuhaufen zu führen.
Schwierigere Sachen wie Melken und mit der Sense mähen lernte ich erst später, als ich älter war und schon die Schule verlassen hatte. Da wurde mir auch beigebracht, dass es Wiesen gab, die nur einmal im Jahr gemäht wurden, und andere, bei denen man zweimal ran musste. Als kleines Kind hatte ich davon keine Ahnung – da war jede Wiese für mich gleich und vor allem mehr ein Spiel- als ein Arbeitsplatz.
Überhaupt betrachteten wir all diese Tätigkeiten, bei denen wir eingesetzt wurden, zunächst als Spiel, aber das waren sie nicht, denn nach und nach wuchsen wir wie unsere große, sieben Jahre ältere Schwester zu vollwertigen Arbeitskräften heran. Je älter ich wurde, desto mehr lernte ich, und desto verantwortungsvoller wurden meine Aufgaben.
Im Sommer ging es an die Getreideernte. Zuerst kam der Roggen dran, dann der Weizen. Alles mähten der Vater und der Knecht damals von Hand. Gerste, Hafer und Flachs wurden in meiner frühen Kindheit noch mit der Sichel gemäht – eine Arbeit, die auch Frauen erledigten, und so wurden hierfür immer Aushilfen aus dem Dorf angestellt. Die Aufgabe von uns Mädchen war es, aus Stroh Seile zu drehen und die Garben zu binden.
Kaum war das Getreide eingebracht, nahte die Kartoffelernte. Das hieß, sich den ganzen Tag über bücken zu müssen, sodass man abends ganz krumm und mit Rückenschmerzen heimkam und sich vor dem nächsten Tag fürchtete, aber so war das nun einmal auf dem Land. Wir lebten von den Erträgen unserer Äcker, und da musste man oft die Zähne zusammenbeißen.
Ab Ende August bis in den Oktober hinein waren wir außerdem im Haus mit den Obst- und Gemüsevorräten für den Winter beschäftigt. In unserem Garten wuchsen neben allerlei Obstsorten reichlich Erbsen und Bohnen, Weißkraut und Möhren.
Die Bohnenpflanzen mussten für mehrere Tage über Stangen in die Sonne zum Trocknen gehängt werden. Allerdings waren die Gestelle überdacht, sodass die Pflanzen nicht nass wurden. Waren sie trocken genug, legte man sie auf eine große Plane und drosch sie mit Dreschflegeln.
Kraut und Schalen benutzte man als Streu fürs Vieh, die Bohnen selbst füllte man in Leinensäckchen und hängte sie unterm Dach auf, damit die Mäuse sie nicht erreichen konnten. Im Winter kamen sie dann als herzhafte Bohnensuppe mit Speck auf den Tisch. Ähnlich verfuhr man mit den Erbsen, die ebenfalls einen wichtigen Platz auf der winterlichen Speisekarte einnahmen.
Als Nächstes musste Kraut eingemacht werden. Die Kohlköpfe wurden mit dem Messer halbiert und mit einem speziellen Hobel in feine Streifen geschnitten, die dann Lage für Lage in ein großes Holzfass geschichtet, mit Salz bestreut und mit einem Holzstampfer kräftig gestampft wurden. War das Fass voll, wurde es mit zwei halbrunden Brettchen abgedeckt und mit einem dicken Stein beschwert. Wenn es einige Wochen im kühlen Keller gegärt hatte, war das Kraut fertig zur Weiterverwertung.
Von allen Gemüsesorten verursachten Möhren die wenigste Arbeit, denn sie wurden einfach in eine Mulde im Boden gelegt und mit Sand bedeckt – auf diese einfache Weise blieben sie den ganzen Winter über saftig, als wären sie frisch geerntet.
Obst in Gläsern einzumachen, war damals bei uns nicht üblich. Äpfel, Zwetschgen und Birnen wurden vielmehr in einem speziellen Ofen gedörrt und bildeten dann eine unerlässliche Zutat für unser weihnachtliches Früchtebrot, das wir alle liebten. Ein Weihnachtsfest ohne diese Leckerei wäre für uns nicht denkbar gewesen, und damit wir an den Feiertagen genug davon hatten, wurde schon lange vorher mit dem Backen angefangen.
Außer getrockneten Birnen und Zwetschgen kamen noch Rosinen ins Kletzenbrot. Weil jedoch die echten Rosinen, die kernlosen nämlich, für unsere Verhältnisse zu teuer waren, verwendeten wir Zibeben. So nannte man die großen Rosinen mit den Kernen, die wesentlich billiger im Laden angeboten wurden. Das Brot schmeckte damit zwar genauso gut, aber die Kerne haben leider beim Essen immer gestört, und deshalb leisteten wir uns nach dem Krieg, als die Zeiten zum Glück auch für uns besser wurden, die echten, die guten Rosinen.
Im Übrigen wurde das Weihnachtsfest bei uns sehr bescheiden gefeiert. Der Vater brachte einen Baum aus unserem Wald mit, der in der Stube aufgestellt und geschmückt wurde. Anfangs hatten wir nur sehr spärlichen Schmuck, ein paar silberne Kugeln und ein bisschen Lametta, doch dann schenkte mir eine alte Frau ihren Christbaumschmuck, und seitdem war unser Christbaum eine wahre Pracht.
So etwas hatten wir zuvor nie gesehen – bunte Kugeln, darunter ein Füllhorn und zierliche Vögel und alles aus hauchzartem Glas.
Die Geschenke, die unter dem Baum lagen, waren spärlich und praktisch. Meist gab es zu Weihnachten ein Paar Socken, einen Schal oder eine Mütze, für die Knechte meist ein Hemd und für die Mägde eine Schürze.
Aber wir waren zufrieden, aßen unser Früchtebrot und andere selbst gebackene Kekse sowie Äpfel und Nüsse, die ebenfalls auf dem Weihnachtsteller lagen. Außerdem gehörten Buchteln zu Weihnachten wie das Amen in der Kirche. Das sind bohnengroße schwarze Schoten, die man anderswo – glaube ich wenigstens – Johannisbrot nennt. Die mussten wir zwar kaufen, aber es war Tradition, dass es sie an Weihnachten gab.
Außer dem Anlegen der Nahrungsvorräte gab es zu Beginn des Winters noch ein anderes Ritual, nämlich ein großes Waschen und Reinemachen. Zum Waschen hatten wir ein eigenes Waschhaus, in dem sich über die Sommermonate Berge von Schmutzwäsche angesammelt hatten. Weil das Waschen damals ohne Waschmaschine eine schwere und zeitaufwändige Arbeit war, ließ sich das nicht so nebenbei erledigen, und es wurden dabei viele fleißige Hände gebraucht.
Zumindest auf dem Land kannte man noch keine Fertigwaschmittel, sondern wusch alles mit Aschenlauge, die aus sauberer Buchenasche hergestellt wurde. Tagelang verfeuerten wir nur reine Buche im Ofen, und sobald genug Asche beisammen war, wurde sie in den Waschkessel aus Zink gegeben, mit Wasser aufgefüllt und in der Küche auf den Herd gesetzt.
Unterdessen schichtete man im Waschhaus die Wäsche in den großen Waschbottich, wobei die besonders schmutzigen Stücke mit Kernseife vorbehandelt wurden. Zuunterst in den Bottich kamen die groben Leintücher, dann die Kopfkissenbezüge; es folgten die Tischtücher, die Handtücher, die Bettbezüge und ganz zum Schluss die Leibwäsche. Darüber deckte man das Aschentuch, das dazu diente, die Asche aufzufangen.
Sobald die Aschenlauge kochte, schleppte man sie zu zweit ins Waschhaus und schöpfte sie mit einem hölzernen Gefäß über das Aschentuch. Das Laugenwasser sickerte dann langsam durch alle Schichten nach unten, und war die Wäsche lange genug eingeweicht, zog man den Holzstöpsel am Boden des Bottichs, um das Wasser abzulassen. Es wurde aufgefangen, wieder aufgekocht und erneut über die Wäsche gegossen.
Die ganze Prozedur wiederholte sich sieben Mal, und von Mal zu Mal wurde das Wasser dunkler – ein Zeichen dafür, dass der Schmutz sich nach und nach aus der Wäsche löste. Nach dem letzten Einweichvorgang wurde die Lauge jedoch keineswegs weggeschüttet, denn jetzt musste darin noch die Stallkleidung gewaschen werden, darunter manchmal vierzig bis fünfzig bunte Hemden. Ganz zum Schluss wurden mit der Lauge noch die Küche und der Hausgang geputzt, sodass alles ganz frisch roch, und dieser Geruch ist für mich noch heute eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen.
Nach dem Einweichen wurde jedes einzelne Wäschestück entweder gebürstet oder auf dem Waschbrett gescheuert und anschließend in vier Wannen ausgeschwemmt, einmal warm und dreimal kalt. Weiße Wäsche wurde anschließend auf ein frisch gemähtes Wiesenstück zum Bleichen gelegt und zwischendurch mehrmals begossen. Buntwäsche kam zum Trocknen auf die Leine. Auf diese mühsame Art hat man bei uns selbst nach dem Krieg noch viele Jahre lang gewaschen – nur für weiße Hemden und Blusen setzte sich schon vorher industriell hergestelltes Waschpulver durch.
Man kann es sich heute kaum vorstellen, doch nachdem diese Waschtage im Herbst vorbei waren, sammelte man den ganzen Winter über erneut die Schmutzwäsche im Waschhaus. Es gab also nur zwei große Wäschen pro Jahr – im Frühjahr und im Herbst –, denn im Sommer hatte man für so etwas keine Zeit. Da war die Arbeit auf den Feldern wichtiger, und im Winter war es einfach zu kalt, und die Wäsche wäre zudem nicht trocken geworden. Weil man unter solchen Umständen natürlich keinen großen Aufwand mit dem Wechseln von Kleidung und Wäsche treiben konnte, wie das heute üblich ist, brauchte man einiges an Vorrat, um einigermaßen über die Runden zu kommen.
Es gab viel Schnee in meiner Kindheit, und die Straßen wurden mit einem Holzschneepflug, vor den zehn Pferde gespannt waren, geräumt. Die Bauern mussten dafür dem Straßenmeister ihre Rösser zur Verfügung stellen. Fürs Schneeräumen auf unserem Hof hatten wir einen eigenen kleinen Pflug. Schön fand ich es im Winter immer, wenn wir einmal unsere wunderschöne Kutsche auf Kufen benutzten, was leider viel zu selten der Fall war. Eigentlich holte der Vater sie nur heraus, wenn auswärts eine Beerdigung stattfand, während wir den sonntäglichen Kirchgang, einen Weg von dreißig Minuten, immer zu Fuß zurücklegen mussten.
Mein Leben veränderte sich mit einem Schlag, als ich neun Jahre alt war. Als ich eines Tages im Februar von der Schule nach Hause kam, lag die Mutter in ihrem Bett. Meine große Schwester, inzwischen sechzehn Jahre alt, die seit ihrer Schulentlassung im Haushalt half, erzählte mir, was geschehen war: An diesem Vormittag hatte die Mutter am Küchenherd gestanden, als sie plötzlich umfiel. Nachdem sie sie ins Bett geschafft hatten, spannte der Vater die Kutsche an und holte den Arzt, der einen Schlaganfall feststellte, obwohl sie gerade erst einundfünfzig Jahre alt war.
Von da an durfte man sie nicht mehr allein lassen. Einer von uns musste stets bei ihr sitzen und sie beobachten. Ganz ruhig lag sie in den Kissen und schien kaum zu atmen. Manchmal dachte ich schon, sie sei gestorben. Medikamente, die wirklich halfen, standen damals noch nicht zur Verfügung, und der Arzt beschränkte sich auf altbekannte Prozeduren. So nahm er täglich Blut aus dem gesunden Arm ab und spritzte es in den gelähmten.
Nach vierzehn Tagen endlich öffnete die Mutter zum ersten Mal wieder die Augen, und bald darauf begann sie zu sprechen. Zwar kamen ihr die Worte schwer über die Lippen, aber sie klangen ganz vernünftig und in keiner Weise verwirrt. Es dauerte noch einige Monate, bis sie wieder auf die Beine kam – nur mit dem Arbeiten wurde es nichts mehr. Sie konnte lediglich Anweisungen geben, und künftig mussten wir Mädchen uns um den Haushalt kümmern, was vor allem für meine mittlere Schwester bitter war, weil sie eigentlich geplant hatte, nach Innsbruck auf die höhere Schule zu gehen.
Der Vater versuchte, uns für die Mehrarbeit zu entschädigen. So durften wir im Sommer immer wieder zum Baden und im Winter zum Skifahren gehen. Obwohl wir in den Bergen lebten, war es in meiner Kindheit durchaus nicht üblich, dass man Ski fahren konnte. Aber uns hatte das der Lehrer beigebracht, der auch regelmäßig Ausflüge mit uns unternahm.
Der Unterricht begann damit, dass jeder Schüler sich Skier besorgen musste, und wenn die Eltern keine kaufen wollten oder konnten, dann musste man eben schauen, wie man sich welche besorgen konnte. Auch wenn es nicht immer einfach war – der Skiunterricht war Pflicht, und da kannte unser Lehrer absolut kein Pardon.
Die Skier von damals waren primitiv, hatten keine Kanten und nur eine einfache Bindung, und da Skilifte ebenfalls unbekannt waren, befestigte man Felle unter den Brettern, damit man beim Aufstieg nicht abrutschte. Waren wir endlich oben am Ziel, schnallten wir die Felle ab und banden sie uns um den Bauch, damit sie nicht verloren gingen. Der Lehrer machte ein paar Schwünge vor, und wir mussten ein paar Mal üben, bis wir losfahren durften. Es war zwar mehr ein Hinabkugeln als ein Fahren, doch es machte einen riesigen Spaß. Sobald wir unten waren, stiegen wir wieder auf, und nach einiger Zeit konnten wir einigermaßen passabel Ski fahren. Ich selbst bin seitdem eine so begeisterte Skifahrerin, dass ich im Winter jede freie Minute nutze, um mich auf meine inzwischen komfortablen Bretter zu stellen und die Hänge hinabzuschwingen.
Als wir das erste Mal mit unserem Lehrer im Tiefschnee den Berg hinaufstiegen, waren alle mit großem Eifer dabei, bis auf einen, der von vornherein lieber zu Hause geblieben wäre und so gar kein Interesse für diesen schönen Sport zeigte. Das war uns allen unverständlich, und auch unser Lehrer bestand darauf, dass er mitkam. Wenn die ganze Klasse statt Unterricht zum Skifahren ging, konnte er doch nicht allein in der Schule zurückbleiben, und so kam er ausgesprochen widerstrebend mit. Als der Lehrer allerdings irgendwann seine Schäfchen zählte, musste er feststellen, dass es dem lustlosen Schüler gelungen war, sich abzusetzen. Als der Lehrer daraufhin ins Tal hinabfuhr, um ihn zu suchen, fand er den verhinderten Skifahrer fröhlich und mit einer Zigarette in der Hand beim Gasthaus vor! Das Donnerwetter kann man sich vorstellen, denn der Bursche war erst dreizehn Jahre alt.
Einige Jahre führte meine älteste Schwester den Haushalt, dann kam die zweite an die Reihe und nach meiner Schulentlassung schließlich ich. Auch ohne die Krankheit meiner Mutter wäre ich ganz selbstverständlich zu Hause geblieben. Ich sah das damals sogar als Vorzug an, weil meine Eltern es sich leisten konnten, ihre Töchter im Haus zu behalten, anstatt sie als Mägde auf andere Höfe zu schicken, wie es in armen Bauernfamilien üblich war.
Bei uns dienten eine Anzahl solcher Knechte und Mägde, aber niemand machte einen Unterschied zwischen ihnen und der Familie. Sie saßen mit uns am Tisch und aßen das Gleiche wie wir. Die Mutter meinte immer, es sei schlimm genug, dass sie sich in der Fremde ihr Brot verdienen müssten.
Wir hatten jedoch eine Großtante, die gegenteiliger Ansicht war. Diese Schwester meiner verstorbenen Großmutter kam gelegentlich zu uns ins Haus, um in der Küche zu helfen. Einmal meinte sie, sie müsse für uns Kinder etwas Besseres kochen als für die Angestellten, und damit diese das nicht mitbekamen, servierte sie uns unser Essen in der Küche. Der Vater, der bereits mit den Knechten und Mägden in der Stube am Esstisch saß, wunderte sich, wo wir blieben. Als er dann die Extrabehandlung entdeckte, wurde er sehr böse. Wir mussten alles stehen und liegen lassen und mit ihm in die Stube gehen.
Im ersten Moment war ich enttäuscht, denn es hatte mir schon gefallen, etwas besonders Gutes zu bekommen, doch bald sah ich ein, dass mein Vater recht gehabt hatte, und nahm mir sein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl seit diesem Tag zum Vorbild.
Übrigens trieb man mit Geschirr und Besteck keinen großen Aufwand, denn meist stand auf dem Tisch nur eine große Schüssel, aus der alle schöpften. Dazu benutzte jeder seinen Löffel, der nach Gebrauch an der Tischdecke abgewischt und in die Schublade am eigenen Platz gelegt wurde.
Mit der Zeit verfiel unsere Mutter immer mehr. Acht Jahre nach dem Schlaganfall konnte sie endgültig nicht mehr aufstehen und war dankbar, wenn eine ihrer Töchter sich die Zeit nahm, eine Weile neben ihrem Bett zu sitzen. Besonders freute sie sich über die Besuche meiner ältesten Schwester, die damals bereits verheiratet war und ein Kind hatte.
Eines Morgens, nachdem ich ihr das Frühstück gebracht hatte, wollte die Mutter, dass ich mit ihr betete. Sie wirkte so traurig, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Auf einmal weinte sie und entschuldigte sich: »Es tut mir so leid, ich kann gar nichts mehr für euch tun. Die ganze Arbeit müsst ihr allein machen, und dazu müsst ihr mich noch pflegen.«
»Ach, Mutter«, antwortete ich. »Mach dir deswegen keine Sorgen. Uns geht es gut, und mit dir haben wir nicht viel Arbeit.«
Ich räumte das Frühstücksgeschirr ab und brachte es nach unten. Inzwischen war meine Schwester mit dem Kleinen angekommen und ging, wie jeden Morgen, hinauf, um der Mutter das Kind zu bringen. Da fand sie sie leblos neben dem Bett sitzend. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Sie hatte wohl einen weiteren Schlaganfall erlitten, vermutete er. Für sie war es eine Erlösung, für uns aber ein schwerer Schlag, denn obwohl sie so lange krank gewesen war, konnten wir uns nicht an den Gedanken gewöhnen, dass das Leben jetzt ohne sie weitergehen musste.
Das Mädchen mit der Ziehharmonika
Gisela, Jahrgang 1927, aus Bochum
Mein Vater, der eigentlich gedacht hatte, er würde sein Leben lang einen sicheren Posten bei der Stadtverwaltung Hattingen haben, wurde durch den Ersten Weltkrieg völlig aus der Bahn geworfen.
Nachdem es schon schien, als würde er heil nach Hause zurückkehren können, erlitt er noch ganz zum Ende einen Lungensteckschuss, und bei der notwendigen, komplizierten Operation ging es um Leben und Tod. Man operierte ihm nicht nur die Kugel heraus, sondern es mussten auch zwei Rippen entfernt werden. Auch die Heilung verlief nicht ohne Komplikationen, wenn man überhaupt von Heilung sprechen kann, denn ganz gesund wurde mein Vater nie wieder.
Jedenfalls lag er noch lange Zeit im Lazarett, als andere Soldaten längst in die Heimat und an ihre alten Arbeitsstellen zurückgekehrt waren, und als auch für ihn endlich die Rückkehr in sein normales Leben möglich schien, musste er enttäuscht feststellen, dass sein alter Arbeitsplatz inzwischen anderweitig besetzt worden war. Ihm blieb also nichts anderes übrig, als sich in jener schweren, sorgenvollen Nachkriegszeit einzureihen in das Millionenheer der Arbeitslosen, das infolge des wirtschaftlichen Niedergangs entstanden war.
Da er inzwischen verheiratet und Vater eines Sohnes war, konnte er es sich nicht leisten, wählerisch zu sein, doch obwohl er bereit war, selbst geringste Arbeiten anzunehmen, wurde er immer wieder arbeitslos. In dieses Elend hinein wurde ich 1927 geboren.
Meine Geburt verlief ziemlich dramatisch, weil ich ein »schweres Mädchen« war, denn ich wog über neun Pfund. Normalerweise wäre man, selbst damals schon, bei einer solchen Konstellation ins Krankenhaus gegangen, doch dazu fehlte meinen Eltern das Geld. Die Entbindung zog sich also hin, und meine Mutter verlor vor Schmerzen fast den Verstand. Meist stöhnte sie nur leise vor sich hin.
Als sie es einmal wagte, laut aufzuschreien, war das einzig Tröstliche, was ihr die Hebamme zu sagen vermochte: »Ja, ja, rein ist schöner als raus.« Darüber war meine Mutter so entsetzt, dass sie mir die Geschichte später immer wieder erzählt hat.
Die erste Erinnerung aus meiner Kindheit geht in das Jahr 1931 zurück. Ich war viereinhalb Jahre alt und erkrankte, ebenso wie mein um sechs Jahre älterer Bruder, an Diphtherie. Obwohl mein Vater arbeitslos war und keine Krankenversicherung hatte, kamen wir ins Krankenhaus, denn der mitleidige Arbeitgeber meiner Mutter versprach, für die Kosten aufzukommen. Er war Betriebsführer einer Zeche, und die Mutter ging in seinem Haus putzen.
Diesem netten Mann war es auch zu verdanken, dass mein Vater bald darauf als Bergmann eingestellt wurde. Es war zwar eine schwere und ungewohnte Arbeit für einen Mann, dessen Lunge nicht mehr voll funktionierte, doch er war froh, überhaupt Arbeit zu haben, damit er seine Familie wieder selbst ernähren konnte.
Während mein Bruder nach sechs Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, musste ich noch bleiben, weil ich eine Schlucklähmung bekam und künstlich ernährt wurde – nicht wie heute über die Vene, sondern über den Darm. Ich erinnere mich an ein unförmiges Gerät mit einer Glaskugel, in das geschlagenes Ei mit einer Traubenzuckerlösung gegeben und mir dann als Einlauf verabreicht wurde, was immer eine furchtbare Quälerei war.
Einmal ist der Schlauch während der Prozedur rausgerutscht, worüber sich eine junge Krankenschwester, die das nach einiger Zeit entdeckte, fürchterlich aufregte und mit mir schimpfte. Während ich aus lauter Verzweiflung zu weinen begann, kam eine ältere Nonne hinzu und wies die weltliche Kollegin zurecht. Sie erklärte ihr, dass ich nichts dafür könne und dass man überdies ein schwerkrankes Kind nicht so behandeln dürfe. Im Übrigen sei es ohnehin ihre eigene Schuld, denn hätte sie nicht das Zimmer verlassen, wäre das ganze Missgeschick nicht passiert.
Insgesamt habe ich siebzehneinhalb Wochen im Krankenhaus verbracht, in dieser Zeit hundertachtundzwanzig Spritzen bekommen, wie meine Mutter peinlich genau registriert hat, und stand einmal, ausgerechnet in der Silvesternacht, am Rand des Todes. Was damals genau mit mir los war, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde ich, als ich längst erwachsen war, nach jeder gründlichen Untersuchung beim Arzt gefragt, ob ich als Kind eine Herzbeutelentzündung gehabt hätte, und irgendwie war einmal davon die Rede, man hätte an mir Kortison ausprobiert. Ob es stimmt, weiß ich nicht, denn als Kind hat es mich nicht interessiert, und später war niemand mehr da, der es gewusst hätte.
Am Tag meiner Entlassung haben mich meine Eltern mit dem Kinderwagen im Krankenhaus abgeholt, denn zum Laufen war ich entschieden zu schwach, und für ein Taxi reichte das Geld nicht.
Zu Hause erwartete mich eine große Überraschung – inzwischen war nämlich ein kleiner Bruder angekommen, der gerade dreieinhalb Wochen alt war. Ich freute mich riesig, jetzt eine lebendige Puppe zum Spielen zu haben. Später allerdings, als er älter wurde und laufen konnte, war er mir manchmal lästig, beispielsweise, wenn er auf dem Spielplatz, den es in unserer Siedlung schon gab, immer hinter mir herrannte.
Oft wurde er müde, und ich musste ihn in meinem Puppenwagen nach Hause fahren, aus dem dann die Füße mit den Rollschuhen heraushingen. Glücklicherweise war der Wagen stabil, nämlich ganz aus Holz hergestellt. Ich hatte ihn von meinen Großeltern zu Weihnachten bekommen, als ich zweieinhalb gewesen war. Er hatte damals 27,50 Mark gekostet, was zu dieser Zeit viel Geld war. Ich weiß den Preis, weil auch später noch ein Zettel unter dem Wagen klebte, aber es ist schon komisch, welche Sachen man sich als Kind so merkt.
Ich spielte gerne mit meinen Puppen, für die meine Mutter schöne Kleider nähte. Vor allem meine Erna liebte ich und war sehr besorgt um ihr Wohlergehen. Einmal, es war im Winter und ein sehr kalter Tag, sah ich, wie meine Mutter den Topf vom Herd zog und wie darunter das Feuer loderte.
Ich nahm meine Puppe aus dem Wagen und behauptete: »Ach, meine arme Erna friert so«, und hielt sie über die Flammen. Im Nu war der ganze Kopf, der ja aus Zelluloid bestand, verschmort. Zum Glück gab es für traurige Fälle wie diesen die Puppenklinik, wo Erna einen neuen Kopf bekam.
Einige Wochen, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden war und mich einigermaßen erholt hatte, besuchten wir meine Großeltern, die nicht allzu weit entfernt wohnten. Ich kann mich an dieses Ereignis deshalb so gut erinnern, weil der Opa ein Radio besaß und ich andächtig stundenlang davor saß, um mir die Musiksendungen anzuhören. Vor allem eine Sängerin mit einer wunderschönen Koloraturstimme ist mir unvergesslich geblieben – ich glaube, sie hieß Erna Sack. Hingerissen hockte ich jedenfalls vor dem kleinen Kasten und seufzte: »Ach, was singt die so schön!« Man konnte mich nur mit dem Versprechen von dem Gerät wegbringen, dass ich die Großeltern bald wieder besuchen durfte.
Wie glücklich war ich, als sich die Eltern 1934 endlich ebenfalls einen kleinen Volksempfänger leisten konnten. Ich genoss es, den herrlichen Melodien zu lauschen, die in bunter Mischung über den Äther kamen, und irgendwann erwachte in mir der sehnliche Wunsch, selbst Musik zu machen, irgendein Instrument spielen zu können – welches, das war zunächst zweitrangig.
Dann kam das Jahr 1937, in dem mir die Richtung gewiesen wurde. Es geschah auf ganz merkwürdige Weise: Wie die anderen Familien in unserer Bergmannssiedlung wurde uns für sechs Wochen ein Junge aus Berlin zugeteilt. Er war Schüler der Napola Spandau, einer jener nationalsozialistischen Eliteschulen, in denen der Parteinachwuchs herangezüchtet wurde, und sollte gemeinsam mit seinen Klassenkameraden im Ruhrgebiet einen Eindruck von der Arbeit unter Tage gewinnen und seine politischen Erkenntnisse in praktische Arbeit umsetzen. Ob meine Eltern eine Aufwandsentschädigung für Kost und Logis erhielten, weiß ich nicht – jedenfalls waren sie nicht gefragt worden, denn solche Sachen galten als selbstverständlicher Dienst an der Volksgemeinschaft.
Unser Gast hieß Paul und war ein hoch aufgeschossener Junge von sechzehn Jahren, der seiner Kleidung und seinem Benehmen nach aus guten Verhältnissen stammen musste. Offenbar hatte er in Briefen an seine Eltern berichtet, dass die Tochter seiner Gastfamilie ausgesprochen erholungsbedürftig aussehe, denn es erging an mich eine Einladung, einige Wochen bei Pauls Eltern in ländlicher Umgebung zu verbringen, und so begleitete ich, gerade zehn Jahre alt, unseren Gast bei seiner Heimreise. Ich war begeistert, zumal Paul uns erzählt hatte, in seiner Familie werde Hausmusik gepflegt.
Meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Der Vater war sehr musikalisch, und alle drei Söhne – einer älter als Paul, der andere jünger – hatten sein Talent geerbt. Fasziniert lauschte ich bei den abendlichen Hauskonzerten den Melodien, die sie ihren Instrumenten entlockten, und in meinen Fingern kribbelte es, weil ich am liebsten mitgemacht hätte. Neben dem Klavier, das sie alle beherrschten, spielte der Vater Geige, Paul Ziehharmonika, Günther Gitarre und Alexander Trompete.