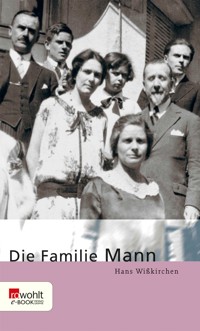22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Politik und Literatur: Hans Wißkirchens große Biographie über Heinrich und Thomas Mann »Was reden doch die zwei unwissenden Magier da?« Das dachte Golo Mann immer wieder, wenn er Heinrich und Thomas, seinen Onkel und seinen Vater, über Politik reden hörte. Wie aber steht es wirklich um die politische Urteilskraft dieser beiden großen Autoren des 20. Jahrhunderts? Wie wurden diese beiden Bürgersöhne aus Lübeck zu glühenden Verteidigern der Demokratie? Hans Wißkirchen, Präsident der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft, zeichnet in seiner Biographie der Brüder ein differenziertes Bild, bei dem Politik und Literatur nicht zu trennen sind und das dank bisher unbekannter Briefe vor allem die Zeit des frühen Exils in ein neues Licht rückt. Weil erstmals beide Brüder gleichberechtigt zu Wort kommen, korrigieren sie sich immer wieder gegenseitig. Beide kommen aus dem ideologischen Raum der Jahrhundertwende. Demokratie ist für beide keine Selbstverständlichkeit. Gerade deshalb wissen sie, was auf dem Spiel steht, und kennen die Gegner ganz genau. Ein engagiertes, unverzichtbares Buch über Heinrich und Thomas Mann und die wiederkehrende Bedrohung der Demokratie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 595
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Hans Wißkirchen
Zeit der Magier
Heinrich und Thomas Mann 1871–1955
Biografie
Inhalt
[Widmung]
Prolog – Die Magier
Auf Augenhöhe
Neue Quellen
Aktuelles
1. Die Anfänge in Lübeck – 1871 bis 1893
Im Weltwinkel
Politik und Privates
Die unliterarische Stadt
Familienbande
Eine Doppelbiographie
2. Schriftsteller werden – 1893 bis 1902
Heinrichs Kämpfe
Sexualität
Nach Italien
Musik
Neapel
3. Zwei Briefe – 1903
Thomas Manns Abrechnung
Heinrich Manns Antwort
Homosexualität
Politik, Sinnlichkeit und das Fremde
Geschwindigkeit und Größe
Leutnant Bilse
Das Gemeinsame
4. Zwei Romane – 1909
Die kleine Stadt
Königliche Hoheit
Eine Art Brudermord
5. Gemeinsamkeiten – 1910 bis 1914
Geist und Tat
Die ›Weiblichkeit‹ der Revolution
Ein ›deutscher Mann‹
Selbstmitleid und Lösungssuche
6. Der Erste Weltkrieg und die Revolution – 1914 bis 1920
Krieg
Ein Brudergespräch
Repräsentative Gegensätzlichkeit
Traum und Wirklichkeit
Intellektuelle
7. Verteidigung der Republik – 1921 bis 1932
Schwierige Annäherung
Ehrliche Einsichten
Politische Morde
Die ›Männlichkeit‹ der Republik
Wechsel der Bruder-Hierarchie
Zwei Büchersendungen
Zwei Epochenromane
Mitten hinein
Hoch hinaus
Der Vierzeilenplan
Die innere Zeitgeschichte auf dem Zauberberg
Kampf um die Republik
Geburtstagsfeiern
Vorwegnehmendes Denken
Nähe
8. Das Exil in Europa – 1933 bis 1940
Lebensbruch
Wie weiter?
Streit um die »Sammlung«
Kritik von innen und außen
Der keusche Joseph
Der gute König
Die Sowjetunion als Ort der Hoffnung?
Der Pakt
Wo ich bin, ist Deutschland
Bruder Hitler
Wanderredner der Demokratie
Der Magier Heinrich
Der Weg aus Europa
9. Die letzten Jahre in den USA – 1940 bis 1950
Filmgeschäfte
Einsamkeit und Ruhm
Späte Antworten
Demokratie
Die großen Männer
Nackte Weiber und schöne Jungen
Warum?
Ein Auslaufmodell?
Rückkehr?
Dagobert Duck
Getragene Schuhe
Das Ende
Epilog – 1950 bis 1955
Anhang
Literaturverzeichnis
1. Briefwechsel Heinrich und Thomas Mann
2. Werke Thomas Manns
3. Briefe Thomas Manns
4. Werke Heinrich Manns
5. Briefe Heinrich Manns
6. Weitere Quellen
7. Sekundärliteratur
Abbildungsverzeichnis
Chronik
Dank
Personen- und Werkregister
Für Jutta
Prolog – Die Magier
»Wenn ich Heinrich Mann und Thomas Mann zusammen politisieren hörte, hatte ich manchmal das gleiche Gefühl: Was reden doch die zwei unwissenden Magier da?« Golo Mann, von dem diese Erinnerung aus der Zeit des amerikanischen Exils stammt, wohnte oft bei seinem Vater in Pacific Palisades und erlebte die beiden Brüder beim Diskutieren. Heinrich Mann wohnte in einer kleinen Mietwohnung, wurde von Katia Mann aber oft mit dem Auto abgeholt und verbrachte dann einige Tage in der großzügigen Villa seines Bruders. Palmen, ein grüner Garten, die Nähe des Pazifik – das war die vordergründige Idylle, in der die Brüder diskutierten. Sicher über alte Zeiten, wahrscheinlich über das Lübeck der Jugend, das nun so weit entfernt lag, als Relikt des 19. Jahrhunderts. Sicher über Literatur. Vor allem aber über Politik. Hitler war gerade dabei, die halbe Erde zu erobern, und das war für beide eine Schande und etwas, wogegen man kämpfen musste. Das taten sie dann auch in großer Einigkeit. Golo Mann aber, der den beiden als junger Historiker zuhörte, zweifelte an der politischen Urteilskraft der beiden. »Unwissend« waren sie für ihn, »weil schlecht informiert, weil wirklichkeitsfern«; »Magier« waren sie für ihn, weil sie, »mit stark intuitivem Blick begabt«, sich »andre Wirklichkeiten« erträumten oder, schlimmer noch, weil sie »Lieblingsträume mit der Wirklichkeit« gleichsetzten.[1]
Joachim Fest hat die Formulierung von den »unwissenden Magiern« zum Titel eines erstmals 1985 erschienenen kleinen Buches gemacht. Als »unrettbar fremd im Politischen«[2] sieht Fest die beiden Brüder. Den Blick auf Heinrich und Thomas Mann hat er damit entscheidend geprägt.[3] Sie gelten in weiten Kreisen heute immer noch primär als große Schriftsteller, die mit dem Politischen fremdelten und deren Rolle als politisch engagierte Intellektuelle man im Rückblick nicht recht ernst nehmen könne.
Aber stimmt das? Wie zuverlässig ist zum Beispiel der Überbringer des Zitats? Hat nicht gerade Golo Mann mit einer Radikalität, die ihn immer wieder in Konflikt mit der Historikerzunft gebracht hat, die Kraft der Erzählung in der Historie betont? Hat er nicht mit dem Wallenstein, seinem 1971 von Historikern wie Hans-Ulrich Wehler kritisierten ersten Hauptwerk, beweisen wollen, »daß Historie und Kunst einander nicht ausschließen; daß in vergangener Wirklichkeit epische Stoffe liegen«?[4] Was er dem Vater und dem Onkel also vorwirft, dass sie auf die magische Kraft der Literatur gesetzt haben, das hat er – sicher ihnen folgend – selbst umgesetzt. Und genau das macht ihn zu einem unzuverlässigen Erzähler, was das politische Denken von Heinrich und Thomas Mann angeht.
Und Joachim Fest? Der hatte das Dementi seiner eigenen These schon 1973, zwölf Jahre bevor er die Brüder Mann aus der Welt des Politischen hinausschob, geschrieben. Seine in diesem Jahr erschienene Hitler-Biographie ist die erste, die Hitler als Künstler-Politiker versteht. Sie wäre ohne Thomas Manns politisches Denken, ohne dessen Blick auf Hitler, gar nicht denkbar gewesen. Schon ganz am Anfang von Fests Biographie wird ausgerechnet Thomas Manns berühmter Essay Bruder Hitler aus dem Jahr 1939 zur zentralen Referenz. In der Vorbemerkung, die um Hitlers historische Größe kreist, heißt es: »Es kann aber sein, daß der Begriff selber problematisch geworden ist. In einem der pessimistisch gestimmten politischen Essays, die Thomas Mann in der Emigration verfaßt hat, sprach er im Blick auf den triumphierenden Hitler zwar von ›Größe‹ und ›Genie‹, doch von ›verhunzter Größe‹ und von Genie auf inferiorer Stufe.« Fest konstatiert sodann: »In solchen Widersprüchen nimmt ein Begriff Abschied von sich selbst.«[5] Fest räsoniert darüber, dass es sich vielleicht um eine abgelebte Sicht des 19. Jahrhunderts handele, die den großen Einzelnen auf Kosten der Strukturen zu sehr in den Mittelpunkt stelle. Aber er hält dann doch in seiner gesamten Biographie am Begriff der Größe als zentralem Analysemodell fest. Freilich in dem modernen und gebrochenen Sinne, den Thomas Mann in Bruder Hitler entwickelt hat. Die Rückbezüge auf Thomas Mann sind zahlreich, sie durchziehen den gesamten Text. Man kann daher zugespitzt formulieren: Eines der zentralen Analysewerkzeuge seiner fulminanten Hitler-Biographie basiert auf dem politisch-ästhetischen Denken Thomas Manns. Es hat fast den Anschein, als wolle er ihn nachträglich als politischen Denker aus der Wahrnehmung drängen, um Spuren zu verwischen. Was bleibt, ist die Tatsache, dass Fest in seinem Opus Magnum dem politischen Denken Thomas Manns ein überzeugendes Denkmal gesetzt hat, das auch sein späterer Text über die »unwissenden Magier« nicht wieder auslöschen kann.
Auf Augenhöhe
Das vorliegende Buch widerspricht Golo Mann und Joachim Fest in nahezu allen Punkten. Die Brüder Mann, so wird im Folgenden erzählt werden, waren nahe an den Fragen der Macht, an der gesellschaftlichen Wirklichkeit und den sie prägenden Gruppierungen. Nicht von Beginn an, aber ab 1910, als es im 20. Jahrhundert galt, Flagge zu zeigen. Sie waren Magier ihrer Zeit, weil sie mit ihrer Literatur, ihren Reden und Essays die eigene Zeit in Worte fassten und sich damit immer wieder politisch einmischten. Natürlich irrten sie auch! Aber für welchen zeitgenössischen Politiker und Intellektuellen hätte das im 20. Jahrhundert nicht gegolten. Dieses Buch zeigt, dass Heinrich und Thomas Mann ihre Zeit als Künstler und Intellektuelle über 50 Jahre hindurch begleitet, kommentiert und beeinflusst haben – auch und gerade durch ihre im Ästhetischen gegründete »Magie«.
Denn ihre Literatur ist die Basis der intellektuellen Kraft. Dass ihr eigentliches Element »Bücher und Träume bildeten«[1], wie Fest richtigerweise konstatiert, ist kein Argument gegen die politische Relevanz beider Autoren. Denn das Politische ist bei ihnen untrennbar mit dem Literarischen verbunden. Bücher wie Thomas Manns Buddenbrooks, Der Zauberberg, Joseph und seine Brüder, Doktor Faustus und Heinrich Manns Professor Unrat, Die kleine Stadt, Der Untertan und Henri Quatre, um nur die wichtigsten zu nennen, schaffen mit ihren Träumen und Gegenwelten ein Fundament für ein politisch-gesellschaftliches Denken, das sich den konkreten Fragen der zeitgenössischen Gegenwart stellt. Seine Rolle als literarischer und zugleich der gesellschaftlichen Wirklichkeit zugewandter Magier hat Thomas Mann am Ende seines Lebens auf den Punkt gebracht. »Der Dichter (und auch der Philosoph) als Melde-Instrument, Seismograph, Medium der Empfindlichkeit, ohne klares Wissen von dieser seiner organischen Funktion und darum verkehrter Urteile nebenher fähig, – es scheint mir die einzig richtige Perspektive.«[2] Und Heinrich Mann hat das politisch Vorausgreifende seiner literarischen Diagnosen und rettenden Träume kurz vor Hitlers Machtübernahme im Brief an den Bruder so skizziert: »Ungeheur schwierig, gewiss keine Utopie, aber so fernliegend, wie heute nur das Vernünftige liegt.«[3]
Dabei gilt: Wissende, politisch erhellende Magier sind sie nur dann, wenn man sie zusammennimmt. Schaut man auf Thomas Mann oder Heinrich Mann jeweils nur für sich, dann fallen tatsächlich vor allem Einseitigkeiten auf: Thomas Manns Politikferne bis 1914, sein Agieren für einen überlebten Obrigkeitsstaat in der Zeit ab 1914, seine Ablehnung der Weimarer Republik bis 1922, sein zögerliches Annehmen der Exilsituation ab 1933, seine unklare Haltung nach 1945 im Kalten Krieg. Heinrich Manns Antisemitismus in den jungen Jahren, seine Forderung nach einer Diktatur der Vernunft in der Weimarer Republik, sein Glaube an Stalin und Russland als einziger Gegenpol zu Hitler, sein Rückzug ins Private ab 1940.
Immer aber, und das ist ein Grundzug der nachfolgend erzählten Geschichte, ist es der jeweils andere Bruder, der gegen diese Einseitigkeiten steht und das gemeinsame Bild entstehen lässt. Heinrich Mann war früh schon ein demokratischer Denker, der sich mit dem Bruder bis 1922 intensiv auseinandersetzte, Thomas Mann war ab 1922 ein glühender Anhänger der Republik, der die Kritik des Bruders an der Demokratie abfederte. Heinrich Mann war ab 1933 sofort einer der fundamentalsten Hitler-Gegner, der dem Bruder in der unsicheren Zeit des frühen Exils zur Seite stand, und ab 1940 war Thomas Mann in den USA einer der Sprecher des »anderen Deutschlands«, der auch für seinen Bruder Heinrich mitsprach.
Ganz wichtig: Erst in diesen Jahren des amerikanischen Exils entsteht jene bis heute gültige Sicht auf die Brüder Mann als ein Schriftstellerpaar, in dem Thomas Mann der Größere, Wichtigere und Bedeutsamere ist. Von den fünfundsiebzig Jahren gemeinsamen brüderlichen Lebens, sind das die letzten fünfzehn Jahre. Man sollte sich daher davor hüten, den gut fünfzig Jahre dauernden intellektuellen Austausch zu stark vom Ende her zu sehen und zu werten. Das verstellt manche Einsicht und macht vor allem die Bedeutung Heinrich Manns für das Bruderverhältnis kleiner, als sie war – auch kleiner, als sie für Thomas Mann war.
Schaut man nämlich genauer hin, dann wird schnell deutlich, dass die scheinbar geklärten Rangfragen sich im Binnenverhältnis der Brüder Mann so nicht wiederfinden. Hier herrschte ein anderes Verhältnis, das sich bei allem Ruhm und aller Überlegenheit Thomas Manns in der öffentlichen Wahrnehmung – über die sich beide Brüder durchaus klar waren – durch viel mehr Gleichberechtigung, viel mehr gegenseitige Achtung auszeichnete, als man bisher wahrzunehmen bereit war.
Man kann es noch deutlicher ausdrücken. Für die Familie Mann, über die schon so viel Kluges geschrieben wurde[4], ist vor allem zweierlei charakteristisch: Fast alle haben geschrieben, und fast alle definieren sich in erster Linie durch ihr Verhältnis zum Vater, zum Großvater und zum Ehemann, eben zu Thomas Mann. Dabei haben wir es in fast allen Fällen mit einem Abhängigkeitsverhältnis zu tun. Das Leben der anderen, es war immer, vor und nach dem Tod Thomas Manns, auf diesen bezogen – und zwar ziemlich einseitig. Thomas Mann stand weitgehend für sich, während sich die anderen in vielen Bereichen aus ihrem Verhältnis zu ihm definierten. Das galt für die Ehefrau Katia ebenso wie für die Kinder Erika, Klaus, Golo, Monika, Michael und Elisabeth. Einzig bei Heinrich Mann war das anders: Er allein prägte auch den Bruder. Deshalb ist Thomas Manns Geschichte ohne den Bruder nur unzulänglich erzählt. Deshalb kann man beide nur verstehen, wenn man das Bruderverhältnis als eines auf Augenhöhe begreift.
Neue Quellen
Wenn man die Brüder Mann gemeinsam in den Blick zu nehmen versucht, steht man vor dem Problem der großen Dominanz, die von der Perspektive Thomas Manns ausgeht. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen ist die Überlieferungslage eine asymmetrische. Wir haben wesentlich mehr Briefe von Thomas Mann an Heinrich Mann als umgekehrt. Und wir haben, für die Jahre 1918 bis 1921 und von 1933 bis 1955, die Tagebücher Thomas Manns. Zum anderen liegt die Dominanz des Thomas Mann’schen Blicks auf die Dinge an dem Hang zur Selbstinszenierung, der bei Thomas Mann sehr ausgeprägt war und bei Heinrich Mann weitestgehend fehlt. Thomas Mann hat sein Werk und Tun zeitlebens mit eigenen Beschreibungen begleitet, er hat an der Wirkung seiner Werke schon sehr früh entscheidend mitgewirkt. Er hat Rezeptionsrichtungen gesetzt, er hat seine Position im literarischen Feld definiert – auch und gerade indem er sich von anderen abgesetzt und die Unterschiede markiert hat. Dies gilt auch für den eigenen Bruder.
Diesem hingegen waren solche Gedanken weitgehend fremd. Im Vergleich zu Thomas Mann mutet Heinrich Manns eigene Ruhmesverwaltung erschreckend lax an. Ihm war wenig daran gelegen, öffentlich über sich und seine Wirkung zu sprechen.
Solche Asymmetrien können durch neue Quellen etwas gemildert werden. Erstmals etwa kann für dieses Buch der im Jahr 2021 neu erschienene Briefwechsel der Brüder zur Grundlage genommen werden. An zwei zentralen Stellen des Bruderdialogs, 1903 und 1918, lassen zum Beispiel zwei bislang unbekannte Briefentwürfe Heinrich Mann umfangreich zu Wort kommen. Sie erlauben uns einen intensiven Blick darauf, wie Heinrich Mann auf zentrale Vorwürfe seines Bruders reagiert. Es sind zudem Dokumente, die Fundamentales über das Bruderverhältnis, die eigene Person und Thomas Mann zum Ausdruck bringen. Das strahlt weit über den jeweiligen Zeitkontext der Briefe hinaus, formuliert Grundsätzliches, wodurch die Position Heinrich Manns weitaus besser als früher erkennbar wird.
Zudem wurden zwei große neuen Quellenkomplexe hinzugefügt. Sie zeichnen das Verhältnis der Brüder Mann insgesamt genauer und in einigen Aspekten auch neu. Da sind zum einen die 81 neu aufgefundenen Postkarten, die sich seit 2012 im Archiv des Buddenbrookhauses befinden. Durch sie ist eine Relektüre der schon bekannten Briefe bis in die 1920er Jahre möglich. Denn diese neuen Materialien sind vor allem unter einem Aspekt spektakulär: Was man hier findet, ist eine große Nähe und Vertrautheit, wie man sie in diesem Ausmaß nicht erwarten konnte. Erstmals als Quelle genutzt werden auch 31 Briefe und Postkarten aus der Feuchtwanger Memorial Library der University of Southern California in Los Angeles. Sie erlauben einen genaueren Einblick in die Jahre des beginnenden Exils nach 1933. Es sind vor allem die bisher fehlenden Briefe Thomas Manns, die seine schwierige Position nachvollziehbarer machen.
Aktuelles
Die Geschichte der Brüder Mann ist eine aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Man könnte also meinen, dass sie damit in der Vergangenheit spielt. Das ist jedoch nicht der Fall. Seit Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angegriffen hat, ist die Welt, in der wir leben, eine andere. Sehr schnell war zu Recht die Rede von der Zeitenwende.[1] In den letzten Jahren ist ihre fundamentale Bedeutung immer klarer geworden, da stetig größere Bereiche unseres menschlichen Zusammenlebens davon betroffen sind. Und auch der Blick auf die Geschichte Deutschlands und Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren hat sich verändert. Die Zeit des Friedens und der vom Pazifismus bestimmten gesellschaftlichen Übereinkunft der deutschen Zurückhaltung bei internationalen Krisen ist an ihr Ende gelangt. Das hängt vor allem mit einem Faktor zusammen, der aus dem neuen Krieg in Europa resultiert: Die Gewalt als ein Mittel der Politik ist zurück! Sie dominiert nicht nur das außenpolitische Geschehen, sondern wird auch im Inneren unserer Demokratie immer sichtbarer und spürbarer. Der politische Mord etwa, wie ihn Heinrich und Thomas Mann in der Weimarer Republik hautnah erleben konnten – innerhalb eines Jahres wurden zwei Reichsminister, Matthias Erzberger und Walther Rathenau, ermordet –, ist im Heute zurück. Der Ton in den demokratischen Auseinandersetzungen wird rauer. Die radikalen Kräfte in den Parlamenten testen inzwischen aus, wie weit sie in der Sprache und in der Aushebelung demokratischer Spielregeln gehen können. Ihr Ziel ist klar: Es geht um das Aushöhlen und Schwächen der demokratischen Institutionen.
All das war den Brüdern Mann nicht unbekannt. Sie wurden beide im wilhelminischen Kaiserreich geboren und erlebten ab 1918 die Demokratie in Deutschland und Europa als etwas Neues, das sich gegen das Alte, das Reaktionäre und Konservative behaupten musste. Ihr Begriff von Demokratie kommt aus einer Zeit, als all das, was wir heute wieder erleben, an der Tagesordnung war. Sie kennen Demokratie nur als eine Staatsform unter Druck. So nach 1918, als die Weimarer Republik von Beginn an von den rechtsnationalistischen Gegnern unterminiert wurde, die die Demokratie nie akzeptieren wollten, was 1933 dann zu ihrem Ende führte. So in den 1930er und 1940er Jahren, als Heinrich und Thomas Mann erst Hitlers Machtergreifung und die Okkupation von Österreich und der Tschechoslowakei erlebten und dann den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der die Demokratie global in einen Abwehrkampf zwang – ein Abwehrkampf, der nicht mehr und nicht weniger war als ihre Rettung.
Die Tatsache, dass beide aus einem vordemokratischen Raum kommen, sich dann auf unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlicher Ausrichtung zu Vertretern und später Verteidigern des demokratischen Zusammenlebens entwickeln, gewinnt damit eine ganz neue Bedeutung. Es geht darum, die Brüder Mann als Spezialisten im Kampf der Demokratien gegen die autoritären Staatssysteme zu lesen. Mit Heinrich Mann gesprochen: »Menschen sind von Natur nicht gut, und nichts bedarf so langer Lehre und Übung, wie Gerechtigkeit. Aber welchen Sinn hätte denn Demokratie, wenn sie uns nicht gerechter machte! Demokratie ist im Grunde die Anerkennung, daß wir, sozial genommen, alle füreinander verantwortlich sind.«[2]
Die Aktualität der Brüder Mann gründet auch auf der Tatsache, dass sie den Gegner genau kennen. Wer wie Heinrich Mann in der Jugend als Herausgeber der Zeitschrift Das zwanzigste Jahrhundert über Jahre reaktionäre und antisemitische Thesen vertreten, man kann auch sagen: ausprobiert hat, der weiß, wovon er spricht. Und das gilt vice versa auch für Thomas Mann. Niemand hat die Stärken und Schwächen des konservativen Denkens eindrucksvoller nachgezeichnet als er in den Betrachtungen eines Unpolitischen. Niemand hat das Denken und Handeln Hitlers von innen heraus so überzeugend kritisiert und analysiert, wie es in Bruder Hitler geschieht.
Dieses Wissen kann vielleicht gerade heute in einer Zeit helfen, in der immer deutlicher wird: Unser bisheriger Begriff von Demokratie gilt so ungebrochen nicht mehr. Die Demokratie ist massiv unter Druck geraten. Wieder einmal muss sie sich gegen autoritäre Versuchungen und Bedrohungen aller Art verteidigen und sich teilweise neu erfinden. Heinrich und Thomas Mann können dabei eine wichtige Rolle spielen.
Im Folgenden wird zu lesen sein, wie das Leben und Schreiben, das Reden und auch Streiten der Brüder Mann über fünf Jahrzehnte hindurch voll von aktuellen Bezügen ist. Gerade in den persönlichen, in den literarischen und politischen Differenzen scheinen immer wieder Einsichten für uns, für heute auf.
Und in diesem Sinne fangen wir an. In Lübeck. Wo alles seinen Ausgang nahm.
1. Die Anfänge in Lübeck – 1871 bis 1893
Im Weltwinkel
»Herkunft, Lebenslauf – Unsinn! Aus Jüterburg oder Königsberg stammen die meisten, und in irgendeinem Schwarzwald endet man seit je.«[1] So hatte Gottfried Benn geschrieben und damit die immer wieder beschworene Bedeutung der Herkunft für die intellektuelle Entwicklung wichtiger Autoren beiseitegewischt. Was für Jüterburg – seinen Geburtsort – vielleicht eine gewisse Berechtigung hatte: Für Lübeck stimmte es nicht!
Diese Stadt, in der Heinrich und Thomas Mann 1871 und 1875 geboren wurden, war etwas Besonderes. Der mit der Reichsgründung 1871 verbundene Aufschwung, all die gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungsschübe der Moderne kommen im Lübeck des späten 19. Jahrhunderts zunächst kaum an. Die Stadt bleibt »Weltwinkel«, wie Thomas Mann es genannt hat, hier nimmt alles einen langsameren Verlauf, und erst in den neunziger Jahren, als die Brüder Mann die Stadt schon verlassen haben, kommt der Aufschwung auch in Lübeck an.
1 Stadtansicht Lübeck, um 1900
Woran lag das? Lübeck lag am Rand, und es war sich selbst genug. Letzteres manifestierte sich vor allem in einem Blick zurück, auf die große Vergangenheit als führende Hansestadt Europas, als man um 1500 mit Metropolen wie London und Venedig konkurrierte. Davon war vieles noch erhalten geblieben. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts erhielt daher das mittelalterliche Stadtbild immer mehr Bedeutung für die Identität Lübecks. Modernisierung galt nicht als Chance, sondern als Gefahr. Man schraube Lübeck damit »mutwillig auf die Stufe einer mittelgroßen Stadt zweiten Ranges« zurück, wie es Emanuel Geibel auf den Punkt brachte.[2]
Der Vater der Brüder Mann war einer der großen Geschäftsleute in Lübeck und wurde 1877 zum Senator für Wirtschaft gewählt. Später kam noch das Finanzressort hinzu. Ohne Übertreibung kann man festhalten: Er war nach dem Bürgermeister der mächtigste Politiker in Lübeck. Und das sollte etwas heißen. Denn trotz aller Probleme war Lübeck bis 1937 ein eigenständiger Staat, und die Position des Vaters kam daher der eines Landesministers gleich. Lübeck war von den drei großen und freien Hansestädten allerdings die kleinste. Bremen und besonders Hamburg hatten ihr den Rang abgelaufen. Gegenüber dem hohen Mittelalter und der frühen Neuzeit, als Lübeck das Haupt der Hanse war, hatten sich die Verhältnisse umgekehrt.
Dennoch war etwas geblieben. Lübeck war zwar klein, aber ein kompletter Staat mit allen erforderlichen Institutionen: mit einem Parlament, Bürgerschaft genannt, einer Regierung, dem sogenannten Senat, einer Börse und Gerichten – vor allem aber mit einem Theater und sogar einer Oper. Für Heinrich und Thomas Mann bedeutete dies, dass sie auf kleinstem Raum eine ganze Welt vor sich hatten. Die daraus resultierende Prägung hielt ein Leben lang bei beiden vor. So schreibt Heinrich Mann 1949, als diskutiert wurde, ob Lübeck, wie Hamburg und Bremen, zu einem eigenen Bundesland in der zu gründenden Bundesrepublik werden sollte: »Ich halte in meiner Erinnerung die alte lübische Tradition so hoch wie möglich. Die Selbstverwaltung der Stadt und ihres Landgebietes wäre meines Erachtens wieder herzustellen. Es handelt sich nicht um eines der kleinen Fürstentümer ohne Geschichte. Lübeck ist unter den ältesten Gemeinschaften Deutschlands ein einmaliger Höhepunkt einstigen Kampfes, Glanzes und Weltruhmes.«[3]
Politik und Privates
Politik wurde von zu Hause gemacht. Der Vater ging die hundert Schritte zum Rathaus, um dort mit den Senatskollegen die Geschicke der Stadt zu leiten. Ein Arbeitszimmer hatte er dort nicht. Von daher erlebten die Brüder ganz unmittelbar mit, wie Politik gemacht wurde, wenn Kollegen nach Hause kamen, wenn wichtige Sitzungen stattfanden. Politik war so gesehen etwas, das zum Leben gehörte, in den familiären Alltag integriert war und nicht in einem abgeschotteten institutionellen Rahmen stattfand.
Damit entstand für die Brüder Mann schon früh eine spezielle Verbindung des Öffentlichen und Privaten, wie sie bezeichnend für die Mentalität in Lübeck war. Lübeck wurde bis 1914 von einer kleinen Schicht regiert, die den Senat stellte und innen- wie außenpolitisch die Geschicke des Stadtstaates leitete. Noch 1907 setzte man, gegen die allgemeinen Tendenzen im Reich, ein Zweiklassenwahlrecht um, das nur wohlhabenden Bürgern die Wahl von über 80 % der Sitze der Bürgerschaft erlaubte. Diese Bürgerschaft wählte auf Lebenszeit die Senatoren, und diese wiederum aus ihrer Mitte jeweils für zwei Jahre den Bürgermeister. Man kann also ohne Übertreibung von einem patriarchalischen System sprechen. Wer im Zentrum eines solchen Systems groß wurden, der erfuhr dadurch entscheidende Prägungen.
Theodor Eschenburg, dessen Großvater mit dem Vater der Brüder Mann über Jahre im Senat der Hansestadt zusammenarbeitete, hat die Denkweisen dieser bürgerlichen Führungsgruppen in der Zeit des späten 19. Jahrhunderts anschaulich beschrieben: »Die Verzahnung von privaten und öffentlichen Angelegenheiten ist charakteristisch für das Lübeck vor 1914. Öffentliches wurde gleichsam als private Angelegenheit behandelt, aber mit der Maxime aus dem römischen Recht von der ›diligentia quam in suis rebus‹, also von ›derjenigen Sorgfalt, die es in eigenen Angelegenheiten anzuwenden gilt‹. Private Angelegenheiten wurden so behandelt, als ob sie öffentlich wären, um vor Staat und Kirche bestehen zu können. Möglich war das nur bei Wahrnehmung von Tabus und der strikten Einhaltung von Konventionen. Das konnte unbequem, ja peinlich sein. Aber Tabus und Konventionen waren ›Schutzwälle‹ zur Erhaltung der Ordnung und damit zur Daseinssicherung der Oberschicht. Sie standen im Mittelpunkt des bürgerlichen Denkens, wenn auch meist unausgesprochen. Ein Verbotswort gab es, in dem das zum Ausdruck kam. Damals häufig gebraucht, ist es heute fast vergessen: ›Das schickt sich nicht.‹«[1]
Heinrich und Thomas Manns politische Grunderfahrung in Lübeck findet sich in dieser Schilderung beispielhaft verdichtet. Sie werden in einem privilegierten und von der übrigen Bevölkerung abgegrenzten Bereich groß. Armut, so Heinrich Mann, wurde in seiner Jugend nicht sichtbar. Sie fand in seinem unmittelbaren Umfeld nicht statt, obwohl es sie natürlich gab, ebenso wie bestimmte arme Stadtviertel, die zu besuchen verboten war.[2]
Das Private und das Politische gingen hier über die Familie, über den Senatorenvater, eine ganz eigene Verbindung ein. Das Schickliche, die unausgesprochenen Konventionen, auf denen diese Verbindung und damit auch das Funktionieren des Stadtstaates Lübeck gründeten, das alles war den Brüdern Mann von früh an bekannt. Diese Konventionen besaßen eine große erzieherische Macht. Man wuchs mit ihnen auf, und sie prägten ihre Sicht auf die Welt entscheidend. Freilich nicht bruchlos. Und mit unterschiedlicher Auswirkung.
2 Thomas Johann Heinrich Mann mit Stock und Zylinder, um 1880
Thomas Mann muss die Mischung aus großer Tradition und unzeitgemäßem Konservatismus gespürt haben, wie nicht nur sein Roman Buddenbrooks zeigt. So gibt es bei ihm eine Protesthaltung gegen Lübeck als geistige Lebensform. Er hat die Regeln verinnerlicht und folgt ihnen auch – allerdings nicht vorbehaltlos, sondern auf seine ganz eigene Art. Paradigmatisch kommt dies in seiner Ablehnung der Schule zum Ausdruck. Die für sein Fortkommen in Lübeck notwendigen Leistungen werden von ihm schlichtweg verweigert.
In seinen eigenen, sehr ironischen Worten: »Ich habe eine dunkle und schimpfliche Vergangenheit, so daß es mir außerordentlich peinlich ist, vor Ihrem Publikum davon zu sprechen. Erstens bin ich ein verkommener Gymnasiast. Nicht daß ich durchs Abiturientenexamen gefallen wäre, – es wäre Aufschneiderei, wollte ich das behaupten. Sondern ich bin überhaupt nicht bis Prima gelangt; ich war schon in Sekunda so alt wie der Westerwald. Faul, verstockt und voll liederlichen Hohns über das Ganze, verhaßt bei den Lehrern der altehrwürdigen Anstalt, ausgezeichneten Männern, die mir – mit vollem Recht, in voller Übereinstimmung mit aller Erfahrung, aller Wahrscheinlichkeit – den sicheren Untergang prophezeiten, und höchstens bei einigen Mitschülern auf Grund irgendeiner schwer bestimmbaren Überlegenheit in ungewissem Ansehen: so saß ich die Jahre ab, bis man mir […] den Berechtigungsschein zum einjährigen Militärdienst ausstellte.«[3]
Während Thomas den passiven Protest wählte, war Heinrich in Sachen Schule aktiv. Er hasste sie wie der Bruder, konnte aber seine Eltern dazu bewegen, 1889 in der Unterprima die Schule verlassen und in eine Buchhandelslehre nach Dresden wechseln zu dürfen. Beides war gegen die Usancen in Lübeck und machte die Brüder zu Außenseitern in der Stadtgesellschaft, die eben nicht den üblichen Weg der Senatorensöhne eingeschlagen hatten.
Die prägende und auch stärkende Kraft der speziellen Lübecker Bürgerlichkeit kommt sehr eindrucksvoll in einem Brief zum Ausdruck, den Thomas Mann im Januar 1904 nach einem schlimmen Streit an seinen Bruder Heinrich schreibt: »Du weißt nicht, wie hoch ich Dich halte, weißt nicht, daß, wenn ich auf Dich schimpfe, ich es doch immer nur unter der stillschweigenden Voraussetzung thue, daß neben Dir so leicht nichts Anderes in Betracht kommt! Es ist ein altes Lübecker Senatorssohnvorurtheil von mir, ein hochmüthiger Hanseateninstinkt, mit dem ich mich, glaub’ ich, schon manchmal komisch gemacht habe, daß im Vergleich mit uns eigentlich alles Übrige minderwerthig ist.«[4]
Diese Haltung formuliert eine für Heinrich und Thomas Mann spezifische Melange. Sie verbindet das Politische mit dem Familiären, die Fragen des Gemeinwohls mit dem Persönlichen. Heinrich Mann hatte das früher als der Bruder gesehen. Das Senatorenamt, das der Vater innehatte, war keine »Parteifrage und von keinen öffentlichen Wahlen« abhängig, so schreibt er in der Rückschau. »Es kam einfach auf die Familie an. Man war es oder man war es nicht – und behielt, einmal in den Senat gelangt, lebenslang die Befugnisse eines absolutistischen Ministers.«[5]
Das politische Lebensgefühl, das die Brüder aus ihrer Lübecker Jugend mitnahmen, war ein konservatives, ein patriarchalisches, aber gleichzeitig auch eines, das den Einzelnen ganz direkt in die Pflicht nahm. Dass man sich mit einer Haltung, die auf bürgerlichen Anstand, Ehre und Moral gründete, zur staatlichen Wirklichkeit zu verhalten hatte, dass man Teilhabe leben musste, weil man dies dem Gemeinwesen schuldig war, all das konnten die Brüder Mann von ihrem Vater lernen, all das haben sie dann auf ihre Art später auch gelebt. Konkret heißt das: Parteipolitisch haben sich die Brüder Mann dabei niemals engagiert. Ihr politisches Engagement basierte immer auf einer persönlichen Betroffenheit, die auf den Lübecker Werten gründete.
Und der weitere Verlauf der deutschen, der europäischen und der Weltgeschichte, sollte ihnen dazu mehr Gelegenheiten geben, als sie damals geahnt haben mögen.
Was folgte, war ein Jahrhundert voller Höhen und Tiefen, voller Brüche und Möglichkeiten. Was folgte war vor allem ein Weg, der von Lübeck, dem ›Weltwinkel‹, hinaus in die Welt führte. Schaut man auf die Orte, die mit den Manns in enger Verbindung stehen, dann wird die Ausweitung des Horizontes, der unaufhörliche Weg der Manns zu einer Weltfamilie, zu global agierenden Schriftstellern und Zeitzeugen sofort einsichtig. Drei Phasen lassen sich bei dieser »Globalisierung« unterscheiden: eine deutsche, eine europäische und eine außereuropäische.
Da ist zuerst der Weg von Lübeck nach München, verbunden mit dem wachsenden Ruhm Heinrich und Thomas Manns als nationale Schriftsteller von Rang. Beide sind herausragende Akteure im literarischen Feld. Sie bestimmen immer stärker die intellektuellen und ästhetischen Debatten in ihrer Heimat mit. Dann kommt der Erste Weltkrieg und darauf folgend die Weimarer Republik. Die Perspektive weitet sich zu einer europäischen. Die Familie Mann steht im Zentrum des weltanschaulichen, politischen und künstlerischen Meinungskampfes. Sie nimmt dabei durchaus gegensätzliche Positionen ein. Heinrich Mann etwa ist von Beginn an gegen den Ersten Weltkrieg, er tritt ganz früh schon für eine europäische Perspektive ein, die in seiner aktiven Rolle bei der deutsch-französischen Versöhnung kulminiert. Klaus und Erika folgen dem Onkel in den 1920er Jahren weitgehend in dieser Sicht der Dinge. Ganz anders Heinrichs Bruder Thomas! Er hält bis weit nach Kriegsende an deutschnationalen und konservativen Positionen fest und kann sich zunächst nicht mit der Republik von Weimar arrangieren. Dann kommt die Wende: Thomas Mann erkennt seinen Irrtum und avanciert bis zum Ende der Republik zum stetig vehementeren Kämpfer für ein demokratisches Deutschland. Dabei nimmt auch er immer stärker die europäische Perspektive ein. Es ist Der Zauberberg mit seinem europäischen Gesellschaftspanorama in Davos, in dem diese Sicht der Dinge ihren künstlerischen Ausdruck findet.
Es folgt das Jahr 1933, der Verlust der Heimat, der Gang ins Exil. Die Perspektive weitet sich abermals: Sie wird eine transatlantische und globale. Die Brüder Mann leben in Frankreich, der Schweiz und später dann in den USA. Besonders deutlich wird diese Weltläufigkeit heute bei einem Spaziergang über den Friedhof in Kilchberg bei Zürich, auf dem die Manns – bis auf Klaus Mann, der in Cannes, und Heinrich Mann, der in Berlin die letzte Ruhe fand – gleichsam wiedervereint begraben sind. So paradox es klingt: Diese Familie, die im 21. Jahrhundert weltweit für Deutschland steht, war am Ende alles andere als deutsch. Betrachtet man das Familiengrab, dann liegen dort amerikanische, britische, ungarische, kanadische und Schweizer Staatsbürger – aber nicht ein einziger Deutscher.
Dabei zeigt sich im Politischen schon in Lübeck ein Muster, das viele weitere Jahre hindurch das Bruderverhältnis bestimmen sollte: Heinrich Mann sah vieles schärfer und genauer als der Bruder, und er sah es früher. Der folgte ihm dann nach.
In einem ganz frühen Text über Lübeck, den er 1889 als 18-Jähriger verfasste, schreibt Heinrich Mann vom »Millionengestank«, der einen beim Gang durch Lübeck immer begleite. Das ist eine vom geliebten Vorbild Heinrich Heine übernommene Metapher, die die bürgerliche Wohlgesetztheit der Stadt meint und diese scharf kritisiert. Lübeck ist behäbig, rückständig, langweilig und wohlhabend. Heinrich Mann zeigt sich in seinem Text historisch und politisch sehr gut informiert. So weist er etwa auf ein Denkmal hin, einen »steinernen Klotz«, der zu Ehren des Knochenhauers Jürgen Paul Prahl errichtet worden war. Prahl hatte 1813 den französischen Besatzern Widerstand geleistet und war zur Abschreckung standesrechtlich erschossen worden. In Heinrich Manns ironischer Schilderung wird Prahls Widerstand gegen das wohlige Sicherheitsbedürfnis der Gegenwart gesetzt.[6]
Bei Thomas Mann klingt die Kritik gemäßigter. In seinem 1893 geschriebenen Vorwort für die Schülerzeitung Frühlingssturm – übrigens nachweislich die erste deutsche von Schülern gemachte Zeitschrift – heißt es programmatisch: »Unser würdiges Lübeck ist eine gute Stadt. O, eine ganz vorzügliche Stadt! Doch will es mich oftmals bedünken, als gliche sie jenem Grasplatz, bedeckt mit Staub, und bedürfe des Frühlingssturms, der kraftvoll das Leben herauswühlt aus der erstickenden Hülle. […] Ja, wie der Frühlingssturm in die verstaubte Natur, so wollen wir hineinfahren mit Worten und Gedanken in die Fülle von Gehirnverstaubtheit und Ignoranz und bornierten, aufgeblasenen Philistertums, die sich uns entgegenstellt. Das will unser Blatt, das will ›Der Frühlingssturm‹! –«[7]
Das ist wenig konkret und wenig originell – auch und gerade im Vergleich zum jungen Heinrich Mann. Aber man merkt, dass hier der kleine Bruder dem großen in seiner Lübeck-Kritik, die sicher Thema zwischen beiden war, nachfolgt. Wir sehen hier erstmals das Muster des vorweggehenden Heinrich Mann.
Auch beim Verlassen der heimatlichen Stadt zeigt sich dieses Muster. Heinrich wechselt 1890 als Volontär zum S. Fischer Verlag in Berlin. Parallel schreibt er sich als Gasthörer an der Berliner Universität ein. Thomas Man tut es ihm nach, als er 1894 von Lübeck nach München zieht. Er wird Volontär bei einer Feuerversicherungsanstalt und später bei der Zeitschrift »Simplizissimus«, als Gasthörer besucht er Vorlesungen an der Technischen Universität. Was Heinrich bei der Trennung von Lübeck und dem Weg ins freie Schriftstellerleben als Muster etabliert, ist ein Doppeltes: Er hält durch das Volontariat eine Zeitlang die Fiktion einer beruflichen Tätigkeit aufrecht und durch die Verbindung zur Universität die einer wissenschaftlichen Beschäftigung. Auch diesem Muster folgt der jüngere Bruder vier Jahre später.
Die unliterarische Stadt
Wie wird man in einer Stadt wie Lübeck zum Schriftsteller? Diese Frage stellt sich unweigerlich, wenn man auf die Karriere der Brüder Mann blickt. Erst einmal war da wenig Anregendes. Heinrich Mann hatte in seinem frühen Text Lübeck explizit als eine unliterarische Stadt geschildert. Es gab freilich eine Ausnahme, es gab Emanuel Geibel!
Geibel war zum Zeitpunkt seines Todes einer der bekanntesten und berühmtesten Dichter des 19. Jahrhunderts. Die Lübecker Zeitung räumte dem Artikel anlässlich seines Todes im Jahr 1884 die gesamte erste Seite ein. Im Nachruf heißt es unter anderem: »Emanuel Geibel ist todt, und dennoch lebt er unter uns; er lebt durch seine Lieder im Volke, er lebt durch seine Werke und wird unsterblich sein, so lange überhaupt noch ein Deutscher seine Sprache und seine Dichter kennt.«[1]
Das ist keine lokalpatriotische Übertreibung, sondern Tenor einer Unzahl von Gedenkartikeln im deutschen Blätterwald jener Tage. Die Rede ist vom Dichterfürsten, dem großen Liederdichter der Deutschen. Die Kaiserin, Bismarck und viele deutsche Fürsten kondolierten dem Lübecker Bürgermeister. Das Begräbnis am 13. August in der Marienkirche glich einem Staatsbegräbnis, und schon wenige Jahre später, 1889, wurde das Geibel-Denkmal auf dem gleichnamigen Platz errichtet.
3 Enthüllung des Geibel-Denkmals am 18.10.1889
Die 100. Auflage seiner Gedichte wurde dem Toten mit ins Grab gegeben, eine Auflagenzahl, die ihm eine singuläre Stellung in der Literatur des 19. Jahrhunderts verschaffte. Man kannte und sang seine Lieder im ganzen deutschen Sprachraum. 1912 verzeichnete der Börsenverein des deutschen Buchhandels 3679 Liedvertonungen von 288 Geibel-Gedichten. Damit schlug er Goethe um Längen. Heute ist er einer der vergessenen Dichter. Zu Zeiten der Brüder Mann war er aber ein literarischer Starautor, der zudem in Lübeck lebte. Damit war in einem eingeschränkten Sinne doch etwas Literatur nach Lübeck gekommen. Und zwar auf eine sehr dramatische und politische Art und Weise.
Bis 1868 lebte Geibel hauptsächlich in München. Als der preußische König Wilhelm am 13. September Lübeck besuchte, wurde ihm ein Huldigungsgedicht Geibels überreicht. Es endete mit den Worten:
Drum Heil mit dir und deinem Throne!
Und flicht als grünes Eichenblatt
In deine Gold- und Lorbeerkrone
Den Segensgruß der alten Stadt.
Und sei’s als letzter Wunsch gesprochen,
Daß noch dereinst die Aug’ es sieht,
Wie über’s Reich ununterbrochen
Vom Fels zum Meer dein Adler zieht.[2]
Der preußische Adler als einigendes Band einer deutschen Nation, von Norden bis in den Süden, vom Meer bis zu den Bergen, das stieß in München auf radikale Ablehnung. Im Oktober wurden alle königlichen Zahlungen eingestellt. Geibel kehrte nach Lübeck zurück, nicht ohne dem neuen bayerischen König vorher einen Brief zu schreiben, in dem er alle seine Ämter niederlegte und betonte, dass er die Einigung des Vaterlandes schon immer angestrebt habe und dass dies für ihn seit dem Preußisch-Österreichischen Krieg nur unter preußischer Führung geschehen könne.
Kaum nach Lübeck zurückgekehrt, erfuhr Geibel, dass ihm der preußische König ein Gnadengehalt von weiteren 1000 Talern bewilligt habe. Sein Ruhm wuchs, vor allem nach der Reichseinigung von 1871, als Wirklichkeit wurde, was er in seinen politischen Gedichten immer wieder gefordert hatte: das Entstehen eines einheitlichen deutschen Staates mit einem Kaiser an der Spitze. Geibel hat das in der Gedichtsammlung Heroldsrufe (1871) in Verse gefasst. Er wurde Lübecker Ehrenbürger und lebte als allseits geachtete Berühmtheit an der Trave. Am 6. April 1884 starb er in Lübeck.
Das alles, so muss man sich in Erinnerung rufen, spielte sich zur Jugendzeit der Brüder Mann in Lübeck ab. Die beiden wussten um eine Kontinuität, die wir heute vergessen haben: Sie erlebten in Lübeck mit Geibel einen nationalen deutschen Dichter, und das hat sie zweifelsohne beeinflusst. Man hatte ihnen sicher von ihm erzählt, man begegnete sich, und er hat mit den Senatorensöhnen auch gesprochen.
So gesehen macht man es sich mit der Formel von der unliterarischen Stadt etwas zu einfach. Auch wenn es kein breites literarisches Leben gab, so gab es mit Geibel einen repräsentativen Nationaldichter! Daran knüpften die Brüder Mann an. Und auch hier zeigte sich wieder eine Ähnlichkeit in der Verschiedenheit.
Thomas Manns berühmteste Äußerung dazu stammt aus seiner Rede Lübeck als geistige Lebensform, 1927 im Lübecker Theater gehalten. Er spricht darin über die Schwierigkeiten der Lübecker mit ihm. »Sie waren an anderes gewöhnt. Sie hatten ein Repräsentanten-Denkmal auf dem Platze hier in der Nähe (in Lübeck ist ja alles ›in der Nähe‹): den thronenden Poeten, zu dessen Füßen der klassizistische Genius mit der gebrochenen Schwinge lehnt, das Standbild dessen, der gesungen hatte: / ›Wie steigst, o Lübeck, du herauf / In alter Pracht vor meinen Sinnen / An des beflaggten Stromes Lauf usw.‹ – gesungen, sage ich, in dem pompösen Sinn, in dem heute niemand mehr singt. Ich habe Emanuel von Geibel als Kind noch gesehen, in Travemünde, mit seinem weißen Knebelbart und seinem Plaid über der Schulter, und bin von ihm um meiner Eltern willen sogar freundlich angeredet worden. Als er gestorben war, erzählte man sich, eine alte Frau auf der Straße habe gefragt: ›Wer kriegt nu de Stell? Wer ward nu Dichter?‹ – Nun meine geehrten Zuhörer, niemand hat ›de Stell‹ bekommen, ›de Stell‹ war mit ihrem Inhaber und seiner alabasternen Form dahingegangen, der Laureatus mit dem klassisch-romantischen ›Saitenspiel‹ konnte keinen Nachfolger haben, das erlaubte die Zeit, die fortschreitende, sich wandelnde Zeit nicht, und was sich nunmehr als literarischer Ausdruck lübeckischen Wesens auszugeben wagte, das war als solcher zunächst wahrhaftig nicht wiederzuerkennen.«[3]
Das ist die klare Anerkennung der Repräsentativität Geibels. Thomas Mann wusste, dass er für einen großen Teil des bürgerlichen Publikums im 19. Jahrhundert sprach. Diese Stelle des Dichters war mit Geibel dahingegangen. Sie war damit auch frei geworden. Diese Botschaft hatte Thomas Mann klar verstanden. Das war eine mächtige Stelle, und er hatte ein Ziel: sie einzunehmen!
Allerdings mit einer anderen Rolle als Schriftsteller und einer anderen literarischen Ausrichtung. Er wusste genau, dass ein Schreiben wie bei Geibel nicht mehr möglich war. In dem Wort »alabastern« zum Beispiel ist eine sehr kluge Kritik an Geibel enthalten, die Thomas Mann einige Jahre zuvor, in einem Aufsatz über Theodor Storm, formuliert hatte. Storm ist für Thomas Mann der Titan, einer der wenigen in der Zeit zwischen Goethes Tod 1832 und dem Aufkommen des Naturalismus und dem späten Erfolg Fontanes am Ende des Jahrhunderts. Storm gegenübergestellt wird als unterste literarische Kategorie das »schlaff Bürgerliche«, ihr folgen »spätromantische[r] Dilettantismus« und »hochbegabte[s] Epigonentum«, als dessen herausragende Vertreter Geibel und dessen Freund und Zögling, der spätere Nobelpreisträger Paul Heyse, genannt werden.[4]
Geibel als hochbegabter Epigone – damit war eine Spur gelegt, die bis heute Wirkung zeigt. Der epigonale Dichter, das ist jemand, der sein Handwerk ganz herausragend beherrscht, der eine ausgewiesene Kenntnis der literarischen Tradition hat, der aber nicht in der Lage ist, das Überraschende, Neue, die Zeit Überragende zu schaffen. Thomas Mann schafft damit zweierlei: Er tritt in Geibels Fußstapfen als Nationaldichter und erledigt ihn dabei als Dichter von Relevanz für die Gegenwart. Mit Geibels politischer Haltung, die ihn erst nach 1871 zum Nationaldichter gemacht hatte, setzt er sich nicht auseinander.
Genau das aber macht Heinrich Mann. In seiner Jugend ist er ein glühender Verehrer Geibels gewesen. Er hatte seine ersten Schreibversuche ausdrücklich auch an der Lyrik und Dramatik des Lübecker Dichters ausgerichtet. An den Freund Ewers, schreibt er nach Lübeck: »Wozu ist der Dichter eigentlich da? Ich sehe hier von Natur und Liebe, den Stoffen, welche allen Zeiten selbstverständlich eigen sind, ab und gelange zu der Antwort: Der Dichter soll unter allen Umständen der Herold seiner Zeit sein. Das können wir beide uns am besten an unsern Lieblingsdichtern, Heine und Geibel, klarmachen. Wer Heine gründlich studiert hat, der kennt jene ganze Zeit mit all ihrem jauchzenden Freiheitsenthusiasmus und all ihrer bitteren, ›arretierten‹ Verzweiflung. Und wer Geibels ›Heroldsrufe‹ und übrige Zeitgedichte gelesen, der ist eingeweiht in jene ganze Periode voll erwartungsvoller Sehnsucht nach einem neuen deutschen Kaiserreich.«[5]
Das ist ein anderer Geibel, den Heinrich Mann in den Blick nimmt. Der politische Lyriker, der von 1840 an für einen deutschen Nationalstaat im konservativen Sinne gelebt und geschrieben hatte. Damit ist er eine repräsentative Figur im 19. Jahrhundert, und der junge Heinrich Mann erkannte auch ganz klar den Gegenspieler: Heinrich Heine. Beide zusammen, so seine Botschaft, machen für die Nachgeborenen die literarisch-politische Signatur des 19. Jahrhunderts erfahrbar.
Es ist auch hier wieder die frühere Erkenntnis, die Heinrich Mann von seinem Bruder unterscheidet. Auch für Thomas war Heinrich Heine schon in Lübeck ein zentraler Baustein seiner literarischen und intellektuellen Sozialisation. Heinrich Heine, der Gute ist ein zweiter Text in der Schülerzeitung betitelt, und er will darauf hinaus, Heinrich Heine nicht unter moralischen und politischen Aspekten als einen guten Menschen zu bezeichnen, sondern einzig unter ästhetischen Aspekten als einen »großen«. Diese und ähnliche Äußerungen definieren bei Thomas Mann schon in der frühesten Zeit eine bestimmte Mentalität. Wenn er sich später in die Rolle des politischen Repräsentanten findet, heißt das nicht, dass er die Rolle des Außenseiters aufgibt. Bruchstücke dieser Haltung bewahrt er bis an sein Lebensende. Thomas Mann nimmt sich immer wieder die Freiheit, sich zu äußern, ohne dabei an die praktisch-politischen Konsequenzen zu denken. Die Rolle des »Praeceptor Germaniae«, die ihm in guter, aber auch in kritischer Absicht zugesprochen worden ist, sie ist nur die eine Seite. Sie muss sich immer gegen das Unbürgerliche, gegen das nach Verantwortungslosigkeit sich sehnende Künstlerische durchsetzen. Der ästhetische Blick auf die Politik bleibt stets latent vorhanden und zeigt sich weiterhin, mal stärker, mal schwächer.
Das wiederum ist auch bei Heinrich Mann so. Politik und Literatur, wir sahen das bei seiner Geibel-Rezeption, denkt er immer zusammen. Und noch am Ende seine Lebens beklagt er sich in einem Brief gegenüber seinem Freund Karl Lemke darüber, dass er auf den politischen Autor reduziert worden ist: »Indessen, einmal von einem Publikum festgelegt als ›politischer‹ Romancier, blieben Schönheiten meist unbeachtet […]; ich bin nur falsch entdeckt. Als Verfasser eines romanhaften Leitartikels möchte ich nicht fortleben«.[6]
Familienbande
Wenn man auf die Anfänge in Lübeck schaut, dann muss auch von der Familie gesprochen werden. Beide Brüder akzeptierten auf der einen Seite ihre familiäre Herkunft. Unvergessen etwa die überlieferte Schilderung, dass Heinrich Mann in den Berliner Bars der 1920er Jahre, so unbürgerlich die Orte und das Publikum auch waren, immer perfekt gekleidet, im Zweireiher erschien. Ein deplatziert wirkender Großbürger aus Lübeck, der sich neugierig auf fremdem Terrain tummelte! Und die Prägung geht weiter. Noch 1945 in seinem großen Memoirenwerk Ein Zeitalter wird besichtigt ist es die Gestalt des Vaters, die aufgerufen wird. Ist es die Verschränkung von Privatem und Öffentlichem, die als das Wesentliche der eigenen Biographie angesehen wird, ist es die Verantwortung für das Persönliche und das Politische, ist es schließlich das Münden all dieser Tugenden in die literarische Arbeit. Heinrich Mann schreibt, und das gilt für Thomas Mann genauso wie für ihn: »Unser Vater arbeitete mit derselben Gewissenhaftigkeit für sein Haus wie für das öffentliche Wohl. Weder das eine noch das andere würde er dem Ungefähr überlassen haben. Wer erhält und fortsetzt, hat nichts anderes so sehr zu fürchten wie das Ungefähr. Um aber erst zu gestalten, was dauern soll, muß einer pünktlich und genau sein. Es gibt kein Genie außerhalb der Geschäftsstunden.«[1]
Die Vorstellung, der Dichter habe sich nur in ein Café zu setzen, mit einem Stift und Papier, und dann flössen ihm die poetischen Gedanken nur so zu, wird als falsche entlarvt. Literatur ist Arbeit! Das wussten und lebten beide Brüder. Und dieses Arbeitsethos stammt aus Lübeck. Beide Brüder haben dann auch mit größtmöglicher Konsequenz immer feste Arbeitszeiten eingehalten. Das erinnerte an die Kontorstunden, die sie beim Vater in Lübeck wahrgenommen hatten. So waren der Familie etwa die drei Arbeitsstunden Thomas Manns heilig. Es hatte absolute Ruhe im Haus zu herrschen, und niemand durfte ihn stören. Wie weit das ging, wurde 1914 deutlich, als man nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Bad Tölzer Sommerhaus so lange mit der Nachricht wartete, bis es 12 Uhr war und Thomas Mann gestört werden durfte. Was war schon der Ausbruch eines Krieges gegen das gerade entstehende Werk des Ehemanns und Vaters! Diese gespenstisch anmutende Szene zeigt, wie die Lübecker Prägungen weit hinein in die Familie Thomas Manns reichten.
Aber da war natürlich auch die Kritik an dieser Lebensform. Heinrich Mann hat darüber berichtet, dass man seinen »Eigensinn«[2] immer wieder kritisiert habe. Bei Thomas Mann war das sicher nicht so aggressiv ausgeprägt wie beim Bruder. Er behielt seine Kritik für sich und sublimierte sie in Literatur. Ihn zeichnete ein Nicht-Mittun und kein radikales Dagegensein aus.
Beide Brüder kamen für die Firmennachfolge nicht in Frage. Das war in Lübeck etwas Besonderes und für den Vater sicher nicht leicht zu akzeptieren. Thomas Mann berichtet von den Versuchen des Vaters, ihn bei den Gängen zu den Speichern und Schiffen der Firma Mann für den Beruf zu begeistern, und dem kläglichen Scheitern, weil der Sohn so gar kein Interesse dafür aufbringen wollte.
Bei Heinrich war es ähnlich, und als der Ältere verließ er Lübeck früher als der jüngere Bruder. Die Buchhandelslehre in Dresden, zu der er 1889 die Stadt verließ, war der Kompromiss zwischen Literatur und Geschäft, auf den sich der Vater eingelassen hatte. Es war ein zum Scheitern bestimmter Versuch, da dem Sohn die merkantilen Seiten des Geschäfts ziemlich gleichgültig waren und es zu entsprechendem Ärger mit dem Lehrherrn kam. Der Vater kam aber noch 1890, kurz vor seinem Tod, nach Dresden, um die Angelegenheit zu lösen, so dass Heinrich ein Volontariat bei S. Fischer in Berlin beginnen konnte. Für Heinrich Mann war das ein neues Stück Freiheit und der Beginn seiner Schriftstellerkarriere.
Im Unterschied zum Vater stand die Mutter, das haben beide Brüder immer wieder betont, für das Musische ihrer Erziehung. Musik und Vorlesen, das war ein Privileg der Mutter. Aber was sich auf den ersten Blick wie ein harmonisch-gewöhnliches Mutterbild ausnimmt, das zeigt auf den zweiten Blick eine Dimension der Fremde und Verstörung. Recht eigentlich nämlich blieb die Mutter in Lübeck eine Fremde. Groß geworden in Brasilien, kam sie als Sechsjährige mit ihrem Vater Johann Ludwig Bruhns nach Lübeck. Der Vater fand sich in der alten Heimat nicht mehr zurecht und kehrte zurück nach Brasilien. Die Tochter ließ er alleine zurück in Lübeck, wo sie bei Verwandten wohnte und zur Schule ging. Sehr jung, mit 17 Jahren, heiratete sie dann den Vater der Brüder Mann. Man mag sich vorstellen, wie dieser Lebensbruch die Mutter geprägt hat. Es muss ein Kulturschock für das kleine Mädchen gewesen sein, aus dem katholisch-sonnigen Brasilien in das kalte und protestantische Lübeck zu kommen und dort zu leben. Den ersten Schnee, so hat sie selbst berichtet, hat sie für vom Himmel gefallenen Zucker gehalten. Zeit ihres Lebens hatte sie ihre Probleme damit, sich in die lübeckischen, die deutschen Verhältnisse einzufügen. Sie blieb die Besondere und Fremde in dieser Familie. Die Brüder haben das beide in ihrer Literatur aufgenommen. Thomas Mann, indem er Gerda Buddenbrook als eine Fremde in Lübeck schildert, die zwar »nur« aus Amsterdam in die Familie einheiratet, aber von einer Kälte und Distanz zu den Lübecker Verhältnissen bestimmt ist. Zwischen den Rassen ist nicht zufällig Heinrich Manns Roman von 1907 betitelt, der viel von der Geschichte der Mutter verarbeitet.
Es ist viel darüber spekuliert worden, wie Mutter und Vater die Brüder geprägt haben. Vom Gegensatz zwischen dem südlichen Naturell der Mutter und dem nördlichen Einfluss des Vaters ist gesprochen worden. Solche Gegensätze verdecken aber mehr, als sie wirklich zu verstehen helfen. Richtig ist: Die Mutter war ein »Störfaktor« in der Lübecker Welt, in der die Brüder Mann groß wurden. Die Familie Mann war in Lübeck etwas Besonderes und »Anderes«, und es mag sein, dass dies einer der Gründe dafür war, dass in dieser unliterarischen Kaufmannsstadt zwei Jungen groß wurden, die von Beginn an nichts anderes vorhatten, als Schriftsteller zu werden, und diesen Plan mit größtmöglicher Radikalität und Intensität umgesetzt haben. Dass beide ihr Leben schon früh auf die Literatur ausgerichtet haben, daran hat die Erziehung der Mutter sicher ihren großen Anteil.
4 Heinrich und Thomas Mann mit ihrer Mutter und der Schwester Julia, um 1879
Und noch etwas kommt hinzu: Es greift zu kurz, wenn man bei den Brüdern Mann nur die Lübecker Perspektive einnimmt. Die Rolle als deutscher Nationalschriftsteller, auf die Thomas Mann später so stolz war, und die Rolle als europäischer Intellektueller, die Heinrich Mann für sich reklamierte, waren nie das Ganze. Über die Mutter gelangte in der prägenden frühkindlichen Phase eine außereuropäische Mentalität in ihr Denken und Fühlen. Dies wird besonders deutlich, wenn man sich die unter dem Titel Erinnerungen aus Dodos Kindheit überlieferten autobiographischen Texte der Mutter anschaut. Man geht sicher zu weit, wenn man ihre Schilderung des Lebens in Brasilien als postkoloniale Literatur bezeichnet, aber fraglos wird darin eine außereuropäische Perspektive sichtbar, die in Lübeck fremd und einzigartig war. Ganz sicher hat die Mutter den Söhnen diese Perspektive mündlich überliefert. Und hinzu kommt noch etwas: Lübeck war zwar am Ende des 19. Jahrhunderts eine altehrwürdige, etwas zurückgebliebene Stadt, zugleich war es aber auch eine Stadt, die nach wie vor in einem weitgespannten und immer noch wirkungsvollen Netzwerk mit der Welt verbunden war. Die vielen Konsulate und sogar Botschaften, die Lübeck noch bis ins 20. Jahrhundert in aller Welt unterhielt, sprechen davon eine eindeutige Sprache. Man war über den Handel intensiv mit der Welt, auch der außereuropäischen, verbunden.
Die unterschiedliche Haltung der Brüder zur Herkunft und zu Lübeck nimmt das Testament des Vaters auf. In gewisser Weise stellt es das »Urmuster« für das Bruderverhältnis dar: Der Bohemien Heinrich steht da gegen den guten Thomas. Der genialisch verbummelte und der arbeitsame Bürger werden kontrastiv beschrieben. Der Vater trug den Vormündern seiner minderjährigen Kinder Folgendes auf:
»Soweit sie es können, ist den Neigungen meines ältesten Sohnes [Heinrich Mann] zu einer s.g. literarischen Thätigkeit entgegenzutreten. Zu gründlicher, erfolgreicher Thätigkeit in dieser Richtung fehlen ihm m.E. die Vorbedingnisse; genügendes Studium und umfassende Kenntnisse. Der Hintergrund seiner Neigungen ist träumerisches Sichgehenlassen und Rücksichtslosigkeit gegen andere, vielleicht aus Mangel am Nachdenken.
Mein zweiter Sohn [Thomas Mann] ist ruhigen Vorstellungen zugänglich, er hat ein gutes Gemüth und wird sich in einen praktischen Beruf hineinfinden. Von ihm darf ich erwarten, daß er seiner Mutter eine Stütze sein wird.«[3]
Diese Stelle ist in der vergleichenden Brüderforschung sehr oft zitiert worden. Zu Recht, denn sie entwirft aus der wissenden Sicht des Vaters ein Bild der Brüder, das einen bedeutenden Unterschied klar in den Blick nimmt. Auf der einen Seite Heinrich Mann, der für viele Zeitgenossen (und auch für den Bruder) zeitlebens ein wirklichkeitsreiner Träumer blieb, der seinen Phantasien und Idealen nachhing und sich um ihre Verwirklichung in der Realität wenig kümmerte. Auf der anderen Seite Thomas Mann, der viel stärker an den bürgerlichen Verhältnissen und Umständen orientiert war als sein Bruder Heinrich. Man hat das bisher immer als partielles Fehlurteil des Vaters interpretiert, der zwar einen Gegensatz richtig gesehen, aber gerade bei seinem zweiten Sohn Thomas im Hinblick auf die bürgerliche Musterkarriere einer grandiosen Fehleinschätzung aufgesessen sei.
Und das stimmte ja auch: Die Firma Mann wurde abgewickelt, weil auch Thomas Mann an der bürgerlichen Kaufmannskarriere kein Interesse hatte. Und in einem praktischen Beruf – der Vater spricht ausdrücklich davon, dass es nicht um die Übernahme der Firma geht – sah sich Thomas Mann ebensowenig wie sein Bruder.
Eine Doppelbiographie
Folgt man dem väterlichen Testament, dann war Heinrich Mann der dem Fortschritt verfallene, der modernere und radikalere Autor. Ein Bohemien, der immer wieder weg von der Wirklichkeit ins Phantastische abdriftet, der aber gleichzeitig früh gegen die konservativen Tendenzen im Deutschen Reich agiert, der als einer der wenigen Intellektuellen von Rang das Augusterlebnis von 1914 als Schwindel durchschaut und sich gegen alle Legitimationen des Krieges als Kulturkrieg, gegen den Krieg überhaupt positioniert. Heinrich Mann wendet sich daher gegen Deutschland und tritt für Italien und Frankreich und früh schon für eine kosmopolitische Weltsicht ein. Heinrich Mann, so das allgemeine Bild, ist ein früher Verfechter der modernen Literatur, von dem ein Benn, ein Döblin und nicht zuletzt die Expressionisten Entscheidendes gelernt haben. Sein Leben ist gegen die Konventionen gerichtet, das Bürgerliche ist ihm eine zwanghafte Lebensform. Er ist gegen die bürgerliche Ehe und kennt bis 1914 keinen festen Wohnsitz.
Thomas Mann hingegen ist so verstanden ein Kind des Obrigkeitsstaates, den Politik überhaupt nicht interessiert. Er hat eine tiefe und unauflösliche Beziehung zur deutschen Kultur. Im Ersten Weltkrieg macht sich das in einer rückhaltlosen Bejahung des Krieges deutlich. Niemand lernt von ihm. Er steht gleichsam als ein Solitär im literarischen Feld um 1900. Bürgerlichkeit ist sein Lebenselixier, Frau, Kinder und Haus sind die schnell verwirklichten Ordnungsmuster, die ihm den sicheren Schreibgrund verbürgen.
Dass dies eine sehr einseitige Sicht ist, die neben viel Richtigem auch viel Falsches enthält, ist einer der zentralen Gründe für dieses Buch. Dabei wird das Leben und Schreiben Heinrich Manns auch als ein Kommentar verstanden. Als ein Kommentar, der Thomas Mann zeitlebens daran erinnert, wie man auch leben und schreiben konnte. Mehr noch: wie er vielleicht auch hätte schreiben und leben können. Dies erklärt, warum Heinrich, der andere, so wichtig bleibt, trotz allem Erfolg, trotz aller Niederlagen im Alter und Exil. Und das gilt natürlich auch umgekehrt: Thomas Mann zeigte dem Bruder ein ganzes Leben lang, was aus den Lübecker Prägungen auch hervorgebracht werden konnte.
Das Verhältnis der Brüder Mann[1] ist bisher zu einseitig als Erfolgsgeschichte Thomas Manns verstanden worden. Die äußeren Fakten sprechen ohne Wenn und Aber für diese Lesart. Thomas Mann, der jüngere Bruder, ist bis heute der Erfolgreichere, und zwar sowohl bei den Spezialisten, den Literaturwissenschaftlern und schreibenden Kollegen, also auch beim Publikum. Er hat zudem den Nobelpreis erhalten und ist immer noch weltweit präsent. Er gilt als der bekannteste und herausragendste deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Einzig Kafka wird ihm gleichrangig an die Seite gestellt.
Alles das ist aber nur die äußere Sicht, die nicht in das Innere des Bruderverhältnisses führt. Man sollte sich von diesen Äußerlichkeiten nicht blenden lassen, sondern genau lesen. Dann wird nämlich deutlich, dass die scheinbar geklärten Rangfragen im Binnenverhältnis der Brüder Mann so gar nicht existierten. Im Inneren herrschte ein anderes Verhältnis, das bei allem Ruhm und aller Anerkennung Thomas Manns in der öffentlichen Wahrnehmung, über die sich beide Brüder klar waren, viel mehr Gleichberechtigung, viel mehr gegenseitige Achtung aufwies, als es bis heute den Anschein hat.
2. Schriftsteller werden – 1893 bis 1902
Heinrichs Kämpfe
Vier Jahre älter als der Bruder, war Heinrich Mann der Maßstab, an dem Thomas Mann sich orientierte, war er das Vorbild, das zeigte, wie man, aus Lübeck stammend, als Schriftsteller leben konnte. In einer Selbstbiographie von 1907 liest sich das ganz kurz und einfach. »Heinrich Mann, als Sohn des Senators Th. Joh. Heinrich Mann und seiner Frau Julia geb. Da Silva-Bruhns, am 27. März 1871 in Lübeck geboren, ging mit 22 Jahren nach Italien, lebt abwechselnd dort und in München, hat sich gleichmäßig an der Kultur der beiden Rassen entwickelt, die sein Blut vereinigt.«[1]
So einfach war es natürlich nicht. Heinrich Mann hatte es zuerst gesehen – durchaus auch in Stellvertretung für den jüngeren Bruder – und auch danach gehandelt. Was er aber gesehen hatte: Man war nicht so wie die anderen jungen Männer in Lübeck. Und er sah noch mehr: dass es genau diese Differenz war, die ihn zum Schriftsteller machte. Also setzte er bei seinem Vater durch, die Schule abbrechen zu dürfen und in eine Buchhandelslehre nach Dresden wechseln zu können. Das war ein Kampf, den er auch für den jüngeren Bruder führte und der von diesem sicher genau beobachtet wurde. Wir schreiben das Jahr 1889, Heinrich Mann ist 18 Jahre alt, als er diesen Kampf innerhalb der Familie führt. Das Ergebnis war ein Kompromiss, wie ihn der durchaus literarisch interessierte Vater mittragen konnte: Heinrich wechselte in die Welt der Bücher, die aber mit dem Geschäftlichen verbunden blieb. Und auch wenn Heinrich Mann gegenüber dem Freund Ludwig Ewers darüber klagt, dass das »Geldzählen, Bestellzettelschreiben und Büchersortieren« etwas »unglaublich Einschläferndes«[2] habe, so lässt ihm die Arbeit doch viel Zeit für eigene Lektüren und erste lyrische Versuche und Kritiken.
Er liest, wie später der Bruder, mit einer Maßlosigkeit, die nur auf den ersten Blick überrascht. Dieses »wilde Lesen«, das neben den Klassikern – Geibel, Heine, Storm, Fontane seien beispielhaft genannt – auch die deutsche und französische Gegenwartsliteratur umfasst und sich in der Philosophie (vor allem Schopenhauers und Nietzsches) verliert, ist die Suche nach Orientierung, nach einem ästhetischen Fundament, das in dieser Zeit auch ein Lebensfundament darstellt. Da steht vieles nebeneinander, was normalerweise nicht zusammengehört. »Ich lese alles mögliche, z.B. Bismarck und E.T.A. Hoffmann« – heißt es am 15.1.1893.[3] Und diese unklare Situation dauert an. Sie dauert etwa zehn Jahre, ehe ab 1900 mit Im Schlaraffenland bei Heinrich Mann und Buddenbrooks bei Thomas Mann die ersten relevanten Romane erscheinen. Durch das Erbe nach dem Tod des Vaters waren beide allerdings nicht auf einen Brotberuf angewiesen, sondern konnten sich, wenn auch nicht auf großem Fuße, ausprobieren. Einen Brotberuf haben beide daher auch nie ernsthaft in Betracht gezogen. Sie agierten damit beide in einem Raum, der von den gesellschaftlichen Problemen der Zeit weitestgehend abgeschottet war. Was all die Anfangsjahre vor allem zählte, war die Lektüre, die beide als ein Lernen an den großen Vorbildern sahen. Das muss betont werden, weil alles Spätere, vor allem das politische und gesellschaftliche Engagement, auf diesem literarischen Fundament aufsetzte.
Und noch etwas ist wichtig. Was immer wieder vergessen wird im Verhältnis der Brüder: Dass Thomas Mann Schriftsteller werden wollte, hing entscheidend mit dem Schreiben und auch dem Erfolg Heinrich Manns zusammen. Er zeigte dem jüngeren Bruder, dass man, aus Lübeck kommend und den normalen Karriereweg ausschlagend, dennoch Erfolg haben konnte.
Sexualität
Was aber war das Besondere? Was machte die beiden Brüder zu Außenseitern in Lübeck und auch darüber hinaus? Was war der Grund dafür, einen Lebensgrund außerhalb der bürgerlichen Arbeitswelt zu suchen?
Bisher hat man vor allem in den Blick genommen, dass beide nicht in die Fußstapfen des Vaters treten wollten. Kaufmann sein in Lübeck – das wollten beide nicht. Schriftsteller werden, das war von Beginn an ihr Ziel. So geht die Erzählung, und sie ist richtig und falsch zugleich.
Sie ist richtig, weil die äußeren Fakten dies belegen. Beide machten überhaupt keine Anstalten, weder in der Schule noch in der Ausbildung, sich in den üblichen Bahnen eines Lübecker Kaufmannssohnes zu bewegen. Beide fingen zudem früh mit dem Schreiben an und haben das konsequent bis an ihr Lebensende fortgesetzt.
Sie ist falsch, weil sie die entscheidende Frage nicht beantwortet. Diese muss aber gestellt werden, weil Sie dem Schreiben vorgeordnet ist, also in einem vorliterarischen Bereich liegt.
Fragt man so neu, dann ist es Heinrich Mann, der den Weg weist. Er wusste um das »Anderssein«, das eigene und das des Bruders. Und das hatte mit Literatur erst einmal gar nichts zu tun. Am Anfang der literarischen Karriere der Brüder Mann stand das Sexuelle, genauer: eine Sexualität, die nicht der bürgerlichen Norm um 1900 entsprach. An seinen Freund Ewers schreibt Heinrich Mann am 8.9.1891: »Ach, all die Pläne. Ich komme fürs erste zu nichts. Ich denke nur ruckweise, dann ist die Leitung